Gerhard Falkner: so beginnen am körper die tage und aufzeichnungen aus einem kalten vierteljahr
beiseitegelegt hast du schere und licht
wie wohl der abend deinen augen tut, hast
du in seiner hand die hand gelöscht, im blut
den docht gezeigt, den seine flamme aufgeschnappt
geschweigt, da er dich wie sein blatt gewendet
leichtes blatt, als ich mit meinem hut durch
diesen engen wind gegangen bin, bis obenhin
nur wunde diesem wind, sag, deine haut
hauchdünn, am kopf von meinem schlag zerrissen
hat er sie gebissen, tat es gut, – die haut
hat sie den den schall gespürt, riß es da neues blut
ans licht, sein stürzendes besteck, befleckt
wie silber schwitzt, hat es geblitzt und dir
das licht zerdrückt: das licht
Die hier wiederveröffentlichten Aufzeichnungen
(aus einem kalten Vierteljahr) sind Teile aus den 1976 und 1977 in den Nürnberger Blättern für Literatur gedruckten Fragmenten und Tagebuchnotizen. Ihre Eintragungszeit überschneidet sich mit den etwa sechs Jahren, in denen ich an so beginnen am körper die tage gearbeitet habe. Mit wenigen Ausnahmen habe ich darauf verzichtet, spätere Texte aufzunehmen, weil ich die Zusammengehörigkeit im Geisteszustand nicht verschieben wollte. Mit bleibt nichts anderes übrig, als mich mit dem, was inzwischen zu einer Abweichung von meinem Geschmack geworden ist, abzufinden.
Geschrieben wurden diese kleinen Destillate, um mich zu erfrischen, abzuduschen, um mich von der Selbstgefährdung, in die auskultierende Lyrik führt, zu reinigen. Es waren Melancholiehemmer, kleine, selbstgeschriebene Tabletten gegen die Schwindsucht von Kompression und poetischer Selbsterpressung.
Wie schon verschiedene Leute bemerkt haben, halte ich die Auffassung, daß Literatur nach ihrer unmittelbaren Brauchbarkeit einzuwerten ist, für falsch und eitel. Die Warenscheinlichkeit unserer Gesellschaft und die Verschleierung der Herrschaft ist zu infam, als daß sie sich in einem Spot auf Supermärkte „erkenntlich“ zeigen würde. Im kritischen Detail versagen wir alle, weil dieses in seinen rasanten Chromosom-Kombinationen und zerfallenden Bedeutungen flüchtig ist und stürzend immer wieder in eine Bewegung eingreift, die finitiv falsch ist.
Jede Kunst, die meint, es genüge, abzubilden oder zu wiederholen, was oben auf der Hand liegt, übersieht neben ihrer ostentativen Belanglosigkeit auch ihr affirmatives Agens. Die „ungekünstelte“ Sprache ist eine beherrschte Sprache.
Gerhard Falkner, Vorwort zu Aus einem kalten Vierteljahr, 1984
Ich könnte immer nur zitieren
Besser läßt sich nicht loben. Ich merke seinen Gedichten die Lust an der Arbeit mit Sprache an, und sie geben diese Lust weiter an mich als Leser. Freunden von Verständigungs- und Erbauungslyrik ist von diesem Buch abzuraten, mit Falkners eigenen Worten:
Ich gebe ja zu, daß mir nichts daran liegt, eine Idee bis ans bittere Ende ihrer allgemeinen Nachvollziehbarkeit zu führen. Jedem Bedenken kann ich nur entgegensetzen, daß es mir eh nicht um Richtigkeiten, sondern nur um Möglichkeiten geht.
tip Berlin
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinz Neidel: Durch vereiste Scheiben sehen
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 18.10.1981
Harald Hartung: Der schöne Widerstand des Gedichts. Lyrik von Marie-Luise Könneker und Gerhard Falkner
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.12.1981
Gerd Herholz: „meine zunge spielt verrückt mit meiner muttersprache“. Über den Lyriker Gerhard Falkner
Deutsche Volkszeitung / die tat, 5.10.1984
so begannen am körper die tage
Beim Erscheinen von so beginnen am körper die tage 1981 hat es so viel Sturm im Wasserglas des Literaturbetriebs gegeben wie erst knapp zehn Jahre später wieder bei Durs Grünbeins Grauzone morgens, ja sogar eigentlich erst bei dessen zweitem Band Schädelbasislektion.
Während Grauzone morgens, ein Titel, der wie eine Paraphrasierung von so beginnen am körper die tage klingt, von der Kritik sofort wie Butter durchdrungen wurde, spaltete mein Band die kümmerliche Schar der Lyrik-Beobachter in Begeisterte und Verständnislose, in Bewunderer und Feinde.
Und während Grünbein in bekannter „Geistesgegenwärtigkeit“ sofort mit allen Mitteln in die Öffentlichkeit drängte, ignorierte ich sie nicht nur, sondern mied sie wie die Pest.
Nach heutigen Gesichtspunkten darf das ruhig als ein Mangel an Intelligenz aufgefaßt werden.
Grund für meine Haltung damals war aber nicht Größenwahn, sondern ein so gut wie nicht entwickeltes Realitätsprinzip und ein narzißtisches Abstandspathos, entstanden aus einer geistigen Sozialisation, die in der Ablehnung durch die Masse die dialektische Bewährungsprobe des Außergewöhnlichen sah. Der Beifall der Vielen galt als Garantie, daß es sich weder um etwas Neues noch um etwas wirklich Herausragendes handeln konnte, denn das Neue und das Herausragende kann nie auf Sichthöhe und in der Jetztzeitigkeit mit Zeitgenossen sich ereignen, sondern braucht etwa ein Jahrzehnt der ästhetischen Adjustierung.
Für mein Denken von Bedeutung und innerlich nahe waren mir asketisch-artistische Konzepte mit radikaler psychologischer Auflösung, wie ich sie bei Augustinus und Nietzsche gefunden hatte, und die romantischen Setzungen des Sublimen und des Absoluten. Ein Gepäck, mit dem man heute höchstens auf der akademischen Halde landet oder auf dem Sozialamt.
Ich muß dies und noch einiges andere vorausschicken, um darstellen zu können, was mir mein erster Band heute bedeutet, geht es mir doch nicht darum, einzelnen Gedichten ihren Bestand zu bestätigen und andere zu verwerfen, sondern mein gesamtkörperliches Betriebssystem zu verstehen, welches zum damaligen Zeitpunkt, Anfang der 80er Jahre, ein solches Buch hervorgebracht hat.
Eines der größten Probleme heute, das die Problemträger möglicherweise gar nicht mehr erkennen können, weil dieses Problem ihre Lebensplattform geworden ist, sehe ich darin, daß der Ehrgeiz, fast möchte ich sagen, die Geilheit, gar nicht mehr in erster Linie auf das Gedicht gerichtet ist, sondern dem aberwitzigen Bedürfnis gilt, via Lyrik bekannt oder sogar berühmt zu werden und zu diesem Häuflein sprachlich vermurkster Gedichtwarenvertreter zu gehören, zu diesen Berühmten, die keiner kennt, keiner liest, keiner mag und keiner braucht.
Das Gedicht selbst ist nicht mehr das große Ziel. Nicht das vollendet gerundete Geschoß ins Zentrum der Seinsgenauigkeit wird gesucht, sondern der Erfolg. Manchmal ist das so absurd, als würden sich Hochbegabte darum reißen, in die Sonderschule zu kommen.
Das Gedicht ist das Ergebnis der Bemühung von Bemühten, einer Bemühung, die erbracht werden muß, um Erfolg zu haben, und hat man erst Erfolg, muß man diesen Erfolg immer weiter füttern, und dann schreibt man nicht mehr, weil man schreiben muß, sondern man schreibt, weil man schreiben muß, nur anders betont.
Als ich so beginnen am körper die tage schrieb, hatte ich weder die Befürchtung noch die Absicht, eine komische Figur des Literaturbetriebs zu werden.
Die Frage, ob ich mit den Gedichten Erfolg haben würde, beschäftigte mich nicht eine Sekunde.
Sie zu schreiben, entsprang eher der unbestimmten Gier, auf einer sehr kurzen Strecke von ausgesuchten Worten einen Weltrekord aufzustellen.
Ich stand einfach unter Strom. Dieser Strom allein leitete die Gedichte. Nicht Karriere stand mir vor Augen, ich hasse Karriere, ich hasse Krabbeln, sondern die Katastrophe des Körpers beim Dichten, die ihn zwingt, Gestalt anzunehmen.
Die Gedichte folgten nicht den Suggestionen des Zeitgeists, ich gehörte keiner Gruppe an, las meine Gedichte nirgends vor und schickte sie nirgends hin, ging nie auf Lesungen, hatte keine Freunde, die schrieben, und las keine Literaturzeitschriften.
Sie überfielen mich wie Schweißausbrüche oder überkamen mich wie Hungergefühle, sie gründeten nicht auf Ehrgeiz, sondern auf Erregung.
Wie es keinem Rüden je einfallen würde, eine Hündin zu besteigen, die nicht läufig ist, wäre es mir nie eingefallen, ein Gedicht zu schreiben, dessen Imago sich mir nicht brünstig genähert hätte.
Wenn ich so beginnen am körper die tage heute lese, fällt mir auf, wie einfach die Gedichte sind. Völlig unbegreiflich, was es damals so schwer gemacht haben soll, sie zu verstehen.
Ein bekannter (Prosa-)Autor sagte mir, nachdem er das Buch gelesen hatte:
Ich kann nicht mehr so schreiben, aber ich kann noch so lesen.
Weiß der Himmel, was er damit gemeint hat. Wahrscheinlich war es der übliche Trick, junge Autoren mit nebulösen Komplimenten in die Gefolgschaftsfalle zu locken.
Was ich immer noch bewundere, ist die Schlackenlosigkeit vieler Gedichte. Die war bereits bei meinem zweiten Band von mir nicht mehr erreicht worden und hat sich erst am Horizont von wemut wieder gezeigt.
Was für mich aber entscheidender ist, und ich habe das sehr deutlich gespürt, als ich diese Gedichte geschrieben habe, sie sind echt. Sie sind tatsächlich das Harz, das mein Körper abgesondert hat, eine Ausscheidung, eine Sprachausscheidung. Die Worte wurden und werden noch immer von meiner Spucke zusammengehalten. Eine DNS-Analyse kann das belegen.
Nahezu alles jedoch, was geschrieben und veröffentlicht wird, ist Literaturimitation. Fast alles, was Menschen als Literatur lesen, ist Literaturimitation. Mit etwas Vaseline taugt sie für jede Karriere.
Literaturimitation verstört und empört nicht, sie spielt mit dem Vertrauten, sie klingt wie das allerneueste für alle diejenigen, die das allerneueste erst wahrnehmen, wenn alle es wahrnehmen, also dann, wenn es das allerneueste keineswegs mehr ist, sondern zehn Jahre Zeit gebraucht hat, um durch die Schädeldecke zu sickern.
so beginnen am körper die tage, so ist immer wieder bemerkt und geschrieben worden, und der Titel legt dies ja auch nahe, ist von einer starken Körperlichkeit beziehungsweise Körperhaftigkeit der Sprache gekennzeichnet – ich sehe darin nichts Besonderes.
Der Hund bellt, der Vogel pfeift, der menschliche Körper spricht, spricht er vollendet, dann ist es Poesie, ist es wahre Poesie, dann handelt sie vom Körper.
Was ich allerdings sehe, und das sehe ich erst heute, ist ein Vexierspiel von Indiskretion und Intimität, das ich per Osmose als ein Anliegen der Zeit aufgenommen haben muß.
Während vor meinen Augen die Intimität auf breiter Front unter dem Ansturm einer beispiellosen, radikal-vulgären Totalkommunikation zerschlagen wird (Anfang der 80er begann die große Mobilmachung der neuen Kommunikationssysteme), vollziehen die Gedichte in so beginnen am körper die tage immer wieder Bewegungen der Enthüllung, der Selbstentblößung, hinter denen sich ein symbolisches Opfer für den Erhalt von Intimität und Diskretion ausmachen läßt.
Fast als wollten die Gedichte eine poetische Superintimität mit einem irrelevanten Spielraum der Preisgabe errichten.
Ich muß zugeben, ich beneide mich heute um diesen Zustand.
Gerhard Falkner, 2005; in Gerhard Falkner: Bekennerschreiben. Essays, Reden, Kommentare, Interviews und Polemiken, starfruit publications, 2017
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram +
Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001.


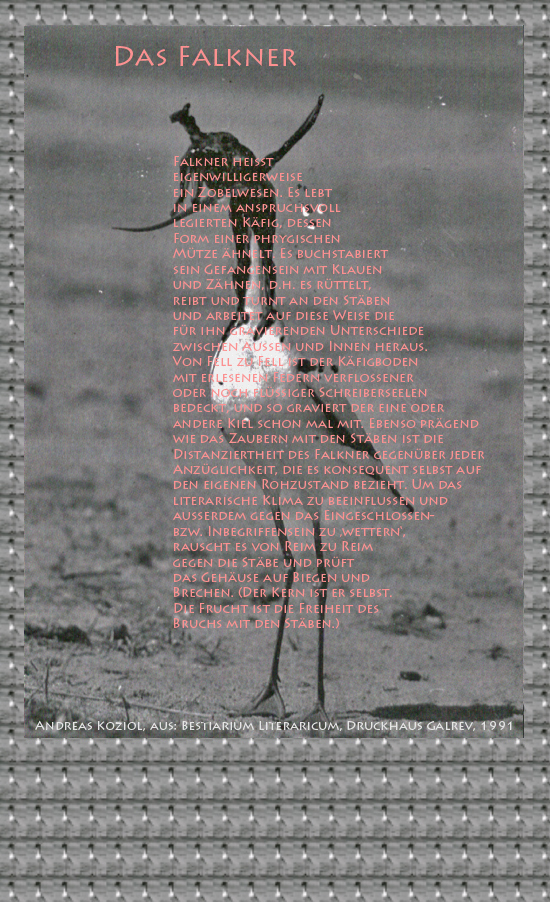












Schreibe einen Kommentar