Gerhard Falkner & Sylvère Lotringer (Hrsg.): AM LIT
FRAGEN DES WACHENS
Ich erwachte, wieder hatte ich von einer Konklave geträumt
in einem beengten Raum
während der Mond wie ein bedrängtes Herz an den
Horizont wankte. Welche Macht hat der Tod
über dies gelöste Atmen. Ein hohler Schrei
dringt aus dem Obstgarten, ein mühsames Einatmen
als ränge etwas um Luft. Dies ist die Last
der Träume. Jeden Morgen liegt zerschmettert
ein Tier auf der Straße – Opposum, Eichhorn, Waschbär.
Ihre Körper sind störend, wie Hundegebell
das nach Sirenen klingt, ein atavistischer Chor
angestimmt von sprachloser Aufregung. Es gibt
hier kein Entkommen vor dem Gefühl des Tiers.
Wer wird einem verdenken, daß man sich unzulänglich fühlt
wenn man nur schlief, um eine Stunde Alleinsein zu vermeiden.-
Ich wache zwischen Mauern, die nichtssagend sind wie Träume.
Bis zum Augenblick der Erkenntnis
begnüge ich mich mit diesem dumpfen Vorbeigleiten
der Phantasie, als wäre damit schon getan
was getan werden muß. Dann knirschen die Autos vorbei
die kaputten Auspufftöpfe dröhnen
und der Hahn ergießt seine Stimme in die
umliegenden Höfe. Wozu sich wehren gegen
Begegnung von Wahrscheinlichkeit
und Tod? Dem Erntemond
rund und geschwollen, ist das orange Licht ausgegangen.
Er muß im nächsten Jahr wiederkehren.
David Shapiro
Übersetzt von Gerhard Falkner
Vorwort
Hier ein kurzes, lästiges Vorwort.
Alles hat sich verändert, und jede Veränderung hat längst ihr Ziel aufgegeben, irgendeiner Bestimmung zu folgen, sondern man kann von ihr eigentlich nur noch mit Bestimmtheit sagen, daß sie sich vollzieht. Die Sprache der Literatur in den letzten Jahrzehnten hat wesentlich mit dieser uns enteigneten Veränderung zu tun. Sie beantwortet die (Selbst)Ent-äußerung der Veränderung mit dem Verzicht auf jede innere Beurteilung. Die Literatur rückt damit in eine Art „Parallelaktion“ zu dem, was aus dem einstürzenden Komplex Wirklichkeit für sie als Text weitergebbar wäre. Mit anderen Worten, sie wird selbstreferentiell, und somit hat die Zeit mit ihrer Sekundantin, der Dauer, beide ja im Grunde nichts als Bewegungsrichtungen der Wirklichkeit, kaum noch Zugang. Die Literatur, besonders die amerikanische, ganz besonders die vorliegende, wird zunehmend reine Vergegenwärtigung, Reflex, die der Autor an sich, als Folie für den Text ablesbar macht.
Wie ein Brocken wird AM LIT dem Leser vorgeworfen, eine Bodenprobe der literarischen Verhältnisse in den USA, eine Entnahme vorwiegend aus der jüngsten Schicht, aus der sich pars pro toto auf die Verhältnisse, den Zustand, die psychologischen Temperaturen schließen läßt.
Wir haben, auch unter Inkaufnahme von Inkonsequenzen, zu markieren versucht, wo die US-Literatur heute steht, wie sie sich zusammensetzt. Wir haben versucht, uns im Gewirr der Rücksichtnahmen und berechnenden Absichten nicht zu verheddern; die Grundmengen schwul, jüdisch, Frau sind reichlich eingehalten, indianisch, spanamerikanisch und schwarz sind kläglich unterberücksichtigt, Whasps oder Kriminelle haben aus schierer Angebotsknappheit in AM LIT überhaupt keinen Anklang gefunden, obwohl gerade auch diese konstitutiv für das Gesamtbild gewesen wären. Wir haben uns, das will ich damit sagen, nicht um Mischungsverhältnisse bemüht, sondern versucht, die bestehenden Kräfte von Ruf, Szene, Empfehlung, Kritik, Interessantheit und persönlichem Eindruck zu nutzen und zu erhalten. Wir haben dabei weiterhin versucht, im „voroffiziellen“ oder außeroffiziellen Bereich zu bleiben (bewußt umrahmt von einigen literarisch festen Punkten), was allerdings äußerst schwierig ist, weil es eine Subkultur, auch wenn viele das dort wie hier nicht wahrhaben wollen, nicht mehr gibt.
Solide Fragen wären nun, was ist neu, was hat Prägnanz, wo steckt das Eigenartige, das Besondere, gibt es die übergreifende oder übergeordnete Stimmungslage, deren Stimme diese Literatur hier spricht?
Zweifellos steht die US-Literatur noch heute unter dem Eindruck der 60er und 70er Jahre. Was wir hier vorliegen haben, ist – zum Teil – auch ein bißchen der „hangover“ nach dieser ausschweifenden Geste. Die Literatur hat sich von der gröhlenden Begeisterung jener Jahre noch nicht wieder erholt, und ein etwas verkaterter Blick richtet sich nun auf die „veränderten“ Verhältnisse: verrottende Städte, Sex als trostlose Zwangshandlung & Generalrequisit (ein Sex, der auf dem Umweg über seine exhibitionistische Rhetorik wieder zu einem Tabu ersten Ranges wird), Kultur als Depot für Problemmüll, der Einzelne als Sonderfall, als Sondermüll, Abartigkeit als hinterletzte Seinserfahrung, entfärbte Lebensumstände, Infantilismus als beschwichtigende (und die Lager schmierende) Begleiterscheinung zu den unüberschaubaren Entwicklungen, die amerikanische Landschaft versinkend in der konsternierenden Unmöglichkeit, ihrer mit einem sprachlichen Kurzzeitgedächtnis noch habhaft zu werden … usw.
Dahinter steht ein unübersehbares Verlangen nach einer Geborgenheit der Kontexte – fast alles ist fast völlig über ein Stadium der Belustigtheit hinaus. Dahinter wird auch sichtbar, wie der Dichter (oder Autor) nun nicht mehr darum kämpft, mit der Sprache einem Anliegen gerecht zu werden, sondern um seine Existenz und sein Verbleiben in dieser Sprache überhaupt. Hierin liegt die Stärke und Bedeutung der AM LIT Texte, und das unterscheidet AM LIT wohl grundsätzlich von anderen amerikanischen Lesebüchern, (die Autoren demonstrieren am eigenen Leib des Textes, welche Verluste zur Zeit zu verschmerzen sind).
Deswegen kann man diesem Vorwort auch nur entgegenhalten:
Don’t think, read!
Gerhard Falkner, Vorwort, 1992
AM LIT – eine Anthologie neuer amerikanischer Literatur
Autor: Es ist zwar eine stattliche Anzahl von amerikanischen Büchern dem deutschsprachigen Publikum in Übersetzungen zugänglich, dennoch stellt die Anthologie AM LIT eine Literatur vor, die in Deutschland bisher nicht wahrgenommen worden ist. AM LIT enthält auch Texte bekannter Schriftsteller, die bestens eingeführt sind, doch die meisten Autoren wurden nie zuvor übersetzt. Das ist kein Zufall. Sie haben Schreibweisen entwickelt, die sich dem unmittelbaren, europäischen Zugriff entziehen. Dabei sind die Texte keineswegs unverständlich. In ihnen werden selten Sprachexperimente betrieben oder extravagante Formen durchgespielt. Sie beziehen sich auf eine soziale Realität, die -noch- nicht die unsere ist. Man kann aus AM LIT viel über die Bedingungen des Schreibens im heutigen Amerika erfahren. Die Frage, ob dies ein „gutes“ Buch, ob man literarische Entdeckungen gemacht habe, wird während der Lektüre immer unerheblicher, obwohl man solche Entdeckungen durchaus machen kann. Sinnvoller ist eine andere Frage. Ist ein europäisch geprägter Literaturbegriff auf diese Texte noch anwendbar? Ähnliche Überlegungen provozierte vor 23 Jahren Rolf Dieter Brinkmanns Anthologie Acid. Ein Vergleich beider Unternehmen liegt nahe, kann aber nur zu Ungunsten von AM LIT ausfallen, den Acid ist ein subkultureller Mythos geworden.
O-Ton Gerhard Falkner: Ich glaube, daß sich tatsächlich viel geändert hat seit den siebziger Jahren. Der Begriff „Subkultur“ ist, meiner Meinung nach, nicht mehr anwendbar. Subkultur ist nicht nur eine Haltung, sondern auch eine Struktur…
Autor: Nicht nur eine Struktur, wie Gerhard Falkner sagt, sondern auch ein spezifisches Zusammengehörigkeitsgefühl, daß so ungebrochen auch eine Konstruktion im Nachhinein sein dürfte. Damit kann nicht mehr gedient werden. Lynne Tillman beschreibt die heutige Situation:
O-Ton Lynne Tillman: Es gibt keine Bewegungen mehr, es gibt Zeitschriften. So viel ich weiß, werden keine Manifeste mehr geschrieben, keine Polemiken. Manchmal geschieht das, wenn eine bestimmte Anthologie herauskommt, ein Vorwort geschrieben wird, in dem Markierungen gesetzt werden, aber niemand glaubt daran. In den späten siebziger und den achtziger Jahren gab es in New York eine Reihe von Zeitschriften. Einige von uns, die an anderer Stelle nicht publizieren konnten oder wollten, veröffentlichten dort zum ersten Mal. Durch diese Zeitschriften sind Personen zusammengekommen, aber die Gruppen sind nicht so zusammenhängend wie es von außen den Anschein hat.
Autor: Die Szene ist heterogener geworden. Was in den sechziger Jahren noch als Innovation galt, gehört heute zur Tradition. Damals konnte es noch als kulturrevolutionärer Impuls empfunden werden, wenn Poeten Rockbands gründeten, mit Comiczeichnern zusammenarbeiteten, Filme machten. Auch viele der Autoren von AM LIT haben in verschiedenen Medien gearbeitet. Sie folgen dabei weniger einem intermedialen Anspruch als der schlichten Notwendigkeit. Richard Hell z.B. dürfte als Rockmusiker bekannter sein, denn als Autor.
O-Ton Richard Hell: Ich kam als sehr junger Mann nach New York, um Schriftsteller zu werden. Doch ich bemerkte, daß so wenige Leute aus meiner Generation lasen, daß ich mich völlig isoliert hätte, wenn ich nur geschrieben hätte. Also begann ich zusätzlich, Musik zu machen. Aber ich habe mich immer in erster Linie als Schriftsteller begriffen.
Autor: Ein Schriftsteller ohne lesendes Publikum. In dieser Situation zwingt schon der Überlebensdruck, sich andere Ausdrucksformen zu suchen. Der Schwerpunkt kann nicht in der Auseinandersetzung mit einer literarischen Tradition liegen, die kaum jemand kennt. Die Texte müssen vorgetragen werden. Sie richten sich an ein aktuelles Publikum, nicht an den anonymen Leser. Ihr Material ist die Alltagssprache, das gesprochene Wort.
O-Ton Eileen Myles: Ich bin am meisten beeinflußt worden, seit ich Mitte der siebziger Jahre nach New York kam, durch die „New York School of Poets“, durch Frank O’Hara, John Ashbery. Poeten, die stark durch die Bildende Kunst beeinflußt waren, die in sehr persönlichen Sprachmustern schrieben. Es waren Autoren wie Kerouac, Henry Miller, die mir Kraft gaben, die mir das Gefühl gaben, ich könne schreiben, weil ich sprechen kann. Wenn ich Autoren lese, die zu mir sprechen, habe ich den Eindruck, ich kann mitreden. Jemand hat gesagt Henry Miller habe eher an eine Zuhörerschaft als an eine Leserschaft gedacht. So geht es mir auch.
Autor: Was Eileen Myles unter „poetry“ verseht, hat mit unserem Poesiebegriff, mag er noch so erweitert sein, nicht mehr viel zu tun. Ihre Texte sind Stellungsnahmen, Ansprachen, Mitteilungen, kurze Monologe, die eine Antwort erwarten. Sie wollen nicht durch Brillianz verblüffen. Es sind Texte für den Augenblick.
O-Ton Gerhard Falkner: Es fehlen zwei Dimensionen, die in der europäischen Literatur eine große Rolle spielen, nämlich die Dimension der Zeit oder des zeitlichen Überblicks. Es ist eine Literatur, die völlig aus dem Augenblick, aus der momentanen Situation lebt und das, glaube ich, auch ganz bewußt tut. Es werden keine zeitlichen Entwürfe mehr gemacht, weder nach vorn, noch nach hinten. Der zweite Punkt ist, daß die Wirklichkeit eigentlich immer über die eigene Person gebrochen wird, ohne dabei psychologisch oder psychologistisch zu sein. Dafür gibt es wohl viele Erklärungen. Ich nehme an, daß das auch mit dem Stil der Medien zu tun hat. Die Medien, das Fernsehen etc., dienen ja eigentlich einer Überwindung der Wirklichkeit, einer Überwindung der Nachricht, einer Überwindung der wirklichen Situation. Sie helfen über das, was sie mitteilen, hinwegzukommen. Sie besitzen eigentlich keine referentielle Wirklichkeit mehr, sondern nur noch ihre eigene. Ich glaube, daß in der Literatur ein ganz analoger Vorgang stattfindet.
Autor: Die Selbstbezüglichkeit und die Betonung der eigenen Person, die Gerhard Falkner an den Texten der Anthologie bemerkt hat, sind nicht gleichzusetzen mit dem Rückzug ins Privatleben. Die Wirklichkeit der amerikanischen Großstädte läßt es nicht zu, sein Ich in der Innenschau zu erfahren. Es geht um die Behauptung der eigenen Person und das im doppelten Wortsinn. Kathy Acker faßt das Problem in einem Satz zusammen.
O-Ton Kathy Acker: I is not an interiour afair.
Autor: Gründe, sich zu beklagen, haben die jungen amerikanischen Autoren genug. Ihre Texte sind voller Bitterkeit, jedoch frei von Larmoyanz. Ihr Tonfall ist lakonisch, unaufgeregt. Es ist, wie es ist. Ein rebellischer Gestus ließe sich allenfalls in ihrer Vorliebe für die obszöne Redeweise erkennen. Seit den Tagen von Lenny Bruce sind in Amerika Protest und Obszönität miteinander verknüpft. In Europa wird das häufig mißverstanden.
O-Ton Gerhard Falkner: Das ist ein Problem, das immer wieder angesprochen wird bei den Lesungen und das offenbar völlig anders gesehen wird von Europäern und Amerikanern. Die Obszönität, „sexual explicity“, wird als ein Teil der Wirklichkeit, bis hin zur politischen Wirklichkeit empfunden. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir damit haben … Ich meine die ganzen Begriffe, die Worte, die verwendet werden, das Menstruieren, der Orgasmus usw., die werden, meiner Meinung nach, metaphorisch verwendet. Sie haben keinerlei psychologischen Bezug zum Körper, zum Bewußtsein und haben keinerlei erotischen Effekt, sondern sind Plakate einer dekonstruierten, amerikanischen Grundsituation. Man hält oft diese Dinge, die berichtet werden in den literarischen Texten, Grausamkeit, Masochismus, Folter, Terror für Ausgeburten von hirnkranken Literaten ohne einfach mal zu bedenken, daß das eine gesellschaftliche Vorgabe ist. Literatur wird nicht erfunden. Man kann formal über etwas hinausgehen, aber man kann inhaltlich nicht über die Wirklichkeit hinausgehen.
Autor: Die beiden Aussagen von Gerhard Falkner scheinen zunächst nicht zusammenzupassen. Die Obszönität der Sprache ist ein Produkt der Gesellschaft und wird dennoch metaphorisch, nicht realistisch verwendet. Der Widerspruch ist scheinbar. Man muß, um sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, keine unmittelbar politische Literatur schreiben. Die Texte in AM LIT sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Sie sind in ihrer Mehrzahl weder unpolitisch noch kunstlos. Die Vorherrschaft der obszönen Metaphorik mag jedoch für europäische Ohren etwas ermüdend klingen.
O-Ton Gerhard Falkner: Die Abnutzung dieser Begriffe ist mit Sicherheit vorhanden. Ich glaube, daß die Abnutzung von Sprache überhaupt sehr weit fortgeschritten ist und in Amerika weiter als irgendwo anders. Das Problem liegt vielleicht auch darin, daß wir die amerikanische Literatur als etwas viel Unverbundeneres oder Eigenes interpretieren oder einfach aufnehmen sollten. Wir müssen uns einfach mit der Situation abfinden, daß das dort funktioniert und unser Einwand ist eigentlich unerheblich. Wir können für alle diese Bereiche eine sehr qualifizierte Kritik finden in Europa, in Deutschland, in Frankreich. Meiner Meinung nach ist diese Kritik je härter umso richtiger. Aber nur von unserem Gesichtspunkt aus.
Autor: Die Abnutzung der Wörter und der Literarischen Formen ist sicher kein spezifisch amerikanisches Problem. Wenn alle Wörter und Formen zur Benutzung freigegeben sind, herrscht Gleichwertigkeit zwischen ihnen. Das heißt aber auch: Sie nivellieren sich gegenseitig. Es wird schwierig, eine literarische Form zu nutzen, ohne sie gleichzeitig zu parodieren. Ich habe in AM LIT keine Texte gefunden, die eindeutig dem komischen Genre zuzurechnen wären. Witzige Passagen sind dennoch nicht ausgeschlossen. Gerhard Falkner behauptet, die Texte seien über das „Stadium der Belustigtheit“ hinaus. Auch dieser Widerspruch ist scheinbar.
O-Ton Gerhard Falkner: Daß es selten über den Zustand der Belustigtheit hinausgeht, muß nicht heißen, daß die Texte humorlos sind. Ich glaube, man findet es einfach nicht mehr witzig, daß der Horror in den amerikanischen Großstädten für jeden unvermeidbar ist, der den öffentlichen Raum betreten muß. Aber wir haben auch in AM LIT Texte wie, beispielsweise von Steve Katz „parrots in captivity“, die außerordentlich witzig und gut sind, wo man diese Ambivalenz sehr deutlich nachweisen kann. Also in einem ganz witzigen und eloquenten Text taucht dann diese Stelle mit dem Aids-Kranken auf, der auf der Straße liegt, im letzten Stadium, und den Yuppie auf dem Weg nach Uptown um eine Kuss bittet.
Sprecher: Das Pappschild des Obdachlosen, der im nächsten Eingang haust, ist umgeweht worden. Ich stelle es wieder auf und sichere es mit einem Stück Holz. Mit blauem Markierungsstift steht in Druckbuchstaben darauf: ICH STERBE AN AIDS. MEINE FAMILIE HAT MICH VERSTOSSEN. MEINE FREUNDE WISSEN NICHT, WO ICH BIN, UND WOLLEN ES AUCH GAR NICHT WISSEN. DIE ÄMTER VERWEIGERN MIR JEDE HILFE. WEIL ICH EIN JUNKIE BIN. ICH HABE KEINE HOFFNUNG UND KEIN GELD. BITTE HELFEN SIE MIR. Wie jeden Tag, seit er vor ungefähr einer Woche hier aufgekreuzt ist, stecke ich einen Dollar in seinen Becher. Er stößt einen schwachen Quieckser aus, und ein Speichelfaden quillt über seine blutig aufgesprungenen Lippen. Ich beuge mich hinunter, um ihn zu verstehen. Sein Gesicht ist von Entkräftung und Krankheit entstellt. Er dünstet den letzten Todesschweiß aus. Dagegen riechen sein Kot und sein Harn geradezu süß. Ein dürrer schwärenbedeckter Arm schiebt sich aus dem Lumpenhaufen, unter dem er steckt, und langt zu meinem Gesicht herauf. Ich zucke zurück. Er sagt etwas. Ich nähere mich wieder. „Was?“ frage ich. Er hebt mir sein Gesicht entgegen. „Küssen Sie mich“, sagt er. „Bitte küssen Sie mich.“ Sein Mund ist schuppig wie eine Schlange, seine Zunge wie ein geschmolzener Löffel. Ich richte mich sofort wieder auf. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich so sein soll. Ich weiß nur, daß es eben so ist.
Autor: Wenig später, der Held ist mit dem Taxi zur Arbeit gefahren, wird er einem weiteren Obdachlosen seinen täglichen Obolus überreichen wollen, eine Art Wegzoll. Dieser aber nimmt den Dollar nicht an. Er befindet sich in der Mittagspause. Für ihn ist es ein Job, wie jeder andere, sein Bruder gehört der Polizei an, und er selbst bezeichnet sich als Künstler. Währenddessen proben im Loft des Helden die Crackers und die Mixed Pickles die Befreiung aus ihren Gefäßen. Sie schwirren durch die Luft. Der Papagei des Hausherrn verführt derweil dessen attraktive Geliebte. Alles ist möglich in Steve Katz‘ Erzählung, und nichts ist in Ordnung, außer der Entlohnung. Das ist natürlich komisch und, wir haben es gehört, schrecklich.
Gerhard Falkner hat von Dekonstruktion gesprochen. Auch die Struktur der Erzählung von Steve Katz läßt vermuten, daß ihm die neuere französische Theorie nicht fremd ist. Er steht damit nicht allein. Ausgelöst durch eine Frage aus dem Publikum, kam es auf der Kölner Lesung unter den Autoren von AM LIT zu einer anregenden Diskussion über die Postmoderne. Es ging nicht um akademische Definitionen, sondern um die Bedeutung theoretischer Überlegungen für die tägliche Praxis. Die Frage, ob George Bataille der Moderne oder der Postmoderne zuzurechnen sei, wurde von Kathy Acker vehement vom Tisch gefegt.
O-Ton Kathy Acker: Als Bataille in den dreißiger Jahren mit der Gruppe „Acéphale“ begann, führte die Realisierung des Kommunismus gerade zu einer Form des Totalitarismus. Also gab es eine Suche nach anderen Gesellschaftsmodellen. Wir sind wieder an der gleichen Stelle. Wir wollen diese Demokratie nicht, wir wollen den totalitären Kommunismus nicht. Wir haben keine Sprache, in der wir über das reden können, was wir wollen. Wir brauchen aber jetzt Modelle neuer Lebensformen. Wir brauchen Diskurse, die nicht auf dem Absoluten basieren. Und der Postmodernismus ist eine Art des Umgangs mit Diskursen, die nicht auf dem Absoluten basieren. Mit ist es egal, ob wir die französische Theorie mißverstanden haben. Mir ist es egal, ob sie falsch angekommen ist. Denn wir brauchen diesen Diskurs in Amerika. Wir müssen Modelle finden, wie man leben kann und wie wir uns ausdrücken können. Und zwar jetzt.
Autor: Die Anthologie dokumentiert Versuche, eine Sprache zu finden, die der heutigen Situation angemessen ist. Sie zeigt ein breites Spektrum literarischer Szenen in Amerika, vorwiegend in den Metropolen, abgerundet durch Einzelkämpfer. Die New Yorker Szene ist in diesem Beitrag, vermutlich nicht zu Unrecht, überrepräsentiert. „AM LIT“ ist ein Bericht von einer Baustelle. Die alten Fundamente sind brüchig geworden. Das Vorbild der Beats, der Literatur der sechziger und siebziger Jahre, ist bei den meisten Autoren noch klar erkennbar. Gleichzeig wird deutlich, daß deren Impetus in der Zwischenzeit die Grundlage entzogen worden ist. Ihr Oppositionsgeist bezog seine Kraft aus einer Aufbruchstimmung, einem noch in der Negation sehr amerikanischen Optimismus. Davon ist nichts geblieben.
Es wird ein Weg gesucht zwischen schwindender Lesekultur und jüngerer amerikanischer Literaturtradition, zwischen Dekonstruktion und direkter Ansprache. Die Pfade sind verschlungen und vielfältig, Sackgasen nicht ausgeschlossen. Dem deutschen Leser wären diese Verästelungen, die individuellen und regionalen Tonlagen, sicher noch deutlicher geworden, wären die Prosatexte nicht fast durchgängig von der gleichen Übersetzerin übertragen worden. Die stilistischen Feinheiten werden dadurch eingeebnet. Vermutlich ließ sich das, aus Kosten- oder organisatorischen Gründen, nicht anders machen. Dieser etwas beckmesserische Einwand soll der einzige bleiben, den ich gegen diese verdienstvolle Anthologie vorzubringen habe.
Joachim Büthe, Deutschlandfunk, 18.7.1992
THE VOICE OF AMERICA
− Marcel Beyer las die Anthologie neuer amerikanischer Literatur AM LIT und lauschte den vortragenden bei der Präsentationstournee. −
AM LIT ist nicht die erste Sammlung der neunziger Jahre, in welcher neue amerikanische Literatur im großen Rahmen vorgestellt werden soll. Allein 1990 widmeten sich die Zeitschriften Wespennest und Rowohlts Literaturmagazin dieser Aufgabe, daneben erschien eine ganze Anthologie von US-Literatur unter dem Titel Mobil in der Edition Isele. Doch verhält es sich mit AM LIT anders als mit den genannten: Es ist die erste Anthologie dieser Art, die aus den neuen Bundesländern, nämlich aus Ostberlin kommt, wo sie vom (bisher mit fast durchweg interessanten Büchern ‚avantgardistischer‘ Lyriker hervorgetretenen) Druckhaus Galrev verlegt wurde. Zwar sind die Herausgeber (der westdeutsche Lyriker Gerhard Falkner und der in New York lebende Sylvère Lotringer – siehe letztes Heft) nicht in der DDR aufgewachsen, doch zeigt das Interesse des Verlages an einem solchen Projekt, daß es einerseits einiges nachzuholen gibt (schließlich lief in der DDR nicht in jeder zweiten Kinonacht „Easy Rider“), daß man andererseits aber auch (dafür bürgen schon die Herausgeber) bisher unbekannte Facetten des literarischen Lebens in den USA dokumentieren will. Mit 66 Autoren auf rund 400 Seiten hat man zudem die bisher umfangreichste Bestandsaufnahme vorgelegt.
Alle diese Sammlungen des laufenden Jahrzehnts sehen sich ausdrücklich in der Folge jener heute ‚legendären‘ Anthologie amerikanischer Beat-Literatur, die Rolf Dieter Brinkmann, Ralf Rainer Rygulla und andere Ende der sechziger Anfang der siebziger Jahre herausgegeben haben. Man will dort anschließen, wo Fuck You, Acid und Silverscreen aufgehört haben – womit man nicht nur eine Lücke von fast zwanzig Jahren überbrücken, sondern die eigene Auswahl auch an einem Mythos messen lassen muß. Überbrücken heißt hier: Es geht den Herausgebern nicht darum, zu dokumentieren, was in der Zwischenzeit gelaufen ist (z.B. die ganz anders ausgerichteten Strömungen „New Journalism“ oder „Metafiction“), sondern man schaut (hierbei schere ich jetzt zahlreiche verschiedene der in AM LIT vertretenen Autoren über einen Kamm), was aus der Beat-Generation geworden ist, bzw. wo deren Kinder stecken.
Jeder möchte an die ‚großen‘ Anthologien anschließen. Was ist aber von jenen geblieben? Nicht mehr als die Beiträge der alten Hasen Ferlinghetti und Burroughs in AM LIT, sowie die vage Erinnerung an eine wilde Zeit des Hippietums und der 68er-Generation. Schon bei Erscheinen von Acid stand der Wiener Schriftsteller Reinhard Priessnitz in einer Rezension der damals noch ungebrochenen Amerika-Euphorie des Vechtaer Schriftstellers und Acid-Herausgebers Rolf Dieter Brinkmann skeptisch gegenüber. Die gesammelten Texte seien fast durchweg mittelmäßig, und Brinkmanns Nachwort schwelge in Ausbruchsphantasien aus der muffigen BRD, ohne zur Kenntnis zu nehmen, daß Techniken wie cut-up und fold-in ursprünglich von der klassischen Moderne Europas erst in die USA exportiert worden seien. – Aber damals ging es um weitaus mehr, als nur um Literatur. Alle Utopien von einer freien Gesellschaft, von einer veränderten, sich gegen überkommene Konventionen auflehnenden Jugend wurden schließlich hierzulande zu ‚frivolen‘ Szenen in deutschen ‚Jugendfilmen‘ runtergeholt, wo angetrunkene Langhaarige in Hot Pants mit dem Buggy durch Sylter Dünen kurven. Später desillusionieren eigene Besuche in den USA Brinkmann bezüglich seiner Visionen vom ‚echten Leben‘, die in Deutschland gerade aufblühende Szene von alternativen Literaturmagazinen ging ein, ihre Beiträger drifteten größtenteils in die Belanglosigkeit ab, und auch die ernstzunehmenden unter ihnen werden heute kaum mehr zur Kenntnis genommen. Der gemeinsame Kampf für eine bessere Welt und das dadurch entstehende Gemeinschaftsgefühl wurden einige Jahre später AKW-Nee- und der Friedensbewegung wieder aufgegriffen – allerdings ohne dabei etwas mit Literatur im Sinn zu haben, ohne eine Veränderung der Ästhetik als Prämisse für gesellschaftliche Veränderung zu sehen.
Wie die Entwicklung nun in der DDR aussah, kann ich nicht beurteilen, zumindest aber ließ sich in den letzten Jahren beobachten, daß die Literaturszene der nach Staatsgründung und Bitterfelder Weg Geborenen längst ein Auge auf die hier vergessenen alten Helden geworfen hat. Das ebenfalls bei Galrev erscheinende Magazin Warten wartet seit 1990 (redaktioneller Abschluß der ersten Ausgabe allerdings bereits 1988) mit interessanten Beiträgen von/zu Schriftstellern und Künstlern wie Burroughs, Gysin und Jürgen Ploog auf. Die Devise heißt nach wie vor: Underground. Inwiefern dieses Kriterium aber noch greift (zumal AM LIT nun, 1992 im wiedervereinten Deutschland erscheint), muß geklärt werden.
Obwohl in Am LIT 66 Autoren vertreten sind, ist natürlich klar, daß dieses Buch nicht alle Facetten der ‚neuen Literatur aus den USA‘ abdecken kann, dazu bekennen sich auch die Herausgeber. Doch tun wir einmal so, als handele es sich um typische Vertreter des US-Undergrounds: nur einer der Autoren ist unter 30, der durchschnittliche Schriftsteller in den USA ist Anfang 40, weiß, hat eine Hochschulausbildung und arbeitet noch heute an der Uni. Auch die Figuren dieses Schriftstellers sind oft Künstler oder bewegen sich zumindest im entsprechenden Milieu. – Das weist eher auf den in der BRD vielgescholtenen Professoren-Roman hin, als auf tuffes Szene-Ambiente. Der durchschnittliche Autor kennt den Zweiten Weltkrieg also nur noch aus Comics oder Erzählungen der älteren Generation, war in der Pubertät, als Kennedy erschossen wurde, hätte sich – im wehrtauglichen Alter – freiwillig für Vietnam melden können, verfolgte den ‚Wüstensturm‘ am Bildschirm und hätte bei der ‚Befreiung Kuweits‘ schon seine ersten Söhne verlieren können.
Der durchschnittliche US-Schriftsteller schreibt meist klassische Short Stories, geschult am Hemingwayschen Modell, das wir im Englischunterricht auswendig lernen mußten: direkter Einstieg in die Situation, Beziehungskrise oder Kindheitstrauma, das man während der kleinen Verrichtungen des Alltags verarbeitet, irgendwo dann eine Klimax in der Geschichte, und am Ende bleibt ein bißchen Geheimnis. – Fragen der literarischen Techniken oder gar die Anwendung ‚avantgardistischer‘ Mittel sind für ihn kein Thema mehr, womit er sich deutlich von der Underground-Literatur der 60er Jahre (oder zumindest von deren Rezeption im deutschspachigen Raum) unterscheidet.
Stattdessen ergeht man sich in globaleren Diskussionen, wie auf der Präsentations-Tour von AM LIT durch sechs vertretene Autoren vorgeführt: eine der derzeit kursierenden – auch nicht mehr ganz so frischen – Hauptthesen ist, daß im Zeitalter der Postmoderne die Grenzen zwischen hoher und ‚trivialer‘ Literatur verschwömmen, ja, daß sie mittlerweile gar keine Rolle mehr spielten. So schwärmte jedenfalls Kathy Acker bei der Leseveranstaltung hier in Köln. Die Begründung dafür ist einfach: schließlich seien sich auch ‚intellektuelle‘ Autoren nicht mehr zu schade, Formen und inhaltliche Versatzstücke der Trivialliteratur (inkl. anderer Medien) aufzugreifen. Im Gegenzug dazu seien früher als trivial angesehene Formen (z.B. Krimi) längst hoffähig geworden. Doch findet sich unter den Beiträgen kein einziger reißerischer Krimi, kein Thriller und keine Science Fiction-Story. Darüber hinaus bleiben auch die ‚großen Namen‘ ausgeschlossen, von irgendwelchen älteren Bestsellerautoren einmal ganz abgesehen ist niemand aus dem vor einigen Jahren sogenannten ‚Brak Pack‘ um Bret Easton Ellis, Tama Janowitz, Jay McInnerny oder Michael Chabon in AM LIT vertreten. Und so wurde Acker in der Diskussion dann auch von Lotringer zurechtgewiesen, der eine differenziertere Sicht diverser aus Europa importierter Theorieversatzstücke bezüglich Postmoderne und Dekonstruktion einforderte.
Hier zeigte sich ein Manko von AM LIT: zwar bestanden die lesenden Autoren während der Veranstaltung darauf, daß sie alle aus völlig verschiedenen Zusammenhängen kämen, doch gibt es im ganzen Buch nicht einen theoretischen Text, nicht eine Positionsbestimmung durch die vertretenen Schriftsteller. Auch die beiden Herausgeber gehen in ihren Vorworten recht sparsam mit Informationen um: man solle selber lesen, meinen sie. Klar, ich erwarte von einem Vorwort ja auch keine Inhaltsangabe des Buches, sondern einen Überblick über die (blühende? – die zahlreichen im Anhang erwähnten Literaturmagazine und Verlage suggerieren dies jedenfalls) Szene der alternativen Literatur in den USA, das Aufzeigen von Tradition und literarischen Gruppenzusammenhängen. Die einzelnen Texte jedenfalls geben keinerlei derartigen Aufschluß, sieht man von wiedererkennbaren, recht grob gefaßten Traditionslinien einmal ab.
Ab und zu wird sich in den Stories auf europäisches Kulturgut bezogen, z.B. gleich in der ersten, „Juli“ (’91) von Barbara Barg. Eine Bardame denkt über Nietzsche nach. Juli ’91, da war doch was? Ja, ich erinnere mich, General Schwarzkopfs frisch erschienenes Buch über den erfolgreichen Verlauf des zweiten Golfkriegs in der Hand gehalten zu haben. Lotringer berichtet über ein Mädchen, das sich in New York an Foucault ranmacht, Acker zitiert Celan. – Überhaupt geben zahlreiche Erzählungen ein Bild von der amerikanischen Sicht auf Deutschland, was wohl der aufmerksamen Auswahl durch die Herausgeber zuzuschreiben ist.
Nicht umsonst Celan: den Opfern der Nazis gedenkend. Meist erscheint hier Deutschland als eine Horde wurstfressender SS-Männer, ja, ‚der Deutsche‘ – grausam und unerbittlich, wie er nunmal ist – mit seinem S/M-Flair dient hier nicht selten zur Verkörperung des Bösen, von welchem die Protagonisten der Erzählungen bedroht werden (z.B. in Jerome Charyns „Der gute Polizist“). Denn meist sind die Erzähler oder Hauptfiguren Opfer (nur John, der Protagonist in Dennis Coopers „John der Anfänger“ schlüpft in die Rolle des Sadisten). Opfer des Vaters, Opfer der Gesellschaft, Opfer der psychischen Unterdrückungsstrukturen etc. Nie sind sie Sieger, nie Schwarzkopf, Indianerausrotter oder alltäglicher Rassist. Oft sind sie homosexuell (was wohl auch auf die Verfasser zutrifft) oder Frauen (was auch auf die Verfasser zutrifft) und reflektieren die Ausweglosigkeit oder den alltäglichen Haß, der ihnen als Vertreter einer ‚Minderheit‘ entgegenschlägt. Das gerät mal eindringlich (wie bei Robert Glück in „Sanchez und Day Street), mal weinerlich. Selten spürt man hier offenen Zynismus (Steve Katz‘ Ich-Erzähler in „Papageien in Gefangenschaft“, der einem bettelnden, AIDS-infizierten Junkie begegnet), es ist eher der Zynismus des ‚so ist es nunmal, doch das Leben geht weiter‘ (so in Gary Indianas „Wüste Küste“, die Schilderung des Zusammenlebens mit einem HIV-Positiven im letzten Stadium, dessen Freund nach einem neuen Lover sucht), welcher als Eindruck nach dem Lesen bleibt.
Anders als die in diesem Band versammelte Prosa, die, wenn schon nicht formal avanciert (zwei Ausnahmen: die hineinmontierten Zitate zur Kulturgeschichte der Zitrone in „Verhütungsmethoden“ von Sandy Huss und Eric Holswaldes Weiterentwicklung des ‚road Movies‘ durch Perspektiv-Verschiebungen in „Zwei“), so doch wenigstens solide geschrieben ist und ihre Inhalte adäquat vermittelt, ist die Lyrik zumeist recht lasch. Da stehen die Konservativen (Beat-Lyrik, und auch nach dreißig Jahren noch immer Beat-Lyrik) neben den Erzkonservativen (nach dreißig Jahren Beat-Lyrik mal wieder ordentlich Sonette, oder doch wenigstens der Hauch der Poesie, ergreifende Bilder und Gedanken wie z.B.: „ein Buch aus Glas“ von David Shapiro). Das unterscheidet sich um keinen Deut von dem, was hierzulande haufenweise produziert wird. Angesichts der Texte von Public Enemy (die übrigens auch in AM LIT fehlen) etc. bin ich hier etwas enttäuscht.
Eine These, die auch hier in SPEX schon mal ab und zu herumschwirrt, besagt, daß der Text zur Musik längst die frühere Funktionen der Literatur übernommen habe, daß also die Lyrics die Lyrik ersetzten. Schon in den 60ern traf man in der Lyrik verstärkt auf Song-Zitate oder – Strukturen, oder man zelebrierte Lyrik und Jazz. Der Weg andersherum scheint allerdings mehr zu versprechen, muß man sich doch, um einen Pop-Appeal zu haben, auch der Mittel des Pop bedienen. Obwohl mehrere Autoren in dieser Anthologie gleichzeitig Musiker sind, schneidet Alan Kaufman von den ‚Horseman of Apocalypse‘ mit seinen langen Gedichten am besten ab: seine Texte klammern sich nicht an überkommene Vorstellungen von Literatur, sondern sollen vor Publikum gesprochen werden, was wiederum auf ihre Machart und ihre Sprache positiv abfärbt. –
Vielleicht wird die Beurteilung der Lyrik in AM LIT allerdings im Vergleich zur Prosa zusätzlich dadurch verstärkt, daß es wohl besser wäre, die Texte im Original vorliegen zu haben. Es gibt aber im ganzen Band keinen einzigen englischsprachigen Text (eine zweisprachige Ausgabe hätte das Werk auf 800 Seiten gebracht), obwohl sich das Meiste auf Schwierigkeitsstufe 2 bewegt – doch schließlich gab es in der DDR keinen obligatorischen Englischunterricht.
Marcel Beyer, SPEX, 1992
AM LIT
Die andere hier vorliegende Publikation ist eine Anthologie der Gegenwartsliteratur der USA, die sich in Auswahl, Umfang und Absichten mit vorherigen Anthologieprojekten im deutschsprachigen Verlagsgebiet kaum vergleichen läßt. Das Kürzel AM LIT steht natürlich für Amerikanische Literatur und sieht so als Titel ein wenig wie eine Kursbezeichnung im Vorlesungsverzeichnis einer Universität aus. Das ist leicht irreführend, denn mit auf gesicherter Tradition abgesteckten Literaturlehrprogramm hat diese Anthologie wahrlich nichts gemein. Das Gegenteil ist eher der Fall. Die beiden Herausgeber, der in München lebende Gerhard Falkner und der in New York lehrende französische Komparatist Sylvère Lotringer, wollen vielmehr die Möglichkeit zur Bestimmung aktueller Trends und Tendenzen geben. Wobei letzterer im Vorwort gleich einräumt, daß die amerikanische Literatur heutzutage keine bestimmte Richtung mehr erkennen lasse (S. 11). Ein solcher Satz gerät freilich nur zur postmodernen Floskel, denn die Auswahlkriterien dieser Anthologie sind ja auch in ihren Absichten erkennbar, bestimmte, wenn auch sehr vielschichtige und vielgestaltige Tendenzen der heutigen US-Avantgarde dem deutschen Leser vorzuführen.
Gerhard Falkner dagegen skizziert in seinem Vorwort die Situation der heute in den USA schreibenden Lyriker und Erzähler vom Standpunkt eines Baudrillard’schen Kulturkritikers, für den das Verschwinden der „Realität“ aus der amerikanischen Gegenwart auch mit der Sprache der Dichtung nicht mehr erfaßt werden könne: „Dahinter wird auch sichtbar, wie der Dichter (oder der Autor) nun nicht mehr darum kämpft, mit der Sprache einem Anliegen gerecht zu werden, sondern um seine Existenz und sein Verbleiben in dieser Sprache überhaupt“ (S. 10). Als ob eine sich ihrer Grenzen kritisch bewußte Literatur nicht auch mehr leisten können als die Reflexion des sprachlichen status quo. In den Wirklichkeiten der Texte von 66 Autoren und Autorinnen des vorliegenden Bandes gehen diese beiden Pauschalthesen jedenfalls nicht auf: weder die These von der absoluten Unbestimmtheit und Richtungslosigkeit noch die von der Sprache als dem letzten Monothema der Literatur ist in diesem Lesebuch haltbar, denn die ausgewählten Texte Kurzprosa und Lyrik vermitteln ein anderes Bild.
Zunächst verrät die Anwesenheit einiger älterer Autoren unter der Mehrheit der um und nach 1950 geborenen Generation so etwas wie einen Traditionsbezug innerhalb der Gegenwart. Das betrifft etwa den Verlagsführer der Beat Generation Lawrence Ferlinghetti und den buchstäblich auf mehrere Literaturszenen einflußreichen William Burroughs. „Bericht über ein Ereignis am North Beach San Francisco“ (Ferlinghetti) und „Tiger Terry“ (Burroughs) wurden in Fraktur gesetzt, wohl um so klarzumachen, daß dies die Generation der altehrwürdigen Großväter ist, deren Wirkung jedoch bis in die neunziger Jahre hinein äußerst intensiv scheint. Eine nächste Generation ist durch Raymond Federman und Steve Katz repräsentiert – Autoren, die in den sechziger und siebziger Jahren die literarische Postmoderne in den USA maßgeblich und mit internationaler Ausstrahlung bestimmten. Diese Schriftsteller haben gewissermaßen die Felder des literarischen Experiments für Jahrzehnte bestellt, und auf diesem Boden arbeiten viele der in den achtziger Jahren debütierenden Autoren weiter, sofern sie auf das ästhetische und thematische Arsenal der Postmoderne zurückgreifen wie zum Beispiel der an Pynchon erinnernde Kalifornier William T. Vollman.
Weibliche Autoren haben nicht unbedingt an diesem männlich dominierten Teil der literarischen Postmoderne angeknüpft, sondern eher radikal versucht, sich aus den „typisch“ weiblichen Schreibmustern zu befreien. Kathy Acker hat da mit ihrem Punkstil Revolutionäres geleistet und fällt innerhalb der gesamten Anthologie mit einem der stärksten und schönsten Texte überhaupt auf. Dieser Text über die Kunstszene New Yorks und ihre inneren sozialen Gesetze („Ein junges Mädchen“) zeigt eindrucksvoll, daß neben der Thematisierung des Mediums Sprache die Sexualität ein ebenso gültiges Medium und zweites großes Thema geworden ist, die Identität des einzelnen wie die Befindlichkeit ganzer Schichten in der heutigen amerikanischen Gesellschaft literarisch zum Ausdruck zu bringen. „Für eine Literatur des Körpers“ heißt es bei Acker programmatisch (S. 42). Es geht freilich nicht mehr um den naiven Liberalismus der sechziger Jahre, sondern wie verschiedene Formen der Sexualität im Bewußtsein von AIDS oder bestimmter Machtrituale unter dem Einfluß einer heterosexuell und (schein-)monogamen Massenkultur miteinander oder gegeneinander gelebt werden. Davon sprechen auch eine ganze Reihe anderer Texte – eine Thematik, die von den Herausgebern offenbar systematisch berücksichtigt wurde.
Innerhalb der Auswahl weniger beziehungsreich zeigt sich die aufgenommene Lyrik, die in der Tat so etwas wie eine diffenzierte „Bodenprobe“ (Vorwort, S. 9) kaum erkennen läßt. Die Themen – sehr häufig Verlustbeschreibungen im privaten wie im öffentlichen Bereich – werden immer noch in einer nüchternen Alltagssprache gearbeitet, wie sie seit den fünfziger Jahren in der amerikanischen Lyrik vorherrscht. Raymond Carvers impressionistische Momentaufnahmen gehören sicher zu den besten amerikanischen Gedichten der letzten Jahrzehnte, doch um einen Einblick in die auch in den USA wichtige Strömung der sprachbezogenen Lyrik zu geben, hätten die Herausgeber den zwei Gedichten Michael Palmers etwas mehr zur Seite stellen sollen (etwa Gedichte von Bernstein, Silliman oder Howe). Das wäre ja auch ganz im Sinne ihrer erklärten Absicht gewesen.
Die Auswahl gesteht die Unterrerpräsentanz der Literatur von ethnischen Minoritäten ein. Der Fokus liegt auf einer Avantgarde, deren Stile und Themen der westeuropäischen verwandt sind und die sich einer ähnlichen kulturellen Situation gegenüber sieht bzw. sich dieser zu erwehren versucht. Andere Strömungen der letzten Jahre, man könnte an den „New Realism“ denken, werden gar als „Wasp und kriminell“ (S. 9) denunziert. Es wird dem deutschen Leser diejenige Strömung innerhalb der amerikanischen Gegenwartsliteratur vorgeführt, die in ihren (sub)kulturellen Parametern auch hier als Bewegungsrichtung eine Entsprechung hat. Der Verlagsort Berlin ist auch in diesem Fall kein Zufall, und es entsteht so eine gültige Korrespondenz über den Atlantik hinweg. Einige Texte sind ohnehin in europäischen Städten angesiedelt und erzählen direkt die Erfahrung ihrer Autoren in ihnen. Die Auswahl zeigt aber andererseits auch nur den Teil der amerikanischen Gegenwartsliteratur, mit dem die ästhetischen Konzepte der hiesigen Avantgarde korrespondieren können. Eine Auswahl also, die einen Trend als deutliche Botschaft der eigenen Konzeption von Literatur meint und somit neben den genannten, schon bekannteren viele junge Autoren hier vorstellt, denen der Sprung von amerikanischen Bestsellerlisten in deutsche Großverlage kaum beschieden sein wird. Damit ist AM LIT als Lesebuch neuer Literatur aus den USA sehr wertvoll und von Anthologien unterschieden, die mehr oder weniger auf den schon vorhandenen Markt aufmerksam machen sollen.
Thomas Irmer, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, Heft 1, 1993
Kühle Texte aus tristen Zeiten
− Die Sammlung von neuer Literatur aus den USA nähert sich der Epoche von Aids, Crack und Wirtschaftskrise. −
hergott warum hupt ihr denn nicht
alle gleichzeitig verdammt noch mal!
ich bin froh daß ich überhaupt lebe
am Gehsteig meißeln Preßlufthämmer
den ganzen Scheiß auf jede Menge Typen
hängen den ganzen Tag draußen rum
in ihren Hauslatschen blinder
Fleck wo etwas mehr noch weniger ist…
Der Anfang eines Textes mit der Überschrift: „Morgenlärm in der Bowery“. Ein Gedicht vielleicht? Der Flattersatz im Original deutet darauf hin, die willkürliche Zeilenzäsur. Gleichzeitig die banale Beschreibung einer Szene. Die Sprache ist nicht metaphorisch, klingt eher nach Umgangston. Der Autor ist ein junger Amerikaner: Robert Fittman, 1959 in St. Louis/Missouri geboren. Jetzt lebt er in New York
Aufsehenerregend
Mit drei Beiträgen ist er in einer Anthologie mit dem Titel AM LIT vertreten: Neue Literatur aus den USA, ein Reader, der schnell Aufsehen erregt hat, obwohl erst ein Teil der Auflage von 5000 Exemplaren in den Buchhandel gekommen ist. Schon werden Vergleiche mit der Kult-Sammlung Acid angestellt. Darin führten R.D. Brinkmann und R.R. Rygulla 1969 eine amerikanische Literaturlandschaft in die Bundesrepublik, die zur Pop-Art explodierte. Zu den Herausgebern von AM LIT gehört neben dem französischen Literaturwissenschaftler Sylvère Lotringer der Nürnberger Lyriker und Buchhändler Gerhard Falkner.
Falkner hatte das Projekt schon vor drei Jahren für den Luchterhand Verlag konzipiert. Doch personelle Veränderungen in der Leitung stürzten Luchterhand in eine für die Planung unerträgliche Situation. Jetzt ist AM LIT bei Galrev erschienen, der Edition von Sascha Anderson, die nach den Stasi-Vorwürfen ebenfalls in eine heikle Lage gerutscht ist. Gerhard Falkner berichtet, daß es Finanzprobleme gibt, daß Gelder zurückgezogen wurden. Außerdem befürchtet er Berührungsängste der Presse, die auch sein Buch treffen könnten. Offiziell solle es erst auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert werden. Doch gerade die Presse zeigte sich nach einer Tournee mit sechs US-Autoren durch Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und Weimar ausgesprochen begeistert. Warum führte kein Tournee-Abstecher nach Nürnberg? „Wie du mir, so ich dir“, sagt Falkner lakonisch. Er hat nicht die besten Erfahrungen mit der Stadt gemacht, in der er wohnt.
AM LIT ist broschiert und liegt gut in der Hand. Die graphische Gestaltung ist dezent zeitgeistig. Die Illustrationen sind ziemlich düster, sind aus der Beliebigkeit gegriffen. Kein hochästhetischer, ein primitivistischer, naiver Strich kennzeichnet die Graphik. Schöne, sehr lesbare Typographie. Ironisch das Spiel mit der Frakturschrift, in der die Texte der immergrünen Altmeister Burroughs, Federman und Ferlinghetti gesetzt sind. Ursprünglich wollte Falkner außer diesen Ausnahmen nur Autoren unter 40 aufnehmen. Nun sind doch noch mehr Ausnahmen gemacht worden.
Als vor 23 Jahren Acid auf den Markt kam, waren deutliche Trends in der amerikanischen Literatur auszumachen, die später in Europa virulent wurden: neue Realitätserfahrungen durch Drogen, bewußte Verletzungen sexueller Tabus, die Einvernahme anderer Medien wie Film oder Schallplatte in die Literatur. Alles war getragen von einem Impetus zur Veränderung.
Die Tendenzen von damals haben sich etabliert, schwingen in den aktuellen Texten mit. Aber neue Linien sind kaum abzulesen. „Morgenlärm in der Bowery“ ist ziemlich charakteristisch für die Stimmungslage, die in Am LIT zum Ausdruck kommt: der Alltag dringt in die Form,, hält sie am Boden des Erzählens. Poetische Aufschwünge gibt es nicht:
Ich hasse jene Dichter
die ihre Musen heraufbeschwören
indem sie nur mit den Fingern schnipsen
und schon strö-ö-ö-men die Worte−
die ihre besten Gedichte schreiben
wenn sie stockbesoffen sind von hochprozentigen Schnäpsen
und dabei bröselnde französische Kippen rauchen…
Heißt es in „Keine Musen-Geküßte“ von Marael Johnson.
Der Erzähler-Gestus tastet nicht in die Originalität. Genres sind ohne Mühe mit verarbeitet: Science Fiction („Aurora“ von Terence E. Holt), Thriller („Der gute Polizist“ von Jerome Charyn). Die Geschichten streben nicht nach Komplexität. Sie sind anstrengungsfrei zu lesen. Es sind urbane Geschichten. Das Land spielt kaum eine Rolle. Themen? Die Vielfalt herrscht. Aus dem Drogen-Aufbruch von Acid ist inzwischen Drogen-Elend geworden (grandios beschrieben in „Ein schwarzes Kleid kaufen“, einer der besten Erzählungen der Anthologie). Die sexuelle Revolution aus Acid ist durch Aids verunsichert. Viele Geschichten handeln davon. Am interessantesten: „Papageien in Gefangenschaft“ von Steve Katz. Sonst ist die Zeitgeschichte kaum präsent. Ein paar Gedichte zum Golfkrieg. Nur eine (sehr schöne) Geschichte behandelt die Armut in Amerika: „Crusader Rabbit“ von Jess Mowry.
Jahrzehnt der Krisen
Fast alle Texte erscheinen privat, vermeiden gesellschaftspolitisches Engagement. Dennoch meint Gerhard Falkner, daß sich der soziale Zustand der Vereinigten Staaten in den Stories und Lyrics ausdrücken würde, allerdings nicht benannt sondern metaphorisiert. Die Texte selbst stünden mit ihrer oft hohlen, leeren, trostlosen Erscheinung für die Situation, in der sie geschrieben wurden. „Sie beschreiben eben das Jahrzehnt von Aids, Crack, Amerikas wirtschaftlichem Niedergang und dem Golfkrieg“, sagt Falkner.
Wollte man eine Überschrift über AM LIT finden, die das postmoderne Nebeneinander zusammenfaßt, müßte man auf den Begriff „Synergy“ zurückgreifen. Nach R. Buckminster Fuller beschreibt er das „Verhalten vollständiger Systeme, das aus dem Verhalten ihrer einzelnen Teile nicht vorhergesagt werden kann“. Synergy bezeichnet die potentielle Einheit aller imaginativen Einsichten und Fähigkeiten und die Impulse, die sie in Bewegung setzen. Insofern ist AM LIT ein synergetisches Buch. Doch immerhin zeugt es von Energie in der amerikanischen Literatur, nicht von einer Stasis, in der sich nichts mehr rührt.
Mann kann tanzen
im Dunklen
man kann singen
im Dunklen
man liebt
im Dunklen
aber Gedichte
kann man im Dunkeln nicht lesen
das ist vielleicht
ihre größte
Schwäche
schreibt Raymond Federman. Oder halte ich nach der Lektüre von „AM LIT“ dagegen, ihre einzige Stärke.
Halef, Nürnberger Zeitung, 20.8.1992
Fade Kostproben
− eine Anthologie zeitgenössischer amerikanischer Literatur. −
Gewichtig und grell liegt das Buch auf dem Tisch; der leuchtend rot-blaue Einband wirkt als Blickfang, dank dem man AM LIT kaum übersehen wird. Der Münchner Lyriker Gerhard Falkner, der diese Anthologie mit neuer Literatur aus den USA zusammen mit dem New Yorker Literaturwissenschaftler Sylvère Lotringer herausgegeben hat, bremst in seinem Vorwort jedoch bereits die Erwartungen. Nach den sechziger und siebziger Jahren sei in der amerikanischen Literatur ein „hangover“ festzustellen, es gehe in den meisten Texten um „reine Vergegenwärtigung“ – was immer das bedeuten mag.
Über die Kriterien der Auswahl erfährt man leider fast nichts; dass kaum schwarze, dafür ausgiebig jüdische und homosexuelle Autoren vertreten sind, scheint Zufall zu sein. Obwohl es gar keine Subkultur mehr gebe, habe man versucht, „im ‚voroffiziellen‘ oder ‚ausseroffiziellen‘ Bereich zu bleiben“, deshalb sind die meisten Namen im deutschen Sprachraum noch unbekannt – ein Überblick bezüglich der literarischen Gruppierungen in den einzelnen Städten wäre hier durchaus am Platz gewesen. Man vermisst bei dieser „Bodenprobe der literarischen Verhältnisse der USA“ nur überdies eine Datierung der Texte und etwas Lesehilfe zu den rücksichtslos fragmentarischen Romanauszügen.
Bei AM LIT hapert es jedoch nicht nur bei der Edition, sondern auch bei der Auswahl der Texte. Spätestens nach der Lektüre der ersten längeren Prosatexte dämmert einem, was mit „reiner Vergegenwärtigung“ gemeint sein könnte: braver, betulicher Realismus ohne jede reflexive Distanz. Alltagspoesie, die den small talk eitel auf die Gedichtzeilen verteilt, und Sozialkritik pur, wie etwas die wahrlich rührende Slumgeschichte von Jess Mowry.
Das Leiden am amerikanischen Zivilisationsüberhang, der Endkampf der Geschlechter, Aids, Beziehungsunfähigkeit – viel Überraschendes ist unter den Themen nicht zu finden. Ästhetische Entdeckungen sind rar unter den 66 Autoren des Bandes. Zum Goldstaub im trivialen Geröll etwa gehören die Gedichte von Rita Dove und La Loca: Die kühnen Bilder nehmen sofort gefangen. Im Spiel mit Banalität und Drastik lässt Alan Kaufman in lustvollem Sprachrausch einen angehenden Nichtraucher Amok laufen, während Danielle Willis die Horrorvision eines Hündinnenbordells skizziert.
Absoluter Seltenheitswert kommt denjenigen Texten zu, die sich zaghaft aufs Glatteis der Satire wagen. „Osteuropa hat die Kommunisten ausgebootet. Ein Dramatiker ist Präsident der Tschechoslowakei geworden, hurra und o weh. Nelson Mandela ist frei, oder auch nicht, aber jedenfalls aus dem kleinen Gefängnis raus und in dem grossen drin, in dem wir alle drin sind. Mir gefällt die Welt nicht mehr.“ Raffinierter ist die parodistische Prosa von Michael Brodsky, der in so verschlungenen wie hohlen Phrasen den Leerlauf der Kommunikation ad absurdum führt.
Die interessanteste Entdeckung ist Eric Holswade, der als einziger das Niveau der paar wenigen Texte älterer Autoren wie Lawrence Ferlinghetti, William S. Burroughs und Raymond Federman erreicht – die nicht durch die gotischen Lettern aus dem Rahmen der Anthologie fallen. Holswade schreibt nicht nur über Kälte, er schreibt kalt. „Was tags zuvor sinnvoll gewesen war, lag nun eine Woche zurück, die Zelte waren weg, alle waren weg, und den Himmel erfüllte jeden Morgen bei Dämmerung das Geräusch der pulsierenden Luft.“ Ein lakonischer Text voll Abwesenheit, in der sich die Tragödie der zwischenmenschlichen Beliebigkeit viel nachhaltiger ausdrückt als in den sentimentalen Stories über lebenslängliche Einsamkeit. In Eric Holswades Erzählung wird das hörbar, was den meisten anderen Texten dieser Anthologie abgeht: eine eigene Stimme.
Sieglinde Geisel, Neue Zürcher Zeitung, 17.12.1992
AM LIT
„Indianisch, panamerikanisch und schwarz sind kläglich unterberücksichtigt, Whasps oder Kriminelle haben aus schierer Angebotsknappheit in AM LIT überhaupt keinen Anklang gefunden…“, dafür sind „die Grundmengen schwul, jüdisch, Frau reichlich eingehalten.“ Die Herausgeber dieser neuen Anthologie, die alles Vergleichbare in den Schatten stellt, was z. Zt. Auf dem Markt ist, haben sich nicht um die exakt „richtigen“ Mischungsverhältnisse bemüht, sondern versucht, „die bestehenden Kräfte von Ruf, Szene, Empfehlung, Kritik, Interessantheit und persönlichem Eindruck zu nutzen und zu erhalten“. Die alten Beatniks sind inzwischen die „literarisch festen Punkte“ geworden, an denen man/frau nicht vorbei kommt, und so sind die Beiträge von Ferlinghetti und Burroughs, von Federman in gotischen Lettern gedruckt…
Beim Durchblättern des Buches fallen unter den fast 70 AutorInnen weitere bekannte Namen auf: Kathy Acker, Patrick McGrath; Harry Mathews, die mit kurzen – ich nehme an: unveröffentlichten – Texten vertreten sind. Spannender wird es bei den jüngeren AutorInnen, die wir zum Teil schon durch einzelne Übersetzungen kennen, deren nächstes Buch wir ungeduldig erwarten oder wo wir eben auf amerikanische Originale angewiesen sind.
Die „Grundmenge“ schwul/lesbisch ist wirklich gut vertreten – was ein interessantes Licht auf die amerikanische Literaturszene wirft, von der die Herausgeber behaupten, es existiere überhaupt keine Subkultur mehr. Also los, einige Beispiele: Brad Gooch outet sich mit vier Gedichten endgültig als „bisexuelles Mädchen“ mit starkem Hang zu härteren Dingen – das Schwulste, was von ihm bislang auf deutsch vorliegt! Robert Glück, erstmals überhaupt auf deutsch mit der Erzählung „Sanchez und Day Street“: ein schwuler Mann mit Hundefreundin Lily auf der Flucht durch Frisco vor Schwulenklatschern, die mit einem car crash scheitern. Man atmet mit dem Erzähler auf und hat nebenbei etwas über seine Kindheit, Familie und Absichten als schwuler Schreiber erfahren.
Robert Peters, geboren 1925, der uns in seinen Gedichten seinen Lover Mitchum vorstellt – phantasievoll und geil. Zu entdecken!
David Wojnarovicz, bei uns wohl eher als bildender Künstler bekannt, mit der Erzählung eines homoerotischen Stopps an einer Autobahnraststätte in Arizona aus „Close To The Knives“. Dennis Cooper mit „John der Anhänger“, einer Short Story aus dem College-/Punk-Milieu, in dem Kunst, Literatur und Sex so ungefähr gleichgewichtig und –bedeutet sind … Sarah Schulman mit einem Auszug aus ihrem nächsten Roman „Empathy – Einfühlungsvermögen“: Ein Psychiater reflektiert über sein Leben, die Psychoanalyse und den Rest der Postmoderne. Eileen Myles berichtet über eine Fotosession mit Mapplethorpe und das ganze Drumherum, Julia Vinograd macht ein Gedicht über „Die Mapplethorpe-Ausstellung“ und und und …
Liebe, Sex, Gewalt, Krankheit, Familie, Psychotherapie in Gedichten, Stories, Fragmenten und Momentaufnahmen, ergänzt mit Fotos, Comics, Graphik. USA live. Don’t think, read!
Rgk, magnus, Heft 1, Januar 1993
Verzweifelter Versuch, im Chaos Sinn zu entdecken
Der Untertiel, dieser mit Fotos, Zeichnungen, Graphiken und Comics interessant und zuweilen gewagt gestalteten Anthologie macht neugierig, und einer der Herausgeber versichert in seinem Vorwort: „Wir haben, auch unter Inkaufnahme von Inkonsequenzen, zu markieren versucht, wo die US-Literatur heute steht, wie sie sich zusammensetzt. Wir haben versucht, uns im Gewirr der Rücksichtnahmen und berechnenden Absichten nicht zu verheddern.“
Jedoch macht der zweite Herausgeber in seiner Vorbemerkung jede Hoffnung des Lesers auf gewisse Orientierungspunkte mit der Feststellung zunichte: „Eine bestimmte Richtung gibt es in der amerikanischen Literatur nicht mehr.“ Die Sammlung widerspiegelt in ihrer inhaltlichen und formalen Heterogenität den gegenwärtigen Zustand der Literatur in den USA zumindest in der Kurzprosa und Lyrik.
Der Einfluß der 60er und 70er Jahre auf das heutige literarische Schaffen ist aber dennoch in der vorliegenden Auswahl unverkennbar, und solche bekannten Vertreter der Beat Generation wie Lawrence Ferlinghetti oder William S. Burroughs dokumentieren eine gewisse Tradition. Das erklärte Anliegen des Bandes ist nicht die Bestandsaufnahme bereits anerkannter Werke der letzten Zeit, sondern „eine Bodenprobe der literarischen Verhältnisse in den USA, eine Entnahme vorwiegend aus der jüngsten Schicht“. Wie man den Bio/Bibliographien am Ende der Auslese entnehmen kann, stehen aber schon viele der abgedruckten Schriftsteller in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Einige, wie die genannten Beat-Autoren oder der experimentierfreudige Raymond Federman und auch der 1988 verstorbene Raymond Carver sind international bekannt, andere wiederum ringen noch um den künstlerischen Durchbruch.
Die Qualität der Texte, die von mehreren Übersetzern mit durchweg akzeptablen Ergebnissen ins Deutsche übertragen wurden, ist sehr unterschiedlich, wobei manche Beiträge recht unfertig und unausgereift wirken. Zwar versucht eine Reihe von Verfassern die spontane Schreibweise der Beats zu kopieren, jedoch erreichen sie nie jene Frische und Lockerheit der Sprache, die das Markenzeichen dieser Gruppe war. Bedeutende gesellschaftliche und historische Fragen werden kaum thematisiert oder spielen, wie in der Geschichte „Sid und Darling“ von Peter Wortsman, nur am Rande eine Rolle. Dominierende Probleme der Kurzgeschichten, Romanauszüge oder Gedichte sind sexuelle Freuden und Nöte, Lebensangst und der Zerfall zwischenmenschlicher Beziehungen. So beginnt die Erzählung von Roy Schneider, deren sprachliches, ästhetisches und moralisch-ethisches Niveau für viele Proben des Bandes stehen kann, mit den Worten: „Jazz is‘ es scheißegal. Er steckt in einem Hotel in Las Vegas zusammen mit einem schwulen Hotelboy, kleine Biester knurren in seinen Eiern. Scheiß drauf!“ Ungleich nachhaltiger wirkt die mit ihrer sozialen Problematik an die dreißiger Jahre erinnernde Kurzgeschichte „Crusader Rabbit“ von Jess Mowry, die das von väterlicher Fürsorge geprägte Verhältnis zwischen einem Trödler und seinem jungen, drogensüchtigen Gehilfen schildert. Stilistisch wiederum ganz anders gestaltet ist das Prosastück „Wüste Küste“ von Gary Indiana, das im Münchner Homosexuellenmilieu spielt und die letzte Phase eines AIDS-Kranken mit beklemmender naturalistischer Deteiltreue beschreibt.
Falkner bemerkt selbstkritisch im Vorwort zum Inhalt der Anthologie: „… die Grundmengen schwul, jüdisch, frau sind reichlich eingehalten, indianisch, spanamerikanisch und schwarz sind kläglich unterberücksichtigt.“‘ Vielleicht liegt es an diesem Auswahlprinzip und am Verzicht auf kritische, neue Farbtupfer setzende Texte anderer Minoritäten oder Gruppen in den USA, daß der Leser trotz der großen Bandbreite der vorgestellten Proben schließlich das Buch enttäuscht beiseitelegt. Die ihm als „neu“, „prägnant“, „eigenartig“ oder „besonders“ empfohlene moderne amerikanische Literatur erweist sich in den meisten Fällen weder als interessant noch anregend, sondern eher als ein dünner Aufguß bekannter Literaturströmungen und als verzweifelter Versuch, in einer scheinbar chaotischen und kaputten Welt doch noch einen Sinn zu entdecken.
Horst Ihde, Neues Deutschland, 11.12.1992
Neues aus den USA verstaubt
AM LIT ist nicht die erste Anthologie neuer US-Literatur, die ausdrücklich dazu einlädt, sie an einem noch heute bekannten, mehr noch: als Mythos gehandelten Vorläufer zu messen. An Acid nämlich. Die von Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla zusammengestellte, 1969 im März Verlag erschienene Dokumentation der seinerzeit neuen Underground-Literatur packte von Burroughs bis Warhol alles zusammen, was sich seit den 50s in den US of A literarisch geregt hatte; und so entstand eine wilde Sammlung von Gedichten, Comix, pornographischen Texten und theoretischen Aufsätzen.
AM LIT dagegen nimmt sich ziemlich bieder aus. Faksimile-Cut Up-Collagen sucht man vergebens, Pornographie dto., formale Experimente unternehmen nur wenige Texte. 80% des Gebotenen gehört in die Rubrik „klassische short story“. Dem deutsch-amerikanischem Herausgeber-Duo kann man die literarische Betulichkeit schlecht vorwerfen. Schließlich müssen sie mit dem arbeiten, was sich an Neuem bietet.
Was Brinkmann/Rygulla 1969 einem überraschten deutschen Publikum vorsetzten, hatte sich bis dahin vor allem literarisch artikuliert. Was sich heute als (weit gefaßt) Gegenkultur darstellt, wird von anderen Leuten getragen. Von Musikern, Filmemachern – Künstlern mithin, die sich schnellerer Medien bedienen. Gegen die neue Consolidated-LP nimmt sich eine Sammlung literarischer Texte eben etwas verstaubt aus.
Martin Posset, MÜNCHNER, Stadtmagazin, Heft 10, 1992
Beziehungsmärchen und Gossen-Fantasy
− Die junge amerikanische Literatur betreibt Neurosenpflege. −
Sascha Anderson, erneut aktiv als Geschäftsführer des Prenzlauer-Berg-Verlags Galrev, kann aufatmen. Seit der Verlag die Anthologie AM LIT auf den Markt gebracht hat, ist er bei Funk und Fernsehen wieder so beliebt wie vor seiner Kreuzabnahme durch Wolf Biermann. Nach der Lektüre dieses Wälzers fragt sich der Leser jedoch warum.
Der Hälfte der 66 Autoren kann man allenfalls Schreibversuche attestieren. Angesichts der Greueltaten dieser Poeten – unreflektierte Innerlichkeiten, verpackt in absichtliche Wortkunst – möchte man beinahe für die Wiedereinführung der Zensur plädieren. In der Prosa überlagert das große „So tun als ob“ jede erzählerische Linie. Sei es in dämlichen Fickgeschichten oder in kreuzbraven Erika-Mustermann-Beziehungsmärchen – die hier versammelten Texte erwecken den Eindruck, bei der nordamerikanischen Spezies handele es sich um ein Volk ohne Seele.
Zumindest einen Grund für das erschreckende Resultat erfahren wir im Vorwort des Mitherausgebers Gerhard Falkner: Die Literatur von Schwarzen und anderen Nichtweißen sei leider „kläglich unterberücksichtigt“ geblieben. In einer Zeit, wo die Texte schwarzer Rapper die Grenzen der Ghettos sprengen und politische Debatten erzwingen, geben also zwei Europäer einen Text-Sampler heraus, der ausschließlich weiße Neurosenpflege betreibt. Kaum einer der Texte beschäftigt sich mit dem Elend der amerikanischen Gesellschaft. Von den wenigen Ausnahmen, die es doch tun, beeindruckt ein einziger Text durch seine Klarheit und Präzision: Kathy Acker gelingt es auf knapp 20 Seiten, Glanz und Elend der amerikanischen Mentalität zu entmystifizieren.
Es finden sich auch andere Autoren, die Ansätze einer zeitgemäßen und mutigen Sprache zeigen, doch die meisten Arbeiten gehen nicht über die unsäglichen Post-Beat-Selbstbespiegelungen der 70er Jahre hinaus. So betrachtet, ist die Anthologie ein Zeugnis hilfloser Privatheit, die monströse Phantasien gebärt, aber weder Wert noch Richtung findet.
Till Briegleb, SZENE Hamburg 9.9.1992
Sieger ist das Subjekt
− Ein Lesebuch aus dem Berliner Druckhaus Galrev verspricht neue amerikanische Literatur. −
AM LIT ist nicht das Kürzel für ein neues Raumfahrtunternehmen. AM LIT ist – und schon werden sich die ersten enttäuscht zurückziehen – ein Lesebuch. Die „Neue Literatur aus den USA“, die der Verlag verspricht, verspricht keine neue literarische Ästhetik. Nicht Bellow, nicht Bukowski, auch nicht Singer, auch nicht Salinger, schon gar nicht Ginsberg und Oates sind die Matadore, die in dem Kompendium um die Ränge ringen. Jeder kämpft mit sich. Das ist Amerika. Jeder, so hat’s den Anschein, ist Patient und Psychiater in einem und sich damit auch genug. Die seelische, geistige körperliche Selbstbefriedigung ist das beständigste Vergnügen, dem sich die Schreiber des Bandes willig hingeben, die meist in den vierziger und fünfziger Jahren geboren wurden, meist im Babylon New York oder im Paradies Kalifornien ihrer irdischen „Freuden“ leben. Mach es selbst, mache es Dir selbst, ist die durchgängige Da-Seins-Devise. Dem Leser kann schon beim bloßen Hinschauen schwindlig werden.
Ist der alltägliche Rassismus so sehr Alltag, ist die einst real existierende Berliner Mauer überall so sehr übliche Mauer wie Cookie Müller behauptet, die den Erzählbericht „Das Berliner Filmfestival 1981“ aufs Papier brachte? Leichtfertig hätte man vor Jahren die Müller-Story als Überreaktion einer leicht bekifften Neurotikerin abgetan. Von Cookie Müller wird keine neue Warnung kommen. Sie starb im November 1989 an AIDS.
Das Neue an der neuen Literatur der Staaten könnte sein, daß die Geschichten vom Gegeneinander der Geschlechter seltener geworden sind. In den Stories steckt unendlich viel von der kaum genau bestimmbaren Zwie- und Zwischengeschlechtlichkeit sowie vom heiter-hintersinnigen Tun und Treiben der Lesben und Schwulen. Daß Eigenes nicht im Selbstbericht steckenbleiben, gar erstickt werden muß, macht einer der beiden Herausgeber der Sammlung vor. Von dem in New York ansäßigen Sylvère Lotringer stammt die Erzählung „Ich war Foucaults Freundin“, die dem Autor eine Travestie im literarischen Text und ein psychologisches Porträt des Franzosen gestattet, ohne sich und seine Erzählung mit einem Satz lächerlich zu machen.
Genau gesehen sind die Texte, einschließlich der lyrischen wie tendenziell essayistischen, Selbstberichte, die als stabile Bausteine für Erzählungen, Gedichte und Essays taugen. Die Texter fragen kaum mehr nach der Form. Das Subjekt und das Subjektive haben gesiegt. Ist das Mache? Ist das Masche?
Das ist nicht auszumachen in der Ausgabe, die nach keinem Publikum und keiner Popularität schielt. Von seiner Masche und Mach-Art kommt der Galrev-Verlag nicht runter. Den Prenzlauer-Berg-Stil des Titels unbeachtet gelassen, ist die Ausstattung typische Heimarbeit. Der künstlerische Teil ist eher ein Kontrast, denn ein Komplementär der Texte. Das Buch ist ein Canyon. Ist der Grand Canyon aber Amerika?
Bernd Heimberger, Ostthüringer Zeitung, 9.9.1992
Junge Wilde
Anläßlich einer Deutschlandtournee der AM LIT-„Star-Aushängeschilder“ im Sommer 1992 konnten sich auch Frankfurter und Frankfurterinnen ein Bild davon machen, was sie denn nun ist, die „neue amerikanische Literatur“. AM LIT (kurz für amerikanische Literatur) ist ein lockerer Zusammenschluß mehr oder weniger junger „neuer“ AutorInnen, die sich in der literarischen Tradition der Beatniks der Fünfziger verstehen. Folgerichtig bestreitet Alt-Idol William S. Burroughs auch einen der rund 80 sehr kurzen bis sehr langen Beiträge dieser über 400 Seiten-Mammut-Anthologie. Sehr unterschiedlich sind die Beiträge auch in der Qualität. Kathy Acker, Asphalt-Splatter-Punk-Literatin aus New York, hat meiner Meinung nach mit der Story „Ein junges Mädchen“ das Highlight des Bandes geliefert. Der Rest erscheint mir mehr wie eine Bestandsaufnahme einer zugegebenermaßen interessanten Tendenz der neueren Ami-Literatur. Daß man jenseits des großen Teiches schreiberisch einen eher direkten und unmittelbaren Zugang zu den Dingen sucht, für diese Erkenntnis (allein) bräuchte es weder diese Anthologie noch die Vereinigung AM LIT. Wer sehen will, was eine bestimmte Richtung (Junge Wilde?) drüben so macht, kann’s mit AM LIT mal versuchen. Ist ganz nett. Netter (weil oft wirklich unmittelbarer) als das, was unsere in der Regel doch recht sittsamen Nachwuchsliteraten von sich lassen!
Günter Schuler, AZ, Frankfurter Stadtillustrierte, 28.11.-18.12.1992
Ratlosigkeit von Coast to Coast
Das beste ist das Layout: Den Einband gestaltete Jad Fair in penckscher Manier, Innen geht es auch kreativ zu, so bunt, wie Europäer sich die Westküste vorstellen. Wechselnde Schrifttypen, Fotos und Zeichnungen zieren den Inhalt.
„Die Grundmenge schwul, jüdisch, frau sind reichlich eingehalten“ verspricht das Vorwort von „AM LIT“, einer vom Druckhaus Galrev vorgelegten Anthologie junger amerikanischer Literatur. Leider, fügen die Herausgeber (Gerhard Falkner und Sylvère Lotringer) hinzu, fehlen „Whasps und Kriminelle, aus schierer Angebotsknappheit“. Womit sie auf den Schwachpunkt dieses Bandes hinweisen: An „schierer Angebotsknappheit“ nämlich mag es liegen, daß Texte ihren Weg in die Anthologie fanden, die nach beendetem „Creative Writing“-Seminar besser in der heimischen Schublade landen sollten.
Aktualisierung Underground-Vokabular
Aber Lotringer und Falkner wollten alles präsentieren. Und so muß man sich durch viele Seiten bekenntnishafter Stilübungen quälen, um nur gelegentlich auf Originelles zu stoßen. Allround-Punker Richard Hell etwa ist auch dabei. Er hat sich mit den „Voidoids“ einen Namen als Musiker gemacht. Das war schon Ende der Siebziger. Was er im vorliegenden Band anbietet, ist auch nicht mehr ganz neu. In seiner Erzählung „The Voidoid“ (deutsch übersetzt mit „Der Hohlhold“) möchte er Kirschen „die Kerne herausrammeln“ und läßt uns weiter wissen: „Liebe ist ein vierzigpapagätiger Diamantring, der die Hosen runterläßt, während seine Eltern verrotten.“ Diese Rückkehr zur surrealistisch-automatischen Schreibweise ist zur Aktualisierung mit reichlich Underground-Vokabular angereichert. Auch von Kakerlaken berichtet der Schriftsteller, und damit wären wir beim Thema des Altmeisters William S. Burroughs, der, obwohl ebenfalls vertreten, in dieser Anthologie nichts zu suchen hat. Schließlich soll es um junge Literatur gehen. Um diesen Widerspruch ironisch aufzufangen, sind Burroughs Texte (ebenso wie die Gedichte von Raymond Federman), den nostalgischen Leser angemessen strafend, in gotischen Lettern gedruckt.
Für viele der vorgelegten Texte gilt: Was den Alten noch aufregendes Experiment war, bereitet den jungen Schriftstellern lediglich einen gehörigen „hangover“ einen Kater. Drogen etwa werden nicht mehr bewußtseinserweiternd, sondern zerstörerisch erlebt.
Positionsbestimmung der alten Jungen
So legt sich der amerikanische Alptraum in der Ära Bush schwer über die einstigen Visionen von Frieden und Happiness: Gewalt, Zerfall, sexuelle Ausbeutung, Aids sind die Themen, die in den Texten leitmotivisch wiederkehren. In ihrer Erzählung „Ein schwarzes Kleid kaufen“, die nur am Rande vom Kleiderkauf handelt, beschreibt Nancy Reilly den Verfall einer kokainsüchtigen Frau. „Dealer waren wie Friseure, nur war es bei ihnen noch offensichtlicher, daß sie einen für ein paar Piepen zugrunderichteten“ heißt es da, und der Satz ist symptomatisch für die – oft reichlich bemühte – lakonische Weise, in der die Autoren vom Zerfall der Städte und ihrer Bewohner künden.
So stellt dieser Band in erster Linie eine Positionsbestimmung dar. Wir erfahren, was „junge“ (kaum ein Autor ist unter vierzig) amerikanische Intellektuelle beschäftigt, wir erfahren, welchen Einflüssen sie unterliegen, welche Ängste sie haben. Und wir erfahren etwas von ihrer Ratlosigkeit darüber, wie die allgemeine Ratlosigkeit zu vermitteln sei.
Daniela Pogade, Berliner Zeitung, 23.9.1992
Mit Dank an Sascha
Vorbilder des im Ostberliner Galrev-Verlag erschienen Buches AM LIT sind unverkennbar Rolf Dieter Brinkmanns Anthologien Acid und Silverscreen: Mit ihnen machte Brinkmann 1969 eine weithin unbekannte amerikanische Avantgarde in der Bundesrepublik bekannt und hielt nicht nur Autoren wie Bukowski oder Frank O’Hara erstmals einem (in jeder Hinsicht) breiten deutschen Publikum vor die verblüfften Gesichter, sondern inspirierte auch für einige Jahre die subkulturelle Literaturszene hier. Dreiundzwanzig Jahre später unternehmen der Lyriker Gerhard Falkner und der amerikanische Literaturwissenschaftler Sylvère Lotringer den Versuch, ähnliches wie Acid für die neunziger Jahre zu leisten. Dabei haben sie einen gründlichen Schiffbruch erlitten: Wenn das, was ihr voluminöses Buch versammelt, die relevante Undergroundliteratur jenseits der offiziellen Stars sein soll, dann muß man trocken feststellen, daß diese Szene außer Epigonentum, Geschwätzigkeit und pubertären Scherzen derzeit wenig zu bieten hat.
1969 mag das Spiel mit pornographischen Einlagen und Tabuverstößen provokant gewesen sein; es heute zu wiederholen zeugt nur von der eigenen Rückständigkeit. Typisch für diese anachronistischen Geschmacklosigkeiten ist das Photo einer nackten, knüppelschwingenden und mit Ketten behängten, sehr dicken Frau auf deren Brust ein Hakenkreuz gemalt ist.
Offenbar meint Gerhard Falkner seine Parole im Vorwort ernst: „Don‘t think, read!“ Es überwiegt der schnoddrige, betont kunstlose Alltagsslang, der vor allem sagt, daß man nichts erlebt, nichts zu sagen hat, mit Literatur sowieso nichts zu tun haben will, dafür aber ungeheuer relaxed ist. Das versucht offenbar an die seltsame Begabung Frank O’Haras oder an den kunstvoll-kunstlosen Klassiker William Carlos Williams anzuknüpfen, ohne jemals deren sprachliche Dichte und Schönheit zu erreichen. Was entsteht, ist selten mehr als ein ermüdendes Gemurmel der Banalitäten, die durch Drogenkonsum und Sex auch nicht aufregender werden: „Bob und ich sind in der / Morgenland-Cafeteria / weil wir auf acid sind / und Bob ist ganz sicher / wenn wir nicht irgendetwas essen / werden wir STERBEN und / ich sage ihm immer wieder / ich habe keinen Hunger aber seine /Augen sind schwarz und glänzen / in der furchtbaren Überzeugung / daß wir ESSEN MÜSSEN oder umkommen werden / also bestellen wir zwei Magic Kingdom Burgers…“ und so weiter und so weiter. Man kann solche Texte nicht lesen, ohne zwangsläufig eine starke Sehnsucht nach einer gediegenen normativen Poetik zu entwickeln, die festlegt, was ein Gedicht ist und was höchstens als miserabel geschriebenes Tagebuch durchgehen kann.
Daneben stehen exzentrische Reaktionen auf ein trostloses Land, ebenso kunstlos, aber genauer in der Wahrnehmung: Dokumente einer an sich selbst erstickenden Gesellschaft, „lost in the stars and stripes“. Nur selten stößt der Leser auf literarisch kraftvolle Texte: das schillernde Talent Kathy Ackers, der trockene Witz der Erzählung Sylvère Lotringers und das seltsame Textdelirium Michael Brodskys sind glänzende Ausnahmen dieses über weite Strecken langweiligen Buches.
Trotzdem ist die hier vorgelegte Sammlung noch in ihrem Scheitern beeindruckend: Die Herausgeber durchstreifen ein hierzulande weithin unbekanntes literarisches Terrain. Kaum ein Text wurde zuvor auf deutsch veröffentlicht, fast alle der über sechzig, meist jungen Autoren sind hier vollkommen unbekannt. Sichtbar wird, wie die literarischen Subkulturen seit den Beatniks verkümmerten zu selbstgefälligen epigonalen Übungen: Man kann die Endmoräne einer einst kraftvollen Avantgarde besichtigen. Möglicherweise verrät dieses Buch, gerade in seinen mißratenen Texten, einiges über die Mentalität des gegenwärtigen nichtkonformistischen Teils Amerikas: Es ist vollkommen richtungslos, mit einem kräftigen Hang zu Zynismus und morbiden Scherzen, ohne Hoffnung, ohne das mindeste politische Bewußtsein und vollkommen kraftlos.
Abgerundet wird der Band durch einen „Dank an Sascha Anderson as usual“, womit klargemacht wird, in welche Tradition aus Pseudorevolte, diffusen Texten und Spekulationen sich das Buch stellt. Neben dem Herren von der Staatsicherheit bedanken sich die Underground-Importeure artig beim „Auswärtigen Amt Bonn, insbesondere Herrn Bruns und Herrn Pölchen“ und „dem Senat von Berlin, insbesondere Dr. Dietger Pforte“ und beklagen larmoyant, daß sie für ihre subkulturellen Taten kein Geld von der Lufthansa bekommen haben.
Zum Erscheinen des Buches veranstaltet der kleine Verlag eine aufwendige Lesereise: Sieben der amerikanischen Autoren werden in dieser Woche in deutschen Städten zu hören sein. Mit dabei sind Kathy Acker und der Punk-Musiker Richard Hell.
Peter Laudenbach, die tageszeitung 24.6.1992
Pulver in unser Allerlei
− Wichtige Impulse für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur kommen nach wie vor aus den USA. Kein Wunder also, daß gerade kleinere Verlage immer wieder mittels Anthologien und Zeitschriften Entdeckungsreisen in diese Literatur anbieten. −
… AM LIT (Neue Literatur aus den USA) vom Sascha-Anderson-lädierten Galrev-Verlag schlägt in die selbe Kerbe, ohne indes für Kontinuität bürgen zu können. Die Herausgeber der Anthologie, Gerhard Falkner und Sylvère Lotringer, beides ausgewiesene Spezialisten, setzten nicht auf Vollständigkeit, bekennen sich zum schweren Acid-Erbe und gestehen ein, daß dem dicken Band ein subjektiver Geschmack zugrunde lag, der inkonsequent sein muß. So findet sich hier vieles, bei dem man sich fragt, warum da ein reichlich Unbekannter aus seiner Hütte gelockt wurde, während andere, deren Vorstellung nun mehr als überfällig ist, außen vor blieben.
Natürlich wird keiner, dem, es auch nur annähernd darum geht, dem großen Bruder auf den Fersen zu bleiben, an AM LIT vorbeigehen können. Aber bisweilen ist es schon ein bißchen quälend, sich da durchwurschteln zu müssen. „Eine bestimmte Richtung gibt es in der amerikanischen Literatur nicht mehr“, überschreibt Lotringer sein freches, kurzes Vorwort, um mit dem vor Weisheit triefenden, eher doch wohl ironisch gemeinten Spruch zu enden: „Aber die Dinge haben sich seit damals verändert.“ Vermutlich ging es den Herausgebern mehr oder weniger darum, den Mythos der Beat-Poeten zu zerstören, mit denen dann auch schmerzlos – für meine Begriffe zu schmerzlos – gebrochen wird, wenn auch, selbstredend, der olle Ferlinghetti und der versteinerte Naked-Lunch-Burroughs nicht fehlen durften – da würden die LeserInnen schön schreien, wa? Aber immerhin haben sie auch Alan Kaufman aufgespürt, einen Vertreter der jungen Post-Beat-Bewegung der oral poetry.
Indes, wenn es überhaupt erlaubt ist, nach so etwas Mediengeilem zu schielen wie einem Trend, dann sei hier verraten, daß die Amis, die AM LIT preisgibt, allesamt mehr mit ihren Befindlichkeiten zu kämpfen haben, mit Verworrenheit und Ausbruchsversuchen aus bürgerlichen Kisten (ohne mehr zu erreichen, als in einen anderen Kasten umzusteigen). Und dann wäre da noch der Sex. Weiß Gott warum, aber die Schwulen scheinen, glaubt man AM LIT, das Terrain der Ami-Poesie zu erobern. Nach der mystischen Emphase eines ständig auf dem Sprung befindlichen Kerouac „(unterwegs“) hat sich wohl so etwas wie eine umfassend goutierte Beschränktheit in Sachen Homo-Erotik breitgemacht, die zwar literarisch relativ gekonnt einherkommt, aber doch auch mit unterschwelligem Missionarismus…
Hadayatullah Hübsch, Pflasterstrand, 15.1.-28.1.1993
Back in the Real World
„Don’t think, read!” fordert Herausgeber Gerhard Falkner die potentiellen Leser des US-Readers AM LIT auf, den er in Kooperation mit Sylvère Lotringer – „aber die Dinge haben sich seit damals verändert“ – herausgegeben hat. „Damals“: Die späten 60er Jahre, als Rolf Dieter Brinkmanns Anthologie „Acid“ im deutschen Sprachraum Furore machte, als Anschlag auf Schreibrituale der darniederliegenden Zunft.
Der Sturm und der Drang von einst hat sich atomisiert, übriggeblieben sind Versatzstücke, Klischees, Phrasen. Theoretisiert wird schon gar nicht mehr. Geschrieben schon. Hüben wie „drüben“. Jüngere amerikanische Autoren wie der blutleere Paul Auster aus New York oder – im Gegensatz zu ihm – der vitale Larry Beinhart, ebenfalls New York, sind Repräsentanten extremster Couleur, die in Deutschland ihr unterschiedliches Publikum fanden. Über oder auch unter ihnen der polemische Tom Wolfe („Fegefeuer der Eitelkeiten“), der vor nicht langer Zeit seine jungen Kollegen aufforderte, doch endlich „die ganze Fülle des amerikanischen Lebens“ literarisch ins Auge zu fassen, die Realität nicht dem Journalismus oder dem Fernsehen zu überlassen.
Jerome Charyn dürfte er mit seiner Polemik nicht gemeint haben, der wie ein Fisch im Bauch von New York schwimmt. Von ihm stammt die Story „Der gute Polizist“ in AM LIT. Und so ist es auch kein Zufall, daß das Gros der in dieser Anthologie versammelten Autoren im heutigen New York lebt, so wie der Mitherausgeber Lotringer.
Inwieweit also dieser Reader für die „neue Literatur“ aus den USA repräsentativ ist, läßt sich aus Nürnberger Sicht schlicht nicht beurteilen. Die Herausgeber selber verweigern entsprechende Auskünfte, zum Glück aber auch Theorien und Behauptungen von irgendwelchen übergreifenden „neuen Szenen“. So steht zunächst einmal jeder vorgestellte Text für sich selbst. Laut Auskunft des in München lebenden Gerhard Falkner wurde bei den Übertragungen ins Deutsche „größtmögliche Präzision“ angestrebt, was heißt, daß die dichterische Übersetzungsfreiheit insbesondere bei Lyrik auf ein Mindestmaß reduziert sei.
„Sachlich“ und offensichtlich sorgfältig ist auf jeden Fall die Präsentation der Texte, zu jedem der Autoren sind biografische Daten und verantwortlicher Übersetzer genannt. Ein inhaltliches Resümee in dem Sinne, daß sich nach der Lese-Reise etwas „Typisches“ oder gar literarisch „Neues“ herauskristallisieren würde, ist kaum möglich, dafür ist die Route zu heterogen, zu momentaufnahmehaft. „Wilde“ oder gar provokative Text finden sich – weder formal noch inhaltlich – kaum, was den Komfort dieser Lesereise natürlich erhöht. Und so ließe sich vielleicht doch ein Grund-Ton ausmachen, der diesem US-Reader zugrunde liegt: der der sanften Melancholie.
Jochen Schmoldt, Plärrer
Patient und Psychiater
− Sieg des Subjekts in jüngerer amerikanischer Literatur. −
AM LIT ist kein Kürzel für ein neues Raumfahrtunternehmen, es ist ein Lesebuch. Lesebücher langweilen eher statt zu unterhalten. Doch dieses langweilt kaum. Nicht, weil AM LIT andere aufregendere Literatur wäre, AM LIT ist ein bißchen man selbst und das, was man selbst um sich herum beobachtet. Die „Neue Literatur aus den USA“ verspricht keine neue literarische Ästhetik, die amerikanische Literatur der achtziger Jahre weckt und kocht wieder nach Großmutters Rezepten.
Wer mag da Kostverächter sein, zumal sich inzwischen herumgesprochen hat, was Hausgemachtes wert ist?
Nicht Bellow, nicht Bukowski, auch nicht Singer, auch nicht Salinger, schon gar nicht Ginsberg oder Oates sind die Matadore, die in dem Kompendium um die Ränge ringen. Es sieht aus, als kämpfe keiner mehr gegen den anderen. Jeder kämpft mit sich und um sich. Auch das ist Amerika heute, wie es leibt und lebt. Das ist aber nicht mehr das Amerika, das mit aller Selbstverständlichkeit zur Seelenmassage auf die Couch ging. Jeder, so hat’s den Anschein, ist Patient und Psychiater in einem und sich damit auch genug. Die seelische, geistige, körperliche Selbstbefriedigung ist das beständigste Vergnügen, dem sich die Schreiber des Bandes hingeben, die meist in den vierziger und fünfziger Jahren geboren wurden, meist im Babylon New York oder im Paradies Kalifornien ihrer irdischen „Freuden“ leben. Mach es selbst, mach es dir selbst, ist die durchgängige Daseins-Devise. Ein „Geist von Trotz und angriffslustigem Stolz“ tigert, turnt, turtelt, tuntet durch die Texte. Dem Leser kann schon beim bloßen Hinschauen schwindlig werden.
Wer im Grünen zu Hause hockt, wird mit offenem Mund in das Hinterhof-Amerika blicken, das seine Ableger auch in Berlin, Paris oder Odessa hat. Ist der alltägliche Rassismus so sehr Alltag, ist die einst real existierende Berliner Mauer so sehr übliche Mauer wie Cookie Müller meint, die den Erzählbericht „Das Berlin Filmfestival 1981“ schrieb? Leichtferig hätte man vor Jahren die Müller-Story als Überreaktion einer leicht bekifften Neurotikerin abgetan. Und nun? Von Cookie Müller wird keine neue Warnung kommen. Sie starb, zwei Monate nach ihrem Mann, im November 1989 an Aids. An der Krankheit starben auch Michel Foucault, der französische Philosoph, und Robert Mapplethorpe, der New Yorker Star-Fotograf. Nicht zufällig tauchen die beiden Promi-Homos und Kultur-Kultfiguren in den Texten auf.
Das Neue an der neuen Literatur der Staaten könnte sein, daß die Geschichten vom Gegeneinander der Geschlechter seltener geworden sind. In den Storys steckt unendlich viel von der kaum bestimmbaren Zwie- und Zwischengeschlechtlichkeit sowie vom heiter-hintersinnigen Tun und Treiben der Lesben und Schwulen. Sehr selbstbewußt kehren sie ihr Können, ihre Kraft ihre Kunst hervor, statt sich verschreckt zu verstecken. Daß Eigenes nicht im Selbstbericht steckenbleiben oder erstickt werden muß, macht einer der beiden Herausgeber der Sammlung vor. Von dem in New York ansässigen Sylvère Lotringer stammt die Erzählung „Ich war Foucaults Freundin“, die dem Autor eine Travestie im literarischen Text und ein psychologisches Porträt des Franzosen gestattet, ohne sich in seiner Erzählung in einem Satz lächerlich zu machen.
Die Anthologie weckt immer wieder den Anschein, als würde erzählt, erzählt, erzählt. Genau besehen, sind die Texte, einschließlich der lyrischen wie tendenziell essayistischen, Selbstberichte, die als stabile Bausteine für Erzählungen, Gedichte und Essays taugen. Sagt ein Autor „zünd dir eine an und schreib / ein Verschen“, so ist die Stimmung und Situation der Literaten treffend beschrieben. Verschen werden verfaßt, wo kein Vers aus dem Kugelschreiber kullert. Die Texte verlangen kaum mehr eine Form. Sie sind die Form für sich. Das Subjekt und das Subjektive haben gesiegt. Sie sind die Substanz. Ist das Mache? Ist das die Masche?
Das ist nicht auszumachen in der Ausgabe, die nach keinem Publikum schielt. Den Prenzlauer-Berg-Stil des Titels unbeachtet gelassen, ist die Ausstattung typische Heimarbeit. Von der Fotocollage bis zum Comic wurde alles aufgeboten, was die dadaistisch anmutende Mutation der Edition ermöglichte. Der künstlerische Teil ist eher ein Kontrast denn ein Komplementär der Texte. Das Buch ist ein Canyon. Ist der Grand Canyon aber Amerika?
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 20.4.1993
AM LIT
Autorin: Herausgeber dieses Bandes sind der deutsche Lyriker Gerhard Falkner und der französische Literaturwissenschaftler Sylvère Lotringer, der seit 20 Jahren in New York lebt und dort zudem als amerikanischer Autor bekannt ist. Lotringer, der sich als Vermittler zwischen der französischen und der amerikanischen Kultur versteht, gibt seit 15 Jahren die Zeitschrift Semiotext(e) heraus und seit neuerem die philosophisch-literarischen Buchreihen Foreign Agents und Native Agents. Die Bitterkeit und den Pessimismus bekannter Schriftsteller angesichts einer am Massengeschmack orientierten Verlagspolitik kann er nur bedingt teilen, denn in den 80er Jahren sei es zahlreichen nichtkommerziellen Zeitschriften gelungen, Autoren zu entdecken. 40 Autoren und 26 Autorinnen sind der der Sammlung „AM LIT“ vertreten, wobei die Herausgeber bei ihrer Auswahl auf die, wie es heißt, „bestehenden Kräfte von Ruf, Szene, Empfehlung, Kritik und persönlichem Eindruck“ vertraut haben. So werden die Kurzgeschichten einer Barbara Barg, Chris Kraus oder Eileen Myles, die Lyrik eines David Shapiro oder Thomas Lux von Kurzprosa und Gedichten bekannterer Schriftsteller frankiert, darunter Raymond Coover, Harry Mathews, Rita Dove und Lawrence Ferlinghetti, jenem Mitbegründer und Leiter von City Light Books in San Francisco. Dazwischen immer wieder graphische Zäsuren: Comics mit „the happy hater“, dem glücklichen Hasser, und dem „amazing cynical man“, der Saddam Hussein einen Besuch abstattet.
Für Gerhard Falkner richtet sich der Blick der hier versammelten Texte u.a. auf „verrottende Städte, Sex als trostlose Zwangshandlung und Generalrequisit“ und den „Infantilismus als beschwichtigende (…) Begleiterscheinung zu den unüberschaubaren Entwicklungen“, der man mit einem „sprachlichen Kurzzeitgedächtnis“ nicht mehr habhaft werden könne. Sylvère Lotringer hebt eine Bewegung hervor, die diesem Band eine besondere Prägung verleiht.
Sprecher: Es gibt da diese ziemlich junge Bewegung des Techno- oder Cyber-Punk, die einen Versuch darstellt, sich all das Wissen wiederanzueignen, welches die Medien, die Popkultur sozusagen in Umlauf bringen, d.h. sie benutzen das Wissen, um es gleichzeitig gegen diese Kultur einzusetzen. Es gibt diese Guerilla-Seite: Einerseits das Streben nach einer reinen Stimme, andererseits eine Art großes paranoisches Delirium als Protest gegen die Gesellschaft. Daneben gibt es immer noch den Personalismus, eine Literatur in der Tradition von Walt Whitman, William Carlos Williams, den Naturalismus der New York Poets, der Europäern meist nur kindlich vorkommt. Die andere Richtung geht ebendahin, eine Art paranoische Sicht der Dinge zu entwickeln, der Konzerne, der Polizei, jener Instanzen eben, die Kontrolle ausüben. Zu dieser Richtung, die sich in der Science Fiction-Linie à la Burroughs fortschreibt, zähle ich u.a. Reginald Gibson, Kathy Acker und Bill Vollmann.
Autorin: Den Versuch junger amerikanischer Autoren, der neobiographischen Schreibweise zu entraten, attestiert Lotringer gar eine Art Heroismus. Dort wie hier gilt es, dem Verlangen breiter Leserschichten zu widerstehen, die das Erzähler-Ich allzugern mit dem Schreibenden identifizieren. Erzählungen von Kathy Acker, die Texte plagiiert und montiert, markieren da eine Grenze. Sie begreift ihre Arbeit als ein gemeinschaftliches Werk, als Fortschreibung von Texten längst verstorbener Schriftsteller wie auch als Angebot an künftige Autoren. In deutscher Übersetzung sind von ihr bisher sieben Bücher erschienen, darunter „Große Erwartungen“ und „Im Reich der Sinne“. Ihr Buch „Harte Mädchen weinen nicht“ wurde wegen des Vorwurfs der Pornographie verboten. Die Verknüpfung von Sex und Politik, meint Kathy Acker, sei heute keine Perspektive mehr. Das genitale Vokabular ihrer Prosa hingegen ist dasselbe geblieben, denn ihr geht es nach wie vor darum, die „Energie der Worte“, welche im Alltag häufig in sexistischer Weise benutzt werden, umzukehren. Mit einer Sache allerdings hat Kathy Acker, die mehrere Jahre in London gelebt hat, abgeschlossen. Ein Leben in New York ist für sie – eine gebürtige New Yorkerin – nicht mehr denkbar.
Sprecherin: Es ist nicht nur die Gewalt der Straße, die Armut und Obdachlosigkeit, die Art, wie mit Aids umgegangen wird, in den Gesundheitsbehörden, bei der Polizei, genauso wie in den Gemeinschaften selber. Daß Leute, anstatt safer sex zu machen, entweder davor weglaufen oder sich für eine Kultur des Todes entscheiden. Für mich ist New York zur Hölle geworden, anders kann ich es nicht ausdrücken, und ich möchte dort nie wieder leben. Für New York lohnt es sich nicht, zu kämpfen, es gibt keinen Ausweg, was sich dort abspielt, übersteigt alles Menschliche.
Autorin: Ihre Erzählung „Ein junges Mädchen“ handelt von eben dieser Gewalt in New York – ein Abschiedstext. Eine bestimmte Richtung, das macht dieser gelungene Sammelband deutlich, gibt es in der amerikanischen Literatur der 90er Jahre nicht mehr. Als gemeinsamer Nenner bleibt einzig der beharrliche Kampf um „ein Verbleiben in der Sprache überhaupt“.
Hans-Georg Soldat, RIAS 1, 23.6.1992
Fakten und Vermutungen zu Gerhard Falkner + Instagram +
Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口


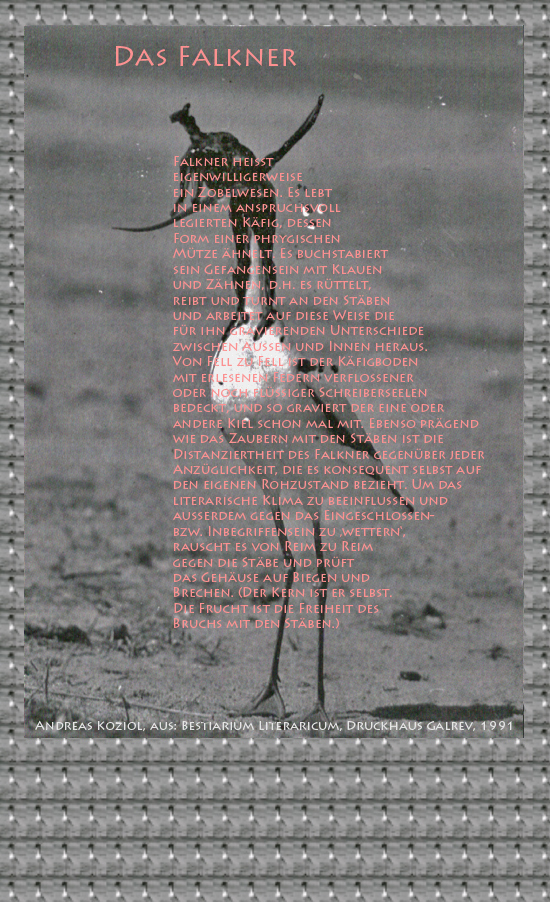












Schreibe einen Kommentar