PENSÉES IV
(höhlengleichnis)
als ein strahl vom licht der welt
einen blick in mein loch warf
entstand an der wand der pfau
mit dem rad voller augen
und dem kreis voller worte
die sagten:
die wahrheit ist nicht sittlich
die wirklichkeit nicht vernünftig
die schönheit nicht beständig
![]()
so beginnen am körper die tage,
der erste Gedichtband des damals Dreißigjährigen, erschien 1981, der zweite drei Jahe später; mit wemut schließt Gerhard Falkner 1989 sein lyrisches Werk ab. „Eine Existenz erlöst sich vom Gedicht“: Über die Hintergründe dieser Entscheidung gibt es keine Auskunft. Vielleicht erschreckt ihn die Grundsätzlichkeit einer gefundenen Form, vielleicht langweilt es ihn, den Ton zu halten, den er meistert und der ihn berühmt gemacht hat.
„glaube, liebe, hoffnung / alles besiegte geschenke“, oder auch „kleine, schmutzige welt, wir singen dich groß und schön / aber nicht mehr lange“: Falkner hinterläßt nicht letzte Gedichte, er nimmt sie zu Lebzeiten vorweg. Er streicht sie aus seinem Tod, als habe Rilke seine Entzifferung des Schönen, das „nichts als des Schrecklichen Anfang“ ist, auf einen leeren Papierkorb geritzt.
Luchterhand Literaturverlag, Klappentext, 1989
Vereinigung der Gegensätze
– Drei Fußnoten zu Gerhard Falkners wemut. –
1
Wer den metaphorischen, rhythmischen und semantischen Bewegungen in Gerhard Falkners Gedichten folgt, wird immer wieder auf eine Grundfigur stoßen: auf die Vereinigung der Gegensätze, auf eine Strategie der permanenten coincidentia oppositorum als Movens des gesamten poetischen Prozesses. In seinem als final annoncierten Gedichtband wemut von 1989 finden wir diese Figur bereits im Titel des Bandes. Die durch das elidierte „h“ fast hieratisch-streng anmutende Vokabel „wemut“ referiert sprachhistorisch auf das mittelniederdeutsche „wëmöd“, das eine aufschlussreiche Bedeutungsgeschichte hinter sich hat: Es bedeutete ursprünglich „Zorn“ und durchlief danach eine Metamorphose bis zu seiner heutigen Bedeutung, die laut Hermann Pauls Deutschem Wörterbuch den „sanften Schmerz der Sehnsucht“ meint.
Zorn und Sehnsucht also. Das sind die Antriebsenergien der falknerschen Poesie, der konstitutive Widerstreit nicht nur der Gemütslagen, sondern auch der Tonlagen: Das Oszillieren zwischen klassisch-romantischer Verzauberung und moderner Entzauberung, zwischen hohem Ton und coolem Gegengesang.
Das Oszillieren zwischen Erhabenheits- und Ernüchterungsmotiven, das in der Vokabel „wemut“ mittönt, manifestiert sich auch in jenen Gedichten des Bandes, die in immer neuen Varianten den Affekt der „Wehmut“ umkreisen. In drei Gedichten des Bandes wird das lyrische Ich „im stande der wehmut“ vorgeführt – dabei erscheint die „Wehmut“ jedes Mal wieder in der neuhochdeutschen Standardschreibung des Wortes. Immer sind aber die Bedeutungshöfe der orthografischen und semantischen Varianten präsent: „We, mute / Wermut“. Eine Metamorphose durchläuft die „wemut“ auch im Gedicht „wermund“, das ein Fehlen des hohen Tons in der Poesie anzeigt, ihn als historisch und verloren kenntlich macht. Der hier „ein fehlen fühlt“, markiert eine poesiehistorische Verlustanzeige:
WERMUND
allein sein, aber alle lust, sage das keinem
aaanannte ich dann und das schwindende, doch sic
zum äußersten, ich fühlte ein fehlen, gebracht,
aaabraucht keine zeit oder höhe, wer erträgt es
um heimirrung fragend, nicht, daß es endet
Mit fragmentierten Zitaten, Abbreviaturen und Inversionen bewegt sich das lyrische Ich durch den Text hindurch; durch die rhythmisch gestaute, stockende und immer wieder neu ansetzende lyrische Rede und die gegen den Strich gebürstete Syntax erhält der Text eine große Spannkraft. Das Gedicht zitiert die Klangfülle der Tradition, in diesem Fall Nietzsches Pathos aus „Zarathustras Rundgesang“ („alle Lust will Ewigkeit“) und verwirft zugleich deren Anspruch auf fortdauernde Geltung, respektive auf „Ewigkeit“. Es ist eine Erfahrung des „Schwindens“ da, eine Gewissheit der Defizienz, die hier als ein „Fehlen“ des hohen Tons aufscheint, der nur noch wehmütig aufgerufen werden kann, nicht aber fortgesetzt in einem neuen unerhörten Sprechen. Das Wort „Wermund“ ist eine Metamorphose der „Wemut“, zugleich aber eine handlungsstarke Gestalt aus der skandinavischen Mythologie. Da ist wieder die Einheit der Gegensätze: die Sehnsucht nach dem Verlorenen und der Zorn der poetischen Aktion.
2
„Unter allen Künstlern bin ich der Einzige, der einen geglückten Selbstmord überlebt hat.“ Der Aphorismus aus Falkners poetologischen Aufzeichnungen Über den Unwert des Gedichts (1993) darf als autobiografischer Kommentar gelesen werden. Denn die Annihilierung der eigenen poetischen Phantasie qua Selbstsuspendierung als Dichter ist Falkner nicht gelungen. „Mit wemut lege ich meinen letzten Gedichtband vor“, dekretierte das „n-a-c-h-w-o-r-t“ zum Band wemut und kündigte den Ausstieg des Dichters aus einer amusischen Literaturlandschaft an.
Abschließend möchte ich anmerken, daß in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, mir immer wahrscheinlicher wurde, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.
Noch im Vermächtnisakt setzte sich der Dichter von der Menge der „Unverfallenen“ ab. Diese trotzige Rücktrittserklärung liest sich wie das Gründungsdokument einer absoluten Poetik, die für sich nicht nur Passioniertheit und Kühnheit, sondern eben auch Einzigartigkeit reklamiert. Der durch und durch der Dichtung „Verfallene“, der seine Existenz der Dichtung gewidmet, sich ihr „ausgesetzt“ hat, spricht von einer einsamen Höhe herab, die das vom Dichter verachtete Fußvolk nie erreichen kann. Aber ein selbstverordnetes Schweigen erzeugt im Literaturbetrieb keine lyrische Nachhaltigkeit. „Eine Existenz erlöst sich vom Gedicht“: Erlösung ist aber durch Zwangsabstinenz vom Poetischen nicht zu haben. Nach den Gesetzen des Literaturbetriebs generiert das selbstauferlegte Schweigen nur ein kollektives Vergessen und nicht die angestrebte Geltung.
Dass er die selbstauferlegte poetische Mangelwirtschaft bald durchbrechen werde, kündigte denn auch der Aphorismus im Unwert des Gedichts an. Bald danach folgte der Auswahlband X-te Person Einzahl (1996). Die Lust an der ästhetischen Konfrontation des Gegensätzlichen – Verzauberung und Entzauberung, hoher Ton und coole Werbeformel, Gesang und Gegengesang – hat seither alle lyrischen Projekte Falkners bestimmt, bis hin zum preisgekrönten Band Hölderlin Reparatur (2009).
3
Der Vereinigung der Gegensätze begegnen wir auch im Gedicht „die roten schuhe“, das in wemut das Kapitel „die kunst und der stille raum“ eröffnet.
DIE ROTEN SCHUHE
fremd bin ich aufgewacht und früh
der stecker steckte noch
eine frau, kleiner als ein pferd
reichte mir einen apfel auf englisch:
apple, she said
willst du nicht beißen
doch wer sind die roten schuhe
the red shoes
dort auf seiner saueren seite
blutig steigen sie den apfel herab
ach ich muß sterben und habe
noch gar nicht gefrühstückt
Im Augenblick des Erwachens befinden wir uns noch im fluiden Bereich zwischen Traum und Wachbewusstsein. So auch das von Schwermut angenagte Ich im Gedicht „die roten schuhe“. Von ferne weht zunächst der elegische Ton des romantischen Wanderers heran, der in Wilhelm Müllers Winterreise zu einem Irrgang in die Kälte aufbricht. „Fremd bin ich eingezogen, / fremd zieh ich wieder aus“: Dieser liedhafte Sehnsuchtston überlagert sich hier mit der beiseite gesprochenen Auflistung von Alltagsrealien und der Evokation alter und neuer Märchen und Mythen.
Falkner inszeniert immer wieder die ästhetische Kollision klassisch-lyrischer Verzauberungsstrategien mit Vokabeln der Ironie und der Ernüchterung. Die Traumsplitter transportieren überscharf gesehene Details, isolierte Gegenstände aus den Symboliken der Poesie und des Märchens: rote Schuhe, ein Apfel, ein surreales Geschehen mit blutigem Ausgang.
Der Dichter mischt die Diskurse und metaphorischen Register so kunstfertig, dass ein reizvoller Zusammenklang von hohem Ton und lässiger Beiläufigkeit entsteht. Das Gedicht „die roten schuhe“ zitiert nicht nur romantische Wehmut, sondern auch alte Märchenstoffe und zeitgenössische Trivialmythen: ein Märchen von Hans Christian Andersen, einen Ballettfilm, Versatzstücke der Popkultur. In Andersens Märchen wird dem armen Mädchen Karen eine obsessive Vorliebe für rote Schuhe zum Verhängnis. Nachdem sie unschicklicherweise in der Kirche getragen worden sind, verselbständigen sich die roten Schuhe, werden zum handelnden Subjekt und zwingen Karen zu immerwährender Bewegung und dauerhaftem Tanz. Und selbst nach der blutigen Amputation der Füße setzen die roten Schuhe ihren Tanz fort.
Gerhard Falkner, der bereits mit seinen frühen Gedichten ein Sensorium für opulente Bilder und metaphorische Überraschungen bewies, kombiniert die unheimlichen Bilder des Märchens mit anderen Motivspuren und potenziert die gefährlichen Verlockungen. Denn hier werden nicht nur die Schuhe aus Andersens Märchen, sondern auch die „red shoes“ und „blue suede shoes“ der Popkultur und nicht zuletzt der biblische Paradies-Apfel Evas in sein poetisches Diarium der Verführungen eingeflochten. Romantische Sprachgebärden verbinden sich mit locker geflochtenen Popsentenzen („apple, she said“) und surrealistischem Witz. Dazu werden englische Redefragmente eingestreut, die dem Text eine unpathetische Lapidarität geben. In den bei den Schlusszeilen kollidiert Pathos mit Komik: Auf einen Vers im hohen Stil („ach ich muss sterben“), der den nahen Tod imaginiert, folgt eine eher schlichte Alltagsnotiz. Das Kunstschöne gibt es bei Falkner nur noch im Status der Defizienz, aber nur in der Reflexion auf seinen Verlust gibt es gültige Gedichte. Die Formel für diese Erfahrung findet sich im Gedicht „materie I“:
o doch, die schönheit soll sich nochmal zeigen
bevor wir sie verloren geben
Michael Braun, aus Text+Kritik. Heft 198. Gerhard Falkner, edition text + kritik, 2013
Zwischen Sprachkörper und Körpersprache
– Gerhard Falkners wemut. –
Es gibt erstaunlicherweise literarische Werke, die sich fast außerhalb der zeitgenössischen Öffentlichkeit entfalten. Sie existieren exzentrisch in der sie umschließenden Mediengesellschaft. Als Drusen liegen sie in der Kommunikationslandschaft. So zeugt Gerhard Falkners Gedichtsammlung wemut wie kaum ein anderes poetisches Werk von isoliertem Wachstum, im harten Widerstand gegen die Bedingungen des zeitgenössischen Literaturvertriebs und dessen Gebot der populären Mitteilung.
Die Poesie Gerhard Falkners ist von bekannten Kritikern wie Harald Hartung und Joachim Sartorius schon zum Zeitpunkt ihres ersten Erscheinens gerühmt worden. Und Michael Maar bescheinigte Falkner, daß er Gedichte geschaffen habe, „die beständig sein dürften“, was „bei der Flüchtigkeit des Mediums (…) eine große Kunst (sei)“. Dennoch erlangte der mehrfach durch Stipendien ausgezeichnete Lyriker sein Ansehen nicht im breiten Publikum, sondern im Kreis geistesverwandter Kunstschaffender. In Zusammenarbeit mit Graphikern und Malern wurden Künstlerbücher in limitierter Auflage hergestellt. Literarische Berührungspunkte ergeben sich mit Lyrikern wie Peter Waterhouse, Felix Philipp Ingold, Thomas Kling, deren Anliegen ebenso die Überwindung der Poetik der siebziger Jahre ist. Nachweislich Eindruck hinterließ Falkners Werk bei den Vertretern einer „grammatologischen“, sprachzergliedernden Lyrik, wie sie sich während der achtziger Jahre in Dresden und Ostberlin im Verbund mit den Bildkünsten etablierte. Allerdings sind die Anliegen und Haltungen dieser Autoren so verschieden, daß mehr von einer allgemeinen Problemkonstellation denn von wechselseitigen Einflüssen zu sprechen ist.
Die zögerliche Aufnahme der Falknerschen Lyrik in einem breiteren Leserkreis bedarf einer Erläuterung. Der Umstand ist nämlich bezeichnend für eine Situation, in der Autorschaft sich im wesentlichen von der öffentlichen, medialen Präsentation der Person, nicht von den Texten selbst herleitet. Literatur ohne Marketing, zumal Lyrik, geht ohne Auftritt in die Archive und Bibliotheken ein, abseits der aparten Modeschauen von Lesungen und Buchmesse. Nur der kleinste gemeinsame Nenner, der die „wichtige“ Literatur von den Scharteken trennt, nämlich die „Innovation“, hält den schnellen Eintritt der Ware Poesie in die Buchspeicher auf. Dies liefert ein Indiz, wie sehr man im Kulturbetrieb der jeweils aktuellsten Trans-Avantgarde mit Zeitgeistanspruch hinterherhechelt. Es stimmt bedenklich, wenn Kritiker den neuen, repräsentativen Ton aus dem Markttreiben herauszuhören vermeinen, der sich aber, wie in Kafkas Geschichte von den Mäusen, weder recht als Singen noch als Pfeifen zu erkennen gibt. Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Hanns-Josef Ortheil hat die Misere sehr offen benannt:
Der literarische Betrieb (leidet) gegenwärtig unter einer kaum noch zu überbietenden Behäbigkeit und Unbeweglichkeit… Er hat sich einer Hektik des Rezensierens, einer manischen Beurteilungsmaschinerie unterworfen, die der Teilnahme am Entwicklungsprozeß junger Autoren keinen Raum mehr läßt. Talente werden wie Sportler in Klagenfurt und anderswo in die Arenen gehetzt, um die Tagespresse zu füllen.
Die Literaturkritik habe sich „vor den stereotyp gepflegten Ikonen einiger anerkannter Schriftsteller eingerichtet.“ Trifft die Klage zu, so verwundert es nicht, daß jüngere Autoren der literarischen Öffentlichkeit den Rücken kehren und sich kompromißlos auf die Entwicklung des eigenen Werks konzentrieren. Gerhard Falkner hat die rigorose Entscheidung getroffen, als Person hinter seiner Lyrik zurückzutreten, ohne irgendwelche Lesungen, Interviews, Radiosendungen abzuleisten.
Im Zeitraum von acht Jahren, von 1981 bis 1989, hat der Dichter drei wichtige Lyrikbände vorgelegt. Gemeinsam ist ihnen die Abkehr von der arte povera und Alltagsdokumentation der siebziger Jahre. Die berühmte „frisch gewaschene schwarze Strumpfhose“ Rolf Dieter Brinkmanns kann als Emblem für jene Art Poesie gelten. Falkner dient zur Remedur die kritische Rettung der internationalen Moderne. Der innere Pegel seines Werks ist das Niveau der lyrischen Formen eines Rainer Maria Rilke, Ezra Pound, St. John Perse oder Pablo Neruda. Bringt diese historische Rückwendung einen ästhetizistischen „Stil“ oder gar „Manierismus“ hervor, wie in der Feuilletonkritik gelegentlich hervorgehoben wurde? Begriffe dieser Art taugen kaum, denn sie verweisen auf die einstige sprachliche Geschlossenheit des Subjekts oder der Epoche. Vielmehr ist von einer „écriture“ zu sprechen, in der sich ein existenzialisiertes Ich sprachlich einnistet. Wie in der Malerei eines Gerhard Richter ist Autorschaft nicht mehr auf einen Stil verpflichtet, sondern das Subjekt zerfasert und zerfranst im Medium Schrift zu einer Vielzahl von gekonnten sprachlichen Haltungen. Zweifellos wirken die Pariser post-saussureschen Text-, Kultur- und Subjekttheorien als prägende Einflußquellen. Denn je stärker sich selbstkritische Lyrik in die unweigerliche Verflechtung von deutscher Tradition und „Experiment“, Hermetik der Poesie und Hermeneutik der Literaturkritik hineinbegibt, je mehr sie der Wirkungsgeschichte der Moderne und der Trümmer-Moderne der Nachkriegszeit durch technische Innovation zu entgehen sucht, desto schwächer wird ihre existenzielle Intensität und Frische. Das Museum der dunklen deutschen Poesie, von Trakl bis Celan, läßt sich für Gerhard Falkner nur durch den Sprung in die fremdsprachige internationale Dichtung und eine antihermeneutische Textauffassung lüften. Die vitalistische Energetik des Gedichts bei gleichzeitiger scharfer Beherrschung seiner Mittel, die vielleicht das spezifischste Moment der Falknerschen Dichtung ist, kommt allerdings nur unter einer bemerkenswerten Aufzehrung zustande. Das auktoriale Subjekt geht unter Preisgabe des intimen Tabubereichs die Grenzen seiner Existenz an.
In Falkners letztem poetischen Werk, dem Lyrikband wemut (1989), ist die Rede vom „Tod des Autors“ keine metaphorische Wendung für das Primat allumfassender Textualität. Vielmehr ist der Entschluß, dem eigenen lyrischen Werk ein Ende zu setzen, ein Akt äußerster Disziplinierung, der schwerlich seinesgleichen findet:
Abschließend möchte ich anmerken, daß in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, mir immer wahrscheinlicher wurde, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.
Von diesem Tod des auktorialen Subjekts aus ist das gesamte lyrische Œuvre zu betrachten, gewissermaßen als Exhuminierung des lyrischen Ichs und seines textuellen Rhizoms. Am einzelnen Poem läßt sich darlegen, wie irritiert die Vorstellung vom sogenannten „Lyrischen Ich“ durch minimale, aber äußerst effektiv eingesetzte Sprachmittel wird:
von schmerzen
geschüttelt
schäle ich
einem apfel
die haut
und denke
die gleiche
ruhe
bei solcher
rohheit
habe ich
nimmer
Das zitierte Gedicht, ein lyrisches Kleinkaliber aus einer Reihe von „capriccios“ ist die einfachste poetische Ausdrucksgestalt, eine traulich klingende Weise wie Goethes zweites Nachtlied mit dem tiefsinnig Lauschenden, der nicht nichts hört, sondern eben die Ankündigung seines Schweigens. Falkners Poem intoniert in verschämter Form die wiederkehrenden Bilder des Lyrikbandes; der sensitive Leib, der umhäutete Dingkörper, das Cogito in paradoxer Konstellation. Wieso hat ein schmerzhaft empfundenes Ich „ruhe“, wieso empfindet es das Schälen eines Apfels als „rohheit“? Ist das denkende Ich überhaupt das empfindene Ich, ist das empfindende Ich das körperliche Ich oder ist es gar – Apfel? Subjekte und Objekte schlittern in einer wundersam schönen Verwirrung ineinander.
Es ist bei dieser Gelegenheit vielleicht an die Prägung des Begriffs „Lyrisches Ich“ zu erinnern, wie er seit den 1920er Jahren in weiten Kreisen zirkuliert, gleichwohl in völliger Verkehrung des Zeitsinns. Denn was als terminus technicus der goetheschen Lyrik trefflich maßgeschneidert sein mag, ist schon bei Gottfried Benn kaum mehr anzupassen: Subjektivität vergeht in zitierten Bildern aus der Antike. Ulrich Meister hat in seiner geglückten Studie zu Benn die Phänomenologie der modernen Subjektivität umrissen als den „Raum, den das Ich durch seine Sprache bezeichnet und umgrenzt“, also den „Raum seiner Identität:“ das „Ich (ist) nur in der Sprache“. Als konsistente, gar authentische Entität ist das Ich in der modernen Lyrik abhanden gekommen. Indessen sind die Ich-Spuren in Falkners Gedichten unübersehbar, ja kaum vehementer tritt in der deutschen Gegenwartslyrik die Erste Person hervor. Der Subjektivität wäre also in ihren Erscheinungsweisen nachzugehen, und zwar im Hinblick auf die „Körpersprache“.
Es heißt in einem Gedicht aus dem Zyklus „nachrichten im april“ (zweite Strophe):
es war april
aaaaaals ich auf die straße ging
umkörpert die brust
aaaaavon tiefen luftrollern
mit anderen worten ein gemüt
aaaaaim stande der wehmut
ins freie geschleudert
Ich und Körper sind getrennt, der Atem, die Wehmut verwringen das leibliche und bewußte Subjekt in eine unauflösbare Lage zwischen Innen und Außen. Eine korrespondierende Zeile aus einem weiteren Gedicht des Zyklus’ führt die Verwirrung fort: „wer war der april / als ich auf die straße kam“. Das cartesianische, reflektierende Ich läßt sich in dem Netzwerk der Subjektivität nicht mehr definitiv angeben.
Die grundlegende Frage, die sich nach Freud, Saussure, Lacan stellt, ist die, ob das Ich unter hochtechnisch-kybernetischen Bedingungen überhaupt noch Ich ist, wenn es Ich sagt. Der Zyklus „ich, bitte antworten!,“ am Ende des zunehmend abstrakter werdenden Bandes wemut, umschreibt diese Frage. Der Form nach handelt es sich um eine Kaskade von sprachphilosophischen Theoriepartikeln, die das polyphone Ich umströmen. Die Distinktion von Wörtern und Objekten, les mots et les choses, schwindet: „grund und gegenteil überqueren die straße; „vielleicht und nein stehen beisammen“. Das Ich bleibt undefiniert: „wo ich war weiß ich noch nicht / wer ich bin kam nicht.“ Das sprechende Subjekt kann das Ich nur als abstrakte Entität begreifen:
das ich sagt du zu einem ding
es möchte mit ihm eine bedeutung bilden
das ich will sich regeln über diese
bedeutung, doch das ding erträgt
keine bedeutung, es trägt jede bedeutung
aber kein ich, das sich dranhängt
und sich schwer macht.
Das Ich als Reflexions-Instanz läßt sich nicht einmal mehr figuralisieren. Im Gedicht „pothos“ heißt es:
ich kann mir nicht sagen der du bist
steh auf und rede
der stuhl ist beschrieben, auf dem ich sitze
und schwanke.
Das sich selbst „setzende“ Cogito des Philosophen Fichte zersetzt sich ironischerweise in ein sitzendes Namens-Ich, aus dessen Inschrift („der stuhl ist beschrieben“) die Körper-Ichs entstehen. Auch diese zerfallen wiederum in der Schrift in pronominale Subjekte, die keinem ganzheitlichen Körper, sondern den grammatischen Spielregeln „unterworfen“ sind: als subjektum. Das Gedicht namens „pothos“ endet mit einem Satzbruch:
ach was wird ich davon denken, wenn
sie mich sieht
im bann dieser ordnung
Noch nicht einmal im Spiegel des Anderen, der Frau, gelangt das denkende Ich zu sich. Das „sie“ ist Phantasma des Ich, daher pronominal austauschbar.
Wer also ist ein Ich? Anders gefragt: wie weit erstreckt sich das Subjekt in den Körper und wie kommuniziert es mit dem spiegelnden Subjekt, dem andersgeschlechtlichen Du? Das Langgedicht „ich, bitte antworten“ befaßt sich mit der Ungewißheit des „Peau-Moi“ (Didier Anzieu) über seine Hautgrenze:
die außenwelt begrenzt das ich schweigend
sie ist von herzen stumm
ihrer stille mangelt alles geschrei
das ich ist es, daß die außenwelt mit lärm
erfüllt. es begeht die welt mit getöse
eine concorde startet
Die monologische Auseinandersetzung mit der technifizierten Welt hält inne beim Gedanken ans Du:
an dich denke ich und mein staunen
stellt das schweigen wieder her
Das Ich ist hier Abstraktum, welches erst im anderen Körper seine Grenze erfährt. Nicht die Begegnung kommunizierender Geister, sondern der körpersprachliche Affekt und das Schweigen definieren die Liebe. Hierin liegt die Auflösung des Kassiberwortes „wemut“, das die Bitterkeit des Wermuts, die trauernde Wehmut und die stumme Paarung „we, mute“ umschreibt.
Einem Tagelied wird das Angebot der Liebe zum Thema. Es geht nicht nur um die zeitgenössische Gepflogenheit des „Kontaktierens“, sondern auch um eine Zusammenführung des Deutschen mit dem Englischen:
fremd bin ich aufgewacht und früh
der stecker steckte noch
eine frau kleiner als ein pferd
reichte mir einen apfel auf englisch:
apple, she said
willst du nicht beißen
dort auf seiner saueren seite
Jeglicher Pathos dieser Begegnung von Mann und Frau ist aufgehoben zugunsten einer boshaften Bloßlegung dessen, was die „sauere Seite“ der Liebe ausmacht: „blutig steigen sie den apfel herab“. Die banalen Zeitrhythmen und gegenseitigen Verletzungen unterliegen selbst dem einfachsten Ritus, dem Gestus zur Teilhabe am Mahl. Die Rätselzeilen der Mitte enthalten die linguistische Pointe des reimlosen Zwölfzeilers:
doch wer sind die roten schuhe
the red shoes
Der situativ motivierte Zusammenprall zweier Sprachen kommt in einer Vertauschung von „wer“ mit „wo“ zum Tragen, dabei einen schillernden Chiasmus zu „where“ und „who“ aufbauend. Eine „Verwechslung“ des anwesenden Signalzeichens Rot mit der abwesenden Frau weist auf eine andere Vertauschung, die der „Liebe“ mit der Körperbegegnung. Das „Peau Moi“ bildet sich allererst in Hautnähe, im Kontakt der Leiber. Die Endzeilen führen eine Riposte gegen das schmerzlichempfindsame Liebeserleben, wie es sich in Goethes „Sehnsucht“ manifestiert. „ach ich muß sterben und habe / noch gar nicht gefrühstückt“.
Das schöne Rätsel der Mitte birgt durchaus eine Anweisung zur Übersetzung. Wie in einem Kaleidoskop fallen neue Bedeutungen zusammen, so nämlich in der Zeile „a woman, smaller than a horse“. Kleiner als ein „horse“ ist doch vermutlich die erste Silbe, also „hor“. So entsteht aus dem Subjekt ein ungeklärtes „who’re“ (wer sind); oder die „whore“. Die Übersetzung spielt damit auf alte moralische Antinomien wie etwa „ehrlich Weib“ und „Hure“ (aus Goethes „Vor Gericht“) an, spannt aber die Prostitution in ein dialektisches Worträtsel ein. Die Scharade verdichtet nämlich bezüglich dieses „Déjeuner sur l’herbe“ eine benjaminsche Allegorese des Verlustes von „natürlicher“ Liebe: die feminisierte Frau läßt sich im Zwang der Moden auf flüchtige Körperzeichen wie den „horseshoe“ mit der Signalfarbe Rot reduzieren. Als vergesellschaftete Eva offeriert sie den Schuh als Apfel. Mithin verdinglicht sie sich in ihrer Hinnahme des Modefabrikats zum Kunst-Reiz, den die Warengesellschaft der Männer hartherzig von ihr begehrt. Die Ware Liebe ist Ausdruck der zur Natur gewordenen Fragmentierung des Daseins.
Betrachtet man die Substanz der Gedichte, den materiellen „Sprachkörper“, so lassen sich Aussagen über das poetische procedere der Zerstückelung machen. An einigen, wenigen Stellen gibt das sprechende Subjekt in der extremen Form des metasprachlichen Kommentars Auskunft über die Bauweise des Gedichts. In einem auffälligen Logogriph wird der Konstruktionsprozeß aufgezeichnet:
hebe mich auf und höre mich um
aus den augen und ohren der welt
bluten die liebenden, i streichen
lebenden, ben streichen, i einsetzen
leiden. leiden streichen, bluten streichen
aus den augen und ehren der welt
Das zerfallene Subjekt, welches das Körper-Ich nicht mehr mit dem denkenden Ich vereinbaren kann, ist letztlich nur als eine Vernetzung von pronominalen Einheiten existent. Es ist dieser Textkörper aus Worten, in den sich verschiedene Existenzformen einsetzen lassen. Grundlegend ist aber auch hier die Negation des ganzheitlichen Corpus. Obschon die grammatische Tektonik mittels Adversativ- oder Konzessionssätzen dominant ist und somit ein hypotaktisches Gerüst aufbaut, wird gerade durch harte Brüche eine Fragmentierung dieser Struktur erzielt:
nicht nur ich und nicht nur alle andern
sondern auch alle sondern
sowohl die aber sondern.
Das Körper-Ich geht völlig im Medium Schrift auf, bis nur noch die Sprache spricht, wie in „materie IV“:
(entbeint den mittelstand!) ein maskenacker
heuchelstabe, hitlerung, herzsicherheitsställe
sommer wie winter unvergeßlich das
kaufhaus zum ewigen frieden
Die Vokabeln bilden keine lexematischen Einheiten, sondern sie werden nur durch die Stabreime zu einer Wortreihe geformt. Der Archaismus dieser phonetischen Wortverkettung im Stil der Richard-Wagnerschen Librettos korrespondiert mit Einzelelementen der Wörter. Die Bestandteile „hitler“ und „ss“ stehen in Verbindung mit dem Runencharakter dieser Zeilen. Wie ein Worträtsel ist der deformierte Mikrotext nur metasprachlich aufzulösen. Erst die Parenthese gibt Aufschluß darüber, wie die Zeilen dekodiert werden können. Folgt man der Anweisung zum „Entbeinen“, so ergeben sich durch das Entfernen der Mittelsilbe „ken“ und das Einsetzen der Silbe „mas“ konventionelle Lexeme einer alphabetischen Folge: Massaker, Maßstab, Maserung, Marstall, Stabreim, Stabhochsprung, Hochsicherheit mögen als assoziative Unterlagen dienen.
Diese „subjektlose“ Schrift, wie sie vornehmlich in dem Zyklus „materien“ auftritt, wird zu einem Mittel der Selbstdekomposition, wodurch sich Sprache selbst ihrer inhärenten Ideologie überführt. Im anthropologischen Sinne ist die „Rückkehr zu den seelischen Elementen des Ich, bevor seine Materie zerfällt“ nicht mehr möglich – doch ebensowenig tritt in der dekomponierten Lyrik der „Rausch chaotischer Auflösung“ ein, wie Böschenstein befürchtet.
Der Textkörper ist am Ende des Bandes wemut die absolute Negation idealistischer und moderner Schönheit zwischen Schiller und Rilke, nur zersprengte Bits lagern sich noch ab:
MATERIE I
zeitgebundener mund orpheus & osiris
mit lauter zunehmenden dingen lauter zerrissene
immer zeitgebundener
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat e x t s p e i c h e rein rot, das gladiolen drängt, zu glühn poren
stürzt auf uns zu steinreiche nacht
o doch, die schönheit soll sich nochmal zeigen
bevor wir sie verloren geben ehre erreck unheil
……
In der Tat sind Falkners „materien“ weniger als avancierte Form „experimenteller“ Poesie zu lesen, denn als Zeugnis einer Auseinandersetzung mit dem Sprachkern der idealistischen Lyrik, wie er insbesondere in den Entwurfsfassungen Schillers oder Hölderlins greifbar wird. Die „materien“ sind ironischerweise als Replik auf klassische Lyrik zu lesen. Als avantgardistisches Sprachpuzzle getarnt, bilden sie eine philologische Fallgrube. In ihrem Innern stecken: „Die Worte des Glaubens“, „Die Worte des Wahns“. In der lyrischen Form der „materien“ zersprengt sich das idealistische Phantasma der nationalsprachlichen Einheit:
Das köstliche Gut der deutschen Sprache, die alles ausdrückt, das tiefste und das flüchtigste, den Geist, die Seele, die voll Sinn ist.
Was Schiller in fragmentarische Entwürfe faßt, dient dem nachmodernen Dichter als linguistische Handhabe en retour gegen lyrische Geschlossenheit. So läßt sich am Gedicht „Deutsche Größe“ des Klassikers gerade dessen materialle Zersprengtheit kritisch retten – als Modell der „Textverarbeitung“:
Finster zwar und grau vor Jahren
Aus dem Alter der Barbaren ein ewg gleich
steht der Deutschen altes Reich Bau
Das eruptive Satzmaterial, welches die Lyrik Gerhard Falkners wortwörtlich beschließt, ist sowohl Ausdruck der durch digitale Codes infiltrierten Sprache wie zynischer Verweis auf das Obsolete der absoluten Forderung nach dem Guten, Wahren, Schönen. „materien“ bilden im Werkkorpus den Gegenpol zu den abgerundeten, gereimten Liebesgedichten:
DIE ENTHÜLLUNG DES PFIRSICHS
schau mal her, ich bin soweit
leuchte in zerrissenheit
mein leib ist eins
mein sinn sind zwei
als trennendes wirkst du dabei
nicht groß genug, um zu verknüpfen
nicht klein genug, um zu entschlüpfen
bist du der riß, der durch mich geht
als auch das licht, in dem er steht
Das Gedicht zeigt sehr deutlich, wie weit diese Art Lyrik gleichermaßen von celanscher Hermetik oder oratorischem Wortspiel, gar linguistischem „Experiment“ der fünfziger, sechziger Jahre entfernt ist. Was den Zeitkern betrifft, so ist eine vitalistische Moderne in die Mitte des falknerschen Denkens eingetragen.
Es ist mit zwei Bemerkungen zu schließen. Gerhard Falkners drei Lyrikbände sind als doppelte Verwindung einer esoterischen, larmoyanten deutschen Lyriktradition und ihrer Umkehr in den Brinkmannschen poems aufzufassen. Die zweite Bemerkung gilt der Stellung des Falknerschen Werks im Kontext der zeitgenössischen Lyrik. Eine Affinität zur sprachsensitiven Lyrik des Prenzlauer Bergs, die sich während der achtziger Jahre als ostmodernes Projekt im parakulturellen Ambiente Berlins zu konturieren und zugleich daraus herauszudrehen begann, ergibt sich an drei diskursiven Schnittpunkten: eine radikale Analyse der eigenen Existenz als eines schriftsprachlich verfaßten Zeichensystems, also eine Ontosemiologie; eine Bezugnahme auf die grammatische Materie der Gedichtsprache, um spielerisch subjektive Kombinationen zu erzeugen, also ein Legoismus; eine Subjektreflektion, die der Körperlichkeit des lyrischen Subjekts Rechnung trägt, d.i. eine Somatologie. Trotz dieser Übereinstimmungen stehen Gerhard Falkners Gedichte in kritischer Distanz zu dem auf Autonomie und Autochthonie bedachten subkulturellen, „heimlichen“ Idiom der östlichen Poesie. In seiner Lyrik ist Vitalität eingebettet in ein Netz von intertextuellen Verweisen auf das allseits zugängliche Archiv der internationalen Lyrik, angefangen von Rimbaud, Baudelaire über Pound, Eliot bis zu Ginsberg und Kavafis. Es ist diese Vereinigung der Bibliomanie mit einem heftigen Alltagsgenuß, woraus der Rang und die stupende Qualität von Gerhard Falkners Dichtung erwächst: als westliche, „postmoderne Klassizität“, welcher die Moderne, knapp vor der bevorstehenden Jahrtausendwende, tatsächlich zur Antike geworden ist.
Auf Gerhard Falkners Gedichtband wemut trifft zu, was einmal für eine bedeutsame Schrift Hegels als „das ungemeine Mißverhältniß, welches zwischen dem substantiellen Werthe des vorliegenden Buches und seiner Anerkennung und Verbreitung liegt“, geltend gemacht wurde. Mit dem Unterschied, daß sich seit Hegel die Diskrepanz zwischen Qualität und Popularität, unter den expansiven Bedingungen des postmodernen Buchgroßhandels, disproportional vergrößert hat. Gerhard Falkners Poesie wäre zu wünschen, daß sich ein berühmtes Diktum aus gerade dieser erwähnten Schrift, Hegels Rechtsphilosophie. erfüllte. Nachdem mit wemut der harte Abschied von der Kunst des Dichtens vollzogen wurde, scheinen nun erst die Bedingungen für die öffentliche Anerkennung des Werkes gegeben, denn „die Eule der Minerva begeht erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“. Wenn die Medienbedingungen tatsächlich die Autorschaft diktieren, so wäre paradoxerweise jetzt, nach dem symbolischen „Tod des Autors“, die erstaunliche Entdeckung eines abgeschlossenen Werks zu Lebzeiten des Dichters zu machen. Gegen seine Worte des Nachrufs, die den essentiellen „Unwert“ des Gedichts konstatieren, wäre nun unter Kritikern und Lesern zeitgenössischer Belletristik die Einsicht in den Mehrwert solcher Poesie zu halten. Gerhard Falkners Lyrik gehört ohne Zweifel zu den stärksten Leistungen der jüngeren Literatur.
Erk Grimm, Sprache im technischen Zeitalter, Heft 128, Dezember 1993
Deflated Poetry – we mute – Demonstration eines Abschieds
– Ein unsystematischer Kommentar zu Gerhard Falkners Apologie des Buchstaben h in wemut. –
Wenn ein Dichter über Dichtung und „deren extremste Bedingungen“1 spricht, wie Gerhard Falkner im „n-a-c-h-w-o-r-t“ (169) zu seinem Gedichtband wemut, den er als „letzten Gedichtband“ ankündigt, spricht er auch über seine Sensibilität, seine heftige Empfindung der Welt als etwas vor der Schöpfung Liegendes, als Urchaos, in und aus dem Dichtung allererst entstehen kann. Das heißt nicht, dass Dichtung als Verdichtung von Unordnung unbedingt zur Ordnung riefe oder als Ordnung ein Gegengewicht zur Unordnung darstellte, sondern dass Dichtung durch den Einsatz ihrer technischen Mittel wie Buchstaben, Silben, Wörter, Vers, Strophen- und Gedichtformen, Metrum, Rhythmus, Syntax, Klang, Orthographie usw. eine wirkliche Differenz zum Urchaos aus diesem selbst heraus konstruiert. Zwar kann sich diese Differenz als gebundenes Chaos nicht gänzlich vom Urchaos lösen, aber sie ist ihm insofern ebenbürtig und nicht nachgeordnet, als sie sich die ohnehin unmögliche Aufgabe, ihm formal zu entsprechen, gar nicht erst stellt. Das ist der Grund, warum Dichtung Autonomie für sich beanspruchen kann und zugleich der Dichtung „Unverfallene“ (169), denen ein antilyrischer Affekt eignet, ihr die Autonomie wieder abzusprechen versuchen.
Die heftige Empfindung der Welt, deren rohe Wahrnehmung, gehört zu den extremen Bedingungen von Dichtung und verbindet das Urchaos mit dem gebundenen Chaos. Was bedeutet also Falkners Abschied von der dichterischen Autonomie? Doch nicht, dass er das Urchaos insofern als Unglück auffasst, als es jegliche Autonomiebestrebung der Dichtung relativiert?
Sein Abschied von der Dichtung in wemut ist ein Abschied aus dem Chaos in das Chaos, aus dem Dichtung gemacht wird. Er beginnt im Chaos mit gebrochenem Deutsch und mit der Bejahung („gebrochenes deutsch oder der umarmte augenblick“ (5–13)) der Heftigkeit der Weltempfindung, die sich in scheinbar ungestalter Sprache äußern, und mündet im Urchaos der Materie („materie I–VI“ (159–166)), wo diese scheinbar wild wuchern kann. Das Paradoxe dabei: Zwischen Anfang und Schlusszyklus entfaltet sich eine vergleichsweise durchlässige Dichtung, während die scheinbar ungestalte Sprache im ersten Zyklus und das scheinbare Wildwuchern der Sprache im letzten Zyklus, wenn man so will, die höchsten poetischen Kontraktionen offenbaren. Falkners Abschied ist also kein Loslassen der Sprache im Sinne einer bloßen Abbildung besagten Urchaos’, sondern im Gegenteil ein Anziehen der poetischen Arbeit am Urchaos, ein Ineinanderfalten der Hände, ein Verflechten der Materie ins Theologische bzw. Metaphysische:
erhaltung das
gebet der materie, grammatik
eine singularität im chaos (S. 153).
Die Hauptfigur, die Falkners wemut durchzieht, ist die des Atems oder der Luft, und allgemeiner: die der Vokalisierung oder der Stimmhaftigkeit und der Stimmhaftwerdung. Es ist anzunehmen, dass eine Detaillierung dieser Aerofigur Aufschluss geben wird über die Krise des Autors, die sich im erwähnten Abschied äußert.
Dichtung benötigt ein Gleichgewicht aus Dichte und Atem- bzw. Luftzirkulation. Der „materie“-Zyklus, so bisweilen der Eindruck, schafft einen luftdichten Raum. Wörter, Wortfolgen und Neologismen ähneln dort Pflanzen, die provisorisch für die Produktion von Sauerstoff sorgen sollen. So lässt sich dieser Zyklus als Raum lesen, in dem inszeniert wird, wie ein Abschied von der Dichtung glücken, wie Dichtung durch zu viel Dichte erstickt werden kann.
Wer erwartet, im Zyklus „gebrochenes deutsch“ oder „umarmter augenblick“ Gedichte in gebrochenem Deutsch zu lesen, wird enttäuscht. Hier geht es weniger um ein „fehlerhaft“ gesprochenes oder geschriebenes Deutsch, bei dem zum Beispiel bestimmte Wortarten je nach syntaktischem Zusammenhang falsch flektiert würden. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Textpartien zwischen Versbeginn und Komma, Komma und Komma oder Komma und Versende in sich grammatikalisch fehlerhaft wären. Vielmehr geht es, in exzessiver Verwendung, um eine in der deutschsprachigen Literatur nur noch selten anzutreffende rhetorische Figur: das Anakoluth.
Werner Hamacher, der das Anakoluth als eine für die Geschichtsschreibung charakteristische Figur betrachtet und somit nicht nur dem Bereich der Rhetorik zuordnet, definiert es „als Abbruch der Kontinuität zwischen dem thematisch Gemeinten und seiner erzählenden Explikation“2 und weiterhin als „das Feld der Nicht-Korrespondenz von Anschauung und Bedeutung, von Phänomenalität und Substanz“.3
Geschichte ist […] diejenige Bewegung, in der zwei verschiedene sprachliche Funktionen, die repräsentative, die dem Bereich der Veranschaulichung und des sinnfällig gemachten Sinns zugehört, und die intentionslos thetische Funktion, die über die Veranschaulichung einer distinkten Bedeutung hinausschießt und insofern ohne kognitive Relevanz ist, auseinandertreten. Geschichte ereignet sich also im literarischen Text dort, wo die Sprache aus ihrer Entsprechungsfunktion heraustritt und damit zugleich ihre ästhetische und ihre Reflexionsschicht durchbricht.4
Paul de Man, zunächst Hamachers akademischer Lehrer und später diesem auch freundschaftlich verbunden,5
the permanent parabasis of an allegory (of figure), that is to say, irony. Irony is no longer a trope but the undoing of the deconstructive allegory of all tropological cognitions, the systematic undoing, in other words, of understanding.[footnote]Paul de Man: „Excuses (Confessions)“, in: ders.: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New Haven und London 1979, S. 278–301, hier: S. 301. Dieselbe Passage zitiert Werner Hamacher in: „Lectio. De Mans Imperativ“, in: ders.: Entferntes Verstehen, Frankfurt a.M. 1998, S. 151–194, hier: S. 192
Die poetische Funktion des Anakoluth6 – der Parekbase, der romantischen Ironie –, besteht also in der permanenten Störung und Unterminierung des tropologischen Sprachsystems, zu dem auch die Allegorie gehört und welches permanent, Verständigung und Vermittlung intendierend, eine Veranschaulichungsfunktion hat. Verstehen und die Bedingungen der Kommunikation gründen auf dieser anakoluthischen Störung als Entgrenzung des Formbewusstseins, durch die Hamacher deutlich machen kann,
daß weder gesellschaftliche Ereignisse noch solche der Literatur den Kategorien der Selbstreflexion und der sie begründenden Phänomenalität unterliegen und daß jede Geschichtsschreibung, die in diesen Kategorien, ob bewußt oder ohne ihr Wissen, fundiert ist, eine ästhetisierende Restriktion ihres Sachgebiets betreibt.7
Wer es in Falkners wemut zu einer Unterscheidung zwischen thematisch Gemeintem und erzählender Explikation bringen will, muss eine gehörige Distinktionswut mitbringen. Der erste Zyklus des Bandes beginnt mit einem Faust-Schlag. Überhaupt spielt Goethes Faust für das Verständnis von wemut eine wichtige Rolle. Das erste Zyklusgedicht, der „umarmte augenblick“ (7), ist eine Reminiszenz an Fausts berühmte Ansprache des Augenblicks:
Verweile doch! du bist so schön!
Es geht also um den Augenblick, den Augenschlag, den Lidschlag, das Sehen und Wahrnehmen von Eindrücken im weitesten Sinne. Falkners Augenblick verweilt schon im Gedichttitel für die Länge einer Umarmung, aber nur, um im letzten Vers Fausts Bitte an den Augenblick stillschweigend mitzuzitieren:
wie einer, für fliehendes leben, schweigende luft.
Man hat es zum ersten Mal mit der Aerofigur zu tun. Die Umarmung des Augenblicks könnte ein Zeichen der Dankbarkeit gerade dafür sein, dass es ihn als das Ephemere überhaupt gibt. Wehmut, das heißt aber auch Erinnerung, wäre ohne Vergehen – wie auch immer „Vergehen“ verstanden wird – nicht möglich. Isoliert man die letzte Zeile, gelangt man zum ersten Theorem des Bandes: Wie Hamacher verwirft der Vers die Idee, es gäbe so etwas wie eine Selbstreflexion des Textes, auch wenn man dazu tendiert, an die Begriffe ,Reflexion‘ oder ,Selbstreflexion‘ zu denken, sobald von Atem oder Luft die Rede ist. Damit nicht verworfen ist die Rede von einer Stimme des Textes. Somit führt der Vers die Unterscheidung ein zwischen Stimme der Schrift und Stimme als etwas Sonorem, Tönendem. Es gibt insofern keine Selbstreflexion des Textes, als die Schrift „schweigende luft“ ist. Die Schrift kann zwar von außen befragt werden, aber antworten wird sie nicht. Es liegt im Wesen der Schrift, zu schweigen. Plötzlich steht das lyrische Ich selbst auf dem Spiel. Denn streng genommen gibt es dieses nicht. Es gibt höchstens ein grammatikalisches Subjekt. Das Anakoluth „schweigende luft“8 täuscht eine Figur der Selbstreflexion an, nur um eine solche zu verwerfen.
Im Gedicht „rotverschiebung“ (9) aus demselben Zyklus kehrt das Problem der Selbstreflexion unter neuer Aeroperspektive wieder. Ausgerechnet das Verb ,atmen‘ wird als reflexives Verb verwendet:
doch alles
es war uns wohl so, atmete sich, eh mancher
mich wollte
[…]
doch waren, die blumen, die schönen, verloren
Rotverschiebung ist in der Astronomie eine Lageveränderung von Spektrallinien und in der Kosmologie eine Universum- bzw. Raumexpansion, die Galaxien mitbewegt Das Gedicht reißt viele Themengebiete an: Hoffnung, Seele, Einsamkeit, Selbstliebe oder -verliebtheit, Territorialansprüche, Natur, Schönheit, Verlust… In ihm wird das Anakoluth selbst zum Thema gemacht – als eine notwendige und / unberührte Parallelität, ja sogar als ein Paralleluniversum, das in keiner Relation zu anderen Universen steht. Vielleicht geht es auch um eine absolute Trennung, durch die eine Schonung des anderen Menschen, aber auch der Natur überhaupt erst möglich wäre. Vor der Lageveränderung, vor der Bewegung und Berührung des Anderen stand jeder und jede und alles nur im Verhältnis zu sich („alles / […] atmete sich“), wusste nichts davon. Keiner und keine und nichts wusste vom Anderen oder von sich, „es war uns wohl so“. Sobald der und die und das Andere kennengelernt wurden, setzte Erkenntnis ein, „ein teilnahmsloses verlangen“, ein sich Sehnen nach Nicht-Wissen und nach einer ursprünglichen unbekannten Gleichzeitigkeit zum Anderen und auch zu sich, „doch waren, die blumen, die schönen, verloren“.9 Der Status der Unschuld vor der Ursünde ist unwiederbringlich verloren. Vor ihr bedeutete das Sich-atmen keine Selbstreflexion, denn Selbstreflexion setzt Erkenntnisvermögen voraus, sondern ein Dahinvegetieren; nach ihr ist Selbstreflexion etwas Relationales und im Grunde immer das Verhältnis zum Anderen, sei es noch das Verhältnis des Ich zu sich, das heißt, des Selbst zum Selbst, des Ich zum Du, des Ich zum… Es ist die Wehmut nach verlorener gleichzeitiger Indifferenz und Differenzlosigkeit.
Das nächste Gedicht „hörbeet“ (10) bekräftigt den Verlust des Dahinvegetierens und des Nicht-Wissens-dass-man-atmet sowie das Sich-zurück-sehnen:
mich verlangte, ein blinder atemzug, wie von hoffnung
das innigste bild ist künftig davon, das durchstreifte
gänzlich verschieden
Mit „durchstreifte“ wird die astronomisch-kosmologisch-galaktische Metapher weitergeführt und selbst besagte absolute Trennung der Paralleluniversen taucht wieder auf („gänzlich verschieden“). Neu ist die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft („das innigste bild ist künftig davon“).
Im letzten Gedicht des Zyklus, „wermund“ (13), ist das thematisch Gemeinte offenbar: die „heimirrung“ des Dichters (?) und wie er „fragend“ zu sich selbst zu finden versucht. Man kann ,heimirrung‘ als eine Übertragung des Derrida’schen Begriffs der „destinerrance“ betrachten, auch mit ,Schickungsirre‘ oder ,Irrgeschick‘ übersetzbar. Mit dem formalen Einsatz des Anakoluths ist diese Heimirrung zugleich reine Formirrung, das heißt, der Versuch, die verlorene Vergangenheit in Form zu bringen. Die Bilderflut des Zyklus „gebrochenes deutsch oder der umarmte augenblick“, die immer wieder über das Thema des Verlustes und der Suche nach dem Verlorenen hinausgeht, kann das Verlorene in keiner Weise aufwiegen. Durch den exzessiven Einsatz des Anakoluths erfindet Falkner eine neue Form des Dichtens: ein Dichten unter Schnappatmung; ein auf Wehmut zurückzuführendes aphasisches Seufzen, das ein zusammenhängendes Sprechen verhindert; eine Suche nach der verlorenen Zeit; und sicher eine große Inszenierung von Wehmut aus „zusammenhängen des Atems“,10 wie Christoph Meckel es vielleicht formulieren würde.
Mit wemut nimmt Falkner – biographisch gesprochen – Abschied von sich selbst, indem er poetisch über sich selbst erzählt:
Die Erzählung der Geschichte ist Raub am Leben dessen, dem sie geschehen [ist]. Was bei der Erzählung der Geschichte geschieht, ist Abschied von der erfahrenen Geschichte. Und nur so ist die Erfahrung der Geschichtserzählung die Erfahrung der Geschichte noch einmal: nicht als Erlebnis, in das man sich wieder hineinleben, hinein- und einfühlen könnte und das sich in seiner Gegenwärtigkeit wieder und wieder reproduzieren ließe, sondern als Abschied vom eigenen und immer nur dem Scheine nach und auf Widerruf eigenen Leben, das erst im Schmerz des Abschieds als geschehenes und erst in der Gefahr seines Verlustes als erfahrenes, also immer erst post festum und unter den Bedingungen seines Verschwindens und nie als solches darstellbar ist. Was geschieht, ist Abschied.11
Und noch einmal: Den Schlusszyklus „materie“ kann man als Atemstillstand verstehen.
Das Register von wemut verändert sich völlig mit dem zweiten und dem dritten Zyklus „die kunst und der stille raum“ (15–29) und „silent rooms“ (31–45). Die relative Durchlässigkeit des Mittelteils wurde schon hervorgehoben. Darin expliziter wird auch die Arbeit am poetologischen Ansatz des Bandes, die im vierten Zyklus „gedichtbau & normalzeit“ (47–67) kulminiert, in dem die meisten Gedichte regelrecht als poetologische zu bezeichnen sind. Denkt man an stille Räume, an silent rooms, so unter Umständen an anechoic chambers, an (selbst-)reflexionsarme bis hin zu schalltoten Räumen, in denen wenig oder kein Schall reflektiert wird. Akustische bzw. Klangexperimente finden darin unter nahezu perfekten Bedingungen statt.12 Oder man denke an die überkonfessionellen Räume der Stille, die sich meistens an Transit- bzw. Nicht-Orten wie Bahnhöfen und Flughäfen, aber auch an Universitäten befinden. Paradoxerweise gelten solche Räume als Orte der Multikulturalität und des Dialogs zwischen Religionen, obwohl darin nicht geredet (und also keine Klangexperimente möglich sind), sondern meditiert und gebetet wird: vereinbartes Schweigen und schweigende Einkehr in die eigene Innerlichkeit als Zeichen der Toleranz. Innerlichkeit ist dem Thema „Wehmut“ notwendig. Aber auch die metaphysische und sehr problematische Trennung zwischen Innen und Außen spielt überhaupt eine große Rolle. So oder so: Die Gedichte im Mittelteil des Bandes sind durchaus als Räume der Stille zu verstehen. Ihre Sprache ist introvertiert, rücksichtsvoll und durchlässig-luftig-dialoghaft… vielleicht sogar typisch für (Nicht-)Orte des Sozialen, für öffentliche Plätze wie ein Flugzeug oder einen Mund, insofern er sich einem anderen Mund zuwendet: „etliche sind unter uns / wie piloten / passagiere im mund: worte / die zu ankömmlingen werden“, heißt es im Gedicht „die kunst und der stille raum“ (18).
Auf der Verdichtungsebene entspricht die Gesamtkomposition von wemut einer Cosinuskurve. Die höchsten Verdichtungs- und Klangkontraktionen befinden sich am Anfang und am Ende des Bandes. Ein Beispiel: Im vorletzten Zyklus „ich, bitte antworten!“ (147–158), der aus einem titellosen mehrstrophigen Langgedicht besteht, ist es die ,Schall‘-Bewegung selbst, die ins Zentrum eines virtuosen Klangspiels rückt:
kraniche habe ich gesehen und flußkrebse
spielhallen auf der bondstreet
ölfrüchte, frachter, startbahnkonsolen
rechnende händler und großrechner
überschallflugzeuge und schallschutzanlagen
lichtdetektorenen, schuldirektoren, schürzenträger
und rollschuhfahrer
filme, folien, beschichtungen, verschalte
beschälte, beschallte, lallende und stürzende
liebende beim auftreffen von alphateilchen
oder physiker in faradeyischen käfigen
wenn ich die sonne dazunehme und die fremde
ein treppenhaus der asams
einen altarflügel in gent, die fiatwerke
autobahnen, gärten, bauplätze
was will denn die sehnsucht?
sie will: ein ende der aufzählung.
Aber ein Ende der Aufzählung ist nicht in Sicht, wenn die Aufzählung nicht Quantitätslogiken (wie Inhalten und Motiven), sondern Qualitätslogiken (wie Klang) gehorcht. Das aber heißt, dass der Abschied von der Aufzählung, dass das Ende der Poesie nur ein Setzungsakt sein kann.
Dazu heißt es im Gedicht „wo menschen sind, ist paranoia“ (52) aus dem schon erwähnten poetologischen Zyklus „gedichtbau & normalzeit“:
ich will dich nimmer wieder
bei mir atem holen lassen
da stürzt du mich sonst
in augen wie brennende städte
da verstößt du mich sonst
auf die schemel des vergessens.
Wird hier das Selbstgespräch eines Dichters, der von der Dichtung Abschied nehmen möchte, poetisch inszeniert? Ist er etwa der Paranoide, wie der Gedichttitel andeutet? Gibt es atemlose, das heißt, zu dichte Dichtung? Gibt es erstickte Dichtung? Wenn das ein Selbstgespräch ist, dann kann man auch „du“ durch „ich“ ersetzen:
ich will [mich] nimmer wieder
bei mir atem holen lassen
da stürz[e] [ich] mich sonst
in augen wie brennende städte
da verstoß[e] ich [mich] sonst
auf die schemel des vergessens.
Der Dichter, der seine eigene Geschichte erzählt, um von sich als Dichter und von der Dichtung Abschied zu nehmen, indem er seinen Atem anhält, seine Luft kappt, ist auf dem Weg, eine Selbstkastration, ja sogar Selbstmord zu begehen. Vor diesem Hintergrund wird deutlicher, was Werner Hamacher meint mit der
Erfahrung der Geschichte noch einmal […] als Abschied vom eigenen und Immer nur dem Scheine nach und auf Widerruf eigenen Leben, das erst im Schmerz des Abschieds als geschehenes und erst in der Gefahr seines Verlustes als erfahrenes, also immer erst post festum und unter den Bedingungen seines Verschwindens und nie als solches darstellbar ist.
Das anschließende, mit „die irren“ (53) betitelte Gedicht kreist um dieselbe Problematik. Ob die Irren nicht die Dichter selbst sind? Die irren Dichter, die von ihren Gespinsten Abschied nehmen wollen? Von der Aerofigur her ist es das zentrale Gedicht von wemut. In voller Länge:
sie haben die seufzer von sich geworfen
weil keiner sie wollte
und stellen sich schützend
vor die gedämpfte welt
sie halten die äpfel des atems an
damit sie nicht schlagen
und den zorn wecken
der bei ihnen ruht
spinnweben werden sofort erdrosselt
daß sie keine konzerte mehr geben
spinnwebkonzerte
für zarte seelen.
Warum werden die Spinnweben erdrosselt und nicht vielmehr angezündet? Wie erdrosselt man überhaupt Spinnweben? Deshalb „erdrosselt“, weil es direkt an die Hälse, die Kehlen, „die äpfel des atems“ gehen soll.13 Zu nichts anderem als zum Selbstschutz verabschieden sich hier die Dichter von ihrer Dichtung. Sie schnüren sich ihre Hälse zu,
damit sie [die Kehlen] nicht [wie Glocken / Glotides] schlagen
und den zorn wecken
der bei ihnen ruht.
Bei ihnen? Bei wem? Bei den der Dichtung „Unverfallene[n]“? Den – und Falkners Formulierung ist hier ironisch – „zarte[n] seelen“? Sehr wahrscheinlich bei genau denen, deren einsichtsloser Zorn dazuführt, dass man sein Wortkunstwerk als „angstkunstwerk“ (54) empfindet.
In der zentralen Passage des vorletzten Zyklus, in der es um die Wiederherstellung des Schweigens geht, wird die Stunde, da die „äpfel des atems“ angehalten werden sollen, als „apfelsperrstunde“ (154) bezeichnet. Im Besonderen ist dieses Selbstverbot ein Inspirationsverbot, im Allgemeinen ein Sprachverbot, und der Genese des Wortes ,Adamsapfel‘ nach nimmt in dieser Sperre eher ein Erkenntnisunvermögen seinen Ursprung: „apfelsperrstunde“, „hölderlinsperre“ (vgl. 98) samt „griechenlands / götterprickelnde[r] luft“ (59), „sprachsperrbezirk“ (162).
Die poetische Sprache muss inspiriert werden, beseelt, behaucht, beatmet, belüftet… und zwar vor allem dort, wo mit Klang, ihn verdichtend, gespielt wird. Spannung bedarf der Entspannung, sonst wird es unerträglich. Am Ende muss Dichtung in dieser Harmonie stehen. Dies bekräftigt Falkner im Gedicht „der fuchs und die trauben“ (60):
ich atme hinaus auf klangrechen
[…]
[…]
[…] in stunden
so ruhelos sprudelnder luft.
Die Klangrechen sind hier das Objekt des Atmens. Das Ich atmet gezielt, und zwar auf das Webmuster, in die Verse hinein, durch sie hindurch, auf sie… als ob jene zu dichten Stellen der Gedichte – als träfen nur Spondeen aufeinander – brennen würden und deshalb auszupusten, auszumachen wären…
was ist denn der atem
anderes als asche, die uns kalt
aus dem mund fällt, vor die brennenden
füße
heißt es im poetologischen Gedicht „gedichtbau & normalzeit“ (66). Lapidar, zumal dieser Gedichtabschnitt ein direkter Brecht-Verweis ist („Lasst uns die Warnungen erneuern, / und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind!“), kann man sagen: In bestimmten Zusammenhängen gibt es auch brennende Versfüße.
Über das, was es heißt, wenn das Atmen ein Objekt des Atmens hat, geben zwei Zeilen aus dem Gedicht „pensées I“ (143) Aufschluss, welches keines hat:
muß für muß
veratmen alle tage
Das Objekt des Atmens in der Dichtung ist die Sprache. Das strukturierte Atmen bindet dort die Sprache; ebenso die Atempausen. Nicht nur, aber vor allem deswegen wird von gebundener Sprache gesprochen. Hier sind es die von der Sprache unberührten Tage, die veratmen. Anders gesagt: Das ungebundene Urchaos veratmet. Und umgekehrt wird das Atmen insofern von der Sprache strukturiert, als sie Luftlinien herstellt; das heißt auch, dass sie es selbst ist, die gelegentlich und fern jeden Willens Verse und (o-i-Klang-)Linien generiert:
tokio, orinoko, hongkong
die sprache stellt luftlinien her (S. 152).
Im letzten Gedicht „materie VI“ (166), in der vorletzten Zeile, des Bandes setzt Falkner schließlich den Atem ins Verhältnis zum Tod. „ausgetretener atem“ schreibt er und beschreibt damit seine Dichtung im Prozess des sich Verabschiedens von ihr. Es liegt im Wesen einer sich von sich selbst verabschiedenden Dichtung, eine Aeroaffäre zu sein, ein deflategate, ein verbotenes Druckablassen angesichts des angestrebten poetischen Gleichgewichts von Atem- oder Luftzirkulation und Dichte. Falkners Dichtung wirkt am Ende völlig erschöpft, aber nirgends im Gedichtband sind zum Beispiel so viele Wortneuschöpfungen wie hier anzutreffen. Als „deflated poetry“ ist Falkners Abschiedslyrik – und das ist das Paradoxe daran – zu dicht, so dass für den letzten Gedichte-Zyklus „materie“ das gilt, was sich im vorletzten Zyklus prophetisch ausgedrückt findet:
wird ein wort so dicht
daß sich sein sinn
der eigenen anziehung
nicht mehr erwehrt
stürzt er in sich (S. 156)
Falkners „deflated poetry“ in wemut kann man als Apologie des Buchstaben h verstehen. Das mag zunächst verwundern, tilgte doch Falkner selbst 1989 das h aus dem Wort ,Wehmut‘. Durch die Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 kam ,Wehmut‘ unangetastet. ,Wehmut‘ durfte weiterhin ,Wehmut‘ heißen (wohingegen zum Beispiel ,rauh‘ fortan ,rau‘ war). Nicht so bei Falkner, und zwar deshalb nicht, weil ihm der Buchstabe h heilig und daher gegen die Feindseligkeiten der Unverfallenen in Schutz zu nehmen ist.
In diesem Sinn tritt er in die Fußstapfen von Johann Georg Hamann, der 1773 die Neue Apologie des Buchstaben h14 schrieb, in der er sich auf einen „orthographischen Zweykampf“15 mit dem Philologen und Theologen Christian Tobias Damm um „einen unschuldigen Hauch […], den einige Sprachgrübler nicht einmal für einen Buchstaben haben erkennen wollen“,16 einließ. Während Damm vorschlägt, das h zu tilgen, weil es unartikuliert bleibt, macht Hamann zunächst die Bedeutung des h als eines „orthographischen Hülfsmittel[s] zur Deutlichkeit und besserer Bestimmung der Begriffe“17 geltend. Aber Hamanns Interesse am h geht weit darüber hinaus.
Thomas Schestag, der im Wintersemester 2000/2001 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main ein Seminar unter dem Titel „H: Aspirationen auf einen Buchstaben“ anbot, brachte in der Ankündigung des Seminars pointiert zum Ausdruck, was am h hängt:
Gegen die Behauptung, das H sei – unter anderem auch – bloß „ein Hauch, den einige Sprachgrübler nicht einmal für einen Buchstaben haben erkennen wollen“, bietet Johann Georg Hamann 1773 – pseudonym – eine Neue Apologie des Buchstaben h auf und unterstreicht die Notwendigkeit der durchs H geleisteten graphischen Distinktion. Acht Jahre später weiß Jean Paul in einem Brief: „Das H ist nichts als die starke Adspirazion, mit der man einen Vokal ausspricht; es ist kein Konsonant […], es ist kein Vokal.“ Weder bloß graphische Spur noch Phonem, weder mit- noch selbstlautend, einerseits – als Hauch – Inbegriff lebendiger Stimme, andererseits Inbegriff der Abgestorbenheit – stumme Letter –, stellt H alle kanonischen Fassungsversuche der Sprache, zwischen Selbst- und Mitbestimmung, Schrift und Verlautbarung, lebendigem und totem Leib, zur Disposition. Insbesondere dort, wo das H in Eigennamen einwandert und den Vorsatz autobiographischen Schreibens teilt. Gerade auch, wo – wie im Fall der französischen Sprache – das H nur graphisch in Erscheinung tritt, was Heinrich Heine, an einer Stelle seiner Memoiren, Klage über die Verballhornung seines Namens, im Französischen, zu „Un rien“ führen läßt. H markiert, je anders, das Milieu der parabiographischen Schriften von Hamann, Jean Paul, Heinrich Heine, Stendhal und Victor Hugo.
Ohne das h entfällt die graphische Distinktion der Wörter, sofern sie sich durch ein h voneinander unterscheiden. Hamanns Beispiel:
Der du für mich gestorben
Führ auch mein Herz und Sinn.18
Aber es liegt ohnehin im Wesen der Dichtung, durch graphische Distinktionslosigkeit das semantische Spektrum der Wörter und Worte zu erweitern. Dafür gibt es verschiedene poetische Wege: Ellipsen, Variierung von Groß- und Kleinschreibung etc. Aber das Wort ,wemut‘ ist insofern ein Spezialfall, als es in seinem semantischen Gehalt auch das Kapital der Dichtung betrifft: die Sprache. ,wemut‘ kann auch als ein ,we mute‘ verstanden/ausgesprochen/gehört werden: als ein ,wir stumm‘. Wenn Dichter sich zum Schweigen entschließen, gibt es überhaupt kein semantisches Spektrum mehr, das zu erweitern wäre. Das wäre fatal.
Darüber hinaus symbolisiert der in Falkners „deflated poetry“ fehlende Hauch h das Urchaos der Welt, in den wemut mündet („materie VI“). Urchaos bedeutet Indifferenz, Differenzlosigkeit, auch graphische Distinktionslosigkeit… Daher die gehörige Distinktionswut, die man mitbringen muss, wenn man Falkner liest. Im ersten und letzten Gedichte-Zyklus des Bandes ist diese Distinktionswut zum größten Teil erfolglos. Es ist das Urchaos selbst, das hier und dort zum Abschied lyrisch inszeniert wird.
Es gibt keine h-lose Dichtung. Jede Dichtung ist spirituell und, wie Hamann es sagen würde, eine „vom Vater in der Höhe“19 enthusiasmierte, berührte, behauchte, beseelte. Die Dichtung, die das nicht ist, möchte ich zuspitzend formulieren, verdient diesen Namen nicht. Damms Versuch, das h loszuwerden, richtet sich gegen die Verlebendigung des Buchstaben durch das h – „Der Geist ist es, der lebendig macht; der Buchstabe ist Fleisch“20 –; das bezeichnet Hamann als „orthographische Ketzerey“.21 Das heißt, er geht aus von der „Orthodoxie meiner Orthographie“.22 Jede Absetzungsbewegung von ihr bedeutete: „Stumme Gräuel und Seelenmord!“23 An der Sprache. Immer wieder akzentuiert Hamann die Unschuld des h. Diese Unschuld aus dem Fleisch der Orthographie zu köpfen,24 hätte für ihn eine „babylonische Verwirrung“25 zur Folge und würde eine „orthographische Sündflut“26 auslösen. Als Abschied und Absetzung von der Orthodoxie der Orthographie ist wemut ein Paradebeispiel.27 Mit dem Wort ,wemut‘, dem ersten Wort des Gedichtbandes, beginnt die babylonische Verwirrung.
Weil er einen Seelenmord an der Sprache plant, gehört auch Damm zu den Unverfallenen. Auch ihm eignet ein antilyrischer Affekt. Bevor man mit seiner Dichtung in der Öffentlichkeit hausieren geht und sie bei einem Mordanschlag auf dem Markt ums Leben kommt, bringt man sie selbst um. Das ist die Apologie. Aber Gerhard Falkner hat nach wemut nie aufgehört, Gedichtbände zu veröffentlichen. Er ist eben ein h-Mann.
Alexandru Bulucz aus Constantin Lieb, Hermann Korte und Peter Geist (Hrsg.): Materie: Poesie. Zum Werk Gerhard Falkners, Universitätsverlag Winter, 2018
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Ursula Krechel: Letzte Ausfahrt, erste Krise
Süddeutsche Zeitung, 10.10.1989
Michael Maar: Kains Schneemann. Gerhard Falkners staunenswerte Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.11.1989
Thomas Zenke: Krise. Über Gerhard Falkner
Die Zeit, 8.12.1989
Joachim Sartorius: Einer im Tremens
die tageszeitung, 2.3.1990
Charitas Jenny-Ebeling: Sprachverfallenheit
Neue Zürcher Zeitung, 9.3.1990
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IZA + KLG + PIA + Laudatio
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + deutsche FOTOTHEK + Dirk Skibas Autorenporträts + Galerie Foto Gezett + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001.


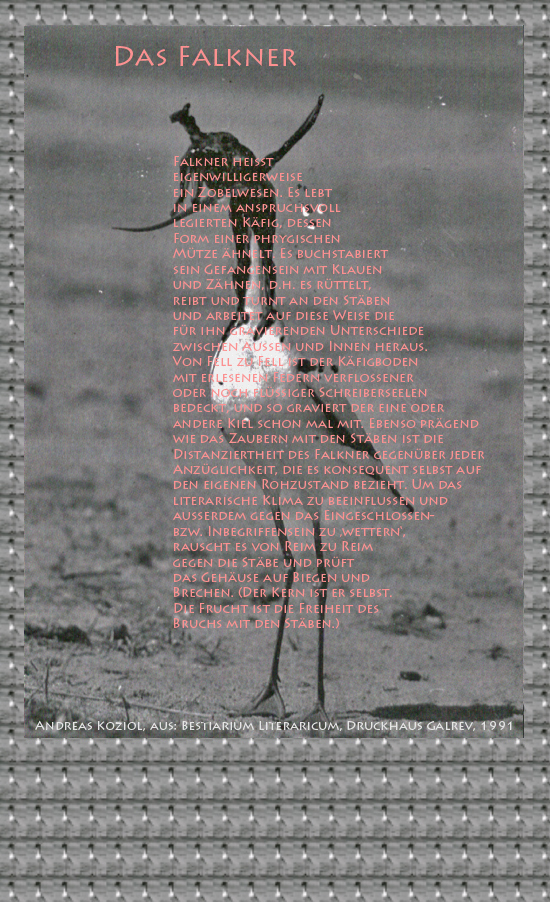












0 Kommentare