Gerhard Oberlin: Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Abend“
– Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Abend“. –
RAINER MARIA RILKE
Abend
Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder,
ein himmelfahrendes und eins, das fällt;
und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt –
und lassen dir (unsäglich zu entwirrn)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so daß es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
1904 (?)
Kommentar
„Stein“ oder „Gestirn“ – fallen oder steigen – Schwere oder Schwebe? Rilkes Anthropologie sucht immer wieder Bilder für das menschliche Zwittersein, seine Binatur, seine Gespaltenheit oder, um es positiv zu formulieren, seine Zugehörigkeit zu zwei Welten, von denen die eine Natur oder Leben, die andere Geist heißt oder (Schopenhauerisch) Wille und Vorstellung, auch Kosmos und Individuum.
Es ist die Doppelnatur, die ihn bereichert, aber mit ihren Konfliktstoffen auch ruiniert; die ihm eine doppelte Heimat beschert, was auf keine Heimat hinausläuft. Die doppelte Zugehörigkeit bedeutet auch doppelte Ungeborgenheit und vor allem einen permanenten Kampf gegen sich selbst. Der Mensch ist nicht nur sein eigener, er ist jedermanns Feind und sein metaphysischer Drang stürzt ihn immer wieder in hoffnungslosen Nihilismus.
Das Naturbild des Gedichts ist vielen so oder so ähnlich vor Augen gekommen: ein durch eine Luftmassengrenze geteilter Himmel, wie Rilke ihn im Sommer 1904 in Schweden real erlebte:
Es war der Abend eines sehr windigen Tages, und der breite Sturm schob einen ungeheuren, nachtgrauen Wolkenkontinent über den Himmel hin und machte die Sonne frei, die sank –, so daß zwei Meere darunter lagen, von einem Streifen blendenden Glanzes getrennt: ein ganz beschattet graues, verhaltenes, schweres neben einem leichten, bewegten, glänzenden, das weithin und ohne Ende zitterte und sich aufgeregt plusterte.1
Der Eindruck im Gedicht, das mystische Aufblicken zum Himmel sei mit der Erdenschwere, der reinen Körperlichkeit nicht zu vereinbaren, versteht sich keineswegs von selbst. Nicht jeder Heilige war Asket. Realismus und Idealismus gehen zusammen, wenn aus Augenmaß nicht Vermessenheit wird und Natur und Kultur kein Gegensatzpaar bilden. Erfüllte Körperlichkeit, das wusste Rilke aus der Lebensreform-Bewegung, schloss Spiritualität keineswegs aus.
Die elegische Abend-Klage dieses Gedichts scheint daher auf den ersten Blick ein Widerruf gegen kulturanthropologische Beschwichtigung und décadence-Therapeuten. Doch liegt in dem „du schaust“ der Naturbetrachtung ein Aufruf zur demutsvollen Achtung des Geschehens und zum Zusammenschluss (oder dem Ertragen) der Pole.
Der Befund des ,Zwischenweltlichen‘ ist für Rilke nicht nur anthropologisch grundiert, sondern auch kulturgeschichtlich indiziert. Zwischen Bürgerlichem Zeitalter und Moderne muss er den Anachronismus des Jugendstils mit den Forderungen nach Abstraktion verbinden. Dass ihm angesichts dieser Aufgabe sein „Leben bang und riesenhaft und reifend“ erscheint, ist unter diesen Umständen so gut zu verstehen, wie es letztlich eine gute Nachricht ist.
Gerhard Oberlin, aus Gerhard Oberlin: Rilke verstehen. Text + Deutung, Königshausen & Neumann, 2022



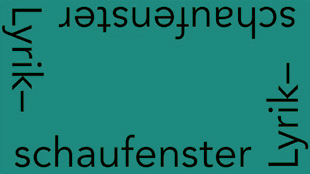
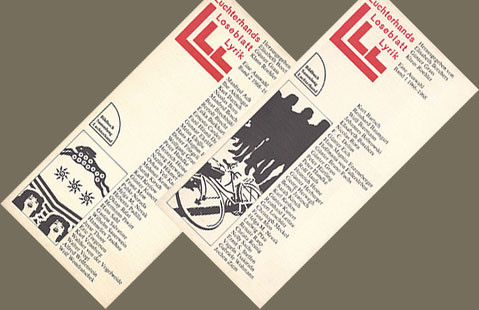



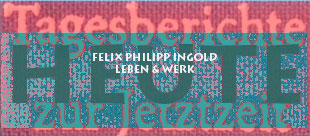
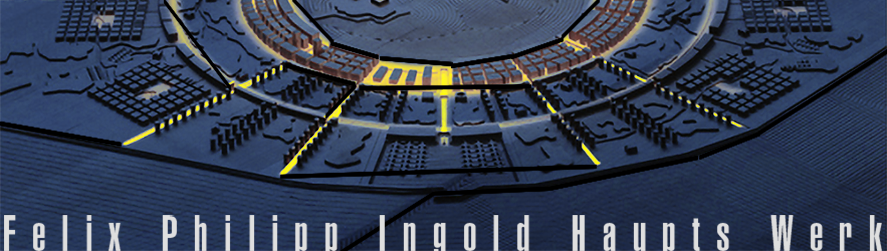
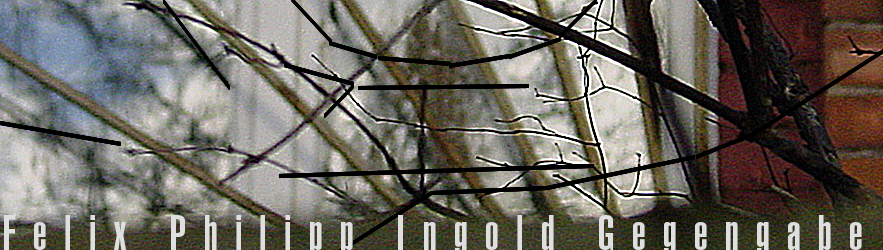
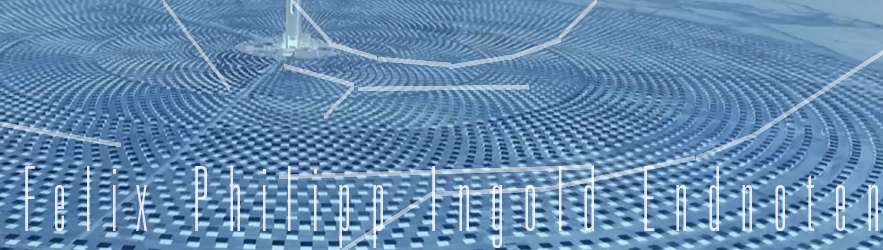

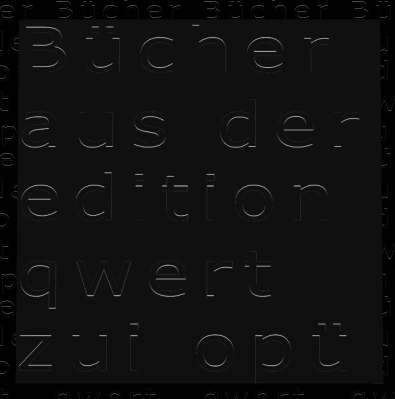
Schreibe einen Kommentar