Gerhard Oberlin: Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Die zehnte Elegie“
– Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Die zehnte Elegie“. –
RAINER MARIA RILKE
Die zehnte Elegie
Daß ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Einsicht,
Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln.
Daß von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens
keiner versage an weichen, zweifelnden oder
reißenden Saiten. Daß mich mein strömendes Antlitz
glänzender mache; daß das unscheinbare Weinen
blühe. O wie werdet ihr dann, Nächte, mir lieb sein,
gehärmte. Daß ich euch knieender nicht, untröstliche Schwestern,
hinnahm, nicht in euer gelöstes
Haar mich gelöster ergab. Wir, Vergeuder der Schmerzen.
Wie wir sie absehn voraus, in die traurige Dauer,
ob sie nicht enden vielleicht. Sie aber sind ja
unser winterwähriges Laub, unser dunkeles Sinngrün,
eine der Zeiten des heimlichen Jahre –, nicht nur
Zeit –, sind Stelle, Siedelung, Lager, Boden, Wohnort.
Freilich, wehe, wie fremd sind die Gassen der Leid-Stadt,
wo in der falschen, aus Übertönung gemachten
Stille, stark, aus der Gußform des Leeren der Ausguß
prahlt: der vergoldete Lärm, das platzende Denkmal.
O, wie spurlos zerträte ein Engel ihnen den Trostmarkt,
den die Kirche begrenzt, ihre fertig gekaufte:
reinlich und zu und enttäuscht wie ein Postamt am Sonntag.
Draußen aber kräuseln sich immer die Ränder von Jahrmarkt.
Schaukeln der Freiheit! Taucher und Gaukler des Eifers!
Und des behübschten Glücks figürliche Schießstatt,
wo es zappelt von Ziel und sich blechern benimmt,
wenn ein Geschickterer trifft. Von Beifall zu Zufall
taumelt er weiter; denn Buden jeglicher Neugier
werben, trommeln und plärrn. Für Erwachsene aber
ist noch besonders zu sehn, wie das Geld sich vermehrt, anatomisch,
nicht zur Belustigung nur: der Geschlechtsteil des Gelds,
alles, das Ganze, der Vorgang –, das unterrichtet und macht
fruchtbar . . . . . . .
… Oh aber gleich darüber hinaus,
hinter der letzten Planke, beklebt mit Plakaten des „Todlos“,
jenes bitteren Biers, das den Trinkenden süß scheint,
wenn sie immer dazu frische Zerstreuungen kaun…,
gleich im Rücken der Planke, gleich dahinter, ists wirklich.
Kinder spielen, und Liebende halten einander abseits,
ernst, im ärmlichen Gras, und Hunde haben Natur.
Weiter noch zieht es den Jüngling; vielleicht, daß er eine junge
Klage liebt….. Hinter ihr her kommt er in Wiesen. Sie sagt:
– Weit. Wir wohnen dort draußen . . . . .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWo? Und der Jüngling
folgt. Ihn rührt ihre Haltung. Die Schulter, der Hals –, vielleicht
ist sie von herrlicher Herkunft. Aber er läßt sie, kehrt um,
wendet sich, winkt … Was solls? Sie ist eine Klage.
Nur die jungen Toten, im ersten Zustand
zeitlosen Gleichmuts, dem der Entwöhnung,
folgen ihr liebend. Mädchen
wartet sie ab und befreundet sie. Zeigt ihnen leise,
was sie an sich hat. Perlen des Leids und die feinen
Schleier der Duldung. – Mit Jünglingen geht sie
schweigend.
Aber dort, wo sie wohnen, im Tal, der Älteren eine, der Klagen,
nimmt sich des Jünglinges an, wenn er fragt: – Wir waren,
sagt sie, ein Großes Geschlecht, einmal, wir Klagen. Die Väter
trieben den Bergbau dort in dem großen Gebirg; bei Menschen
findest du manchmal ein Stück geschliffenes Ur-Leid
oder, aus altem Vulkan, schlackig versteinerten Zorn.
Ja, das stammte von dort. Einst waren wir reich. –
Und sie leitet ihn leicht durch die weite Landschaft der Klagen,
zeigt ihm die Säulen der Tempel oder die Trümmer
jener Burgen, von wo Klage-Fürsten das Land
einstens weise beherrscht. Zeigt ihm die hohen
Tränenbäume und Felder blühender Wehmut,
(Lebendige kennen sie nur als sanftes Blattwerk);
zeigt ihm die Tiere der Trauer, weidend, – und manchmal
schreckt ein Vogel und zieht, flach ihnen fliegend durchs Aufschaun,
weithin das schriftliche Bild seines vereinsamten Schreis. –
Abends führt sie ihn hin zu den Gräbern der Alten
aus dem Klage-Geschlecht, den Sibyllen und Warn-Herrn.
Naht aber Nacht, so wandeln sie leiser, und bald
mondets empor, das über Alles
wachende Grab-Mal. Brüderlich jenem am Nil,
der erhabene Sphinx –: der verschwiegenen Kammer
Antlitz.
Und sie staunen dem krönlichen Haupt, das für immer,
schweigend, der Menschen Gesicht
auf die Waage der Sterne gelegt.
Nicht erfaßt es sein Blick, im Frühtod
schwindelnd. Aber ihr Schaun,
hinter dem Pschent-Rand hervor, scheucht es die Eule. Und sie,
streifend im langsamen Abstrich die Wange entlang,
jene der reifesten Rundung,
zeichnet weich in das neue
Totengehör, über ein doppelt
aufgeschlagenes Blatt, den unbeschreiblichen Umriß.
Und höher, die Sterne. Neue. Die Sterne des Leidlands.
Langsam nennt sie die Klage: „Hier,
siehe: den ,Reiter‘, den ,Stab‘,und das vollere Sternbild
nennen sie: ,Fruchtkranz‘. Dann, weiter, dem Pol zu:
,Wiege‘, ,Weg‘; ,das Brennende Buch‘, ,Puppe‘, Fenster‘.
Aber im südlichen Himmel, rein wie im Innern
einer gesegneten Hand, das klar erglänzende ,M‘,
das die Mütter bedeutet . . . . .“
Doch der Tote muß fort, und schweigend bringt ihn die ältere
Klage bis an die Talschlucht,
wo es schimmert im Mondschein:
die Quelle der Freude. In Ehrfurcht
nennt sie sie, sagt; „Bei den Menschen
ist sie ein tragender Strom.“
Stehn am Fuß des Gebirgs.
Und da umarmt sie ihn, weinend.
Einsam steigt er dahin, in die Berge des Ur-Leids.
Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los.
Aber erweckten sie uns, die unendlich Toten, ein Gleichnis,
siehe, sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren
Hasel, die hängenden, oder
meinten den Regen, der fällt auf dunkles Erdreich im Frühjahr. –
Und wir, die an steigendes Glück
denken, empfänden die Rührung,
die uns beinah bestürzt,
wenn ein Glückliches fällt.
1912–22
Kommentar
Der Abschied vom monumentalen Stil der Distichen mündet am Ende dieser Elegie in ein kleines Gedicht, das den Glauben an Mehr, Höher, Weiter: an die Maximierung des Glücks durch Wohlleben und Sentiment auf den Kopf stellt:
Und wir, die an steigendes Glück
denken, empfänden die Rührung,
die uns beinah bestürzt,
wenn ein Glückliches fällt.
Die Antinomie „steigen“/„fallen“ trägt eine ähnliche (und allerdings nicht-moralische) Weisheit, wie sie der Volksmund unter der Formel kennt:
Hochmut kommt vor dem Fall.
Wer sie im Ohr hat und das Gedicht noch einmal von vorne liest, versteht, weshalb es einer Gegenkultur, nämlich z.B. der altägyptischen, bedarf, um das tote Lebendige gegen das lebendige Tote zu halten.
Rilke verarbeitet hier seine Ägyptenreise, die sonst fast spurlos geblieben wäre, da er sie in absorbierender Gesellschaft verbrachte. Mit seinem „behübschten Glück“ erinnert er an den Ring des Polykrates, jene Ballade, in der Friedrich Schiller Menschen mit viel Glück viel Unglück verheißt und empfiehlt:
Drum, willst du dich vor Leid bewahren,
So flehe zu den Unsichtbaren,
Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn1
Der Dichter zeichnet nun eine mythopoetische „Leid-Stadt“, deren Kulisse und Akteure Rudolf Kassners kulturpessimistische Geißelung der Moderne illustrieren, die dieser als maskenhaft, theatralisch und weltfremd erlebt. Die Charakteristik des gesellschaftlichen Treibens als „Trostmarkt“ bringt den „Jahrmarkt“ der Eitelkeiten mit der Rolle von Hedonismus, Amüsement und Traumfabrik („frische Zerstreuungen“) zusammen.
Wieder sind es inmitten der Spiegelwelt die „Liebenden“, die eine Gegenwelt markieren. Von einem „Jüngling“ ist die Rede, der eine „Klage“ liebt: vielleicht Orpheus, der Kitharode, der seine verstorbene Geliebte aus der Unterwelt führt und – verliert, weil er sich nach ihr umdreht („wendet sich, winkt“).
Damit aber wendet sich auch die Szene ins Altertum, die Zeit der Pharaonen, Totenkulte, Orakel („Sibyllen“). Die Rede von einem „Klage-Geschlecht“ deutet auf leidnahes, authentisches Leben, begleitet vom allgegenwärtigen, alles prägenden authentischen Tod. Wer von den alten Herrschern wann, wo und wie „weise“ regierte, bleibt ohne historischen Beleg, wenn man von der „Pschent“ (griech. Ψχέντ [pskhént]) absieht, jener rot-weißen Doppelkrone der Pharaonen, mit der das archaische Reich im Zusammenschluss von Ober- und Unterägypten im dritten Jahrtausend begann.
Das angerissene Narrativ von der Nilquelle, aus der „ein tragender Strom“ wird – oder ist es der Acheron? – lässt die Wasser der Erde, assoziiert mit Tod und Leben, den Menschen zum Segen gereichen und beschwört eine Szene herauf, die mit dem „Stab“ – einem Thyrsos? – und einem „Fruchtkranz“ auf ein dionysisches Äquinoktal- oder Erntefest verweist, wie es z.B. in Delphi gefeiert wurde. Der mythische Raum scheint – bei aller Paradoxie – eine vor Lebensfreude strotzende Unterwelt zu sein, voller Zukunft, voll gegenweltlicher Eigenschaften, die mit dem authentischen „Urleid“ das seichte „Glück“ der Gegenwärtigen in den Schatten stellen.
Vieles in dieser letzten und manches in den anderen Elegien will kaum erschlossen werden und bleibt im Dunkeln. Der Andeutungsstil geht gerade hier so weit, dass man ihn fraglos respektieren und nicht erst legitimieren muss, indem man im übrigen Werk, in den Briefen oder Tagebüchern herumstochert und findig auf Brücken stößt. Rilke forciert jetzt das Enigma, das Öffentlichkeit entweder ein- oder ausschließt. Mit dem Andeutungsmosaik, auch wenn es einem unvollständigen Puzzle gleicht, geht er an die Grenze des Sagbaren, ohne doch das „Unsägliche“ zu mystifizieren.
So ist es also nicht das hermetische Siegel der Ägypter und Griechen oder das esoterische Tabu der Mysterienkulte, das vor dem „Geheimnisverrat“ schützt, sondern die minimalistische Darstellung der Darstellungsmittel, die zur äußersten Abstraktion und sei es zur leeren Fläche führt. Wie beim Malen einer leeren Leinwand auf eine wiederum leere Leinwand macht sich das Fehlen eines Gegenstands an sich zum Motiv. Wird das Darstellungsmittel selbst zum Objekt, scheint kein Objekt mehr zu existieren. Die Botschaft des leeren Bildes ist dann keine Botschaft – oder mit Wittgenstein zu sprechen (der Rilke materiell förderte):
Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.2
So bleibt es bei der Vision der Vision der Vision … Das poetische Bild als Ganzes trägt nicht mehr. Die Sprache als ganze trägt nicht mehr. Die Mittel sind ausgereizt und verbraucht. Das Gedicht bedeutet nicht, es ist.
Es ist vielleicht Musik! Tatsächlich drängt sich nach all diesen Elegien, am meisten aber nach der „Zehnten“, die Frage auf, ob wir es nicht mit einem Notenbild in Worten zu tun haben, die sich zu keiner Melodie, wohl aber einem Zwölfton-Cluster verdichten.
Gerhard Oberlin, aus Gerhard Oberlin: Rilke verstehen. Text + Deutung, Königshausen & Neumann, 2022



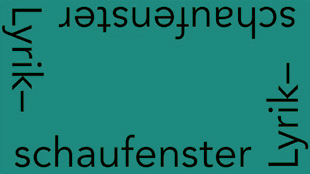
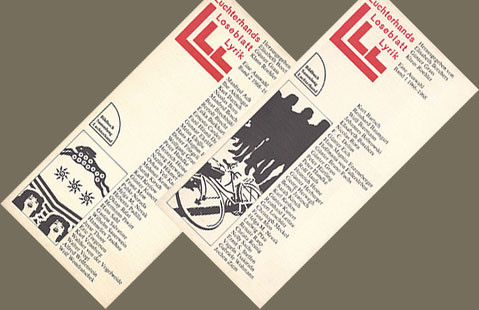



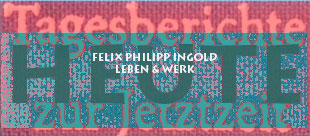
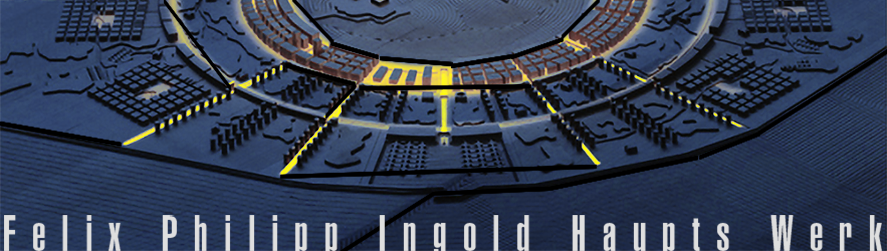
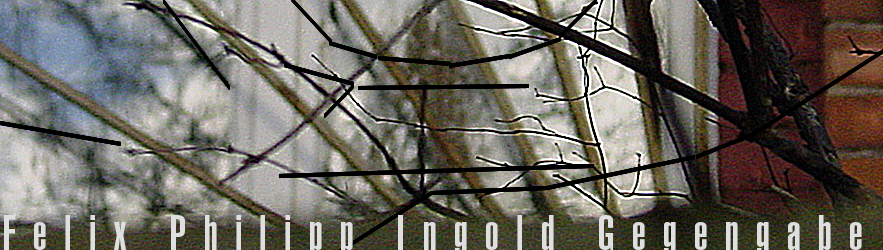
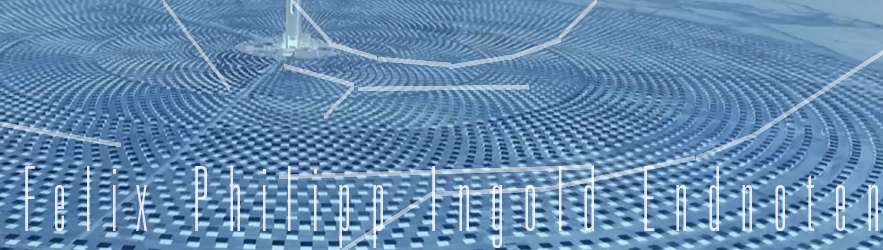

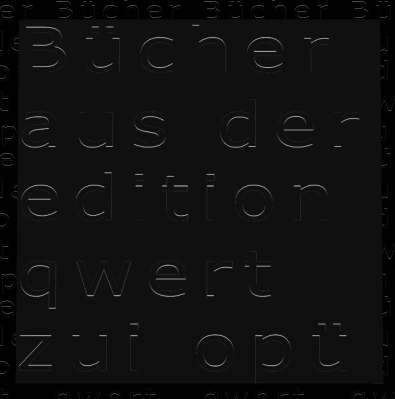
Schreibe einen Kommentar