Gerhard R. Kaiser (Hrsg.): Landschaft als literarischer Text
LANDSCHAFT ALS LITERARISCHER TEXT
– Ein Eingrenzungsversuch. –
Es gibt Begriffe, die mehrdeutig sind und deren Bedeutungsränder merklich ausfransen und zerfasern. Die Bezeichnung „Landschaft“, bereits im Althochdeutschen nachgewiesen, meint so verschiedene Sachverhalte, daß dies dank der damit verbundenen beträchtlichen Streubreite zu Verschwommenheiten geführt hat. Das Diffuse, Zerfließende, das sich der Sprachgebrauch angelegen sein läßt, zieht Auflösungserscheinungen nach sich, so daß der ursprünglich doch einmal ziemlich fest zu umreißende Wortwert zusehends an Bedeutung verliert und zu einem Suffix zu verkommen droht. Eine der Schwierigkeiten könnte darin liegen, daß Landschaft sowohl Abstraktum als Konkretum ist, aber mehr Abstraktum als Konkretum. Begriffe, die sich nicht so ohne weiteres auf den Punkt bringen lassen, schweben und schwingen. Bei Hammer und Amboß gibt es diese vertrackten Probleme nicht.
Um mich zu vergewissern, habe ich einige Wörterbücher befragt. Adelung unterscheidet zwei Grundbedeutungen. Zum ersten als Ableitung von Land eine Provinz. Zum anderen steht die Bezeichnung im Gegensatz zur Stadt, meint „eine Gegend auf dem Lande, so wie sie sich dem Auge darstellet“. Davon abgezogen dann die künstlerische Darstellung einer solchen ländlichen Szenerie. Grimm unterscheidet sieben Bedeutungen, ausgehend von dem Komplex „zusammenhängender landstrich“. Erstens die natürliche Beschaffenheit einer Gegend, zweitens die bildliche Darstellung, drittens die Region „als ein sozial zusammenhängendes ganzes“. Die restlichen muß ich nicht ausbreiten, da sie für mein Landschaftsverständnis irrelevant sind. In Sanders’ Handwörterbuch (1888) wird als vierte Begriffserklärung angeführt:
Eine Gegend nach dem Eindruck, den die (leblose) Natur dort auf den Beschauer macht.
Allzu pauschalisierend mit verwischenden Verkürzungen wird Landschaft im Etymologischen Wörterbuch des Deutschen (1995) abgehandelt. Immerhin nehme ich davon an:
Geographisch zusammenhängendes Gebiet mit einem bestimmten Charakter, mit bestimmten Eigenschaften.
Mir verbleibt nun, das reichlich unbestimmt bleibende „Bestimmte“ näher auszuführen.
Mehrere Fachdisziplinen, vor allem Geographie und Botanik, reklamieren „Landschaft“ in streng abgegrenzter Bedeutung, wobei die Einbeziehung ästhetischer Aspekte zumeist empfindlich stört. Die zahlreichen Begriffsbeschreibungen und Definitionsbemühungen gehen jeweils von terrestrischen Gegebenheiten aus. Soziale Strukturen bleiben dabei fast immer außer Betracht. Landschaft bleibt so sehr oft ein allgemeiner, beliebiger Naturausschnitt. Und am Ende wird Landschaft als blanke Natur genommen oder als das, was an unbebautem Terrain als Natur deklariert wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch beginnen sich beide Begriffe zu verwischen und in eins zu gehen, für ein und dasselbe gehalten zu werden. Wie oft bin ich nicht schon der Kategorie „Naturdichter“ zugeschlagen worden, obwohl ich ein ausgesprochener Landschafter bin. Da Landschaft für mich im Zentrum aller Textierung steht, liegt es nahe, über individuelle Vorstellung und Verwendung zu reden. Je länger die Vorüberlegungen zu einer Erörterung währen, die nur auf eine annähernde Umschreibung hinauslaufen kann, desto mehr festigt sich die Einbildung, jeder sieht seine Landschaft. Der Begriff muß soviel Variabilität zulassen, daß er personengebunden ist. Jeder nimmt sich heraus, was ihm frommt, ähnlich wie es dem Wort „Demokratie“ in gegenwärtigen Zeitläuften ergeht. Umso zwingender, sich dank einer gebotenen Gelegenheit zu erklären.
Als ich in den letzten Dezembertagen des Jahres 1964 das Programmgedicht „die erde bei Meißen“ entwarf, lag dem das Eingeständnis zugrunde, nur das gestalten zu können, was ich kenne. Den entscheidenden Impuls, mich auf ein Segment zu beschränken, das pars pro toto für Welt steht, gab Johannes Bobrowski mit seinem „sarmatischen Diwan“. Als unmittelbare Schubkraft beim Schreiben kam mir die Lektüre des Romans Levins Mühle zustatten. Entscheidend für die thematische Beschränkung auf eine Region, in der ich bis 1957 gelebt und zu der ich inzwischen nicht nur räumlichen Abstand gewonnen hatte, war zugleich die Gewißheit, bei der literarischen Landnahme frei verfügen zu können, da ich keinen vor mir sah, der diese Landschaft textiert hatte. Alle theoretischen und auch poetologischen Einsichten wuchsen erst allmählich. Sie liefen mehr oder weniger parallel zum Schreibprozeß, der in erster Linie auf Gedichte zuhielt, in denen ich, von Stufe zu Stufe wechselnd und erweiternd, beispielhafte Poesie sah. Gleichzeitig spielten aber auch die Negativbeispiele, von denen es sich abzustoßen galt, eine beflügelnde Rolle.
Zudem flogen mir bei der Lektüre Äußerungen zu, von denen Bestärkung ausging. Die Literaturwissenschaftlerin und Lyrikerin Britta Titel setzt in ihrer Studie zu Bobrowskis Lyrik einen scharfen Trennstrich:
Obgleich Gegenstände der Natur – Vegetation und Getier, die Erscheinungen des Wetters, die Elemente, geologische Formen: Hügel, Hang und Berg und Ebene in die Gedichte eingehen, zögert man, diese als Naturlyrik zu bezeichnen; denn es ist eigentlich das Landschaftliche, das vorherrscht. Natur und Landschaft sind zweierlei: Natur ist überall Natur, Landschaft aber ist überall anders; und gerade das Eigentümliche von Landschaften in ihrer geographischen, ethnographischen, historischen und kulturgeschichtlichen Prägung sucht Bobrowski zu fassen. Alle seine Gedichte, wie sie auch betitelt sein mögen – „Der litauische Brunnen“, „Das Holzhaus über der Wilia“, „Die Memel“, „Der Ilmensee 1941“, – atmen landschaftliche Eigenart. (Johannes Bobrowski. Selbstzeugnisse und Beiträge über sein Werk, Berlin 1967.)
Als Stachel unter den Merksätzen wirkte Bismarcks Bemerkung:
Die Kunst landschaftlicher Schilderung besteht nicht darin, eine ganze Landschaft getreulich abzumalen, sondern vielmehr darin, den einen Punkt zu entdecken, wodurch sich diese Landschaft von jeder anderen unterscheidet.
Ein weiterer entscheidender Aspekt, der mich Abgrenzung auch im politischen Sinne lehrte, war Bobrowskis literarischer Welt-Anschauung zu entnehmen. Der Staat, in dem ich lebte, und das Land, das mir als Herkunftslandschaft zufälligerweise mitgegeben wurde und das ich mittels Poesie in Besitz zu nehmen trachtete, waren nicht identisch. Ich konnte mich auf eine geschichtsträchtige Landschaft und deren Bewohner von weitaus langlebigerer Konsistenz berufen. Außerdem forderte ein Staats-Gebäude, das aus Falsifikationen und Lügen gebaut war, zur Kritik, wenn nicht zunehmend zur Ablehnung heraus. Mir ging es um eine unverstellte Selbstentfaltung, die nicht auf Gegnerschaft aus war, aber Distanz zur offiziellen Sprachregelung erkennen ließ. Mehr dazu habe ich in dem Aufsatz „Gegensprache im Gedicht“ ausgeführt.
Obwohl es auf der Hand liegt, sollte ich vielleicht doch expressis verbis hinzusetzen: Landschaft, unter der jeweils eine real vorhandene Region verstanden wird, ermöglicht mir, der vielbeschworenen, ideologisch überstrapazierten sowie vielgeschmähten „Heimat“ begrifflich zu entkommen. Auch dies eine bewußte Form der Abgrenzung. Dieses Recht nehme ich mir heraus, wohl wissend, daß Heimat, ein Wort, das nicht mehr wertfrei zu besetzen ist, als emotional aufgeladener Raum tatsächlich vorhanden ist, unabhängig davon, was ich von dem Begriff halte, wie strikt ich ihn weiträumig auch immer zu umgehen bemüht bin.
Zwar bin ich seit der frühen Lektüre von Albert Soergels Literaturgeschichte, die mir einführende Vorstellungen vom Expressionismus vermittelte, mit Warngedichten konfrontiert gewesen, die das Weltende prophezeiten. Aber dies blieb doch in unbestimmte Ferne gerückt, wenn nicht metaphorisch verklausulierte Utopie. Erst als ich von 1969 an gezielt begann, mich mit ökologischen Problemen zu befassen und dabei neue Einsichten gewann, die den Prozeß eines bruchhaft einschneidenden Umdenkens einleiteten, rückten mir die Prophezeiungen von Else Lasker-Schüler und Jakob van Hoddis so erschreckend nah auf den Leib, daß mir bewußt wurde, alles, was sich noch auf Heile-Welt-Positionen zurückziehen zu können glaubte, lag hinter mir. Zu diesem biografischen Einschnitt zählt zum einen ein freiwilliger Arbeitseinsatz in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der mich mit der einsetzenden Massentierhaltung und in statu nascendi befindlichen Kooperativen konfrontierte. Mit derlei Abschreckungen versehen, wurde mir zur Gewißheit: Darstellung moderner Landwirtschaft kann nicht mein Thema sein. Zum anderen gab es um diese Zeit noch den Ratschlag Reiner Kunzes bei einem der Besuche in Greiz, wenn ich schon Land, Landwirtschaft, Landschaft thematisiere, müsse ich mich auch um die damit verbundenen ökologischen Probleme kümmern. Ich habe mir dies gesagt sein lassen, ohne darauf zu verfallen, Landschaft nur noch ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt zu sehen.
Die ökologisch verheerenden Destabilisierungen lassen leicht erkennen, daß Natur, soweit in geschützten Refugien und als museales Relikt überhaupt noch vorhanden, nicht separiert von den dominierenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Nutzungspraxis existiert. Und soweit Landwirtschaft noch auf natürliche Wachstumsprozesse unter freiem Himmel basiert, wird dies eher notgedrungen in Kauf genommen. Ohne chemisierte Pflanzenzucht und manipulatorische Eingriffe, die auf Ertragssteigerung setzen, ist moderne industrialisierte Großflächenwirtschaft offensichtlich nicht mehr aufrecht zu erhalten. Mit althergebrachten Methoden genutzte Flächen fallen dabei nicht ins Gewicht. So rücken naturbelassene Areale immer weiter in Randpositionen. Rückgewinnung einmal vernutzter, zerstörter Flächen ist nur partiell und mit enormem Kostenaufwand möglich. Von Umkehrabsichten keine Spur. Allein vielleicht deshalb nicht, weil die Möglichkeiten dafür längst verbaut und verspielt sind.
Auf Grund der nur grob skizzierten Problematik ist es anachronistisch, Natur und Landschaft in eins gehen zu lassen, keine Unterscheidung zu treffen oder es noch auf Naturlyrik absehen zu wollen. Natur bleibt in der Landschaft ein Aspekt neben vielen anderen.
Viel prägender als die Natur-Reliquien in meinen Erlebnis-Landschaften waren die Abdrücke und Überlieferungen historischer Ereignisse. Die unmittelbarsten Eindrücke hinterließen jene, die mit der eigenen Biographie kollidierten, wie das Ende des Zweiten Weltkrieges mit all den existenziellen Umstülpungen, Verwerfungen, Umbrüchen. Daß Brüche in der Geschichte immer auch Brüche in der Biographie sind, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe nicht zuletzt vor allem dies zu thematisieren versucht. All das schließt freilich nicht aus, daß es bei allen Umbrüchen gewiefte Anpasser gab, von denen die Geschichte wie eine Flüssigkeit abgetropft ist, die keinerlei Spuren und also auch keine Brüche hinterlassen hat. Da ich in einer Agrarlandschaft groß geworden bin, haben mich die Einschnitte, die von der Bodenreform zur rigiden Kollektivierung führten, besonders nachhaltig mit Lebens-Material versorgt. Denn es handelte sich dabei um eine tragische Umwälzung gräßlich-grandiosen Ausmaßes, die zur perfekt und gnadenlos abgewickelten Abschaffung eines Standes führte, der mit seiner Arbeit, seinem Denken, seinem Lebens- und Sprachbewußtsein eine meiner in Rede stehenden Landschaften über die Jahrhunderte maßgeblich geformt, wie auch immer im ursprünglichen Sinne kultiviert und damit besetzt gehalten hatte. Die Arbeit schuf die Bilder, die ich aufnahm, die Sprache, in die ich hineingeboren wurde. Neben dem Krieg, der wortwörtlich vor meinen Füßen auf Panzerketten ausrollte, waren es dann die Praktiken der Enteignung, Parzellierung und wiederum Enteignung, die vorzugsweise ebenjene Brüche in der Biographie sehr anschaulich hinterließen. Alles in allem eine mit brachialen Aktionen angereicherte Landschaftsgeschichte, die sich für mich aus einer Vielzahl von individuellen Lebensgeschichten zusammensetzt.
Zu der berufsbedingten Neugier, die derlei Geschichten aufgesaugt und gespeichert hat, kam dann noch die Erfahrung, daß zwischen dem eigenen Erleben und der offiziellen Darstellung jüngster Geschichte, die ja immer bis vorgestern reicht, eine erhebliche Differenz bestand. Also galt es, ein Geschichtsbewußtsein mit Gegenbildern, Entzerrungen, Dementis und dergleichen aufzubauen, das auf der Suche nach Wahrheit war. Und da es ein Absolutum an Wahrheit nicht geben kann, mußte es folgerichtig darum gehen, Lebenserfahrung und erworbenes Wissen zu nutzen, um diesem edlen Begriff möglichst nahe zu kommen. Auch davon muß Landschaft reden. Es gibt keine gesichts- und geschichtslose Landschaft, wohl aber Unwissen, Desinteresse aus Beziehungsarmut, sicherlich auch die Möglichkeit, sich dumm zu stellen, um zu verdrängen, aus welchen Gründen auch immer. Verwehrte Welterkundung zwang, aus der Not eine Tugend zu machen. Je kleinteiliger das be- und erfahrbare Territorium, um so genauer konnte es wahrgenommen werden. Um das Spezifische einer überschaubaren, begehbaren Landschaft namhaft machen zu können und so sprachlich zu fixieren, mußte man möglichst bezeichnungsfest sein. Georg Maurer vermittelte, daß Genauigkeit eine wesentliche Kategorie für Poesie sei. Die Frage blieb nur, wie Genauigkeit verstanden und eingesetzt wurde über Simultanstil und impressionistisches Additionsverfahren hinaus. Entscheidend ist, wie es, um mit Gottfried Benn zu reden, zum „Kombinatorischen im Vollzug des Dichtens“ kommt.
Dies führt zu dem gravierendsten Problem der Landschaftsdarstellung. Wenn man begonnen hat, in Gedichten zu denken und auf poetische Ideenfindung aus ist, schichtet sich das visuelle Landschaftserlebnis rasch ästhetisch um. Sprache ist schwerlich in der Lage, eins zu eins abzubilden. Die Sprache, die mich als Individuum vertritt ebenso wie die Dinge, die sie benennt, zwingt zu Formung, das heißt zu einem Übersetzungsvorgang. Wobei ich Poesie als Absolutum sehe, das sich keiner Doktrin als Magd dienend unterordnet. Allenfalls lasse ich die Poesie als einzige Doktrin gelten. Ästhetische Umsetzung ist ohne Mimesis nicht zu erreichen. Mit dieser Schwachheit, die Sprache auszeichnet, beginnt die literarische Arbeit. Das heißt, wenn ich im Gedicht auf ein geschlossenes kleines Kunstwerk abziele, muß jedes Gedicht neu ansetzen. Was Benn das Kombinatorische nennt, meint das experimentelle Arbeiten beim Modellieren. Dieser notwendigerweise konstruktivistische Vorgang baut darauf, daß nur das tatsächlich vorhanden ist, was Textlandschaft wird. Es ist mir leider nicht möglich, die davon handelnden hundert Seiten aus der Habilitationsschrift von Reinhard Kiefer zu referieren. Dabei wird einbezogen, was mir sprachlich mitgegeben wurde, was mir auf den diversen Lebensstationen zuflog, was angelesen oder sonstwie angeeignet worden ist. Am Mischpult werden die Stilschichten verschoben und verschnitten, eingeschmolzen und verschliffen, koloriert, auf Genauigkeit abgeklopft, um Bedeutungsabschattungen und auf Klangbild abzielende Nuancierungen herauszuholen. Je stärker die Benennungsfähigkeit, desto größer das Differenzierungsvermögen. Stefan George sprach „von der Kraft der Ausdruckserneuerung“. Er hat die Kraft nach seiner Rückkehr aus Paris aufgebracht und etwa ein Jahrzehnt lang unter Beweis gestellt. Wobei ich hinzusetze: Die Bibel bleibt der poetische Grundtext meiner Sprache. Nur was ich über den Augenblick hinaus an Materiellem wie Immateriellem zu fixieren vermag, ist existent. Wortschöpfung, wenn sie nicht blufft, erweist sich als Wertschöpfung. Man kann dies als ein dezidiertes Programm des bekennenden Anti-Eventismus nehmen. Muß ich hinzusetzen, daß wissenschaftliche wie künstlerische Leistung eines Minimums bis Maximums an Anstrengung bedarf, die bis zur Besessenheit reichen kann? Der Hamburger Sprachtheoretiker und Ästhetiker Jörg Zimmermann meint, eine „neue Ästhetik der Natur kann […] nur in Verbindung mit einer neuen Ethik der Natur entwickelt werden, die die normativen Bedingungen formuliert, unter denen sich die Möglichkeiten ästhetischer Naturerfahrung gesellschaftlich realisieren und sichern lassen“. Vor diesem Hintergrund sei die Aufgabe des Künstlers neu zu definieren.
Dazu gehört die Möglichkeit, Kunst in nichttrivialer und reflektierter Form wieder mimetisch auf Natur zu beziehen. Denn der strikt antimimetische Impuls der Avantgardebewegung ist inzwischen aus internen Gründen erschöpft und kann nicht mehr ohne weiteres als Kriterium ästhetischer Progressivität angesehen werden: Provokation und Innovation lassen sich nicht mehr als radikale Antithese zu aller vorangegangenen Kunst verstehen; die Grenzüberschreitungen beziehen sich auf ein im Prinzip schon betretenes Gelände. (Vgl. den Beitrag „Zur Geschichte des ästhetischen Naturbegriffs“ in dem von Zimmermann selbst herausgegebenen Sammelband Das Naturbild des Menschen, München 1982)
Allerdings haben sich derart fundamentale Erkenntnisse längst noch nicht überall herumgesprochen. Noch immer sind vermeintliche Avantgardisten, die in ihrer intoleranten Selbstherrlichkeit nicht wahrhaben wollen oder können, daß sie längst in der Riege „Arrieregarde“ turnen, wenn sie einen um eine Laterne gewickelten Fahrradschlauch als Kunstwerk ausgeben, das sie dem erweiterten Kunstbegriff anlasten.
Der väterliche Malerfreund Curt Querner und Thomas Bernhard haben mich gelehrt, man kann nur offen sein, wenn man sich zur Wehr setzt und abgrenzt gegen alles, was einem literarisch wie ethisch fundierten Glaubwürdigkeitsanspruch zuwiderläuft. Auch dies gehört zu den Voraussetzungen, um eine Landschaft in ihrer Vielgestaltigkeit und Komplexität erfassen zu können. Will ich literarisch gestalten, muß ich die Landschaft als Text lesen, sie zu dechiffrieren suchen. Nach Kiefer wird die hergestellte Textlandschaft zur Simulation einer Kunstlandschaft, die ihrerseits eine Naturlandschaft simuliert. Und wenn ich Landschaft ästhetisch aufnehme und umsetze, dann doch immer mit dem mir reichlich zufließenden Wissen, daß Landschaft unabhängig davon über weit mehr Aspekte verfügt, über die zu reden besser Sache der Geologen, Geographen, Biologen bleibt.
Gerade die territoriale Eingrenzung, die nicht Abschottung auslobt und gleich gar nicht Scholle versus Asphalt setzen zu müssen meint, ermöglicht einen artifiziell subtilen Landschaftsentwurf, der für einen Weltentwurf steht. Auch wenn Landschaft als literarischer Text im öffentlichen, gesellschaftlichen Bewußtsein höchst peripher, wenn nicht gar vollends irrelevant ist, nimmt er für sich in Anspruch, auf die Bewahrung menschlichen Lebensraums zu setzen. Weitaus konkreter, beweiskräftiger läßt sich dies alles, was ich theoretisch leichtverständlich abgezogen zu umschreiben suchte, hoffentlich am Korpus der Gedichte exemplifizieren.
Wulf Kirsten
Vorwort
Wulf Kirsten wurde am 27. Mai 2003 auf Vorschlag der Philosophischen Fakultät die Ehrendoktorwürde der Friedrich-Schiller-Universität Jena verliehen; am 21. Juni 2004 vollendet er das 70. Lebensjahr. Der vorliegende Band verdankt sich beiden Anlässen. Er dokumentiert die Ehrenpromotion und gibt einen vorläufigen Rückblick auf vierzig Jahre dichterischen Schaffens. Die Konzentration auf die Lyrik als den Kern des künstlerischen Werkes wie auch die Fokussierung auf die „Landschaft“ als dessen leitendes Konzept sind gewollt. Daß sich der Dichter selbst an diesem Unternehmen mit einem eigens geschriebenen Essay beteiligte, ist ein Glücksfall.
In seiner dichterischen Sprache hat Kirsten drei Optionen zu einem unverwechselbaren Idiom zusammengeführt: eine ideologieresistente, ja -allergische Faszination durch die Sinnlichkeit von Dialekten und Soziolekten, zumal durch die Poesie der Namen; die Weigerung, zwischen den Alternativen eines sprachlich biederen, ja reaktionären „sozialistischen Realismus“ und eines im Sinne Hugo Friedrichs von Sprachmagie und Dunkelheit bestimmten Modernismus zu wählen; und schließlich die Orientierung an der Lyrik als dem Maß schlechthin dichterisch-verdichteten Sprechens, auch in erzählender und essayistischer Prosa. Kirsten hält am genauen gegenständlichen und thematischen Bezug der Sprache fest. Der Sperrigkeit, in die er sie damit vielfach treibt, sind die Gesten des Zweifels, des Zu-bedenken-Gebens und des Einspruchs bis in die Mikrostruktur von Interpunktion und Rhythmus eingeschrieben.
In Kirstens lyrischen wie auch in seinen erzählerischen und essayistischen Texten – das umfangreiche editorische Werk nicht zu vergessen – begegnet dem Leser ein Geist doppelt verstandenen kontrapräsentischen Erinnerns (Anke Degenkolb im Anschluß an Jan Assmann): Erinnern in einer aktualitätssüchtigen Gegenwart und Erinnern an solche Traditionen, die in der jeweils vorherrschenden Erinnerungskultur vernachlässigt, ausgegrenzt oder unterdrückt bleiben und daher langfristig von Vergessen bedroht sind.
Karl Kraus schrieb einmal:
Detlev von Liliencron hatte nur eine Landanschauung. Aber mir scheint, er war in Schleswig-Holstein kosmischer als Heine im Weltall. Schließlich werden doch die, welche nie aus ihrem Bezirk herauskamen, weiter kommen als die, die nie in ihren Bezirk hineinkamen.
Das Kraussche Heine-Verdikt ist mehr als fragwürdig, doch das über Liliencron Gesagte gilt sinngemäß nicht weniger für Kirsten. Es ist die angedeutete Dialektik von Enge und Weite, die auch sein Dichten bestimmt. Der in Klipphausen bei Meißen geborene und seit den sechziger Jahren in Weimar lebende Dichter Wulf Kirsten, der die biographisch erlittene und künstlerisch produktiv gewendete Enge schon früh in weiteste Bezüge stellte, hatte in dieser Hinsicht nach 1989 nichts zu lernen. Als er im März 2002 zu einer Lesung nach Paris kam, durfte ich ihm einen Tag lang einige von den Touristen vernachlässigte Seiten der französischen Metropole zeigen. Der Weg führte von Joseph Roths Hotel am Jardin du Luxembourg über die von Walter Benjamin vergegenwärtigten Passagen zwischen dem Palais-Royal und den inneren Boulevards bis zu Heines Grab auf dem cimetière Montmartre. Nach seinen Wünschen für den langen Spaziergang gefragt, hatte er die Ruhestätte Heines als ersten genannt. Der Dichter aus Klipphausen auf dem von sechsstöckigen Hochhäusern umstellten und einer viel befahrenen Brücke durchschnittenen cimetière Montmartre, die ihm längst vertrauten Verse auf dem Grab Heines entziffernd – „Wo wird einst des Wandermüden / Letzte Ruhestätte sein? / Unter Palmen in dem Süden? / Unter Linden an dem Rhein?“ –: womöglich ein emblematisches Bild für einen Autor, einen Bewahrer dichterischer Traditionen und einen bewundernswert Erinnerungssüchtigen, der in der Provinz lebt, aus der und über die Provinz schreibt, doch weder thematisch noch formal ins Provinzielle verfällt, sondern Enge und Weite in immer neuen Verhältnissen in Beziehung setzt.
Wulf Kirsten hat in den Jahren der DDR-Diktatur Rückgrat bewiesen. Er war einer der ganz wenigen, die Reiner Kunze bis zu dessen Ausreise, 1977, zur Seite standen. Ein Einspruch erhebender Brief an Hermann Kant, 1979, nach den Ausschlüssen aus dem Schriftstellerverband, ließ an Bestimmtheit und Klarheit nichts zu wünschen übrig – auch dies Gründe für herzlichen Dank. Möge dieses Bändchen, das ihn ausspricht, Wulf Kirsten erfreuen, möge es dazu beitragen, einer der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur noch mehr Gehör zu verschaffen!
Gerhard R. Kaiser, Vorwort
Einführende Beobachtungen
Wenn es gilt, einen Lyriker zu ehren, böte es sich an, gewissermaßen gleich ins Gedicht zu fallen. Damit freilich wäre, zitierte ich ein charakteristisches Gedicht, schon jetzt das für Wulf Kirsten und sein Œuvre zentrale Thema angeschnitten: die Landschaft im Gedicht als Ort des autobiographischen Erinnerns und Vergegenwärtigens. Dazu jedoch ist schon viel Kluges gesagt worden und darüber werden heute noch Karl Corino, den ich sehr herzlich begrüße, und Wulf Kirsten selbst sprechen. Ich habe mir deshalb für diese einleitenden Worte einen anderen Gesichtspunkt herausgegriffen, das kritisch-distanzierte Verhältnis Wulf Kirstens zu der Zunft und der Einrichtung, die ihn heute ehrt – zur Literaturwissenschaft und zur Universität – und denen er manches Bedenkenswerte zu sagen hat; wohl freilich eher auf indirekte Art und Weise.
Die zentralen Stationen von Wulf Kirstens Lebensgang und die wichtigsten Buchpublikationen, die anzuführen auch Aufgabe dieser einleitenden Bemerkungen ist, werden dabei in der gebotenen Kürze zur Sprache kommen. Wie ich mich überhaupt kurz fassen kann, denn explizit, wie gesagt, spielen Literaturwissenschaft und Universität bei Kirsten gar keine oder doch kaum eine Rolle. Es läge daher auch durchaus der Verdacht nahe, ich hätte mir ein Thema gewählt, das gar keines ist. Ich versuche es trotzdem und konzentriere mich auf vier Gesichtspunkte:
Die Universität als Institution
Wulf Kirsten hat spät zu ihr gefunden. 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren, besuchte er die Oberschule in Meißen, war zunächst unter anderem Bauarbeiter und Buchhalter, bevor er 1957 an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig ein Lehrerstudium für Deutsch und Russisch aufnehmen konnte. Während dieses Studiums war er zeitweise freier Mitarbeiter am Wörterbuch für sächsische Mundarten und dann ab 1965 Lektor im Aufbau-Verlag. Seine Examensarbeit von 1964 ist den pietistisch geprägten Zeitgenossen Schillers und Hölderlins gewidmet, weitgehend vergessenen Autoren des schwäbischen Klassizismus.
Die Universität als Institution hat, wenn ich das richtig beurteile, keine über das Erwartbare hinausgehende Rolle im Leben Kirstens gespielt. Es gibt im Gegenteil ein Moment der ironisch-kritischen Distanz. In seiner Laudatio auf den Landsmann Thomas Rosenlöcher zitiert Kirsten dessen Text über das Einnicken, das Rosenlöcher offenbar vor allem im Hörsaal befiel und ihn zum Schwänzen der Vorlesung veranlaßte: „Schwänzte wochenlang die Uni, versuchte Gedichte zu schreiben“, heißt es dort etwa oder: „Las […] Mörike, Eichendorff, den Anti-Becher Bobrowski, Rilke natürlich und Hölderlin“. Die Geburt des Poeten also nicht „im“, sondern „außerhalb“ des Hörsaals.
Mich beunruhigen Passagen wie diese stets von neuem, weil sie nicht nur das Recht auf Muße einfordern, sondern diese als Voraussetzung für all das zeigen, was nicht am Wege liegt. Individuation braucht eben Zeit und hat wenig mit Regelstudienzeit zu tun, wenngleich diese natürlich nicht jene ausschließt. Von den 15 Semestern, die ich glaubte studieren zu müssen, habe ich zwei ganze außerhalb des Hörsaals verbracht, eines in Berlin mit der Bennschen Gesamtausgabe, das andre in Freiburg mit den Romanen von Hermann Lenz. Es sind dies die beiden Semester, die mir in der Erinnerung die liebsten sind, und die oben zitierten Sätze von Rosenlöcher haben mich wieder an sie erinnert. Damit ist auch ihr übers Anekdotische hinausgehendes Potential angedeutet: Sie erinnern uns an die eigenen Mußestunden, die nie vergeblich waren, wenn sie uns immer wieder in die Gedanken kommen, und die immer auch unter Verzicht auf anderes und gegen Widerstände durchgesetzt werden mußten.
Nun, lieber Herr Kirsten, ist der Dichter wenn schon nicht gleich in den Hörsaal (aber warum dies nicht auch demnächst?), so doch in die Aula einer Universität gekommen, was uns freut und ehrt und zugleich hoffen läßt, daß das Thema „Kirsten und die Universität“ vorerst unabgeschlossen bleibt. Das gilt für mein zweites ohnehin:
Die Sprache und ihre Wörter
Die beiden Stichwörter könnten rasch ins Zentrum des Kirstenschen Lyrikkonzepts führen, das ja zunächst ausgeblendet bleiben soll. Ich umkreise es also eher. Zunächst zur Sprache: Mehrfach wurde von Wulf Kirsten Sprachpflege angemahnt, und sie wird gerade von denen erwartet, denen die Aufmerksamkeit für die Sprache – jedenfalls von außen gesehen – in besonderem Maße anheim gegeben ist und die bekanntlich sehr häufig ein verloddertes, phantasieloses oder, schlimmer noch, jargonbesetztes Deutsch sprechen: den Germanisten. Pflege der Sprache setzt Kenntnis der Grammatik voraus und ein Interesse eben an den Wörtern: „Ein so klein als nur irgend möglich gehaltener Wortschatz“, so heißt es anläßlich der Verleihung des Deutschen Sprachpreises der Henning-Kaufmann-Stiftung an Wulf Kirsten, „ist Trumpf. Und auch jene, die sich von Berufs wegen in der Öffentlichkeit redend darstellen müssen […], lassen nur im Ausnahmefall erkennen, daß Sprache einen geistigen Reichtum ausstellt und glanzvolles Teilstück der Nationalkultur sein könnte“. Und Sprache besteht zuallererst aus Wörtern; Grammatik und schon gar rhetorisch-stilistische Mittel folgen, das gilt für Lyrik und Prosa gleichermaßen. „Ein umfangreicher, niemals zu reich bestückter Wortschatz ist“, so Kirsten, „die Basis für die Literatur, die auf Ausdrucksstärke und Treffsicherheit aus ist“. Denn „die Poesie sitzt“ bekanntlich „im sinnlich-konkreten Detail“, auch, wenn man so will, die Poesie, die der Prosa eigen ist, wenn sie bedacht ist. (Nur nebenher und um meiner Pflicht zu genügen, erwähne ich, daß Wulf Kirsten zwar stets als Lyriker geehrt wird – mit mittlerweile rund einem Dutzend bedeutender Literaturpreise –, aber ein nicht minder glänzender Prosaschriftsteller ist. Wer sich davon überzeugen möchte, lese den skurril-komischen Kleinstadtbericht „Kleewunsch“ [1987] oder die wunderbare, autobiographisch gefärbte Kindheitsgeschichte „Die Prinzessinnen im Krautgarten“ [2000]).
Die Wörter, und im Falle Kirstens sind damit die Wörter seiner Mundart und Heimat gemeint, bilden den Humus seines Werks, eines Werks, das mit Blick auf das Wortmaterial nicht auf dem Exquisiten aufruht, sondern auf dem Passenden. Und bei diesem Bemühen kann durchaus das eine oder andre Mal die germanistische Zunft nützlich sein: So findet gelegentlich der schon erwähnten Rede die Syntax-Vorlesung Walther Flemings dankbare Erwähnung wie auch die Werke der Mundartkunde oder die Wortbildungslehre Walter Henzens. Aufs Ganze gesehen bildet dies für die Germanistik allerdings wenig Anlaß, sich auf die Schultern zu klopfen, eher schon Grund, den sprachpflegerischen Appell ernst zu nehmen. Freilich ist gerade dieser im Fach bekanntlich heftig umstritten. Mein dritter Gesichtspunkt
Die vergessenen Autoren
zielt auf Kirstens Leistung für die Literaturgeschichtsschreibung. Dies ist nun ein durch und durch erfreuliches Thema, freilich ein umfängliches. Ich begrenze es, wie angedeutet, auf die ,vergessenen‘, also nicht kanonisierten Autoren. Zu sprechen wäre auch, in einem weiteren Rahmen und das sei nur angedeutet, über das Thema der literarisch produktiven Rezeption, also über die Bedeutung anderer Autoren von Hölderlin über Rilke zu Bobrowski für die Kirstensche Lyrik oder über gattungstypologische Reflexionen Kirstens – etwa über die Erzählung –, die meiner Einschätzung nach in ihrer systematischen Plausibilität und historischen Verankerung durchaus mit denen der Literaturwissenschaft konkurrieren können.
In seiner langjährigen Tätigkeit als Lektor für den Aufbau-Verlag und auch später hat Kirsten viele Anthologien herausgegeben. Nur wenige Titel seien genannt: Die schönsten deutschen Balladen des 19. Jahrhunderts (1974); Gedichte vom Reisen (1977); Deutschsprachige Erzählungen 1900–1945 (1981); Eine Auswahl deutscher Volkslieder (1989); Eintragung ins Grundbuch. Thüringen im Gedicht (1996) und jüngst (2002) – ich habe vieles übergangen –: Stimmen aus Buchenwald. Ein Lesebuch, ein Buch, das die Bestie Mensch in grauenerregender Weise vor Augen führt, aber auch zeigt, was Menschen zu ertragen bereit sind, wenn sie leben wollen.
Jede dieser Anthologien enthält neben dem, was im jeweiligen Kontext zu erwarten war, Überraschendes, Texte von Autorinnen und Autoren, die aus dem Erinnerungskosmos herausgefallen sind. Texte, die – wie manche Wörter fast schon vergessen sind, die aber nicht nur ihr Recht in sich selbst haben, sondern die das mit ausmachen, was man den ,geistigen Reichtum‘ einer Literaturgeschichte nennen könnte. Dies schließt auch das herausgeberische und interpretatorische Bemühen um Autoren mit ein, die in der DDR randständig waren und blieben – wie Hermann Hesse, Franz Kafka oder Oskar Maria Graf.
Nun ist aber diese Erinnerungsarbeit bei Kirsten nicht auf die herausgeberische Tätigkeit beschränkt, sondern hat immer auch die anderen Tätigkeitsfelder geprägt, etwa die Reden. So bildet die Rede auf Elisabeth Langgässer ein Musterstück einer zugleich kritischen und doch auch einfühlsamen Würdigung einer nicht mehr gelesenen Autorin, und die Würdigung des Lyrikers Ludwig Greve durch Wulf Kirsten hat dessen Bedeutung erst recht eigentlich ins Licht gerückt. Aber auch die Gedichte selbst, vor allem die nicht ganz wenigen eigenen Autorengedichte, sind von dieser Erinnerungsarbeit geprägt. Damit bin ich wieder bei den Gedichten angelangt, wohin ich ja nicht wollte; aber das geht wohl nun nicht mehr anders. Mein vierter Gesichtspunkt lautet daher:
Das Gedicht und seine Erklärbarkeit
Einer Wissenschaft, die es – aufs Ganze gesehen – aufgegeben hat, zu begreifen, was uns ergreift, die aber doch den Anspruch erhebt (oder doch bis vor kurzem erhoben hat), dem Text auf die Spur seiner inneren Widersprüche zu kommen, einer solchen Wissenschaft müssen Sätze wie die folgenden, die aus der Rede auf Sarah Kirsch stammen, zur Irritation geraten:
Erst wenn man sich in der Wirklichkeit auskannte und imstande war, sie fest in der Hand zu halten, vermochte man sie hochzuheben und dem Gedicht so eine neue Dimension zu geben. Bestenfalls gelang es, das Gedicht in einen Schwebezustand zu bringen. […] Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es könnte Liebermann gewesen sein oder ebenso einer der französischen Impressionisten, der gut gemalte Apfel müsse einige Millimeter über der Tischplatte schweben. Auf eine solche Über-Wirklichkeit hin hat Sarah Kirsch ihre Gedichte geschrieben.
Kirstens Lyrik – mit den wichtigsten Sammlungen der bleibaum (1974); die erde bei Meißen (1987); Stimmenschotter (1993); Wettersturz (1999) –, Kirstens Lyrik wurzelt metaphorisch gesprochen in einer immer wieder ganz gegenwärtig erscheinenden Wortlandschaft: Man sieht sie förmlich vor sich, meint in ihr zu gehen, die Blumen und Pflanzen riechen zu können, Mensch und Tier wahrzunehmen. Nichts weniger freilich als das. Ist doch alles Wort und Bild, „poetische Rede“, „Textur“, um Kirsten zu zitieren, der seinerseits Kafka zitiert: „Wirkliche Realität ist immer unrealistisch“. Damit ist schon die andere Seite des Problems angedeutet, ist doch auch die wirkliche Landschaft nicht real, sondern nur ein Konstrukt unserer je individuellen Wahrnehmung. Was passiert nicht alles auf dem mühsamen Weg der Wiedergabe des Wahrgenommenen und Gefühlten im Gedicht – und dann auf dem Weg der Aufnahme des Gedichteten beim Leser? „Ich rede“, sagt Kirsten, „dem Gedicht aus einer künstlerischen Gestaltungsabsicht das Wort, in dem es um Konstruktion, Kombination, Komposition, Klangbild geht“. In dem Spannungsfeld von eigener Erinnerung, je sich nach Lebensalter wandelnder Wahrnehmung, Aufnahme literarischer Traditionslinien und Arbeit an der Sprache, in diesem Spannungsfeld stehen die Kirstenschen Gedichte, oder eben: über ihm schweben sie. Und eine Wissenschaft, die meint, wenn sie die Wegwarte in einem Gedicht von Wulf Kirsten vor den Hintergrund der romantischen Blauen Blume stellt, etwas erklärt zu haben, hat vielleicht ihren eigenen Gesetzen gehorcht, verbleibt aber doch günstigstenfalls damit im Vorhof des Verstehens. Und wenn sie nicht naiv ist, sieht sie dies auch. Aber Autoren geht es nicht besser. Bekanntlich ist oft genug der Text klüger als sein Autor, und gute Autoren wissen dies. Autoren und Literaturwissenschaftler gehen sich bedauerlich oft aus dem Weg und sie tun das, denke ich, weil sie sich nicht gern gegenseitig ihre Probleme mit den Texten eingestehen mögen.
Wir, lieber Herr Kirsten, haben – und ich danke in diesem Zusammenhang ausdrücklich Herrn Kollegen Kaiser für seine Anregung zu dieser Ehrung – wir haben einen anderen Weg gesucht, einen Weg, der Sie in die Universität führt. Dies hoffentlich nicht nur heute, sondern noch oft.
Jens Haustein, Vorwort
Inhaltsverzeichnis
– Text der Promotionsurkunde
– Fotoserie Wulf Kirsten
– Gerhard R. Kaiser: Vorwort
– Karl-Ulrich Meyn: Grußworte
– Bernhard Vogel: Grußworte
– Jens Haustein: Einführende Beobachtungen
– Karl Corino: Der Mensch in der Landschaft. Dichtung deutscher Bauernsöhne
– Wulf Kirsten: Landschaft als literarischer Text. Ein Eingrenzungsversuch
– Theo Buck: „Rabenüberschwärmt“. Lyrische Fortschreibungen eines Bildmotivs von Millet und van Gogh bei Paul Celan und Wulf Kirsten
– Holger Helbig: Fagus sylvatica hybrida. Landschaft und Dichtung oder Vorbereitung zur Deutung eines Verses von Wulf Kirsten
– Sebastian Kiefer: Von den Vorzügen der Langsamkeit. Wulf Kirsten und die Urbanität
– Gerhard R. Kaiser: Erdzeit, Jahreszeit, Menschenzeit. Thüringer Landschaft in Wulf Kirstens Gedichten
– Jan Röhnert: „nie vernommen, / was da aufzuckt im licht“. Dimensionen des Verschwindens in neueren Gedichten Wulf Kirstens
– Kai Agthe: „in den garten entwichen mit einem buch unterm arm“. Wulf Kirstens Nietzsche bewegt sich im „centro juvenita“
– Hans Christoph Buch: Lob der Werktätigen
– Martin Straub: Die Welt im Winkel. Wulf Kirsten: „Die Prinzessinnen im Krautgarten. Eine Dorfkindheit“
– Wolfgang Haak: Postskriptum für Wulf Kirsten, 2002
– Michael Knoche: Wulf Kirsten – eine Bibliotheksbiographie
– Justus H. Ulbricht: Nachlese im Totenwald
– Edoardo Costadura: Vom Umsetzen des Umgesetzten . Ein Bericht aus der Übersetzerwerkstatt
– Wulf Kirsten/Jan Röhnert: Welt, Poesie und Sprache(n) im Gedicht. Ein Interview
– Wulf Kirsten: „augenweide“ und andere neue Gedichte
– Anke Degenkolb: Bibliographie Wulf Kirsten
– Autorenverzeichnis
Der Dichter Wulf Kirsten
hat drei Optionen zu einem unverwechselbaren Idiom zusammengeführt: eine ideologieresistente Faszination durch die Sinnlichkeit der Sprache; die Weigerung zwischen den Alternativen eines ästhetisch biederen „sozialistischen Realismus“ und eines „dunklen“ Modernismus zu wählen; schließlich die Orientierung an der Lyrik als dem Maß allen dichterischen Sprechens.
Der Band dokumentiert die im Jahre 2003 erfolgte Verleihung der Ehrendoktorwürde der Friedrich-Schiller-Universität an Wulf Kirsten und nimmt den 70. Geburtstag des Autors zum Anlass eines ersten umfassenden Rückblicks auf das Werk. Im Mittelpunkt steht das leitende Konzept der „Landschaft“, zu dem Wulf Kirsten selbst einen neuen poetologischen Text beigesteuert hat, es werden jedoch auch andere, bisher weniger beachtete Facetten seiner Poetologie in den Blick genommen. Darüber hinaus enthält der Band sieben neue Gedichte Wulf Kirstens, ein aufschlussreiches Interview, eine Bibliographie, und einige Photographien.
Glaux Verlag Christine Jäger, Ankündigung
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Zum 70. Geburtstag von Wulf Kirsten:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag von Wulf Kirsten:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag von Wulf Kirsten:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag von Wulf Kirsten:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zu Wulf Kirsten + Archiv + KLG + IMDb +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


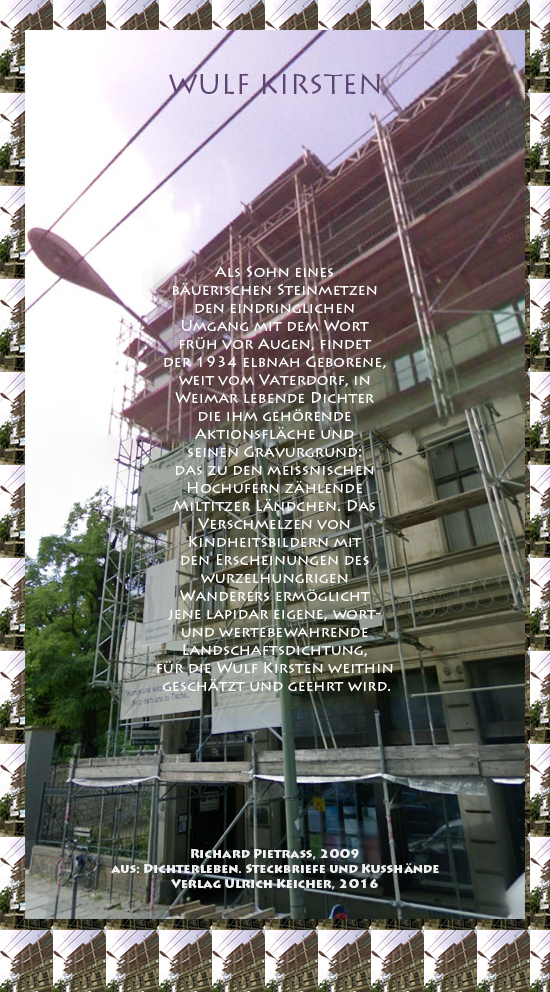












Schreibe einen Kommentar