Gerrit-Jan Berendse (Hrsg.): KrⒶwarnewall
GEHEIMTIP
In der Abteilung TEXTE UND ZEICHEN nicht des Dritten Programms im Norddeutschen Rundfunk, sondern der in Berlin bei Klaus Wagenbach verlegten Zeitschrift Freibeuter, erschienen vor sechs Jahren, in der neunten und zehnten Nummer, in zwei Folgen „Momente einer Aufklärung über Nebbich“, in der zweiten Folge auch „Mein Nebbich“ genannt, im vollen Wortlaut im Text selbst innendrin im Heft dann überschrieben:
Momente eines Aufklärungsreferates über meinen in Entstehung begriffenen Roman ,Nebbich‘.
Autor: Adolf Endler. Im Kleingedruckten am Fuße der ersten Seite der ersten Folge, unterzeichnet „Anmerkung der Redaktion“, ist das Folgende zu erfahren:
Der DDR-Schriftsteller Adolf Endler, bekannt geworden als Lyriker, Essayist, Nachdichter, ist, nach zahlreichen glaubwürdigen Zeugnissen, inzwischen auch der Kunst des Romans nähergetreten: Es handelt sich um das Romanwerk Nebbich (geplant in 4 Bänden à 736 Seiten, nach anderen Quellen… in 8 Bänden à 1.200 Seiten), zugleich gehandelt als sog. ,Geheimtip‘ von dem immer wieder Bruchstücke (wenn auch nicht solche großer Konfession) auftauchen, d.h. eher Informationen über das Vorhaben als solches – siehe den hier abgedruckten Text.
Das mit dem Geheimtip stimmt. Ich erinnere mich diverser mit der dazugehörigen gesenkten Stimme vorgetragener Hinweise auf dieses da auf dem Prenzlauer Berg „in Entstehung begriffene“ Riesenwerk aus dem Munde kompetenter Kollegen des Autors Endler; nachhaltig hab ich’s im Ohr von Franz Fühmann, daß da etwas entstehe, worum man sich kümmern müsse. Mindestens 1.000 Seiten davon müsse es schon geben, so wurde geraunt; genau wußte es aber keiner.
Ich kannte Adolf Endler den Autor bis dahin nur als Lyriker und wußte, daß er als Kritiker und – wie Franz Fühmann – unermüdlicher Verteidiger von und Streiter für junge und jüngere Kolleginnen und Kollegen und als Streiter mit ungefähren Altersgenossen wie Sarah und Rainer Kirsch oder Karl Mickel tätig war, mit denen zusammen er nach Interlinearübersetzungen Nachdichtungen georgischer Poesie aus acht Jahrhunderten, von Jessenin, Alexander Blok, Konstantinos Kavafis und anderen veröffentlichte, Anthologien zusammenstellte im ständigen Kampf gegen Mittelmäßigkeit und Provinzialismus, wie die 1966 im Mitteldeutschen Verlag erschienene In diesem besseren Land – Gedichte der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945 (zusammen mit Karl Mickel).
Dokumentiert sind alle diese Bestrebungen eines poeta doctus, der gar nicht gebildet sein will, in einem Land, in dem zu leben er selbst gewählt hat, eine hochkarätige Literatur mit zu entwickeln, zu schreiben und zu fördern, in zahlreichen Aufsätzen und Polemiken in den einschlägigen DDR-Literaturzeitschriften Neue deutsche Literatur, Sinn und Form, Weimarer Beiträge, überschrieben etwa „Probleme eines begabten Lyrikers“ (1963), „Und Mut gehört zum Wort. Gedichte von Schülern“ (1965), „Die Suche nach dem Ich“ (1968), „Im Zeichen der Inkonsequenz“. „Weitere Aufklärungen“. „Klärender Meinungsstreit“ (1971/72 ), „Sarah Kirsch und ihre Kritiker“ (1975).
Ein vom Autor „Fragment einer Rezension“ genannter 30-Seiten-Aufsatz über die DDR-Lyrik Mitte der siebziger Jahre ist dann im Jahr 1978 in den Amsterdamer Beiträgen zur Neueren Germanistik erschienen und ein ebenso umfangreicher Essay über den literarischen Nachwuchs in der DDR vor gut einem Jahr im Dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks gesendet worden.
Der Autor, der, wie viele seiner Kollegen, bis zum Beginn der sechziger Jahre fasziniert war von der Hoffnung auf eine endlich besser werdende Welt in einem hart darum kämpfenden Staatsgebilde; der in solcher Euphorie „einem jungen westdeutschen Poeten“ ins Stammbuch schrieb: „Anderswo treibt man Kanäle ins Land, / Verse wie Spaten. / Du aber hebst drei Körner Sand, / die siehst du fallen wie gebannt…“, dieser Autor schrieb wenige Jahre später, 1963, einem (offenbar in der DDR angesiedelten) „ungebrochenen Rezensenten“ in dessen Stammbuch:
„Gebrochene Gefühle!“ rügt er manchen kühl.
Will jener Rezensent auf Steine pochen?
Ich, leider Mensch, bin ratlos: Mein Gefühl
wird dutzendmal am Tag und mehr gebrochen.
Wie ist ein ungebrochenes Gefühl? Mit glatten Rändern?
Meins jubelt heute, morgen schon in Not!
Meins ist gebrochen. Kann ich es denn ändern?
Willst aber du es ändern, schlag mich tot!
Der produktive Streitgestus, wie man sieht, ist geblieben, übrigens bis heute. Gedruckt worden ist dieser Text allerdings nicht 1963, sondern erst elf Jahre später, 1974, in beschwichtigender Kulturerbe-Distanz, möchte man sagen, in Adolf Endlers Gedichtband Das Sandkorn im Mitteldeutschen Verlag Halle, der ein weiteres Jahr später als leicht veränderte Lizenzausgabe unter dem Titel Nackt mit Brille bei Klaus Wagenbach in Berlin/West erschien.
Offenbar während der Arbeit an den 1967 im Verlag Volk und Welt erschienenen Jessenin-Nachdichtungen ist ein Palimpsest-Gedicht entstanden, Jessenin in den Mund gelegt, der lange tot war und ein einfacher Querdenker wie sein Nachdichter, überschrieben „Jessenin 1923“ und mutmaßlich deshalb ungeschoren aufgenommen in Endlers 1964 erschienenen Gedichtband Die Kinder der Nibelungen. Es endet mit den Zeilen:
Ich habe meinen Adressaten wohl verpaßt,
Und meine klare Botschaft klingt verrückt und wirr.
Das ist insofern die klare Botschaft eines einfachen Querdenkers, als sie sehr simpel einen allerdings bitteren Befund beschreibt. Doch hat Adolf Endler sich bis heute nicht davon abbringen lassen, mit solchen schlichten Benennungen zu arbeiten, wodurch er nur notorisch zwischen allen Stühlen sitzt. Nachdem sich am Ende der sechziger und, legitimiert durch den VIII. Parteitag der SED 1971, in den siebziger Jahren bis zum jähen Ende, das 1976 die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann markierte, die kulturpolitische Szene in der DDR hoffnungsvoll aufgehellt hatte, schien ihm die Geschichte noch einmal recht zu geben mit seiner atemberaubend direkten, was immer auch heißt: streitsüchtigen, was immer auch heißt: lebendigen Art, Stellung zu beziehen. Einem nicht eingeweihten westlichen Publikum seines Wagenbach-Gedichtbandes Nackt mit Brille übermittelte er 1975, freundlicher Übermittler, der er immer auch war, im Anhang einige Erläuterungen. Zu seiner „Düsteren Legende vom Karl Mickel“ ist dort die folgende Anmerkung zu lesen:
Das Scherzgedicht geht u.a. auf die berüchtigte Forum-Diskussion über Poesie (1966) zurück, die mit einer Art Bannfluch über sämtliche relevanten jüngeren Lyriker der DDR endete, ausgesprochen von einer Troika führender Literaturwissenschaftler der DDR.1 Über den Lyriker Karl Mickel hieß es z.B.: „Dieser jämmerliche, zynische und vulgäre Sexualpragmatismus, oder wie immer man das nennen soll, der da glaubt, intellektuelle Überlegenheit, Unabhängigkeit und die nur ihm eigene ,Größe‘ durch Prahlen mit dem offenen Hosenlatz kundzutun…“ Antworten auf solche Anwürfe werden nicht mehr abgedruckt, wie auch das Werk der betroffenen Poeten in den folgenden Jahren nur noch in winzigen Bruchstücken das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Daß die 1967 entstandene „Düstere Legende“ 1974 endlich doch publiziert werden konnte, kennzeichnet die veränderte Situation nach dem VIII. Parteitag der SED.
DIE DÜSTERE LEGENDE VOM KARL MICKEL
Losgekettet habe ich mich oft mit Bissen,
Dickes Blut floß mit dem Speichel aus der Zunge.
Von den andern schnitt ich sanfter mich mit Küssen.
Einmal noch, nur einmal! flehten Alt und Junge.
Wankend stand der Feind der Lügner und der Trägen
– Wars Villon, Karl Mickel, war es Oscar Wilde? –,
Sah sie eifrig, junge Frauen, den Schandpfahl sägen;
Witwen, sie vor allem, haben sich beeilt.
Auch der Hohe Rat hat ihn mit Macht gescholten:
Seine sittenlosen Schriften treff der Bann!
Drei Doktoren unsrer Alma mater rollten
Jenen Pfahl zum Markt: Reicht her den Mann!
Losgekettet habe ich mich oft mit Bissen,
Ha und Blut floß mit dem Speichel aus der Zunge.
Von den andern schnitt ich sanfter mich mit Küssen.
Einmal noch, nur einmal! flehten Alt und Junge.
Ob mit Eheringen, güldnen, ob mit Beilen
Zielten sie auf was man lustvoll schiebt.
(Drei Doktoren gründlich tilgen Mickels Zeilen,
Bis es keine auf der ganzen Welt mehr gibt.)
Eisig nunmehr, Heros düsterer Ballade,
Er skandierte: Each man kills the thing he loves.
Und sie taten es und schnürten ihn zum Rade.
Konnte keiner Englisch in dem Rund des Kaffs?
Wie dermaleinst François Villon, beschreibt hier einer mit der Kraft der Wut und Worte, was ist: er liefert den Befund, sonst nichts. Dafür lebt er, Adolf Endler, loyaler Bürger und fleißiger Arbeiter, offiziell ausgewiesen in den letzten Jahren vor allem als Übersetzer, aus dem Schriftsteller-Verband der DDR ausgeschlossen seit 1979, getröstet, möchte man sagen, mit einem Leipziger Reclam-Band namens Akte Endler. Gedichte aus 25 Jahren, erschienen 1981, in seinem einst so hoffnungsvoll gewählten Lande bar jeder offiziellen Resonanz, wiewohl in Literatenkreisen bis in die höheren Ebenen hinein geachtet, respektiert und anerkannt.
Daß, um zum Anfang zurückzukehren, sein seit entsprechend geraumer Zeit entstehendes großes und den Gerüchten zufolge einzigartig umfangreiches Romanwerk den Arbeitstitel Nebbich geführt, ist bei all dem kein so großartiges Wunder. „Nebbich“ ist ein Wort aus dem Jiddischen und heißt als Substantiv soviel wie Tölpel, Gimpel, Tropf, der nur zu unbedeutenden Handreichungen beim Stehlen gebraucht wird; als Redensart soviel wie „da sei Gott vor“ oder „was soll’s“.
Ohne Nennung von Gründen, im Untertitel „Vermischtes aus dem poetischen Werk des Bobbi ,Bumke‘ Bergermann“, ist sein bisher letztes Buch überschrieben, das so etwas wie den ersten, über das im Freibeuter 1981 in zwei Folgen gedruckte „Aufklärungsreferat“ hinausgehenden Extrakt des „in Entstehung begriffene(n) Roman(s) ,Nebbich‘“ enthält, erschienen im Herbst 1985 im Rotbuch Verlag Berlin (West). Das Unternehmen soll in Bälde fortgesetzt werden. Im Frühjahr 1985, während der Leipziger Buchmesse, las Adolf Endler daraus im inoffiziellen Messe-Begleitprogramm in einem Jugendclub, was heißt: in keinem gedruckten Messeprogramm angekündigt. Dort endlich habe ich mich getraut, meine vor Jahren von Franz Fühmann in Auftrag genommenen Schularbeiten zu machen und den Autor Adolf Endler anzusprechen auf den Geheimtip, der soeben vor meinen Augen und Ohren aus dem Aggregatzustand des Gerüchts in den einer tatsächlichen Lesung übergegangen war. Da war Franz Fühmann schon seit einem Dreivierteljahr tot.
Gisela Lindemann, 1987
Vorwort
An einem der Pfeiler der U-Bahn-Haltestelle Dimitroffstraße/Ecke Schönhauser Allee (heute Eberswalder Straße) in Berlin-Prenzlauer Berg fand sich 1991 der Spontispruch „KRⒶWARNEWALL“ – mittlerweile von neuen Aufrufen übertüncht. Der aus der Spraydose auf die Mauer gesprühte Neologismus war einer der wenigen sichtbar gebliebenen skripturalen Rudimente aus der kurzen Revolutionszeit in der DDR. Das heißt: aus jenem ebenso historischen wie spektakulären Sommer und Herbst 1989, als Ostdeutsche die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überschritten, Honecker zurücktreten mußte und die SED- Macht ins Wanken geriet.
„KRⒶWARNEWALL“ enthält mehrere Bedeutungsebenen, sammelt u.a. die Vokabeln „Krawall“, „war“, „warn“, „wall“ und „Karneval“ in sich und setzt das Zeichen des Anarchismus Ⓐ in den Brennpunkt. Das anonyme graffito sagte dem Mahnmal der realsozialistischen Repression seinen chaotischen Kampf an, war jedoch nicht in erster Linie auf die Beseitigung der vierundeinhalb Meter hohen und insgesamt hundertsechsundsechzig Kilometer langen festen Grenzanlage um Berlin herum aus, sondern benutzte sie als Projektionswand des Projekts Aufruhr. Die anarchistische Pointe: die Berührungsangst vor dem auf der Ostseite bis dahin unantastbaren Stein des Anstoßes zu überwinden. Die Inschrift durchbrach ein Tabu, rief zur Profanisierung des SED-Totems auf. Aber bevor die schon fast paralysierte DDR-Autorität es zum Karneval auf der Mauer kommen ließ, riß sie noch in den letzten Zuckungen den „Ost-Chaoten“ das neue Spielzeug aus den Händen. Sie zerstörte es lieber eigenhändig, als daß sie ihre versteinerte Legitimation der Veralberung preisgab. Mit dem 9. November, so Klaus Hartung in seinem Essay „Neunzehnhundertneunundachtzig“, begann die Niederlage der Opposition in der DDR: die „Maueröffnung war die letzte geheime Rache der SED“. Der Wunsch nach ihrer Karnevalisierung ging nicht in Erfüllung, statt dessen wurde der Spruch unbeabsichtigt zum Menetekel, denn bald sollten Bulldozer die Mauer für immer aus der Welt schaffen. Was blieb, waren die immer noch spürbaren und so bald nicht zu lindernden Phantomschmerzen.
Adolf Endler, im ersten Augenblick wie fast alle seine poetischen Kompatrioten für die „Befestigung der Staatsgrenzen“ agitierend, hat es vor allem in seinen in den siebziger Jahren geschriebenen Prosastücken gewagt, die Grenzanlage, mitsamt ihres sie rechtfertigenden Diskurses, zum Gegenstand des Spotts zu machen. In mehreren Fragmenten seines Großprojekts Nebbich wird die Mauer zum Bild, in dem die Kluft zwischen Wirklichkeit und Ideal in chaotischen Bildern karikiert wird. Radikaler als in seiner Lyrik porträtierte er ein Gesellschaftsbild, das auch jene Ecken und Kanten ausleuchtete, die im Namen der nicht-antagonistischen Gesellschaft von Staats wegen frisiert werden sollten. Endler war in der Beziehung einzigartig; er legte das Fundament einer Schreibweise, auf dem im Jahrzehnt darauf eine literarische Subkultur gedeihen konnte. Wer nicht an den zahlreichen berühmt-berüchtigten Lesungen teilgenommen hatte, mußte allerdings lange auf die Veröffentlichungen in Buchform warten. Überhaupt ist bei Endler eine fast magisch anmutende zehnjährige Verspätung in Sachen Publikation zu erkennen. Auch seine wichtigsten lyrischen Texte, die er in den Sechzigern schrieb, erschienen erst im darauffolgenden Dezennium.
Mit seiner Einwanderung in die DDR im Jahre 1955 ging Adolf Endler einem Traum nach, im Ostteil Deutschlands könne eine bessere Gesellschaft, gar ein idealer Schriftstellerhort – nach dem Konzept der Becherschen „Literaturgesellschaft“ – aus den Ruinen auferstehen. Aber die Hoffnung auf bessere Zeiten war bald geplatzt, u.a. als 1966 der Ausgang der von Kulturfunktionären gelenkten Diskussionen in der FDJ-Zeitschrift Forum über die Lyrik der später sogenannten Sächsischen Dichterschule enttäuschte. Die 1971 von ihm angezettelte Debatte über die nicht nur in seinen Augen realitätsfremde Germanistik in der DDR ging wie das Hornberger Schießen aus. 1979 erfolgte im Zuge der Biermann-Affäre der Ausschluß aus dem Schriftstellerverband, worauf das Totschweigen seiner Person und literarischen Arbeit einsetzte. Einzig das Nachdichten russisch-, georgisch-, armenisch- und englischsprachiger Literatur brachte ihm noch Aufmerksamkeit. Endler wurde unterdessen kein gebrochener Melancholiker. Statt dessen wagte er die Konfrontation mit der versteinerten Welt des autoritären Worts mit anderen Mitteln. Er „entdeckte“ André Bretons Anthologie des Schwarzen Humors und erklärte diese zu seiner Bibel. Aus ihr speiste er neue Techniken des Zersetzens, gleichzeitig fand er im Humoristischen einen Schutz, den ihm die Mauer längst nicht mehr zu gewähren vermochte. Nach wie vor blieb er dem „Volke“ verbunden, ging er auch den Berliner Weg, auf dem er nach Spuren ursprünglichen Redens suchte. Mit dem Rücken zur Mauer gewendet, ließ er in der Prosa sein fiktives Personal, etwa seine Alter egos Bobbi „Bumke“ Bergermann und Bubi Blazezak, in so manchem subversiven Volksfest toben. Das Reich der für ihn produktiven Dissonanzen fand er unterm blätternden Lackanstrich des Staatsgebildes bzw. im Untergrund:
…………………………………………
Ja geh Ich hol mir mit dem Straßenpumpenschwengel
Zum Trost die Stimmen jener zweiten Stadt nach oben
Der Rattennacht Ja geh mein ausgedienter Engel
Nicht Dich die Stadt der Ratten will ich künftig loben
Einwohner zählt die hundertmalachthunderttausend
Und tolle Tage immer und Massaker toben
Durch Katakombe und Kanal Kloake brausend
Der riesigen Rattenheere Hin- und Hergefetze
Gleich Bombensplittern Glut und Wut und Blut zerzausend
Der Ratten Krieg um Zuzug Schlupfloch Fraß und Metze
Ich lausch entzückt dem Goal wenn sie gut zugebissen
Wie fern ja geh die Welt der Alexanderplätze
Mich laß die Rattenschnauze die hier meine hissen2
Endler entpuppte sich als ein Gargantua in DDR-Format. Er konsumierte und entlarvte zugleich. Er rülpste, was einmal auch seine „Utopie“ war, aus: und siehe, es waren die Sonntagsreden des realen Sozialismus. Mit dem Dogma des sozialistischen Realismus stand er auf feindlichem Fuß, lieber stürzte er sich auf die herumliegenden Absurditäten, welche er als Abfallprodukte eines DDR-typischen „grotesken Realismus“ (Michail Bachtin) besang. Allerdings sind die von ihm beschriebenen Details immer so realistisch, wie es das offizielle Literaturprogramm einst verlangte, und werden, wenn sie unglaubwürdig erscheinen, mit wissenschaftlichem Gestus mit Quellenangaben belegt. Der Endlereske Charakter der Geschichten entsteht beim Vertauschen von Fiktion und Realität, besser: beim Vertuschen der Demarkationslinie zwischen beiden Welten, denn die Absurditäten im Alltag sind nicht immer erfunden, so fiktiv sie manchmal auch erscheinen. Im Wechsel der Maskierung und Demaskierung kreist die Prosa bis zum Schwindelanfall. Hinzu kommt eine gewollte Absage an die erzählerische Kontinuität, die den Blick auf das Reale verzerrt und das Groteske in den Geschichten mit evoziert. Die kapriziöse Prosa Endlers erinnert an jene karnevalesken Verrenkungen und Verkehrungen offizieller Weltbilder aus der Feder des Meisters des Grotesken, François Rabelais. Nach dem Vorbild des Treibens auf Jahrmärkten im Frankreich während der Zeit der Renaissance zeichnete dieser die Feste der Umstülpung und Parodie einer Hochkultur auf: Die Darstellungen animalischer Triebe, das Lob der Extravaganz und insbesondere die Vertonung des ambivalenten Lachens fanden ihren Höhepunkt im Riesenprojekt Gargantua und Pantagruel, das Rabelais 1532 unter dem anagrammatischen Pseudonym Alcofibros Nasier antrat.
Statt in Lyon und Paris des 16. Jahrhunderts versuchen die grotesken Gestalten von Adolf Endler (bzw. Dove Elfland bzw. Dr. E. Ladenfol) in Ortschaften wie Ost-Berlin und Devils Lake, North Dakota des 20., wenn nicht sogar des 21. Jahrhunderts, mit kynischer Bravour Autorität zu unterminieren. Eine der schwindelerregenden Absurditäten, und ein häufiger Gegenstand der Nebbich-Capriccios, ist die Berliner Mauer. Sie wird topographisch genau situiert, nicht etwa vorsichtig metaphorisch angedeutet. – Endler und seine fiktiven Kombattanten gehen schnurstracks auf die vor November 1989 noch unbefleckten Betonflächen an der Ostseite Berlins zu, berühren sie, um wieder auf Distanz zu gehen. In rhythmischen auf und ab gehenden Tanzschritten vollzieht sich der literarische Dialog mit der Mauer/Macht. Endler akzeptiert die Einsperrung und enttabuisiert die Berührung des Schutzwalls: nur so kann er es zur entlarvenden Wirkung des literarischen Karnevals kommen lassen. Denn wer im Abseits steht, sieht nur die Folklore der skurrilen Tänze, nimmt aber nicht an der von ihr ausgehenden Subversion teil. Auch bei ihm gilt Volkskultur als Gegenkultur, wobei sich der Karneval in der DDR ebenfalls zwangsläufig von seiner Kehrseite zeigt, nämlich als Tristesse.
Ein Beispiel: In der 1978 verfaßten Kurzgeschichte „Bobbi Bergermanns Vormittagsweg“ ist die Wohngegend des (Anti-)Helden der Geschichte östliches Sperrgebiet. Dem Leser wird die Ahnung von der Einsperrung durch die.Anwesenheit von an der Westseite der Mauer auf den bekannten, heute schon historisch gewordenen Plattformen mit Fotoapparaten und Fernrohren gaffenden Touristen vermittelt. Aber je öfter Bobbi „Bumke“ Bergermann bei der täglichen Tour zum Postamt an dieses „besondere Stück des ANTIFASCHISTISCHEN SCHUTZWALLS“ herantritt, desto größer kommt ihm der Spielraum im Käfig DDR vor. Die Anwesenheit der Zaungäste verstärkt den Jahrmarktcharakter. Als eine von der Mauer geprägte „Tierart“ kann er seine Künste zeigen.
An dieser Ecke unter der westlichen Zuschauertraube fühlt man sich immer wieder in die Lage versetzt, nicht nur ein BÜRGER DER DDR zu sein, sondern außerdem den BÜRGER DER DDR zu spielen, den Gang des DDR-Bürgers, die Kopfhaltung des DDR-Bürgers, die Art und Weise, in der der DDR-Bürger seine Kleidung trägt – so auch unsereins (weshalb hat noch niemand „Bravo!, Da Capo!“ gerufen?).3
Die Wiederholung der grotesken Verrenkungen an der Mauerfläche erzeugt keinen demonstrativen Ekel vor der Einsperrung. Sie ist die Bedingung für das Kunstwerk der in Gesellschaftssatire übergehenden Travestie. Was folgt, ist ein Stück reinster Bekenner-Literatur, die wir nur noch aus den heroischen Aufbaujahren des ersten sozialistischen Arbeiter-und-Bauern-Staates auf deutschem Boden kennen:
„Die DDR“, führte er Daumen und Zeigefinger gegen die herzförmig herausgestülpten Lippen, „die DDR – Zucker!!
Wer solch ein Lob ausspricht, gerät natürlich in den Verdacht, gerade das Umgekehrte zu meinen: Süße Töne eines nur scheinbar besänftigten Tiers, das mit Ausbrechen droht.
Im schnellen Schlagabtausch von Ver- und Enthüllung, im Vermischen von Lobgesang und Ekel in einer als paradox empfundenen Welt nimmt der „Verfasser“ das einstimmige, autoritäre Wort in den Mund, verzehrt und verdaut es, um es daraufhin auszustoßen. Endler spricht dabei keine moralischen Verdikte aus – seine Satyrgeschichten vermitteln ebensowenig ein heiteres Abschiednehmen von Fehlern, um sich geläutert Gegenwart und Zukunft widmen zu können, wie Marx die Funktion der Satire einst deutete. Endler gibt sich nicht den binären Konstellationen hin; diese werden gerade im Wechselbad der Diskurse gesprengt. So heißt ein anderes Fragment aus der Mauer-Geschichte bezeichnenderweise „Eiszeit-Tauwetter / Tauwetter-Eiszeit“. Darin werden Gesprächsfetzen und Ausschnitte aus den unterschiedlichsten Zeitungen und Zeitschriften montiert, und die darin collagehaft eingesprenkelten Wiederholungen und Verdopplungen, Zurücknahmen und Umkehrungen lassen den Standpunkt des Erzählers nur ahnen. Er ist wohnhaft zwischen den Ruinen von Realität und Fiktion.
Man muß sich natürlich fragen, ob das Plädoyer für ein „Anschreiben gegen Festgeschriebenes“ nicht einfach eine der vielen Utopien war, die eher fixieren als befreien. Denn der Karneval fand nur an der Peripherie des Machtzentrums statt. Endlers Prosa hat in der DDR nie eine große Reichweite erlangt. War Adolf Endler vielleicht nicht mehr als ein belächelter, vom Staat tolerierter Sprach-Akrobat, von einem Staat, der letztendlich mit seinen konzessionierten Freiräumen den Rhythmus der Repression in Gang hielt? Der Tanz mit der Mauer wurde ihm erlaubt, da die Tanzfläche ihn isolierte. Denn das Areal, in dem er seine literarischen Orgien ausleben konnte, bestand meist aus Wohnzimmern in abbruchreifen Mietskasernen in den Stadtteilen Berlin-Prenzlauer Berg oder Leipzig-Connewitz. Das subversive Potential des Feierns verbarg sich im Ausschluß des Publikums, wobei das Versteckspiel der hedonistischen Aktionen dem asketischen Imago des Staates in die Karten spielte. An die Öffentlichkeit – falls Leser westlicher Feuilletons – drang gelegentlich eine Meldung über den subkulturellen Trubel, zum Beispiel über das 1984 in privaten Räumen stattgefundene, mehrtägige Happening während der sogenannten „zersammlung“, auf der junge Autoren der Prenzlauer-Berg-Szene nochmals ihre „Unanhängigkeit“ proklamierten. Waren aber in DDR-Zeiten die exzentrisch-privaten Bewegungen noch ein vages Zeichen einer Opposition, so drohen sie heute im kollektiven anything goes des Marktes verlorenzugehen.
Am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer den Geschichtsbüchern überlassen, der Spontispruch „KRⒶWARNEWALL“ ist unleserlich geworden. Endlers Karnevalisierungen scheinen jedoch heute nicht nur von historischem Interesse. Der Tanz mit Ruinen, mit Totem und Tabu, verläuft auf anderer, nicht weniger harmloser Ebene weiter, etwa dann, wenn er seine 1994 in Tarzan am Prenzlauer Berg niedergelegten Erinnerungen seines Wirkens im Kiez in just dem Augenblick auf den Markt bringen läßt, als die Rede von den „Stasi-Metastasen“ (Wolf Biermann) ihren Höhepunkt erreicht und die wohl bedeutendste kulturelle Bewegung in der DDR-Existenz endgültig zu degradieren droht. Sein bis jetzt erfolgreichstes Buch ist zugleich Memoire und Neuanfang einer Schaffensperiode. Endler findet neue Mauern, neue Lust an der Zersetzung und neue Gegner – nicht zuletzt in den von ihm so genannten und einst gehätschelten Dichtergefilden der Sächsischen Dichterschule und der Prenzlauer-Berg-connection. Von Ostalgie und neuer Westerfahrung hin und her gerissen, vagabundieren seine anarchistischen Schelme nach wie vor durch die Weltgeschichte, wo doch das Absurde nicht vor Nationalgrenzen und politischen Systemen haltmacht und der groteske Realismus sich gar nicht mal so radikal gewendet zu haben scheint.
Gerrit-Jan Berendse, 1997, Vorwort
Inhalt
Vorwort
Zwei Stimmen zu Endler
Wolfgang Hilbig: Der Wille zur Macht ist Feigheit
Manfred Behn: Adolf Endler – eine kleine Apologie
Erwägungen zur Lyrik
Günter Kunert: Berliner Barock
Rainer Kirsch: Über Adolf Endler
Peter Rühmkorf: Eine Ballade vom Schnee und vom Schnaps
Gisela Lindemann: Geheimtip
Peter Gosse: Dichter Endler
Adolf Endler: Traumsplitter, Akte Endler, Ichkannixdafür
Gerrit-Jan Berendse: Von der Kunst des Ruinierens
Erwägungen zur Prosa
Bernd Jentzsch: Endlers „Nadelkissen“
Helmut Heißenbüttel: Schnäcke, die man gebrauchen kann
Hajo Steinert: Wottka-Kalé! Wottka-Kalé!
Jan Faktor: Ein Satz zu Adolf Endlers Schichtenflotz
Frank Goyke: Für und wider das Jahrhundert des glasierten Wahnsinns
Jürgen Verdofsky: Vorbildlich schleimlösend
Hans-Christian Stillmark: Paraphrasen zu A. E.
Peter Walther: Ich dumm! Ich mach anders!
Ursula März: Der schelmische Realist
Helmut Böttiger: Reisender Kettenraucher
Erwägungen zur Person
Jürgen Israel: Das Gnadenbrikett
Jürgen Beckelmann: Gekreuzte Wege und Wiederbegegnung. Spaziergang mit A. E. in Berlin/Prenzlauer Berg
Karl Mickel: Porträt A. E.
Elke Erb: Das Abseits, die Mitte. Ein Jahrzehnt mit E.
Frank-Wolf Matthies: Lottumstraße
Gerd Adloff: Schaufenster ’86
Henrik Röder: Tarzan in Peitz
Andreas Koziol: Der A.endler
Fritz Mierau: Lebensgroß
Auskunft des Poeten
Adolf Endler: Die Säkular-Sauftour Bubi Blazezaks / Tagebuchblatt und Prosafragment
Anhang
Biographie
Bibliographie
Quellenverzeichnis
Das anonyme
Sponti-Graffito KRⒶWARNEWALL vereint die Vokabeln „Krawall“, „war“, „wall“ und „Karneval“ und setzt das Zeichen des Anarchismus Ⓐ in den Brennpunkt. Diese Pointe paßt zu Adolf Endler, zu einem „melancholisch-pathetisch-apathisch-cholerischen“ Autor (Endler über Endler), der in verwirrender Weise mit verschiedenen Namen und Funktionen auftritt. Mal als „Tarzan am Prenzlauer Berg“, mal als gewisser Eddy „Pferdefuß“ Endler bzw. A. E. oder Adolf Andler, der Fragmente der fingierten Berliner Dichter Bobbi „Bumke“ Bergermann und Bubi Blazezak herausgibt. Später ist es ein gewisser Adolf Endler, der seine Texte vorlegt, allerdings im Jahre 2011 oder 2030 aus dem amerikanischen Exil.
Der Literaturwissenschaftler Gerrit-Jan Berendse, University of Canterbury/Neuseeland, versammelt in diesem Materialienband eigens zu diesem Anlaß geschriebene Essays sowie eine Auswahl wichtiger Rezensionen und Untersuchungen zum literarischen Werk Adolf Endlers.
Reclam Verlag Leipzig, Klappentext, 1997
Studio LCB mit Adolf Endler am 16.9.2008 im Literarischen Colloquium Berlin.
Lesung: Adolf Endler
Gesprächspartner: Gerrit-Jan Berendse und Cornelia Jentzsch
Moderation: Maike Albath
Gespräch
Lesung
Diskussion
LOTTUMSTRASSE
für A. E.
die abendsonne bricht
aaapsst die haustür öffnet sich trippelnden schritten
die abendsonne bricht
aaaund lausch! was ist was da schreit
im butzenglas der hoftür steht
aaawas hat da die stille zerschnitten
das treppenhausfenster sieht blind
sieht stumm zersprungen nicht weit
aaawas ist aus dem müll dort gestiegen
ach die abendsonne fällt flach
durchs dach auf den staubigen boden
versteckt sich im hof vielleicht ein wind
ein spielendes kind
was war das was schrie
was kommt vor dem keller zum liegen
Frank-Wolf Matthies, 1980
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope + Facebook
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


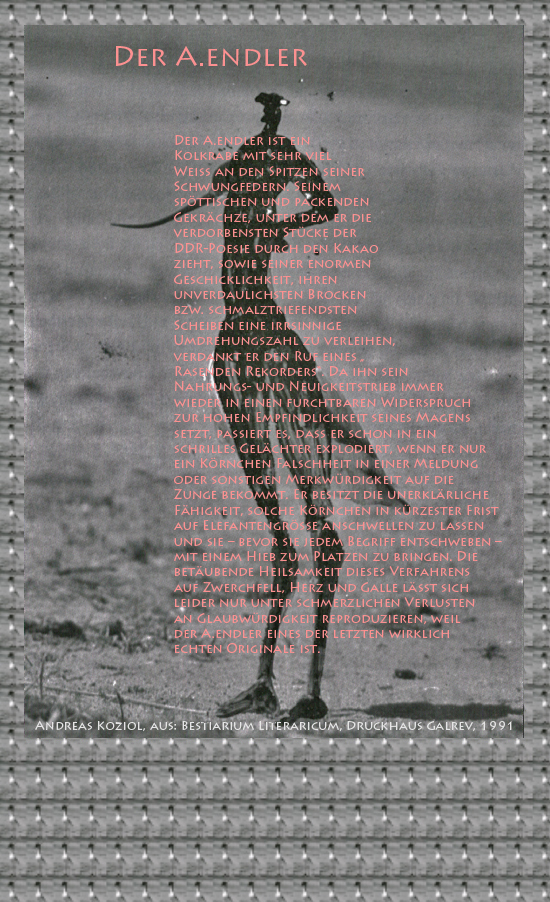
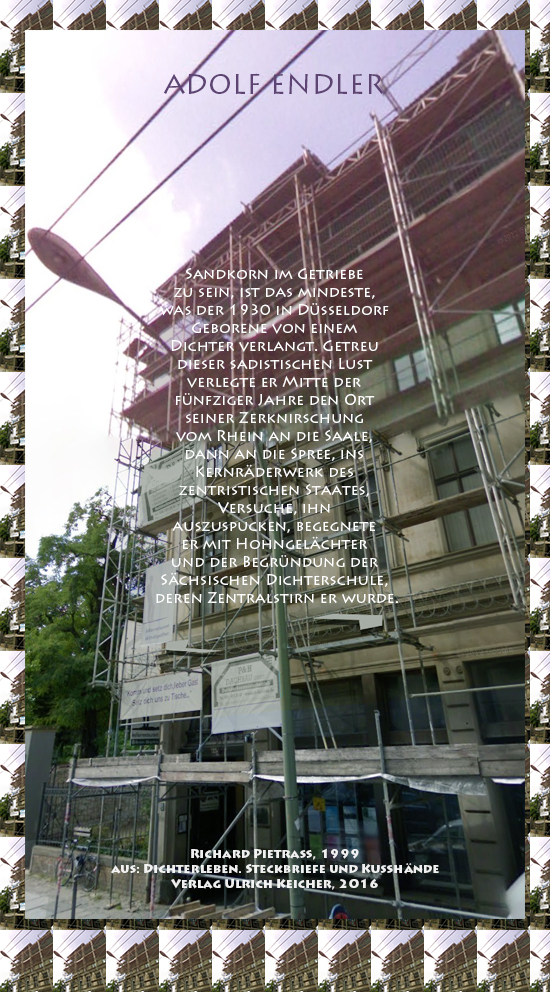












Schreibe einen Kommentar