Gottfried Benn / Thomas Florschuetz: Blumen
ANEMONE
Erschütterer −: Anemone,
die Erde ist kalt, ist nichts,
da murmelt deine Krone
ein Wort des Glaubens, des Lichts.
Der Erde ohne Güte,
der nur die Macht gerät,
ward deine leise Blüte
so schweigend hingesät.
Erschütterer −: Anemone,
du trägst den Glauben, das Licht,
den einst der Sommer als Krone
aus großen Blüten flicht.
Palette für Mohn
In memoriam Hans Günther Huch
Es ist lange her, daß etwas so Harmloses und Liebreizendes wie eine Blume einen literarischen Schock auslöste. Aber genau das geschah, als im Jahre 1912 in einem kleinen Verlag in Berlin-Wilmersdorf die Sammlung Morgue und andere Gedichte erschien. Das berüchtigte Büchlein kam auf das nichtsahnende Publikum als „Flugblatt“ zugesegelt, sein Verleger Alfred Richard Meyer erinnerte sich später des legendären Moments so: „Wohl nie in Deutschland hat die Presse in so expressiver, explodierender Weise auf Lyrik reagiert wie damals bei Benn.“ Man stelle sich die ästhetische Provokation noch einmal probeweise vor: Eine Handvoll Gedichte, ihre Schauplätze sind Kreißsaal, Krebsbarakke und Pathologie, alles dreht sich um tote, zerschnittene, gemarterte Leiber, gedruckt ist das Ganze auf Büttenpapier, mit einer gelborangefarbigen Kordel geheftet. Ihr Verfasser, ein frisch approbierter, promovierter Militärarzt, hatte sie während seiner Ausbildungszeit an einem Moabiter Krankenhaus geschrieben, in den Abendstunden nach einem Sektionskurs. Das war keine schöne Dichtung mehr. Als ekelerregend, mindestens unappetitlich wird auch der heutige Leser empfinden, wovon da die Rede ist. Wir hören von menschlichen Ausscheidungen, krebszerfressenen Schößen, offenen Bauchhöhlen – in einer Unverblümtheit, die mit aller bisherigen Ausdruckszurückhaltung brach. Doch weniges reicht an die Verstörung heran, die das Auftauchen einer kleinen blauen Aster in diesem Umfeld bewirkte. Wer ihr einmal begegnet ist, dem will sie nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Man kann sich fragen, woran das liegt. Es mag einiges mit der erstaunlich präzisen Farbangabe zu tun haben, die in Zeile zwei das Motiv einführt: „eine dunkelhellila Aster“. Unheilschwanger kommt sie daher, mit der Blauen Blume der Romantiker hat sie nichts mehr gemein. Der Clou aber ist die Kombination. Nach dem Prinzip der Collage, damals noch neu und verblüffend, waren hier Elemente zusammengestellt, von denen sich sagen ließ: eins von den beiden Dingen gehört nicht hierher. Was Benn da praktizierte, war ein Verfahren, das Lautréamont, der letzte der schwarzen Romantiker Frankreichs, gut vierzig Jahre vor ihm entdeckt hatte als dichterische Methode. In die Literaturgeschichte ging es ein als „die unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“, so die berühmte Stelle aus dem sechsten der Gesänge des Maldoror. Die Surrealisten entwickelten daraus später ein ganzes Kunstprogramm. Benn aber war ihren Pariser Experimenten um Haaresbreite voraus. Der Szene mag real Erlebtes zugrunde liegen, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Wir haben es hier nicht mit Photographien aus dem Pathologenalltag zu tun, sondern mit dem Genre der physiologischen Groteske (Helmut Lethen). Geschildert werden, in barocker Übertreibung, Zustände, wie sie im Klima eines zünftigen Medizinerzynismus gediehen, wo der Umgang mit dem Tod durch eine gewisse Routinehaltung erleichtert wurde. Das Arrangement selbst aber hakt sich im Bewußtsein fest, weil eine Blume im Mund einer Wasserleiche eben reichlich deplaziert ist. Der Leser wird zum Betrachter, den ein schockierendes Bildelement in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Vorsicht, sagt es, von diesem Dichter geht eine latente Gefahr aus. Ergriffenheit kann in diesem allzu Empfindsamen sich jederzeit in Angriffslust umkehren.
Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt.
Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhellila Aster
zwischen die Zähne geklemmt.
So fängt das wahrscheinlich bekannteste Gedicht Gottfried Benns an. Und wäre da nicht der Reim, man könnte es für den Beginn einer Prosaerzählung halten, eine Krudität aus dem Berliner Proletenmilieu. Ein neuer Tonfall war das, ein merkwürdig distanzstiftender Jargon, der aber jederzeit Halt machen konnte bei einer herzzerreißenden, kleinen Einzelheit. So hat schon die Farbangabe Signalcharakter. Als vielsilbiges Adjektiv zeugt sie von Behutsamkeit – die Zunge gerät beim Deklamieren ins Stocken. In ihrer Übergenauigkeit enthüllt sie die Schwelgereien eines Malerauges, das die Kontraste genießt. Man muß nur hinsehen: das Chiaoscuro wird als Ausdrucksform offen angekündigt. Hier geht ein Helldunkelmaler ans Werk, der die „Einerseits“, „Andererseits“-Struktur allen Lebens nur ertragen kann, indem er sie zeigt. Und solch brutaler Ästhetizismus kam auf den Ätherwellen der Lyrik daher. Unauslöschlich blieb dieser erste Eindruck. Von nun an wanderte jener Farbfleck durch alle Gedichte und Schriften Gottfried Benns und wurde zum Markenzeichen: das unschuldige Blümelein aus den Märchen und Liedern.
Es ist die Sommeraster, das Aschenputtel unter den Schnittblumen, auch Aster chinensis genannt, die den Reigen eröffnet. Benn wird sie als Feldblume kennengelernt haben, während der Kindheit auf dem brandenburgischen Land, wo er mit den Dorfjungen aufwuchs, bis zum November barfuß lief, in die Felder fuhr, auf die Wiesen zum Heuen – wie es im Lebensrückblick heißt. Eine Eingewanderte ist sie, von weither aus Südostasien, wie ihre edleren Verwandten, die Chrysanthemen, und dann so heimisch geworden, daß sie am Wegrain blühte, an Wiesen, eine Streunerin. Nicht lange haltbar, in der Vase verfärben die Stengel das Wasser rasch ins Bräunliche, und ein Geruch von Fäulnis geht dann von ihnen aus.
Ich packte sie ihm in die Bauchhöhle
zwischen die Holzwolle,
als man zunähte.
Trinke dich satt in deiner Vase!
Von Oskar Loerke stammt die Bemerkung, die Stücke aus dem Zyklus Morgue wirkten heute wie „Stilleben mit Leichenteilen“. Dieses Heute war allerdings von 1917, mit dem Abstand der Weltkriegsjahre geschrieben und entsprechend abgeklärt. Genügend Zeit war vergangen, um vor dem Bild zurückzutreten, nachdem man den Schock verarbeitet hatte. Man konnte nun auch vergleichen: War nicht die ganze Kunst des Jugendstils von der Belle Epoque bis zum Ersten Weltkrieg von floralen Motiven durchrankt? Nicht nur die Verse und Stoffmuster, auch die Gebrauchsgegenstände, das Mobiliar und der Stuck an den Häuserfassaden. Auch der Symbolismus hat seine Blumen gehabt, die des Bösen zuerst, dann die im Gewächshaus der Sprache Gezüchteten und schließlich die Trockenblumen, denen aller Duft abhanden kam, als aus Gedichtbänden Herbarien für Bücherliebhaber wurden. Aber handelte es sich noch um dasselbe? War der Skandal nicht die Verpflanzung an einen Ort gewesen, wo keiner sie erwartet hätte und wo sie auch heute noch Anstoß erregen würden? Aus den bürgerlichen Salons mit ihren Vasen von Lalique und Gallé war es nun übergesprungen ins Leichenschauhaus. Und eine Morgue war keine Einsegnungshalle, nicht einmal Totenkränze gehörten dorthin. In den Kühlräumen der Pathologie hat kein Blumenschmuck etwas zu suchen. Es mußte sich also um einen Kunstgriff handeln, hier war ein Arrangeur, raffinierter Artist zu Werke gegangen. Das hat ein Arztkollege, der Romancier Alfred Döblin, deutlich gesehen, als er mit Blick auf die Eigengesetzlichkeit dieser Dichtersprache schrieb: „Es ähnelt dem alogischen Charakter der Malerei, wirklichkeitsfremde Farben in wirklichkeitsfremden Zusammenhängen.“
Damit war nun die Kompositionstechnik im ganzen gemeint. Döblins Hinweis mit der für Schriftsteller so seltenen Analogie zur modernen Malerei galt dem Bennschen Stil. Der Dichter gebraucht den Wortschatz wie ein Matisse die Palette, wie ein Picasso die Elemente der Malerei selbst. Er isoliert die Vokabeln und nimmt sich die Freiheit, sie um des reinen Signalwerts willen neu zu kombinieren, unbekümmert um Kontext und Bedeutung. So entstehen Collagen aus Substantiven, Bouquets aus lexikalischen Orchideen, sonderbare fetischhafte Wortfindungen. Einmal ist da von „Astermeeren“ die Rede, ein andermal von „Blütengeweichel“ Benn selber hat das Verfahren freimütig aufgedeckt, aus seiner Poetik der botanophilen Wortmagie kein Geheimnis gemacht. Im Lebensweg eines Intellektualisten, einer seiner vielen Selbstauskünfte, erklärt er den Zaubertrick so:
Worte, Worte – Substantive! Sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen und Jahrtausende entfallen ihrem Flug. Nehmen Sie Anemonenwald, also zwischen Stämmen feines, kleines Kraut, ja über sie hinaus Narzissenwiesen, aller Kelche Rauch und Qualm, im Ölbaum blüht der Wind und über Marmorstufen steigt, verschlungen, in eine Weite die Erfüllung – oder nehmen Sie Olive und Theogonien – Jahrtausende entfallen ihrem Flug.
Es ist die Pflanze im Schriftbild, die hier als Droge zur Wirkung kommt, es bedarf dazu nicht erst des Rauschgiftkonsums. Die rein metaphorischen Genußmittel, die betäubenden und erregenden Phantastica der Wortschätze aller Kulturen bringen es an den Tag. Entrückung setzt ein, so will es der Dichter, sobald die exotischen Ingredienzen, oft genug aus den Bereichen Botanik und Geographie, ineinanderfließen und die lyrische Sinnesverwirrung bewirken. Wie das Mescalin die Wunder des Innenlebens enthüllt, das Morphin aus dem Saft der Mohnkapseln das Zeitgefühl dehnt, so die Gedichtzeile und in ihr das einzelne Wort als Alkaloid – von weit hergeholt. Den Sprachsinn erfaßt das Glück der Halluzination, die Operation geht in Richtung Ichauflösung. Der Vers als euphorisierender Reim spielt süße Regressionsmelodien. Pflanzliches hat an diesen Durchbruchsversuchen den größten Anteil. Wo Pflanzliches nah ist, geschieht die Lockerung, taucht das Gehirn in den offenen Bedeutungsraum ein, sinkt durch die semantischen Felder.
„Also nach der Zerstörung das Vegetabilische“ – so umschreibt der Autor selbst im Rückblick seine Methode. Vom Assoziationssturm zerwirbelt liegt die Welt des Verstandesmenschen, nun kann die Verwandlung geschehen. Benn hat den Vorgang mehrfach beschrieben. In der frühen Brüsseler Prosa um den Arzt Rönne kehrt die Szene in etlichen Variationen wieder. Rönne, der expressionistische Doppelgänger des Mediziners Benn, sehnt sich, müde der Ratio und des Realitätsprinzips, nach dem großen Entformungsgefühl, er erlebt „Entschweifungen der Schläfe“. Im Moment, da Subjekt-Krise und Blackout des Bewußtseins zusammenfallen, betritt er das Blütenzimmer, gibt er sich fallend den Asphodelenwiesen hin, taucht unter in der Levkoienwelle: „… aber noch ging er durch den Frühling, und erschuf sich an den hellen Anemonen des Rasens entlang“, heißt es in Die Reise. Und Die Eroberung hält denselben Erlösungsmoment so fest: „Er wühlte sich in das Moos: am Schaft, wasserernährt, meine Stirn, handbreit, und dann beginnt es.“
Das ist er, der keineswegs harmlose, noch immer nicht ganz jugendfreie Gottfried Benn. Ein Gedicht wie „Blumen“ kann bei ihm ein ganzes Epochengemälde enthalten. Der Titel ist Tarnung, er scheint geradewegs ins Poesiealbum zu führen. Hier aber geht es um Herkunft und Glaubensfragen, Biographisches wird heraufbeschworen.
Im Zimmer des Pfarrherrn
Zwischen Kreuzen und Christussen,
Jerusalemhölzern und Golgathakränzen
Rauscht ein Rosenstrauß glückselig über die Ufer:
Gottfried Benn wird am 2. Mai 1886 in dem Dorf Mansfeld in der westlichen Prignitz geboren, Brandenburg, anderthalb Stunden Autofahrt entfernt von Berlin, als zweites von acht Kindern eines protestantischen Pfarrers. Das Pfarrhaus ist, wie für den zeitlebens und inbrünstig verehrten Friedrich Nietzsche, kultureller Brutraum. Der Vater arbeitet als Erzieher in den Schlössern des preußischen Landadels, bevor er die Stelle des Gemeindepfarrers übernimmt. Er wird seinen christlichen Einfluß bei der Erziehung geltend gemacht haben, daran ist kein Zweifel. Gottfried Benn ist getauft und katechisiert worden, der Vorname spricht Bände, um so erstaunlicher dann der geistige Entwicklungsweg dieses Extremsportlers in der Disziplin Nihilismus. Man fragt sich, was alles schiefgehen mußte mit dem Zeitalter, daß solche Ausgangsbedingungen zu so verstörenden Resultaten führten. Die Transformation religiöser Energien in Philosophie und Poesie, eine Wirkung von Luthers Reformation, ist seit langem Diskurs. Die literarisch Hochbegabten, das weiß die Germanistik, sind über vier Jahrhunderte lang Pfarrhäusern wie diesen entsprungen, einige so abtrünnig wie gefährlich sprachmächtig. Denn Sprachmacht war das Erbteil dieser verlorenen Söhne, die zeitlebens bibelfest blieben. Das Gedicht „Pastorensohn“, aus Gründen der Pietät zuerst unterdrückt (und dann doch im Zyklus „Fleisch“ eingerückt), spricht es mit böser Verächtlichkeit aus. Man wird kaum kryptisch nennen, was so grob mit den biographischen Fakten hantiert.
Der Alte pumpt die Dörfer rum
und klappert die Kollektenmappe,
verehrtes Konsistorium,
Fruchtwasser, neunte Kaulquappe.
Der Krebstod der geliebten Mutter, einer Französisch-Schweizerin, die als Gouvernante in Deutschland eine Stellung gefunden hatte, wird angedeutet, und getrieben ist das Ganze vom Zorn auf die religiöse Vernageltheit des Vaters, der es dem Arztsohn verwehrte, die Qualen der Sterbenden mit Morphium zu lindern.
Von wegen Land und Lilientum
Brecheisen durch die Gottesflabbe −
verehrtes Konsistorium,
Gut Beil, die neunte Kaulquappe!
Man meint, einen flegelhaften Jung-Ödipus reden zu hören. Das Motiv des Vatermordes, hier grotesk überdreht, gehörte fest ins Repertoire der literarischen Epoche (in der die Psychoanalyse ihren Siegeszug antrat). Das läßt sich jeder einschlägigen Anthologie entnehmen, von Kurt Pinthus’ Menschheitsdämmerung – Symphonie jüngster Dichtung (1919) bis zur Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts (1955), letztere versehen mit einem Vorwort von Gottfried Benn. Im Jahr darauf ist er, nachdem er alles abgeräumt hatte, was ästhetisch auf seinem Feld zu holen war, in Berlin vielbeweint gestorben. Nach den Photos der Beisetzung zu urteilen, muß die Blumenpracht überbordend gewesen sein. So werden Bühnengrößen am Grabesrand überschwemmt, Filmstars einst und heute die eine oder andere Diva der Popkultur. Neu war, daß auch ein Dichter, dem zwischen den Zeilen Gott und Geschichte abhanden gekommen waren (nicht aber die Herrlichkeiten der Erde), ein Mann, vertieft ins lyrische Selbstgespräch, postum solche Ovationen erntete. Man wüßte gern, welche Sträuße sich damals ihm zu Ehren sammelten und aus welchen Händen, zumeist wohl von Verehrerinnen. Das Gedicht „Blumen“ aber fährt unbeirrt fort:
Wir dürfen ganz in Glück vergehn.
In unserm Blute ist kein Dorn.
Die Information, die in Zeilen wie diesen steckt, sollte noch immer nicht unterschätzt werden. Herausfordernd wird hier das Ende des Christentums annonciert – in Form eines häuslichen Stillebens. Ein Rosenstrauß wird gegen den Glauben an eine Sinngebung durch Christi Leidensweg ausgespielt. Die schiere Blütenpracht, als Farbexplosion wie auf den Leinwänden der Fauvisten, triumphiert über Golgatha und Dornenkronensymbolik. An anderer Stelle sind es van Goghs Sonnenblumen, wie in der Novelle „Der Garten von Arles“, die das Dasein des christlichen Dulders aggressiv überstrahlen.
An diesen Beispielen läßt sich entwickeln, was es mit all den Blumen und Blüten bei Benn auf sich hat. Sie sind, wie sich im Überblick zeigt, anfangs Trophäen eines neuheidnischen Vitalismus, bevor sich an ihnen, vor allem in späteren Jahren, die konstitutionelle Müdigkeit des Melancholikers sammelt. Gottfried Benn, der Mann der vielen Widersprüche, von Begriffen zerrissen – und dann läuft alles auf einen Strauß Blumen in einer Vase hinaus. „Stell auf den Tisch die duftenden Reseden.“
Einmal darauf aufmerksam geworden, wird man in jedem dritten Gedicht das Blumenmotiv finden. Blumen sind in diesem unruhigen Werk eine der wenigen Konstanten, gewissermaßen Das Unaufhörliche – (um den Titel eines Gedichtzyklus zu zitieren, der Auftragsarbeit zu einem Oratorium für Paul Hindemith). Gerade aus den Blumen, diesen wehrlos-weichen, hingebungsvollen, leicht verwelkenden, zarten Naturformen, leuchtet das Unzerstörbare, Unvergängliche des Seins. Sie sind wie wiederkehrende Reminiszenzen an den Garten Eden: Ihr kurzes Blühen und Duften bringt die Urerinnerung an verlorene Paradiese zurück. Nicht zufällig tragen sie Namen wie Augentrost, Immortelle oder Himmelsschlüssel. So vieles ist verloren, vergangen, von Geschichte und Zivilisationsprozeß entwurzelt, auf sie aber ist noch in der schlimmsten Naturzerstörung und Landschaftsverwüstung Verlaß: Sie sind das Wiederbringliche im Unwiederbringlichen. Und ihre Funktion scheint in allen Kulturen dieselbe: die von Liebesboten, Schönheitsstiftern, Trauerschmuck – Metaphern als Geschenkgaben. Das gilt im Orient wie im Okzident, für Japans Ikebana-Tradition ebenso wie für den Rosenkult Persiens, die Tulpenmanie zur Rembrandt-Zeit, den Schnittblumenmarkt der Weimarer Republik. Oder die von der Stadtverwaltung unterhaltenen, öffentlichen Rabatten.
Dann kam in einem Park ein Beet:
Das überblühte das ganze Elend,
den See, die Wolken und den Sturm im Garten
Und schrie: Ich bin ganz unvernichtbar!
Ich versenge dem Tod seine kalte Fratze.
Nietzscheanische Anwandlungen eines Pastorensohns waren das. Ein Blumenbeet wird begrüßt wie der Jüngste Tag. Gegen die Fruchtbarkeitsschübe der Erde, von denen die Vegetationskulte wußten, hatte der Tod als pietistische Veranstaltung keine Chance. Hier schrieb einer, der den Glauben seiner Vorväter verloren hatte wie das Schulkind auf dem Heimweg den Hausschlüssel. Ein Dichter, der von sich selbst behauptete, ihm persönlich sei Frömmigkeit konstitutionell unmöglich. „Dieser evangelische Heide aus alter norddeutscher Theologenfamilie“, wie Else Lasker-Schüler ihn anbetungsvoll nannte.
Was aber sind das für Blumen, die so zum Leitmotiv wurden wie bei keinem anderen Dichter? Woher der Eindruck ästhetischer Nähe zu den gleichzeitig ablaufenden Entwicklungen in der Malerei seiner Zeit? Benn ist, wie die französischen Modernisten, nicht an realistischer Darstellung interessiert. Es geht ihm, wie es Henry Matisse für sich deklarierte, um „Verdichtung erlebter Formen“. Es ist das Konglomerat Blume, das ihn beschäftigt. Die Rede ist von den „ligurischen Komplexen“, die in gewissen Reizwörtern eingekapselt sind wie die Samenkerne. Er zielt, wenn er vom „Anemonenwald“ schreibt, auf die Schichten dieses Querschnittes von Begriff. Das Wort als solches sensationiert diesen Dichter „ohne jede Rücksicht auf seinen beschreibenden Charakter rein als assoziatives Motiv“. In den heraufgerufenen Gewächsen verknüpft sich für ihn ein ganzes Bündel heterogener Eindrücke und Empfindungen zu einem geschlossenen Ganzen. Darum genügt oft schon die bloße Anrufung des Namens für den erwünschten Effekt: „Schleierkraut, Schleierkraut rauschen / rausche die Stunde an“.
Ging es den Malern im Gefolge Cézannes um eine radikale Reduktion der Mittel – „Alles was nicht nützt, schadet im Bild“, so bei Benn um die Konzentration auf das einzelne Substantivum. Das Haupt- oder Dingwort (oder wie es das Lexikon definiert): „Wort, das für sich allein besteht“, also aus Eigenem, dieses Wort, das ein Ding, einen Begriff, auch ein Lebewesen (eine Blume beispielsweise) bezeichnet, soll nun in seiner ganzen Autonomie erstrahlen. Es wird freigesetzt, aus den Verstrickungen der Semantik gelöst, zum Radikal im chemischen Sinne. Darin, hauptsächlich darin besteht die Bennsche Entdeckung im lyrischen Feld. So ergibt sich der vielzitierte, selten im kunsthistorischen Zusammenhang gewürdigte, sogenannte Nominalstil. Das Gedicht wird, wie im Kubismus der Bildraum, neu konfiguriert: als ein Stilleben aus einander entfremdeten Worten. Der Rhythmus bleibt magische Größe, die Lexik wird rein imaginär. Vom Hintergrund her (von der Psyche des Dichters, des Hörers) wird nach vorn auf die Buchseite zugearbeitet. Auf ihr erscheinen die Wörter, wie mit der Wurzel herausgerissen, als Fremdkörper. Sie selbst aber werden, anders als im Kubismus die Formen der Dinge, bei Benn nie deformiert. Der Dichter hat zeitlebens nie eine bestimmte Linie des moderaten Avantgardismus überschritten. Bei aller Begeisterung für den Futurismus – sein Vers vermied dessen dynamische Kapriolen ebenso wie die Sinnsabotage des Dada oder bloße Lautmalerei. Mit dem Kubismus verband ihn die Suche nach dem statischen Stil.
Spätestens hier kommt nun Carl Einstein ins Spiel, der Freund und Gesprächspartner aus frühen Brüsseler Tagen, Kunstanalytiker und Brückenbauer zwischen den Gattungen, ein Ethnologe der Avantgarden. Von ihm sind die tiefsten technischen Einsichten zum Fall Benn überliefert. Die beiden konnten sich stundenlang über Picasso, Braque oder Gris unterhalten, und die Problemstellungen, die sich daraus für die Literatur ihrer Zeit ergaben, waren ihnen vertraut. „Nur Benn ging ran“, wird Einstein in den zwanziger Jahren resümieren, nach einer Bilanz der Weimarer literarischen Szene. Einstein, der Sohn eines jüdischen Kantors, war in dem vagabundierenden Protestantensproß einem Geistesverwandten begegnet, einem überlegenen Objektivisten, unter Künstlern die seltenste Spielart. Da waren zwei aufeinander gestoßen, die sich in höhnischer Selbsteinsicht zurufen konnten: „Ihre Sucht nach Originalität entspringt Ihrer beschämenden Leere; meine auch.“ Von Einstein stammt, in einer Besprechung anläßlich des Erscheinens der Gesammelten Gedichte 1927, der klassische Reklamespruch: „Vor Leistung ist Lob töricht; ich stelle meine Bewunderung fest.“ Und weiter heißt es da: „Bei Benn ist alles auf Isolierung des Ichs gerichtet, und dies ist schmale Fackel der Gestaltung.“
Der Rückzug aufs Ich also, und aus solcher autonomen Stellung heraus die Neugestaltung des Verses analog zu den Pioniertaten der europäischen Malerzeitgenossen, das war es, was den Kunstdenker an dem fast gleichaltrigen Dichterkollegen anzog. Der Verfasser des Romans Bebuquin (den Benn zeitlebens hochhalten wird als eines der Hauptwerke der literarischen Avantgarde) hatte den ersten Schritt auf dem Weg zu einer „absoluten Prosa“ getan, nun war Benn an der Reihe mit seiner Triebpoetologie, die dem Einzelwort ein Maximum an Wirkung sichern sollte. Frühe Stichworte Einsteins sind die „Reduktion in die Fläche“, die „gereinigte Palette“. Auch bei Benn ist alles weggeschnitten, was nicht zum Ausdruck gehört. In seinem kurzen Credo aus Anlaß einer Zeitschriftenumfrage („Schöpferische Konfession“) heißt es dazu (1919):
Ich finde nämlich in mir selber keine Kunst, sondern nur in der gleichen biologisch gebundenen Gegenständlichkeit wie Schlaf oder Ekel die Auseinandersetzung mit dem einzigen Problem, vor dem ich stehe, es ist das Problem des südlichen Worts.
Die Frage, die sich daran knüpft, ist nur: Warum Südwort, wo man doch im Norden operierte? Der deutsche Künstler, scheint es, kommt aus dem Defizit. Es bedarf eines Sprungs über Breitengrade und Vegetationszonen, um das Wort aufzusprengen, daß es zum Farbbüschel wird, als polychrome Rakete aufschießt vor dem weißen Malgrund der Buchseite. Fraglich bleibt aber auch, ob das Wort je ein so starkes Eigenleben entwickeln kann wie ein van Goghsches Gelb oder ein Grün, ein Orange, ein Blau bei Matisse? Was ist das Unvergleichliche, nimmt man ein Gemälde des letzteren, etwa „Die Koloquinten« – und ein Gedicht wie „Kretische Vase“, beide aus demselben Jahr 1916?
Du, die Lippe voll Weingeruch,
Blauer Ton-Zaun, Rosen-Rotte,
Um den Zug mykenischen Lichts…
Wird man jemals ergründen, was ein Kompositum wie „Rosen-Rotte“ oder das nie zuvor gehörte Adjektiv „wiesenbIütig“ in Broca-Areal und Wernicke-Zentrum bewirken – den beiden an Sprachverarbeitung maßgeblich beteiligten Hirnregionen? Wir wissen nur, daß sie vom Gehirn entschlüsselt werden wie jeder noch so überraschende Neologismus. Und daß dieser Prozeß der Zeichendeutung anders vor sich geht als der stille sensualistische Glücksakt der Versenkung in eine farbengesättigte Leinwand. So bleibt der Abstand zuletzt unüberbrückbar. „Wie ein Gemälde ist das Dichtwerk“, lautet die metaphorische Umschreibung des Horaz. Eine harte Nuß, denn aus dem wie sprudeln alle Widersprüche zwischen den Kunstformen. Ezra Pounds großspurige Definition der phainopoeia, jener Eigenschaft der Dichtkunst, die sie dem Sehsinn am nächsten bringt – „wodurch Bilder auf die innere Netzhaut projiziert werden“, hilft hier nicht wirklich weiter. Ein Gedicht wie „Henri Matisse: ,Asphodèles‘“ bezeugt es. Wir haben ein Stilleben gleichen Namens (1907), zu sehen im Museum Folkwang in Essen, und wir haben den Vierzeiler, der das Griechenwort aufgreift und assoziativ entführt. Das Gemälde bleibt, wo es ist, auf der Leinwand als Farbkomposition, der Vers läßt sich im Gedächtnis davontragen. Geschriebenes ist immer schon Abschweifung – in diesem Falle zu den griechischen Unterweltsmythen. Wie Picasso hätte auch Benn von sich sagen können, nur der Süden inspiriere ihn zu mythologischen Themen. Freilich ist der Süden des Dichters ein rein imaginärer. So wird das Bild den Augen entzogen und zum Symbol verwandelt, hinübergeschmuggelt in eine Vorstellung von Transzendenz. Für diese genügt der Anklang, die reine Evokation plus – ein paar Gedankenstriche. Dem Namen der mythischen Pflanze, jenes ästigen Gewächses aus dem Mittelmeerraum, das tatsächlich unter der Erde überdauert als Geophyt, wird eine ganze Zeile eingeräumt, um in voller Klangschönheit aufzublühen. Asphodelen lautet das Losungswort, der Rest ist Übermalung des ursprünglichen Bildes mittels Lauten, Spurenverwischung.
Sträuße – doch die Blätter fehlen,
Krüge – doch wie Urnen breit,
− Asphodelen
Der Proserpina geweiht −.
Folgt man den Werkstattberichten, von denen die autobiographischen Schriften voll sind, den vielen brieflichen Auskünften, bleibt die Nähe zur Malerei jederzeit evident. Gottfried Benns Blumen wirken auf den heutigen Leser, der sein Pensum an Kunstretrospektiven absolviert hat, als Signalelement der Moderne. Der Besucher von Bundesgartenschauen, der Hobbygärtner wird ohnehin staunend verweilen. Das Isolierte an ihnen – daß sie aus der Verszeile gleichsam herauswachsen – verschafft ihnen Dauer. Völlig aus jedem Erzählzusammenhang gelöst sind sie, kühles Dekor, befreit auch vom persönlichen Anlaß des lyrischen Überbringers. Der Dichter liebte es, besonders blütenschwere Strophen an seine diversen Geliebten zu versenden. Benns Blumengedichte reichen weit über ihr bloßes Motiv hinaus, und das kommt dem Ideal absoluter Poesie schon sehr nah. Manche wollen nur das sein: Akkorde gesättigter Farbtöne. Das gelingt etwa dann, wenn das Wort Mohn ins Spiel kommt, ein Wort, in dem das Rot der Blütenblätter und der Milchsaft, aus dem das Opium gewonnen wird, schon mitklingt. Es gibt eine Notiz aus dem Nachlaß, die ein Licht wirft auf die Arbeitsweise dieses Spezialisten der Synästhesie.
„Palette für Mohn“ stand da, auf einen der vielen Notizblöcke gekritzelt, zwischen den Patientenbesuchen in der ärztlichen Praxis. Benn trug seine Einfälle gern in Taschenkalender ein, die ihm Jahr für Jahr von der Ärztekammer zugestellt wurden. Sie sind heute im Marbacher Literaturarchiv zu besichtigen. Man kann die Eintragung als Regieanweisung verstehen. Der Dichter gibt einen Hinweis auf die Bandbreite von Nebenbedeutungen, die ein noch ungeschriebenes Gedicht mit dem Titel „Mohn“ entfalten könnte. Die Mohnfelder selbst sind Erinnerungen an die Landschaft der Kindheit, typisch für die Felderwirtschaft in der Prignitz. Er hat dabei aber auch an das betreffende Malerwerkzeug gedacht: jenes Brettchen, auf dem die Farben angerührt werden. Benn hat den Prozeß der Mischung, Anreicherung und Verdichtung in mehreren seiner Essays beschrieben. Noch in späten Jahren, in dem dann sehr populär gewordenen Vortrag „Probleme der Lyrik“ kommt er darauf zurück. Wie zu gewissen Stunden, nach Lektüre zahlloser Bücher, beim Blättern in Bildbänden, in Momenten gesteigerter Assoziationsbereitschaft, als buntes Durcheinander von Stoffen und Aspekten, eine Art typologischer, kompendiöser Schichtung sich realisiert.
Da lobe ich mir den tiefen Alt des Mohns.
Da denkt man an Blutfladen und Menstruation.
Weiter entfernt vom Zentrum deutscher Romantik, von der Blauen Blume des jungen Novalis kann einer nicht landen. Und doch spukt auch in diesen Niederungen des blutigen, abgestumpften, sumpfigen, promiskuitiven Lebens noch ein Rest geistiger Absolutheit. Der hier schrieb, prägte später den Begriff Ausdruckswelt für sein lyrisches Unterfangen, und gemeint war, ganz ernsthaft, ein Beitrag zur Geistesgeschichte, artistische Schwerarbeit im Namen der Transzendenz. Visionen eines Frauenarztes, Zusammenfassungen eines Spezialisten für Haut- und Geschlechtskrankheiten waren das. In ihnen ist abgerundet, was ein Kenner der Drogen, der Kunststile und ihrer biblischen Hintergründe an Wissensbeständen nur raffen konnte, vorgetragen im Jargon seiner Epoche. So sprach der Arzt Gottfried Benn, Freund und Helfer der Prostituierten, ein Zeitgenosse der Grosz und Beckmann, im selben Moment wie diese gestartet und dann wer weiß woanders gelandet.
Das Pflanzliche ist der gemeinsame Nenner der Bennschen Lyrik. Blumen trugen ihn über alle Lebensphasen hinweg bis in den letzten Frühling. Sie sind das sicherste Zeichen für den Wechsel vom Zynischen ins Elegische, vom Sarkasmus in die hemmungslose Melancholie. Von Aster zu Aster ad astra führte der Weg dieses Dichters, der im deutschen Sprachraum heute das Schicksal des bunten Hundes teilt. Die Auswahl hat es an den Tag gebracht: Was als kuratorischer Einfall erscheint, ist in Wirklichkeit ein gültiger Querschnitt durch das Gesamtwerk dieses Allzubekannten.
Es beginnt mit einem Gedicht in ungleich langen, unregelmäßigen Zeilen in graphischer Halbtrichterform, das mit dem Wort „Aster“ endet und einem Ausrufungszeichen – anstelle des zu erwartenden Amen. Nach Jahrzehnten hat sich alles beruhigt und wird nun aufgefangen in der klassischen Vierzeilerstrophe, dem von Horaz bis Heine zu letzter Raffinesse ausgefeilten Quatrain. Das Sortiment aber ist bis dahin stetig erweitert worden. Eine Aufzählung mag hier genügen: Es gibt die Amarylle und das Schleierkraut, die Glockenblume und die Skabiose, Georginen, Kornblumen und Asphodelen – und immer wieder die Rosen und den Mohn. Manche tragen sie im Titel, bei anderen läuft nicht zufällig der Reim auf den Blumennamen hinaus. Manchmal kommt beides zusammen wie in dem Klassiker „Anemone“. Einmal dient die Blume als Schmuck, einmal als Gleichnis, und fast immer muß sie als Erkennungsmelodie, Stimmungssignal herhalten. Böse Zungen könnten sagen: die reinste Floristenlyrik. Dabei mehr Fleurop als Linne – denn niemals kommen hier Unterarten, selten lateinische Bezeichnungen vor. Der Autor hält sich nicht lange mit Etymologien auf. Hier ging es nicht um „Botanik als Wissenschaft“ (Goethe). Ein Exzerpieren aus Pflanzenbestimmungsbüchern, wie es Paul Celan praktizierte, wäre ihm zu esoterisch erschienen. Alles beruht hier, wie in der Schlagerparade, auf den gewöhnlichsten Blumennamen. In ihrer Eingängigkeit schmeicheln sie populären Hörgewohnheiten. Benn nahm bewußt in Kauf, daß seine Verse zu Ohrwürmern wurden. Er selbst sah sie, furchtlos vor Kitschvorwürfen, in der Nähe von Unterhaltungsmusik. In einem der Briefe an Friedrich Oelze, den Beichtfreund für lange Jahre, zeichnet er sein kritisches Selbstporträt:
Ich sitze dann an einem bestimmten Fenster meiner Wohnung u. schaue auf die leere u. wenig begangene Strasse u. sage mir, ein weiter Weg vom frühen G. B., dem wüsten Encephalitiker („Vermessungsdirigent“, „Karandasch“) bis zum Verfasser der harmlosen Rosenverse, die von Gustav Falke sein könnten u. von Phili Eulenburg komponiert…
Auch im Schlager der Weimarer Republik hatten die Liedtexter sich ausgiebig in den Blumengeschäften versorgt, und genauso dann wieder in den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders denen Benn sein Comeback verdankte. Das teilweise Schwülstige aber, verstärkt in den Altersgedichten, ist bei seiner Bühnenerfahrung nur als ästhetischer Dreh zu begreifen. Warum nicht in die Rolle des Chansonniers schlüpfen, der die Damen zum Schmelzen bringt? Das leise Lamento vom allgemeinen Verblühen war nur die Kehrseite seiner schneidenden Intellektualität. Auch die erotischen Untertöne sind immer mitkomponiert. „Laß mich noch einmal weich sein / Im Blumengeruch der Nacht.“ Benn pokerte gern mit Emotionen. Als leidenschaftlicher Radiohörer wußte er um die Wirkung der einsamen Stimme, die nachts auf unsichtbaren Frequenzen durchs Zimmer wehte. Eine solche Stimme war schließlich auch die seine geworden, wenn sie durch Blumen zur Nachwelt sprach. Und schließlich kam der Moment, da auch die Blumen ihm unerträglich wurden.
Nimm fort die Amarylle
Ich kann kein Blühen mehr sehn…
Durs Grünbein, Nachwort
Inhalt
„Ruhe sanft, kleine Aster“, „O du, sieh an, Levkoienwelle“ oder „Nimm fort die Amarylle“ – in jedem dritten Gedicht Benns gibt es eine Anspielung auf Blumen und Blüten. Manche tragen die Blume im Titel, andere im Reim. Hier dient die Blüte als Schmuck, dort als Gleichnis und manchmal auch als Signal einer Stimmung oder Gestimmtheit. Das sicherste Zeichen sind sie für den Wechsel vom Zynischen ins Elegische, vom Sarkasmus in die hemmungslose Melancholie.
Thomas Florschuetz und Durs Grünbein haben aus diesem Reichtum eine Auswahl getroffen. Thomas Florschuetz, einer der „herausragenden Vertreter der international höchst anerkannten deutschen Fotografie“, stellt Benns Gedichten eigene Bilder von Blüten und Früchten zur Seite. Durs Grünbein begleitet die Auswahl mit einem Nachwort und einem Gedicht.
Insel Verlag, Ankündigung, 2011
Max Rychner: Gottfried Benn. Züge seiner dichterischen Welt, Merkur, Heft 18, August 1949
Max Rychner: Gottfried Benn. Züge seiner dichterischen Welt (II), Merkur, Heft 19, September 1949
Hans Egon Holthusen: Das Schöne und das Wahre in der Poesie. Zur Theorie des Dichterischen bei Eliot und Benn, Merkur, Heft 110, April 1957
L.L. Matthias: Erinnerungen an Gottfried Benn, Merkur, Heft 171, Mai 1962
Nico Rost: Begegnungen mit Gottfried Benn, Merkur, Heft 218, Mai 1966
Nino Franks Bericht über seinen Besuch bei Benn, Merkur, Heft 398, Juli 1981
Walter Aue: „Das ist Bahia, am Meer“. Wege zu Gottfried Benn
Norbert Hummelt: Auf einen Sprung zu Gottfried Benn
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Gottfried Benn
Helmut Böttiger: Gottfried Benn – Kleine Aster und andere Gedichte
Gottfried Benn: Kleine Aster – Gedichte und Prosa. Ulrike Draesner und John von Düffel im Gespräch mit Anja Brockert am 21.01.2019 im Literaturhaus Stuttgart.
Gottfried Benn. Der Mann ohne Gedächtnis
Lesung: Holger Hof
Moderation: Jörg Magenau
Im Literarischen Colloquium Berlin am 13.12.2011
Tondokument: Peter Rühmkorf und Adolf Muschg über Benn und Brecht am 16.9.2006 in der literaturwerkstatt berlin.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Carl Werckshagen: Gottfried Benn 60 Jahre
Schleswig-Holsteinische Volks-Zeitung, 27.4.1946
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Max Rychner: Gottfried Benn
Die Tat, Nr. 120, 3.5.1956
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Adolf Muschg, Jürgen P. Wallmann, Edgar Lohner: Abschied von Gottfried Benn?
Die Tat, 29.4.1966
Zum 10. Todestag des Autors:
Jürgen P. Wallmann: Kunst als metaphysische Tätigkeit
Die Tat, 2.7.1966
Bruno Hillebrand: Gottfried Benn – zehn Jahre nach seinem Tod
Neue Deutsche Hefte, Heft 110, 1966
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Peter Rühmkorf: „Und aller Fluch der ganzen Kreatur“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.6.1976
Jürgen P. Wallmann: „Der Ruhm hat keine weissen Flügel“
Die Tat, 30.4.1976
Zum 20. Todestag des Autors:
Gert Westphal: Gottfried Benn – nach zwanzig Jahren
Neue Zürcher Zeitung, 23.7.1976
Heinz Friedrich: Plädoyer für die schwarzen Kutten
Merkur, Heft 30, 1976
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Albrecht Schöne: Gottfried Benn?
Die Zeit, 2.5.1986
Peter Rühmkorf: Gottfried Benn oder „teils-teils das Ganze“
Deutsches Sonntagsblatt, 6.7.1986
Zum 50. Todestag des Autors:
Wolfram Malte Fues: Nur zwei Dinge
manuskripte, Heft 174, 2006
Jörg Drews: Das Gegenteil von ,gut gemeint‘
Tages-Anzeiger, 4.7.2006
Cornelius Hell: Persönlich, poetisch, politisch
Die Furche, 29.6.2006
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1, 2, 3 & 4
Autorenäußerungen zu Person und Werk von Gottfried Benn
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Gottfried Benn: Deutsche Rundschau ✝ Merkur ✝
Aufbau ✝ Tumba
Gottfried Benn – das letzte und einzige Fernseh-Interview mit Gottfried Benn am 3. Mai 1956 zum 70. Geburtstag.
Fakten und Vermutungen zum bHerausgeber + Instagram 1 & 2 +
Facebook + KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


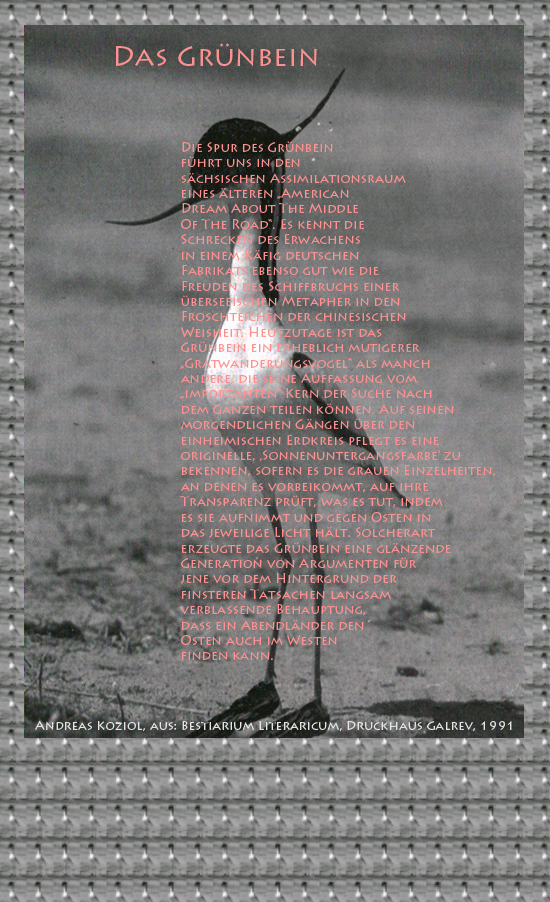
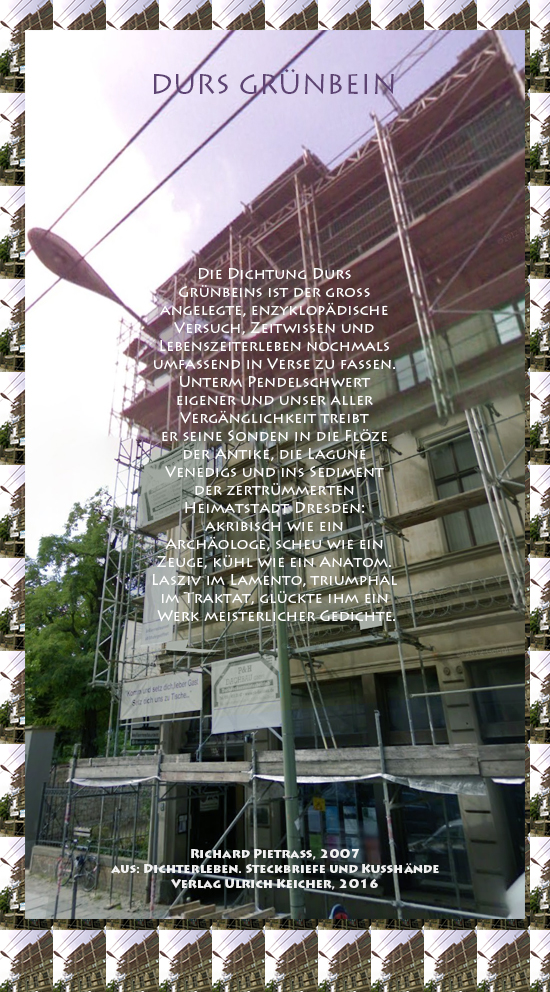












Schreibe einen Kommentar