Günter Kunert: Der ungebetene Gast
GAGARIN
Als er durch des Himmels Bläue aufgefahren,
Schien es, er bewege sich nicht länger fort,
Und er hänge fest in dieser schwarzen Weite,
Und die Erde drehe sich vor seinem Fenster dort.
Eine unfaßbare Kugel nannte er nun Heimat,
Und wie nie vorher kam sie ihm plötzlich nah,
Da er, fern von ihr in den Unendlichkeiten,
Stumm und reglos auf sie niedersah.
Und er liebe sie, die sich ihm zeigte,
Weil sie doch der Menschen Mutter war,
Immer noch die Söhne nährend und behausend,
Aber auch durch sie in tödlicher Gefahr.
Während seiner Rückkehr zum Planeten
Ward ihm klar: Die Erde ist nur eins.
Die darauf sind, müssen miteinander leben,
Oder von ihr wird es heißen: Leben keins.
Auf der Schwelle des Hauses
Für die literarische Situation in der DDR ist es nicht ungewöhnlich, daß die Bücher gewisser Autoren mit oft erheblichen, durch eine engstirnige Zensur bedingten Verzögerungen auf den Markt kommen. Zu diesen „verzögerten“ Büchern gehört der neue Gedichtband des in Berlin-Treptow lebenden Günter Kunert: Der ungebetene Gast; Aufbau Verlag, Berlin/Weimar; 96 S., 7,50 DM, der dann innerhalb einer Woche vergriffen war. Kunert, erst kürzlich mit Manfred Bieler und Wolf Biermann in das PEN-Zentrum Ost aufgenommen, war längere Zeit hindurch den Angriffen der SED-Funktionäre ausgesetzt. Der ungebetene Gast ist seine erste größere Publikation seit 1961 in der DDR. Der Aufbau Verlag bereitet für dieses Jahr eine Sammlung von zweiundfünfzig Liebesgedichten Kunerts vor.
Günter Kunert, 1929 in Berlin geboren, ist auch bei uns kein Unbekannter mehr. 1963 erschien im Hanser Verlag München eine Auswahl aus den vier bis 1961 in Ostberlin publizierten Gedichtbänden (Erinnerung an einen Planeten), 1964 folgte dann im gleichen Verlag eine erste Prosasammlung: Tagträume, die Kunert als bedeutsamen und eigenwilligen Erzähler auswies. Zur Zeit arbeitet er an einem Roman Im Namen der Hüte, der die Nachkriegsjahre in Berlin, insbesondere das Groteske und Derivierte der damaligen Situation, ins Auge faßt.
Sein neuer Gedichtband, der neunundsechzig Gedichte vereinigt, liefert nachdrücklich den Beweis, daß Kunert zu den begabtesten Poeten deutscher Gegenwart gezählt werden muß.
War in seinen lyrischen Anfängen das Vorbild Brechts zuweilen noch recht unvermittelt zu spüren, so läßt sich an Hand der nun vorliegenden Arbeiten feststellen, daß Kunert zu der ihm eigenen, unverwechselbaren Sprache gefunden hat. Sie ist härter und genauer geworden. Er vermeidet das allzulange Ausholen und Unterwegssein auf eine pointierende und moralisierende Schlußsequenz hin. Aussage tritt neben Aussage, Optik neben Optik, gleichgewichtig, mit nichts anderem belastet als dem, was sie selbst ist. Kein Wort mehr, keines weniger. Nüchtern wirkt das, blockhaft. Und gerade diese Blockhaftigkeit, diese fast mathematisch anmutende Genauigkeit erzeugt feine untergründige Spannung innerhalb des ganzen Gebildes, das da Gedicht heißt. So etwa in „Ich bringe eine Botschaft“:
Auf einem Vulkan läßt sich leben, besagt
Eine Inschrift im zerstörten Pompeji.
Und die Bürger der vom Meere geschluckten
Ortschaft Vineta
Bauten für ihr Geld Kirchen, deren Glocken
Noch heute mancher zu hören vermeint…
Kunerts Sprache ist von leidenschaftlicher Strenge, präziser Sachlichkeit und kühler Sensibilität, nicht ohne Melancholie und ausgerüstet mit durchaus kräftigen Antennen für Ironie und Selbstironie:
Innerhalb meines abendlichen Gehirns
Schlürft ein Schatten umher
Auf abgelaufenen Füßen,
Eine kleine undeutliche Laterne in
Der Hand und immer im Kreise.
Erkennte ich ihn, wüßte ich eher
Wer ich bin und wer nicht.
Kunert stellt mit seltener Eindringlichkeit die Frage nach dem Verbleib des Menschen. Hier ist ein Dichter unterwegs, unermüdlich jene menschlichen Bewußtseinslagen anpeilend, die der Hoffnung auf Überleben, auf positive Veränderung des Hier und Heute begründeten Anlaß zu geben vermögen. „Auf der Schwelle des Hauses“ sitzend, besorgt, jene „Lichtflecken“ aufzufinden, die es gestatten, „zwischen zwei Herzschlägen (zu) glauben: Jetzt ist Frieden“. Seine Gedichte sind Negative, „schwarze Lehrgedichte“, die dazu zwingen, eine Gegenlehre zu ziehen, ohne daß Kunert der Verdeutlichung halber noch den moralischen Zeigefinger erheben müßte:
Betrübt höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Um den Menschen und um seine Möglichkeiten, innerhalb anonymer Massengesellschaftssysteme und „einer Welt, die ihre Ideale an die Wände nagelt“, einer Welt, die noch gekennzeichnet ist durch die Spuren großer Menschenverfolgungen, wo zu lernen war „das Abc des Verreckens und Übrigbleibens“ einen Rest von Menschlichkeit zu bewahren, geht es Kunert in allen hier versammelten Gedichten:
WAS IST DENN IN DIR
Und was soll geliebt sein?
Was deine Brüste vortreibt,
Die Hüften kurvt, was
Wölbung und Bauchung und Regung
Und zuckt und da ist?
Was rosenrot, schneeweiß, was schwarz?
Armkraft, Lachmuskel, Salzträne?
Was denn, wenn nicht
Das aller Natur Allerfernste, gestempelt
Mit dem verachteten, veralteten, verlogenen
Abwaschbaren Wort Mensch.
Gregor Laschen, Die Zeit, 13.5.1966
Brecht-Schüler
Günter Kunert begann, wie so viele unserer jungen Lyriker, mit Gedichten, die deutlich den Einfluß Bertolt Brechts verrieten. Als formalen Einfluß aber scheint dem eigenwilligen und so ganz persönlich geprägten Lyrikstil Brechts die Tendenz innezuwohnen, daß er Epigonen erzeugt; er ist seinem Wesen nach einmalig und unwiederholbar. So sind viele der lyrischen Brecht-Nachfahren denn auch im Epigonalen steckengeblieben. Auch Kunert war dieser Gefahr zuweilen erlegen, hier aber, in dem neuen Gedichtband Der ungebetene Gast, ist er zur Befreiung von der bloßen Nachahmung Brechts gelangt, zu schöpferischer Weiterverarbeitung der großen Anregung.
Zwar sind auch hier noch einige Gedichte deutlich-allzudeutlich brechtianisch, aber andere sind auf dem Umweg über sprachliche Sprödigkeit zu eigenständigem Ausdruck gelangt. Ihr komplizierter Duktus will ebenso komplizierte philosophische Ueberlegungen, zuweilen auch nicht recht zu Ende geführte, in einprägsame Formeln zwingen. Tief durchdacht wird die Faszination des Weltraumflugs, Hoffnung kämpft mit Pessimismus, eine grüblerische Haltung findet zu einem unbeirrbaren Glauben an Humanität und Menschheitszukunft. Kunert ist ein problematischer Dichter, das heißt hier: ein mit Problemen beschäftigter.
H. U., Neue Zeit, 28.4.1966
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Sabine Brandt: Der ungebetene Dichter
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.11.1965
Armin Zeißler: Lyrik der Veränderung
Neue Deutsche Literatur, Heft 1, 1968
Hans-Peter Anderle: Der ungebetene Gast
Publik, 14.3.1969
„Sinnsuche“
– Versuch einer Skizze zur Lyrik Günter Kunerts. –
Die anfängliche Schwierigkeit der DDR-Lyrik, ihre eigene Stimme zu finden und ihre Sprache zu artikulieren, wird in den Gedichten, die Günter Kuriert in den vergangenen 25 Jahren geschrieben hat, ebenso deutlich wie das, was diese Lyrik über die Grenzen jenseits von Oder und Harz hinaustrug. Heute, wo Kunert ein stattliches Œuvre vorweisen kann – er schrieb neben Romanen und Essays zahlreiche Filmdrehbücher, Hör- und Fernsehspiele – wird der Stellenwert seiner Lyrik besonders sichtbar: Er gehört nicht nur zu den wesentlichen Dichtern der DDR, sondern ist wohl der wesentlichste innerhalb seiner Generation. Zahlreiche Reisen, die er durch das westliche Europa und bis in die USA unternahm, haben ihre Ergiebigkeit erwiesen: Sie haben den Horizont des 1929 in Berlin Geborenen geweitet, ein Faktum, das insofern wichtig geworden ist, als es Kunerts Fähigkeit zum Ausbalancieren existentieller Situationen im Gedicht geschärft und zahlreiche Korrekturen ermöglicht hat, die den Brecht-Adepten der fünfziger Jahre dahin brachten, daß er heute in seinen prosanahen Versen einen lyrischen Lakonismus handhabt, der seinem skeptischen Materialismus adäquat ist.
Bezieht man zwei in der Brecht-Nachfolge geschriebene Lehrstücke („Gedanken für einen Flieger“; „Fetzers Flecht“) ein, die Kunert in seinen Lyrikband TAGWERKE (1961) aufnahm und die er – nimmt man den Untertitel des Bandes „Gedichte, Lieder, Balladen“ ernst – offenbar in die Nähe der Lyrik gerechnet haben wollte, so stimmen die Gedichte jener Zeit einen Ton an, der sich – auch hierin Brecht folgend – gegen das Diktum des „Lyrischen“ wehrt: spröde, distanziert, nicht in sich selber aufgehend, versuchen jene Gedichte, die noch heute Interesse beanspruchen dürfen, eine dialektische Geste zu vollziehen, die Kunerts generationsbedingten Erfahrungen entspricht. Die lyrisch-biographische Aufarbeitung der Kriegs- und Nachkriegsbedingungen, von denen Kunert redet, seine didaktisch-poetischen Verweise auf eine Zukunft, die, liest man diese Gedichte genau, nicht ohne weiteres eine „bessere“ zu nennen ist, geben Auskunft über die innere und äußere Verfassung eines lyrischen Ichs, dessen Individualität keinem Kollektiv zugesellt werden kann. Auch der appellative Charakter einzelner Gedichte – „Einer ist nichts. Allein kann keiner bestehen. / Mit ein paar Händen baut er kein Haus. / Und die Spur seines Schrittes löscht der Regen aus, / Daß sie nicht mehr zu sehn.“ – kann ebensowenig wie einige der Zeit geschuldete Pflichtübungen darüber hinwegtäuschen, daß das Gefühl einer inneren und äußeren Einsamkeit schon in frühen Versen Kunerts ihren Ausdruck sucht. Nicht zufällig erlangen gelungene Verse („DA SIND MENSCHEN / Die vor den Fenstern / Stehen und hineinblickend wähnen, / Drinnen spiele sich das Leben ab. / Während die drinnen hinausstarren / Auf die Straße, im Glauben dort sei / Es.“) gegenüber anderen, die wie abgezwungen wirken, eine auffallende formale Geschlossenheit. Kunert, durch Leiderfahrungen gegangen, die durch seinen äußeren Lebenslauf nur ungenau berührt werden können, mißtraute offenbar von Anfang an jeglichen Heilslehren und Versprechungen einer Erlösung aus der Kontinuität des Leids, das ihn die Geschichte gelehrt hatte. Metaphern, Bilder, Wendungen „früher“ Gedichte verweisen immer wieder auf ein Vokabular, mit dessen Hilfe aus der jüngst vergangenen Geschichte Lehren gezogen werden sollen, freilich nicht durch Appelle, sondern durch Hinweise, deren Gehalt der Leser selbst zu ermitteln hat. Mißtrauen gegenüber jeder Art von Gefühligkeit, dialektische Verschränkung von Ich und Du, kennzeichnen im übrigen auch die Liebesgedichte dieses Autors, die denen der „Liebeslyrikwelle“ jener Jahre in der DDR entgegengesetzt sind:
IN DIESEN STUNDEN
Bevor du kommst, sind die
Bäume aus geborstenem Eisen.
Der Himmel ist fortgegangen. Der
Wind hat sich versteckt. Gleich
Den Geräuschen
Zwei Kilometer im Kreis.
Mit solchen epigrammatischen Kurzgedichten setzt Kunert bereits in den späten fünfziger Jahren Zeichen in eine Wirklichkeit, deren alltägliche Härte nur allzuhäufig durch lyrische Gebilde verklärt wird. Georg Maurer verwies in seinem Essay „Zur Deutschen Lyrik der Gegenwart“ bereits 1965 mutig auf die Gefährdung der Lyrik durch Gedichte, „die nach der Couéschen Methode“ verfahren:
Durch die dauernden Behauptungen, daß das Leben wunderschön ist, wird das Leben noch nicht wunderschön. Mag sein, daß die Lyriker und Lyrikerinnen, während sie solches schreiben, dieser Autosuggestion verfallen. Eine suggestive Macht solcher Verse auf den Leser hat es kaum gegeben.
Mit einem an Brecht geschulten kritischen Selbstbewußtsein schrieb Kunert inmitten einer noch immer vorwiegend rosenrot dichtenden Umgebung Verse, die nicht nur als poetischer und ideologischer Kontrapunkt wirkten, sondern auch auf eine Poetologie verwiesen, mit der sich der Dichter gegen jeden Verklärungsversuch der Nachkriegs/Aufbaujahre wehrte:
DIE WOLKEN SIND WEISS. WEISS IST
Die Milch im Krug, weiß wie die
Windprallen Hemden auf der Leine, weiß
Wie Verbandsstoff vor der Schlacht.
Schon die Enjambements dieser Verse, die in einem stockenden, jeweils am Versende aufgestauten Rhythmus von Zeile zu Zeile auf den letzten Vers mit seiner erstaunlichen, warnenden Wendung hinweisen, füllen dieses kleine Gedicht mit Energie, einer Energie übrigens, die sich wie ein Angebot Kunerts an Kunert ausnimmt, wenn man manches der späteren Gedichte, denen mitunter der Vers verloren zu gehen droht, dagegensetzt. Wie sehr aber und mit welchem Recht Kunert der Verführung zum „Lyrischen“ mißtraut – er selbst bezeichnet einen Teil seiner Gedichte des Bandes Tagwerke offenbar nicht ohne Ironie als „Lyrismen“ – illustriert im Gegensatz zu „DIE WOLKEN SIND WEISS“ ein Gedicht wie dieses:
VON DEM, WAS WÄCHST GEFÄLLT MIR AM BESTEN DEIN HAAR
Das gäbe ich nicht für Korn, Efeu und Gras.
Als dein Gesicht sehr nah meinem Gesicht war,
Schien der Himmel aus blauem zerbrochenen Glas.
Zwar heben sich auch diese Verse noch immer von denen vieler seiner damaligen Zunftgenossen vorteilhaft ab, jedoch: sowohl der Rückgriff auf ein mit Pseudopoesie aufgeladenes Vokabular (Korn, Efeu, Gras, Himmel aus blauem, zerbrochenen Glas), das um einige Nuancen zuviel an Brechts Hauspostille erinnert, wie auch das Kunert unangemessen Innige der lyrischen Situation stehen nahezu im Gegensatz zu der bereits in früheren Gedichten erreichten Position einer von Widersprüchen und Erfahrungen geprägten Form, der das Liedhafte fremd ist und die im Leser den Partner sucht, einen Partner, der im hohen Maße an der „Sinnsuche“ beteiligt wird.
Kunerts Gedichte vermitteln sowohl in den fünfziger wie in den sechziger Jahren bereits eine sich immer wieder gegenseitig aufhebende und bedingende Fragwürdigkeit der Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Natur. Auch die Liebe ist von dieser Fragwürdigkeit nicht ausgenommen, ja im Reflektieren dessen, was im Jargon der Sprachregelung als „zwischenmenschliche Beziehungen“ bezeichnet wird, setzt sich in Kunerts Lyrik auf eine besondere Weise gern kritischer Impetus durch. Gemeinsamkeit und „abwesendes Beieinandersein“ bedingen in dem späteren Gedicht „Unterwegs mit M.“ einander; Sorglosigkeit und Glück heben sich ab vor dem Hintergrund bedrohlich wirkender Wortgruppen wie „platzender Regen“ „geborstene Wespen“ und dem jähen Wechsel von Sonne und Dunkelheit. Dieses Gedicht, Momentaufnahme eines Zustands, dessen Dauer begrenzt ist, legt den Akzent auf ein Gefühl, das – in höchster poetischer Verkürzung – an eine Grundstimmung erinnert, in der Wechsel und Dauer wie in Lenaus „Schilfliedern“ als poetischer Topos erscheinen. Ist in diesem Gedicht als Ergebnis eines Reifeprozesses der Widerspruch der Dinge und Erscheinungen in den Text integriert, so belegt ein Gedicht aus den fünfziger Jahren noch Kunerts angestrengtes Bemühen um eine Dialektik, die dem Dichter eine auf Distanz gehende Haltung abverlangt. Noch scheint es dem Ich nicht zu gelingen, ganz im Text aufzugehen; die Dialektik scheint fast ein Spiel und wie in einem Spiegel begegnet das Ich seinen Gedanken, die es uns vorführt:
ICH DENKE AN DICH
Wenn der Regen vor die Häuser
Fällt,
Denn es regnete,
Als ich aus Deiner Tür ging.
Und ich denke an Dich,
Wenn die Sonne durch alle Dinge
Spazierengeht,
Weil es hell war,
Als ich zu dir kam.
Also denke ich an Dich
Zu allen Zeiten.
Resultat der Lektüre eines derartigen Textes dürfte beim Leser wohl kaum Betroffenheit sein, sondern weit mehr ein Gefühl der Unverbindlichkeit des Autors dem Emotionalen gegenüber. Kunert rückt das Gelegenheitsmoment des Gedichtes (als ich im Regen von Dir ging) in gehörige Distanz: noch erahnbar, jedoch nicht mehr unmittelbar zum Gedichttyp gehörig, wird es vorn gedanklichen Prozeß, den das Gedicht austragen will, verdrängt. Nur in einigen Gedichten der sechziger Jahre scheint Kunert sein Mißtrauen. gegenüber der Tragfähigkeit des Unmittelbaren verloren zu haben. Betont distanzerheischend gibt sich dagegen schon der Titel eines Zyklus’: ENTWÜRFE. Nicht immer ohne dem Material Gewalt anzutun entwirft Kunert Gleichnisse, die Lehren vermitteln wollen, indem sie den geschichtlichen und sozialen Hintergrund transparent werden lassen. Kunerts „Lehrgedichte“ unterscheiden sich allerdings von denen Brechts, indem sie – wenn auch deren Ton benutzend – die aktuelle Utopie in den Vordergrund stellen. Gaben Brechts für das Stück Die Mutter geschriebene Rollengedichte – „LOB DES LERNENS“, „LOB DES KOMMUNISMUS“, „LOB DER DIALEKTIK“ – noch Anweisungen zum kollektiven Handeln, so verweist Kunert, der das aktuelle Moment der Gegenwart nicht ausspart, immer wieder auf jene Augenblicke, die den Status quo als Ergebnis geschichtlicher Erfahrungen des lyrischen Ichs markieren. Die Umwertung eines negativ aufgeladenen Begriffs wie „Anpassung“ wird beispielsweise selbst zum Gegenstand des ersten Gedichts des Zyklus’, in dem den Schriftstellern geraten wird, sich den neuen Zeiten „anzupassen“. Indem Kunert implizit dazu rät, neue Kunstmittel einzusetzen („Die Steinaxt gilt noch als Waffe, aber / Sie ist nicht mehr gefährlich.“) stellt er sich selbst in den literarischen Kontext der „Neuerer“. Gedichte wie dieses markieren die Schwierigkeiten, mit denen sich Kunert in jenen Jahren auseinanderzusetzen hat: sein skeptischer Individualismus steht zunächst den noch aufklärerischen Möglichkeiten eines Schreibens gegenüber; noch scheint ihm die Welt in dem Maße veränderbar, wie es ihm gelingt, den dialektischen Gang der Vernunft selbst zur Sprache zu bringen. Obwohl die damalige aktuelle Bedeutung solcher Gedichte heute kaum noch nachvollzogen werden kann, darf vermutet werden, daß derartige Appelle an das Bewußtsein der Zeitgenossen kaum die Wirkungen gehabt haben dürften, die sich der Autor versprach. Es zeigt sich auch, daß Kunert bei allem Insistieren auf Fortschritt und Aufklärung letztlich auch hier eine Auseinandersetzung geführt hat, die paradox war und paradox bleiben mußte. Charakteristisch dafür ist der achte Entwurf ZWEI ARTEN, der vorführt, wie die abtretenden alten Verhältnisse noch den aufkommenden neuen Ideen davonfahren, um schließlich von diesen doch eingeholt und überholt zu werden:
In einem alten Buch fand ich dargestellt
Zwei Arten vorwärtszukommen.
Herab von der eleganten Kutsche, bespannt
Mit kraftvoll sich bäumenden Pferden, betrachten
Höhnisch die Insassen
Einen Menschen, der ein häßliches Fahrzeug mit
Ölgeschwärzten Händen steuert, die Kutsche
Einzuholen.
Wie leicht traben die Pferde,
Wie verzerrt das Gesicht dessen im selbstfahrenden
Wagen. Sein aufgerissener Mund läßt Flüche
Vermuten auf die Schwäche des eisernen Motors.
Aber er fährt.
Das ist ein Gleichnis und trifft zu
Auf jedwede neue Weise fortzuschreiten:
Heiße sie Auto oder heiße sie
Kommunismus.
Die Eindeutigkeit dieses Gleichnisses läßt keinen Spielraum für Vermutungen: Wie man das Gedicht auch immer interpretiert: den größten Nutzen aus diesem Text wird vermutlich der Autor selbst gezogen haben. Doch ein wesentliches Element der Kunertschen Lyrik konstituiert sich bereits in diesen Versen: das der Paradoxie. Auch wenn der Ausgang dieses Textes in die Zukunft führt, und zwar in eine gesellschaftstheoretisch eindeutig fixierte, so bleibt er doch in dem Sinne „offen“, daß nichts über deren schließliche Gestalt und den Zeitpunkt der Verwirklichung konkret gesagt werden kann. Ein ständiges Widerspiel von Position und Gegenposition kennzeichnet auch dieses Gedicht; und bei allem Ernst, mit dem es seinen Gegenstand behandelt, wohnt ihm auch der Gestus eines Spiels mit Möglichkeiten inne. Das kennzeichnet jedoch nicht nur dieses Gedicht, sondern schlechthin den gesamten Charakter von Kunerts Lyrik der sechziger Jahre: Kunert überholt Kunert und wird wiederum von diesem überholt. Als dialektische Nothelfer werden DIE KLASSIKER aufgerufen (achter Entwurf), aber die NATUR selbst, die uns „ganz zu dienen“ scheint, erhebt sich doch immer noch gegen die vom Menschen verwaltete Welt. Kunert macht die dialektische Vernunft selbst zum Gegenstand seiner Gedichte, indem er ihren Gang aus den Niederungen des Kreatürlichen bis hinauf zu einem Reich der Freiheit verfolgt. Verlieren sich die ENTWÜRFE auch mitunter in der Abstraktheit des Begriffs: Kunert weiß in anderen Gedichten, daß das Humanum, welches in der Utopie steckt, auch im Konkreten seine Spuren für die Zukunft vorzeichnet: das kleine Gedicht „FOTOGRAFIE: LENIN MIT EINER KATZE“ spricht davon beredt. Dennoch ist für Kunert der Widerspruch an sich in dieser Phase noch ein sein Dichten beherrschendes Mittel; geradezu besessen macht er ihn immer wieder zum Gegenstand seiner Gedichte, Poesie als ein Medium begreifend, durch das ein dialektisches Prinzip sichtbar gemacht werden kann. So lautet ein SCHLUSSWORT AN DEN LESER:
Gewöhn dich dran: Der Widerspruch stirbt nie.
Es wäre keiner, könnte er einst sterben.
Er ist der Phönix. Wir sind seine Asche hie.
Wir werden ihn als unser bestes Teil vererben.
Gelöst entsteht er in der Lösung neu
Und treibt erneut uns, ihn zu lösen.
Wie nie ein Freund folgt er uns treu.
Doch wir sind folgsam ihm dabei gewesen.
Kunerts in den siebziger Jahren geschriebener Aufsatz „Paradoxie als Prinzip“ kennzeichnet eine Zwischenstufe im bisherigen Werk dieses Lyrikers. Er verweist auf zwei Gedichte eines Typus’, der seine Lyrik beherrscht und bereits mit Gedichten wie „GESANG FÜR DIE IM ZWIELICHT LEBEN“ ausgebildet wurde. Kunert kennzeichnet ihn als durch ein lyrisches Ich gebildet, das „als Legierung individueller und gesellschaftlicher Komponenten“ erscheint und einen Spannungszustand herstellt, der „aus dem scheinbar Widersinnigen, Unzuvereinbarenden herrührt: aus Paradoxie.“ – Es erweist sich, daß das, was von Kunert in den fünfziger und sechziger Jahren als Widerspruch erfahren und als solcher benannt worden ist, nun eine Sublimierung erfährt, die bemerkenswert ist. Von einer „Gleitbahn abstrakter Gedanken“ (Maurer) ist Kunert mehr und mehr zu jener Konkretheit gelangt, die es ihm ermöglicht, den dialektischen Vorgang als „Momentaufnahrne“, als „Schnappschuß“ zu bannen. Daß es Kunert dabei nicht um eine poetische Technik an sich geht, verrät der Essay eindeutig: dem Ich Günter Kunerts „ist das Unmögliche eingebrannt: das Vergessen vergessen zu machen“. Das Gedicht „NOTIZEN IN KREIDE“ ist „ein Gedicht gegen die Pest unserer Zeit: gegen den Faschismus.“ Und wiederum besteht er auf der Authentizität seiner historischen Erfahrungen:
Meine Erfahrungen, ich gestehe es ein, machen mich zum Realisten.
Die beiden Gedichte, die Kunert in diesem Essay zur Erläuterung seines Selbstverständnisses heranzieht, geben Auskunft über die Homo/Heterogenität von poetischer Praxis und theoretischem Verständnis. Das „dialektische Paradoxon“, das er anhand beider Gedichte apostrophiert, weist jedoch über sie hinaus und damit auf Not und Tugend eines Verfahrens, das innerhalb der DDR-Lyrik nichts Vergleichbares aufzuweisen hat. Kunerts sich immer deutlicher entwickelnder Stil eines lyrischen Parlando, der es ihm ermöglicht, fast jeden Gegenstand sicher in den Griff zu bekommen, entfernt sich zunehmend von einem Verständnis formaler Tradiertheit, das für Lyriker wie Karl Mickel (Goethe) oder Volker Braun (Klopstock, Hölderlin) charakteristisch ist. Auch der zeitweilig dominierende Aktivismus, der vor allem die sechziger Jahre während und nach der „Lyrikwelle“ kennzeichnete, ist ihm fremd geblieben. Innerhalb seiner eigenen Generation steht Kunert ohnehin allein, haben sich doch bei Lyrikern wie Günther Deicke oder Uwe Berger die poetologischen und ideologischen Prozesse abgeschlossen und verfestigt. Die Flexibilität, mit der Kunert jetzt auf die Ereignisse beider Welthälften zu reagieren vermag, zeigt, daß sein Prinzip der Paradoxie es ihm ermöglicht, seine geschichtlichen Erfahrungen im gegenwärtigen historischen Moment aufzuheben.
Zieht Kunert noch in den während der sechziger und Anfang der siebziger Jahre geschriebenen Gedichten einen scharfen Trennungsstrich zwischen den beiden beherrschenden politischen Systemen der Gegenwart, so berührt er mit späteren Texten immer eindringlicher die Sphäre des Existentiellen. Der Band DER UNGEBETENE GAST (1965) bereits kennt ein Hauptthema: die Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz, die Sorge, diese Existenz auch für die Zukunft zu gewährleisten. Dabei geht es Kunert angesichts der Möglichkeit eines dritten Weltkriegs durchaus nicht nur um ein nacktes Überleben, sondern seine Gedichte verweisen immer wieder auf eine bestimmte Qualität, die zu den Voraussetzungen gehört, damit diese Zukunft überhaupt sinnvoll erscheint: nämlich die der Humanisierung, die durch das bloße Machtraumdenken nicht gewährleistet werden kann. Die konkrete Utopie, die aus dem individuellen Tun und Lassen der Menschen erwächst, ist ihm keine Verheißung – anonym, und darum unzuverlässig –, sondern hat Name und Gesicht. Dadurch verliert die Kategorie „Widerspruch“ zunehmend an Abstraktheit, ist nicht, wie oft bisher, nur Postulat, sondern gewinnt auch an poetischer Plastizität.
Zwischen solchen Texten des Bandes DER UNGEBETENE GAST, die unmittelbar und mit scheinbarer Kunstlosigkeit aussprechen, worauf es Kunert ankommt, und die oft den Leser auf das Gedicht direkt zurückverweisen, indem sie vom Schluß des Gedichtes her eine Einsicht vermitteln, die „Aussage“ des Textes ist, stehen jene, die kunstvoll die Subjektivität des Autors mit dem Material des Gedichts und seiner Sprache verspannen. Zu ihnen gehört „WINTERTAG“:
Der glasweiße Himmel wolkenlos. Greller als
Die dunstfreie Sonne: der
Schnee. Aus schwarzem Eisen scheinbar und
Verbognen Röhren die nackten Bäume, unbeholfen
Geformt. Die kleine Brise
Bringt eisige Lähmung.
Hinter der frostgeblümten Scheibe
Des stillen Hauses (ein wenig Rauch steigt auf)
Zeigt sich undeutlich ein Gesicht.
Den dort
In der Abgeschiedenheit Wohnenden
Sieht im Vorbeifahren der Reisende mit
Neid; uneingedenk
Daß spurlos gleich diesem Tage, gleich dem
Schnee und den Bäumen, vergehen wird, wer so
Einsam ist.
Was dieses Gedicht ausspart, was aber in ihm enthalten ist, läßt sich aus den Schlüsselworten anderer Texte dieses Bandes schließen: Vergehen und Vergessen, Angst und Hoffnung, Zukunft und Heute, Freundlichkeit, Leben, Fülle, Dauer, Mut und Schwäche. Inmitten der dialektischen Beschreibung eines Zustands, die diese Gedichte zu geben versuchen, wirken derartige Begriffe – auch wenn ihr Gehalt zum Teil auf das Gegenteil hinweist – als Fixierungen auf eine Hoffnung, die die Menschwerdung des Menschen einschließt in einer Ordnung, die die Expropriation der Expropriateure bereits hinter sich gelassen hat und die sich anschickt, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Zu diesen Aufgaben gehört auch die Aufhebung der Entfremdung und Selbstentfremdung. Das Gedicht „WINTERTAG“ gibt nun – gewissermaßen mit einem negativen Vorzeichen – darüber Auskunft, wie sich Ideal und Wirklichkeit nicht entsprechen. Der Schluß – eine negative Konklusion, hervorgehend aus der Beschreibung eines Naturzustandes – enthält keinen Hinweis darauf, wie zu leben sei. Nur am Beispiel des in der Einsamkeit Lebenden, auf sich selbst Verwiesenen, schafft das Gedicht einen Hinweis auf Entfremdung (und Exil), bündig in seiner Art: als Parabel. Kunerts Bemühen, die eigentliche Bestimmung des Menschen zu benennen, findet freilich selten genug Ausdruck in einer „positiven“ Beschreibung. Nicht nur, daß latent vorhandene Angst vor dem Unwesentlichsein und -werden oft unverhüllt durchbricht – „So rasen wir / Mit dem Pferdeschlitten über das Eis und / Um die Wette mit dem, was / Rasend unter uns / Zergeht“ heißt es in „LAUFENDE REDUKTION DES UNGESEGNET ZEITLICHEN“ –: in vielen Texten apostrophiert Kunert sein Bild einer vermenschlichten Zukunft zuallererst am Gegenbeispiel der Vernichteten, Gestorbenen, Gescheiterten. Die Träume „der noch Niedergedrückten“, „die Gedanken der bereits Aufrührerischen“ wie die „Taten der sich schon Erhebenden („VOM VERGEHEN“) erhalten expressis verbis in Kunerts Gedichten jedoch kaum Kontur. Bestenfalls dienen ihm die als himmelstürmende Großtaten gepriesenen Satellitenstarts als ein warnendes Exempel:
In einer Kugel aus Metall,
Dem besten, das wir besitzen,
Fliegt Tag für Tag ein toter Hund
Um unsere Erde
Als Warnung, daß so einmal kreisen könnte
Jahr für Jahr um die Sonne,
Beladen mit einer toten Menschheit,
Der Planet Erde,
Der beste, den wir besitzen.
Kunert, gewarnt von den Entgleisungen der Geschichte (und Literaturgeschichte) kommentiert solcherart nüchtern, was andere in Hymnen und Manifesten besungen haben. Auch Gagarin bringt ihm nicht weniger und nicht mehr als eine Botschaft, die da heißt:
Die Erde ist nur eins.
Die darauf sind, müssen miteinander leben,
Oder von ihr wird es heißen: Leben keins.
Kunerts Fähigkeit, in allen Erscheinungen auch deren Widerspruch zu erkennen, indem er gängigen Bewertungen seine Sicht auf die Dinge entgegenstellt, macht ihn zu einem unbequemen Partner des Lesers. Jeder Romantisierung abhold, sieht er im Bestehenden auch dessen Negation. So manifestiert sich sein Fortschrittsbegriff vor allem darin, daß er den Dingen ihren schönen Schein nimmt. Indem er das real existierende Gleichgewicht der Kräfte beider Weltlager illusionslos interpretiert – ein in der DDR-Lyrik der sechziger Jahre noch seltenes Unternehmen – heißt es:
Sicherheit
Findet sich im Nirgendwo. Nicht getroffen
Von dem alles verheerenden Schuß
Werden einzig die Generationen, die vorher
Ins Nichts sich begaben.
So wie in diesen Versen nimmt Kunerts Gesellschaftskritik in keinem seiner Gedichte ausdrücklich Bezug auf die innerhalb der DDR oder im sozialistischen Lager existierenden Widersprüche. Trotzdem läßt sich aber nicht übersehen, daß er mit seiner unbequemen, kritischen Haltung, die fast immer aufs Ganze der menschheitlichen Problematik geht, sich oft selbst in den Widerspruch zu einer DDR-eigenen Kulturpolitik gesetzt hat, der über weite Strecken an einer realistischen, d.h. die Widersprüche ganz austragenden Literatur nicht gelegen sein konnte.
In seinen Überlegungen zur Lyrik hat Kunert wiederholt auf die relative Zweckfreiheit des Gedichtes hingewiesen. Dem entspricht auch in seinem Selbstverständnis die „allen Gedichten innewohnende Eigenart, bedeutungsvoll und bedeutungslos zugleich zu sein.“ Dennoch weisen alle von Kunert geschriebenen Texte darauf hin, daß dieser Lyriker ein poête engagé ist. Gerade dadurch, daß sich seine Gedichte der Beanspruchung durch staatsoffizielle Interessen entziehen, wird seine Präsenz als die eines Dichters deutlich, dessen Geschichtsverständnis nicht vor der eigenen Haustür halt macht. Der Prozeß der „Poesiewerdung“, wie er sich beim Lesen seiner Gedichtbände von den frühen fünfziger Jahren bis in die Gegenwart verfolgen läßt, entspricht seiner Einsicht, daß der Gang der Geschichte sich langsam und unter unsäglichen Opfern vollzieht. Er beschwört die absurd anmutenden Relikte der Vergangenheit und distanziert sich, den Leser einbeziehend, von ihnen, freilich zunehmend ohne die Hoffnung, ihre Benennung im Gedicht würde sie bannen. Schreiben selbst wird ihm zu einem Versuch, die bedrohliche Resignation angesichts der geschichtlichen Rückfälle aufzuheben und dem Paradoxen der Existenz selbst Stimme zu geben. Das jedoch geschieht nicht mit der Objektivität eines Chronisten, sondern wirkt als Sprachwerdung der eigenen biographischen Erfahrung und durch Identität/Nichtidentität und Betroffenheit, die diese Sprachwerdung im Gedicht überhaupt erst ermöglicht. Im „EPITAPH FÜR TADEUSZ BOROWSKI“ wirkt jene moralische Instanz, die die Schuldigen schuldig spricht, vor allem durch die Ordnung, mit der das Gedicht die Zeichen einer Zeichensituation zueinander in Beziehung setzt. Es geht um das Überleben eines in jedem Sinne Beteiligten – des polnischen Dichters Tadeusz Borowski. Dieses Überleben von Krieg, Auschwitz und Nachkrieg erweist sich für Borowski jedoch als keine Alternative zum Tod, dem er entkommen ist. Er erschießt sich 1951, neunundzwanzigjährig. Das Gedicht, das Begriffe wie „steinerne Welt“, „Herzen Granit“ und „Steine“ zu lastenden Sinnworten macht, wirkt selbst wie ein Monolith, darin jenes Epitaph Kunerts eingemeißelt ist. Ihm fehlt auch völlig das für Kunert charakteristische dialektische Wenden des Vokabulars, wie es frühere Gedichte kennzeichnet. Und: dieses Gedicht will und kann keine Lehre vermitteln außer der, die in der Biographie Borowskis und in deren Geschichtlichkeit selbst enthalten ist. Damit erreicht Kuriert jenen Sinn existentieller Wahrheit, der im Grenzbereich von Leben und Tod angesiedelt ist und um den es Kunert in zunehmendem Maße geht. Die Hoffnung, die diesem Gedicht innewohnt, erwächst aus der Anstrengung gegen das Absurde des Todes – und diese Anstrengung, im Vorgang des Schreibens enthalten, teilt die Struktur dieses Textes über dessen „Inhalt“ hinaus mit. Indem sich das Gedicht selbst in jener Grenzsituation von Tod und Leben ausbalanciert, erhebt es das „Banale“, Millionenfache „sinnlosen“ Sterbens zum besonderen-, zum Einzelfall. Das gilt – modifiziert – auch für andere Gedichte in der Nachbarschaft des EPITAPHs: Indem Kunert gegen das Modewort von der „unbewältigten Vergangenheit“ anschreibt, das ja die Leerstellen des allgemeinen Bewußtseins eher zudeckt als sie bloßzulegen, entdeckt er wie im Aufblitzen sich zuckend bewegender Filmbilder als Möglichkeit des Gedichts die Reversibilität des vergangenen geschichtlichen Augenblicks. Von „der Zukunft, / Die ins Heute zu sickern / Beginnt“ sieht nicht nur das der Gewehrkugel und den Häschern entkommene lyrische Ich die Vergangenheit: auch die Opfer der Gaskammern und Erschießungskommandos werden noch einmal an den Tag gebracht und so dem Vergessen entrissen.
Die Umkehrung des Irreversiblen – „Film – verkehrt eingespannt“ heißt eins der Gedichte – wird zur Methode, die als ein memento mori ein Jüngstes Gericht heraufbeschwört: unter der Oberfläche der inzwischen geglätteten Massengräber beginnt die Auferstehung der Opfer:
WENN DIE FEUER VERLOSCHEN SIND
Fällt die Asche in die Kamine zurück:
Aus den Ofen gleiten die Leiber heil
Und erheben sich. Das Gas verweht.
Aus den zementenen Menschenfallen
Gehen sie hervor.
Voran die Kinder. Über die Rampe in Viehwaggons
Zum wiederholten Mal: Eilig und eisern
Ziehen ihre Bahn sie in sechsfacher Richtung
Sterngleich:
Nach Kiew. Paris. Athen und Amsterdam.
Lemberg und Berlin. In die gewesenen Städte.
Da werden welche heimkehren
Erwartet von Haus und Tisch und Bett
Als wäre nichts geschehen: Einen Augenblick nur
Ausgegangen
Der Leuchter, der gewisse, der siebenarmige:
Für eine kleine Weile
Nachdenklicher Dunkelheit.
Ein Gedicht wie dieses nicht als ein politisches zu bezeichnen, dürfte unmöglich sein. Und doch liegt sein politischer Sinn nicht an seiner Oberfläche, wie ja auch die geschichtliche Dimension, die es mitteilt, derart unerhörten, jedoch wirklichen Geschehnissen angehört, daß schon deren bloße Mitteilung unser Betroffensein auslösen sollte. Daß dem nicht so ist, lehrt die Geschichte auch: selbst die massenhaft verbreiteten Aufnahmen geöffneter Massengräber oder der zum Verbrennen aufgeschichteten Leichname der Toten des 13. Februar 1945 von Dresden haben es nicht erreicht, unser Bewußtsein dauerhaft zu aktivieren. Die Ambivalenz von momentanem Betroffensein und dem gut funktionierenden Mechanismus, der derartige Bilder wieder verdrängt, ist jedem bekannt. Und zweifellos kann auch ein Gedicht wie Kunerts „WENN DIE FEUER VERLOSCHEN SIND“ seine Wirkung nicht ausschließlich darin suchen, dort Betroffenheit auszulösen, wo ein Bewußtsein von der geschichtlichen Präsenz des Faschismus und seinen Methoden fehlt. Entscheidend ist jedoch, daß der ästhetische „point of view“ dieses Gedichts die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich zieht, indem die poetische Idee des Textes zur Idee des Gedichts, zu der seiner poetischen Realisierung gemacht worden ist. Indem das Gedicht den realen Prozeß umkehrt und die Toten aus den Ofen in unser Leben zurückkehren läßt, leistet es einen Akt der Aktivierung und Reaktivierung des Bewußtseins, der es Celans „Todesfuge“ vergleichbar macht.
Auch in Kunerts Gedichten der siebziger Jahre wird man jene sich gegenseitig bedingenden Momente des Politischen und Poetischen, die das oben genannte Gedicht bemerkenswert machen, nicht vergeblich suchen. Die immer stärker hervortretende Individualität Kunerts – Merkmal seiner poetischen Authentizität – bekundet, daß die mitunter sich in sich selbst bewegende Dialektik seiner früheren Gedichte nun endgültig von einem Stil abgelöst worden ist, der sich durch eine Unmittelbarkeit kennzeichnet, die die Distanz zwischen lyrischem Ich und seinem Gegenstand verringert. Tatsächlich ist auch in Kunerts späten Gedichten die Distanz zwischen Ich und „Rolle“ völlig getilgt: das Ich selbst ist Agens einer Sprechweise, in der das Verschmelzen von Geschichtlichkeit und Individualität Gedichte entstehen läßt, deren skeptisch-trotzige Tonlage sich jedem Versuch einer Kategorisierung widersetzt. Antinomien wie optimistisch/pessimistisch oder positiv/negativ – Fritz J. Raddatz z.B. glaubte, in Kunerts Gedichtband Im weiteren Fortgang ,,keineswegs optimistische Züge“ sehen zu können – verkennen die Eigenart dieses Dichters. Kunert selbst, der die Bedingungen seines Schreibens sehr genau kennt – was durchaus nicht für jeden Autor selbstverständlich ist – hat mit Recht darauf verwiesen, daß eine „falsche Identifikation“ im Sinn einer Gleichsetzung von Schwärze = Negativ = Schwarzseherei ergo Pessimismus am Wesen der Intention seiner Lyrik vorbeigeht. Die dialektische Schärfe mit der Kunert in vielen seiner späten Gedichte ein Auf-sich-selbst-Verwiesensein des Menschen in einer Dingwelt konstatiert, gegen deren Konsumcharakter auch der real existierende Sozialismus nicht gefeit ist, macht seine Lyrik in dem Sinne „unbequem“, daß sie sich nicht dem „Verbrauchtwerden“ angepaßt hat. Auch die Gedichte des Weltreisenden Kunert konsumieren nicht Orte und Stationen seines Reisens, sondern problematisieren seine Zeitgenossenschaft, indem sie nachdrücklich und ununterbrochen auch an jene Toten wie Anne Frank erinnern „für die nirgendwo / ein Grab ist / außer in unserem Gedächtnis“.
Diese permanente Auseinandersetzung mit dem Phänomen Geschichte kennt allerdings einen Ort, der als Fixpunkt direkt und indirekt immer wieder in Kunerts Gedichten erscheint: Berlin. Als Brennpunkt von Kunerts geschichtlichen und literarischen Interessen ist diese Stadt, deren eigenes Schicksal auf die Biographie des Dichters wie keine andere gewirkt hat, eng mit dem Werk des Fünfzigjährigen verbunden.
„Man kann die Erde des Vaterlands nicht an den Schuhsohlen mitnehmen“ heißt es in Büchners Dantons Tod. Kunerts Haus in Buch bei Berlin ist der Ort einer permanenten Auseinandersetzung mit den Gefahren und Gefährdungen, die uns zu beherrschen versuchen. Kunerts Geschichtsverständnis, dem Brechtschen „Lege den Finger auf jeden Posten“ folgend, hat sich – undogmatisch – jenen Gedanken von Marx zu eigen gemacht, daß „die Menschen zwar ihre eigene Geschichte machen, aber nicht aus freien Stücken, denn die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf den Gehirnen der Lebenden“. Keine Totenbeschwörung, wohl aber ein tüchtiger Schuß preußischer Skeptizismus, beherrscht Kunerts lyrisches Werk. Ingeborg Bachmanns Gedanke, daß eine Poesie, die in die Gegenwart wirken will, „wie Brot zwischen den Zähnen knirschen und den Hunger wiederwecken müsse, ehe es ihn stillt“, scheint mir auf Kunerts Lyrik anwendbar zu sein. Kunerts Gedichte haben – ohne in einem vordergründigen Sinn „Gebrauchslyrik“ zu sein – einen Gebrauchswert, der sich mit einem Vers des in der Ahnenreihe der Illusionslosen stehenden Günter Eich umschreiben läßt:
Seid Sand, nicht Öl im Getriebe der Zeit!
Der Hoffnungsimpetus, mit dem Kunert trotz alledem schreibt, fragt nach, bohrt, wehrt sich gegen die falschen Verallgemeinerungen, indem seine Poesie sich von jener Konkretheit nährt, die durch die Erfahrungen des lyrischen Ich abgedeckt ist. Der Marxismus und dessen historisch-materialistische Methode – im alltäglichen Verständnis der Funktionäre nicht mehr nach seinem wahren Gehalt befragt, sondern zum bloßen ideologischen Propagandainstrument verkommen – ist bei Kunert ständig präsent und wird zum Mittel eines Rekurses auf die Geschichte. Nicht in der falschen Utopie schöner Verheißungen, sondern im gegenwärtigen geschichtlichen Augenblick entdeckt Kunert jenen Funken Zukunft, der zur Flamme werden könnte, wenn… Um dieses „Wenn“ jedoch geht es, solange man akzeptiert, daß die Opfer, die die Geschichte verbraucht hat, überhaupt einen „Sinn” gehabt haben. Was sich aus Kunerts Gedichten herauskristallisiert, sind jene „Bekundungen von Güte“, die angesichts der sich zuweilen kundgebenden „Sinnferne“ und „Unfaßbarkeit des Lebens“ noch in der Negation des Bestehenden selbst spürbar bleiben.
„Sinnsuche“ heißt ein Gedicht, das zu einem jener anscheinend vergeblichen Anläufe ansetzt gegen den „Gedächtnisschwund“, der das „Schwinden der Armut“ begleitet, „die / ihren Aufenthaltsort wechselt“, indem sie „umzieht / vom Magen zum Kopf“:
Aufstehen. Arbeiten und heimgehen
und ins Bett: das ist der Sinn.
Aufgestandensein und erschossen
und begraben werden: das ist der Sinn gleichfalls.
Werde und stirb: ist die Umkehrung sinnvoller?
Auf und heim und schießen
und selber getroffen ins Grab oder ins Bett:
ist eine Alternative der Sinn?
Aufgestandengewesen und heimgegangen,
gearbeitet haben und geschossen,
eingegraben, aufgebettet, aufgegeben:
den Geist, den Sinn, daß dies
der Sinn sei, aber er ist es trotzdem:
Aufstehen, Arbeiten, Heimgehen.
Alle Verwüstungen der Person
vollziehen Personen, überzeugt vom Sinn
des Vollzugs: Quellen steter Sinnflut.
Eine Taube schick aus
zu einem Festland: dich selber suche, du findest dich
an der Arbeit für dein Bett, für dein Grab.
Wie häufig in Kunerts Gedichten, so erscheint auch hier der Text als eine Aufgabe, die, an den Leser gerichtet, hinter sich verbirgt, was er, der Leser, an „Arbeit“ zu leisten hat, um „das Gedicht im Gedicht“ (G. Wolf) zu entdecken. An seiner Oberfläche scheint der Text nichts zu vermitteln als die schroffe Absage an jedwede Hoffnung: kein wie auch immer geartetes Subjekt versucht hier, aus dem zeitlos scheinenden Kreislauf geschichtlichen und leiblich-biologischen Geschehens auszubrechen. Eine Anthropologie der Aussichtslosigkeit scheint Platz greifen zu wollen, endgültig und unabweisbar. Und doch: Kunerts Gedicht besteht gerade indem es auf eine Seite des Lebens verweist, auch auf der Möglichkeit der anderen. Drehpunkt der Möglichkeit, aus dem Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten und Heimgehen ausbrechen zu können, sind die Verse „Alle Verwüstungen der Person / vollziehen Personen, überzeugt vom Sinn / des Vollzugs“. Die geschichtliche Situation bleibt nicht anonym und zeitlos, sondern erweist sich als äußerst bestimmt: namhaft gemacht werden die Stellvertreter der Herrschenden, die Ideologen, die die Einschränkung des Subjekts als zweckgerichtet absegnen. Die Paradoxie, bei Kunert oft im Gedicht ausgetragener Dialog von Widerspruch zu Widerspruch, wirkt in diesen Versen als Provokation auf den sich zur Identifikation konzentrierenden Leser. Dieser wird herausgefordert, den Standpunkt des Autors nicht für immer und endgültig zu akzeptieren. Das Gedicht, das (wie es Kunert einmal auf einen anderen Autor bezogen formuliert hat) „seine Hoffnung auf die Kraft und Dynamik des Lebens selber setzt“, observiert zwar die Hoffnungslosigkeit eines auf die „Brauchbarkeit“ des Subjekts reduzierten Lebens, aber es denunziert dieses Leben nur in dem Maße, wie es verändert werden muß. Gerade weil das Leben „an sich“ keine Sinngebung kennt, ist die „Sinnsuche“, die Kunert angesichts der Absurdität des Lebens und des Todes vorschlägt, nicht vordergründig in der Vermittlung von Lebensregeln und -interessen zu finden. In Kunerts Gedicht selbst verbirgt sich der Anstoß, die „Quellen steter Sintflut“ zu verstopfen: sich selber zu suchen, um seine eigene Lage zu erkennen. Somit wird der Leser, verwiesen auf seine eigene gesellschaftliche und existentielle Situation, vom Objekt zum Subjekt der Geschichte. Kunert, der die Einschränkungen kennt, denen jede klassenkämpferische Aktivität unterworfen ist, kann nicht mehr wie Brecht zum Kampf des „Unten“ gegen das „Oben“ aufrufen. Aber er vermittelt die Einsicht, daß der scheinbar ewige Kreislauf von „Werde und stirb“ zumindest von einer Sinngebung des Lebens dergestalt ausgefüllt werden kann, daß Aufstehen, Arbeiten und Heimgehen nicht auf die Dauer die ersten Bürgerpflichten zu sein haben.
Kunerts „Sinnsuche“ wird zum Programm eines Schreibens, das seinen Sinn auch angesichts der geschichtlichen Fehlplanungen und der heraufdämmernden Umweltkatastrophen nicht aufgibt. Es folgt als Prozeß der Selbstrealisierung des Menschen K. einem „individuellen Weltverständnis“, von dem Kunert, bezogen auf seine Lyrik, sagt:
Meine Gedichte sind meine Gedichte: Entsprechungen meines Selbst, welches nachdrücklich zeit- und gesellschaftsgeprägt worden ist.
Aber Kunerts Weltverständnis – dies wäre hinzuzufügen – greift über das Individuelle hinaus, indem es gegen jede Verfestigung des Denkens und der Geschichte engagiert ist, auch dort, wo das lyrische Ich Trauer, Resignation und Verzweiflung durchmißt.
Heinz Czechowski, aus Michael Krüger (Hrsg.): Kunert lesen, Carl Hanser Verlag, 1979
Peter Hamm: Zur Situation der jüngsten DDR-Lyrik, Merkur, Heft 205, April 1965
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
DAS&D + Archiv + Internet Archive + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett + IMAGO +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ Sinn und Form ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


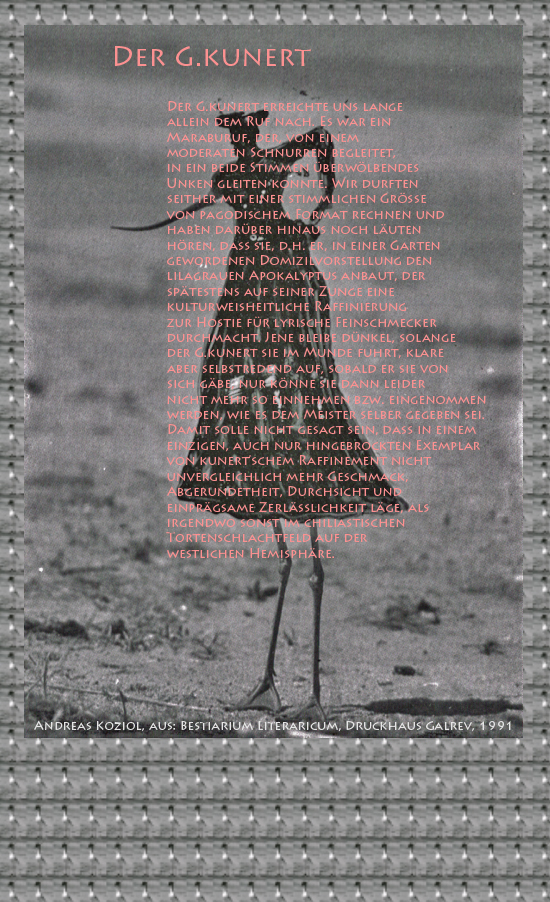
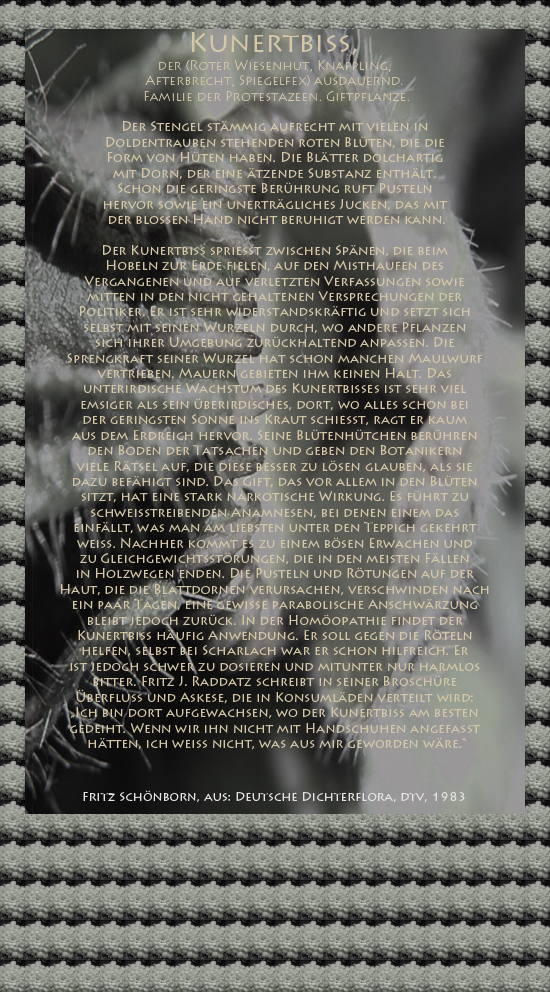
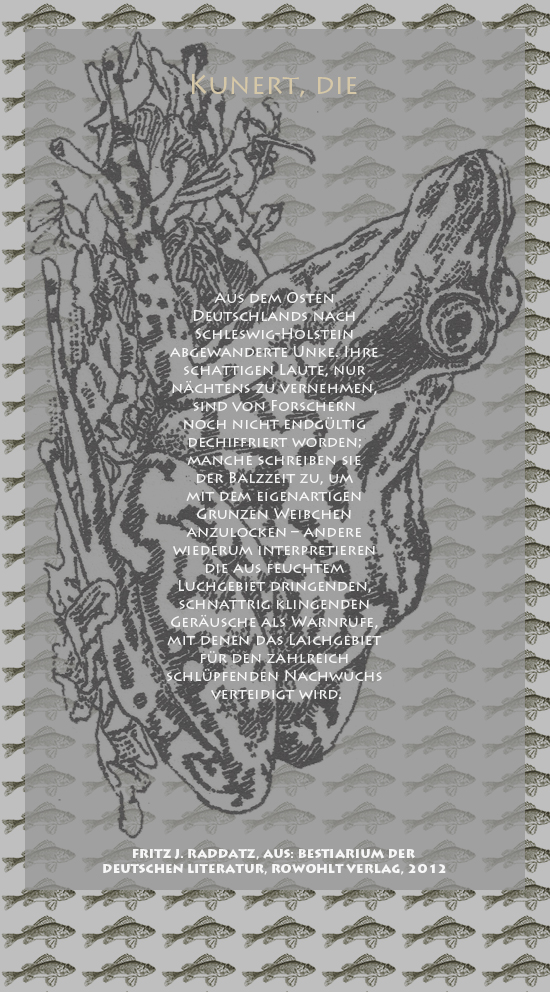
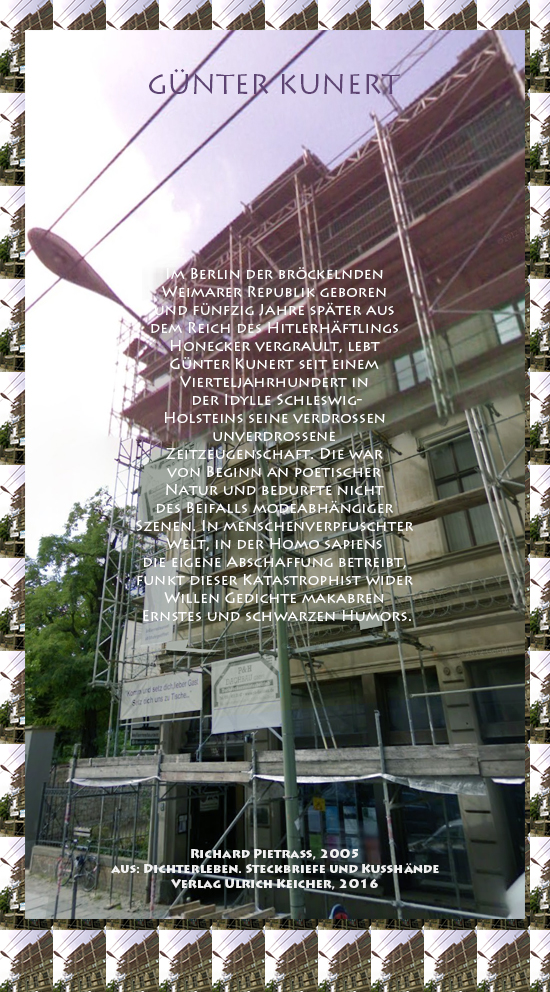












Bitte vorherigen Kommentar ergänzen:
auf V. 8 enthält einen Fehler: “nieder sah” statt “niedersah”.
sehr geehrte frau metzger, leider können wir zur zeit ihre fehleranmerkungen betreffs der rechtschreibung nicht überprüfen. wir müßten in dem buch von kunert nachschauen. so wie es dort steht, ist es für uns verbindlich. es wäre sehr hilfreich und ginge wesentlich schneller, wenn sie uns ein foto des gedichtes schicken könnten.
Bitte um Korrektur!
Im lyrischen Text “Gagarin” befindet sich ein sinnentstellender Fehler, der auch in der baden-württembergischen schriftlichen Prüfung zum MBA 2021 übernommen wurde. S. 3, V. 1 lautet nicht etwa “er liebe sie” (in vermeintlicher Fortführung der Verwendung des Konjunktiv I in der ersten Strophe), sondern vielmehr “er liebte sie” in direkter grammatischer Linie zum narrativen Präteritum der Strophe 2.
Generell darf die oft sehr nachlässige Wiedergabe noch lange nicht gemeinfreier Texte im Internet bemängelt werden.