Günter Kunert: Die befleckte Empfängnis
DR. BENN, SPÄTES FOTO
Gesicht: besorgt. Die kahle Stirn
vielfältig und der Blick verschlossen.
Ein Zeitenknotenpunkt: Sein Hirn.
Und immer ohne Weggenossen.
Viel Haß. Zuviel für einen
der doch das Wort erhalten hat:
Die Selbstzerstörung findet im Geheimen
und trotzdem vor dem Leser statt.
Ausbruch aus Gefangenschaft
Nach wie vor gestatten die Gedichte Günter Kunerts keine Gleichgültigkeit. Schon die ersten Blicke in den Band Die befleckte Empfängnis reichen bereits, um das zu wissen. Er bringt eine Auswahl der Gedichte, die Günter Kunert verfaßte, seit er das märkische Berlin verließ, um im norddeutschen Kaisborstel zu siedeln.
Der Dichter hat beachtenswerte Berlin-Gedichte geschrieben. Einige der besten im letzten Halbjahrhundert. Berlin bleibt er zugetan. Berlin konzentriert seinen Kummer und mehr. Quillt die Auswahl auch nicht vor Berlin-Andichtungen über, so nehmen sie doch einen dominierenden Platz in Anspruch. Der Lyriker wagt nichts, wenn er seiner Wehmut Worte gibt. Nur so kann er immer wieder aus der Gefangenschaft ausbrechen, in die ihn die Gefühle bringen. Gefangennahme, Ausbruch, Gefangennahme… ziehen den Teufelskreis. Der wächst wie die Jahresringe der Bäume. „Wie keine mein ist diese: Stadt“ schreibt Kunert, der Berlin meint und viele Städte als „Ausdruck betonierter Depression“ sah.
In der Lage, seine Liebe der Liebe wegen zu verlassen, ist er nicht dazu verdammt, seine Liebe zu verraten. Also spricht er, mit Scham auch, aber ohne Scheu als ein selbstgetäuschter, selbstenttäuschter Liebhaber. Einer, der sich – nur sich? den Rat gibt: „Du selbst bleibst dir besser ungewiß.“ Diesem subjektiven Wunschdenken Kunerts kommt das denkende Subjekt Kunert immer wieder in die Quere. Und das will so gern Gewißheit, obwohl die Lektion längst ausgelöffelt ist, daß es keine Gewißheit gibt. Gläubig, ungläubig, fremd, befremdet guckt der Lyriker auf das – nicht ewige? Menschengeschlecht und den Globus, den es – noch! – bevölkert.
„Reisebericht“ hätte nicht nur der Titel eines Gedichts, hätte der Titel des ganzen Bandes sein können. Was der Lyriker den Lesern liefert, sind die Erd-Erkundungen des Günter Kunert. Der ist durch und durch ein irdisches Wesen, dem sich das Wesen der Welt äußerst unwirtlich zeigt. Er kann und will nicht recht heimisch werden in der wirklichen Welt. Nirgends heimisch, spricht er mit der Stimme des Lyrikers, der ins Exil des Lebens verstoßen wurde. Mit den Mitteln der Sprache zimmert er sich ein Dach, um unter ihm zu existieren. Am besten durch ein „Heimkehren in die biologische Wahrheit“? Könnte das tatsächlich ein Ziel, gar das Ziel des ruhelos Reisenden sein? Es könnte, kämen ihm nicht immer wieder einmal Zweifel an der ganzen Zeilen-Schinderei. Dennoch nicht die Finger vom Schreiben zu lassen, bedeutet, den eher klagenden denn anklagenden Aufschrei nicht zu ersticken. Die Gedichte des Günter Kunert sind therapeutische Aus-Sprachen, die die Gefahr der Bildung von Geschwüren mindern.
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 4.12.1989
„Gebeine bilden unsern Lebensgrund“
Es gibt, erfreulicherweise, in der DDR einen neuen Kunert-Band. Zuletzt (1980) war hierzulande Unterwegs nach Utopia erschienen, Verse der Jahre 1974 bis 1977 enthaltend. Inzwischen aber präsentierte Kunert bei Hanser drei Sammlungen: Abtötungsverfahren, Stilleben, Berlin beizeiten. Und der Aufbau-Band, vorgelegt kurz vor dem 60. Geburtstag des Dichters, unterbreitet nun den hiesigen Lesern eine Auswahl aus diesen Sammlungen – wobei sogleich hinzugefügt werden soll, daß sie, mit Befriedigung ist es zu konstatieren, nichts Feigenblatthaftes an sich hat. Sie macht 161 Gedichte zugänglich, führt keinen irgendwie gefilterten Kunert vor, vermittelt ein Bild, das als angemessen bezeichnet werden kann. Besorgt hat die Auswahl Almut Giesecke. Ihre Leistung verdient es, ausdrücklich hervorgehoben zu werden.
Vielleicht das Auffallendste an diesen neueren Kunertschen Gedichten: Für sehr viele von ihnen wurde die vierzeilige Reimstrophe gewählt. Deren Fähigkeit, auf lapidar pointierende Art Befunde zu fassen, zu denen das radikal desillusionierte, das unglückliche Bewußtsein gelangt, hatte am prägnantesten Gottfried Benn ausgebildet:
Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten
sich deine Sphären an – Verlust, Gewinn –:
ein Spiel von Bestien: Ewigkeiten,
an ihren Gittern fliehst du hin.
Der Bestienblick: die Sterne als Kaldaunen,
der Dschungeltod als Seins- und Schöpfungsgrund,
Mensch, Völkerschlachten, Katalaunen
hinab den Bestienschlund.
(„Verlorenes Ich“)
Und für Kunert ist Benn zweifellos anregungskräftig geworden. Was nicht bedeutet, daß Distanz völlig dahingeschwunden wäre. „Dr. Benn, spätes Foto“, lautet einer der Gedichttitel:
Gesicht: besorgt. Die kahle Stirn
vielfältig und der Blick verschlossen.
Ein Zeitenknotenpunkt: Sein Hirn.
Und immer ohne Weggenossen.
Viel Haß. Zuviel für einen
der doch das Wort erhalten hat:
Die Selbstzerstörung findet im Geheimen
und trotzdem vor dem Leser statt.
Ein Bennscher Haß schlägt sich denn auch nirgendwo nieder in Kunerts Gedichten. Die Melancholie, auf die sie sich gründen, bleibt frei von dessen böser Kälte. Wenn Benn aber nicht nur abstoßend, sondern auch anziehend auf Kunert zu wirken vermochte, so wohl deswegen, weil der Nachgeborene ein überkommenes dichterisches Werk erblickte, das in konsequentester Weise einer Totalernüchterung Rechnung trug. Daß Gott tot sei, hatte Nietzsche verkündet. Und kaum ein anderer hatte die Bedeutung dieses Satzes so furchtbar bis ins letzte erfaßt wie Benn. Kunert wiederum war, da sich ihm jeglicher Glaubensrest verflüchtigte, ein Mann schon in den mittleren Jahren: Um so entsetzlicher die Macht seiner Verlust-Erkenntnis. Die Notwendigkeit jedoch, als Dichter zu leben mit ihr, mußte die Suche nach einem Maß beginnen lassen; gerade weil diese Erkenntnis einer allumfassenden Leere als absolute begriffen wurde, schien die haltgebende Hilfsinstanz einer festen Form geboten – und zugleich einer solchen, die in der Lage wäre, das negativ Definitive bündig-adäquat hervorzukehren. Und eben bei Benn konnte Kunert vorgebildet finden, wonach es ihn verlangte. Er entdeckte sich das Anregende eines Gedichttyps, dem „schlagend“ gereimte Aussagen über die Verlorenheit des Ichs sowie über den Mangel jeglichen Sinnzusammenhangs in der Welt das Gepräge gaben.
Gleichwohl sind Kunerts Verse wieder und wieder durch innere Spannung gekennzeichnet. Was als nackte und klare Wahrheit erfaßt wurde, steht polar jener religiösen beziehungsweise parareligiösen Hoffnung gegenüber, die als Erinnerung noch immer unvergessen ist und die auch dem derzeitigen Ich im Sinne eines schmerzlich bewußten Bedürfnisses eignet. „Götterdämmerung“:
Nicht festzuhalten: Dieser Tag. Das Leben
Gewebe löst sich auf und schwindet hin.
Was auch geschieht, du suchst den Sinn.
Zumindest wirst du danach streben.
Du kannst die Einsicht nicht ertragen:
Aus Dreck und Feuer eine Spottgeburt.
die haltlos durch das Universum tourt,
stets auf der Flucht vor solchen Fragen.
Erkenntnis die: Wir können uns nicht fassen.
Und finden keinen, der uns Göttern gleicht.
Und keinen, der uns Hilfe reicht.
Wir sind uns ohne Gnade überlassen.
Und wenn hier neben dem chaosbewußten Goethe auch der auf Sinn und Daseinserfüllung insistierende vergegenwärtigt wird, so bleibt dieser letztere ja noch dort unabgefertigt, wo ihn das Ich entschieden korrigiert:
Verweile doch. Laß dich umarmen.
Du mir nah wie der Moment,
den man mit vielen Namen nennt.
In unserm Falle mit: Erbarmen.
Es ist der karge Augenblick,
der später lebenslänglich dauert,
obgleich man über seine Kürze trauert:
Was niemals war, bleibt dir zurück.
Nur Zeichen. Aber kein Gelingen.
Ein Wort, das alles das enthält,
was du ersehnst: Sobald es fällt,
regt Ikarus erneut die Schwingen.
(„Goethe – stark verbessert“)
Freilich ist die Abwandlung charakteristisch. Nicht der „große“, sondern der im Elend harrende Mensch steht im Kunertschen Blickpunkt. Wenn sich aber solch individuelle Elendserfahrungng stets aufs neue mitteilt in den Gedichten, so – wie im hier zitierten – auch stets als eine ganz unegozentrisch gefaßte. Und keine Spur demnach von aristokratisch-elitärem Leidensstolz. Nochmals ist Benn zu erinnern: Ihm waren Gesten, die Exzeptionalitätsbewußtsein zum Ausdruck bringen, nicht fremd. Kunert hingegen läßt ein Ich sprechen, das zumeist „nur“ artikuliert, was es doch im Grunde für alle als zutreffend erachtet. Die im Gedicht reflektierte „Alltagsexistenz“, es ist diejenige des Ichs und gleichwohl die eines Jedermann:
Wie überleben, wenn nicht als ein Stein?
Wir werden täglich überrollt und gleich vergessen.
Vergeblichkeit heißt unser Schmerz. Indessen
wir Stück für Stück verkaufen unser Sein.
Ich liebe dich: So reden Stimmen,
die weder deine noch die meine sind,
aus Apparaten, während Nacht um Nacht verrinnt
und alle Ziele sacht in Nichts verschwimmen.
Es sinkt der Tag, du hebst dein Haupt,
vergreist, verkarstet und von Träumen leer –
nur tote Schatten kommen zu dir her:
Ein Gott der stirbt. Und es nicht, glaubt.
Daß Kunert in seinen Gedichten der alltäglichen Sprache verhaftet bleibt, daß er die Möglichkeiten moderner Metaphorik ungenutzt läßt, dürfte mit dieserart Gemeinsinn zusammenhängen. Was immer als esoterisch gelten könnte, die Kunertschen Verse geben ihm keinen Raum. Dabei ist erstaunlich, welche Ausdrucksleistung der konventionellen Sprache abgenötigt wird, und dies um so mehr, als Kunert mit schockierend verfremdenden Pointen durchaus sparsam umgeht: In seinen Gedichten stellt er eine Sprache her, die als solche, noch indem sie expressis verbis jeden Rest von Verläßlichkeit und Stabilität illusionslos in Frage stellt, auf unbezweifeltem Grunde baut. Und es wären auch Interpreten denkbar, die in Anbetracht des Widerspruchs geneigt sein mögen, von einer paradoxen Ungereimtheit zu reden. Freilich erscheint es eher angemessen, dieses Kunertsche Sprachverhalten mit einer Kommunikationsfreundlichkeit in Verbindung zu bringen, der ein ernstlicher Verständigungsimpuls zugrunde liegt. Erstrebt wird Kommunion im Zeichen der „nackten“ Wahrheit; und eine kleine Hoffnung ist damit den Gedichten denn doch eingeschrieben. Vielleicht die auf ein allgemeineres Innewerden der elenden menschlich-gesellschaftlichen Existenzsituation – und auf ein Innewerden, aus dem solidarisches Selbsterbarmen hervorgehen könnte.
Mit dieser kleinen Hoffnung korrespondiert wohl auch der immer wieder unternommene Versuch, Erinnerungsarbeit zu leisten. Daß sie vergeblich sei, Kunert gibt diesem seinem Wissen unüberhörbar Ausdruck. Und wenn er es tut, steckt gar nicht etwa ein Zweckpessimismus dahinter. Doch wie seit je läßt er kaum ab, der Zeichenspur des Vergangenen, vom Vergessen Bedrohten nachzuforschen: Dem deprimierenden Wissen opponiert der bohrende Drang, eine Gedächtnistätigkeit zu bezeugen, die gerade deswegen gefordert erscheint, weil das „sorgfältig gebundene“ Buch der Geschichte den Dienst verweigert:
Als ich das Buch aufschlug
in diesem Moment
schwirrten die Buchstaben
auf und davon: Mir blieb
das sorgfältig gebundene Vergessen
Sprachlos über die leeren Seiten
der Geschichte geneigt
wußte ich nicht mehr
was war was ist
wer ich bin
sein kann sein will
werde
Aufgeregte Schriftgelehrte
sprangen umher mit großen Netzen
brachten mir ihren Fang
und schütteten die ermatteten Reste
an den alten Platz zurück
(„Vorfall“).
„Bauernkriegs-Eingedenken“, „Père-Lachaise“, „Am Landwehrkanal“. Und Verse, denen die Erinnerung an Dichter, Maler eingezeichnet ist. Ein Gedicht aber auch wie „Requiem“:
…
Hier sind Leute gewesen
sagt der Weg: Hier sind sie lang
gegangen und sind nicht
wiedergekommen. Nur das Gras
ist ihnen gefolgt
bis an die rostigen Gleise. Sieht so
meine Heimat aus
verwildert von Gleichgültigkeit?
Der die Frage stellt: ein zutiefst Befremdeter.
Wir aber, die wir sie vernehmen denen sie unter die Haut geht?
Bernd Leistner, neue deutsche literatur, Heft 446, Februar 1990
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
A. Günther: Worte und ein Doppelpunkt
Sächsisches Tageblatt, 11./12.3.1989
Rüdiger Bernhardt: Beschreibung des Befindens
Liberal-Demokratische Zeitung. Halle/Saale, 13.5.1989
Thomas Bickelhaupt: Ein Windhauch aus Utopia
Thüringer Tageblatt, 8.6.1989
Eckhardt Ullrich: „Die befleckte Empfängnis“
Sonntag, 10. 12. 1989
Kunert-Rezeption in der DDR?
− Einige Beobachtungen zu einem Un-Thema. −
Eigentlich hat man es gar nicht anders erwartet. Und was von Anfang an vermutet wurde, bestätigt sich durch Recherchen. Die mageren Ergebnisse passen nur zu gut in das Bild von der DDR vor dem Mauersturz, das sich vom Westen aus geboten hat: Ein Staat, der alle Mittel einsetzt, Widerspruch und Kritik zu unterbinden, der wird auch versuchen, die Echo-Stimmen dieser Kritik zum Schweigen zu bringen. Die Rezeption Günter Kunerts nach seinem Weggang aus der DDR im Jahr 1979, sie wird wohl gleichermaßen an der mangelnden Verfügbarkeit der Primärtexte scheitern wie auch an den nicht vorhandenen Publikationsmöglichkeiten für Sekundärtexte.
Günter Kunert selbst:
(…) natürlich gibt es nach 1979 keine Kunert-Rezeption in der DDR. Da ich ja 79 wegging, war ich eben eine Unperson! Aus den Bibliotheken wurden meine Bücher entfernt – das war die Rezeption!
Die wenigen Texte von und über Günter Kunert, die dennoch zu finden sind, bestätigen in Anzahl und Art eher die Feststellung des Autors, als daß sie sie widerlegten. Auch wenn noch 1981 in dem von Ingrid Hähnel herausgegebenen Band Lyriker im Zwiegespräch zwei Texte zu Kunert zu finden sind, so betonen diese doch in ihrer Einzigartigkeit, wie sehr der Autor nach 1979 ein Unthema war. Offen ausgesprochen wird das erst seit dem gesellschaftlichen Umbruch in der DDR. Eckhard Ullrich beschreibt in seiner Rezension des Gedichtbands Die befleckte Empfängnis, wie 1980 seine „lange vorbereitete und mit einem immensen Materialberg grundierte Diplomarbeit von einem rückgratlosen Professor untersagt wurde“. Zwar wurden noch bis 1981 Bücher Kunerts beim Aufbau-Verlag verlegt, zwar lassen sich über die Jahre verteilt einige Texte Kunerts in DDR-Publikationen finden, doch sind diese Einzelfälle wegen ihrer geringen Zahl nicht systematisierbar. In ihrer Verschiedenartigkeit zeigen sie sich eher als Zeichen einer konzeptionslosen Kulturpolitik. Und die allgemein dominierende Ignorierung des Autors scheint diese Konzeptionslosigkeit am besten als systematisches Vorgehen kaschieren zu können.
Einige Beobachtungen der spärlichen Publikationstätigkeit bringen jedoch Eigentümlichkeiten zum Vorschein, die einige Aussagekraft besitzen. Beispielsweise gibt es eine literaturwissenschaftliche Behandlung der Texte Kunerts nur in den frühen achtziger Jahren. Dabei zeigt sich in den zwei bemerkenswertesten Beispielen, beide in Ingrid Hähnels Buch erschienen, eine ähnliche Argumentationstaktik.
Klaus Werner geht in seinem Beitrag „Rilke bei Kunert“ von einer Entwicklung der Auflösung fester formaler und weltanschaulicher Prinzipien bei Kunert aus und davon, daß deshalb nun „Kunerts weltanschaulich-künstlerisches Zuhause mit (…) Eindeutigkeit kaum mehr zu fassen“ sei. In einer merkwürdigen Gespaltenheit wird Kunert verteidigt und kritisiert:
Man muß Kunert zugute halten, daß er sein Irritiertsein freimütig aussprach (…).
Dazu wird härtere Kritik zitierend und verweisend übernommen. Tendenziell stört sich diese Kritik daran, daß Kunert sich von der Diskussion des Gesellschaftlichen ab- und der Beschreibung des allgemein Existentiellen zugewandt hat. Die formale Untersuchung durch Werner orientiert sich denn auch offen am Gesellschaftlichen:
Ergiebiger erscheint uns daher der Versuch, den von Rilke begründeten Entwurf des Dinggedichts, also ein bestimmtes literaturästhetisches Prinzip auf seine Funktionsweise in der Dichtung eines Lyrikers der DDR zu prüfen.
Bei aller Kritik, die Werner an den Gedichten Kunerts übt, kommt er doch zu dem überraschend konzilianten Schluß, daß die Texte in bestimmter Hinsicht dem gesellschaftlichen Auftrag von Dichtung in der DDR gerecht werden können:
Obwohl es sich hierbei um ein stärker gefühlsmäßiges als erkenntnishaftes Verstehen handelt, muß Kunerts Dinggedichten zugebilligt werden, daß sie das ,Anschaun‘ (…) elementarer Wirklichkeit, Aufgeschlossenheit gegenüber Daseinsreflexen der dinglichen Welt ausbilden helfen. Wie sehr sie auch immer verunsichern mögen, so liefern sie das Ich doch entschieden seiner eigenen Realität und der der anderen aus, entlassen es gleichsam abgeschminkt, erschreckt und geläutert in die Bewährung.
Werner, der sich ausschließlich mit Kunert-Gedichten aus dessen DDR-Zeit befaßt, billigt damit der in der DDR erschienenen Kunert-Lyrik zumindest eine in Maßen systemunterstützende Funktion zu.
Auch Ursula Heukenkamp äußert in ihren Dichterporträts Kritik. Seine Darstellung Heines sage mehr über ihn selbst denn über Heine aus, so lautet ein Kernpunkt. Dann kommt die Autorin jedoch ebenfalls zu einem harmonisierenden Schluß:
Kunert bringt sein Bekenntnis zur Unruhe im Verhältnis von Dichter und Welt in sein Heinebild ganz ein.
Aber diese beiden Beispiele sind zu wenig, um den Nachweis zu erbringen, daß unter der Tarnkappe der Kritik doch noch der abwesende Literat gewürdigt werden konnte.
Für die Außenstehenden nicht nachvollziehbar ist, warum in einer Zeit publizistischer Isolation mit älteren Kunert-Texten DDR-Literaten charakterisiert werden sollten. Wie, von wem und mit welcher Absicht publizistische Nischen gefunden und genutzt wurden, bleibt verborgen. Doch wirken solche Texte wie Zeichen gegen das totale Vergessen des Dichters. Eine Greßmann-Anthologie bietet Kunerts „Verspäteten Nachruf auf Uwe Greßmann“ (1974), ein Geburtstagsband für Stephan Hermlin das Antiporträt „Ein sozialistischer Grandseigneur“ (1976).
Erst in den späten achtziger Jahren erscheint die Mauer der Isolation wirklich durchlässiger. Kunert selbst beschreibt diese Zeit als „Zeit beginnender ideologischer Lockerung“. So erschienen 1987 in Sinn und Form erstmals wieder neuere Gedichte, dann zum sechzigsten Geburtstag erstmals wieder ein Buch Kunerts, der Gedichtband Die befleckte Empfängnis, der neuere Lyrik in einer Auswahl vorstellte. Zwar gibt es bereits aus dem Zeitraum kurz nach dieser Veröffentlichung erste Rezensionen, aber sowohl der Charakter der Besprechungen als auch die Veröffentlichungsorte weisen darauf hin, daß Günter Kunert zwar wieder erwähnt werden durfte, aber noch nicht im eigentlichen Sinne diskussionsfähig war. Diese Rezensionen erschienen in Zeitungen, die geographisch wie organisatorisch nicht unmittelbar an den Berliner Machtapparat des Staates gekoppelt waren.
Die verschiedenen Autoren gehen den eigentlichen Konflikten, die mit der Person Kunerts verbunden sind, aus dem Weg. Dadurch kommt es zu einer durchweg positiven Beurteilung der literarischen Qualität Kunerts, während inhaltliche Problembereiche entweder nicht thematisiert oder dezent in die sozialistische Publikationspraxis eingepaßt werden.
Uwe Nösner begründet in der Dresdner Union die literarische Qualität von Die befleckte Empfängnis durch eine konsequente persönliche Weiterentwicklung Kunerts, die nicht ortsgebunden sei:
Sie (die Gedichte) führen Früheres konsequent fort. Kunert war nie Wurzelloser, der karge nationale Boden der fünfziger Jahre hat ihn wohl getragen, aber nicht genährt, zu sehr war er – und ist es heute erst recht – Kosmopolit, Reisender in den poetischen wie realen Welten, (…).
Damit ist dem Weggang aus der DDR 1979 der Konfliktstoff entzogen, da der Ortswechsel ja Kunerts Wesensart gemäß ist und die literarische Entwicklung des Dichters nicht beeinträchtigt hat.
Ähnlich einfach die Vorgehensweise von Thomas Bickelhaupt im Thüringischen Tageblatt. Der Ortswechsel wird unkommentiert erwähnt. Die Biographie des Dichters kann nach Bickelhaupt lediglich die Inhalte, aber nicht das Wesen von Kunerts Lyrik ändern.
Die Besprechung der Liberal-Demokratischen Zeitung in Halle führt die doppeigleisige Argumentation am aggressivsten und deutlichsten vor. B. Bernhardt erkennt die literarische Qualität der Gedichte an, indem er auf ihre Bedeutung zur Verarbeitung allgemein existentieller Probleme verweist. Damit bleibt der Ortswechsel unabhängig vom literarischen Wert der Texte offen kritisierbar. Bernhardt geht von Kunerts Themen Tod und Vergänglichkeit aus, die sich „oft zu intensiver Beschreibung von Hoffnungslosigkeit“ verdichtet hätten. „Seit der Dichter 1979 in die BRD übersiedelte, haben sich Kunerts Überlegungen dazu weiter verstärkt (…)“. Und Bernhardts Bewertung dieser Umstände:
Enttäuscht und verbittert hat Kunert vor zehn Jahren einen neuen Anfang gesucht. Die Gedichte weisen aus, daß dieser Versuch zu noch tieferer Enttäuschung geführt hat. Sie war das Ergebnis der Erfahrung, daß es dort, wo er hingegangen war, kaum noch Bewegung gab, nur den Schein einer solchen.
Bernhardt führt damit die Trennung von Anerkennung der literarischen Qualität und Kritik am persönlichen Verhalten des Dichters beispielhaft vor. Er kann Kunert würdigen, ohne dafür den Boden der Linientreue verlassen zu müssen.
Auch wenn bereits 1989 mit Kunerts Rede „Die Musen haben abgedankt“ in Sinn und Form ein grundlegender Text gedruckt wurde, kann man doch erst nach dem Mauersturz von einer Wahrnehmung der bis dahin spärlichen Rezeptionsmöglichkeiten reden. In Neue Deutsche Literatur erschien eine Rezension der Befleckten Empfängnis erst im Februar 1990 mit fast einjähriger Verspätung. Bernd Leistner bespricht darin form- und sachorientiert die Gedichte. Der einzige Kommentar zur vergangenen Nichtbeachtung Kunerts: Es gebe nun, „erfreulicherweise, in der DDR einen neuen Kunert-Band“. Gleichzeitig erscheint die Feststellung, daß die Gedichtzusammenstellung nichts „Feigenblatthaftes“ an sich habe, wie eine sachte Rechtfertigung der bisherigen Publikationspolitik. Eckhard Ullrich dagegen sieht die Leistung Almut Gieseckes, die die Auswahl besorgte, anders. Sie habe das Mögliche getan. „Aber: Es war das Mögliche von vorgestern.“ Die Möglichkeit, Ende 1989 alles sagen zu dürfen, läßt Ullrich keine Rezension, sondern eine späte Rechtfertigung Kunerts schreiben. Sieht man von Ullrichs berechtigtem Zorn ab, dann deckt sich sein Blick von innen mit dem von außen: Eigentlich gab es keine Kunert-Rezeption, denn es gab ja auch kaum die Möglichkeit, Kunert zu lesen. Doch nun, so scheint es, soll vieles nachgeholt werden.
Torsten Unger jedenfalls fand ähnliche Worte für die Situation zwischen 1979 und 1989:
Das literarische Ereignis Günter Kunert fand seit November 1979 unter Ausschluß der DDR-Öffentlichkeit statt. So schrecklich einfach war das, möglich allein dadurch, daß es einem Mächtigen nicht be-Hagerte.
Und zur Notwendigkeit, über das Versäumte nicht nur zu berichten, sondern es wahrzunehmen und aufzuarbeiten, sagt er: „Der Rest ist nun Schweigen? Nein, lesen.“
Christoph Sahner, aus: Text+Kritik – Günter Kunert, Heft 109, Januar 1991
„… wir Armen sind nur Gäste…“
− Gespräch mit Günter Kunert. −
Günter Kunert gehört zu den produktivsten und intellektuell anspruchvollsten Autoren seiner Generation. Neben seinem umfangreichen lyrischen Werk werden auch seine Erzählungen und seine Kurzprosa viel beachtet. In seinen sensiblen Beobachtungen und Notizen fixiert er skurrile Situationen und gesellschaftliche Paradoxa. Als Skeptiker befragt er die moralischen und politischen Maßstäbe unserer Zeit. Dabei kennzeichnen Melancholie und Pessimismus nicht selten seine Sicht. Dem steht jedoch die Lust am sprachschöpferischen Spiel gegenüber.
Man müsse erst „erkranken an der Welt“ sagt Kunert, „um sie diagnostizieren zu können als etwas Heilloses schlechthin. “ 1929 als Kind jüdischer Eltern in Berlin geboren, wuchs er in diese Weltsicht hinein. Entrechtet und nahezu isoliert, entbehrte er als Kind die Geborgenheit, die die jüdische Großfamilie vielleicht hätte sein können. Außer seinen Eltern waren alle Mitglieder der Familie im Dritten Reich umgebracht worden.
Uwe Nösner stellt zur Prosa von Günter Kunert fest: „Kunert verzichtet nicht auf Dunkelheiten, die schrecklichen Fäulnisfarben der Schattenseiten der Zeit und des Denkens, doch malt er sie ohne Sentiment. Er ist ein sensibler Zeichner des Wortes, doch seine Lektüre ist alles andere als eine ,Schule der Empfindsamkeit‘.“ Kurt Drawert schreibt über Günter Kunerts Lyrik: „In den Koordinaten von Mythos und Moderne, Sehnsucht und Vergeblichkeit, Geschichte und Schuld bewegen sich die Gedichte in einer Schönheit, die ihr eigentlicher Entwurf ist, ihr Anliegen an sich.“
Ich traf Günter Kunert am 06. November 2004 in Kaisborstel bei Itzehoe, wo er und seine Frau ein am Ende des Ortes gelegenes ehemaliges Schulhaus bewohnen. Vermutlich war der geräumige Saal, in welchem wir unser Gespräch führten, der ehemalige Schulraum der Dorfschule, in dem einst die Schüler aller Altersstufen dem einzigen, sie gemeinsam unterrichtenden Dorfschullehrer gegenübergesessen hatten. Jetzt war ich der Schüler und Günter Kunert mein Lehrmeister. Lernen konnte ich genug: zum Beispiel wie heitere Gelassenheit und nadelstichartige Prägnanz zusammengehen können. Kunert ist so etwas wie der Meister des Lapidarstils und der grotesken Zuspitzung. Seine Bücher hatten früh eine große Anziehung auf mich ausgeübt, da sie provozierten und verunsicherten. Wir sprachen in Kaisborstel über Kunerts soeben erschienenen Band Die Botschaft des Hotelzimmers an den Gast, Aufzeichnungen aus 25 Jahren. Ein Buch, das wie kein anderes die breite Spannweite seiner Themen zeigt. Kunert stellt sich, um seine Schreibposition zu verdeutlichen, gern zwischen „Egomanie“ und „Psychopathie“ auf. Ohne Ichbezogenheit, sagt Kunert, gebe es keine Literatur, keine Kreativität, ohne eine extreme Geistes- und Gemütsverfassung kein Kunstwerk.
[…]
Axel Helbig: Sie sagen, „das zeitgenössische Gedicht hat auf den großten Teil seines Publikums verzichtet, um seiner Funktion treu bleiben zu können.“ Wie würden Sie diese Funktion beschreiben?
Günter Kunert: Wir sprachen schon darüber, daß sich der Dichter in sein Gedicht verwandelt. Das ist ein psychischer Vorgang, der dann auf sehr individuelle Weise vom Leser nachvollzogen wird. Das Gedicht bietet dem Leser die Chance der Selbsterkenntnis, oder Selbstverständigung, zur Selbstsicht überhaupt. Und zwar in einem stärkeren Maße als Prosa, als Erzählungen und Romane, die zugleich auch ein bißchen unterhaltend wirken. Das Gedicht ist nicht zur Unterhaltung da. Wenn das Gedicht überhaupt eine Funktion hat, dann ist es diese, daß der Leser, das Gedicht lesend, sich selber stärker ins Blickfeld rückt. Daß er aus den Stimmungen, Emotionen, die in dem Gedicht stecken, seine erwecken kann, oder sie überhaupt wahrnimmt oder sie verstärkt.
Es gibt keine normative Ästhetik, wie früher. Dichten war im 19. Jahrhundert sehr leicht, da es die normative Ästhetik gab, die zwischen Leser und Dichter vermittelte. Sah ein Knab ein Rößlein stehn. Das war ganz unproblematisch. Diese normative Ästhetik war eine Lesehilfe für den Leser. Seitdem es in keiner Kunstgattung mehr normative Ästhetiken gibt, hat es der Rezipient schwerer. Und der Dichter hat’s natürlich auch nicht leichter. Weil ihm durch das Fehlen der normativen Ästhetik diese wunderbaren Krücken fehlen, an denen er durch die Verse humpeln konnte. Jetzt muß er versuchen, sich auf andere Art auszudrücken. Das führt zu einem gewissen Hermetismus. Und wenn der Leser nicht bereit ist, diese Schwierigkeiten mit dem Dichter zu teilen, dann schrumpft eben das Publikum. Damit muß der Lyriker rechnen.
Das ist von den Formen unabhängig. Es kann auch eine Verlockung bieten, sich in Formen, wenn man sie ein bißchen aufbrechen kann, zu bewegen. Aber es ist eben schwieriger geworden, weil der Leser des Lesens weniger geübt ist als früher. Die heutigen Leser lesen in der Hauptsache Sach- und Fachbücher.
Helbig: Sie schreiben dem Gedicht die Funktion einer „geschichtsphilosophischen Sonnenuhr“ zu, „die durch ihren Schattenwurf anzeigt, welche Stunde uns geschlagen hat“. Das in Ihrem ersten Band Wegschilder und Mauerinschriften (1950) enthaltene Gedicht „Über einige Davongekommene“.
Als der Mensch
unter den Trümmern
seines
bombardierten Hauses
hervorgezogen wurde,
schüttelte er sich
und sagte:
Nie wieder.
Jedenfalls nicht gleich.
könnte in diesem Sinne als Türschild vor den Eingang in die Kunertsche Welt genagelt werden… (Zwischenruf von Günter Kunert: „ V o r s i c h t D i c h t e r !!‘“)
… Vielleicht auch als Warnschild. So sehr ist in diesem frühen Gedicht bereits der Schattenwurf angezeigt. Peter von Matt hatte sich beim Lesen dieses Gedichtes an Dürrenmatts Satz: „Zu finden ist die schlimmstmögliche Wendung“ erinnert gefühlt. Ist dieser Satz ein tauglicher poetologischer Hinweis für das Verständnis Ihrer Dichtung?
Kunert: Nein. Ich suche nicht die schlimme Wendung. Die schlimmen Wendungen sind ja seit langem vorhanden. Dürrenmatt, in seiner gemütlichen Schweiz, mit einem ganz anderen Leben hinter sich, hat natürlich suchen müssen, um zu finden. Aber diese Wendungen sind längst eingetreten. Man kann sie eigentlich nur schreibend begleiten.
Helbig: Das Gedicht „Über einige Davongekommene“ hat bereits dieses Seismographische. Das Entstehen des Gedichtes fällt mit einer massenpsychologischen Umorientierung der Deutschen zusammen. Wie haben Sie Deutschland und die Deutschen in diesem Übergang wahrgenommen?
Kunert: Das Gedicht ist 1948 entstanden. Man mußte kein Seismograph sein, es ist ein ganz realistisches Gedicht. Denn nach dem Kriege – 1946/47 – waren sehr viele Leute (Männer!) bereit, a) noch einmal in den Krieg zu gehen („Jetzt müßten wir mit den Amerikanern gegen die Russen.“) und b) das Fronterlebnis umzubewerten. Da wurde nicht mehr der Schrecken erinnert, Tod und Not, sondern die Kameradschaft, das Teilen der letzten Zigarette, der Feldpostbrief von der Verlobten. Der Verdrängungsprozeß hatte bei den Leuten, die in Berlin aus den Kellern gekrochen waren, sehr früh eingesetzt. Ganz erschreckend! Wer nicht gerade gerne in einen neuen Krieg ziehen wollte, hat zumindest von der Vergangenheit nichts mehr wissen wollen. Nicht zufällig hat es sehr lange gedauert, bis die finstersten Kapitel der deutschen Geschichte aufgearbeitet worden sind. Das hat ja bis 1968 gedauert, bis zur Studentenrevolte, daß überhaupt erst einmal der Mantel des Schweigens gelüftet wurde.
[…]
Ostragehege, Heft 37, 2005
Dagmar Hinze: Der Bruch mit der Utopie. Die Lyrik der 80er und 90er Jahre von Günter Kunert
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
DAS&D + Archiv + Internet Archive + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ Sinn und Form ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


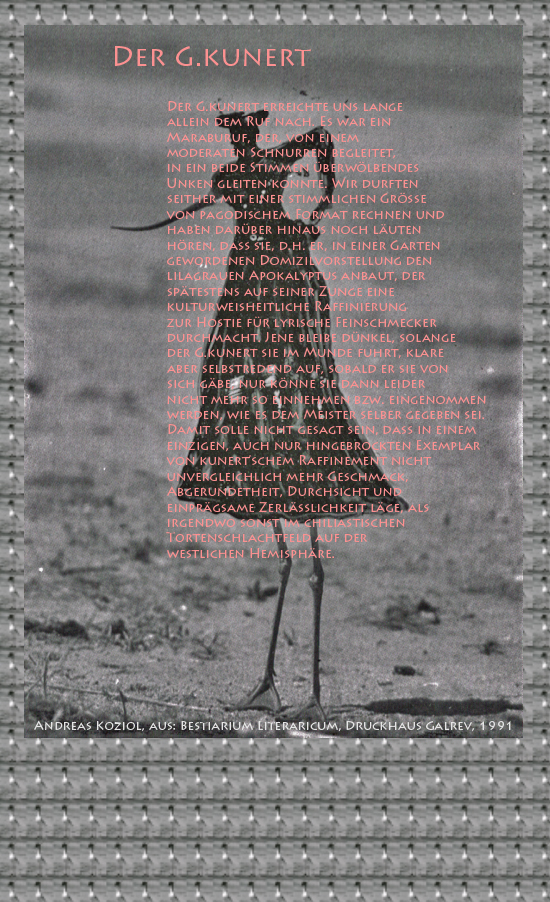
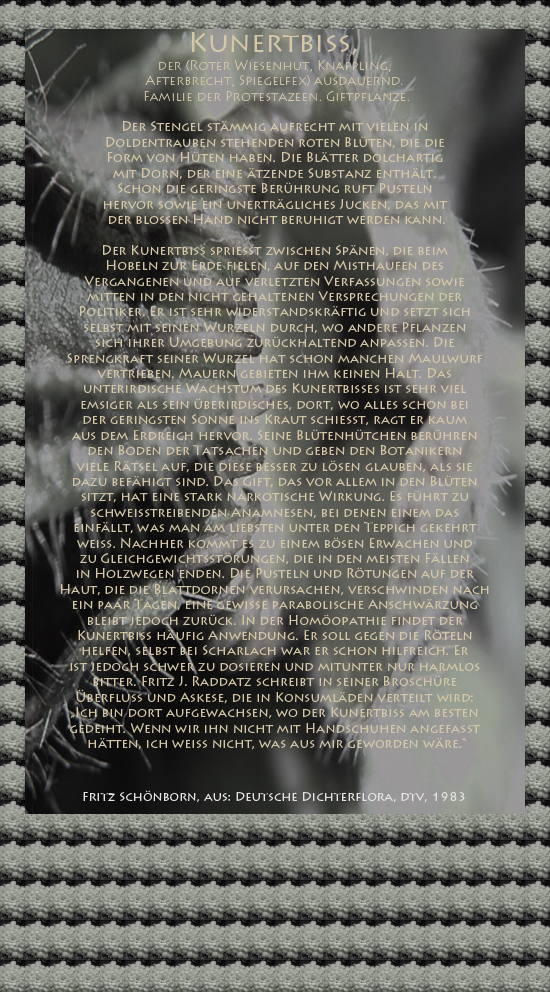
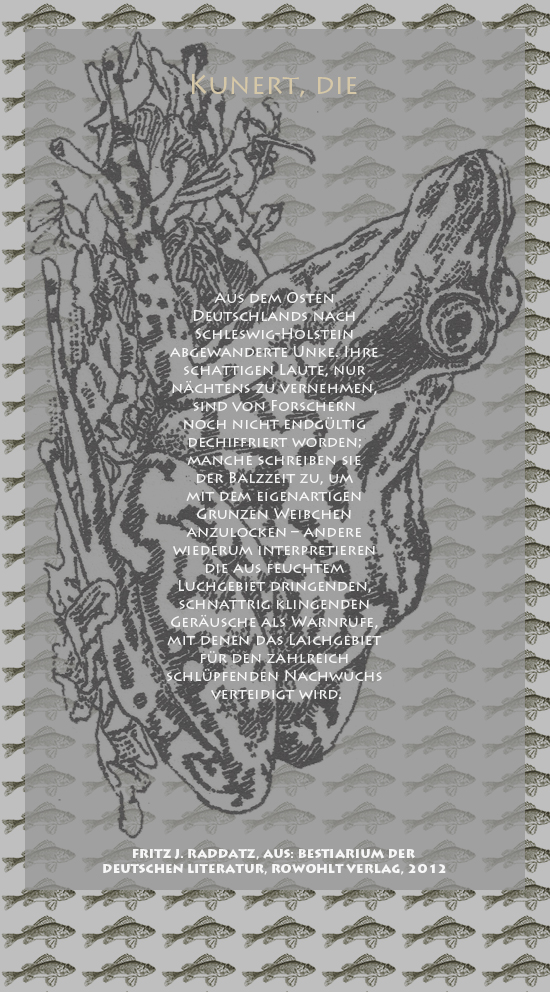
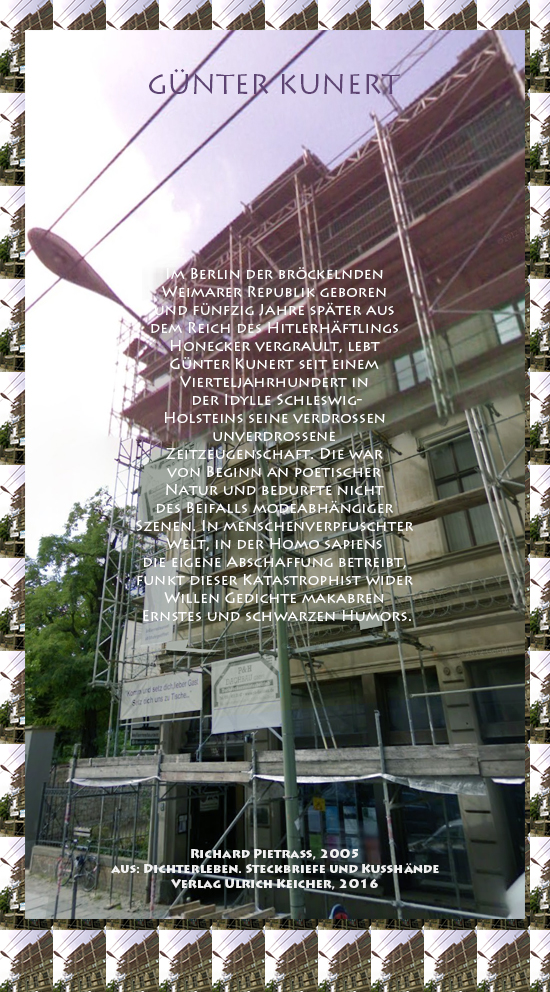












Schreibe einen Kommentar