Günter Kunert: Lesarten
RICHARD ANDERS
Das Fenster
Aus dem Album fällt dir
ein fünfzigjähriges Photo:
Du stehst auf Zehenspitzen am Fenster.
Wenn du das Photo behauchst,
am Ärmel abwischst,
glänzt wieder die Scheibe
und setzt sich Bruchstück
für Bruchstück zusammen
zum Gartenbild. Wie es
sekundenlang blüht
mit dem lachenden Himmel
darüber im Apfelbaum, bis
das Glas unter der Eisblumenschrift
jeder Antwort auf Hoffnung erblindet.
Ein Ausschnitt
Die Vor-, Haupt- und Nachspeise des Alternden, Altgewordenen besteht aus dem Dinner der Erinnerungen. Das Gedächtnis liefert bei Bedarf (oder zufällig) Sequenzen früherer Lebensstadien, aber es ist ein menschenfreundlicher (oder hinterhältiger) Lieferant, denn es läßt uns nur die angenehmen zukommen. Die Desaster der Kindheit, der Jugend: Wie nie gewesen. Die Überwältigung durch frühe Ängste und Verzweiflungen, mit welcher sich die des späteren Alters selten messen kann, wie ausradiert. Was das Hirn zu behalten bereit ist, beinhaltet hauptsächlich positiv Erlebtes. Auch ohne die Gedächtnisstütze der Fotos gleichen die Erinnerungen eher Schnappschüssen als wiederbelebtem Dasein. Einzig Ausschnitte, Bruchstücke werden verwaschen sichtbar, meist verbunden mit einem angenehmen Empfinden. Aus dieser Vorratskammer bestreiten viele ab einer bestimmten Altersgrenze ihren emotionalen Haushalt: Man lebt vom Eingemachten. Soweit das psychologische Faktum.
Dem Autor unseres Gedichts mißlingt diese selige Einkehr ins unfreiwillig geschönte Gestern. Sein Erinnern, das so „gemütvoll“ einsetzte, erstirbt unter der Eisblumenschrift jeder Antwort auf Hoffnung. Das kündet von umfassendem Unglück, das wir nur zu gut verstehen, da es jeden von uns betrifft. Unserem ureignen Hoffen – worauf auch immer gerichtet, es zielt stets auf Künftiges – werden Antworten zuteil, die kalt und vernichtend sind. Ja, diese Antworten, welche die Gegenwart unseren unausgesprochenen Erwartungen erteilt, verwandeln nicht nur die Zukunft zum Gorgonenhaupt, sie vernichten auch den möglichen Trost durch Erinnern, weil – obwohl merkwürdig und widersprüchlich klingend – die Vergangenheit, die allgemeine wie personale, einzig Bestand haben kann, solange noch Zukunft denkbar bleibt. Dem Verfall der Zukunft korrespondiert die Auflösung glückhafter Memorabilia eigener Gewesenheit.
Vorwort
Du forderst mich auf, den Boden zu pflügen. Soll ich ein Messer nehmen und die Brust meiner Mutter zerfleischen? Wenn ich sterbe, wird sie sich weigern, mich an ihrer Brust ausruhen zu lassen. Du forderst mich auf, nach Steinen zu graben. Soll ich unter ihrer Haut nach Knochen wühlen? Wenn ich sterbe, kann ich nicht in ihren Leib zurückgehen, um wiedergeboren zu werden. Du forderst mich auf, Gras zu mähen, Heu zu machen und es zu verkaufen, um reich zu werden wie die Weißen. Doch wie kann ich es wagen, meiner Mutter Haare abzuschneiden?
Das sprach, wie wir in Werner Müllers Studie über „Indianische Welterfahrung“ lesen, einst der Häuptling Smohalla zu Major MacMurray, der den Oberlauf des Columbia River bereiste. Eine Begegnung wie sie im Lesebuch steht oder in einem der abenteuerlichen Epen Karl Mays. Der Indianer äußert sich auf eine Weise, welche nicht bloß Major MacMurray, sondern auch uns ungewöhnlich vorkommt. „Exotisch“ würde man es nennen wollen, weil der Begriff des Exotischen so angenehm distanzierend wirkt. Man muß sich selber durch das „Exotische“ nicht betroffen fühlen. Es ist das Fremdartige, das Fremde schlechthin. Uns ist völlig klar: Dieser Eingeborene weigert sich in einer „blumigen“ Sprache, die Notwendigkeiten und Forderungen einer neuen, veränderten Zeit einzusehen. Wir, im Besitz der einzig uns vorstellbaren Kultur, halten unseren „Roten Bruder“ für zurückgeblieben in jeder Hinsicht. Früher, in den schlechten alten Zeiten, als wir noch Rousseau lasen, wollten wir zurück zur Natur und so sein, wie dieser Eingeborene. Inzwischen jedoch, im Verlauf von zweihundert Jahren, haben wir uns das anders überlegt. Das natürliche Dasein ist zu unbequem. Wer es dennoch aushält, kann unserer herzlichen Verachtung gewiß sein. So stehen wir auf der Seite von Major MacMurray und vor Häuptling Smohalla und denken uns unser Teil, und in diesem kommt der „Wilde“ nicht gut weg. Wir begreifen die umständliche und wenig objektive Beredtheit dieser Leute nicht und sind geneigt, gekränkt zu sein, weil sie nicht bereit sind, unser „kulturelles Niveau“ als überlegen und erstrebenswert anzuerkennen. Wer dermaßen zurückgeblieben ist, hat von uns nichts, falls nicht gar das Schlimmste zu erwarten. Abgesehen jedoch von unseren Vorurteilen, und ich ahne, wie schwer es uns fallen wird, von unseren Vorurteilen abzusehen, also abgesehen davon, tritt in dem Gespräch zwischen Smohalla und MacMurray etwas in Erscheinung, das unsere Beachtung verdienen sollte. Denn was sich da bemerkbar macht, liefert möglicherweise den Schlüssel für ein Phänomen, an dem die Literaturwissenschaftler bisher vorbeigedacht und vorbeiinterpretiert haben. Ich rede von den Voraussetzungen für Lyrik, von den Bedingungen, unter denen ein Gedicht entsteht. Und natürlich rede ich auch davon, wie wenig befriedigend doch alle Erklärungen für diese ungewöhnliche Betätigung bisher gewesen sind. Damit bin ich nun mitten ins Thema gesprungen, zu dem aber die scheinbar völkerkundliche Einleitung gehört. Denn wir kommen nicht ohne diesen Forschungszweig aus, der in den letzten Jahrzehnten einen enormen Aufschwung genommen hat. Aus der Ethnologie stammt die Anregung für unsere Spekulationen und Hypothesen. So kehren wir rasch zurück zu Smohalla und MacMurray am Columbia River, um die beiden Vertreter extrem unterschiedlicher Kulturkreise als eindeutige Beispiele für unsere aufklärerische Absicht zu benutzen. Wir gehen also von unserem geschichtlich jungen Wissen aus, daß das Denken Smohallas und seinesgleichen in einer ganz anderen Art der Welterfahrung gründet, als das Denken MacMurrays. Schauen wir uns diese indianische Welterfahrung, wie die Ethnologie sie uns darbietet, näher an, stellen wir verblüfft und wie von einer Eingebung erleuchtet fest: Etwas Ähnliches findet sich nur bei den letzten „Naturmenschen“ der alten Welt, bei den Dichtern.
Das indianische Bewußtsein, wie es uns beschrieben wird, ist im Gegensatz zu dem MacMurrays, mit dem wir mehr oder weniger identisch sind, ganz archaisch. Diesem Bewußtsein ist noch nicht die Fähigkeit abgestorben oder von der Ratio ausgetrieben worden, umfassende Bedeutungen an den Dingen der Umwelt wahrzunehmen. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, heißt eine treffende Redewendung für den Zustand, in dem man den Überblick verloren hat und Zusammenhänge nicht mehr erkennt: Dieser Zustand ist der gegenwärtige und allgemein gültige. Dem archaischen Bewußtsein jedoch, das noch bei Menschengruppen vorhanden ist, an denen der „Prozeß der Zivilisation“ bisher vorüberging, eignet jene besondere Gabe, den Wald zu erkennen und zwar selbst anhand eines Zweiges. Es handelt sich um die Befähigung des Blickes, den ich, um die Durchschlagskraft des Fremdwortes zu nutzen, „morphologisch“ nennen möchte. Es handelt sich tatsächlich um einen gestaltbildenden, gestaltenden Blick. Aus völkerkundlichen, übrigens auch geschichtskundlichen Berichten geht hervor, wie sich dieser morphologische Blick auswirkt. Ihm werden naturhafte Erscheinung zu den Geistern der Ahnen, zu Dämonen und Halbgöttern. Geschildert wird dieses außerordentliche Geschehen meist im Tone des Mitleids oder der Überheblichkeit. Das ist die Position des Blinden, oder, anders gesagt, die des wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhunderts, das alles besser wußte als alle Zeitalter vor ihm. Mit dieser Besserwisserei hat es uns dermaßen infiziert, daß wir gar nicht mehr in der Lage sind, von unserem Standpunkt abzugehen und einen anderen als gleichwertig zu akzeptieren. Die ahnungsgeladenen Visionen der Vergangenheit, die visuellen Verselbständigungen der Instinkte wurden abgewertet, indem man sie zu Hysterieprodukten erklärte oder zu Einbildungen abergläubischer Angst. Dieser überhebliche Standpunkt gipfelt in der Behauptung, der Mangel an naturwissenschaftlichen Kenntnissen habe bei unseren Urahnen zur Personifizierung von Naturerscheinungen geführt. Manitou läßt es regnen, Zeus schleudert seine Blitze und Poseidon verhindert durch eine katastrophale Großwetterlage im Mittelmeer die Heimkehr des Odysseus. Die „wissenschaftliche“ Erklärung der Mythen schüttet insofern das Kind mit dem Bade aus, als sie die gegenwärtige Rationalität absolut setzt und für überhistorisch verbindlich erklärt. Sie legt ihre ärmliche Elle an die Vergangenheit und verwirft alles, was ihrem Maß nicht entspricht. Dieses Maß mag gegenüber praktischen Funktionszusammenhängen seine Nützlichkeit erwiesen haben, gegenüber den subtilen geistigen Projektionen muß es versagen. In unserem Falle nimmt die gegenwärtige Vernunft den morphologischen Blick gar nicht erst zur Kenntnis, weil er sich in keiner Hinsicht verwerten läßt. Was soll der Blick, dem sich seine Anschauungsobjekte zu etwas anderem, als sie eigentlich sind, zusammenfügen? Vergessen, daß einstmals Traum und Wachzustand ungeschieden waren und als gleichberechtigt galten und daß beide sich gegenseitig durchdrangen. Erst die Rationalität hat den Traum als das Unbrauchbare schlechthin vom Leben abgespalten und ihn mit der faulen Phrase, daß Träume Schäume seien, aus dem Alltag vertrieben. Aber haben wir damit etwa mehr Vernunft und Erkenntnis gewonnen? Mehr Einsicht und mehr Aufgewecktheit? Im Gegenteil, meine ich. Indem wir den Traum gebannt haben, haben wir unsere Vernunft zum Alptraum gemacht.
Ungeschiedenheit ist auch ein Kennzeichen des erwähnten archaischen Bewußtseins. Es tritt nicht in Distanz zur Welt, sondern steckt in ihr. Wie zum Beispiel dem Kind die Welt noch ungeschieden ist, und wie dem Kinde Wolken und Formen als Fratzen und Ungetüme erscheinen, so spiegelt dem archaischen Bewußtsein die Natur wider, was es in ihr erblickt. Für das archaische Bewußtsein ist die Umwelt bildhafter. Allüberall entbargen sich aus den Erscheinungen Bilder, die unmittelbar als Sinnbild verstanden wurden. Als Symbol. Und zwar als Symbol, das in Beziehung zum eigenen Schicksal stand. Vielleicht ist Walter Benjamins „Aura“ der Dinge nur ein Nachglanz dessen, was vordem ihre Symbol- und Bedeutungsträchtigkeit gewesen war. Das Mysteriöse bestand im übrigen darin, daß das Symbol, als welches sich die Sache zeigte, auf die Sache selber zurückzuwirken imstande schien. Wenn der Häuptling Smohalla von der Erde als seiner Mutter sprach, und zwar keineswegs im übertragenen Sinne, so wie wir etwa heute von „Muttersprache“ reden, so meinte er mehr als nur ein rhetorisches Gleichnis. Erde und Mutter bildeten für ihn eine faktische wie symbolische Einheit. „Wenn ich sterbe, kann ich nicht in ihren Leib zurückgehen und wiedergeboren werden.“ Das ist eine Formulierung, auf die wir falsch, nämlich mit psychoanalytischen Entschlüsselungsversuchen reagieren, eben mit unserer reduzierten Rationalität. Aber hier versagt die Neurosenlehre. Smohalla meint gar nicht sich allein. Er spricht von der Beständigkeit indianischer Generationen, die, sobald sie den Boden bearbeiten würden, nicht mehr die gleichen Indianer wären. Auf uns wirkt die Formulierung von der Erde als Mutter exaltiert. Aber indem etwas bildlich-konkret benannt wird, ist ein wesentlicher Umstand, eben die Dauer des indianischen Volkes, gemeint – und dieser Vorgang, der Vorgang des indirekten Sprechens, wiederholt sich nahezu gleichartig im Gedicht. Auch für das Gedicht besteht die Notwendigkeit solcher Übersetzung. Wir aber, mit unserer direkten Denk- und Sprechweise, nehmen alles wörtlich und begreifen daher nichts. Um noch einmal zu verdeutlichen, worin die Differenz besteht, will ich Smohallas Einwand gegen die Bodenbearbeitung in das Kauderwelsch unserer Tage übersetzen. Mit der Übernahme eines anderen sozialen Status, nämlich dem des Farmers, verlieren wir unsere gruppenspezifische Identität. Das ist natürlich nicht dasselbe wie:
Soll ich unter ihrer Haut nach Knochen wühlen? Wenn ich sterbe, kann ich nicht mehr in ihren Leib zurückgehen, um wiedergeboren zu werden.
Zweimal der gleiche Inhalt und doch unterschiedliches Gewicht. Die abwehrende Phrase drückt nicht mehr aus als einen sozialpsychologischen Tatbestand, einen kritischen Einwand, dessen Berechtigung dahingestellt sei. Die zweite Äußerung dagegen besitzt eine kosmische Dimension. Die Rede vom Sterben und Wiedergeborenwerden zeigt transzendentale Züge. Beschworen wird der Untergang. Denn Nichtwiedergeborenwerden ist das endgültige Ende. Das „Stirb und Werde“ ist damit unterbrochen und der naturhafte Rhythmus ausgesetzt, der die Kontinuität des Lebens garantierte. Dafür konnte MacMurray kein Ohr haben.
Daß der morphologische Blick in der Metaphorik des Gedichts überlebt hat, muß man nach diesen Ausführungen nicht zusätzlich betonen. Das Gedicht, das ein Bild darstellt, das als Bild fungiert, ist so etwas wie eine in Schrift geronnene Vorstellung. Und zwar eine Vorstellung von der Welt und von den Dingen, die sich mit der Oberfläche nicht zufrieden gibt und ahnen läßt, daß hinter der Oberfläche das eigentlich Wichtige läge. Fast zwangsläufig nimmt jedes Gedicht Gleichnischarakter an. Wir spüren ganz deutlich beim Lesen eines solchen Textes, daß sein Autor über die Wörtlichkeit hinaus uns etwas mitteilen will, was sich der Wörtlichkeit ständig entzieht. Häufig stehen wir ratlos vor solchen Schöpfungen und finden keinen Zugang. Eben weil die Gattung alle Gegenständlichkeit unabänderlich mit symbolischer Bedeutung auflädt, aufladen muß, um ihr Gattungswesen sowohl zu verwirklichen wie zu erhalten. Lyrik würde zu etwas anderem, müßte sie darauf verzichten, wie Häuptling Smohalla zu reden, müßte sie darauf verzichten, die Dinge zu transzendieren – auch wenn es, wie Hugo Friedrich in den „Strukturen der modernen Lyrik“ meint, eine „leere Transzendenz“ ist – entleert darum, weil ihre einstige Verpflichtung und Bindung zum Sakralen mit diesem selber verfallen sei. Gott und die Götter sind ihr abhanden gekommen, aber sie redet immer noch so, als erhielte sie von ihnen die Legitimation. Da das Heilige nicht mehr auszumachen ist, hilft sich die Verlegenheit mit dem verbrauchten Begriff des „Existenziellen“ aus der Klemme. Doch das bleibt eine Hilfskonstruktion. Niemand vermag zu erklären, was dieses „Existenzielle“, auf welchem das Gedicht gründe und für das die unfreiwillig zu Symbolik berufenen Konkreta stünden, denn eigentlich wäre. In zahllosen Interpretationen, Untersuchungen und Analysen taucht dieser Begriff wie ein Fels im Meer auf, erweist sich jedoch, sobald man sich ihm nähert, als Fata Morgana. Gerade weil hinter den Dingen, die das Gedicht evoziert, eine Qualität zu stecken scheint, die sich der Eindeutigkeit wie der Definition entzieht, entfaltet es überhaupt seine Wirksamkeit. Könnten wir diese besondere Qualität exakt herausoperieren, um sie zu betrachten, wäre wohl der letzte Augenblick der Dichtung gekommen. Analog zu dem, was E.M. Cioran über das Leben sagt, das, falls man faktisch seinen Sinn entdeckte, plötzlich ganz sinnlos würde, so verwandelte sich das Gedicht in ein Wortsammelsurium, gäbe es eine grundsätzliche Erklärung für seinen hermetischen Hintergrund, für sein Geheimnis, das es bedingt. Das Walten des Unbewußten bei der Entstehung eines Gedichts, selbst eines solchen, das höchst rationale Absichten verfolgt, begründet seine Einmaligkeit und Eigenartigkeit. Ich bin geneigt, anstelle einer verschwundenen normativen Ästhetik das Wirken des als „archaisch“ apostrophierten Bewußtseins als Kriterium und Merkmal, sozusagen als Gütesiegel des Gedichts, anzusehen. Damit freilich wäre das Gedicht der beanspruchten Kompetenz vieler Berufsinterpreten entzogen, denn es würde zu seinem Verständnis ganz anderer Talente bedürfen, als die gemeinhin als ausreichend empfundenen. Nur wo ein gleichartiges Bewußtsein, zumindest rudimentär, existierte, gäbe es somithin die erforderliche Entsprechung zu seiner Deutung. Aber das würde wahrscheinlich den Zirkel noch enger und esoterischer werden lassen, als er ohnehin ist.
Aber ich sprach von zusätzlichen Belegen für das archaische Bewußtsein, dem sich die Welt in vielsagenden Bildern und als Bild darbietet. Sobald wir nach seinen Spuren fahnden, stoßen wir zuallererst auf seinen unmittelbaren Ausdruck: auf die Sprache.
Schlüpften wir kurzfristig in MacMurrays Haut, würden wir die Ansprache des Häuptlings weniger als real aufzufassende Mitteilung werten denn als „poetischen“ Monolog, obgleich dieser nichts Poetisches beabsichtigt.
Bloß besitzt für uns, die wir alle auf irgendeine Weise MacMurrays sind, das Sprechen in Bildern und Symbolen und Gleichnissen keine Sinnfälligkeit mehr. Solche Redeweise hat ihr letztes Reservat in der Dichtung gefunden – und zwar ausschließlich dort, da das der einzige Ort war (und noch ist), wo nicht eindeutige Zwecke und Zweckdenken vorherrschen. Jedem mußte die Berufung auf Leib und Gebein der Mutter Erde kindlich vorkommen, dem es um Hektarerträge ging, um Getreidepreise, Maximierung der Landwirtschaft, ökonomisches Wachstum. Die Natur als solche konnte man sich höchstens am Feierabend leisten. Aber da war sie wohl keine mehr, zumindest nicht mehr in ihrer bergenden Ursprünglichkeit.
Die Voraussetzung für die Rezeption von Gedichten besteht nun mal in einem „Organ“, das hier und da, bei diesem und jenem noch als eine Art seelischer Blinddarm vorhanden ist: sonst würde ja auch niemand Gedichtbände kaufen.
Gäbe es nicht eine gewisse Resistenz gegen die ständig abstrakter und lebloser werdende Sprache, keiner läse mehr Lyrik. Daß dieser Wandel der Sprache jedoch nicht erst mit der allgemeinen Wissenschaftsvergötzung, mit der Arbeitsteiligkeit der Industriegesellschaft seinen Siegeszug antrat, beweist ein weiteres Zitat aus Werner Müllers Buch. Dort beklagt ein Araukaner, ein Eingeborener eines inzwischen ausgestorbenen Stammes, den Zustand der Sprache, und wir können uns solchen Klagen nur anschließen: „Was bei unseren Vorfahren sagbar war“, heißt es da, „können wir heute nicht mit vielen Worten klarmachen und erläutern. Denn auch unsere Sprache ist mit uns arm geworden, und wir müssen viele Worte gebrauchen, um zu sagen, was unsere Voreltern mit einem Wort deutlich machten. Was wir fühlen, können wir nicht mehr ausdrücken und müssen uns oft mit spanischen Worten behelfen.“
Den Dichtern geht es wie dem Araukaner. Sie empfinden ein dauerndes Ungenügen an einer Sprache, die letztlich nicht hergeben will, was man ihr abfordert. Wer, ohne Dichter zu sein, hätte nicht selber in irgendeinem schwungvollen Augenblick seines Lebens das Verlangen gespürt, seiner Euphorie Ausdruck zu geben. Und wer hätte in solchem Augenblick nicht betroffen bemerkt, wie sehr ihm diese Worte dazu fehlten.
In einem Statement Rimbauds zu seiner Lyrik findet sich die Sehnsucht nach einer umfassenderen Sprache genauso wie das Zeugnis für den besagten morphologischen Blick:
Ich erfand die Farbe der Vokale! – A schwarz, E weiß, I rot, O blau, Ü grün. Ich bestimmte Form und Bewegung jedes Konsonanten, und mit Hilfe triebhafter Rhythmen schmeichelte ich mir, eine poetische Sprache zu erfinden, die, früher oder später, allen Sinnen zugänglich sein würde. Die Übersetzung sparte ich einstweilen auf. Das war zunächst nur Übung. Ich schrieb das Schweigen, die Nächte, ich zeichnete das Unaussprechliche auf. Ich hielt den Taumel fest.
Und über den morphologischen Blick:
Ich gewöhnte mich an die einfache Halluzination: ich sah ganz deutlich eine Moschee an der Stelle einer Fabrik, ich sah, wie Engel Unterricht im Trommeln erteilten, sah Kutschen auf den Straßen des Himmels, einen Salon auf dem Grunde eines Sees; die Ungeheuer, die Geheimnisse…
Und dann kommt ein höchst verräterischer Satz, dessen wahre Deutung Rimbaud selber möglicherweise entgangen ist: „Zuletzt kam ich dahin“, schreibt er, „die Verwirrung meines Geistes geradezu als etwas Heiliges zu empfinden.“
Instinktiv hat Rimbaud gespürt, daß die Fähigkeit des archaischen Bewußtseins, die Welt ab bildlich zu erleben, als Vielzahl von Zeichen, hinter denen sich das Allerheiligste verbarg, die Welt und ihre Erscheinungen geheiligt hat, indem sie allem und jedem eine höhere Weihe verlieh. Und die Sprache „entsprach“ diesem Umstand insofern, als sie jeder dieser Erscheinungen einen eigenen Wert, ergo ein eigenes Wort zubilligte. Die Sprachen der sogenannten „Primitiven“ sind im Gegensatz zu den modernen Nationalsprachen enorm differenzierend und von einem unvorstellbaren Reichtum des Wortschatzes. Häuptling Smohalla hätte uns beispielsweise eine Vielzahl von Namen für den Schnee in seinen unterschiedlichen Stadien nennen können. Wo wir bereits zu Adjektiven Zuflucht nehmen müssen, gibt es bei den kanadischen Indianerstämmen, erst recht bei den Eskimos, Worte für Schnee bei bestimmter Beleuchtung, in dieser oder jener Jahreszeit, in unterschiedlichen Konsistenzzuständen, und wenn das nicht ausreicht, so wird ein neues Wort aus dem Vorrat des Vorhandenen geschaffen. Eine ideale Sprache für Dichter. Zur Abstraktion, zum abstrakten Denken, wie es MacMurrays Gehirn bewegte, ist sie weniger brauchbar. Und obschon wir so stolz auf diese unsere Fähigkeit zur Abstraktion sind und die Bemühung um sie und um ihre Systematisierung sogar „Liebe zur Weisheit“ nennen, ist uns dabei sowohl die Liebe wie auch die Weisheit abhanden gekommen.
Wie in den Naturwissenschaften (und nicht allein in diesen) die Methode das Resultat determiniert, so präsentiert und repräsentiert auch die Sprache als Methode des denkenden Erkennens eine vorbestimmte Wirklichkeit, vielmehr: Einen Ausschnitt von ihr, einen Bruchteil. Falls nicht – wie ich den Verdacht habe überhaupt sogar nur pure Einbildung. Während das konkrete Benennen noch die Totalität widerzuspiegeln sucht und die Fülle ahnen läßt, wird durch das metastasenartige Wachstum der Abstraktion die Sprache selber immer selektionistischer, „wählerischer“ im schlechten Sinne, und untauglicher zur Unterscheidung. Indem sie das Gegenständliche gegen den Begriff eintauscht, büßt sie ihre Präzision ein, denn die fahlen Schemen der Begrifflichkeit können nicht einmal die ihnen zugeordnete Bedeutung halten und verfärben sich nach Lust und Laune ihrer Benutzer chamäleonartig von Kontext zu Kontext. Die Abstraktion der Wirklichkeit löst sie selber auf. Und da, wo die Abstraktion zusätzlich Vorzeichen eines Wissensgebietes erhält und zur Terminologie ausartet, verabschiedet sich die Realität ohnehin auf Nimmerwiedersehen. Jede Terminologie schottet ihre Benutzer gegen die Fülle der Wirklichkeit ab, um letztere nur in Auswahl zuzulassen. Jede aus einem geschlossenen Denksystem entstandene Sprache begrenzt nicht nur generell die Skala der Methoden und Mittel zur Kenntnisnahme der Wirklichkeit, sie selber ist in den Kreis der ihr eigenen Schlüssigkeit gebannt, aus dem sie nur befreit werden kann wie der Geist aus der Flasche: Zum Unheil jener, die sie für dienstbar gehalten haben und nun sehen müssen, wie sich dieses Gespenst über sie erhebt. Zur Ideologie ausgeweitet, scheint solche Sprache von Nutzen, dank ihrer vereinfachenden und funktionalen Klischees, so daß ihre Förderer nicht merken, wie sie immer mehr zu Gefangenen ihres eigenen Redens werden.
Es handelt sich bei unserer so abstrakt gewordenen Sprache um eine, die sich so weit von individueller Erfahrung entfernt hat, daß über sie – wie wir hier schon zu unserem Leidwesen anmerkten, nur auf die gleiche, durch sie konstituierte Weise nachgedacht werden kann. Hingegen wird in der Sprache des Gedichts nichts anderes laut als individuelle Erfahrung. Während die abstrakte Sprache ihre jeweiligen Raster über die lebende oder meinetwegen sterbende, zumindest sterbliche Wirklichkeit legt, um sie solcherart vorzuordnen, wobei nur sichtbar wird, was das Raster gestattet, ordnet das Gedicht die Wirklichkeit nicht nach einem vorgebildeten Muster, ja, es nimmt vielmehr selber deren Ordnung plus Unordnung an. Durch das Medium individuellen Bewußtseins, dessen archaische Grundzüge die Sensoren für sie sind, zeigt sich Wirklichkeit im Bilde, im Gebilde des Gedichts. Ob dabei die Wirklichkeit eine äußere sei oder die innere des schreibenden Subjekts, spielt kaum eine Rolle. Stets wird ein Stück einer auf keine andere Art erkennbaren Realität kenntlich, und zwar einer weder theoretisch noch ideologisch limitierten. Darum hat das Wörtchen „Wahrheit“ unter den letzten Indianern Europas seine unbezweifelte Gültigkeit behalten. Die Pilatusfrage stellt sich nicht. Weil man genau weiß, daß nur wahr sein kann, was der Wirklichkeit mit einer Sprache abgefragt wird, deren Vokabular nicht autoritär und instrumental ist, und die mehr wiedergibt als die mechanischen Geräusche des universalen Getriebes. Freilich wird die Sprache des Gedichts, diese Sprache der Wahrheit, um es mit einem Anflug von Pathos zu formulieren, immer unverständlicher, was nun keineswegs ihr Verschulden ist, sondern an der fehlenden Verständnisbereitschaft liegt.
Was die archaischen Sprachen durch ein einziges besonderes Wort treffend auszusagen vermochten, danach strebt die Sprache des Gedichts auf semantischem Wege. Mittels ungewöhnlicher Kombinationen versucht sie, die Bedeutung der Wörter unterschwellig auszuweiten, um assoziativ vorstellbar zu machen, wofür die Bezeichnungen fehlen. Dem heutigen Leser, dem überall alles eindeutig vorkommt, wird insoweit Anstrengung abverlangt, als das Gedicht sich weigert, von ihm wörtlich genommen zu werden. Die dichterische Rede ist nicht Ja-ja, Nein-nein, nicht computerisierbar, nicht datenverarbeitet und auf Abruf bereit. Das erschwert die Situation des Gedichts gegenüber einem qualitativ neuen Analphabetismus. Man kann zwar im allgemeinen lesen und schreiben, dürftig übrigens, aber zur Aufschlüsselung eines Textes sind viele, allzuviele, kaum noch in der Lage.
Das – und daran gibt es keine Zweifel – liegt an der „Verwissenschaftlichung“ der Sprache, eine Unmöglichkeit in sich, die jedoch ein eindimensionales Verstehen zur Folge gehabt hat.
Stellen wir uns vor, daß wir nur noch im Soziologendeutsch parlieren würden – was alles bliebe unbegriffen, was alles könnte nicht mehr wahrgenommen werden. Wie tief terminologische Splitter aus „Fachbereichsdialekten“ in die Umgangssprache eingedrungen und folgenreich geworden sind, sei hier nur an einer zentralen Vokabel der Psychoanalyse aufgewiesen: an der „Verdrängung“. Dieses Wort hat seinen festgelegten Platz in der Praxis des Psychiaters verlassen und grassiert wie ein außer Kontrolle geratener Virus. Diesem Virus will es gelingen, ein anderes Wort zu zerstören, zumindest zu überdecken: Das Wort „Vergessen“ nämlich. Wir sind dahin geraten, daß der Bankangestellte, eine Einzahlung annehmend, den Kunden um Nennung seiner Kontonummer bittet, mit der Begründung, er habe die Kontonummer des Kunden „verdrängt“. Aber beide Worte sind keine Synonyme, stammen aus ganz anderen Zweckzusammenhängen und tun daher auch ganz etwas anderes mit uns, sobald wir uns ihnen tätig unterwerfen. Während das Vergessen ein passiver und regenerativer Vorgang ist, manchmal sogar ein Schutz für den, der vergißt, gleicht das Verdrängen dem unkontrollierten Verstecken von etwas Unangenehmen in den untersten Fächern der Seele. Dieser Unterschied zeitigt auch unterschiedliche Folgen. Der falsche Sprachgebrauch führt notwendigerweise zum falschen Empfinden, zum falschen Verhalten – auch wenn sich das niemals wird beweisen lassen. Die feiner gesponnenen Fallstricke für unser Denken und Fühlen und Handeln aufzudecken, sind wir außerstande. Und wie viele solcher aus ihrem Zweckverband gerissenen Wörter beeinträchtigen unsere Mitteilungen über alles und jedes, nicht zuletzt über unsere eigene Person, die dadurch für uns selber immer unfaßlicher wird. Um substantiell in Erscheinung zu treten, fehlt ihr die verbale Haut. Wir sind mit unserer Sprache arm geworden, wie der Araukaner sagte, und haben infolgedessen die Grenzlinie überschritten, jenseits derer uns dieser Umstand noch schmerzlich bewußt gewesen ist. Wir haben uns nicht allein an diese Armut gewöhnt, wir empfinden sie schlimmerweise als Normalzustand und betrachten unseren Verlust gar noch als Gewinn, was sich in der Überheblichkeit kundtut, sobald wir zu Menschen sprechen, die auf unsere, mit wertlosen Kenntnissen gespickte Beredsamkeit nicht wie erwartet reagieren. Bildung meint heutzutage kaum noch die aus einem kulturellen Fundus gespeisten persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten, statt dessen den Besitz von Wissen, welches – wie Nicolas Born schrieb – sich selber nicht weiß.
Außer der zunehmenden Abstraktheit führt die Fremdbestimmtheit der Sprache dazu, daß der einzelne, wenn er von sich spricht, es in einer Weise zu tun gezwungen ist, die ihn unweigerlich als Fall klassifiziert. Es ist nicht sein Schicksal, das in einem erlösenden oder befreienden Sinne „zu Worte kommt“, es damit vielleicht rechtfertigend oder verwerfend, eher ähnelt das Selbstbekenntnis einer Diagnose, der nur noch das therapeutische Resümee fehlt. Und diese Methode, durch die wir uns absolut mechanistisch auffassen, wenden wir mit dem gleichen, nämlich ausbleibenden Erfolg, auch auf unsere Vorfahren an. Wir sehen in den vergangenen Generationen nur uns selbst und unterschieben ihnen unaufhörlich unsere eigenen Manien und Ängste. Unsere Überzeugung, daß sie schlimmer dran waren als wir, geht von unserem aktuellen Ich aus und imaginiert dieses gute Stück einfach in anderes Ambiente: Ein Unternehmen, dessen Erträge faule Früchte sind.
Dieselbe Konstellation, wie wir sie zwischen Häuptling Smohalla und Major MacMurray erleben, wiederholt sich vor unseren Augen noch einmal zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Mitleidig und überlegen betrachten wir das Gestern, ohne auf die Idee zu kommen, daß es, nein, nicht etwa besser in sozialer Hinsicht gewesen ist, wohl aber daß es Qualitäten hatte, die festzustellen wir gar nicht mehr in der Lage sind. Erneut bietet sich hier die Analogie zu den Indianern an, von denen wir wissen, daß ihnen von der Kopfschmerztablette bis zum elektrischen Rasierapparat nahezu alles fehlte; daß sie weder Weltkriege geführt hatten noch fremde Völker beherrscht; daß sie keinen Goethe hervorbrachten, keinen Beethoven, keine „New York Times“, und nicht einmal ihren großen Geist zum Autor des Buches der Bücher machen konnten. In Erkenntnis all dieser Mängel haben sie es trotzdem vorgezogen, ihre Mängel beizubehalten. Für jeden von uns ist es selbstverständlich, daß Ströme von Menschen aus meist ökonomischen Gründen dahin fließen, wo es sich „gutsein“ läßt – warum stellten sich die Indianer so bockbeinig?
Nicht allein die Diffamierung als minderwertige Minorität hat ihre Integration verhindert, etwas weitaus Wesentlicheres hat ein erstaunliches Desinteresse an unserer Zivilisation geschaffen, dem wir nicht folgen können. Etwas, das wir nicht einmal ahnen. Aber wir wollen unser Klagen beenden und zur Sprache zurückkehren. Was wir noch nicht erwähnten ist, daß sie neben ihrer funktionalen und instrumentalen Bestimmtheit auch die des Fungierens hat, und zwar auf eine heimtückische Art und Weise. Was in früheren Jahrhunderten verlegen vertuscht wird, entwickelt sich später zur staatlich vollzogenen Sprachregelung. Harmlose Wörter wie „Endlösung“ und „Sonderbehandlung“ erwecken jetzt einen Schauder, nachdem bewußt wurde, was sich dahinter verbarg. Das öffentliche Sprechen tendiert ständig zu Beschönigungen. „Entsorgen“ ist eines dieser Wörter, die uns Sorgen bereiten, weil sie das Gegenteil von dem suggerieren, was sie eigentlich benennen. Da uns Herstellung wie Aufbewahrung hochgiftiger und radioaktiver Stoffe mit den schlimmsten Befürchtungen erfüllen, hat das Wort zu leisten, was die Praxis nicht vermag: Uns dieser Sorge, dieser Befürchtungen zu entheben. Was de facto dahintersteckt, ist die Umwandlung des Planeten in eine Zeitbombe. Sogar wenn wir um den klartextlich ausgesprochenen Krieg herumkommen, was uns im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, und wer weiß wie lange noch, unter die Schuhsohlen geschoben wird, muß eines Tages zur Katastrophe führen. Einzig ihre Größenordnung wissen wir nicht im voraus. Mit der unabweislichen Einsicht in diese Tatsache verändert sich der Gebrauch der „Entsorgungs“-Formel. Aus Selbsttäuschung und Heuchelei wird lebensbedrohender Betrug. Das Festhalten an solchen Euphemismen gegen die wachsende Erkenntnis ihres wahren Charakters kriminalisiert ihren Benutzer – nicht in strafrechtlicher, wohl aber in moralischer Beziehung.
Von den Euphemismen, die Sachbestände verkehren, bei OrweIl „Neusprache“ genannt, zur Fungierung sind die Übergänge fließend. Die fungierende Sprache ist eine, die an die Stelle dessen tritt, was faktisch abwesend ist. Kein moderner Absolutismus ohne fungierende Sprache, die den Untertanen das Potemkinsche Dorf bereitstellt, in welchem sich aufzuhalten sie wähnen sollen. Die fungierende Sprache, die eine unerreichte, unerreichbare Realität zu ersetzen hat, muß naturnotwendig andere, einer lebendigen Sprache innewohnende Möglichkeiten des Weltverstehens und der Welterfahrung dieser ihrer einzigen Funktion unterordnen. Dadurch wird sie starr und statisch, da sie nicht länger auf Erkenntnis ausgeht, sondern mit ihrem Zeichensystem einen fiktiven Zustand als bestehend deklariert. Indem sie für inexistente Realität einsteht, erleidet diese Sprache selber einen umfassenden Realitätsverlust. Sie bekommt etwas Scheinhaftes und Unwahres. Gleichzeitig verliert sie ihre Tauglichkeit für den Einzelnen zum Ausdruck seines Befindens. Selbstverständlich ist jede persönliche Färbung, jeder individuelle Duktus undenkbar, da ihre Zweckbindung sie auf einen einzigen Nenner bringt und dort verfestigt.
Ich habe das etwas ausführlicher vermerkt, um den Gegensatz zur Sprache des Gedichts überdeutlich zu machen. Unabhängig von allen politischen oder sonstigen inhaltlichen Intentionen erweist sich das Gedicht innerhalb des Bereichs einer fungierenden Sprache als Fremdkörper sui generis. Das im Gedicht wirksame archaische Bewußtsein kollidiert unbeabsichtigt mit jenem Bewußtsein, dem, verkürzt gesagt, nicht die Welt zum sprachlichen Bild wird, sondern die abstrakte Sprache zur Welt. Ein größerer Widerspruch ist kaum denkbar. Und seine logische Konsequenz ist dann auch meist die Unterdrückung derjenigen, die sich den brachial durchgesetzten oder aufrechterhaltenen Sprachregulierungen widersetzen. Ein Indianerschicksal! Denn in der dichterischen Sprache steckt unartikuliert die Widerlegung des sogenannten „Fortschrittes“, seine Leugnung und Mißachtung, die ihre Berechtigung aus einem starken Empfinden des Einklanges mit den Gegebenheiten der Natur bezieht, aus einem Gefühl kosmischer Einheit, das sonst aus den anderen sprachlichen Medien verschwunden ist. Darum liest sich jedes Gedicht wie eine Verlustanzeige, ohne daß der Gegenstand des Verlustes besonders benannt werden müßte. Zwischen dieser unabdingbaren Ausgangsposition und der intellektuellen Unterwerfung unter die Zwecke gesellschaftlicher Maschinerien ist eine Vermittlung unmöglich, geschweige denn eine Annäherung. So wenig das archaische Bewußtsein den Aufgaben und Zielen der zu „Hochzivilisationen“ ernannten Gesellschaftssysteme gerecht werden kann, ohne sich selber auszulöschen, so wenig kann das Gedicht sich einer sogar notwendigen politischen Praxis unterordnen. Beide, archaisches Bewußtsein wie das ihm entspringende Gedicht, haben die Eignungsprüfung des Utilitarismus nicht bestanden. Und unsere Crux besteht darin, daß wir diesen unaufhebbaren Gegensatz überhaupt nur in der abstrakten Sprache des eingeschränkten Bewußtseins selber darzulegen und zu diskutieren vermögen. Wir sprechen sozusagen in der Sprache unseres Feindes über unsere, uns von ihm zugefügten Leiden.
Am Ende kehren wir zur Ausgangssituation zurück. Wie die beiden konträren Bewußtseinsformen und die ihnen eigenen Sprachen einander gegenüberstehen, so ist ihre gegenseitige Fremdheit und Beziehungslosigkeit in Häuptling Smohalla und Major MacMurray verkörpert, unseren Leitfiguren für ähnliche Figurationen im luftigen Reich der Ideen.
Und ein Weiteres scheint vorweggenommen in der Begegnung dieser beiden Männer, falls wir den Mut haben, darin mehr zu sehen als nur die personalisierte Berührung unterschiedlicher Kulturkreise. Smohallas ferneres Geschick, wie das seines Volkes, könnte das der Dichter und ihrer Gedichte vorausmelden: Sie werden unaufhörlich als Anachronismen aus einem technisch-ökonomischen Wirkungsgewebe an dessen Rand gedrängt, wo ihnen noch nicht einmal das Gnadenbrot sicher ist. Die einstmals mächtige Wirksamkeit der Dichtung, von der noch bei den Dichtern der Spätromantik ein letztes Flackern kündet, mußte mit der Adaption des allgemeinen Bewußtseins an jenes überwältigende Gefüge enden, das von kritischen Geistern „Megamaschine“ genannt wird. Den letzten Indianern Europas sind noch ein paar Reservate zugestanden worden, in denen sie ihren sonderbaren und überlebten Riten frönen können – manchmal für ein Eintrittsgeld, den Buchpreis, bestaunt und sogar bewundert.
Trotz aller öffentlichen Versicherungen, die Dichter gehörten zur Gesellschaft und seien Teil von ihr – sie können gar nicht dazugehören, ohne ihr Wesen aufzugeben. So wie die letzten noramerikanischen Indianer nicht den berühmten„ Way of Life“ gehen und dennoch Indianer bleiben dürfen.
Am Schluß bleibt uns die Frage, ob diese Mini-Minorität mit ihrer schwer verständlichen Sprache und ihrem altertümlichen Bewußtsein, ob die Dichter also eines Tages auch noch ihre Stellung als lebende Fossilien einbüßen und vom betonierten Erdboden verschwinden werden. Oder ob sie nicht eventuell so etwas sind wie eine Handvoll Samenkörner einer ausgestorbenen Pflanzensorte, die die Chance einer Wiederkehr erhält, sobald man die Körner erneut zum Blühen bringt – um einmal im Stile Smohallas zu reden. Wobei jedoch zu fürchten ist, daß diese Chance von Tag zu Tag geringer wird.
Wenn es uns auch nicht gegeben ist, unsere fehlgelaufene Entwicklung umzukehren oder umzulenken, so wollen wir uns doch wenigstens durch das dichterische Wort an das erinnern lassen, was wir rettungslos versäumt haben – uns den Traum zu bewahren, der Leben heißt.
Günter Kunert, Vorwort
Lesarten – Gedichte der ZEIT
Bei den die Gedichte begleitenden Texten handelt es sich keinesfalls um Versuche, gültige oder auch nur annähernd verbindliche Interpretationen herzustellen. Beabsichtigt war, Lesarten für Gedichte vorzuschlagen, Gedanken angesichts poetischer Hervorbringungen zu äußern, und damit den Leser anzuregen, sein eigenes Lyrikverständnis zu entwickeln.
Einzige feststehende Vorgabe bei den „Begleittexten“ war, daß keiner länger sein sollte als eine Schreibmaschinenseite. Nicht jedes der mir damals zugesandten Gedichte ist dann auch (nebst Lesart) erschienen, da in einer Wochenzeitschrift immer wieder unverhoffte Aktualitäten oder das Anzeigengeschäft gegen die Dichtung entschieden. Hier liegt die Serie jetzt vollständig vor, und zwar in alphabetischer Reihenfolge und nicht in der ihres Erscheinens in der ZEIT 1982–83. Beim nochmaligen Lesen haben sich einige, wenn auch nicht den Inhalt betreffende Korrekturen als nötig erwiesen.
Günter Kunert, Nachwort
Zu diesem Buch
Fünfzig Gedichte von fünfzig zeitgenössischen Lyrikern enthält dieser Band – unter ihnen Rose Ausländer, Wolf Biermann, Hilde Domin, Hans Magnus Enzensberger, Ludwig Fels, Erich Fried, Peter Härtling, Rainer Malkowski, Jürgen Theobaldy und Gabriele Wohmann.
Günter Kunerts Begleittexte zu den Gedichten wollen nicht als gültige oder auch nur annähernd verbindliche Interpretationen verstanden werden. „Beabsichtigt war, Lesarten für Gedichte vorzuschlagen, Gedanken angesichts poetischer Hervorbringungen zu äußern, und damit den Leser anzuregen, sein eigenes Lyrikverständnis zu entwickeln.
Die für die Zeit geschriebene, dort aber nur teilweise abgedruckte und für die Buchproduktion überarbeitete Serie liegt in diesem Band nun vollständig vor.
R. Piper Verlag, Klappentext, 1987
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
DAS&D + Archiv + Internet Archive + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ Sinn und Form ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


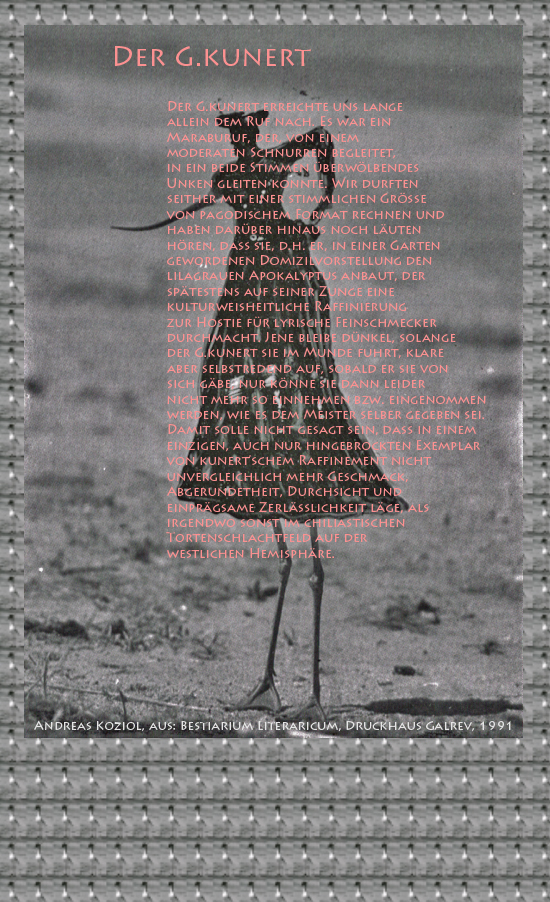
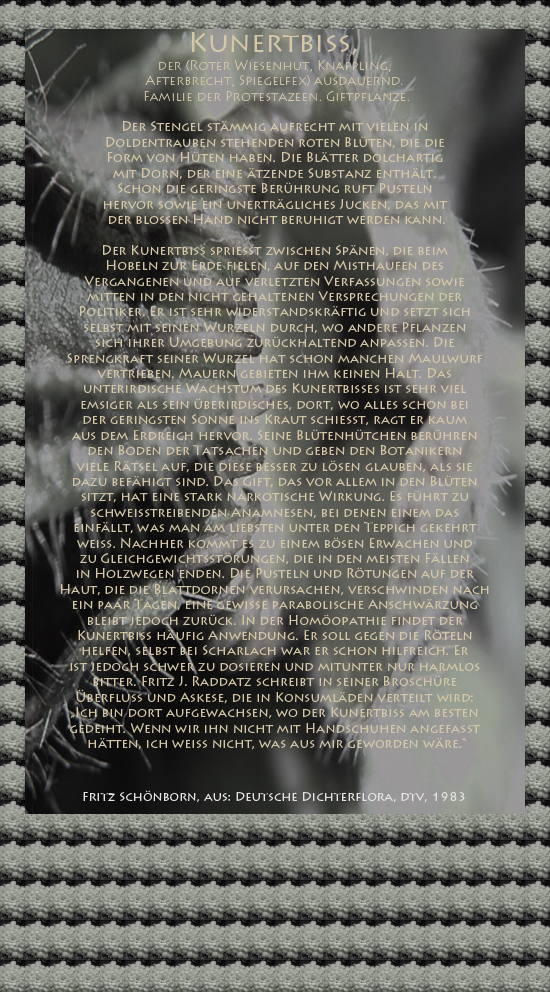
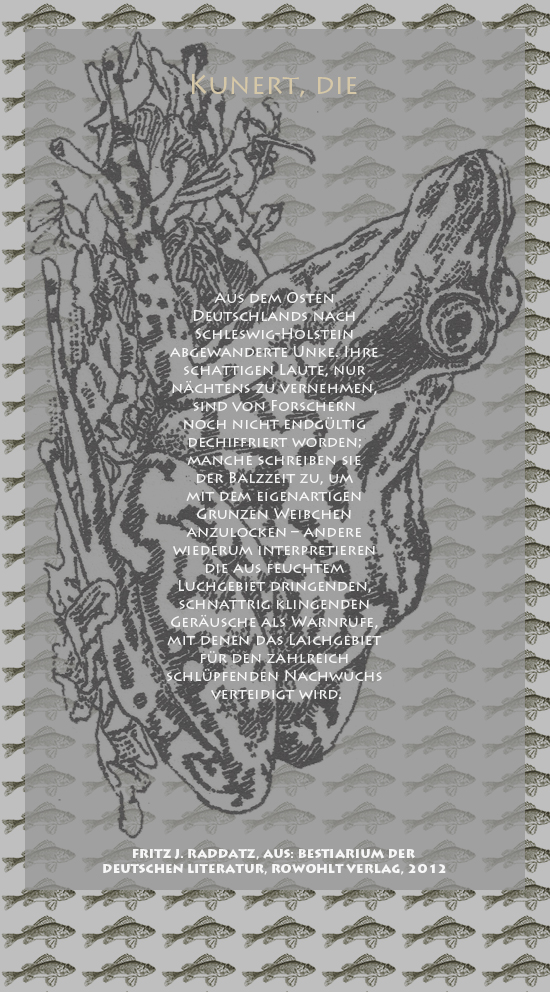
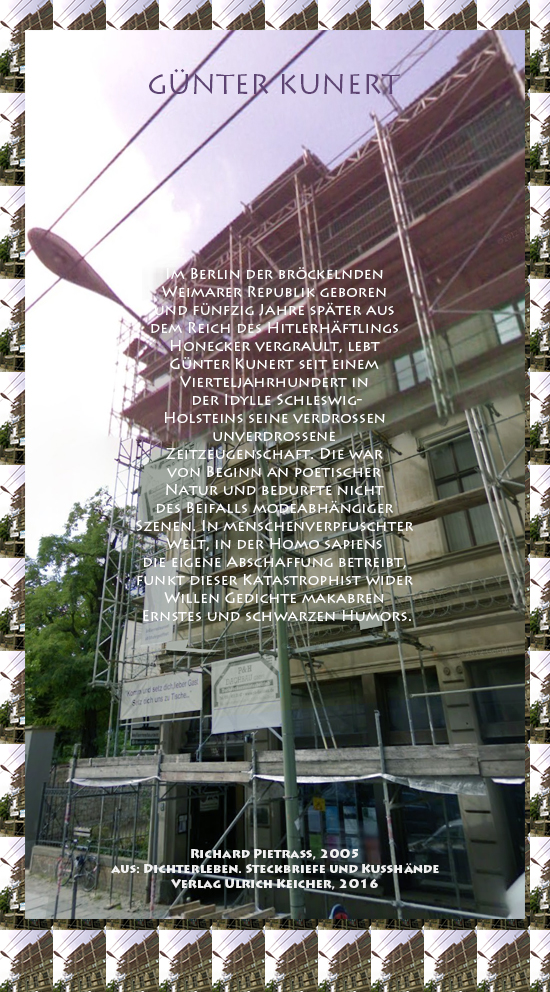












Schreibe einen Kommentar