Günter Kunert: Notizen in Kreide
TESTAMENT
Wie meine Gestalt
überliefert erscheinen wird:
hungrig und durstig inmitten
nachbiblischen Tohuwabohus
von Töpfen und Tassen Tellern und Abfall
leeren Gläsern und leerem Papier
denn das Chaos geht der Schöpfung voran
und das Vorher ist besser
als jedes Hernach: ordentlich gekleidet zwar
doch unordentlicher Gedanken voll
unter der kahlen Stirn; nämlich
daß menschengemäße Ordnung
die nicht mechanisch und also letal verläuft
sondern sich anschmiegt
dem Kopf dem Körper dem Atem die Kunst wär:
ein Element
das alle vier anderen brauchen
um mehr zu sein als sie sind:
so
überliefere ich mich
als elementares Ereignis
als flüssiges Feuer als luftige Erde
gebannt in Fleisch und Blut
geschmiedet
an den Felsen der Zeitlichkeit.
Nachwort
1
Als Gesprächspartner ist Günter Kunert anregend und angenehm. Frei von Ehrgeiz, alles besser wissen zu wollen, scheut er die Besserwisser. Seine Argumente bestechen durch Klarheit und Bildkraft. Er kennt Geschichte, unternimmt es, sie in ihrer Dialektik zu fassen. Ein Hang zum Satirischen ist unverkennbar. Reisen sind seine große Leidenschaft: bringt er doch mehr als blaues Glas nach Hause. Tieren gehört seine Sympathie, Katzen besonders. Für Hüte hat er ein Faible. Und nicht zuletzt: Seine Bücher – ob mit oder ohne Zueignung – sind Marianne, seiner Frau, gewidmet.
Kunert ist Lyriker: er vermag seine Gedichte als Entsprechungen seines Selbst anzusehen, „eines Selbst, welches nachdrücklich zeit- und gesellschaftsgeprägt worden ist“. Und er präzisiert diese Haltung, wenn er schreibt:
Ich meine, die Befreiung der Menschen in der sozialistischen Gesellschaft besteht (unter anderem) in ihrer Freilegung von rasch veränderlichen Äußerlichkeiten; besteht im Zusichselberkommen, im endlichen Aufhören der Entfremdung, die nichts anderes gewesen ist als die Dezimierung existentieller Fülle: der Sieg der ökonomischen Funktion des Individuums über alle seine anderen Anlagen und Möglichkeiten: der Triumph des Akzidentiellen.
2
„Was ist denn in dir / und was soll geliebt sein?“ ist eine der Fragen, die den Dichter unseres bewegten Säkulums, geformt von einer revolutionären Umwälzung neuer Qualität, nicht zur Ruhe kommen läßt, die er in vielen seiner Gedichte zu ermitteln und zu beantworten sucht. Günter Kunert reflektiert den Menschen, der aufgebrochen ist, auch in der Liebe ganz Mensch zu werden, so daß „Unterwegs mit M.“ Glück erfahren werden kann. Da er selbst in der intimsten Sphäre menschlicher Zweisamkeit gesellschaftliche Beziehungen erkennt und in Aktion umgesetzt sieht, verliert sich seine Liebeslyrik nicht im Privaten, das Subtile nicht im Abseitigen. Eine ungebrochene Kommunikation der Liebenden zueinander als gesellschaftliche und zugleich kreatürliche Wesen wird ablesbar, wenn wir Kunert auf die „Pirsch“ und „auf Alexanders Spuren“ folgen oder uns in den Gedichten „Was uns manchmal bewegt“ und „Ferne Verwandtschaft“ die Kraft menschlichen Liebesspiels durch die Konfrontation mit dem Treiben der Naturgewalten bewußt gemacht werden soll.
Der Liebeslyrik Günter Kunerts ist ein ungestörtes Verhältnis zwischen Sexualität und Erotik immanent. („Leibhafte Liebe“ und Sinnlichkeit werden auf ihre schöpferischen Potenzen durchforscht: „Kürze der Wollust“, „Unschuld der Natur“, „Zuspruch, wortfrei“, „Beschreibung eines Muttermales“, „Landschaft“, „Auch ein Liebeslied“.) Das unterscheidet sie von einer Lyrik, in der elementare menschliche Regungen und Bindungen nur verzerrt erscheinen und das Erotische nicht als Teil des menschlichen Kultivierungsprozesses begriffen wird. Der Gedanke der Produktivität, der in der Welt- und Menschensicht des Dichters heimisch geworden ist, äußert sich in anderen Dimensionen, wenn „Vorwärts auf der Straße zu einem Traum“ gefahren wird, wenn man vernimmt, „Wie wir uns im Walde noch einmal begegnen“ und einem im „Blick auf einen Strand“, wo sich Leiber „aus den Menschenschmieden, den Maschinenhorsten, den Geräteflüssen“ mit der Erde paaren und vermählen, die Zukunft offenbar wird. Doch bei allem:
Wo wir liegen sitzen gehen laufen
immer bleibt um uns ein schwarzer Rest
von dem Dunkel über das wir schweigen
das uns bis zum Ende nie verläßt.
3
Berlin und London, der Rhein und die Adria, Texas und New York ließe sich als Route einer Reise vorstellen. Kunert benutzt diese Stationen, sich als Dichter über Land und Leute, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges auszusprechen. Er scheut es nicht, den Namen eines Stroms zu erfinden, der, unsichtbar und voller Gefahren, alles und jeden mitnimmt, durchspült und aufsaugt: „Daystream“. Er wird zum Symbol des Schöpferischen, Aufbauenden, Zukunftsweisenden, zur Metapher, die in allem mitschwingt, was Kunert bei nächtlichem Wandern durch Städte und U-Bahnschächte erfährt, was ihm beim „Wohnen“ und beim Nachdenken über „Sterben“ ergreift, bei Besuchen eines „Nachlaßlagers“ in der Berliner „Kleinen Alexanderstraße“ und der Stadt „Rovinj“ in Istrien oder in „Downtown Manhattan“ anrührt, was ihn bei allen Gegenfaktoren und ihrer noch möglichen und immer wieder hervorbrechenden Aggressivität doch zu der aktiven Schlußfolgerung gelangen läßt:
Damit von unseren Städten mehr bleibt als der, der durch sie hindurchging, der Wind, ist eine langanhaltende, wenig gewalttätige, gesicherte Entwicklung nötig; ohne Bedrohung durch die vielfältigen Schrecknisse unseres Jahrhunderts.
Kunert kennt sein Berlin, wurde hier geboren, als die Weltwirtschaftskrise begann: 1929. Mit sechzehn erlebte er, wie es nach zwölfjähriger Barbarei und sechsjährigem Krieg in einem Teil Deutschlands, im Osten, anders zu werden anfing. „Die Zeit der Aufrechten, der Arbeitsamen, Friedlichen hat begonnen“: weiß er zu berichten. Ein anderes, neues Berlin wuchs aus den Trümmern, das sich mit Dankbarkeit eines russischen Arztes erinnert und jener, „die den Krieg zu enden kamen in die Stadt“. Aber nicht nur eine Stadt, viele Städte, ein ganzes Land veränderten ihr Gesicht, von Menschen geprägt, die einander helfen, gälte es, einen „Brand rasch zu zertreten“. Aus der Konstellation, die Stadt sei den Menschen „günstig“, weil sie von ihnen „geschaffen“ wurde, leitet sich die berechtigte Hoffnung ab, sie für immer zu besitzen, wird der „Ausflug“ nicht in einer Stadt enden, die, „während des wir schliefen“, der Vernichtung anheimfiel.
Der Dichter ist kein kontemplativer Chronist unserer Epoche. Er will die Menschen in Bewegung bringen, will zerstören, was die Wachsamkeit einschläfern könnte, will die „Schatten entziffern.“ Den „Davongekommenen“ und Gleichgültigen soll das Gedächtnis aufgefrischt werden, suchten sie den doch vergeblich, „… der / sie freispricht von Schuld / am eignen Untergang diesmal“. Dem Reisenden, der den „in der Abgeschiedenheit Wohnenden“ beneidet, gibt er zu bedenken: „daß spurlos gleich diesem Tage, gleich dem / Schnee und den Bäumen, vergehen wird, wer so / einsam ist“. Da die Menschheit in unserem Jahrhundert eine Perspektive zu erhalten vermochte und das Ideal vom befreiten Menschen sich im Kampf verwirklicht, besteht auch für die Menschen in den Fabriken die Möglichkeit, zu begreifen, „… daß / da kein Mitleid ist, / und / daß sie sich erbarmen müssen ihrer selbst- / erbarmungslos“.
Am Ende der Reise rücken die Welt im Großen und die Stadtwelt im Kleinen eng zusammen. Aber immer wieder ist Berlin der Ausgangspunkt, Stadt an der Spree, in der sich zwei Welten – Krieg und Frieden – gegenüberstehen. Kunert ist mit dem sozialistischen Berlin verwachsen, das ihn behaust und beschirmt, das er, jetzt in einem Vorort wohnend, auf andere und neue Weise erlebt:
Hier geht die Luft geruhsam umher.
Hier brennt eine Gaslaterne und
da auch. Hier riecht es nach Flieder
und dem Rauch
einer verlorenen Lokomotive.
Doch nicht weniger gern führt er uns die Straßenbahnen vor, die Autos. Und nicht nur sie: die Wolken, den Wind und die Erde ebenso, an der ihm gefällt:
… Daß sie
trotz aller Mühen nicht stehenbleibt.
Und eilt.
Und fährt – Und kommt −
Und fliegt auf alle zu, die für Bälle Kugeln halten
4
Die Mahnung des Dichters wider das Vergessen, ausgesprochen in den Gedichten aus den Städten und über sie, bleibt nicht anonym. Sie wird von ihm an eine ganz konkrete Adresse gerichtet: „… Gegen die Pest unserer Zeit: gegen den Faschismus“. Ihn selbst traf die „Gewehrkugel“ nicht, der zweite Weltkrieg „verschonte“ ihn. Der Name Günter Kunert wurde nicht „entziffert auf den Listen“ der faschistischen Schergen. Noch immer aber:
Kein Ende finden, die jämmerlich geendet.
Wo Rauch steigt
und wo Asche fällt,
ist ihrer schon erinnert: erst recht, wo
Unrecht brennt −
denn dessen Flackerschein hebt aus
dem dunklen Nichts
die starren Masken derer, die nicht sterben können,
damit sie
nicht umsonst gestorben sind.
Sei es der „ungebetene Gast“, ein Jude aus der Gegend um Warschau, der am Tisch Platz nimmt und „stumm seine Geschichte erzählt“, oder Anne Frank, derer in der „Prinsengracht 263“ gedacht wird, sei es ein unbekannter Soldat „Unter einer Decke von Beton“, der erst gefallen sein muß, um zu erkennen, wer seine wirklichen Mörder sind und daß sie schon wieder marschieren: immer richtet der Dichter Blick und Sinne darauf, Aktivität zur Abwehr der Gefahr zu entwickeln, die den Menschen in unserer Epoche noch bedroht. Dieses Bestreben wird bis in die Stilmittel hinein sichtbar, die Kunert benutzt, um sich poetisch zu äußern. Er bevorzugt einen didaktischen Stil und zeigt Vorliebe für freie Rhythmen mit metrischen Rudimenten und Alliteration. Chiasmus und Oxymoron sind häufig gebrauchte, die Wirkung steigernde Stilfiguren.
Das belehrende Element, ein integrierender Bestandteil der Kunertschen Poesie, nährt sich aus der Vorstellung des Dichters vom sinnvollen Widersinn: „Paradoxie ist aber nichts weiter als die Momentaufnahme, als der Schnappschuß eines dialektischen Vorganges.“ So stehen zum Beispiel Überschrift und Aussage des Gedichts „Notizen in Kreide“ in einem paradoxen, antithetischen Verhältnis zueinander. Notizen in Kreide sind vergänglich, der Regen kann sie fortspülen, eine Handbewegung tilgen. Die Gegenwart jedoch macht es unmöglich, die Vergangenheit zu vergessen. Daß die Ermordeten durch die Existenz der Mörder noch im Bewußtsein der Lebenden vorhanden seien, bedeutet daher für Kunert das Paradoxon von „Notizen in Kreide“.
Die erste Strophe des Gedichts offenbart den provisorischen Zustand im Dasein des Menschen als Subjekt. Aber die Baracke ist „fester denn jede Festung und dauernder“. Die grauenhafte Vergangenheit, in Strophe zwei beschworen, bestürmt sie immer aufs neue. Doch der Erfolg muß ausbleiben. Der Faschismus kann als Vergangenheit nicht überwunden werden, weil, wie in der Schlußstrophe enthüllt wird, „zu lebendig die fleißigen Töter / noch und wieder noch“. Kunert präzisiert diesen Gedanken:
Obwohl ich in einem Staat lebe, dessen Beginn aus einer historischen Zäsur erwächst und der daher die Erbschaft mörderischer deutscher Misere nicht antrat, bedrückt mich das kontinuierliche Fortkommen der Schuldträger im anderen deutschen Teil. Meine Erfahrungen, ich gestehe es ein, machen mich zum Realisten.
Erfahrungen, die der Lyriker selbst gemacht hat, können sich so bei ihm mit der Einsicht in die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unseres Zeitalters verbinden. Sein „De profundis“ wie die Schlußfolgerung, zu der er gelangt „zwischen Dunkel und Dämmer“ und in einer „Botschaft“ niederlegt, verdunkeln daher nicht die Perspektive:
Solange die Zerstörung einträglicher ist
denn Aufbauen, und
solange
nicht abgeschafft sind
derer die Einträglichkeit ist; solange
wird vielleicht hin und wieder sein: Ein wenig
Ruhe. Sicherheit
keine.
5
Die Porträts, die Günter Kunert entwirft, sind Ergebnisse einer literarischen Arbeit. Sie hängen nur indirekt mit dem Studium an der Hochschule für angewandte Kunst zusammen, das der Dichter nach dem Krieg fünf Semester lang in Berlin-Weißensee betrieb. Die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Zeiten mit der unterschiedlichsten Bedeutung rücken für mehr als eine „hundertstel Sekunde“ ins Licht einer poetischen Weltbetrachtung und Persönlichkeitsdeutung. Für die Geschicke der Menschheit zu rühmende Namen finden sich darunter: Marx und Lenin; unrühmlich und hassenswert der Name Hitler und eines seiner Vasallen, Mulka, „auserwählt um nichts zur Verwandlung / in eine Menge flüchtiger Asche“. Konterfeit wird auch Orpheus, der sagenhafte griechische Sänger, und aus dem Griechenland der Gegenwart „Yannis Ritsos nicht zu vergessen.“ Über Menschen, „… die überall sind. Die / im Schatten leben. Die / ans Licht treten hin und wieder / für / eine hundertstel Sekunde / der ziemlich dunklen Ewigkeit“, gibt ein „Fotoalbum“ Auskunft.
Gedichte über den römischen Lyriker Catull, den deutschen Dichter Balcke, den tschechischen Lyriker Halas, den amerikanischen Schriftsteller Masters und den polnischen Dichter Borowski erheben nicht den Anspruch, die Galerie zu vervollständigen. Daß sie „aufbewahrt zu fragwürdiger Bedeutung / für eine / fraglose Nachwelt“ werden, deutet Kunerts Auffassung vom Leben an, die er in zwei Varianten vorstellt. Die eine: Ein kurzes, aber schöpferisch-kämpferisches Leben, die andere: Ein langes, aber unproduktiv-monotones Dasein. Beide Gedichte stehen sich im Inhalt konträr gegenüber. Sie lehren: „Das Leben ist die Dauer, nicht die Fülle“ als unproduktiv zu begreifen und jener Alternative den Vorzug zu geben, die besagt: „Das Leben ist die Fülle, nicht die Dauer.“
Das nur oberflächlich Optimistische wird von Kunert gemieden. Deshalb verwundert es nicht, wenn er im Porträt über ein „Berühmtes Subjekt“, den Physiker Albert Einstein, ein Bild der Persönlichkeit gibt, der Größe ihrer wissenschaftlichen Leistung und mit der Frage endet: „Angesichts dieser Tatsachen muß gefragt werden, / war Einstein überhaupt Optimist?“ Diesen offenen Schluß und „offenen Ausgang“… „für alle Zukunft, / die beharrlich und selber ohne aufzuhören / eintritt −“ findet man bei Kunert nicht selten. Der Leser soll angeregt werden, das Gedicht zu vollenden, vermag er doch sein Wissen über Einsteins progressives Auftreten gegen Krieg und Mißbrauch von Naturwissenschaft und Technik hinzuzufügen, wie auch sein Verständnis und seine Vorstellung von Künftigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung. Aus der Nicht-Identität, vielleicht hervorgerufen durch einen „Spiegelblick“ oder die Aussage eines „Testaments“, kann so Produktivität erzeugt werden. „Das Gedicht färbt die Psyche des Lesers, er wiederum färbt nach seinem Ebenbild das Gedicht“, schreibt Kunert. Der Tod Gagarins mindert daher auch in keiner Weise den weiterführenden Gehalt und die optimistische Aussagekraft eines Gedichts über den ersten Kosmonauten der Welt:
Während seiner Rückkehr zum Planeten
ward ihm klar: Die Erde ist nur eins.
Die darauf sind, müssen miteinander leben,
oder es wird von ihr heißen: Leben keins.
6
Kunerts „Verkehrte Welt“ schöpft aus der widerspruchsvollen Realität unserer Epoche, um im Bewußtsein des Lesers die Einsicht zu etablieren, nicht länger Objekt der Geschichte zu sein, sondern zu ihrem denkenden, erfinderischen und phantasiereichen Gestalter zu werden. Ein Angebot, den dialektischen Prozeß nachzuvollziehen, „den ihm das Gedicht vorschreibt…“; denn als Lyriker und Erzähler geht Günter Kunert davon aus,
daß der Akt des Schreibens einer der Selbstbefreiung ist, des Selbstverständnisses, der Selbstverwirklichung, einer der einzig möglichen Individuation, nämlich der geglückten Identitätsfindung. Und ist solchermaßen der Akt des Schreibens gelungen, gelingt auch der des Lesens: der Nachvollzug beim Leser gibt diesem in abgeschwächter Weise, was der Autor unvermittelt beim Schreiben gewonnen hat.
Wer für den Frieden eintritt, muß in einem Teil der Welt rechnen, daß ihn die Gegner des Friedens der Freiheit berauben. Wer auf Kruzifixe baut, kann Gefahr laufen, vor ihnen in die Keller flüchten zu müssen, um nicht von ihrer Güte vernichtet zu werden. Wer von sich selbst bekennt, er sei gutwillig, ist damit noch kein nützliches Wesen für die Gesellschaft. Wer nur an der Oberfläche der Dinge kratzt, schont sein Gehirn. Wer sich dem Wasser als Fisch angepaßt hat, um sich vor einer Katastrophe zu retten, braucht Zeit, nach ihrer Beendigung wieder Mensch zu sein. Und:
Wer sich nicht bereitgefunden beizeiten mit
seinesgleichen die Kohle zu heben
muß einsam sterben wenn kommt was
wir uns entschlossen
Schnee zu nennen.
Der Gedanke, daß der Mensch danach strebt, „Mensch zu werden“, kehrt in mehreren Varianten wieder. In den Gedichten „Zu Radierungen von Goya“, „Unruhiger Schlaf in der Altwelt“, „Herbes Gedicht“, „Hotel Nevermore“ und „Aufbruch eines bedeutenden Tieres“ zum Beispiel, aber auch in Versen wie diesen, Erlebnisse des Dichters in den USA reflektierend:
Auf verschiedenen und vielen Ebenen
überrollt jeder jeden und sieht nichts
als geschwungene Verschränkungen
aus Beton
als die parallele und diagonale
die horizontale und vertikale
Bewegung der Wagen.
Niemand nimmt wahr
wie wir sind:
wie besonders
wie außerordentlich
ich meine: als Menschen.
Kunert bedient sich nicht selten des historischen Gewandes, um das gesellschaftliche System der Besitzenden anzuprangern, das die Entwicklung des Menschen zu hindern sucht: seien es die herrschenden Kreise im Land der Etrusker, die die PoIitik des „kleineren Übels“ vorziehen und die Interessen des Volkes verraten, sei es der Gouverneur in „Kansas City“, der nur die eine Forderung an seine Anhänger hat, das Denken ihm zu überlassen, ein Denken allein an sich, oder „Unterwegs nach El Paso“ eine Reminiszenz des Lyrikers:
Das Blut toter Armadillos
bildet auf dem Straßenbelag oftmals
Zeichen
die keiner entziffert weil keiner anhält
weil keiner es wagt
weil
am lebendigsten von all dem die Gefahr
daß sich selber verlorengeht
wer in die Weite wer in die Leere
die Füße setzt.
Die „verkehrte Welt!“ und die Sicht auf sie mittels der „Optik“ bedürfen der Veränderung. Nicht um eines formalen Experiments willen, sondern der Notwendigkeit halber, gegen den aggressiven Krieg zu kämpfen, wird der „Film – verkehrt eingespannt“. Die „Fernöstliche Legende“ rührt an die Grundfrage unserer Zeit: Während Mr. Goliath (USA) seine Keule wider den David (Vietnam) schwingt, gegen zur Befreiung entschlossene Völker, „sicher des Sieges / über die, winzige Schleuder,… / ist unter den Völkern der Erde / sein mächtiges Bild / schon zerschmettert“.
7
Günter Kunert sucht einen Weg zu allem, was mehr ist als individualistischer Natur: „Ich bin ein Sucher / eines Weges. / Sucher eines Weges / für mehr / als mich.“ Den Freunden der Schreibkunst rät er, sich den neuen Zeiten anzupassen: „Die Steinaxt gilt noch als Waffe, aber / sie ist nicht mehr gefährlich.“ So greifen die Vision des Arbeiters „Während der Mittagspause“ und der „Traum von der Erneuerung“ der Zeit und Entwicklung weit voraus. Schon heute jedoch tragen sie keinen utopischen Charakter mehr, weil „die Zeit um ist“, der Durst nach dem Reichtum der Erde, nach Weite, Wahrheit und Glück in der Gegenwart gestillt werden kann. Ein Grundakkord der Kunertschen Lyrik ist angeschlagen. Die Kraft des befreiten Individuums wird besungen. Die kleinen Leute, nicht mehr ungenannt, vollbringen große Taten und zeigen „das Antlitz des Herakles“. Sein und Tätigkeit werden in ihrer Identität erfaßt, mündend in den „Vorschlag“:
… Ramme
einen einzigen, einen neuen Gedanken
als geheimes Denkmal
deiner einmaligen Gegenwart
in den Deich
gegen die ewige Flut.
Der Mensch, „zu jeder Früh“ neu aufkommend „wie ein unerwarteter / Aufstand zielloser schäumender Unzufriedenheit / wie die Sonne und mit ihr zusammen“ und noch die Unebenheiten der Erde spürend, vermag sich schon das Ziel zu stellen, nicht nur „die Gedanken wandern“ zu lassen, sondern einen anderen Stern zu besiedeln. „Die Rakete“ wird für den Dichter zum Anlaß, die „Größe des Reisens“ zu bewundern wie auch jene, die sie ersonnen, um zu beweisen, „daß die Finsternis unterliegt“.
Gegen die Ziellosigkeit menschlichen Handelns wendet sich Kunert ebenso wie gegen die Ungeduld auf dem Weg, das Ziel zu erreichen. „Das Fenster ist aufgestoßen“, die Wahrheit hereinzulassen. Mag er konstatieren: „Auch die größte Sache / wird eines Tages alltäglich“, setzt er dieser Möglichkeit dialektisch entgegen:
Jedoch
gewinnt die alltägliche Sache an Größe,
wenn sich erweist: Sie ist
für den Alltag brauchbar.
Für die Amseln, für den Genuß, für
die Freundlichkeit, für den Menschen.
Er empfiehlt, gleich Ikarus die Arme auszubreiten und einen Anlauf für das Unmögliche zu nehmen: „Denn Tag wird. / Ein Horizont zeigt sich immer. / Nimm einen Anlauf.“
Der Dichter, der Partei ergreift, weiß vom Klassenkampf und seiner Notwendigkeit, aber auch von neuen Kämpfen ganz neuer Art, wie „die Klassiker lehrten, und diese / machen Geschichte und sind Geschichte / der Inseln und Wälder, der Städte und Dörfer, / der Alten und Jungen“. Dem Menschen im Sozialismus vermag das gelungene Werk Genuß zu bereiten. Es ist nicht das Ergebnis der Arbeit eines einzelnen. Gott wurde abgelöst „von der zweiten Schicht: ,Kolonne Mensch’“, Leuten aus Fleisch und Blut, denen es Spaß macht, ihre Herzen, Hirne und Muskeln zu betätigen, die als Schöpfer der Technik zugleich ihre Herren sind, um aus der Ödnis ein Werk wachsen zu lassen,
… das dröhnt und schreit, mit tausend
Stimmen spricht und tausend Leben lebt:
das dem, der es da liegen sieht, die Lungen
bläht voll Stolz.
Diesen genieße: er
schmeckt niemals bitter, wie so bitter einmal
die Lust des Zerstörens.
Das lyrische Ich wird von Günter Kunert als Legierung individueller und gesellschaftlicher Komponenten empfunden und verstanden. Der Dichter bleibt diesem Prinzip treu, sei es im subtilen oder auch drastischen Liebesgedicht, mag es um die „großen Fragen“ unserer Epoche gehen oder die „kleinen Fragen“ des menschlichen Alltags, zwischen denen ein dialektischer Spannungszustand herrscht. „Den Wissensdurstigen, kann“, wie er selbst sagt, „nicht der Weisheit letzter Schluß geboten werden“, ihm scheint der Zweck des Gedichts, der Sinn seines Geschriebenwerdens sehr viel verborgener, ungreifbarer zu sein, „und nie so recht mit irgendeiner Elle nachzumessen“.
Kunert verabreicht Gefühl „nur in geringen Dosen“. Um so mehr attackiert er die Gedanken des Lesers. Er versetzt ihn in Unruhe. Er stellt ihn vor Alternativen. Er will geistige und emotionale Aktivität bewirken. „Jeder Versuch eines nur äußerlichen Verstehenwollens“, schreibt er, „führt notwendigerweise zu Mißverständnissen – exklusive der oberflächlichen Gedichte.“ Sein Anliegen: zur Entgröberung des Lesers, seiner Sublimierung und Humanisierung beizutragen. In dieser Richtung jedenfalls sucht er die Antwort, sollte ihm die Frage gestellt werden, wozu er schreibt. Die Poesie Günter Kunerts läßt erkennen, daß sie im sozialistischen Sinn humanisieren möchte. Sie richtet sich gegen alles, was die Entwicklung des Menschen in unserer Epoche gefährdet. Daraus vor allem ergibt sich ihre Produktivität und Perspektive.
Der Dichter, der seine Entdeckung Becher verdankt und Brechtsche Pfade beschritt, geht heute längst seinen eigenen Weg. Vielleicht aber nähert er sich den beiden auch wieder, und nicht nur ihnen, auf andere und neue Weise. Saarow und Buckow liegen noch immer bei Berlin. Und Buch und Bernau sind für Kunert nicht nur Stationen an einer S-Bahn-Strecke, sie sind für ihn mehr geworden, Orte der Erkundung für sein lyrisches und episches Schaffen:
Das Alltägliche der Ortschaft ist scheinbar: es bleibt in seiner wahren Bedeutung unerkannt, weil, wer in ihr geboren oder seit einigem zugezogen, durch Gewöhnung erblindet ist. Diese Gewöhnung, auch meine eigene, zu durchbrechen, versuche ich Ortschaften und Landschaften auf literarischem Zugang zu betreten, auf einem ungewohnteren Wege also, so daß sie dem Besucher andersartig und fremd vorkommen. Insofern wird jeder Ort ungewöhnlich und betretenswert und ein Anlaß zum Weltverständnis.
9
Lyrik und Prosa sind in Günter Kunerts literarischer Arbeit miteinander verschwistert. Aber auch andere Genres gesellen sich hinzu, die zum Musikalischen Brücken schlagen, wie die Kantate oder die Funk- und Kinderoper, oder die mit dem Film verbunden sind, wie das Szenarium. Und stets fungieren als Begleiter dieses Wirkens theoretische Äußerungen des Dichters, die den Bänden voran- oder nachgestellt sind oder sich auch als Klappentext präsentieren, Gedanken zum jeweiligen Thema, ausgesprochen in mündlicher oder niedergelegt in schriftlicher Form. Da vermag sich der Leser ein reicheres Bild von einem Menschen zu machen, angeregt von seinem „Kramen in Fächern“ und der Ausbeute wie von seinen Schätzen, die er ans Licht hebt, die „geheime Bibliothek“ durchstöbernd. Der Mensch unserer Epoche ist der unerschöpfliche Gegenstand Kunertscher Erkundungen, Erwägungen und Beschreibungen. „Realismus in der Gegenwart, der erstrebenswert ist, mir Zumindest“, notiert Kunert, „erscheint als Haltung, die die großen politischen ökonomischen gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht als unwürdige unreine unpoetische Plattheiten ansieht, sondern begriffen hat, wie sehr das Individuum an ihnen teilnimmt; mehr: daß eigentlich sie, die Umstände, im wahrhaftigsten und tiefen Sinn des Wortes den Menschen ausmachen.“ Dabei gewährt er in seinem lyrischen wie auch prosaischen Werk der Paradoxie einen großen Spielraum, die auf Extremen beruht, die „… schon in der wirklichen Wirklichkeit aufeinander bezogen sein… müssen“.
Kunertsche Poesie und Prosa hängen aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Paradoxie zusammen, ganz zu schweigen von thematischen Berührungspunkten und der Tatsache, daß die Grenzen zwischen den Gattungen fließend sind. Kunert ist in allem ein Dichter, impressionistische Darstellungen meidend, der versucht, auf Erkenntnis zu insistieren, auf die Bahnung eines Weges zu einer Einsicht bin. Das erfolgt in der Prosa anders als in der Lyrik, die einer eigenen Gesetzlichkeit unterliegt. In den Prosastücken zum Beispiel dominiert das erzählerische Moment und vermag ein Ausschnitt die ganze Geschichte zu implizieren, fällt eine stärkere Hinneigung zum Philosophischen auf und eine kräftigere Ausprägung von Ironie und Satire. Bezogen auf seine Arbeit, heißt es in einem „Selbstporträt“ Günter Kunerts:
Schreiben ist Rettung vorm Tode, solange es anhält. Das ist der Augenblick der Wahrheit, da sich das Individuum seiner Individualität begibt und sich aufs innigste mit dem unsterblichen Ich menschlicher Allgemeinheit verquickt, das wiederum, sonst zu Gesichtslosigkeit und Abwesenheit verdammt, selber das am Tisch hockende, übers Papier geneigte, haarloser werdende Individuum braucht, um sich zu manifestieren und sichtbar zu sein.
Kunerts literarisches Schaffen, mittlerweile zu einem Werk angewachsen, begann nach 1945. Mag es Zufall sein oder nicht: Im Rückblick gewinnt das Faktum an Bedeutung, daß die ersten Veröffentlichungen, Gedichte und Kurzgeschichten, satirischen Charakter trugen. Und wenn sich der Dichter 1967 in seiner Geschichte „Berolina: Gewöhnlich wie gehabt“ an das Berlin von 1945 erinnert, zeugt das nicht nur von Kontinuität in thematisch-künstlerischer Hinsicht, sondern vor allem davon, daß er von Anfang an, gleichviel in welcher Form, Menschheitsfragen unserer Epoche aufgreift und zu gestalten trachtet. So vermochte sich Günter Kunert in fast drei Jahrzehnten seinen Platz in der literarischen Landschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu erarbeiten und in unserer sozialistischen Lyrik, Prosa und Essayistik eine Position zu markieren, geprägt von einer dem realen Humanismus verpflichteten geistigen Haltung und künstlerisch unverwechselbar. Was er Ende der fünfziger Jahre über Becher schrieb, dürfte sich für ihn, sein Leben und sein Werk, als nicht weniger wichtig erwiesen haben und auch in Zukunft erweisen, das Verhalten des Dichters zur Arbeiterklasse betreffend:
Ohne sie wäre er nicht und wäre er nicht er. Lehre, daß ohne geistigen und emotionalen Zusammenwuchs mit einer revolutionären, einer historisch noch fortschreitenden, einer zukunftsbildenden Kraft ein Dichter sich von Wirksamkeit und Bedeutung löst. Lehre, daß mit dieser Kraft, und von ihr gestärkt, er weltweit wirken wird.
Armin Zeißler, Nachwort, November 1974
Günter Kunert (geb. 1929):
Der Zweck des Gedichts, glaube ich, ist sein Leser, indem er sich mit dem Gedicht befaßt, sich mit sich selber zu befassen genötigt wird: in einem dialektischen Prozeß: im gleichen, den ihm das Gedicht v o r s c h r e i b t und vorexerziert.
Das spannungsträchtige lyrische Ich und das Leser-Ich werden während des lesens identisch und gleichzeitig nicht identisch; das eine verfremdet das andere und deckt es doch gleichzeitig. Das Gedicht färbt die Psyche des Lesers, er wiederum färbt nach seinem Ebenbild das Gedicht.
Fragte man mich, wozu solche komplizierten Vorgänge heraufzubeschwören nötig sei, ich wüßte nichts rechtes zu antworten. Soll man vielleicht sagen, daß der Vorgang zu einer Entgröberung des Lesers führt? Daß es ein Prozeß der Sublimierung ist? Der Humanisierung? In dieser Richtung jedenfalls liegt die Antwort, wenn man sie suchen will.
Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, Klappentext, 1975
„Diese fertige und schon wieder verschwindende Welt…“
− Interview mit Günter Kunert. −
Monika Ammermann-Estermann / Alfred Estermann: Herr Kunert, wie arbeiten Sie, schreiben Sie einen Text in einem Zuge herunter oder arbeiten Sie mehr erprobend, indem Sie Formulierungen sammeln, Ideen speichern und nach mehreren Versuchen erst zu der gewünschten Form kommen?
Günter Kunert: Eher in einem Zuge herunter, das heißt also Prosatexte, deren auslösendes Moment ähnlich ist wie bei Gedichten, zwar etwas anders, aber ähnlich. Der Text entsteht meist im Fortschreiten, Schritt für Schritt von Assoziation zu Assoziation, von einem Bild zum nächsten sich vorarbeitend. Ich speichere keine Ideen und bin auch ohne meinen Schreibtisch, ohne das Papier und einen Stift ein ganz schlechter Schreiber, ich benötige also auch die direkte Schreibsituation zum Schreiben. Ich kann mich nicht irgendwo hin bewegen, spazieren gehen, wie man das von Uwe Johnson weiß, der wochenlang umhergeht und seinen Text dann fast fertig hat und ihn nur noch aufschreiben muß – dies ist mir leider unmöglich. Nach diesem ersten Aufschreiben, Hinschreiben, das ein sehr lockeres ist, beginnt dann die Arbeit. Der technische Prozeß ist einfach der, ich schreibe mit der Hand, übertrage es in die Maschine, das ist eigentlich der größte Sprung: die Maschinenversion. Die unterscheidet sich am stärksten von der handgeschriebenen. Diese erste Maschinenversion wird dann korrigiert und noch einmal abgeschrieben, dann kommen noch kleinere Korrekturen und meist ist es dann in der gewünschten Form.
Ammermann-Estermann / Estermann: Welche ausländischen und deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts beziehungsweise der Gegenwart schätzen Sie am meisten? Welche Vorbilder, Identifikationsmuster oder Lieblinge im Musée imaginaire de la littérature haben Sie?
Kunert: Am Anfang meines Schreibens stehen zwei amerikanische Patenväter, Edgar L. Masters und Carl Sandburg, die mich sehr beeindruckt haben, zwei amerikanische Lyriker, die eigentlich gänzlich vergessen sind, auch in Amerika nahezu; Edgar L. Masters ohnehin. Über seine Vergessenheit kann ich rasch noch etwas ganz Konkretes sagen: Er gehörte zu den Lyrikern, die auch unter ganz trostlosen Umständen gestorben sind, nach dem Kriege in einem New Yorker Altersheim. Brecht kannte ihn brieflich und hätte ihn auch gern gesprochen, nur konnte Masters ihn nicht besuchen, weil er kein Geld hatte und frug bei Brecht an, ob der ihm nicht das Fahrgeld schicken könne und Brecht, der selber auch kein Geld hatte, mußte dann auf diese Begegnung verzichten. Sandburg war zu seiner Zeit ein berühmter Mann, der durchs ganze Land zog und, so eine Art Ur- und Vor-Biermann, überall seine Lieder sang, wenn auch diese Lieder weniger direkt politisch waren, der außerdem eine sechsbändige Lincoln-Biographie geschrieben hat. Sehr beeindruckt hat mich auch ein Autor, der ganz wichtig für mich war, wie für viele andere Leute auch: Proust. Das ist ja ein Buch, Die Suche nach der verlorenen Zeit, aus dem man anders herauskommt, als man hineingegangen ist. Ein weiterer wesentlicher Autor war für mich Italo Svevo, den man leider auch viel zu wenig kennt, der immer als Vorläufer von Joyce bezeichnet wird, was er eigentlich gar nicht ist, wie ich finde. Die deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – da müßte ich vielleicht etwas besitzergreifend Kafka nennen, der aber mit der Bezeichnung „deutscher Schriftsteller“ gar nicht gefaßt ist, da kommt sehr vieles zusammen. Und Tucholsky selbstverständlich. Und auch ein Autor wie Ringelnatz – muß ich sagen, zu seiner Ehrenrettung, der als ein Trivialdichter gilt, der er eigentlich nicht war: ein stiller Vorläufer, bei dem die Groteske, das schwarze Gedicht sich noch freundlich und verbindlich zeigt, obwohl sich darin vieles abzeichnet, was später Unmenschlichkeit wird.
Ammermann-Estermann / Estermann: Wie war Ihre Stellung zu Brecht, Ihre persönlichen und literarischen Beziehungen zu ihm?
Kunert: Als Brecht zurückkehrte, habe ich ihm, als er noch im Hotel Adlon hauste, meine Gedichte gegeben, bin ich mit ihm daraufhin in Kontakt gekommen und habe ihn sporadisch besucht, in Weissensee, wo er in einer alten Fabrikantenvilla hauste, die ihm – er war ja erstaunlich geizig – immer zu teuer war. Ich bin immer, weil er ein Frühaufsteher war – ich war es damals noch gar nicht – sehr früh erschienen, und er hat sich häufig angesehen, was ich schreibe, hat etwas dazu gesagt und hat auch, vielleicht zum Text, vielleicht aus Neugier, Arbeiten von sich gezeigt, immer mit der Frage: kann man das veröffentlichen, kann man das aufführen, aber das hat er wohl auch tausend andere Leute gefragt. Sicher ging davon, von dieser Bekanntschaft aus auch ein formaler, denkerischer Einfluß auf mich über, der aber dann mit dem Wandel der Zeiten auch wieder verschwunden ist.
Ammermann-Estermann / Estermann: Sind Sie mit der öffentlichen Reaktion auf Ihr Werk in der Bundesrepublik Deutschland zufrieden, mit dem Publikum, das sicherlich anders ist als in der DDR? Wünschen Sie sich mehr Popularität und öffentlichen Einfluß?
Kunert: Was ist eine öffentliche Reaktion? Eine Reaktion durch die Rezensenten, durch die Presse oder durch das Publikum? Das müßte man differenzieren. Zur Reaktion durch die Kritik kann ich ziemlich schwer etwas sagen. Zur Reaktion des Publikums weitaus mehr. Es ist nämlich merkwürdig: So sehr unterscheidet sich mein Publikum in der Bundesrepublik von dem der DDR eigentlich nicht, es ist ein relativ junges Publikum, was mich immer wieder ‘erstaunt und verblüfft und damit ein Publikum, das in diese Welt gelangt ist, in eine fertige und schon wieder verschwindende, die diesem jungen Publikum, dem jungen Leser eigentlich sehr wenig zu bieten hat, an Sinn für seine Existenz schon gar nichts und der hier wie da mich oder meine Gedichte eben nach einem möglichen Sinn für sich, für seine Existenz befragt. Ehrgeiz, öffentlichen Einfluß zu haben, habe ich weiß Gott nicht. Das ist etwas, was ich mir sicher nicht wünsche. Und außerdem, was ist öffentlicher Einfluß, was kann man schon beeinflussen, ich glaube ohnehin, nichts.
Ammermann-Estermann / Estermann: Sie arbeiten in verschiedenen Medien, der Schriftstellerei, dem Film, der bildenden Kunst. Welches ist Ihr bevorzugtes Medium, worin können Sie sich am besten ausdrücken?
Kunert: Im Zentrum dessen, was ich tue, steht das Gedicht, weil es mir die direkteste Transformation dessen, was mich bewegt und was ich bin, bietet; und Prosa oder auch Dialogisches, andere Schreibweisen haben in einem weitaus stärkeren Maße immer etwas Mittelbareres als die Lyrik, die immer das direkteste ist, auch, wenn sie so scheinbar indirekt spricht.
Ammermann-Estermann / Estermann: Welches halten Sie für Ihr bestes Buch?
Kunert: Das beste Buch ist natürlich immer das letzte, als Lyrikband Abtötungsverfahren, als Prosabuch die Verspäteten Monologe.
Ammermann-Estermann / Estermann: Ihre Gedichte sind oft in der Nähe zum Aphorismus. Bevorzugen Sie die sogenannten „einfachen Formen“ oder würden Sie lieber kompliziert gebaute Romane schreiben?
Kunert: Die Gedichte waren in der Nähe zum Aphorismus, denn in den letzten Jahren sind die Gedichte von dieser etwas pointierenden Form weggegangen und haben sich verändert. Ob ich lieber kompliziert gebaute Romane schreiben würde – ich weiß das gar nicht, dazu kann ich eigentlich nichts sagen.
Ammermann-Estermann / Estermann: In Ihren Gedichten verwenden Sie in der letzten Zeit häufiger den Reim. Werden Sie das auch weiterhin tun oder war das nur zu einer bestimmten Zeit?
Kunert: Ich habe selber mit Rührung und Verblüffung bemerkt, daß der Reim zurückkehrt. In einem doch relativ großen Teil neuer, auch unveröffentlichter Gedichte ist der Reim wieder da, eine stärkere Metrik, ein festerer Rhythmus. Ich kann aber gar nicht erklären, warum es so ist. Vielleicht liegt es daran, daß ich durch die festeren Formen selber eine größere Sicherheit gegenüber noch nicht so exakt greifbaren Entwicklungen gewinne. Ich weiß es nicht genau.
Ammermann-Estermann / Estermann: In Ihrem Essay „Warum Schreiben?“ haben Sie den Gedanken angesprochen, daß Sie durch Schreiben etwas bewahren, retten, sozusagen in Bernstein einschließen möchten. „Das Gedicht als Arche Noah“, vor der großen Flut – wie kommen Sie zu dieser pessimistischen Einstellung zur Literatur?
Kunert: Das ist keine originäre Vorstellung, daß jemand durch Schreiben etwas bewahren, retten und aufheben möchte, vor dem „Zahn der Zeit“ schützen will, das ist, glaube ich, sogar bei vielen, auch früheren Autoren ein Schreibmotiv, auch Schreibanlaß. Nur hat sich für jemanden, der jetzt schreibt, diese Situation natürlich verschärft, weil die Gefährdung in unserer Zeit zugenommen hat. Nicht nur, daß alles in eine größere Unsicherheit gerückt ist, sogar schon selbst als Gegenstand ist die Literatur nicht nur durch Moden und durch Ökonomismus und Konsumismus, durch dieses schnelle Umschlagen und durch ein Verbrauchsdenken gefährdet, sondern sogar dadurch, daß wir wissen, daß das Papier der Bücher bestenfalls dreißig bis vierzig Jahre Bestand hat. Wie man nun unter diesen Umständen überhaupt noch etwas festhalten soll, weiß ich auch nicht, aber ich sehe darin eigentlich keine pessimistische Einstellung, sondern eher eine fragende, eine nüchterne, vielleicht eine skeptische.
Ammermann-Estermann / Estermann: Aus vielen Ihrer Gedichte und anderen Veröffentlichungen (zum Beispiel kürzlich die Rezension zu Janina David in der FAZ) läßt sich Kulturpessimismus erkennen. Ist es richtig, daß er mehr Entwicklung als Grundlage und Voraussetzung Ihrer Arbeit zu sein scheint?
Kunert: Ich versuche immer, diesen Begriff des Pessimismus, der völlig nichtssagend ist und auch immer nur das Ergebnis bestimmter Denkweisen ist, für mich abzulehnen und zurückzuweisen. Das, was man heute als Pessimismus sieht, und gestern als Pessimismus gesehen hat, kann ja im nachhinein rehabilitiert werden als eine Hellsichtigkeit oder als ein Klarblick. Wenn wir uns vorstellen, wie Leute vor 1933 oder vor dem Zweiten Weltkrieg, die alles kommen sahen, damals als Pessimisten bezeichnet worden sind, so müssen wir sagen, daß jene anderen, die sie als Pessimisten bezeichnet haben, totale Idioten gewesen sein müssen. Dies zum Begriff des Pessimismus. Daß ich aber, was die allgemeine, durch nichts begründete Hoffnung betrifft, ein bißchen skeptisch bin, dafür sprechen eigentlich sehr viele Tatsachen, die man, wenn man will, jeden Tag in der Zeitung lesen kann: Entwicklung oder Grundlage meiner Arbeit, ja und nein, oder weder-noch, sondern eher beides in einer dialektischen Verschränkung.
Ammermann-Estermann / Estermann: Woran schreiben Sie zur Zeit, planen Sie ein neues Theaterstück?
Kunert: Ein Theaterstück plane ich überhaupt nicht. Natürlich schreibe ich Gedichte; Gedichte entstehen eigentlich immer, und es gibt auch Mappen, in denen man Texte sammelt. Auf der einen steht „Geschichten“ und auf der anderen steht „Aufsätze“. Zu befürchten ist, daß das natürlich eines Tages Bücher werden, wie alles zum Buch wird.
Ammermann-Estermann / Estermann: Sie stammen aus Berlin – haben Sie heute noch Beziehungen zu dieser Stadt? Fühlen Sie sich noch emotional an die ehemalige Weltstadt gebunden, besonders von Ihrem jetzigen, etwas einsamen Wohnsitz aus?
Kunert: Berlin ist etwas, was eigentlich für mich absolut inexistent geworden ist, es ist ganz weggerückt, fast ganz und gar verschwunden. Einerseits weil dem Berlin, wie ich es gekannt habe und wie ich es mir auch eingebildet habe – denn es war auch eine Fiktion – diesem Berlin ist die Grundlage entzogen worden durch die Realität. Das ist das eine. Das andere ist, daß ich doch ziemlich viele Texte über Berlin geschrieben habe und damit habe ich auf psychotherapeutische Weise mich dieses Berlins entledigt, es ist eigentlich etwas, woran ich nie denke und was es für mich gar nicht mehr gibt. Es besitzt nur noch historisch-archäologischen Wert.
Ammermann-Estermann / Estermann: Sie hatten eine Gastprofessur in den USA. Welches waren Ihre wichtigsten Eindrücke dort, würden Sie noch einmal in die Vereinigten Staaten fahren?
Kunert: Meine Eindrücke waren ambivalent: einerseits war, was aber verständlich ist, die Kenntnis von der Lyrik, die in der DDR gemacht wurde, nicht sehr groß, das konnte man auch nicht voraussetzen, und andererseits, was angenehm berührte, war das Interesse dafür: Ein Interesse, das völlig ohne jede Voreingenommenheit war. Interessant für mich, und was man mit einem ganz altfränkischen Begriff „völkerpsychologisch“ bezeichnen könnte, war, daß die Studenten, die ich in diesem Seminar um eigene Gedichte bat, ihrer Herkunft entsprechend unterschiedlich schrieben. Ein Teil der Studenten war deutschstämmig, lebte also 10, 15 Jahre oder seit ihrer Jugend in den Vereinigten Staaten, das andere waren gebürtige Amerikaner. Die Gedichte der gebürtigen Amerikaner erwiesen sich als weitaus konkreter, sinnlicher, bildhafter und nicht „von des Gedanken Blässe“ angekränkelt, wie es immer so schön heißt, also nicht so deutsch eigentlich. Selbstverständlich würde ich noch einmal in die Vereinigten Staaten fahren, es ist ja doch eine Welt für sich, die man nie erschöpfend kennen lernen kann, man entdeckt immer etwas Neues.
Ammermann-Estermann / Estermann: Sie sind aus der DDR in die Bundesrepublik umgezogen. Kann man Ihre politische Einstellung an Gedichten erkennen, etwa an „Wie ich ein Fisch wurde“?
Kunert: Wenn man eine politische Einstellung aus einem Gedicht herausliest, frage ich mich immer: Und wo ist das Gedicht? Gedichte als politische Konfessionen zu lesen, täte sowohl dem Gedicht wie dem Denken des Gedichtschreibers unrecht. Ich bin übrigens ganz sicher, daß sogar hochpolitische Gedichte, vorausgesetzt, daß sie ihre Bezeichnung zu recht tragen, nicht aus politischen Motiven heraus geschrieben. sind, sondern aus der psychischen Befindlichkeit ihres Autors – eine Befindlichkeit, die sich in seinem Falle eben politisch artikuliert. Damit will ich Lyrik nicht psycho-analytisch erklären, sondern nur sagen: Die Initialzündung eines Gedichtes liegt latent in der Biographie des Autors.
Ammermann-Estermann / Estermann: Würden Sie unter bestimmten Bedingungen in die DDR zurückkehren?
Kunert: Sicher. Aber diese Bedingungen werden, wie ich fürchte, in absehbarer Zeit dort nicht Realität werden; Bedingungen, die für mich ganz einfach zu benennen sind: nämlich die Möglichkeiten zu schreiben und zu veröffentlichen.
Aus: Günter Kunert. Begleitheft zur Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main vom 28.4.-30.5.1981, herausgegeben von der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, April 1981
NOTIZEN IN KREIDE
„Seit einer Woche hast du das Buch! Glaubst du, ich brauche es nicht mehr?“
„Ist klar, aber eine Woche ist zu wenig, ich lese manche Gedichte dreimal, viermal. Ob es das noch einmal gibt? Was meinst du?“
„Glaub’ ich nicht, alle guten Dinge sind hier rar und besonders gute Bücher! Geh doch mal in die Stadtbibliothek, da haben sie noch Sachen von dem Kunert.“
„Der ist ja wirklich gut, der Mann!“
„Plätze finden, fröhlich sich zu paaren,
das ist schwer, für solche ohne Raum…“
(Notizen in Kreide, Reclam-Verlag, Leipzig)
„Ich weiß von Hans, daß er schon vier Wochen in der Bücherei auf den Kunert wartet. Viele klauen auch gleich seine Bücher, da kannst du lange warten! Würde ich auch machen, solche Bücher muß man haben.“
Gerald K. Zschorsch
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
DAS&D + Archiv + Internet Archive + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett + IMAGO +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ Sinn und Form ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.



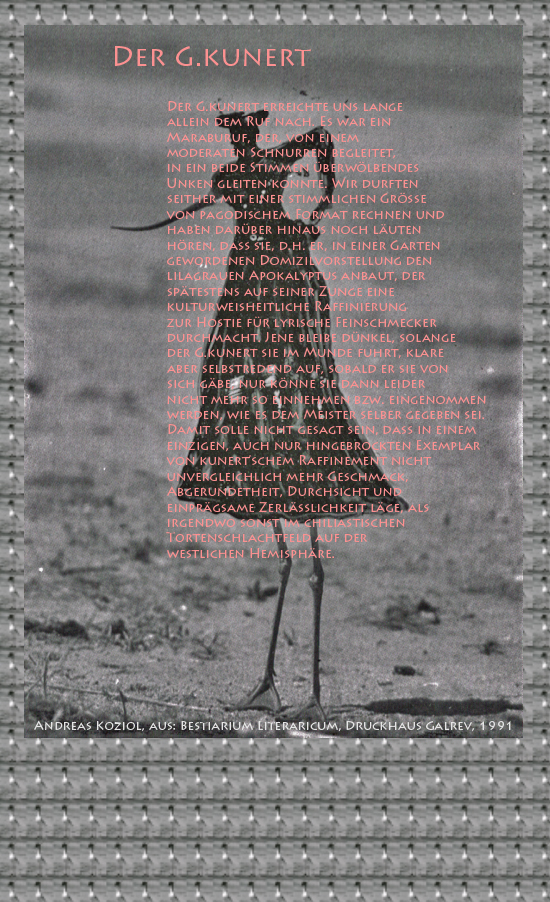
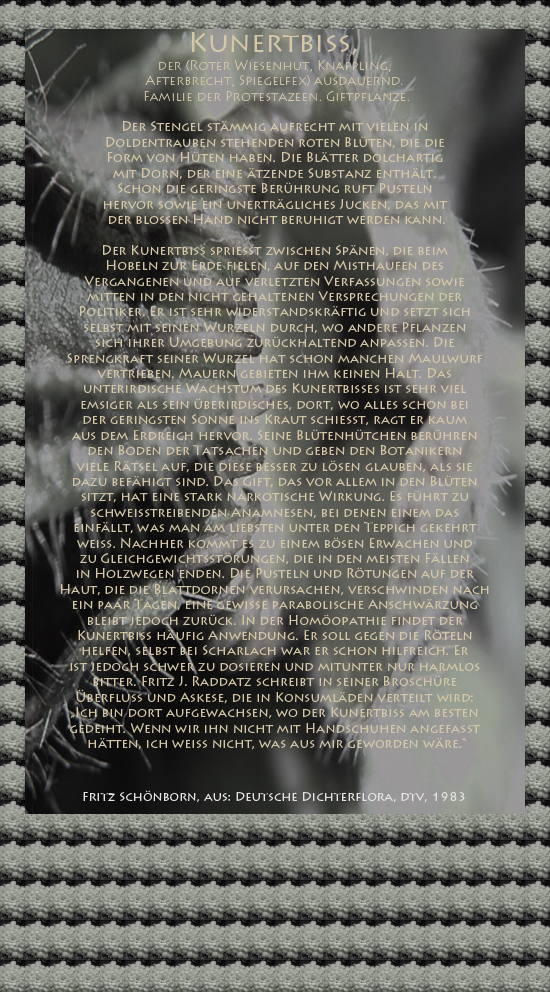
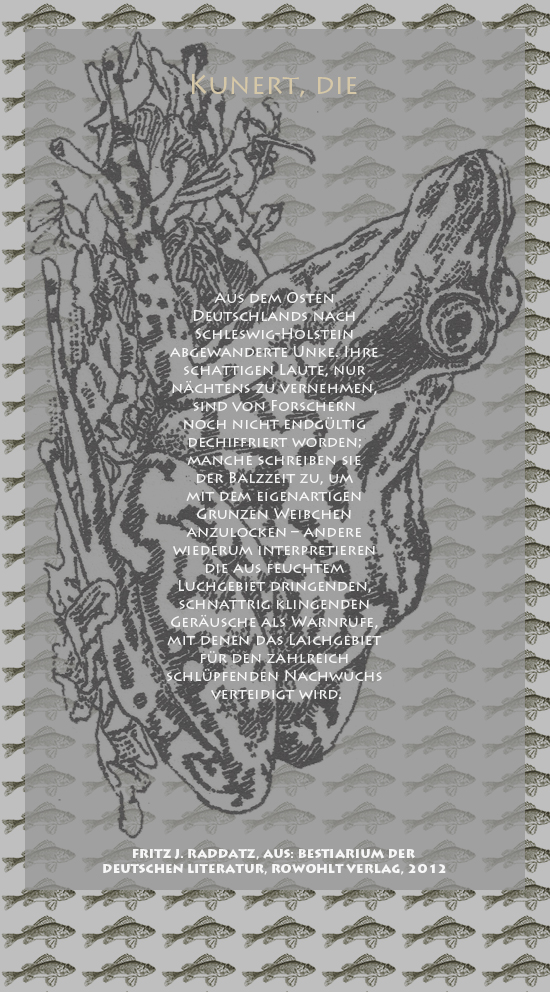
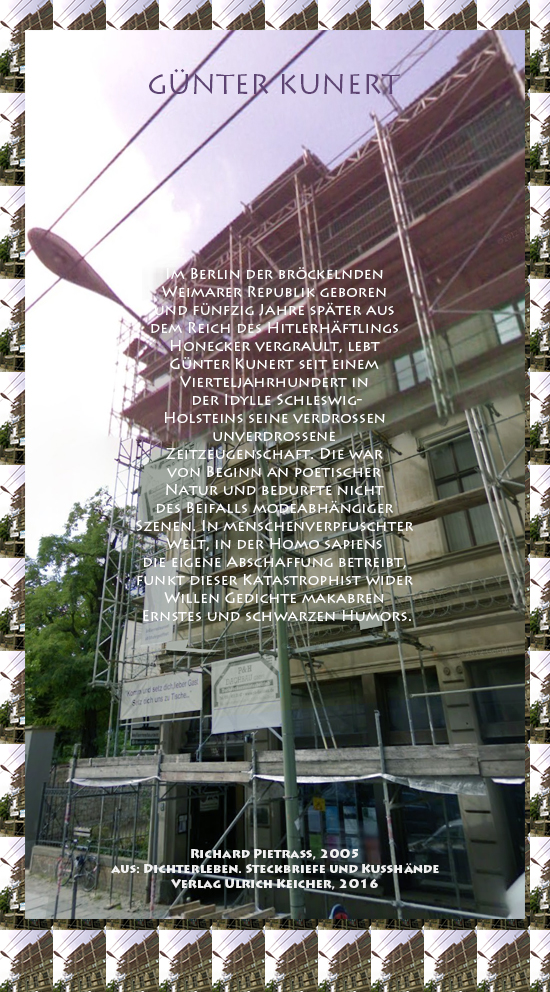












Schreibe einen Kommentar