Günter Kunert: Schatten entziffern
WAHRNEHMUNG
Gleich neben dem Hinterausgang
der Zeit
stapelt sich Gegenwart um Gegenwart:
Unbetretbare Halde
Erschreckender Anblick
Was hinter uns bleibt
ein Friedhof
Herausragende Trümmer und Torsi
Die bleiche Gestalt
Engel der Geschichte
vorlängst abgestürzt
Sein Blut ist schneeweiß
tritt unmerklich aus
verheerend wie Abwasser
wirksam wie Lethe
durchtränkt den Boden
unter deinen Füßen:
Vergiß dich besser selber
bevor andre es tun
Nachwort
In Günter Kunerts Biographie spiegeln sich die wichtigsten Daten der jüngeren deutschen Vergangenheit. Geboren im Jahre 1929 als Sohn einer jüdischen Mutter, erleidet er sehr unmittelbar die Zeit des Nationalsozialismus. Er ist sechzehn Jahre alt, als seine Geburtsstadt und mit ihr das Dritte Reich unter Trümmern begraben werden. Vier Jahre später wird die DDR gegründet, die er als Fünfzigjähriger desillusioniert verläßt; bei ihrem Zusammenbruch ist er sechzig Jahre alt.
Als Heranwachsender muß er ansehen, wie die Mitglieder der Familie seiner Mutter einer nach dem anderen in den Konzentrationslagern des Deutschen Reiches verschwinden. Dieses Grunderlebnis taucht in seinem Werk immer wieder auf, etwa in der Beschreibung des Konzentrationslagers Dachau unter dem Titel „Schöne Gegend mit Vätern“, oder in Essays, die an die „Ungemeinsame Geschichte“ zwischen Deutschen und Juden erinnern. „Erschreckenswürdige“ Prosatexte, unter denen die meisterhafte satirische Erzählung „Zentralbahnhof“ Kunerts internationalen Ruf begründete, oder die in der Lyrik heraufbeschworenen Metaphern von Rauch und Asche halten uns „Diesseits des Erinnerns“, wenden sich gegen unsere Vergeßlichkeit, unser Vergessen-Wollen.
Erinnern und Erinnerung sind zentrale Begriffe in Kunerts Werk, zu denen er häufig zurückkehrt. Sie beziehen sich einerseits auf bestimmte historische Ereignisse, bezeichnen aber gleichzeitig auch den Versuch, den eigenen Standpunkt im Ablauf der reißenden Zeit zu erkunden und damit auch den Spuren der geschichtlichen Entwicklung des Menschen nachzugehen. „Doch kein Erinnern stirbt ganz aus“, heißt es. Diese Art des Erinnerns geschieht nicht in den gängigen Geschichtsbüchern, die Kunert in ihrem Bemühen um wissenschaftliche Distanz von den vergangenen Ereignissen mit Herbarien gleichsetzt, „voller vertrockneter, gepreßter, entfärbter und klassifizierter Gegenstände“, sondern vollzieht sich in den Gedichten, Geschichten und Darstellungen der Künstler.
Schon Kunerts frühe Werke zeugen von seiner äußerst skeptischen Haltung in bezug auf die Erziehbarkeit des Menschengeschlechts; neben dem Traum von der Erneuerung findet man schon in seinem ersten Gedichtband Wegschilder und Mauerinschriften (1950) auch das epigrammatische Gedicht „Über einige Davongekommene“. Da schwört einer nach der sinnlosen Zerstörung, die auch ihn betroffen hat, dem Krieg ab mit einem „Nie wieder“; doch folgt nach einer deutlichen Pause die Einschränkung „Jedenfalls nicht gleich“. Auch die negativen Seiten der Entwicklung von Naturwissenschaften und Technik geraten schon früh ins Blickfeld des Schriftstellers. Im „Lied von einer kleinen Stadt“ beschreibt Kunert die tödlichen Auswirkungen von Zinkdampf auf eine kleine Stadt in Amerika. Was hier noch verhältnismäßig begrenzt und zahm „nur“ den Tod von neunzehn Pennsylvaniern verursacht, wächst sich in späteren Gedichten und Berichten Kunerts zur „Gewißheit“ vom bevorstehenden Untergang der Menschheit aus. „Galileis Enkel“ kehren bestenfalls „zurück in die Steinzeit“.
Während Kunert für die tragische Grunderfahrung des Menschen, der nicht aus seinen Fehlern lernen kann und will, häufig den Mythos des Sisyphus zitiert und abwandelt, wird Prometheus für ihn zur Personifikation für Fehlentwicklungen des technischen Fortschritts. Zwar brachte Prometheus den Menschen das Feuer und leitete damit den Beginn der industriellen Zivilisation ein, aber er nahm den Menschen als Gegenleistung die Gabe des Vorauswissens und damit die Fähigkeit, den einmal begonnenen Weg als Irrweg zu erkennen.
Es ist klar, daß ein Konflikt zwischen Staat und Dichter unvermeidbar war. Während man sich in der DDR, wenigstens anfänglich, ernsthaft auf dem Wege nach Utopia glaubte, sah und beschrieb Kunert den Weg nach jedem Utopia als leidvolle Fiktion („Unterwegs nach Utopia I“), als Flucht in eine eingebildete, unfruchtbare Idylle (II) oder als ewige Kreisbewegung (IV). Damit verdiente sich der Autor schon frühzeitig den Ruf eines Pessimisten.
Dieses Etikett taucht in Verbindung mit Kunerts Werk immer wieder auf, ohne es jedoch im Kern zu treffen. Zugegeben, der Autor mißtraut nach einer anfänglichen Phase „im eisigen Wind der Ideale“ dem Prinzip Hoffnung. Jedoch entstammt Kunerts Haltung nicht einem Flirten mit dem Untergang oder gar einer apokalyptischen Vision der Welt, sondern vielmehr der „Tugend des Zweifelns“, wie er sie bei Michel de Montaigne im Philosophischen und bei Heinrich Heine im Literarischen findet.
Der Skeptiker Kunert bedient sich eher gebrochener Ausdrucksformen wie Ironie, Montage, Zitat, Verfremdung und Paradoxon. Er spielt mit den Formen und versucht, sie aufzulösen. Er bietet keine geschlossenen Systeme, sondern stellt in Frage und relativiert.
Da erzählt zum Beispiel in „Die Beerdigung findet in aller Stille statt“ ein Erzähler seine Geschichte, die ein Leben kostet, mit soviel augenzwinkerndem Verständnis für seinen Protagonisten und ohne jegliche moralische Entrüstung, daß man fast an ein Happy-End glaubt und sich an ironisch-humorvolle Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert erinnert – trotz der Leiche. Manchen Gedichten eignet auch ganz unvermutet ein vertrackter, an Ringelnatz erinnernder Humor:
ÜBERRASCHUNG
In einem Walde bei Hamburg
ertappte ich
die Ewigkeit in Form
einer eiligen lautlosen Viertelstunde:
Eh ich sie begriff
sprang sie davon
durch das Unterholz.
Nun bin ich aufs Neue
ganz sterblich.
Es wäre wahrscheinlich ein ertragreiches Unternehmen, wenn man den zahlreichen Studien über Pessimismus, tragisches Lebensgefühl, Skepsis und Nihilismus bei Kunert eine Untersuchung über die komischen Elemente in seinem Werk hinzufügte.
Schließlich sollte man auch den moralischen Impetus in den Texten Kunerts nicht übersehen.
Wenn ich mich doch nur taub und blind machen könnte gegen die Welt, fühllos zudem, wieviel leichter schriebe es sich, von keiner Verzweiflung behindert, besser sogar und unabgelenkt,
heißt es in den „Verspäteten Monologen“. Allerdings steht der Text nicht nur im Konjunktiv Irrealis, der bereits anzeigt, daß dem Autor eine solche Haltung nicht möglich ist, sondern er endet auch mit einer Antwort in rhetorischer Frageform: „Die Frage bliebe bloß: Worüber?“
Ob es um sein Schreiben gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen, um den katastrophalen ökologischen Zustand der Welt oder ob es um politische Tagesfragen wie Ausländerfeindlichkeit geht – Kunert bezieht eindeutig und ohne Rücksicht auf ein eventuelles Image Stellung. Und daß er im wahren Sinne des Wortes zu seinem Wort steht, hat nicht nur sein konsequentes Verhalten bei der Ausbürgerung von Wolf Biermann gezeigt, das 1979 zu seiner Übersiedelung in die Bundesrepublik führte.
Worte, Sprache, Dichtung sind für Kunert untrennbar mit seinem Leben verknüpft. Schreiben bedeutet für ihn Leben.
Schreiben ist Rettung vorm Tode, solange es anhält. Das ist der Augenblick der Wahrheit, da sich das Individuum seiner Individualität begibt und sich aufs innigste mit dem unsterblichen Ich menschlicher Allgemeinheit verquickt,
heißt es im „Selbstporträt im Gegenlicht“. Kunert braucht die Sprache, braucht das Schreiben zur Selbstvergewisserung und Selbstbestimmung, aber indem er den Schreibakt vollzieht, indem er „in aller Wortwörtlichkeit, der formulierten wie der gelebten“, nur er selber ist, drückt er zugleich auch Allgemeineres aus. Günter Kunert wird im Schreiben zu „Günter Jedermann“. Dieser Glaube legitimiert den Vorgang des Schreibens und drückt zugleich ein unbegrenztes Vertrauen in die Sprache aus. Selbst wenn der Dichter im „Gedicht“ klagt:
Immer verweigert sich
das erste Wort und sträubt sich
Immer ist es das zweite
das sich hervortut: das schwächere.
Es hat einen Sprung
das hört man am Klang
kann von einer Sprachkrise, von einem Zweifel an der Möglichkeit, vermittels der Sprache zu den Dingen selbst vorzudringen, bei Kunert keine Rede sein. Er mag Zweifel in bezug auf die Zukunft der Menschheit haben, dem Fortschritt, den Utopien, den Naturwissenschaftlern und dem Wetter mißtrauen – unerschütterlich aber bleibt sein Vertrauen auf die Aussagekraft des Wortes und sein Glaube an die Tauglichkeit der dichterischen Sprache.
Die Sprache schafft sich selber ihren Sinn und hat die Fähigkeit, durch das Individuelle zum Allgemeinen, Archetypischen vorzustoßen und es auszudrücken.
Das Nachdenken über das Schreiben, die Bedeutung der Sprache und die Rolle des Autors nehmen einen zentralen Platz in Kunerts Werk ein. Immer wieder umkreisen die Texte poetologische Themen, lauern dem Gedicht auf, versuchen die eigene Prosa zu beschreiben oder den Essay als Gattung zu definieren.
Kunerts eigentliche Liebe gehört zweifelsohne dem Gedicht. Ihm eignet nach Auffassung des Dichters die Fähigkeit eines archaischen Bewußtseins, das sich dem utilitaristischen, rationalen Denken nicht ergibt. In seinem Essay „Die letzten Indianer Europas“ vergleicht Kunert die Sprech- und Denkweisen der Indianer mit denen der Lyriker. Während unser alltägliches Denken und Sprechen alles wörtlich nimmt, versteht es die lyrische Bilder- und Metaphernsprache, unbekannte, ursprüngliche Zusammenhänge aufzuzeigen, die uns in unserem heutigen Zweckdenken verlorengegangen sind. Das Gedicht, das auf Ganzheit angelegt ist, vermittelt eine Welt- und Selbsterkenntnis, die notwendigerweise mit den modernen, spezialisierten, abstrakten Konzepten vom Ich, seiner Welt und seiner Sprache kollidieren. Das Gedicht „Winterabendausblick“ kann als Beispiel dienen, um das Kunertsche Konzept vom Archaischen zu verdeutlichen:
Himmel: Abschiedsträchtig
Schneefladen Windeinfälle
Im Geäst Scherenschnitte von Krähen:
Das Wirkliche als Bild
mit dem unhaltbaren Versprechen
von Bedeutsamkeit:
Wie alle Bilder.
Eine Winterlandschaft am Abend wird entworfen. Man sieht den grauen, leeren Himmel, aus dem schwere Schneefladen fallen; man spürt die Kälte des Windes. Die grauschwarzen Krähen auf den kahlen Baumästen heben sich scherenschnittartig vom leeren Himmel ab. Die Worte „Abschiedsträchtig“ und „Ausblick“ laden dieser Landschaft eine Bedeutung auf, die sich auf uns bezieht; sie erinnern uns an Abschied, Tod, Vergehen. Obwohl der verkürzte, verdichtete, spröde Ton der ersten Zeilen sehr modern klingt, handelt es sich im Grunde um ein traditionelles „mementomori“-Gedicht: Archaisches Bewußtsein wird angesprochen; wir werden an die Vergänglichkeit der Natur und damit auch an unsere Vergänglichkeit erinnert. Doch bleibt das Gedicht nicht bei dieser Beschwörung stehen, sondern nimmt sie im zweiten Teil gleichsam wieder zurück, denn das heraufbeschworene lyrische Bild ist ein „unhaltbares Versprechen von Bedeutsamkeit“. Unser archaisches Bewußtsein kollidiert mit dem Wissen, daß das Gedicht eben kein Bild ist, sondern Sprache. Auf diese Weise erhält das Gedicht – wie häufig bei Kunert – einen Stachel. Es liest sich wie eine „Verlustanzeige“, die uns eine andere Wirklichkeit ahnen läßt, zugleich aber von der Unmöglichkeit spricht, in diese Wirklichkeit zu gelangen.
Doch müssen solche Erklärungsversuche, die Lyrik in Prosa übersetzen wollen, immer am Kern des Gedichtes vorbeigehen, „denn die Wahrheit des Gedichts ist einzig und allein die Wahrheit des Gedichts“. Übersetzungen, Interpretationen, Erklärungen zerstören die aufs Ontologische angelegte Aussage und Wirkung des Gedichtes. Lyrik ist eine „gänzlich unbeschreibliche Angelegenheit, denn sobald die Beschreibung ihr nahetritt, verfliegt ihre archaische Kraft,… ihre fragwürdige Abgründigkeit.“
Der „Winterabendausblick“ zeigt Kunerts Tendenz zum Epigramm, zum gedrängten, auf wenige Worte verknappten Erkenntnisblitz, der das Resultat eines intensiven Denkvorganges darstellt. Auf einem ähnlichen Prinzip und Prozeß beruhen auch viele Kurzprosatexte, Mini-Essays und verkürzte Erzählungen. Der Übergang vom Epigramm zum Prosatext, der sprachlich einen Gedanken, eine Idee bis in die letzte Konsequenz hinein ausleuchtet, ergibt sich auf natürliche Weise. Auch in den Prosatexten gibt es häufig noch eine rhythmische Sprache und eine Konzentration auf die Schlußpointe hin. Einfälle werden auf eine vertrackt präzise, hartnäckige Weise so dargestellt, daß man sich der Entwicklung der Erzählung oder des Denkvorganges kaum entziehen kann. Der Satzbau erinnert an Kleist, bei dem die Sprache die Gedanken formt, ertastet und vorwärtstreibt – auf eine komplizierte, verschränkende und verzögernde Weise. Dabei geht es nicht mehr so sehr um ganzheitliche Bilder wie in der Lyrik, sondern um Ausschnitte und Bruchstücke der Wirklichkeit, die die Sprache durchsichtig und erkennbar macht.
Es sind scheinbar episodische Darstellungen, die aber umfassendere Themen einkreisen und von verschiedenen Seiten beleuchten. Im Zentrum steht der verletzliche, mißhandelte Mensch, der zu sich selbst kommen möchte in einer Gegenwart, die durch die Vergangenheit verdunkelt ist und deren Zukunft kaum Anlaß zur Hoffnung bietet. Dabei läßt sich für das Gesamtwerk eine deutliche Entwicklung feststellen. Ideologie und Utopie treten immer mehr in den Hintergrund. Wie Kunert selber schreibt, hat er zunächst die Rolle des Predigers, Agitators, Moralisten, Satirikers und Zeitkritikers gespielt, bis er merkte, daß die großen Wahrheiten ziemlich beliebig und außerdem stets relativierbar seien.
Bis ich zu meiner eigenen Wahrheit fand, indem ich die Utopien einfach vergaß und mich der Sprache als einzigem Medium der Selbstvergewisserung erinnerte. Bis ich die Fremdbestimmung verlor, ohne jedoch die Selbstbestimmung als totale Autonomie zu verkennen.
Ein häufig und meisterhaft von Kunert gebrauchtes Genre, sich dem Ziel der wortwörtlichen Selbstbestimmung anzunähern, ist der Essay. Wie sein Vorbild, Michael de Montaigne, benutzt Kunert den Essay zum Dialog mit sich selbst und der Welt „in einem nahezu unbegrenzten intellektuellen Freiraum, der nichts von dem, was ihn [den Essayisten] beschäftigt, ausschließt“. Der Essay dient ihm als Vehikel, seine Gedanken unbeschädigt von wissenschaftlichem Denken in kreativer Spontaneität und unmittelbar subjektiv auszudrücken. Einerseits erlaubt ihm dieses „nachdenkliche Tasten auf dem Rücken der Dinge“ die Freuden des Schreibens, die für ihn lebensnotwendig sind, und andererseits dient es ihm als Mittel zur Selbsteinsicht.
Selbsteinsicht findet Kunert auch in seinen zahlreichen Reiseberichten, die eines der wichtigsten Themen in seinem Schaffen aufnehmen und variieren: Die Spannung zwischen Fremde und Heimat. Es ist nicht verwunderlich, daß Berlin in Kunerts Werk zu einer schillernden, vieldeutigen Zentralchiffre geworden ist und eine ähnlich konstituierende Bedeutung für ihn besitzt wie etwa Danzig für Günter Grass. Berlin, das ist Heimat – aber eigenartigerweise nur das Berlin der zwanziger Jahre, das Kunert selber nie erlebt hat; Berlin, das ist eine unbewohnbare Stein- und Betonwüste, ein Zeichen für Hoffnung, eine Chiffre für den Untergang, für die verlorene Zeit, für die deutsche Geschichte und schließlich auch ein Symbol für die eigene Biographie, für das eigene Ich:
Das letzte Gedicht über Berlin
wär auch das Ende vom Lied:
ein immer unvollendeter Vers,
weil ihn keiner mehr sieht.
Parallel zu diesem Umkreisen des Themas Berlin in Gedichten, Erzählungen und Essays gibt es den Topos des Reisens. Einerseits fangen die Reisegedichte, -berichte und -skizzen die Atmosphäre, die Stimmung der besuchten Orte, den spiritus loci ein; auf der anderen Seite zeigen sie aber auch das Wirken der Zeit, die fortgeschrittene Zerstörung, den Verfall. Zwar leben der Reiz des Reisens, die Freude am Erfahren und Entdecken in den Texten Kunerts und verleihen ihnen manchmal sogar ein Gefühl der Schwerelosigkeit; dennoch steht hinter allem Reisen die Gewißheit: „Wo wir auch anlangen / liegt das Ziel / schon hinter uns“. Ob Pompeji oder Bomarzo, Prag oder Budapest, ob England oder Amerika beschrieben wird, ob es sich um den Mont Ventoux oder die Lüneburger Heide handelt, letzten Endes ist alles Reisen nichts mehr als Flucht, und wir enden immer wieder in einer Welt, für die Kunert die Chiffre „Beton“ wählt:
UNTERWEGS NACH UTOPIA II
Auf der Flucht
vor dem Beton
geht es zu
wie im Märchen: Wo du
auch ankommst
er erwartet dich
grau und gründlich
Seit Kunert sich entschloß, Berlin zu verlassen und dorthin zu ziehen „wo das Gespräch über Bäume / kein Schweigen mehr bindet / dorthin wo keiner einem / die Sprache verschlägt“, beschäftigen sich seine Texte ausführlich mit der neuen, der fremden Heimat Schleswig-Holstein. Das Arkadien im Norden wird in Gedichten evoziert und in Essays beschrieben und analysiert. Obgleich der Ton, vor allem der Gedichte, lyrischer, schwermütiger und vielleicht auch versöhnlicher wird, handelt es sich doch um ein Arkadien, in dem der Herbst angebrochen ist. Auch hier scheint die braune Vergangenheit durch, und die Mülldeponie liegt gleich nebenan. Es ist eine fremde Heimat. Aber gibt es denn überhaupt noch eine heimatliche, eine anheimelnde Heimat?
In seinem Essay „Heimat als Biotop“ zeigt Kunert, wie die Industriezivilisation den Bereich, den wir gewohnt sind, als Heimat zu bezeichnen, immer stärker einengt und zerstört. Als möglichen Ersatz für diesen Schwund an lebenswichtiger, raumgebundener Heimat schlägt er vor, daß wir den Begriff der geistigen Heimat ernsthaft prüfen sollten. In dieser geistigen Heimat ist Kunert auf zweifache Weise zu Hause: Einmal als Schreibender, der im Akt des Schreibens zu sich selbst findet und zugleich seine Verbindung mit der Umwelt herstellt; zum anderen als der Verfasser eines Werkes, das man getrost zu den wichtigsten in der deutschen Nachkriegsliteratur zählen kann.
Jochen Richter, Nachwort
„Im Schatten der Wörter“
Dieser Band hält Rückschau und ist doch ganz gegenwärtig. Günter Kunert schreibt seit fast einem halben Jahrhundert. Grund genug, endlich einmal das zu tun, was der Erzähler und Lyriker, der polemische Essayist und Reisebuchautor seit langem betreibt: Schatten entziffern. Das ist der Titel eines Gedichts von 1970, das prophetisch anhebt:
Wer zu lesen verstünde
die Buchstaben die keine sind:
bemooster Ziegel vom Dach
brandiges Holz noch vom Krieg
Blöcke geborstnen Betons…
Und es endet mit der Einsicht, der Hoffnung wohl nur, daß „alle Wahrheiten“ zwischen schrundigen Häuserzeilen stünden, wo gelebt worden ist. Doch alles ist anders, weit schwieriger. Im Prosatext „Ich – Berlin“ von 1994 erinnert Kunert an alte Eindrücke im Berlin seiner Kindheit und Jugend. Seltsame, traumwandlerische Gänge durch die zerstörte Stadt:
Dieses merkwürdige Oszillieren zwischen kaum selber noch erlebter oder nur vermittelter Vergangenheit und einer Gegenwart, die zum Steinbruch abgesunken war, hat meine Gedanken bewegt und noch mehr meine Psyche.
Damals und heute: Immer gerät Kunert an „gewisse Überbleibsel“: Inschriften, Steine, alte Frauen oder ein Stück „Unterwelt“, Reste von Straßenbahnschienen, Bilderrätsel im Beton. Er sieht das alles mit dem Blick eines Wanderers, süchtig nach Hieroglyphen, die zu ihm sprechen oder Auskünfte verweigern. Berlin ist ihm als Stadt seiner Erlebnisse nahezu verschwunden:
durchsetzt mit haltlosen Plätzen – eine Großsiedelei, eine Freude, die man nicht kennt; die einem nichts mehr zu sagen hat, und vor der man selbst sprachlos steht, ehe man sich abwendet, um zu erstarren.
Seine Arbeit hat er gelegentlich als „abstruse Tätigkeit“ bezeichnet. Ironisch und ernst, denn: „Ich konnte nichts anderes, und… ich wollte auch gar nichts anderes können.“ So spielt er gern Rollen, ist „Gesandter der Zukunft“ und weiß dennoch vom Ende der Aufklärung zu berichten. Dem Schreibzwang ausgeliefert, unternimmt er immer wieder Anläufe, „die nichts bedeuten als den Versuch / etwas von mir sichtbar zu machen…“ Einmal ist sein Selbstporträt der „melancholischen Physiognomie eines Seehundes“ nahe, dann wieder lobt er den Regen und die Wolken oder fühlt sich gestärkt, wenn „vor der Tür Chamisso stünde / oder sein Schatten oder ich / sein Schatten bin oder auch Chamisso selber…“
War der „Sucher“ Kunert in den sechziger und siebziger Jahren noch der „Vergiftung durch Werte“ und der „Angst vor der Angst“ auf der Spur, so ist der Ton neuerer und neuester Texte merklich sanfter, mitunter fast schon stimmlos. Im Gedicht „Gegenüber der Deponie“ (1990) fragt er: „Warum gebe ich die Welt verloren?“ Als Antwort die Einsicht in die Vergeblichkeit der Bücherwelt:
Weil in keinem geschrieben steht
was geschehen wird
was immer geschah
in vergangener Zukunft
von Wort zu Wort
zu Wortlosigkeit.
Warum Günter Kunert dennoch nicht vom Schreiben lassen kann, ein Großkritiker hat ihn längst „Vielschreiber“ genannt, verrät schon der kleine Text „Eins plus eins gleich eins“ von 1972. Er ist seiner Frau gewidmet und steht nicht zufällig am Anfang dieses Bandes. Er teilt mit, warum eher mehr geschrieben als geschwiegen wird. Wer Kunerts Bücher, eine stattliche Reihe, kennt, weiß: Sie alle werden mit einer anmutig-blumigen Widmung für Frau Marianne eröffnet. Fast göttlich steht sie seiner Poesie zur Seite, und er lobt hoch: „Sie ist mit einem Wort, bis zu dem zu gelangen ich so viele gleichwertige brauchte: das Elementare.“
Hoch im Norden „Bei Itzehoe“ sind ihm die Elemente allesamt ganz nahe:
Jenseits und nördlich
meines verlassenen Daseins
also liegen tröstliche Flächen
zwischen Meer und Meer
Sumpf und Marsch
Nässe und Nichts.
Dominierten während der Berliner Jahre noch die Stein- und Mauer-Metaphern, so hat der Ortswechsel auch zum Wortwechsel geführt. Im Text „Heimat“ (1986) gesteht er:
Ich gebe zu, viele meiner Texte aus keinem anderen Grund verfertigt zu haben, als für diese kurze Weile des Schreibvorganges andernorts zu sein, abwesend von den äußeren Umständen meiner Existenz.
In neueren Texten taucht mehrfach der Begriff „Heimat“ auf. Der Dichter dürfe nicht vor dem Tore stehen bleiben, sondern „in ganz andere Brunnen hinabsteigen, um Heimat zu entdecken“, empfiehlt Kunert 1991. Denn Heimat sei „ein erweitertes kulturelles Bewußtsein“, und Unterwegssein die adäquate Lebensweise, weil „schreiben nichts Endgültiges konstituiert, sondern nur Impulse gibt“.
Ausdrücklich nimmt Kunert in jüngsten Prosatexten Abschied von ein paar Illusionen. So von der Über- und Selbstüberschätzung der Schriftsteller, vom „vermuteten Bedeutungszuwachs“ durch Literatur und eben pflichtgemäß auch von der Illusion eines demokratischen Sozialismus. Nicht ganz spurlos geht solch Paket des Abschieds am Gedicht vorbei. Im „Bekenntnis“ (1990) klingt es so: „Die Werte / werden zittrig statt trefflich“, und im Gedicht „Urteil“(1994) ganz frostig: „Du redest / von Menschen und sprichst schon / zu einer dir fremden Gattung.“ „Schatten entziffern“ ist ein Handwerk, das aussterben kann. Die Signale sind nicht zu überlesen. Noch erkennt der Leser dieser sachkundig ausgewählten und geschickt komponierten Texte das nuancenreiche Bild und Werk Günter Kunerts. Auch gibt es Überraschungen, Wiederbegegnungen, noch immer ist vieles schön, was einst unter anderer, doppelbödiger Beleuchtung erschien.
Noch findet der Dichter das Wort für diese Zeit:
So bleibt bloß ein kurzes Ausruhen
im Schatten der Wörter
von allem was sie besagen.
Helmut Hirsch, Berliner LeseZeichen, Heft 10+11, 1996
Dagmar Hinze: Der Bruch mit der Utopie. Die Lyrik der 80er und 90er Jahre von Günter Kunert
BEIM ALTEN DICHTER (III)
im arbeitszimmer
statt bücher
blech-
spielzeug im regal
vergraut vom staub
der messingschlüssel
zum aufziehn
der kindheit.
Ingolf Brökel
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
DAS&D + Archiv + Internet Archive + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett + IMAGO +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ Sinn und Form ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


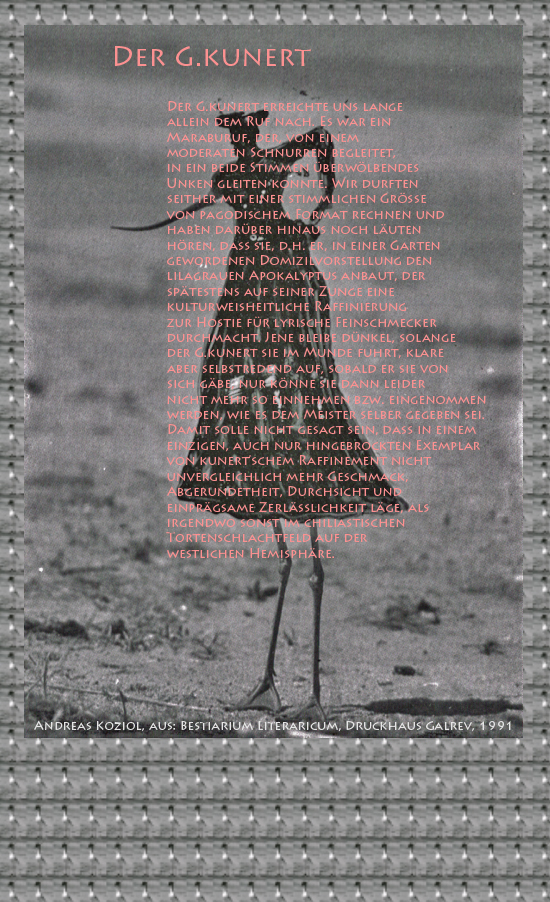
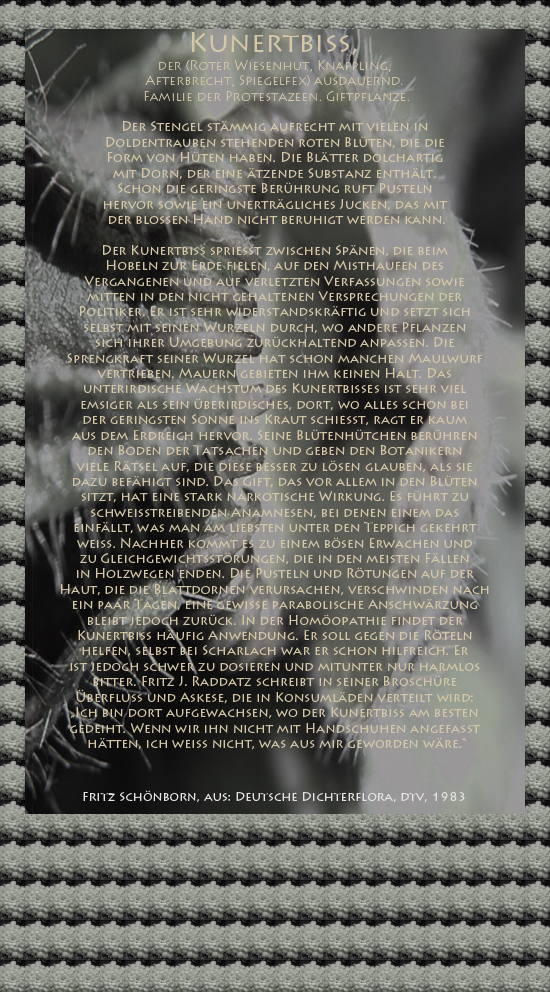
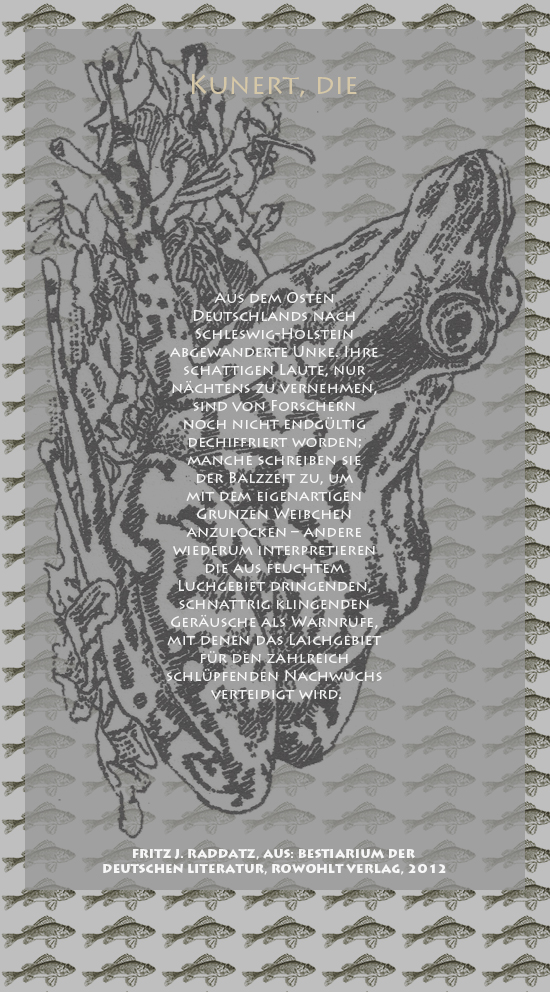
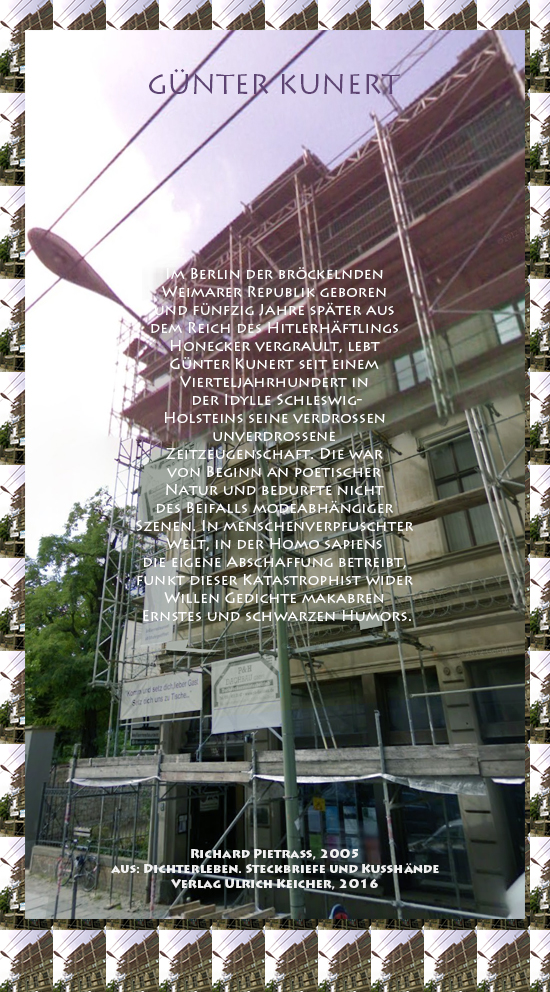












Schreibe einen Kommentar