MEIN AUFENTHALT
Im europäischen Telefonnetz
irrt meine Stimme umher: meinem Munde
entwichen, kein Gehör gefunden, gefangen
im Draht.
Zu Impulsen verwandelt,
schwachen, und immer schwächer töne ich
leise und unverständlich „Völker,
hört die Signale…“ in
stillgelegten Membranen.
Wer mich empfänge
und recht verstünde und
fern amtlicherseits,
dem wäre ein Rufzeichen geworden,
ein Echo seiner eigenen Stummheit,
eine Antwort seiner Fraglosigkeit:
dem wäre ich
sehr verbunden
![]()
Das Buch
Das sind Gedichte, die jeden Literaturtheoretiker, der nur die vordergründige „gesellschaftliche Relevanz“ gelten läßt, in Harnisch bringen: Naturgefühl und Naturbewußtsein im Wettstreit miteinander. Kunert versteht sein Dichten als einen Anstoß zur Welt- und Selbsterkenntnis – nicht als direkten Impuls, sondern als einen Versuch, mittelbar zur Veränderung beizutragen. In einer Zeit, da die Sprache zur Terminologie verkommt und „die Dinge nicht nennt, sondern ersetzt“, plädiert er für die Lyrik als Gattung, die indirekt auf das Denken und Fühlen, auf Psyche und Ratio des Lesers einwirkt. „Im Gedicht“, so Kunert, „kann Sprache wieder an Autonomie, also an Vielschichtigkeit, Bedeutungsfülle, Farbe, Schönheit und Intensität gewinnen, je mehr man das Gedicht selber als relativ autonomes Bewußtseinsgebilde zu betrachten geneigt ist. Gedichte wie Aufrufe zum Maisanbau oder wie Anleitungen zur Destruktion von Schrebergärten zu lesen, ist ein Mißverständnis…“
Deutscher Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1979
Beitrag zu diesem Buch:
Friederike Fecht: Ist uns wieder nur innerlich?
Vorwärts, 19. 4. 1979
„Wenn ich so dächte wie Kunert, möchte ich lieber tot sein“
Fritz J. Raddatz: Herr Biermann, Ihre neue Platte – letzten Endes eine Art Buch – hat den aggressiven Titel Eins in die Fresse, mein Herzblatt. Und Günter Kunerts neuer Gedichtband hat das Gegenklima schon im Titel: Abtötungsverfahren. Zeugt das für zwei verschiedene Angänge, Umgänge mit Erfahrung? Sie beide haben sehr ähnliche Erfahrungen in beiden Deutschländern, der eine rausgeschmissen, der andere gegangen worden. Aber bei Biermann doch so ein Biß in die Gegenwart, in die Aktualität hinein; eine kämpferische, zum Teil wütende, zum Teil – wenn ich an das Dutschke-Gedicht denke – sehr traurige, aber immer aktuelle Auseinandersetzung mit Wirklichkeit. Bei Kunert nicht erst jetzt, aber vor allem im neuen Gedichtband ein düsterer Ton, fast abgestorben. Zufall oder Konzept?
Wolf Biermann: Ihre Frage kann man in zwei Schichten beantworten. An der Oberfläche mag es so sein, wie Sie es von den Titeln ablesen. Wir beide waren in diesem Punkt auch schon in der DDR verschieden. Wenn Sie aber diese beiden Haltungen, wie auch diese beiden Titel, dialektisch lesen, dann enthalten sie ja beide auch ihr Gegenteil in sich selbst; denn Kunert überlebt ja, indem er Abtötungsverfahren schreibt. Und Kunert bewahrt sich ja vor der Verzweiflung, indem er seine Verzweiflung artikuliert. Kunert erscheint bei oberflächlicher Betrachtung als der Verzweifelte, der völlig Niedergebeugte – und „kehre, woher ich kam“. Aber ich kenne ihn ja ein bißchen besser…
Günter Kunert: … bitte, bloß nicht: als er sich selber…
Biermann: Nein, nein, nein, obwohl auch das passiert. Über sich selbst kann man sich ja unheimlich irren. Aber er ist ja auch ein Schelm. Er hat ja nicht diese triefende, selbstmitleidige Traurigkeit…
Raddatz: Davon war auch nicht die Rede…
Biermann: … sondern hat eher ein Weltmitleid als ein Selbstmitleid, so kommt es mir vor. Ihm selbst geht es dabei so verzweifelt gar nicht, wie es dem naiven Betrachter erscheinen mag.
Raddatz: Gut, ich bin also naiv. Sehen Sie sich richtig begriffen, Herr Kunert?
Kunert: Mir gefällt es, was Biermann sagt, und ich wünschte, es wäre so, dann wäre ich vielleicht ein heiler Mensch, wenn auch die Welt dann nicht heil wäre – ich wäre es dann zumindest. Aber ich glaube eben nicht, daß ich ein heiler Mensch bin. Und es ist so, daß Melancholie oder Depression oder Verzweiflung über einen Weltzustand – der natürlich außerhalb der Person bleibt – häufig begleitet wird von einer Art des Witzigseins, von einer ganz guten Laune, die so über den Wassern schwebt. Aber der Grund darunter sieht doch ein bißchen anders aus. Man kann nicht auf der einen Seite verzweifelt über die Welt sein, auf der anderen Seite vergnügt über sich selber, das ist undenkbar. Insofern finde ich mich doch nur zum Teil richtig charakterisiert.
Raddatz: Ist in dieser Verzweiflung Bitterkeit, Definitives? Biermann sagt: „Das Niederschreiben der Verzweiflung ist immer auch eine Hoffnung“ – das stimmt nicht ganz. Es gibt doch Bitterkeit, Resignation, die, obwohl ein Schriftsteller weiterschreibt, dennoch ein Definitivum ist; das heißt: ein Nicht-mehr-Glauben an Änderbarkeit des Menschen oder der Weltzustände, von denen Sie eben sprachen.
Kunert: Es gibt ja auch eine Art von heiterer Verzweiflung. Und vielleicht ist sogar die heitere Verzweiflung die endgültigere, das wäre denkbar, weil in einer heiteren Verzweiflung, so wie ich das sehe, eigentlich sehr wenig an Aggressivität steckt und an Unternehmungsgeist oder Energie, diese Verzweiflung abstellen zu wollen oder abstellen zu können. Sie ist vielleicht so eine Art von Rückblick auf etwas, was nicht mehr existent ist, was verschwindet.
Raddatz: Eine Bilanz?
Kunert: Ja, ein Resümee, aber ein allgemeines, nicht ein persönliches. Und ich meine auch, daß wir jetzt in eine Situation geraten sind, wo sich diese heitere Verzweiflung leider zu bestätigen anfängt. Und wenn wir zu meinen Gedichten kommen, die Sie für ganz schwarz und absolut pessimistisch halten, dann meine ich eher, daß dies Begriffe sind oder Bezeichnungen, die die Gedichte nicht fassen. Sie sind in meiner Sicht eher realistische – Diagnosen ist schon zuviel gesagt, sie sind ja eigentlich keine analytischen Gedichte, keine diagnostischen – aber sie sind einfach Merkmale einer realistischen Sicht, vielleicht könnte man es so nennen.
Raddatz: Herr Biermann, das ist eigentlich diametral entgegengesetzt dem Impuls Ihrer Arbeit. Zwei Leute mit einer vergleichbaren Biographie gehen so völlig anders mit ihrer Erfahrung um, produzieren aus ihrer Erfahrung ganz anders.
Biermann: Ich glaubte ja nicht, daß Kunert verzweifelte Gedichte schreibt und zu Hause heiter sei, das wäre in der Tat absurd. Aber, wie die Juden sagen: „Mies und gebildet bin ich alleine.“ Ich kann mich mit dieser Monopolisierung der Traurigkeit nicht abfinden, sie ärgert mich; so traurig wie Kunert bin ich schon lange, mindestens. Kunert gebrauchte vorhin, um seine Haltung zu kennzeichnen, zwei Worte nebeneinander: Verzweiflung und Melancholie. Für mich sind das aber verschiedene Welten. Verzweifelt bin ich wohl, dazu gibt’s ja auch allen Grund, aber Melancholie ist, wenn ich das richtig verstehe, die narzißtische Form der Trauer, die auf einen selbst zurückfällt und nichts mehr in der Welt bewirkt. Und bewirken möchte ich allerdings etwas. Freilich sehe auch ich, daß es tausend Gründe gibt, warum wir zugrunde gehen müssen. Wer das nicht sieht, muß ja wahrscheinlich dafür bezahlt kriegen, daß er es nicht sieht. Aber dennoch denke ich an den Satz von Brecht, den er elegant bei Marx abgeschrieben hat: Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Und ich denke allen Ernstes, wir haben noch eine Möglichkeit.
Raddatz: Ist so ein Satz „Das Schicksal des Menschen ist der Mensch“ nicht inzwischen ein furchtbares Klischee, das eigentlich mit nichts mehr gefüllt ist? Das kann inzwischen genauso gut in der Werbung stehen, etwa für eine Lebensversicherung. Sind Sie ein Menschheits-Versicherungs-Agent?
Biermann: Unsinn. Schauen Sie, der Kunert kommt aus einer jüdischen Familie, viele seiner Leute sind umgebracht worden. Ich komme zufällig auch aus so einer Familie, die sind auch umgebracht worden, ich bin der einzige, der noch übrigblieb, von seiten meines Vaters. Und wenn ich mal die Familie etwas weiter fasse, all die Kommunisten, die abgeschlachtet wurden von den eigenen Leuten – von den Nazis sowieso – wenn ich daran denke, unter welchen Mühen solche Leute wie Kunert und ich bis 1945 überhaupt am Leben gehalten wurden – ein Wunder. Und wenn ich daran denke, wie überall in der Welt die Menschen abgeschlachtet werden in Tötungsfabriken, dann will ich nicht das Recht in Anspruch nehmen, mich in die Verzweiflung fallen zu lassen die so angemessen ist. Und passierte mir eben das dennoch, dann wollte ich auch nicht mehr schreiben. Dann würde ich auch nicht mehr die Mühe auf mich nehmen, ein Wort hinter das andere zu bauen, geschweige denn, mich auf eine Bühne zu stellen und die Leute noch zu beliefern mit Liedern.
Raddatz: Sie sagen, Sie wollen was bewirken. Was wollen Sie denn bewirken?
Kunert: Da kommt man jetzt nämlich auf den Punkt.
Biermann: Ja, weil du meinst, es sei nichts mehr zu bewirken, und was da zu bewirken sei, könnte diesen Untergang nicht aufhalten.
Kunert: Nein, ich meine das so eigentlich nicht, sondern ich frage mich, was will man überhaupt bewirken, und was wird aus der Wirkung. Das, glaube ich, ist allerdings eine Grundfrage. Sind wir nicht in einer Situation – ich stelle es nur als Frage – oder in einer Welt, die ja bereits determiniert ist von ganz bestimmten Denkweisen? Eine Welt, in der ganz bestimmte Lebensweisen bevorzugt oder ersehnt werden; denn die ganze Welt will leider nichts anderes als diese Industriegesellschaft, nur mit ’ner anderen Fahne, kopieren, diese alteuropäische Industriezivilisation. Und ich frage mich, ob, was man in diese Welt wirft oder wovon man glaubt, daß es hier wirkt, ob sich nicht unter dieser Voraussetzung diese Wirkung sofort in ihr Gegenteil verkehrt.
Biermann: Aber Günter, entschuldige, lieber Günter, das ist doch nun wirklich eine Allerweltsplattheit, denn das ist doch so alt wie die Menschheit, daß die Menschen mit allem, was sie bewirkt haben, auch in Zeiten, die nicht so dramatisch am Rand der Katastrophe für die Gattung Mensch waren, immer anderes und oft das Gegenteil von dem bewirkt haben, als sie vorhatten. Das ist ja fast das Gesetz des menschlichen Handeins…
Kunert: Also wieder „wirken“ – aber wie denn, bitte sehr?
Biermann: Es trotz alledem versuchen. Freund Marx, was hat denn der bewirkt? Wir haben es ja nun am eigenen Leibe erlebt. Er hat eine Gesellschaft initiiert, in der er selbst auf jeden Fall im KZ gelandet wäre. Aber es gibt ja auch Unstetigkeitsstellen in einer Kurve, wo es ganz anders weiterläuft, und möglicherweise sind wir an solch einer Unstetigkeitsstelle. Aber es ist doch wahr, daß in jeder gesellschaftlichen Fehlentwicklung, Katastrophe, an der Menschen zerrieben werden, auch immer die Kräfte sich entfalten, die neue Wege finden, und du könntest jetzt sagen: eine höhere Form der Katastrophe organisieren. Aber das ist ein alter Gedanke.
Raddatz: Ein alter Gedanke muß ja noch kein falscher Gedanke sein. Was Sie sagen, klingt im Grunde genommen auch nicht sehr geschichtsoptimistisch, eher geschichtspessimistisch. Wenn Sie aber gleichzeitig sagen: Ich will etwas bewirken, dann liegt darunter ja immer noch ein Stück Gläubigkeit, Menschengläubigkeit, gar Menschensucht oder gar ein Stück Optimismus. Vielleicht der letzte Funke, der bei Ihnen vom Marxismus übriggeblieben ist, seinem Fortschrittsgedanken. Den finden Sie bei Kunert schon lange nicht mehr. Da liegt doch der fundamentale Unterschied.
Kunert: Meine Frage war ja nicht, ob es noch Menschen oder Gruppierungen gibt, die vielleicht versuchen, aus dieser schleichenden Katastrophe, in der wir uns ja schon befinden, Abhilfe zu schaffen. Darum geht es gar nicht, es geht um etwas anderes. Bisher hat es immer die Hypothese gegeben: die Ideale sind eigentlich nur durch eine schlechte Praxis, durch die Praxis der Schlechten verkehrt worden. Heute ist aber die Frage: ist in dieser materiellen und geistigen Verengung der Welt überhaupt noch eine Alternative denkbar, ist also in diesem Fall die Utopie noch denkbar, als Praxis? Eine Alternative der kleinen Praxis ist ja das sogenannte alternative Leben. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die meinen, sie könnten Probleme lösen, wenn wir nur alle ins Grüne zögen und unseren Kohl selber anbauten. Das setzt voraus, daß in der Bundesrepublik 40 Millionen Menschen zuviel leben, die erstmal verschwinden müßten auf irgendeine Art, damit die restlichen zwanzig dieses alternative Leben überhaupt führen könnten. Und insofern zielt meine Frage darauf: ist eine positive gesellschaftliche Utopie überhaupt überführbar in eine Praxis ohne die endgültige Zerstörung der Welt, um es ganz kraß zu sagen?
Biermann: Ich finde es nötig, aber nicht hinreichend, die tausend Gründe aufzuzählen, warum wir zugrunde gehen müssen. Das zu tun mag nötig sein, auch für den Schriftsteller, und deswegen lese ich auch deine Gedichte. Aber selbst deine traurigsten Gedichte stacheln mich. Ich will mich dagegen aufbäumen. Die hat mich schon immer geärgert, diese Haltung. Bei dir achte ich sie, weil sie mir echt vorkommt, die Verzweiflung. Als modische Schminke ärgert sie mich bei anderen sehr. Ich sehe, wie die Menschen sowohl leiden als auch sich wehren, sowohl verzweifelt sind als auch sich aufbäumen, sowohl ratlos sind und dennoch Rat suchen und sich auch helfen. Wie soll ich leben, wenn ich nicht die Dinge in ihrer Widersprüchlichkeit sehe. Die Widersprüche, wie der Meister sagt, sind die Hoffnungen, und das gilt für mich.
Raddatz: Da haben Sie genau dieses Wort benutzt: Hoffnung. Welche Hoffnung? Ist Utopie heute nicht zur Illusion verkommen?
Biermann: Utopien sind niemals eingelöst worden, das wissen Sie doch! Aber es hat sie dennoch immer gegeben, und es mußte sie geben, weil die Menschen sonst nicht überlebt hätten. Woher nehmen Sie denn die Kühnheit jetzt, der Menschheit zu bescheinigen, daß sie nicht fähig ist, aus diesen begründeten Verzweiflungen nicht neue Kraft und neue Überlegungen und Hoffnungen und Utopien zu finden, mit denen sie ein Stück weiterkommen und sich am Leben erhalten kann. Ich glaube, gerade in dieser Zeit besinnen sich die Völker auf die eigenen Möglichkeiten, auf die Quellen der eigenen Kultur.
Kunert: Also da muß ich jetzt wirklich widersprechen. Wir erleben auf der ganzen Welt entweder die Vernichtung von ethnischen Minoritäten, der Indianer zum Beispiel in Südamerika. Wir erleben die Schrecken in Afrika. Und wir erleben zugleich, daß es für sie gar kein anderes Modell gibt als das eine auf dieser Welt, Europa, daß sie sich alle dorthin bewegen, daß sie alle eine Industriegesellschaft haben wollen, daß sie alle aufrüsten, daß das erste, was sich ein neuer junger Nationalstaat anschafft, eine Armee ist, eine sehr teure, daß er beginnt mit der Industrialisierung und daß er dann, weil er auf diese Weise seine Grundlagen zerstört hat, von außen ernährt werden muß. Für dieses Europa aber wiederum gilt: Wenn wir selbst noch drei Filter auf irgendeinen Schornstein setzen oder wenn wir die Produktion von irgendeiner Säure verbieten oder das Verklappen der Dünnsäure in der Nordsee einstellen: daß es darum eigentlich nicht mehr geht.
Die primäre Vergiftung – jetzt sage ich gleich etwas ganz Ketzerisches – ist auch eine Wirkung der Aufklärung, also des wissenschaftlichen Zeitalters. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, einerseits der Wissenschaft zu vertrauen der liebe Gott ist nicht mehr existent, jetzt haben wir die Wissenschaft, die macht das alles schon. Du kennst die Leute, ich kenne die Leute auch. Ich bin nicht nur in Buch und in Berlin jeden Tag einkaufen gegangen und habe mit vielen Leuten geredet; das mache ich hier auch, in Itzehoe gehe ich fast jeden Tag einkaufen und spreche mit dem Elektriker oder der Kassiererin bei Spar, fast jeden Tag. Ich weiß, was die Leute reden und denken. Jetzt sind sie aufgescheucht, jetzt sind sie verstört, jetzt spüren sie natürlich die Krise, die da ist, eine ökonomische und eine ökologische, und die ökonomische ist ja von der ökologischen bewirkt und ausgelöst. Aber mehr oder minder haben alle dieses Realitätsverhältnis, das die Wissenschaft vorgezeichnet hat, verinnerlicht. Und das ist eigentlich die weitaus größere Katastrophe, weil sie nämlich bei dieser Sichtweise auf die Welt alternative Ideen überhaupt, die vielleicht phantastisch sind, notwendigerweise verhindern muß. Über eines sind wir uns doch alle im klaren: wir gehen zurück in die Steinzeit, da beißt keine Maus einen Faden ab, alle, das kann sich ein bißchen noch hinziehen, irgendwann kommt es. Und wer nicht freiwillig in diese Steinzeit geht, der wird in diese Steinzeit gehen müssen oder in sie gebombt. Die Übrigbleibenden werden ihre Lebenskraft, ihre Lebenssubstanz sich eigentlich nur erhalten können, wenn sie grundlegend anders denken und damit auch anders fühlen können. Und weil ich nicht daran glaube, bin ich kein Optimist und habe auch keine Hoffnung.
Raddatz: Einmal Inexistenz von Hoffnung – zum anderen: „Wenn die Menschheit nicht endlich lernt…“ Ein ziemlicher Widerspruch.
Kunert: Das ist eine Chance, an die ich selber nicht mehr glaube.
Raddatz: Wenn das stimmt, was Kunert über Aufklärung und Rationalismus gesagt hat – historische Denkkategorien, in denen wir ja alle groß geworden sind, dann bleibt natürlich von dem „Biß“ bei Ihnen, Biermann, wenig.
Biermann: Alles, was Kunert über die Katastrophen ausmalt, in die wir hineinrasen, kann ich in den wissenschaftlichen Publikationen nachlesen. Das ist ja verbreitet, und es ist ja auch wahr. Nur die Tatsache, daß wir hier überhaupt sitzen und darüber reden, daß Herr Raddatz jeden Tag in die Redaktion tigert und seine Zeitung da macht, das macht er ja auch nicht bloß, weil er sein Monatsgeld da immer holen will.
Raddatz: dazu ist es zu wenig…
Biermann: Und die Tatsache, daß du Gedichte schreibst, die für manche oberflächliche Leser nur schwarz sind, ist ja selbst schon ein Zeichen großer Hoffnung, du kommst nicht davon.
Raddatz: Wenn schreiben, meinetwegen auch redigieren, inszenieren, liedermachen, heißt, Denkkategorien, Moralkategorien gar, verändern zu können, dann bleibt dennoch die Frage: Schaffen wir das? Was mich daran interessiert, auch für meine eigene Arbeit, ist: Gehen Menschen etwa in einer Zeitungsredaktion anders – besser – miteinander um als „Resultat“ beispielsweise der Arbeit von uns dreien? Oder lügen wir uns da was in die Tasche?
Biermann: Natürlich machen wir uns was vor. Und alle Menschen, die bisher gelebt haben und was bewirkt haben, haben sich was vormachen müssen, damit sie überhaupt die Kraft hatten, am Morgen aus dem Bett aufzustehen, um nicht zu verfaulen an sich selber.
Kunert: Aber wenn sie nur aufstehen, um in den Abgrund zu stürzen, meine ich, ist diese Kraft vergeudet.
Biermann: Aber dann ist doch deine Kraft vergeudet, das nun auch noch in Worte zu fassen. Dann ist es ja auch nur eitel und Haschen nach Wind.
Kunert: Nein. Meine Schreibmotive sind ja anders. Ich beabsichtige ja keine Wirkung, ich gehe ja nicht primär von der Wirkung aus.
Biermann: Das halte ich für eine Selbsttäuschung, sonst würdest du nicht die Menschheit belästigen mit deinen Büchern.
Kunert: Das mache ich nicht, um wirken zu wollen.
Biermann: Tust du doch, Günter. Und sei es, um diese Menschen in der Seele so tief zu schwärzen wie du glaubst, daß deine Seele sei.
Kunert: Das Primäre ist, daß man ja schreibt, weil man schreibt, weil man das macht, wenn man es machen muß.
Biermann: Ich schreibe nicht, weil ich schreibe, nein.
Kunert: Also mir geht es jedenfalls so, ich schreibe primär nicht mit der Vorstellung: Hier ist ein Leser, und so will ich auf den wirken. Ich schreibe, weil es eine Art – großes Wort – „Lebensäußerung“ ist. Du willst wirken, was du ja auch tust, aber du kennst deine Wirkung auch nur bis zu einem gewissen Grad, du kennst die Wirkung in einem engeren Zirkel, vielleicht einem mittelweiten. Aber deine Lieder oder meine Gedichte oder seine Artikel haben nicht nur diese eindimensionale Wirkung, die man ablesen kann: Jemand liest etwas, sagt, aha: so ist es also. Das Schlimme an dem, was wir machen, ist ja die Ersatzfunktion: daß wir in dem, was wir machen, auch etwas ersetzen beim Leser, ihm etwas abnehmen, was er dann nicht mehr nötig hat zu tun, selber zu leisten.
Biermann: Natürlich wird niemand von uns die Welt aus den Angeln heben und die bessere Welt inaugurieren können.
Kunert: Was ist die bessere Welt? Die Frage ist doch, ist die bessere Welt überhaupt denkbar, außerdem geht es doch auch gar nicht mehr darum, ob eine bessere Welt denkbar ist, sondern ob überhaupt noch denkbar ist, wie unsere Welt weiterexistiert.
Biermann: Richtig. Aber es ist ja wohl denkbar, daß wir diese Katastrophe auf irgendeine gute menschliche Weise überleben werden…
Kunert: Aber das sind Illusionen…
Biermann: Ja, das sind Illusionen, aber du kennst doch den Satz von Luther, der gesagt hat: Und wenn ich wüßte, daß morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Dieser Trotz erscheint mir menschlicher und produktiver als das, was du die heitere Verzweiflung nennst. Das klingt sehr ähnlich wie ein Wort von Hölderlin, und Hölderlin darf man hier wohl zitieren, weil, was Verzweiflung betrifft, konnte er es ja mit dir und mir leicht aufnehmen; Hölderlin hat ein besseres Wort gefunden für eine bessere Haltung. Im vorletzten „Hyperion“-Brief gebraucht er das Wort „Heiterkeit ins Leiden“. Das ist schwebender, das faßt mehr die Dialektik von Verzweiflung und Hoffnung, in der wir uns ja immer bewegen. Ich glaube einfach nicht, daß wir aus dem grundlegenden Koordinatensystem, in dem wir uns immer bewegt haben, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, herauskommen. Ich will nicht und kann nicht verstehen, daß nur, weil wir jetzt in so einer verzweifelten Lage sind, die Lage verzweifelt sei.
Kunert: Wir haben eine Grenze überschritten. Gewiß, das hat es immer gegeben, mal war’s ein Volk und eine Nation, mal nur ein Stamm oder eine Rasse. Aber dahinter blieb dann immer noch genügend übrig. Diese Chance ist eben nicht mehr da. Eine der Grenzen ist zum Beispiel die Mengengrenze – wir sind einfach zu viele geworden. Und aus diesem Zuviel entsteht das, was man dialektischen Umschlag nennt. Aus diesem Zuviel nämlich entsteht plötzlich, daß ein eigentlich ganz normaler und nützlicher und auch schöner Vorgang, ein „Akt“, zur Grundlage einer möglichen Katastrophe wird: indem man nämlich Kinder macht, oder daß man sein Essen kochen will, auch eine ganz normale und selbstverständliche Sache. Aber ob wir nun unser Hemd waschen, ob wir unsere Suppe kochen, ob wir unsere Haare schneiden – es wird ins Gegenteil verkehrt, denn unsere Flüsse sind ja unter anderem durch die Waschmittel keine Flüsse mehr, und unsere verpestete Luft ist unter anderem auch darum verpestet, weil sich zu viele Leute ein Süppchen kochen oder die Haare elektrisch schneiden.
Biermann: Alles, was du sagst, mag richtig sein, das habe ich alles schon gelesen im Bericht des Club of Rome. Ich kann daran nicht zweifeln. Aber ich zweifle daran, daß die Menschen, die ja phantastisch erfinderische Tiere sind, nicht Wege finden zur eigenen Rettung. Denn gerade die Tatsache, daß die Bedrohung so global geworden ist, ist ja mindestens auch ein Element, das den Menschen ins Bewußtsein rückt – da sehe ich übrigens auch unsere Aufgabe als Schriftsteller −, das sie befähigt, sich zu helfen, sich selbst am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen.
Kunert: Ich meine es nicht so metaphorisch, sondern ich meine es eigentlich konkreter. Das klingt gut: die Menschen sind phantasievolle und erfindungsreiche Tiere, und wir müssen uns selber am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Bitte konkret – wie?
Biermann: Konkret? Daß wir zum Beispiel mit der harten Rute unseres Ölhungers geschlagen, abgeschnitten von den Ölquellen – denn die werden ja nicht ewig fließen – mit dem kalten Hintern in unseren Wohnungen sitzen werden und vielleicht dabei einen heißen Kopf kriegen. Daß wir nicht durch die Überredungskünste der Dichter, die Verführungskünste der Sänger, sondern durch den harten knochigen Zwang der Not gezwungen werden, über uns nachzudenken…
Raddatz: Wir werden hier zum Stammtisch, der fragt, wie ersetzen wir Öl durch was. Und von der Windmaschine bis zu „Vielleicht doch ein bißchen Atomkraft“ werden gleich alle Antworten auf dem Tisch liegen. Ich möchte zurück zu Ihrer Arbeit mit dem Wort. Es gibt diesen schrecklichen Satz von Tucholsky, ziemlich am Ende seines Lebens: „Ich hatte Erfolg, aber keine Wirkung.“ Da liegt unser Thema. Wenn Sie sagen: ich will aber Wirkung – können Sie sie eigentlich an irgend etwas ablesen, außer daß die Leute klatschen und rufen „Sing’ doch nochmal den Evergreen von damals“? Wirkung wäre ja was anderes. Viele haben ja auch vom menschlichen Sozialismus geträumt, gar gesungen, für ihn gesungen…
Biermann: … ich träume immer noch davon.
Raddatz: Ja eben. Aber Träume sind etwas sehr schwer Realisierbares, wenn man von Wirkung redet. Man träumt auch immer, daß man fliegen kann, indem man beide Arme ausbreitet. Spätestens seit den Stalin-Prozessen bis zu dem Datum, an dem wir hier reden, hat sich das doch auch als Illusion herausgestellt. Ich sehe den menschlicheren Sozialismus nicht auch nur irgendwo auch nur zu Teilen realisiert oder angepackt. Alle, die in den Lauf der Geschichte eingreifen wollten, denen sind mindestens die Hände, wenn nicht anderes, von diesem Lauf der Geschichte gebrochen worden.
Biermann: Ich unterscheide mich von Kunert und Ihnen in dem einen wichtigen Punkt: Ihr meint, der kontinuierliche Prozeß der Geschichte habe jetzt eine diskontinuierliche Stelle, die uns vollkommen aus den Angeln hebt.
Kunert: Nein, Wolf, ich sehe das anders. Ich sehe, daß der soziale Fortschritt nichts anderes bringt als eine Funktionsverbesserung. Wir haben geträumt, daß die Menschen einfach anständiger und freundlicher werden und menschlichere Menschen. Das war eine Illusion.
Raddatz: Kunerts Modell ist ein fast christlich-pessimistisches. Er sagt, dies alles sind nur Zirkelbewegungen, die letzten Endes nie weitergeführt, sondern allenfalls woanders hingeführt haben. Aber keine Weiterentwicklung im Sinne der Humanität, der Moralität.
Nun lassen wir mal das Kapitel Wirkungen – welche Wirkungen haben der Liedersänger Biermann oder der Journalist Raddatz oder der Autor Kunert; aber was macht Sie denn hoffen, woher nehmen Sie denn Ihre Hoffnungen? Ihre Sätze fangen sehr oft an mit„ Ich glaube“. Eine heikle Kategorie.
Biermann: Nicht für einen ungläubigen Menschen wie mich. Meine Hoffnung kommt aus der Beobachtung der Wirklichkeit, wie ich sie freilich sehe. Aus der Beobachtung der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Menschen, die sich wehren, wenn sie unterdrückt sind. Menschen, die oft nicht wissen, wo ein noch aus, und dennoch suchen und die nicht einfach in Selbstmitleid verfaulen wollen.
Kunert: Darf ich mal ein Beispiel erfinden? Eines Tages wird man sagen: O.k., Sie sind 60 Jahre alt, alle Sechzigjährigen sind überflüssig, und wir sind ihrer überdrüssig – leider haben wir ab sechzig keine Kohlen, keine Lebensmittel, kein Bier und keine Milch mehr für Sie. Hier haben Sie eine Tablette, Sie müssen nun leider von dieser schönen Welt scheiden. Was meinst du, was dann geschieht? Die meisten werden sich sagen, Gott sei Dank, ich bin ja erst neunundfünfzig, ich habe ja noch so viel Zeit vor mir. Und die übrigen werden eben weiterleben. – Und auch wir sind schon so weit. Wenn wir im Fernsehen die Mütter mit ihren verhungerten Kindern sehen, die Mütter, die selber verhungert sind, und wissen, in diesem Jahr krepieren fünfzehn Millionen Menschen. Ich meine, wir leben damit, aber wie leben wir damit. Wir können damit nur leben, indem wir’s rationalisieren und im Grunde nicht in uns eindringen lassen. Wir nehmen es doch psychisch gar nicht auf. Aber der Witz ist ja der, wir wissen im Grunde nur Dinge, die wir auch psychisch aufnehmen, was wir rational wissen, wissen wir noch lange nicht. Und so verarmen und verblöden wir nämlich seelisch und psychisch immer weiter.
Biermann: Ja, das ist eine chronische Demontage.
Kunert: Mit der kann man nachher nicht mehr leben. Und jetzt muß ich einen Namen nennen, der ein Beispiel ist, ein Beispiel, daß man, wenn man solche Reduktion erfahren hat, nicht mehr leben kann: Jean Améry.
Raddatz: Und dem man bei einer Lesung aus seinem Selbstmordbuch zugerufen hat: Na, wann tun Sie’s denn? Und er hat nur gesagt: Warten Sie’s doch ab. So klingt für mich Biermanns Antwort-Zuruf an Kunert: Warum schreibst du denn dann noch?
Biermann: Das ist nicht wahr. Denn ich sage ja, wenn ich überhaupt jemandem etwas zurufe: Lebe doch! Bring dich nicht um! – Ich beharre auch nach diesem Gespräch darauf, die Dinge in ihrer Widersprüchlichkeit zu sehen und zu fassen. Wenn ich das nicht täte – egal, ob ich in der DDR lebe oder jetzt hier – dann würde ich jedenfalls nicht schreiben können. Ich könnte auch nicht leben. Ich möchte dann lieber tot sein.
Die Zeit, 14.11.1980
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993 – Lesung: Günter Kunert. Moderation: Hajo Steinert. Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + DAS&D + Archiv + Internet Archive + IZA + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: AA ✝ FAZ ✝ FR ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ NDR 1 + 2 ✝ NZZ ✝ Sinn und Form ✝ SZ 1 + 2 ✝ Tagesspiegel ✝ Welt ✝ Die Zeit 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


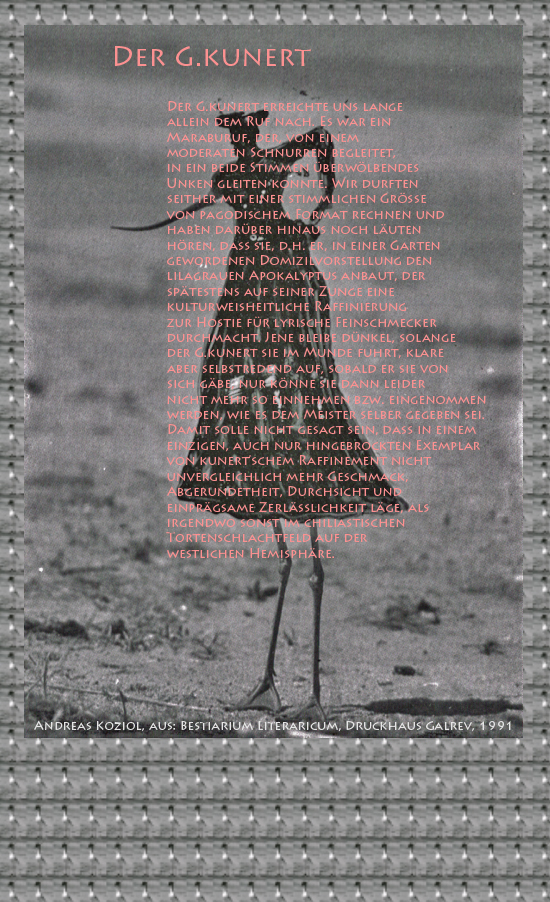
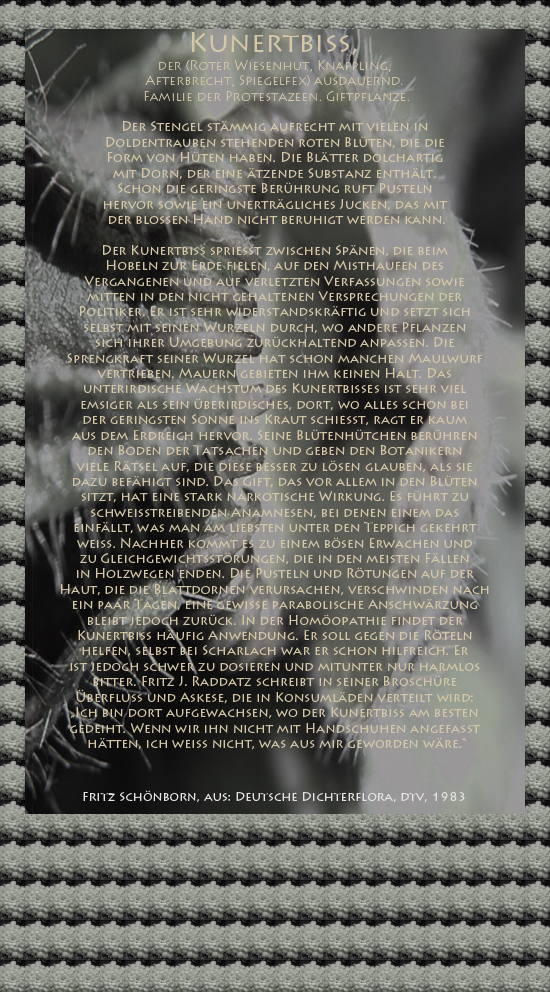
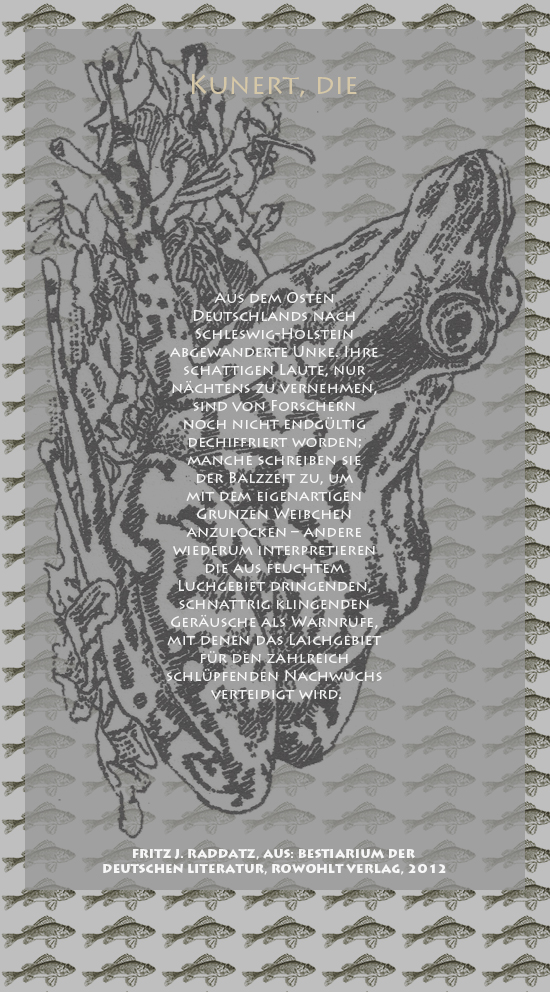
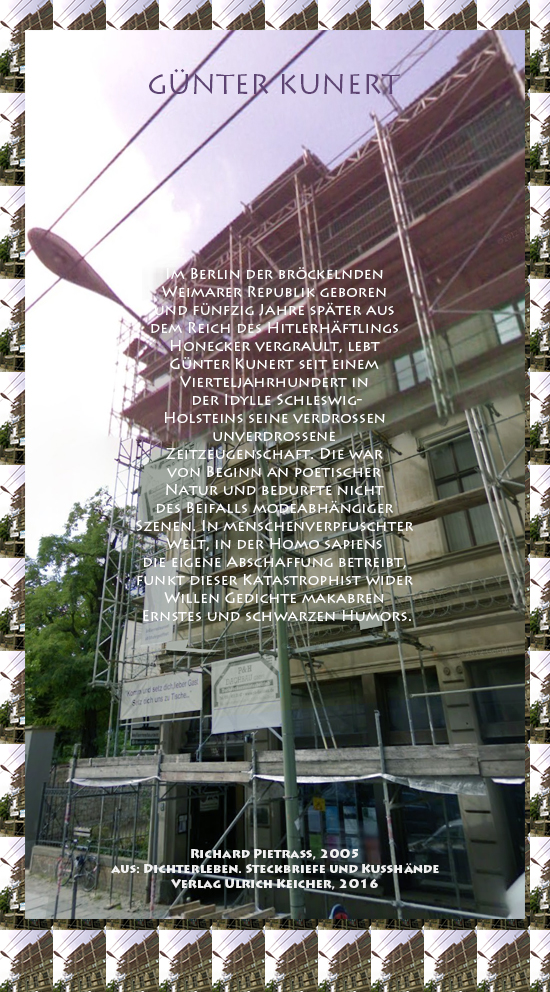












0 Kommentare