H.C. Artmann: Achtundachtzig
EIN REISSBRETT AUS WINTER,
alles pro forma,
der abend reiter darüber.
ich hätte ein klares aug
und den sinn für sterne.
ich bin vierzig jahre.
meine beine sind in einen
einzigen stiefel genäht.
ich bin ein hüpfender
unter guten läufern.
Nachbemerkung
ein bißchen innenleben freisetzen
mehr oder weniger für nachwelten
oder nähere nachmittage zitieren
Nein, keineswegs soll mit diesem Motto angedeutet werden, daß Artmanns Lyrik hier der Seelenpoesie oder ähnlichem zugeordnet wird; wohl aber unterstützen diese Zeilen – immerhin die letzten seines bislang letzten Gedichtbuchs – die Auffassung, daß Artmanns Gedichte nicht nur, wie immer wieder betont, gemacht, sondern auch, wie vielleicht zu oft nicht wahrgenommen, von jemandem gemacht sind.
Fällt es denn nicht auf – das Leben des Dichters im Hinterkopf −, daß sein häufigstes Personal der Soldat, der Dichter und der Frauenlob sind? Hat nicht sein Vergnügen am Versteckspiel hinter allen möglichen Fantomasken gelegentlich auch etwas Notwendiges? (Dichter ist ja nicht nur der, der sich erinnern, sondern immer auch der, der nicht vergessen kann.)
Und doch ist es immer auch Rollenspiel, heiteres Ausprobieren.
Taghell ist es in Artmanns Gedichten, auch da, wo es um Nocturnes geht. Scheinbar geheimnislos, verführen sie doch ständig zum Wiederlesen. Sie sind artifiziell und einfach, sind gran maniera und dolce stil nuovo.
Das früheste Gedicht Artmanns ist jetzt genau ein halbes Jahrhundert alt. Alt? Alles, was er geschrieben hat, hat etwas von jener schönen Blauäugigkeit, die nur Kindern und Dichtern geglaubt wird: und mit einem Mal wird alles möglich.
Diese Auswahl zusammenzustellen, war schwer und leicht zugleich. Schwer natürlich, von weit über tausend Gedichten nicht einmal jedes zehnte nehmen zu können. Und welches? Das beste? Das wichtigste? Das typischste? Das populärste? Das liebste? Das, das man nicht vergessen kann? Und leicht, weil seit der zehnbändigen Ausgabe, die Klaus Reichert bei Rainer und Renner gemacht hat, nahezu alles griffbereit ist, ihnen sei Dank.
Jochen Jung, Nachwort
Achtundachtzig Beispiele
aus einem halben Jahrhundert Artmannscher Dichtung
H.C. Artmann zur Ehre und uns zur Freude hat der Residenz Verlag achtundachtzig Juwelen aus Artmanns Schatzkästchen zum Vorlesen und Selberlesen in ein Büchlein verpackt – das bedeutet achtundachtzig Mal staunen, gruseln, rätseln, nachdenken, sich wundern, kopfschütteln, schmunzeln. Das Buch sei den Verwaltern sprachlichen Gutes österreichischer Zunge ans Herz gelegt, zeigt es ihnen doch, daß der Horizont unserer Sprache bis weit in „wenceslao weibelfrostens lant“ hineinreicht; es sei Artmannkennern ans Herz gelegt, zeigt es ihnen doch, daß er nicht nur „med ana schwoazzn Dintn“ schreibt; es sei uns allen ans Herz gelegt, die wir uns darüber freuen, wie er mit Gefühl und Witz sein Spiel mit vorrätigem Sprachmaterial treibt. Empfehlung!
Max Dreier, österreichisches bibliothekswerk, 1996
„Ein Orphaneum für Bücher“
Bibliothek und Biographie
plötzlich lag ich in einem brachfeld und dreißig meter vor mir war ein maschinengewehr aufgebaut das wie eine kanone aussah weil es zwei räder hatte und dahinter lagen zwei russische burschen in meinem eigenen alter und die artillerie schoß wieder einmal zu kurz und der dreck spritzte durch die gegend und ich dachte mir du kannst ja die zwei haberer nicht so einfach mir nix dir nix abschießen aber ich hatte sie genau im visier kimme und korn und ich war einer der sich auf den schießplätzen nicht nur einen sonderausgang geschossen hatte und dann blitzte es noch gelber als die sonne und mir drehte es den magen um er kam mir hoch in den schlund und wollte ausbrechen tat es aber dann doch nicht aber wer sich einmal den ellenbogen angestoßen hat das närrische bein den musikantenknochen der wird das gefühl verstehen das ich in der rechten hüfte hatte au meine nieren rief ich das weiß ich noch ganz genau und dann wälzte ich mich so gut es in dem hohen gras ging einige meter nach links und zog die unbedeckte birne ein und das zworädrige maschinengewehr ballerte unverdrossen nach der stelle an der ich noch vor sekunden gelegen hatte und die deutsche artillerie schoß wieder einmal viel zu kurz und der dreck richtete seine braunen fontänen nach dem blauen himmel und ich sagte mir verdrossen au scheiße mich hats erwischt.
Daß H.C. Artmann diesen atemlosen Bericht seiner Verwundung als Wehrmachtssoldat an der Ostfront am 11. Juli 1941 überhaupt schreiben konnte, hatte er wohl einer Erfindung des Verlagshauses Langenscheidt zu verdanken: dem Taschenwörterbuch. Denn die russische MG-Kugel, die ihm einen Durchschuß der rechten Hüfte und dann einen mehrmonatigen Aufenthalt im Lazarett einbrachte, durchquerte zunächst der Länge nach den gesamten Buchblock eines deutsch-spanischen Vokabulars, das Artmann in der rechten Brusttasche seiner Uniform mit sich führte. Das Projektil wurde durch den 1931 gedruckten Band daran gehindert, in den Oberkörper einzudringen und zudem wohl derart abgebremst, daß sich der Getroffene noch selbst aus der unmittelbaren Gefahrenzone retten konnte. Artmanns Hüfte wurde gleichwohl nie wieder völlig hergestellt, was nur belegt, wie schlimm alles hätte enden können, wenn er nicht auch an der Front seinem Interesse für Sprachen nachgegangen wäre. Sein – mit Gerhard Rühm – „ausgesprochener Spanienfimmel“ hat Artmann also ganz offensichtlich das Leben gerettet.
Selten dürften ein Menschenleben und ein Buch auf derart enge Weise miteinander verknüpft gewesen sein wie in diesem Falle, wo es wohl sonst hätte heißen müssen: Ohne Buch keine Biographie. Artmann war sich der Bedeutung des durchschossenen Langenscheidts, der so ganz anders durchschossen“ war, wie der gleichlautende bibliothekarische Begriff meint, bewußt. Er hütete das Stück wie seinen Augapfel und war sehr wählerisch in der Frage, wem er den devotionaliengleich behandelten Gegenstand vorführte. Hans-Christoph Buch – bei diesem Schriftstellerfreund aus Berliner Tagen bewahrheitet sich das nomen est omen in bemerkenswerter Form – erinnert sich, daß der Band „nur wenigen Auserwählten“ gezeigt wurde. Diesen Betrachtern wird es schwergefallen sein, sich der auratischen Wirkung des Buches zu entziehen. Anhand der Dichterreliquie, die sich nun im Besitz von Artmanns Tochter Emily befindet und auch von dieser als ein Schatz empfunden wird, bestätigt sich ein Satz des Bibliophilen Rudolf Adolph – „Jedes Buch hat seine Geschichte“ – auf exzeptionelle Weise.
Überträgt man diese Sentenz auf eine Bibliothek, so finden sich in den Regalen Geschichten sonder Zahl vereinigt. Auch dieses Phänomen brachte der Büchersammler auf einen kurzen Nenner: „Bibliotheken sind Autobiographien“. Zunächst einmal im buchstäblichen Sinne, denn der Besitzer hinterläßt oft Spuren in den Büchern, die weit über den eigenhändigen Namenszug und Besitzeintrag hinausgehen. Gerade im Falle der Sammlung Artmann liefert ein nicht geringer Teil der Bestände einen wertvollen biographischen Zugriff, weil er in der Regel nicht nur das Datum und den Ort seiner Erwerbung auf dem Vorsatz des gekauften Buches festhielt, sondern in teils langen Listen zudem akribisch vermerkte, wo und wann er im jeweiligen Band las. Die Eintragungen auf dem Vorsatz eines Lehrbuchs der norwegischen Sprache für den Selbstunterricht zeigen nicht nur den Namen des Eigentümers in verspielter Sütterlinschrift und informieren über Ort und Tag des Kaufs („Wien 23.8.1940“), sondern acht weitere Vermerke belegen ferner, daß Artmann an der russischen Front außer spanisch offenbar auch norwegisch lernte, daß er diesen Studien noch weitere dreißig Jahre lang treu blieb und daß ihn das Buch sowohl bei seiner Übersiedlung nach Schweden („Falköping, 7.11.61“) als auch nach Frankreich („Rennes, 6.2.70“) begleitet hat. „Jede organisch angelegte Bibliothek ist Topographie der Persönlichkeit“, heißt es bei Rudolf Adolph. „Wir können in ihr das Leben der Besitzer ablesen“. In einer Art Lesebiographie kann man sich Artmann vor allem von einer Seite nähern, die für die Entwicklung als Autor von prinzipieller Bedeutung gewesen ist: seiner Lektüre. Golo Manns einprägsamer Satz, „Wir sind alle, was wir gelesen“, ist eben mehr als nur ein Bonmot. Es liegt auf der Hand, daß sich mittels Erwerbungs- und Arbeitsvermerken zentrale Phasen innerhalb der Karriere des Schriftstellers Artmann herausfiltern lassen. So hat er etwa die Texte des für sein Werk so immens wichtigen spanischen Surrealisten Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) um 1950 und in den Jahren danach gekauft – den hier abgebildeten fand er übrigens 1956 in Barcelona. Sein Interesse für das literarische Vorbild hielt jedoch weit darüber hinaus an, denn in den 1970er und 1980er Jahren kamen weitere Bände hinzu, die er in Palma de Mallorca und in Kiel erstand.
Bibliothek und Werk
Ob, was und wieviel ein Dichter gelesen hat, braucht an sich keineswegs aufschlußreich zu sein.
Diesen Satz stellte der Lyriker und Literaturwissenschaftler Michael Hamburger an den Beginn seiner Studie über die Bibliothek Hugo von Hofmannsthals. Man kann dem nur zustimmen. Denn in der Tat sind weder die Lektüre noch der Besitz von Büchern zwingende Voraussetzung für das Schreiben, ja mancher Autor vertritt gar die entschiedene Meinung, allzu umfangreiche Belesenheit schade der eigenen Originalität. Vertreter dieser Spezies sind gar nicht so selten. Sie leiden an der vom britischen Forscher Harold Bloom diagnostizierten Anxiety of influence. Diese Einflußangst kannte zwar auch H.C. Artmann, allerdings nur in bezug auf die Gegenwart. Auf die Frage, ob er zeitgenössische Literatur lese, antwortete er: „Nix. Da habe ich Angst, mich irgendwie zu verlieren. Ich lese eigentlich nur Gedichte und lerne dadurch die Sprachen wieder“. Trotzdem zählt Artmann zu jenen Autoren, die in nicht zu unterschätzendem Ausmaß Literatur aus Literatur machen. Alle Lektüre, die nicht wirklich weiterhalf, betrauert Artmann in Gestalt seines Erzählers in Nachrichten aus Nord und Süd: „ich las ich las so manches jahr und was ich las es ward zu rauch mir blieb kein wörtlein das ich klug verwenden könnt“. Seine Bibliothek ermöglicht einen aufschlußreichen Blick in die Werkstatt eines Autors, der gerne zitiert, der Gelesenes mit Einfallsreichtum und Virtuosität abwandelt, der Geborgtes auf spielerische Art anwendet, der Gedrucktes in neue literarische Zusammenhänge stellt. Die systematische Durchsicht der gesamten Sammlung ist aufregend, weil sie vielfältige Bezüge zwischen einzelnen Büchern und Themen quer durch den Bestand eröffnet – und eh man sich versieht, befindet man sich im lebhaftesten Dialog mit dem Autor und dessen Werk. Und darüber hinaus mit dem Werk anderer Autoren, etwa Mitgliedern der Wiener Gruppe, wenn man in Rechnung stellt, daß Artmann die Lesefrüchte seiner oft extrem frühen Lektüre von Texten, die aus bis dato unbekannten literarischen Avantgarden Europas hervorgegangen waren, zu teilen bereit war und durch Leihgaben seiner Bücher zudem als großer Literaturvermittler gelten kann: Artmanns Bibliothek hatte außer ihrem Besitzer noch zahlreiche weitere Nutznießer und anteilnehmende Rezipienten. Genauso, wie Artmann von den Sammlungen anderer Autoren profitieren konnte.
Im Bestand der Bibliothek stößt man auf einige, die schriftstellerische Tätigkeit Artmanns erhellende Entdeckungen. Man muß sich vergegenwärtigen: Als Leser war Artmann nicht gleich Artmann. Da las der Prosaautor, der Lyriker, der Dramatiker, der Übersetzer oder schlicht der Fan bestimmter Kollegen bzw. einer speziellen literarischen Richtung. Manches Buch bot verläßliche Auskünfte, andere lieferten eine Fülle von Stoffen und Motiven, nach denen er gezielt fahndete, viele dürften auch den Lesehunger gestillt haben. Die ungeheure Vielfalt der Lektüre wird deutlich, wenn man die mit Artmanns Büchern gefüllten Regale abschreitet. „Dann lese ich“, resümierte er: „über alte Philosophien, Druidentum, Zauberei, Mythologien, prähistorische Texte, mittelhochdeutsche Lyrik, Ritterromane. Ich habe eine Riesensammlung von Comics. Echte, alte. Die beste Literatur ist ja Donald Duck. Mickey Mouse mag ich nicht, dafür Asterix. Und Comics aus den zwanziger Jahren, die sind sehr schön. Aber die Horror-Comics und diese Sex-Comics, die sind alle blöd“. Die Liste ließe sich noch um manche, vor allem triviale Gattungen erweitern, besonders die Kriminalliteratur sollte an dieser Stelle Erwähnung finden. „Weißt, daß ich eine wunderbare Sammlung Tom Shark habe?“ fragte Artmann den Zeichner Janosch, als dieser ihn besuchte. „Wart, ich zeig dir’s… Ich habe viel daraus in meinem Dr. U. zitiert…“ Seine ungewöhnliche Bibliothek war ihm Reservoir, Arbeitsinstrument und handwerkliches Rüstzeug für die äußerst virtuos angewandte „ars combinatoria“. Irgendwo Entlehntes mit dem Eigenen zu verschmelzen sei, so stellt Michael Hamburger schon zu Zeiten fest, als das Phänomen der Intertextualität in der Wissenschaft noch unter dem zweifelhaften Etikett der Quellen- und Einflußforschung firmierte, „eine durchaus dichterische Fähigkeit“. Manchmal dürfte das Gelesene einen bestimmten Ton getroffen, eine Art von Sound geliefert haben, den Artmann dann kunstvoll nachzuahmen im Stande war, ohne sich des direkten vorgefundenen Wortlauts zu bedienen. „Da fallen Zitat und authentische Stimme in eins“, meint mit Klaus Reichert der langjährige Freund und Editor Artmanns, „das Zitat klingt nur so als wäre es eines, und unter der eigenen Stimme klingt immer die andere hindurch“. So entstehe ein dauernder „Aneignungs- und Austauschprozeß“. Der Schriftsteller pflegte eine Art symbiotische Beziehung zu seinen Büchern: Wie die Ameise die Blattläuse melkt, um an Zucker zu gelangen, war der lesende Dichter Artmann stets auf der Suche nach TextsteIlen, die seine eigenen Produkte versüßten. Im Falle seiner Auseinandersetzung mit der Dichtung des Barock machte er selbst vor der chamäleonartigen Aneignung des im 17. Jahrhundert üblichen Äußeren eines Buches wie Satz, Drucktype und aufwendigster Gestaltung des Titelblatts nicht halt.
Diese Arbeitsweise spiegelt sich im schriftlichen Nachlaß des Autors kaum wider, um derart intensive intertextuelle Verfahren also nachvollziehen und belegen zu können, benötigt man den ständigen Zugriff auf die Bücher des Autors. Doch nicht nur deshalb ist die Erhaltung von Artmanns Bibliothek als geschlossenes Ensemble von ganz außergewöhnlicher Bedeutung für die Erforschung seines Werks.
Bibliothek und Nachlaß
Artmanns Bibliothek muß nicht deshalb ein besonderer Wert beigemessen werden, weil sie die Schausammlung eines Bibliophilen voller Pracht- und kostbarer Erstausgaben ist, sondern weil sie die viel benutzten Bände eines Schriftstellers vereinigt, der mit Literatur gelebt und gearbeitet hat. Und obwohl er nicht ständig mit dem Stift in der Hand las, müssen die Bücher Artmanns gewissermaßen als Ersatz für den fast marginal zu nennenden schriftlichen Nachlaß gelten, der nur 14 Archivboxen umfaßt. „Nie ist einer nachlässiger mit seinen Manuskripten umgegangen“, heißt es unisono. In einer Typologie literarischer Nachlaßgeber, deren Pole zwischen dem pedantischen Archivar seiner selbst und dem eher chaotischen Minderer seiner Bestände liegen, müßte man Artmann letzterer Gruppe zuordnen. Klaus Reichert bedauert dies als dessen Herausgeber besonders:
Er hat eine Laxheit gegenüber seinen Skripten gehabt. Er hat sie verloren, liegengelassen. Es tauchen immer wieder Sachen auf, die zufällig Freunde irgendwo gefunden haben. Er hat nicht, wie andere Dichter das machen, die Besessenheit, alles aufzubewahren, alles schön abzulegen, zu ordnen usw. Es interessiert ihn das, was er im Augenblick schreibt, die Maske, in die er sich im Moment hineinbegeben hat. Das ist es, was ihn interessiert. Was er früher einmal geschrieben hat, ist ihm eigentlich egal.
Viele Geschichten, die vom traurigen Schicksal zahlreicher Handschriften und Typoskripte künden, passen sehr gut zur Mythisierung des eigenen Lebens. So soll, berichtet Artmann an einer Stelle, ein Hausmeister im schwedischen Malmö, wo er Anfang der 1960er Jahre lebte, nach seinem Auszug einen „Großteil des dort entstandenen Œuvres vernichtet“ haben. Ein Rezensent berichtet schon 1966, nach Erscheinen des Gedichtbands verbarium davon, daß er sich schwer tue bei der Frage, ob diese Verse auch die besten Verse Artmanns seien:
Der Zufall liest nicht nach qualitativen Prinzipien aus. Vielleicht hat Artmann viel bessere geschrieben, vielleicht sind gerade sie verlorengegangen, haben sich zumindest nicht angefunden, sind aus des verschwenderischen Poeten Füllhorn in private Laden, Alben und Archive geflattert. Es heißt, Sammler klaubten ihm die Sachen unter der Feder weg.
Fest steht jedenfalls, daß es Artmann zeitlebens nur seinen Freunden zu verdanken hatte, daß sein Werk einem größeren Leserkreis überhaupt in gedruckter Form zugänglich war. In einer Besprechung des Bandes ein lilienweißer brief aus lincolnshire wird die archivarische Treue der Freunde Artmanns etwas mokant kommentiert:
Die starke Gruppenintimität jedoch, das Freundschaftsgefolge, die nach wandernden Bewunderer des „Meisters“, überhaupt das Klüngelhafte im literarischen Leben Österreichs, brachten es fertig, daß kaum ein Text Artmanns verlorenging, während er selbst, genialisch-unbekümmert, seine Gedichte „verschmiß“, sie in seinen dauernd wechselnden Wohnorten liegen ließ oder sie ohne Abschrift aus der Hand gab. Das Nachwort von Gerald Bisinger macht deutlich, welche Querverbindungen, welches Ausforschen, Sammeln, Bewahren von anderer Seite diese mustergültige Edition erst ermöglichten.
Bezeichnend ist, daß sich im Nachlaß von Hannes Schneider, einem Autor aus dem Umfeld der Wiener Gruppe und Initiator der Zeitschrift Eröffnungen, mehr Texte Artmanns befinden, als in dessen Nachlaß selbst überliefert sind, darunter als einmaliges Stück der Entwurf zum Manifest gegen die Wiederbewaffnung Österreichs vom 17. Mai 1955. Diese erstaunliche Nachlässigkeit in bezug auf die Dokumentation seiner schriftstellerischen Arbeit gilt freilich nicht für die etwa 3.500 Bände seiner Bibliothek, die – gerade weil es an nachlaßtypischen Materialien mangelt – wegen ihrer Arbeitsspuren und Marginalien sowie der beigelegten Notizzettel den vielleicht zentralen Kern des literarischen Vermächtnisses von H.C. Artmann ausmacht.
Bibliothek und öffentliche Sammlung
Als die Bibliothek Artmanns vor deren Erwerbung im Jahr 2004 in seinem Salzburger Haus besichtigt wurde, konnten sich die Besucher davon überzeugen, daß die so prall gefüllten Regale keineswegs von der „leise[n] Langeweile der Ordnung umwittert“ waren, die der bibliophile Philosoph Walter Benjamin einst beschworen hat. Die auf dem Vorsatzblatt und dem Frontispiz verwendeten Aufnahmen, die die frühere Aufstellung dokumentieren, belegen, daß Artmann seine Bücher weder alphabetisch noch nach Fachgebieten aufgestellt hatte. Dabei dürften regelhafte und regellose Aufstellung parallel existiert haben. Manchmal sind Inseln auszumachen, wo sich innerhalb der Reihen eindeutige Verwandtschaftsbeziehungen konstatieren lassen, wo offensichtlich nach einem System gegenseitiger Sympathien oder Antipathien gestellt wurde, wo es im Nebeneinander derart heftige Kontraste gab, die nach längerem Überlegen doch prima vista verborgene Übereinstimmungen beinhalten. Über weite Teile der Bücherborde freilich ist keinerlei Regel erkennbar, auch mehrbändige Werke stehen nicht beieinander. Artmann hat die aus diesem Grunde fälligen Suchzeiten bisweilen beklagt und hat darin bekannte Vorläufer wie Christoph Martin Wieland. Dem wurde vorgeworfen, daß er in seiner etwa 6000 Bände umfassenden Bibliothek voller literarischer Preziosen nicht recht Ordnung hielte, worauf er entgegnete: „Mein Wille ist nicht schuld daran, sondern – wie soll ich sagen? – mannigfacher, oft nur kleiner Gebrauch, Zerstreuung, Vergeßlichkeit… da sammeln sich Bücher, die besser an ihrem Orte ständen, da werden andere verlegt, und ich suche sie überall, wo sie nicht zu finden sind“. Artmann war sich der Problematik bewußt. Er gab die Schuld an dem Mix von subjektiver Ordnung und objektivem Chaos auf seinen Regalen den beengten Verhältnissen im Salzburger Haus. Hinzu kam der zweite Standort mit seiner Wiener Wohnung: „Ich habe meine ganzen Bücher in Salzburg“, sagte Artmann in einem Gespräch. „Ich habe in Salzburg noch viermal so viele Bücher wie hier stehen. Oder fünfmal so viele. Ich hätte sie schon längst aufgegeben, die Wohnung. Aber ich kann die Bücher nicht aufgeben“. Barbara Wehr, eine langjährige Freundin Artmanns, die als Professorin für italienische und französische Sprachwissenschaft an der Universität Mainz tätig ist, ließ das nicht gelten und rief Artmann dazu auf, diesen Zustand nicht andauernd zu beklagen. Sie stellte ihm die zentrale Frage: „Wann ordnest Du Deine Bücher?“
Diese Aufgabe hat die Wienbibliothek im Rathaus übernommen, und Artmann somit posthum einen lange Zeit gehegten Wunsch erfüllt: „Ich hatte mal einen Traum, da hatte ich die ganzen Bücher beieinander, und da war ich sehr begeistert“. Bei der Aufstellung konnte es jedoch nicht darum gehen, die originale Reihung zu rekonstruieren. Es wurde vielmehr eigens eine spezielle Systematik entwickelt, die die uneingeschränkte Benutzbarkeit der Sammlung gewährleistet. Tatsächlich kann sich der Benutzer durch die fast komplett aufgestellte Bibliothek der Leseleistung Artmanns auf einzigartige Weise annähern. Selbst Bände, bei denen eine Reparatur notwendig wäre, wurden trotz, bisweilen auch wegen all ihrer – mit den Worten des Dichters Karl Wolfskehl – „Ehrenmarken, Narben und Alterszeichen“ bei der Aufstellung berücksichtigt. Neben wohlerhaltenen Erstausgaben sind spätere Auflagen, abgenutzte Bände, abgegriffene Umschläge und eingerissene Broschuren zu finden. Zudem sind viele Bücher gebräunt und stockfleckig. Zuweilen haben sie offenbar als Unterlage für eine Tasse Kaffee oder ein gepflegtes Glas Wein gedient. Anderen Bänden sieht man an, wie sie unter der räumlichen Bedrängtheit in Salzburg gelitten haben. Generell waren Artmann der Fund samt darin enthaltenem Text wichtiger als der Zustand eines Buches. Die nicht immer rosige finanzielle Situation des Autors tat ein übriges, wie sich Friedrich Polakovics erinnert, der häufig bei Artmanri in Breitensee, wo Polakovics noch heute wohnt, zu Gast war: „In seinem Kabinett in der Kienmayergasse hat er ein zusammengenageltes Regal gehabt, da sind seine meistens broschürten Bände drinnengestanden, so billig wie möglich, wie es halt damals gegangen ist“. Natürlich wußte Artmann einen schönen alten Druck durchaus zu schätzen, wie man seinem schwedischen Tagebuch, in dem es wie in seinen realen Kalendern nur so von Lektürehinweisen wimmelt, entnehmen kann:
Heute morgen ist mein guter Quixote, den ich vor achtzehn monaten in Stockholm zurücklassen mußte, wieder bei mir angekommen. Lederrücken, goldtitel und braunfleckiges papier sind ja nicht so ganz nach meinem geschmack, aber was will man? Die ausgabe ist von 1840, bei Baudry, Librería Europea, no 3, Quai Malaquais, cerca deI Pont des Arts und der druck ist angenehm zu lesen.
Bei Artmann bewahrheitet sich, daß jeder Sammler und Leser Moriz Sondheim zufolge „seine eigene Bibliophilie [besitzt], die ihn beglückt“. Artmann schreckte trotz aller Bücherliebe aber nicht davor zurück, sich im Notfall von einigen Bänden zu trennen. Als es Anfang der 1950er Jahre Mode war, den Künstlertreffpunkt Strohkoffer zu besuchen, brauchte er das nötige Kleingeld dafür:
Ich bin halt auch hingegangen. Und war dann fast jeden Abend dort. Immer dann, wenn ich einen Schilling g’habt hab. Das Trinkgeld für die Garderobe. Das war das Wichtigste. Sonst hätt’ ich mich geniert. Manchmal hab’ ich Bücher versetzt, um den Garderoben-Schilling zu kriegen. Meine Anatole-France-Sammlung hab ich so verschleudert.
Dieser Bücherschwund zu Lebzeiten Artmanns ist naturgemäß nicht kompensierbar. Aber zu weiteren Verlusten oder gar zur endgültigen Auflösung der Sammlung wird es wegen ihrer geschlossenen Erwerbung durch die Wienbibliothek nicht kommen. Das ist auch heute nicht selbstverständlich. „Nur wenige Privatbibliotheken haben das Glück“, schreibt Roland Folter in seinem noch immer gültigen Standardwerk, „geschlossen erhalten zu bleiben und dadurch ein geistiges Bild ihrer Besitzer der Nachwelt zu überliefern. Das Schicksal der meisten ist es, aufgeteilt, verkauft, verstreut zu werden“. Denn selbst die Bibliotheken von so prominenten Schriftstellern wie W.G. Sebald, dessen Texte ähnlich intensive Rückschlüsse auf die Lektüre des Autors zulassen wie bei Artmann, drohen zu zerfallen, weil einschlägige Institutionen (im Falle Sebalds das Deutsche Literaturarchiv in Marbach) aufgrund der vielen „Dubletten“ von einer geschlossenen Erwerbung absehen und nur solche Bände übernehmen, die eindeutige Arbeitsspuren tragen. Doch wer definiert diese? Eindeutige Festlegungen sind hier noch nicht getroffen, so daß der Forschung ohne Not unwiederbringliche Verluste drohen. Freilich sind sich nur wenige Literaturwissenschaftier dieser Gefahr bewußt, wie etwa Sven Hanuschek, der ein Verzeichnis der Bibliothek des Dramatikers Heinar Kipphardt vorgelegt hat, um dessen Bücherbesitz wenigstens in Katalogform zu überliefern.
Die Schicksale von Dichterbibliotheken beschäftigen seit jeher insbesondere die Eigentümer selbst. „Ausserdem will ich es nicht zulassen“, schrieb beispielsweise Petrarca an Boccaccio,
dass die Bibliothek eines Mannes, wie du einer bist, zerstreut wird und in unwürdige Hände fällt. Denn obwohl wir getrennt voneinander lebten, waren wir doch durch unseren Geist miteinander vereint. Deshalb will ich, dass unsere Sammlung auch nach unserem Tod zusammenbleibt. Wenn Gott meinem Wunsche entsprechen will, dann wird sie völlig ungeschmälert an einen heiligen und frommen Ort verbracht werden, an dem man sich unserer in alle Ewigkeit erinnern wird.
Petrarcas Sorge war berechtigt. Sowohl seine als auch die Büchersammlung von Boccaccio wurde in alle Winde verweht. Nur noch wenige Exemplare sind einem der beiden Dichter der Renaissance zuzuschreiben. „Ja, ich habe Sorge um meine Bücher“, äußerte auch Artmann kurz vor seinem Tod. Seine Schützlinge hätte er gerne an sicherem Ort versorgt gewußt: „Ich wollte ein Waisenhaus, ein Orphaneum für Bücher machen. Damit die Bücher nicht in alle Welt verstreut werden. Da sammelt einer ein ganzes Leben an Büchern, und dann, zack, stirbt er, und dann sind die völlig zerstreut, liegen die herum“. Die Wienbibliothek hat sich der Bücherwaisen Artmanns angenommen. Allen. Walter Benjamin stand solchen Übernahmen privater Kollektionen durch öffentliche Einrichtungen skeptisch gegenüber: „Das Phänomen der Sammlung verliert“, kommentierte Benjamin den Tod eines Bücherherrn, „indem es sein Subjekt verliert, seinen Sinn. Wenn öffentliche Sammlungen nach der sozialen Seite hin unanstößiger, nach der wissenschaftlichen nützlicher sein mögen als die privaten – die Gegenstände kommen nur in diesen zu ihrem Recht“. Das soll sich mit der geschlossenen Erwerbung und der kompletten Aufstellung der Bücher Artmanns ändern: Jeder Besucher der allgemein und frei zugänglichen Sammlung kann in die Rolle des von Benjamin zitierten Subjekts schlüpfen. Die Bedeutung der über Jahrzehnte zusammengetragenen Bibliothek Artmanns, ihr Gewinn im einmaligen Ensemble der nun in der Wienbibliothek versammelten und zur ständigen Verfügung gehaltenen Bände zeigt sich mit jedem Titel, den man dort findet. Ihr Wert steigt mit jeder Benutzung. Ohne Zweifel hätte sich H.C. Artmann darüber sehr gefreut…
Marcel Atze, Einführung aus: Marcel Atze und Hermann Böhm (Hrsg.): „Wann ordnest du Deine Bücher?“ Die Bibliothek H.C. Artmann, Sonderzahl Verlagsgesellschaft, 2006
Zeit-Reisende umsteigen! Bern 1951–1953
1971 stand ich mit dem Hippie-Guru und Flüchtling Timothy Leary neben dem alten Berner Blutturm, in welchem nach der Sage einst die Hexen und Ketzer eingekerkert wurden. Wir sahen an uns, von den Alpen her, den Aarestrom vorbeirauschen.
Es war eine Stimmung wie aus einer ganz alten Sage oder einem ganz modernen Science-Fiction-Roman.
„Bern ist eigentlich eine sehr gute Station für Time-Travellers, für Zeitreisende“, meinte Leary.
„Das habe ich schon vor ziemlich genau 20 Jahren von einem Freund gehört“, meinte ich, „einem Österreicher, der die keltischen Mythen und die echte Schweiz ebenso liebt wie du.“ „Es ist das Schicksal von allen Zeit-Reisenden, immer die gleichen Schlüsselsätze zu hören“, sagte Leary.
Simmens Liebes-Galerie
Alles begann, zumindest von uns aus gesehen, im Jahr 1948, als der junge Antiquar René Simmen an der Schwarztorstraße seine Kunstgalerie gründete.
„Nach dem Schock des Krieges“, erzählte er darüber später, „gab es bei uns gar nichts, als den etwas verstaubten, auf die Verherrlichung der angeblich so ,Guten alten Zeit‘ vor den Weltkriegen gerichteten, durch und durch verlogenen Kulturbetrieb. Da die ganze Auseinandersetzung mit den deutschen Richtungen für Jahre wegfiel, sah ich mich gezwungen, für die Jungen einen Mittelpunkt der Diskussionen zu schaffen. Usw. usw.
So würde ich jene Jahre darstellen, wenn ich ein Heuchler mit der Aussicht auf einen ehrenden Abschnitt in der Kulturgeschichte wäre.
Seien wir aber ehrlich! Ich liebe nun einmal, wie alle Männer, schöne Frauen; habe aber nun einmal, wie alle Männer unserer Zivilisation, innere Schwierigkeiten, ihnen näher zu kommen – und wie kommt man ihnen schon besser näher, als wenn man etwas Avantgardistisches gründet und zum Mittelpunkt einer kleinen Welt wird, die die Phantasie anregt?“
In Simmens Antiquariat, wo er angestellt war und jenes Geld zu verdienen versuchte, das ihn seine Liebes-Galerie kostete, tauchte auch eine sehr junge Schauspielschülerin auf, geriet mit ihm – zuerst über Bücher, Kunst und so – in Gespräche und wurde anschließend für ein paar Jahre seine Lebensgefährtin.
Ihr zuliebe, da sie nun einmal in der damals vorherrschenden Öde des Berner „Kulturbetriebes“ neues Theater spielen wollte, gründete Simmen eine neue Bühne, das „Atelier-Theater“, das gleichzeitig eine Wirtschaft und wiederum ein Ort bahnbrechender Kunstausstellungen werden sollte.
Die Idee war wunderbar, das Gebäude erstand – nur Simmen wurde von „realistischen“ Geldgebern aus dem Spiel herausgedrängt. Statt einer ersten großen Außenseiter-Bühne für neue Stücke und Diskussionen mit nicht anerkannten Dichtern besaß Bern von nun an eine zweite kleinere Ausgabe seines Stadttheaters, die im großen und ganzen ebenfalls nur „bewährte Traditionen“ hütete.
Für Esther und René war dies ein Ende vieler Utopien und Hoffnungen und namentlich für den letzteren eine unglaubliche Zunahme seiner Schulden.
Dazu ist es ziemlich schwer geregelter Arbeit nachzugehen, wenn man sein Bett in einer Kunstgalerie hat, die von einer Reihe von Künstlern und von andern lustigen Leuten als der Ort ihrer Wohngemeinschaft betrachtet wird. „Jetzt habe ich keine Stelle mehr“, sagte er eines späten Morgens zu mir voller Traurigkeit, als er nach einer ziemlich unruhigen Nacht den Wecker aus einer Zuckerdose herausholte und bekümmert feststellt, daß er eigentlich schon seit drei Stunden zu arbeiten hatte.
Simmen blieb nichts übrig, als nach Zürich zu verschwinden, wo er, unternehmungsfroh bis heute, einen kleinen Verlag gründete. Die Simmen-Zeit Berns war damit zu Ende – überall regte sich aber dank diesen Jahren das Gefühl, daß man ohne Kleintheater, Diskussionsklubs, Dichterlesungen, Cabarets, Experiment-Kinos, Galerien gar nicht leben könnte. „Diese Dinge sind wie Fenster, die uns Luft zum Atmen ins Haus bringen“, sagte mir einmal Esther.
Und so reiste sie, meines Wissens nun 18jährig, schon 1951, also vor dem letzten Todeskampf des verschuldeten Simmen-Kreises, nach Wien. Dort fand sie, wie sie uns später erzählte, ein entsprechendes „Fenster“ im „Art-Klub“, veranstaltete dort Lesungen der Werke von Lorca und Neruda und traf auch H.C. Artmann – den Übersetzer von Lorca und Neruda.
Neue Spielregeln
Wie mir dann HC und sein Freund Wieland Schmied erzählten, muß sie in Wien über Bern im allgemeinen und uns im besondern ganz wunderbare Geschichten erzählt haben – sozusagen über eine Hippie-Stadt, von tiefsinnige Narrheiten erzählenden „Naturphilosophen“ durchwandert!
„Für eine großartige neue Liebe, die einen neuen Lebensabschnitt bedeuten soll“, lehrte HC, „braucht es einen entsprechenden Hintergrund.“
Also waren sie alle auf einmal da.
Wie ich eines Abends heimkam, lagen zwei gekreuzte Degen auf meinem Bett. „Dies bedeutet Auseinandersetzung, den Zusammenstoß von zwei verschiedenen Energien, aus denen eine neue Kraft entstehen soll“, deutete mir HC anschließend das malerische Sinnbild.
Er, Esther und Wieland Schmied waren, um mich auf diese Art kennenzulernen, zu meinem Fenster im ersten Stock hinaufgeklettert und kamen nun lachend aus einem Versteck heraus.
„Ich komme“, sagte HC anschließend, „um Bern so zu sehen, wie ich eure Stadt aus Esthers Geschichten schon kenne. Es ist ein Versuch – ich frage mich, ob ich enttäuscht werde.“
Was die Stadt angeht, wurde er ganz sicher nicht enttäuscht.
Wie sollte dies auch möglich sein?
Er kam mit dem ganzen Willen zu Leben und zu Erleben – verständlicherweise verwandelten sich ihm alle Dinge, die wir als alltäglich und nebensächlich anzusehen gewöhnt waren, in spannende Erlebnisse. Und dadurch, daß er unsere Umwelt neu sah, wurde sie für uns alle ebenfalls jung und neu und zu einer Quelle endloser Abenteuer.
„Die echte Revolution“, dies erzählte er mir an einem der ersten Abende, als ich ihn kennenlernte, und ich habe es sogar aufgeschrieben, „die beginnt nicht auf der Straße sondern nur bei uns. Man macht sie nicht gegen eine Regierung sondern gegen eine alte Welt, gegen die Realität, die man in der Schule als unausweichliche Wirklichkeit anzuschauen gelernt hat.
Ihr glaubt in einer langweiligen Provinz zu leben und meint, in Paris oder London geboren, hättet ihr ganz andere Aussichten. Man muß nicht an die Zukunft und Vergangenheit denken, sonst verliert man sein einziges Gut und Glück, die Gegenwart. In jeder Pinte an der Landstraße kannst du sämtliche Philosophien des Universums finden und wenn du aus ihnen die richtige Schlußfolgerung machst, dann kann der hinterste Winkel, da dies geschieht, auf einmal zur Pilgerstätte für die ganze Welt werden.
Paris, London, früher vielleicht Rom, Athen und Jerusalem, waren am Anfang sicher verlauste Dörfer. Sie wurden zu Mythen von jenem Augenblick an, als dort ein paar erwachte Menschen, die zuerst vielleicht für jedermann lächerliche Außenseiter waren, groß zu lieben und dann die Welt auf neue Art zu sehen wagten.“
Entdeckung der Gegenwart
In vorgerückter Stunde waren dann unsere Zechereien und Zauber-Gespräche in Berns letzten Kaschemmen zwangsläufig zu Ende.
Die Wirte verwiesen mit erbarmenswürdigem Gebärden-Spiel auf die nun einmal gesetzlich geregelte Schließungs-Zeit. Drohend tauchten gleichzeitig an den Türen die Schatten der Ordnungs-Hüter auf und wurden auch für die verwegensten Pinten-Pilger zum Mahn-Zeichen.
Doch an das Heimgehen dachte dann damals in Bern selbstverständlich trotzdem niemand: Vor allen nun sorgfältig verriegelten Wirtshaus-Pforten ballten sich jetzt Klumpen von erwartungsvollen Mitmenschen. Voll Sehnsucht warteten sie oft stundenlang, sich gelegentlich aus einer noch vorsorglich beim Verlassen der Gaststätte erstandenen Flasche stärkend, auf jemand, der sie noch irgendwohin einlud. Ein solcher mitleidender Erlöser zeigte sich eigentlich immer – sei es nun, daß er selber ein ewig durstiger, einsamer Zecher war oder auch nur ein um Volksgunst ängstlicher Politiker, der also noch in nächtlicher Stunde die ihm fehlenden Wählerstimmen zu erjagen versuchte.
„Kommt alle zu mir“, pflegte ein solcher Glücks-Bote aufzurufen, „ich habe noch was Gutes im Keller. Kommt selbstverständlich nur für ein halbes Stündlein, denn ich muß schon in der Frühe an die Arbeit.“
Wie die Herde hinter dem besten Hirten wanderten dann alle Rauschmänner hinter ihrem Gastgeber.
Irgendwo in einem der alten Häuser begann darauf eine der erstaunlichen allnächtlichen Berner Zechereien, bei denen sehr häufig Leute, die doch am hellen Tage umeinander einen riesigen Bogen beschrieben, miteinander die Gläser anstießen und einander von ihren Schicksalen berichteten – der Nationalrat und der Vagabund, der Polizeichef und der Dichter, der Spießbürger und der Zuhälter.
HC war bald ein großer Freund dieser phantastischen und für alle ihre Zeugen unvergeßlichen Berner Nächte.
„Wäre man dabei selber nüchtern genug“, sagte er mir einmal, „könnte man dabei alles Wort um Wort aufschreiben, was dabei so dahergeredet wird, ich glaube man könnte das großartigste Theaterstück auf die Bühne bringen.
Die Leute reden ja offener und ehrlicher miteinander, als wären sie im Vorhof des Himmelreiches oder auch der Hölle. Sie können dies alle zusammen tun, weil sie ganz genau wissen, daß jedermann so besoffen ist, um noch am nächsten Tage einigermaßen zu unterscheiden, was er mit seinen wirklichen Ohren hörte und was er sich nur dank dem Alkohol zusammen träumte.
Ich glaube, wenn sie dann ihren Suff richtig ausgeschlafen haben, wissen die nicht einmal, in welchem ihrer barocken Gespensterhäuser das Gelage stattfand und ob es überhaupt stattfand oder ob sie, als sie aus ihrer Pinte herausgeworfen wurden, überhaupt noch irgendwohin hingingen – und nicht vielmehr schön brav ihren Betten zu taumelten.“
Theater des Lebens
„HC, du siehst es wieder einmal zu schön“, widersprach ihm gelegentlich Esther, „wenn die Berner so phantastisch wären, so viel Sinn für Stunden der Wahrheit besäßen, warum haben sie denn ein so verschissenes langweiliges Stadttheater?“ „Wozu sollen sie schon an einem modernen Theater basteln“, meinte darauf Artmann, „wenn sie sich Nacht um Nacht, und dies erst noch vor dem wunderbaren Bühnenbild ihrer barocken Stadt, ein so wunderbares Theater vorspielen können – ein Theater, in dem sie erst noch nicht zahlende Zuschauer sind sondern zu jeder Stunde jeder sein Hauptheld.
Nein, liebe Esther, damit du groß rauskommst, müssen wir dir schon irgendwo außerhalb Bern an einem viel langweiligeren Ort eine Bühne finden.
Die Berner werden erst dann anfangen, echtes Theater, ich meine Theater auf Brettern, zu machen, wenn man ihnen ihr wunderbares Nachttheater, also das echte Lebens-Theater, wegnimmt.“
Ich glaube kaum, daß solche Lehren für Esther einen großen Trost bedeuteten.
Immerhin ist hier festzustellen, daß ziemlich sofort als HC Bern den Rücken kehrte, Bern auf erstaunliche Art und Weise zu einem erstaunlichen Begriff für die neueste Kulturgeschichte des Theaters emporstieg.
Dr. Hans Rudolf Hilty, einer der wichtigsten Kenner der Entwicklungen auf diesem Gebiet, betrachtet für jenen Zeit-Abschnitt Bern mit seinen schon vor 1960 emporblühenden „Kellerbühnen“ als den wichtigsten Ort des deutschen Sprachgebiets für die Entstehung eines „Off Broadway“-Theaters: Also eines Theaters, das versucht, ein Ausdruck der geistigen Spannungen und Strömungen zu sein und nicht ein staatlich gefördertes „Kulturalibi“ für eine Schicht von ewig-gestrigen Langweilern.
Ganz abgesehen vom kometenhaften Aufstieg des Berner Theatermannes Friedrich Dürrenmatt: Es veranstalteten z.B. Claus Bremer und Daniel Spoerri schon 1953–1956 im damals neuentstandenen Berner „Kleintheater Kramgasse 6“ die für das ganze, durch die Folgen des Weltkrieges niedergehaltene deutsche Sprachgebiet so wichtigen Uraufführungen von Ionesco und Picasso. Am gleichen Ort versuchten jene beiden schon damals die Zuschauer während der Aufführung in ihre Handlung einzubeziehen und es gab schon damals etwas wie „Experimente der Publikumsbeschimpfung.“
Wir freuten uns natürlich dann alle über diese unglaubliche Entfaltung, aber die angeführten Worte von HC kamen uns allen häufig genug in den Sinn. Entstand hier „nur“ ein Fluchtweg für eine Minderheit aus einem immer unmöglicheren Alltag? War hier einfach ein schwaches Gegengewicht zur peinlichen Tatsache, daß die alten verrauchten Wirtshäuser mit ihren bunten Gästen nach und nach ebenso verschwanden, wie die für alle Zecher offenen Weinkeller. Daß die Wohnhäuser der Altstadt sich nach und nach von allem abenteuerlichen Volk leerten und immer mehr zu Sitzen von zahllosen Ämtern werden mußten. Daß, kurz gesagt, Bern immer mehr so wurde, wie man es allgemein von einer Beamtenstadt erwartet…
Schwarze Romantik
Oft zog es aber, wenn es Mitternacht schlug und die öffentlichen Gaststuben ihre Türen schlossen, HC und seine Freunde nicht an jene eigenartigen Gelage mit ihren endlosen Gesprächen, die der ewigen Welt wirrer Träume zu entstammen schienen.
„Man kann an manchen Orten über Surrealismus und Schwarze Romantik theoretisieren“, sagte uns Artmann, „Bern gehört aber, wahrscheinlich mit gewissen Städten von Neu-England und Irland zusammen, zu jenen Städten, in denen Surrealismus und Schwarze Romantik zur Wirklichkeit gehören, wie anderswo Warenhäuser und durchfahrende Autos.“
Was Neu-England angeht – Artmanns großer Guru, also der Führer auf den geheimen Pfaden durch die unbekannten Reiche des Geistes, war damals der eigenartige Amerikaner H.P. Lovecraft: Ziemlich unbekannt und arm hatte dieser 1890–1937 in den ihm fremden USA gelebt und dort aus Überresten von Indianermythen und den Ängsten der ersten puritanischen Ansiedler seine Gruselgeschichten zusammengeschrieben. Nur ein winziger Kreis von Freunden echter Science-Fiction-Dichtung und der psychedelischen Kunst (bevor es dieses Wort gab!) pflegten sein Andenken in Amerika, kein Mensch hatte am Anfang der Fünfziger etwas von ihm in Europa gehört. Noch länger als ein Jahrzehnt blieb er ausschließlich ein Dichter für Dichter – wie ich dann zufällig in Gesprächen vernehmen konnte, z.B. auch für einen Cocteau, Dürrenmatt.
HC erzählte Esther und mir schon damals, 1951/1952 Lovecraft-Geschichten, von denen es meines Wissens noch keine einzige französische oder deutsche Übersetzung gab. Gleich uns mußte Lovecraft der Vergangenheit seines Landes nachgeträumt, und auf einsamen Wanderungen ohne Ziel die Hexenhöhlen und Druidensteine des amerikanischen Küstengebiets erwandert haben. Diese Orte waren ihm, genau wie uns nach stundenlangen Gesprächen mit dem eigenartigen Volk der alten Gaststätten, „rätselhafte Pforten nach anderen Zeiten und Welten; die dem Kenner gefährliche Ausblicke in für das menschliche Hirn fast unvorstellbare Weisheiten ermöglichen“.
Bern gehört sicher zu jenen Städten, die ein sehr reiches Schrifttum über eigene Legenden besitzen. Auch arbeitete ich damals als Bibliotheksassistent an der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern und hatte damit den festen Auftrag, für unsere nächtlichen Abenteuer die nötigen „wissenschaftlichen“ Unterlagen zu beschaffen – ich schaute in verstaubten Chroniken nach und ich trat in Beziehung mit allerlei Volkskundlern.
Meistens erhielten wir aber die von uns benötigten Anregungen unmittelbar aus dem Volke.
Alte Arbeiter und Bauern, Scheren- und Messerschleifer, Nachkommen der letzten Fahrenden (die sich selber mit verhaltenem Stolz als „Zigeuner“ oder „Jännischi Giele“ bezeichneten!) saßen auf einmal neben uns: Wir vernahmen von „Heidenlöchern“, in denen einst die Nomaden überwinterten und ihre Feste feierten, von Schwarzkünstlern, die in Kräuterdämpfen alle Geister erscheinen ließen; über den erst 1931 verstorbenen „Dällebach-Kari“, über den jedermann lachte, „der aber wohl der gescheiteste Gring (Kopf) in Bern war“.
Dichter ohne Namen
„Schade, daß die meisten Leute, die so gut erzählen können“, sagte dann HC immer wieder, „sich selber für ,asoziale‘ Taugenichtse und wertlose Müßiggänger halten und nicht stolz auf sich selber sind.
Leute, die nur den ganzen Tag betriebsam herumlaufen und dabei nie jemandem die geringste Freude bereiten, haben ihnen solches Zeug beigebracht, nur um selber etwas besser dazustehen. Jetzt schämen sich die letzten großen Volksdichter Europas der Tatsache, daß sie so gut sind, halten sich selber für wertlos und sind, wenn sie nicht genug Wein heruntergeschüttet haben, richtig unglücklich. Dabei hör doch genau hin! Nicht nur die Geschichten an sich sind rein wie von Lovecraft oder den größten barocken Dichtern erfunden, jedes Wort ihrer Erzählungen ist richtig gesetzt, ist schön, treffend, bildhaft. Wie beneidenswert glücklich sind sie, daß sie wohl nicht genug in die Schule gingen, um das ausgewetzte, ausgehöhlte, bleiche Schullesebuch-Deutsch zu reden.“
Als später auch für die jungen schweizerischen Künstler die im April 1953 verfaßte „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes“ so viel Bedeutung gewann („… daß man Dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben…“), als vor allem HC’s Versuche in Wiener Volkssprache gerade in Bern eine ganze Bewegung junger Dichter zur „Modern Mundart“, „zur Abkehr vom Schriftdeutschen“ anregten – dachten wir an jene zeitlosen Märchenabende.
Wir erkannten aus Anschauungs-Unterricht: Daß es wieder einmal das namenlose Heer der Dichter ihres eigenen Lebens, der Fahrenden, der Geschichten-Erzähler aus dem Volke, der gegen jede Ordnung ketzernden Trunkenbolde und Außenseiter gewesen war, die halfen, eine neue Richtung der Kunst und des Lebensstils aus der Taufe zu heben.
Aber war es nicht immer so?
Man muß schon sehr verbildet sein, um nicht, wenn wir die größten Werke der Weltdichtung genießen, Homer, Shakespeare, Goethe zum Beispiel, nicht den Hintergrund jener verrufenen Pinten oder Lagerfeuer zu erblicken, von wo deren phantastische Hauptanregungen herkamen.
Vom Happening zum Zeit-Reisen
„Man muß schon ein ausgekochter Esel sein“, rief einmal HC, „wenn man sich darüber den Kopf zerbricht, was von den wunderbaren Dingen, die wir in einer solchen Geschichte hören, überhaupt stimmt.
Gespenstererscheinungen und die Zaubereien von Hexen sind für uns Wunder. Viel wunderbarer finde ich aber das Wunder, daß wir vor dem Hintergrunde einer Bilderbuch-Stadt, den man in keinem noch so barocken Theater nachzubilden vermöchte, zusammensitzen, daß wir Menschen zuhören können, deren Mundart ein einziges gewaltiges Kunstwerk der Dichtung ist, daß wir zumindest im Augenblick alle einander gern haben und an den gleichen Dingen unsere Freude finden.“
An solchen Abenden verzichteten wir darauf, einen zufälligen Gastgeber für ein Riesenfest zu suchen, sondern wanderten mitternächtlich den Orten nach, von denen wir die alten Geschichten sammelten.
„Wein und gemeinsame Freude sind die stärksten Zaubereien“, lehrte HC alle, die mitkommen wollten, und würzte dies mit Hinweisen aus seiner geliebten keltischen Dichtung und aus Lovecraft-Geschichten, „die Schranken von Zeit und Raum werden für unser Bewußtsein durchdringbar und die Vergangenheit wird dann für uns zu einem Bestandteil der Gegenwart und damit der Zukunft.“ (Also sprach so ungefähr HC, wobei ich hier einschieben muß, daß er 1952 möglicherweise noch nicht das seither bei solchen Überlegungen meistbenutzte Wort „Bewußtsein“ gebrauchte, sondern wahrscheinlich „Geist“).
Dann standen wir vor dem von Sagen umgebenen Zeitglocken-Turm oder dem noch allgemein im Volk verrufenen „Gespensterhaus“ an der Junkerngasse 54. Wir blickten von der Münsterplattform auf die Aare oder drangen in die seither teilweise verschwundenen Hinterhöflein des Matten-Quartiers. Wir wanderten durch den finsteren Bremgartenwald zum Glasbrunnen, der angeblich zum Schlosse des noch heute (samt seiner wunderschönen Tochter!) wild herumspukenden „Ritters Nägeli“ gehörte. Wir versuchten die Kreuzwege wiederzufinden, an denen einst „Fahrende Schüler“ alle Mächte der Finsternis beschworen oder forschten am Klösterlistutz und „hinten am Gurten“ nach den Überresten der Hexenhäuslein, die dort gestanden haben sollen.
Die Grenze von Schein und Sein, äußerer Wirklichkeit und Traum gerieten uns auf diese Art und Weise so gründlich durcheinander, wie man es damals, also immerhin etwa 15 Jahre vor dem Bekanntwerden der ersten Erfahrungen mit „psychedelischen Drogen“, eigentlich für unmöglich hielt.
In gewissen, für ihn offenbar sehr wichtigen Fällen besuchte HC die uralten heiligen und unheiligen Plätze nur zusammen mit Esther, da er nun einmal schon damals überzeugt war, daß aus dem Spannungsfeld zwischen Mann und Frau „sozusagen magische Wirkungen hervorzugehen vermögen“.
Zusammen zogen sie zum Beispiel in den Grauholzwald, durch den damals noch keine Autobahn führte. Zwei vorgeschichtliche Steinmale stehen dort einander gegenüber, die das Volk noch heute als das Grab des Riesen Botti bezeichnet, nach dem Berner Dichter Gotthelf des letzten Sprossen der Riesenzeit.
Angeblich hauste der einsame Titane dort zusammen mit der ihm auf der ganzen Welt allein ebenbürtigen Schwester, und es ist verständlich, daß es HC gelüstete, dort an Ort und Stelle „die Liebe der Riesen“ nachzuempfinden.
Ganz allein zog Artmann sogar, in einer unruhigen Vollmondnacht auf den (seither ebenfalls ziemlich verbauten!) Lentulushügel beim Steinhölzliwald. Ein alter General besitzt dort sein Grab und er soll, ebenfalls nach einer schon mehrfach veröffentlichten Volkssage, zur Zwiesprache bereit sein – „wenn ein Würdiger es wagt, ihn aus seinem Schlafe zu wecken“.
Erlebnis wird Literatur
Ein erstes bernisches Büchlein über diese erstaunlichen Schauspiel- und Dichterkeller, die nach 1953 emporblühten, nennt HC, offenbar irgendwelche dem Sinn nach richtige Legenden in Tatsachen ummünzend, geradezu als einen ihrer unmittelbaren Begründer!
Immerhin wurden schon in jenen frühen, hier behandelten Berner Jahren großzügige Pläne für einen „Kultur-Untergrund“ entwickelt: Gut 15 Jahre bevor von den USA her der Begriff „Underground“ bei uns modern werden konnte, brauchten wir also schon ungefähr das gleiche Wort. Ganz einfach weil für Klubbetrieb, Dichterlesung, Kunstausstellungen, Theater, Jazz usw. im „nichtamtlichen“ Stil in Bern damals (und noch immer…) tatsächlich höchstens „unter dem Grund“, also unterirdisch Platz war. Einmal weil vom Krieg her zahlreiche Luftschutzkeller noch unbenützt standen – und dann weil Bern, einst durch „zweihundert Kellerpinten“ berühmt, aus ihrer sagenhaften Vergangenheit mehr wunderschöne Kellergewölbe besaß als jede andere schweizerische Stadt.
Immerhin ist es möglich, daß die von mir erlebte Dichterlesung im Keller, die Esther und HC veranstalteten, die erste jener Hunderte von poetischen „Untergrund-Veranstaltungen“ war, die dann später Bern bei allerlei unruhigem Volk weit über die Landesgrenzen berühmt machten (und von denen viele der „Ruhe und Ordnung“-liebenden Bürger der Stadt bis heute noch nichts gehört haben…).
Auf unterhaltende Art verflochten sich damit bei dieser Veranstaltung die Entwicklungslinien der jungen österreichischen und schweizerischen Kunst, um dann wieder auseinanderzugehen und in den folgenden Jahren ein ganzes Netz unübersehbarer Folgen hervorzubringen.
In den Chroniken der Wiener Künstlergruppen gilt auf jeden Fall dieser Kellerauftritt für eine ebenso wichtige Stufe im Vorgang der Entstehung ihres neuen Selbstbewußtseins, wie er es sicher auch für uns war. Dort wird etwa so zusammengefaßt: „Erster Auslands-Auftritt junger Wiener im Ausland, Bern, 25.7.1952, Rühm führt seinen „Versuch einer Heiterkeit im Luftschutzkeller“ vor, eine Schweizer Schauspielerin und Artmann-Freundin (gemeint ist eben Esther!) liest Arbeiten von Ebner, Okopenko, Artmann…vor.“
Dies alles mag schon heute in Literaturgeschichten seine paar Zeilen ausmachen. Für uns alle ist es unendlich mehr – ein Bestandteil von unserem Wesen.
Sergius Golowin, aus Über H.C. Artmann, herausgegeben von Gerald Bisinger, Suhrkamp Verlag, 1972
H.C. Artmann
Es muß Anfang Dezember 1949 gewesen sein, daß ich Artmann kennenlernte. Ich war Student der Wiener Universität und wohnte in Mödling. Ich traf ihn wie so viele andere, zu denen danach so etwas wie Freundschaft entstand – wie René Altmann, wie Gerhard Fritsch –, in der Redaktion der Neuen Wege am Michaelerplatz. Wir haben uns schon bald darauf unzählige Male gesehen, auch in Mödling, wo er mich regelmäßig besuchte (soweit man bei Artmann ein Wort wie ,regelmäßig‘ überhaupt verwenden darf).
Die Nähe zum Surrealismus, in die wir alle mit unseren dichterischen Versuchen gerieten – H.C. Artmann, der schon viele Schritte weiter war als die meisten von uns, wohl am wenigsten – war es wohl auch, die uns zuweilen den Vorwurf der Metaphernschwelgerei, wenn nicht des Epigonentums eintrug. Ein Beispiel dafür ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Im Sommer 1952 war Artmann mit Esther, seiner großen Liebe jener Jahre, nach Bern gefahren, wo er bei ihren Eltern in einer Siedlung am Rande der Stadt wohnte. Er lud mich ein, nachzukommen, und ich fuhr mit meinem kleinen Puch-Motorrad in die Schweiz. Indes er ein Zimmer im Hause hatte, war für mich ein kleines Zelt im Garten aufgestellt worden, das für die nächsten Wochen mein Obdach darstellte.
Zu den ersten Aktivitäten, die wir in Bern in Angriff nahmen, gehörte die Veranstaltung einer Dichterlesung. Wir wollten eigene Arbeiten vortragen, aber auch Gedichte der Freunde René Altmann, Andreas Okopenko und Hanns Weißenborn zu Gehör bringen. Es gelang uns mit der Hilfe von Schweizer Bekannten – H.C. Artmann hatte hier bereits einige Freundschaften geschlossen, ich erinnere mich an Sergius Golowin und René Simmen (Harry Szeemann und Bernhard Luginbühl lernte ich erst später kennen) – einen Keller an der Kramgasse als Lokal für die Lesung anzumieten und herzurichten, das heißt mit Holzbänken für die Zuhörer und Tisch und Stuhl für den Vorlesenden auszustatten. Dazu muß man bemerken, daß die großzügigen Kellerräume in der Altstadt von Bern alle von der Straße aus über eine breite, oft jedoch steile Treppe zugänglich sind.
Die Vorbereitungen gingen gut voran, wir stellten ein Programm zusammen, das etwa eineinhalb Stunden dauern sollte, und ließen graphisch einfach gestaltete Einladungen drucken. Diese wurden an alle Adressen geschickt, die man uns genannt hatte, und viele trugen wir selber aus. Das war im wesentlichen jedoch meine Aufgabe, ich machte alle möglichen Besuche und klopfte an die verschiedensten Türen. Wenn ich mich richtig erinnere, kamen dann Jean Gebser, Lola Lorme – die erblindete Goldoni-Übersetzerin –, Hans Zbinden und Erwin Heymann zur Lesung, ich besitze noch die eine oder andere Fotografie, die Artmann und mich im Gespräch mit den Honoratioren zeigt.
Besonders wichtig war uns die Präsenz der Presse, denn wir hofften, gute Kritiken zu bekommen und diese dann mit nach Wien nehmen zu können, wo wir sie im Triumph vorzeigen wollten. So suchte ich die verschiedenen Berner Zeitungen auf, ich glaube, es waren damals drei täglich erscheinende Blätter, darunter auch den Berner Bund, der als die konservativste Zeitung galt und in Bern die Bedeutung besaß und besitzt, die der Neuen Zürcher Zeitung für die gesamte Schweiz (wenn nicht für den ganzen deutschsprachigen Raum) zukommt. Ich ging also zu den einzelnen Feuilleton-Redaktionen und sagte mein Sprüchlein auf, wir seien eine Gruppe junger österreichischer Autoren, die sich für die internationale Avantgarde interessierten und zeigen wollten, daß in Wien nicht nur Heurigen- und Operettenseligkeit herrscht, etc.
Der Abend der Lesung kam, und diese wurde zu unserer Freude beifällig aufgenommen. Es gab keine Buhs und keine Pfiffe, aber, so glaube ich mich zu erinnern, ganz respektablen Applaus. Um so gespannter warteten wir auf die Kritiken in den drei Tageszeitungen. Alle berichteten über das Ereignis, meist durchaus wohlwollend, vielleicht auch ein bißchen nichtssagend, jedenfalls sehr viel kürzer, als wir im Stillen erhofft hatten. Es waren nur Einspalter oder knappe Zweispalter herausgekommen. Nur der Berner Bund machte eine Ausnahme. Er räumte uns zwar etwas mehr Platz ein, ging aber mit den vorgetragenen Texten sehr viel kritischer ins Gericht. Einzelne Stellen wurden genauer analysiert – und verworfen. Nein, das sei nun wirklich nicht die wahre Avantgarde, konnten wir da lesen. Das sei vielmehr – bei allem unbestritten guten Willen – doch ziemlich rückständig und vom gegenwärtigen Stand einer als progressiv zu bezeichnenden Poesie meilenweit entfernt. Aber aus Wien sei wahrscheinlich heute nicht mehr zu erwarten. So ungefähr hörte sich das Urteil an, das im konservativen Berner Bund über uns gesprochen wurde. Wir rieben uns die Augen und verstanden die Welt nicht mehr, denn wir bildeten uns ein, unglaublich modern zu sein. Bis wir den Autor unserer Rezension in einer Altstadtkneipe kennenlernten. Es war der Filmkritiker des Berner Bundes, und er hieß Eugen Gomringer. Heute kennt ihn die Welt als den herausragenden Vertreter konkreter Poesie (und als anerkannten Theoretiker der konstruktiven Kunst). Damals kannte ihn nur Bern und nur für seine Filmbesprechungen. Je näher wir ihn kennenlernten, desto besser gefiel er uns. Er schien uns ganz in Ordnung zu sein – auch wenn er unserer Arbeit nicht viel abgewinnen konnte.
Mit H.C. Artmann habe ich in den frühen fünfziger Jahren manche Reise unternommen. Eine führte uns nach Venedig, wo wir in der Jugendherberge auf der Giudecca wohnten, ehe wir nach Verona weiterfuhren. Aus dem Canale di Giudecca hatten wir einen Hundert-Lireschein gefischt, aber der hielt nicht lange. Wir hatten nur Geld gehabt, Fahrkarten bis Verona zu lösen, und überlegten, ob es wohl auffallen würde, das handschriftliche Verona in Genua umzuändern, haben uns dann aber nicht getraut, es zu tun. Artmann fuhr bis Brescia, dort trennten wir uns, mich zog es weiter nach Cremona und Mantua. In Brescia gaben wir eine ,an die Götter‘ adressierte Postkarte auf, deren Sitz wir in der Nähe vermuteten, und rätselten, wem diese wohl zugestellt würde – wir hatten sie jedenfalls ordentlich frankiert.
Eine andere, weitgehend per Autostop zurückgelegte Reise führte mich wenig später allein bis nach Florenz, Pisa und Livorno. Artmann hatte mir bestimmte Tips mit auf den Weg gegeben. Der wichtigste war, in Florenz an einer bestimmten Piazza ein bestimmtes Café aufzusuchen und dort nach dem Salettl zu fragen und sich auf keinen Fall abweisen zu lassen. Dort würden die jungen Florentiner Dichter tagen, ich solle von H.C. Artmann grüßen, sie würden mich dann herzlich aufnehmen. Auch in Florenz wohnte ich in der Jugendherberge – ein Fenster führte den Blick hinaus auf eine Feuermauer, die als Projektionsfläche eines Freilichtkinos diente. Am nächsten Tag machte ich mich auf die Suche nach dem Salettl. Ich fand die beschriebene Piazza, fand dort auch mehrere Cafés, die freilich alle etwas anders hießen, als H.C. gesagt hatte, aber in keinem war ein Salettl bekannt, noch so hartnäckiges Nachfragen half nichts. Es dauerte, bis ich mir meine Niederlage eingestand und resignierte. Das Salettl existierte nicht. Ich war einem Schabernack aufgesessen und „in den April geschickt“ worden, wie man in solchen Fällen zu sagen pflegt. Aber ich hatte, wie mir freilich erst sehr viel später bewußt wurde, durch mein unbeirrtes Suchen sehr viel anderes entdeckt, was mir sonst entgangen wäre. So blieb ich Artmann Dank auch dann schuldig, wenn er in diesem wie in einigen anderen Fällen seinen jungen und wenig erfahrenen Freund auf verkehrte Fährten lockte. Ich habe mehr daraus gelernt als durch manche wohlmeinende Hilfestellung und bin später das eine oder andere Mal seinem Beispiel gefolgt und habe mir den Spaß erlaubt, falsche Ratschläge zu geben.
Eine andere Reise verlief weniger glimpflich, jedenfalls für H.C. Artmann. Wir waren in Ulm verabredet. Das war im Mai 1962. Ich war damals Lektor beim Insel-Verlag in Frankfurt am Main und hatte auch H.C. Artmann für den Verlag gewonnen, zunächst als Góngora-Übersetzer. Das Theater in Ulm wollte die von Ezra Pound bearbeiteten Nō-Spiele, die ich auf Anregung von Eva Hesse übertragen hatte, auf die Bühne bringen, der Chefdramaturg des Hauses, Claus Bremer, hatte sich dafür stark gemacht, Peter Palitzsch sollte Regie führen.
Es wurde ein schöner Abend, die Aufführung fand viel Beifall, wir blieben nachher noch länger beisammen. Thomas Bernhard, Eva Hesse, Horst Bingel und andere Freunde waren dabei. Und natürlich war Artmann gekommen, der mich einst als erster auf Ezra Pound hingewiesen hatte, ehe ich das Werk Pounds im Februar 1952 innerhalb des Austrian Seminar in American Studies in Schloß Leopoldskron in Salzburg eingehender studieren konnte.
Es wurde spät an diesem Abend, und Mitternacht war schon eine Weile vorbei, als sich unsere Wege trennten. Einige, zu denen auch ich gehörte, wollten zu Bett, andere, unter ihnen Artmann, wollten weiterfeiern. Als sie am nächsten Morgen nicht zum Frühstück erschienen, begannen wir uns Sorgen zu machen und ihrem Schicksal nachzuforschen. Stück für Stück erfuhren wir die Wahrheit. Artmann wollte noch einen guten Schluck Bier zu sich nehmen, ehe er schlafen ging. Auf der Suche nach einer Kneipe, die noch offen hatte, hatte man ihn nach Neu-Ulm geschickt. Die Adresse, mit der man ihn ausgestattet hatte, erwies sich als dubios. Ein Nachtklub, dessen Türen fest verschlossen waren. Artmann klopfte. Nichts rührte sich. Er klopfte nochmals, rief lauter. Eine Stimme antwortete. Was ist los? Gute Freunde, rief Artmann, macht auf, wir wollen nur einen Schluck edlen Biers. Nichts da, war die Antwort, Haut ab! Aber so leicht ließ sich H.C. nicht abweisen. Macht doch auf, insistierte er. Da öffnete sich die Tür, starke Arme ergriffen den durstigen Gast und zogen ihn in den Hausflur. Dort wurde er mit Stahlruten und Gummiknüppeln blutig zusammengeschlagen – und wieder auf die Straße geworfen. Von wo die draußen wartenden Freunde ihn eiligst in ein Hospital brachten, wo seine Wunden versorgt wurden, eine mußte genäht werden.
So etwa hörte sich alles am nächsten Morgen an. Wir – Bernhard, Bingel und ich – begannen H.C. zu suchen und klapperten die verschiedenen Krankenhausadressen ab, die man uns gegeben hatte. Bei der zweiten oder dritten wurden wir fündig. Ja, ein Herr Artmann sei hier gewesen, in der Nacht sei er eingeliefert worden, aber er sei heute früh, vielleicht vor einer Stunde, wieder entlassen worden. Wir waren ratlos. Wo sollten wir weitersuchen? Schließlich machte ich mich mit meinem VW auf die Heimfahrt nach Frankfurt, wo ich die romantische Adresse Eiserne Hand 33 hatte. Die ganze Strecke über dachte ich an H.C. Wo mochte er geblieben sein?
Es fällt mir schwer, meine Überraschung zu beschreiben, wo und wie ich ihn wiederfand. Er lag in meinem Bett. Bis heute weiß ich nicht genau, wie er nach Frankfurt, und noch viel weniger, wie er in meine Wohnung gekommen ist. Vielleicht hatte die Hausbesorgerin ihm mit einem Nachschlüssel aufgemacht. Wie auch immer. Er lag in meinem Bett, ein Häufchen Elend, und sah furchtbar aus. Wie Don Quijote am Schluß seines Weges, als er den Helm Mambrins aufsetzen will und verprügelt wird. Und wie Don Quijote mit einer Stimme wie aus dem Grabe spricht, fragte Artmann mich, ob ich bereit sei, einem müden Krieger Quartier zu geben und ihn zu pflegen. Natürlich, keine Frage. Ich war stolz, ihn aufnehmen zu dürfen, wie ich ihm später in Hannover und Berlin Quartier geben durfte. Es dauerte Tage, bis er wieder auf die Beine kam, und noch nach Wochen waren die tiefblauen Flecken unter den Augen zu sehen, die er davongetragen hatte.
Doch noch einmal zurück in die fünfziger Jahre, die Zeit, die uns am intensivsten verbunden hat.
H.C. Artmann wohnte in der Kienmayergasse 43 in Wien-Breitensee. Oft habe ich ihn dort besucht, und oft ist er – allein oder in Begleitung – zu mir nach Mödling hinausgekommen. Für die Rückfahrt erbat er sich meist von mir einen ,Ehrenschilling‘, um die Straßenbahn bezahlen zu können. Wir waren beide stets knapp bei Kasse, er verdiente sein Geld (zumindest die fünfziger Jahre hindurch) durch Gelegenheitsarbeiten und bezog Arbeitslosenhilfe, nahm manchmal auch obskure Jobs an und wirkte als Statist bei einigen Filmen mit, ich schrieb als (schlecht bezahlter) freier Mitarbeiter Kunstkritiken. Für Buchrezensionen bekam ich nichts, durfte aber das besprochene Buch behalten. Doch den ,Ehrenschilling‘ für H.C. Artmann hatte ich immer in der Tasche – das war Ehrensache.
Hier muß ich eine Bemerkung anfügen, damit die Sache mit dem ,Ehrenschilling‘ nicht mißverstanden wird. Artmann war der großzügigste und freigebigste Mensch, der sich denken läßt. Wann immer er über Geld verfügte, lud er seine Freunde ein. Und wenn er wenig hatte, teilte er dies ganz selbstverständlich. Mit der Würde eines Königs bot er meiner Frau und mir Mitte der sechziger Jahre in seiner winzigen Wohnung in der Berliner Kleiststraße aus einer Tasse mit abgebrochenem Griff Kaffee an – die Grandezza, die Generosität, die Herzlichkeit, mit der er das tat, war unübertrefflich und blieb uns beiden – meiner Frau und mir – unvergeßlich. Als heiliger Martin hatte er seinen Mantel in der Mitte auseinandergeschnitten, einen Bedürftigen zu wärmen, als König sein Reich unter den Freunden geteilt, jedem sein Lehen zugewiesen.
Von Mödling aus unternahmen wir viele Wanderungen und Fahrten. – Die weitesten Reisen aber traten wir gemeinsam in dem schmalen Zimmer an, in dem er in der Kienmayergasse hauste. Er schlief in einem Bett, von dem zumindest ein Fuß abgebrochen war, es wurde durch mehrere übereinander geschichtete Ziegelsteine abgestützt. Über diesem Bett hing eine braunstichige Landkarte, ein Kupferstich – oder wohl richtiger: die Reproduktion eines Kupferstichs –, einem Buch aus dem 19. Jahrhundert entnommen. Sie zeigte in allen Details die Reisewege des Don Quijote durch die Mancha. Auf seinem Bett aufgerichtet, hat H.C. Artmann sie mir so genau erklärt, als wären es die eigenen Fahrten, die er einst in dieser Weltgegend unternommen hätte: hier die Windmühlen, dort die berüchtigte Kneipe des treulosen Wirts… Und dann sind wir gemeinsam aufgebrochen, Don Quijote auf seinem Rosinante zu begleiten und ihm in den Gefahren beizustehen, in die er sich so leichtgläubig begab.
Hier, in Breitensee, ist H.C. Artmann vor unvordenklich langer Zeit geboren worden, in der schmalen Stube neben der Schusterwerkstatt des (früh verstorbenen) Vaters ist er aufgewachsen. Als ihn seine Gedichte in der Mundart ,Bradnsees‘ berühmt machten – das war 1958, als die Sammlung Med ana schwoazzn dintn erschien –, brauchte er einen neuen Geburtsort, um sich nicht als Mundart- oder Heimatdichter abstempeln lassen zu müssen. Damals fiel ihm das legendäre „St. Achatz am Walde“ ein, in dem er seither zu Hause war. So stand der Geburtsort fortan fest und wurde in so manche Biographie übernommen. Allein das Geburtsdatum hatte er vergessen – die Angaben schwankten –, so blieb er zeitlebens jung, bis in die Beschwerden des Alters.
Wenn ich an meine Besuche in der Kienmayergasse und an die Begegnung mit den Reisewegen des Don Quijote zurückdenke, wird mir wieder bewußt, in wie hohem Maße bei H.C. Artmann wirkliches und imaginäres Leben ineinandergriffen. H.C. Artmann lebte aus seiner Verbindung zur imaginären Welt – heute würde man vielleicht sagen: zur virtuellen Welt – und bezog von dorther Kraft und Intuition, nicht nur für seine Dichtung, sondern genauso für sein tägliches Leben. Tägliches Leben und Dichtung gingen bei ihm genauso ineinander über wie wirkliche und imaginäre Welt, wie gegenwärtige und längst vergangene Zeit.
Mehrmals durfte ich ihm helfen und an den biographischen Angaben mitbasteln, welche die eine oder andere seiner kleinen Veröffentlichungen begleiten sollten. Solange es – in den fünfziger Jahren – noch keine Buchpublikationen von ihm gab, mußten diese erfunden werden, um seine Lebensdaten abzurunden, wie dies auch die eine oder andere nur in Gedanken unternommene Reise tun mußte (später wurde Artmann tatsächlich ein großer Reisender, den vor allem jene Landstriche anzogen, deren Boden mit historischen Ereignissen und dem Wandel sagenhafter Figuren verbunden war). Einer jener Titel niemals erschienener (und niemals geschriebener) Bücher lautete (um 1954): „Der Oktober ist die Deichsel“, an andere kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Die Husarengeschichten, die Artmann an der Wende zu den sechziger Jahren schrieb, siedelten in jener imaginären Welt edler Ritter, unbesiegbarer Abenteurer und fährtenkundiger Detektive, die ihn immer umgab und die man geradezu physisch spüren konnte, wenn man mit ihm zusammen war.
Schon früh schien mir H.C. Artmann die Eigenschaften eines Adlers zu besitzen – souverän im Fluge, ein König der Lüfte, den die ausgebreiteten Schwingen trugen, wohin immer er wollte. Aber auf dem Boden der Erde sich seltsam staksig-ungelenk bewegend, nur schwerfällig vorankommend. Mit dieser Metapher meinte ich schon bald nach unserer Bekanntschaft etwas von seinem Wesen erfaßt zu haben. Wenn er Gedichte schrieb, wenn er sich im Reich der Poesie bewegte, war Artmann so frei wie nur der Adler im Fluge und konnte unbeschwert von Raum und Zeit überallhin gelangen. Wenn er aber etwas Theoretisch-Essayistisches formulieren sollte, und sei es einen ganz knappen Text, bereitete ihm das ungeheure Schwierigkeiten, und er zögerte nicht (wenn er nicht absagte) Freunde um Hilfe zu bitten, Freunde, von denen er wußte, daß sie seine Gedanken kannten und verstanden. So hat Klaus Reichert später für ihn und ganz in seinem Sinn den schönen Text „Wie ein Gedicht entsteht“ zu Papier gebracht. Das ist ein Stück aus seinem Geist – und stammt doch nicht von seiner Hand.
1953 hatte Artmann die „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes“ verkündet. Sie stellte so etwas wie sein Glaubensbekenntnis dar. Darin heißt es: Man kann Dichter sein, ohne je eine Zeile geschrieben zu haben. Artmann meinte: durch die Haltung, die man in allen Situationen des Lebens bewahrte. Durch den Geist, aus dem heraus man lebt und handelt. Vielleicht auch in dem Sinne, in dem Odysseus ein Dichter war, durch die Fahrten, die er unternahm, ohne davon zu wissen und sich darum zu kümmern, daß ein Homer sie einmal besingen würde.
So glaube ich, daß Artmann schon Dichter war, ehe er die erste Zeile eines Gedichts zu Papier gebracht hatte (das geschah 1945, als er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde). Das Schwierigere ist: nicht nur in der Jugend, sondern ein Leben lang Dichter zu sein. Man kann Dichter sein, hätte Artmann in seinen letzten Monaten resümieren können, auch wenn man nichts mehr schreibt. Auch wenn man 79 Jahre alt ist und 79 oder mehr Bücher geschrieben und zehntausend oder mehr Seiten veröffentlicht hat.
Wieland Schmied, aus Wieland Schmied: Lust am Widerspruch, Radius Verlag, 2008
H.C. ARTMANN
1
Fragen-fraß
1) was ist 1 cannibalus gegen 1 schluckfix im zauberhaften simsalabim, wenn der küchenchef ausgebüchst ist?
2) was ist, wenn eine uhufrau zlawittert vornüber?
3) wann fängt das hanhnebüchen an vor isegrimm heimwärts zu schlittern, und schleckst ihm bereits und wie reagiert drauf das dralleweib?
4) da ist wohl doch noch der Nil ein bissel zu kitten oder Sie, na i!?
6) eh das da will ein wolf sein mit seinen hamsterbacken gahns von alleine wo andersch hi, am bestn zrück ins flegelheim mit nimmtaxi?
7) GanGst Mao Häme ans TeVau-Grät? Die wüssens eh Becherowskaner wie unsereins wasch sich abspült hat in der Weltentrockenschleuder.
2
wartump knast tu sott klosse auen
wömm wöllst erschröcken mit der nösen
mit dämnen schandmaleur des zahlstein
wossu der omma brülle an der brauen
mit a stimm so koalt und grauen
wie ist mir ach die kehle weh
ein piff ein paff en puffer fehl er geh
am hals am ohr samt bart vorbeh
wo bleibst denn mit dei scheren
im hirn uns zu verklären
schau nicht den wein am nachtschrank stehn
gib s pfötchen meinem enkel schön
und dann verzisch dich im
turnschuhsenkelhalsumdrehn
Peter Wawerzinek
Der Mond isst Äpfel… sagt H.C. Artmann. Die H.C. Artmann-Sammlung Knupfer
Clemens Dirmhirn: H.C. Artmann und die Romantik. Diplomarbeit 2013
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
Reportage + Gesellschaft + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Wiener Vorlesung vom 10.5.2022 – Zwei Dichter ihres Lebens: H. C. Artmann und Wolfgang Bauer. Lesung und Diskussion literarischer Schätze:
Daniela Strigl und Erwin Steinhauer. Gestaltung und Moderation: Maximilian Gruber
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


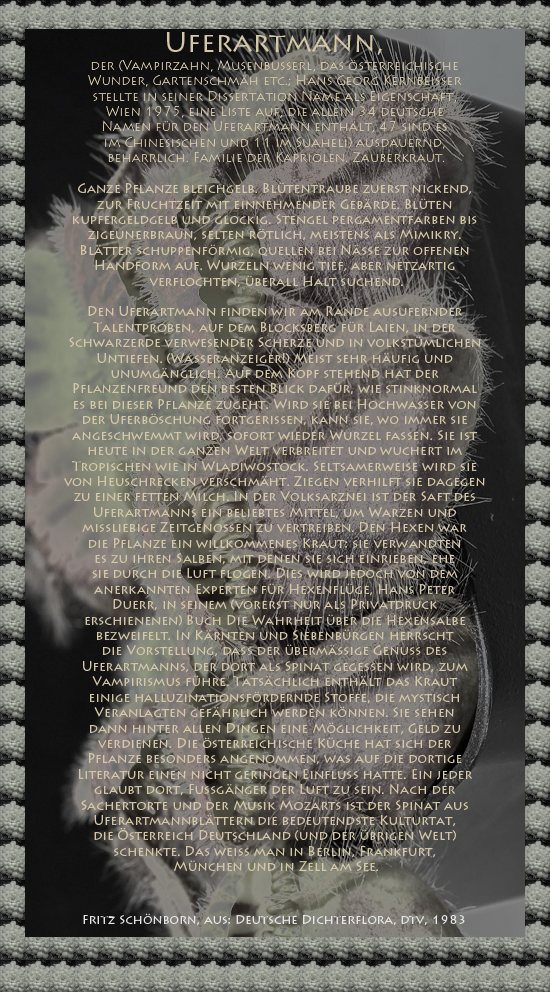












Schreibe einen Kommentar