H.C. Artmann: Das poetische Werk – Aus meiner Botanisiertrommel
wär ich ein kesselflicker,
ich flickte mir das herz
mit blanken kupfergroschen,
zu stillen meinen schmerz.
durch zauberei und sünde
empfing es loch um loch,
ich geh durch wiesengründe,
und lach ich, wein ich doch.
mein trank ist von dem rebstock,
ihn trink ich, wo ich kann,
oh, wär ich gleich ein rehbock
in efeufinstrem tann.
will ich den leib ausruhen,
so fliehet mich der traum,
in ausgedienten schuhen
wach ich am waldessaum.
mit schlummerlosen augen
vergeht mir so die nacht,
sie will zu gar nichts taugen,
die ganze flimmerpracht.
was nützts mir, wenn am himmel
der blanke mond sich zeigt,
wenn er im sterngewimmel
bloß trauerländler geigt.
die andren haben wiesen,
viel äcker, manches rind;
die berge stehn wie riesen,
mein hemd durchpfeift der wind.
der hauswirt sitzt am herde,
genießt die vesper frei,
ich wünscht, ich säß zu pferde
und ritt in die türkei.
Ich betrachte die folgenden texte…
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft.
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?
Auch die konventionelle science-fiction ist meist nichts anderes als in die zukunft projizierte vergangenheit (kenntlich allein schon am imperfektstil), obendrein dominiert der vergangenheitscharakter jedenfalls eindeutig in ihr.
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
Auf die frage, welche von diesen möglichkeiten mir selbst am meisten am herzen liegen, kann ich nur antworten: jene, die in die westliche, in die atlantische richtung weisen, jene abenteuer, die ich bei der lektüre der fragmentarischen altirischen dichtung er-lebte, durch-lebte und noch heute weiter-lebe.
H.C. Artmann, aus: Unter der Bedeckung eines Hutes, Residenz Verlag, 1974
Editorische Notiz
Gegenüber der Erstausgabe ist unsere Ausgabe um vier Gedichte gekürzt und um vier Gedichte ergänzt. Aus der ursprünglichen Sammlung hat der Autor folgende Gedichte gestrichen: „herr artmann kommt auf den vulkan“, „ganz vesteckt in wildem wein“, „um eintracht in worte“, „ein ritter rülpst auf seiner veste“. Eingefügt hinter „er kommt aus london“ sind die drei Gedichte „herr doktor jekyll“, „dunkel die maske“, „herr über messer“. Diese drei Gedichte standen im Erstdruck unter der Überschrift „oh, diese bösen männer im gaslicht“. Eingefügt wurde ferner das für die Jubiläumsnummer der Manuskripte im Jahr 1975 geschriebene Gedicht „alaska und nebraska“. Im Manuskripte-Druck findet sich als Begleittext folgender Auszug aus einer Brief des Autors an den Herausgeber Alfred Kolleritsch: „zu deinem unterricht, lieber f.: das verdichten schöner und erhebender melodien, seien sie nun von strauß und lanner, seien sie kommunisten-, faschisten-, fahrtenlieder oder gar, was häufiger als beiläufiger vorkommt, ouverturen aus der feder eines mendelssohnes, lortzings, wagners, oder verdis, ist mir seit kurzem herzensangelegenheit geworden; ich trällere nunmehr den ganzen tag und summe so vor mich hin, wodurch, wie aus dem täubchenzylinder des zauberkünstlers gefischt, die absonderlichste oden und rhapsodien entstehen. diese bieliegende rhapsodie entstanden nach der hauptmelodie des tonfilms ,flieger, grüß mir die sonne‘ aus dem jahre 1932, und ich widme sie dir in aeronautisch-mestizischer verbundenheit für die jubiläumsnummer der manuskripte im manuskript. H.C.“.
Rainer Verlag und Verlag Klaus G. Renner
Editorische Notiz der Verleger
Die Idee zu einer mehrbändigen, aufgegliederten Ausgabe des damals schon auffällig vielschichtigen poetischen Œuvres von H.C. Artmann in der „Kleinen Reihe“ des Rainer Verlages – naheliegend erschien es damals – entstand 1967. Sie wurde – wie die meisten „Ideen“ von Verlegern – aufgrund dieser und jener Entwicklung (des Autors, seiner ständigen Wohnwechsel, des kleinen Verlages und seiner Probleme) ad acta gelegt, eigentlich aber nie aus dem Gedächtnis entlassen.
1969 erschien die von Gerald Bisinger mit Liebe und Fleiß betreute Sammlung Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire im Suhrkamp Verlag. 1978 auch in Taschenbuchform, die bis dahin vollständigste Zusammenstellung der Gedichte, welche bis heute Gültigkeit und Wirksamkeit erlangt hat.
Viele Jahre später, im Herbst 1991 also – was im Durcheinander der Frankfurter Buchmesse nicht möglich – nämlich bei einem Besuch der Renners bei Rainers im ungarischen Fünfkirchen, gerät diese „Idee“ wieder ins Blickfeld: ein mehrbändiges Werk, verteilt auf zwei Schultern.
Salzburg, Wohnort des H.C., liegt zwischen Fünfkirchen und München, zwischen Rainer und Renner. H.C. gibt also wenige Tage später sein Placet, bekundet Wohlwollen, avisiert gar seine Mitwirkung. Auch Klaus Reichert in Frankfurt am Main – nobilder und aufrechter Herausgeber vieler Werke H.C.s – wird sofort gewonnen.
1992 – Klaus Reichert hat seine nicht mühelose Arbeit angefangen, fortgeführt und mit H.C. abgestimmt – die, von den Verlegern übernommen, die Bandzahl der Gesamtausgabe auf zehn Stück (ursprünglich acht) ausgeweitet bzw. begrenzt. Die redaktionelle Arbeit des Herausgebers und des Autors ist vorläufig abgeschlossen.
Im Sommer 1993 beginnen Pretzell und Renner unter Nutzung der typographischen Vielfalt einer 1992 erworbenen leistungsfähigen Photosatz-Maschine die Ausführung der ersten Bände.
Frühjahr 1994 – Beendigung der Satzarbeiten. Die Drucklegung kann beginnen…
Klaus G. Renner und Rainer Pretzell, Nachwort
Lyrischer Uebermut
Es gab Jahre, in denen H.C. Artmann seine Leser mit dem, was er sozusagen Schlag auf Schlag publizierte, nicht aus den Ueberraschungen kommen liess. Man folgte seinen Eskapaden und Scharaden gern, seinem literarischen, lyrischen Uebermut, seinen verbalen Maskeraden. So ist es bis heute geblieben, wenn auch die rasche Abfolge der Bücher ausblieb. Nun hat sich Artmann ganz in seiner Manier wiedergemeldet, schön manieriert bis in die Titelgebung. Ich meine seine Balladen und Naturgedichte, die er Aus meiner Botanisiertrommel nennt. Trommeln gehört auch bei ihm zum Handwerk, und er besorgt dies nachhaltig in einem Band, den er selber ein Hausbuch nennt. Es ist alles auf einmal: ein Feld-, Wald- und Wiesenbuch, das ebensogut draussen lesbar ist wie in der Stube, ein Buch der grünen, wuchernden Phantasie. Es wird wieder gereimt, die Phantasie wird auf den Reim getrimmt.
„Einen kränz aus butterblumen / winde ich dir um das haupt“, so beginnt es, unumwunden wird weiter gereimt, Allotria getrieben, wird bei Rotwein und Legenden so gut gespielt wie mit der Mythologie. Alles steht bei Artmann zur Verfügung, wenn er will. Von einem gewissen Augenblick an lässt es sich überall einrichten und ausrichten: Dichten und Trachten als der bekannte Uebermut, der ansteckt. Artmann hat eine Natur-Girlande für lustige und bereife Leser und Mitspieler, Mitdichter um seine Sammlung gelegt. Und er dichtet unaufhaltsam, spöttisch und genau in der höheren Nachahmung:
Nach Italiens feigenhängen
möchtest ziehen du mit mir,
lauschen südlichen gesängen
wie ein nördlich fabeltier?
ach, geliebte, ich verspreche
alles, was dein herze heischt,
lasse becher, wirt und zeche,
wenn dein wandervogel kreischt.
Man sieht, hier wird kein Feigenblatt vor den Dichtermund genommen. Hier wird überhaupt kein Blatt vor dem Mund zugelassen. Denn geboten wird alles und nichts an Ausgelassenheit:
biete dir ein klangerleben,
blas respighi dir ins ohr,
süsses zartes lusterbeben
an dem brunnen vor dem tor.
Die schöne Taugenichts-Poesie des H.C. Artmann feiert in solchen Zeilen ihre Triumphe, und die „Pinien von Rom“ oder auch nur die römischen Fontänen à la Ottorino Respighi werden es mit Vergnügen durchstehen.
Ein Gedichtband zum Aufsagen wie in einem phantastischen Kunst-Verein, ein „duschelied der neuen nachtigall“, der inzwischen schon etwas älter gewordenen, doch unbändigen österreichischen Nachtigall, die mit Tinten in allen Farben schreibt, ein Tier also, das es nicht gibt, das aber die falschen Vergleiche, die verrutschten Metaphern mit Inbrunst aus seiner Singvogelbrust entlässt. Des Autors lyrische Botanisiertrommel ist etwas für Anhänger des schieren und des durchwachsenen literarischen Vergnügens. Gewiss nutzt sich eine derartige Insektenbelustigung ab. Doch ehe es dazu kommt, klappt Artmann sein Hausbuch zu. Monotonie (die man ahnt) ist gewiss nicht seine Sache. Er belässt uns nur sechsundneunzig Seiten unter der Reim- und Anmutsdusche. Das ist tatsächlich genug, für diesmal, wie ich gleich hinzufügen möchte, in der Hoffnung, dass H.C. Artmann inzwischen schon wieder sein Kostüm gewechselt hat, wenn ich ihn mir eigentlich auch weiterhin so vertraut mit Tritonen und Feen, Anarchisten und anderen Melancholikern wünsche. Aber Artmann ist unseren Wünschen voraus.
Artmann ist schon weiter, Konfetti und Gedichte (oder Prosa?) in den Taschen, österreichisch tolldreist und so überlegen wie denkbar. Er treibt sein Spiel weiter, und ihm und uns wird dabei mitgespielt. So verstehe ich jedenfalls auch das literarische Spiel des H.C. Artmann. Und wenn er auch Konfetti nicht erfunden hat, so weiss er es doch zu verstreuen: ein Dichter für den Corso, der auf eine Wiese oder in irgendeinem freundlich-listigem Gedränge endet:
das hat ein ara gesungen,
rebellischer papagei,
sein buntes lied der arbeit
macht alle menschen frei.
Bunt und beziehungsvoll und traurig und politisch geht es überall zu. Man muss auf die Wörter achten. Sie sind leicht, aber sie besagen etwas bei ihm, mehr als manchem lieb ist, vermute ich.
Der Schrecken ist nicht weit vom Getändel. So will es der Lyriker, und ehe dies alles schrecklich gefährlich oder schrecklich langweilig zu werden droht, ist das Lied aus, hat es sich ausgereimt:
Es fällt aus alten briefen
so manches gilbe wort,
das trägt die graue amsel
in blaue morgen fort.
Man wird von diesen schaurig-schönen und empfindlichen und reichlich wahrhaftigen Balladen fortgerissen, bis zum Schluss: „ich säe dunkle lettern / aus hellem äroplan.“ – „Alles was man sich vornimmt, wird anders als man sich’s erhofft“, hat der Autor einmal von seinem Tun gesagt. Bei ihm gibt es jedenfalls keinen Unterschied zwischen Trivialität und Kunstverstand: alles bleibt bei ihm schön verfügbar. Das Leichte wird beklemmend, aber man kommt nicht dazu, die Beklemmung einzugestehen, weil man viruos unterhalten wird.
Karl Krolow, Die Tat, 14.11.1975
Weitere Beiträge (zur Erstausgabe)
Rolf Michaelis: Ein Balladen-Jahr. Neue Gedichte von Hans Magnus Enzensberger, F.C. Delius, Helga M. Novak, H.C. Artmann
Die Zeit, 10.10.1975
Jörg Drews: ,… tauchte forsch die Feder drein‘. Aus H.C. Artmanns Botanisiertrommel
Süddeutsche Zeitung, 8.10.1975
Inge Meidinger-Geise: H.C. Artmann. Aus meiner Botanisiertrommel
Literatur und Kritik, Heft 111, 1977
Beiträge zur Gesamtausgabe: Das poetische Werk
Fitzgerald Kusz: Kuppler und Zuhälter der Worte
Die Weltwoche, 18.8.1994
Andreas Breitenstein: Die Vergrößerung des Sternenhimmels
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1994
Thomas Rothschild: Die Schönheit liegt in der Abwesenheit von Nützlichkeit
Badische Zeitung, 15.10.1994
Franz Schuh: Weltmeister jedweder Magie
Die Zeit, 2.12.1994
Albrecht Kloepfer: Hänschen soll Goethe werden
Der Tagesspiegel, 25./26.12.1994
Karl Riha: Wer dichten kann, ist dichtersmann
Frankfurter Rundschau, 6.1.1995
Christina Weiss: worte treiben unzucht miteinander
Die Woche, 3.2.1995
Dorothea Baumer: Großer Verwandler
Süddeutsche Zeitung, 27./28.5.1995
Armin M.M. Huttenlocher: Narr am Hofe des Geistes
Der Freitag, 25.8.1995
Jochen Jung: Das Losungswort
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1995
Der eigentliche poetische Akt ist das Leben
− Fragmentische Anmerkungen. −
H.C., der Sir, der König, der Gaukler, der Maskenspieler, das Kind, das sich Geburtsort und Namen erfand, ganz ohne jene Attitüde, mit der etwa A. Lernet Holenia seine Abstammung aus tiefem Kinderleid korrigieren wollte, St. Achatz am Walde, das Hans Weigel angeblich im Telefonbuch gesucht hat und dessen Erfindung einen niederösterreichischen Kulturbeamten so sehr vergrämte, daß er sich gegen die Vergabe des Würdigungspreises an H.C. aussprach, H.C., alias hans karl bonislavius artmann, Kaptain John Adderly Bancroft, alias Lord Lister, alias Davis Blennhast oder Mortimer Grizzleyword de Vere; H.C., der Freund, der Ruhelose, der Neugierige, der Ruhelose aus Neugier und der Neugierige aus Lebenshunger, der bürgerliche Antibürger, das Sprachgenie, der seinen Schreibschülern in der Schule für Dichtung Grammatiken als Materialbuch für ihre Versuche anbot, der med ana schwoazzn dintn geschrieben und damit eine genialische Entnazifizierung der Sprache in Gang gesetzt hat, die auch eine breite Öffentlichkeit erreichte, der Kriegsteilnehmer, für den über den Krieg zu schreiben unanständig war, und der wohl deshalb sein „Manifest“ schrieb
wir protestieren mit allem nachdruck
gegen das makabre kasperltheater
welches bei wiedereinführung einer
wie auch immer geartete wehrmacht
auf österreichischem boden
zur aufführung gelangen würde…
wir alle haben noch genug
vom letzten mal −
diesmal sei es ohne uns!!…
H.C., bereits frühe Legende im Freundeskreis und später in der Öffentlichkeit, H.C. das Gesamtkunstwerk, der Magier und magische Dichter, eine Rarität, ein Unikum, einer, der in einer Art Vor-Wort zu The best of H.C. Artmann schreibt:
meine heimat ist Österreich, mein Vaterland Europa, mein wohnort Malmö, meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden, meine laune launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, mein anliegen sprunghaft, meine sehnsüchte wie die Windrose, im handumdrehen zufrieden, in handumdrehen verdrossen, ein freund der fröhlichkeit, im grunde traurig, den mädchen gewogen, ein großer kinogeher, ein liebhaber des twist, ein übler schwimmer, … beim kartenspielen unachtsam, im schach eine null, … im krieg zerschossen, im frieden zerhaut, ein hasser der Polizei, ein verächter der obrigkeit, ein brechmittel der linken, ein juckpulver der rechten,…
H.C. – ein bewegliches Gesicht, die Augen ohne Schalk und in keiner Ideologie zu Hause, kein unpolitischer Mensch, aber nicht einzuordnen, möchte man fortsetzen, ein Europäer aus Ruhelosigkeit, Überzeugung, Sprachkenntnis, Literaturkenntnis, Reiselust und Mißtrauen gegen Grenzen.
Die Latte liegt hoch, wenn man über ihn und von ihm sprechen will. In seiner Selbstbeschreibung und in der Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes hat er alles zusammengefaßt, was es über ihn und sein Schreiben zu sagen gäbe, ließe sich die Frage nach der Identität zwischen Autor und Werk, die im Normalfall eine Illusion ist, völlig klären. Immerhin läßt sich eines ablesen: H.C. fordert etwas ein, das sich jeder wissenschaftlichen Bearbeitung entzieht: Freundschaft, Courage, Lebenslust, Spielfreude und seine Art von Wahrhaftigkeit, die der Lust nicht im Weg steht.
Spurensuche. In welcher Zeit soll man ihn ansiedeln? Seine Liebe zur Barockdichtung ist legendär. Der Reichtum an Formen, die Üppigkeit, das Sinnliche daran habe ihm gefallen. Das ist gut nachzuvollziehen. Auch, daß einer, der schreibt, sich seine Vorbilder, sein Spielmaterial aus einem anderen Jahrhundert holen mag, als aus dem, in das er hineingefallen ist, aus einem, das unschuldiger erscheint, weniger brutal, weniger mechanistisch, weniger redoktionistisch als das miterlebte, mag einiges für sich haben. Aber da ist noch etwas anderes. Es sind Begriffe, Wendungen, die nicht nur eine zeitliche Entfernung signalisieren, sondern auch ein Vorüber, Vorbei einer gewesenen und nun nicht mehr geltenden Gültigkeit. In dem Essay „Ein Gedicht und sein Autor“, eine Art Erklärung zu Landschaften 8, eher ein Zeigen denn eine Erklärung, erzählt H.C. über das Buch Iter Lapponicum von Carl von Linné, einem wissenschaftlichen Bericht. „Er ist in der Bibliothek zu Stockholm zu sehen“, steht in Klammer. „Zu Stockholm“, das klingt vornehm, rührend behutsam, fast ehrfürchtig, ohne manieriert zu wirken. In der Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes tauchen Formulierungen wie „Act des Herzens“, „heidnische Bescheidenheit“, „heitere Demut“ und „Lauterkeit“ auf, Wörter, die wir nicht mehr oder kaum noch verwenden.
Es ist eine Sprache, die sich der des Dritten Reiches und auch der Zeit davor wie danach radikal zu entwinden versucht und es ist eine Sprache, die nach einer synchronen Haltung verlang. Der Spieler spielt ernsthaft, die erfundenen Identitäten bedeuten auf Zeit die eigene Identität, in einem Prozeß zwischen so und anders, als eine permanente Anverwandlung und Verwandlung. Der Magier lebt auf, nicht der TaschenspieIer. An Gerald Bisinger schreibt er:
Ich finde es so wichtig, dies auch alles aus der magischen warte zu betrachten, die ja schließlich & endl. die meine ist.
Peter Pabisch interpretiert das Bekenntnis zum Magischen in seiner Arbeit „Das Alogische im literarischen Werk von Hans Artmann“ als ein Bekenntnis zum Irrationalen. Genauso gut kann man es als ein Bekenntnis zum Unausgesprochenen, Unaussprechbaren und zu dessen unaufgedecktem Wirken auffassen, als Verbundenheit mit allen und allem, als die erlittene Antithese zum erlebten Krieg, über den zu sprechen eben unanständig ist. Als wäre er, H.C., viele, die in ihm schlummerten und die in einem poetischen Akt, einem Gedicht, einem Text, Theaterstück oder einer Erzählung hervortreten könnten, nicht als Erfindung, sondern als das, was da war, lang vor dem eigenen Eintreten in die Welt oder auch lang danach sein könnte.
Der Rückgriff auf das Barock, auf Wendungen und Wörter mutet wie der Besuch einer Epoche von größter Kindlichkeit und größerer Herzensunschuld an. Barock auch als Metapher für Verlorenes. H.C., das Kind, das Kinderbücher schreibt, z.B. Allerlei Rausch, ganz einem magischen Denken verhaftet. Aber diese Augen. Man muß sie ernst nehmen, denn sie blicken auf den Bildern immerzu ernst. Pose? Wenn ja, dann so, wie sie im poetischen Akt, Punkt 5 beschrieben wird. „Der poetische Akt ist die Pose in ihrer edelsten Form frei von jeder Eitelkeit und voll heiterer Demut“.
Alles ist Spiel, gewiß. „Beim hl. Nepomuk, wir banden uns larven vor die augen, die hatten nasen, deren beträchtlichkeit alles dagewesene übertrafen, rosarot, sammer außen, seide innen, schwartz beflort…“ beginnt der aeronautische Sindbart. Aus dem absichtlosen Spiel entsteht irgend etwas: ein Gedicht, Freundschaft, Wahrnehmung und Festhalten, eine verdrehte Welt, die in der Drehung als die eigentlichere erscheint, die lebendiger, menschenfreundlicher und damit menschengerechter ist.
Abichtslosigkeit scheint ein Schlüsselwort zu sein, auch wenn man sagen muß, daß die forcierte Absichtslosigkeit schon wieder Absicht bedeutet. Es geht gegen den Zwang, Absichten – und dies nach vorformuliertem Anspruch – verfolgen zu müssen. Und darum darf der poetische Akt, Punkt 3, „nur durch Zufall der Öffentlichkeit überliefert werden. Das jedoch ist in hundert Fällen ein einziges Mal. Er darf aus Rücksicht auf seine Schönheit und Lauterkeit erst gar nicht in der Absicht geschehen, publik zu werden, denn er ist ein Akt des Herzens und der heidnischen Bescheidenheit.“
Das zweite Schlüsselwort lautet Hingabe. Der Spieler spielt mit Hingabe. Nicht Karten, wie er feststellt, da ist er unachtsam. Kartenspiel ist das Spiel der Erwachsenen, nicht das der kindlichen Unschuld.
Ja, aber die Augen. Sie sehen so vieles, haben so viel gesehen. Und dieses phänomenale Gedächtnis vergißt nichts. „… im grunde traurig“, steht da, gleich nach „ein freund der fröhlichkeit“.
„Das Wort Parfümerie hat für mich die Farbe lila. So mehr heller Flieder“, sagte er einmal. Das war in Neuberg, während einer Woche Schule für Dichtung, wo der Unterricht im Gasthaus außerhalb der sogenannten Klassenzimmer weiterging. „Für mich haben Wörter Gerüche und Farben“. Er hielt ein etwas abgegriffenes Buch in der Hand, einen Sprachführer, wie er für Touristen zusammengestellt wird, die sich in einem Sprachraum bewegen, der ihnen fremd ist. Es war ein altes Modell sozusagen, mit mehr Grammatik als heutzutage üblich ist. Aus den Sätzen wie „was kostet das“, Fragen nach der Zeit, nach Ein- und Zweibettzimmern, nach Menüs, und: „Wie geht es ihnen?“, aus Deklinationen und Konjugationen entstand so nebenbei, wie es schien, ein Gedicht, ich glaube nicht, daß er es aufgeschrieben hat. Vielleicht hat es der oder die eine aus seiner Klasse gemacht. Es war ernst gemeint, mit Begeisterung gezeigt, voll Hingabe. Schaut, was man mit so einfachen Dingen machen kann. Wenn man so will, war die Woche in Neuberg gleichzeitig ein Tauchlehrgang.
in die tiefe seines bauches
nach wörteralgen taucht der dichter
am weißen strand des papieres
spreitet er sie zum trocknen aus,
es wird gebeten das seegras nicht
vor seiner zeit zu wenden danke
Das wollte er vermitteln und zeigen. Spreiten – das Wort erhebt sich zum Bild. Man sieht das Geflecht von Seegras und Algen ausgebreitet, aufgelockert … was solls. Spreiten ist besser und sagt alles. Und der Titel des Buches, in dem dieses Gedicht das erste ist, spricht ebenso klar. von der wollust des dichters in worte gefaßt von H. C. Artmann.
In Worte fassen läßt sich wenig von dem, was in der Tiefe des Bauches nistet und die Wollust des Dichtens ausmacht. Wörteralgen, verschlungen, im Einzelnen immer nur ein Fragment. Danach zu tauchen zeigt, was man tun kann und was nicht: Es werden keine geordneten Perlenreihen von Sätze, schnurgerade aufgefädelt und der Logik einer erlernten Grammatik gehorchend an den Strand des Papiers gespült werden, sondern Verknotungen, Geflechte, die behutsam auszubreiten sind und sich dennoch nicht völlig entwirren lassen werden. Es wird gebeten, das Seegras nicht vor seiner Zeit zu wenden – danke.
In Worte zu fassen, was H.C. Artmanns Dichtung ausmacht, bedeutet, sagt, wie sie winkt, woher sie kommt, läßt sich noch weniger. Alles Interpretation. Anekdoten sind leichter auszutauschen. Da ist der Spaßmacher, der Clown ohne Maske, dessen Einsamkeiten sich nicht einmal ahnen lassen. Die Anekdoten gehen fehl und treffen gleichzeitig. „Der eigentliche poetische Akt ist das Leben“, sagte H.C. Artmann einmal in einem Interview und das macht es unmöglich, nicht an die Person zu denken, wenn man an das Werk herangeht. Diese Erinnerung ist Schlüssel, der öffnet und gleichzeitig den Zugang versperrt. In den Salzburger Nachrichten war zu lesen, daß H.C.s Dichtung in Zukunft nun für sich allein stehen müsse, also ohne den Beistand des Magiers. Werner Thuswaldner hat recht. Es geht um eine Entmythologisierung, und das Werk wird ihr standhalten, vielleicht erst dann besser verstanden sein. Wir aber werden noch eine Weile brauchen, die Texte zu lesen, ohne gleichzeitig die Person zu denken, H.C. hinter uns zu lassen. Das ist gut so. Denn wir brauchen beides, wir hatten ihn als Menschen so nötig wie die literarische Nachkriegsszene einen Dichter wie ihn nötig hatte, mit seinem Witz, seiner Phantasie, seinen Kopfständen, dem Unernst gegen den aufgesetzten Ernst.
„Der eigentliche poetische Akt ist das Leben“, lang nach der Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes gesprochen, ist eine tiefe Verbeugung vor dem Leben, ein in Ehrfurcht sich Neigen, die Antwort des Kriegsteilnehmers, des Schamanen, wie man ihn nennt, auf die vielfältigen Angriffe, denen das Leben ausgesetzt war und ist, die Hochachtung und Wertschätzung alles Lebendingen, in dem nichts gering gilt. Es war die Antwort des Magiers, der manchmal tatsächlich zaubern konnte.
In den frühen Fünfzigerjahren galten für den Aufsatz noch strenge Korrekturvorschriften. Nicht allein Rechtschreibung und Beistrichsetzung waren zu beachten, sondern auch die richtige Wortwahl. Und die richtige Wortwahl bedeutete, daß Dialektausdrücke verboten waren. Dialekt, das war ein schwerer Fehler, gleichgültig, wie sehr diese Wörter der Empfindung und Befindlichkeit des oder der Schreibenden entsprachen. Acht Fehler bedeutet Nichtgenügend, acht Fehler waren schnell beisammen. – Wie übersetzt man schleich di authentisch ins Hochdeutsch? – Kein Lehrer konnte sich dem widersetzen. Die korrekte Sprache, die political correctness des Deutschen Aufsatzes mußte gewahrt werden zusammen mit dem, was man heute schwarze Pädagogik nennt. Und dann kam med ana schwoazzn dintn heraus. Und plötzlich gab es Spielraum für die Anerkennung solch falscher, eben doch richtiger Ausdrücke, lang bevor es zu einer offiziellen Änderung der Korrekturvorschriften kam. Ganze Klassen von sogenannten B-Zug Schülern wußten nicht, wen sie es zu danken hatten. Dieses Buch war ein Teil der Entnazifizierung der Sprache, setzte einen Diskurs in Gang, der noch nicht als solcher erkannt war, aber weiterlief.
Ich erzählte H.C. von jenem Lehrer, der im 20. Wiener Gemeindebezirk in der Greiseneckergasse unterrichtet hat und für den H.C. Artmanns Dichtung zum Argument gegen Fachinspektoren wurde, um „seine“ Buben zu schützen. „Na geh“, sagt H.C.
Bleibt noch Punkt 8 der Proklamation:
Der vollzogene poetische Akt, in unserer Erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen Reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.
Und jenes Gedicht aus der „Grammatik der Rosen“.
ich lege ein wenig ermüdet mein binokel auf die holzbraune fläche meines fensterbrettes und sage euch als freund adieu, wer weiß, ob ihr mich verstehen könnt, aber es wäre schön, ihr tätet es … adieu!
Wer weiß, ob wir ihn verstehen, in dieser letzten Einsamkeit.
Marianne Gruber, manuskripte, Heft 153, 2001
Artmann II
Artmann stammt aus einem urbanen Vorkriegsmilieu, in dem noch Volkssänger das Kleinbürgertum der suburb unterhielten – einer Zeit „ohne audiovisuelle erfahrung“ (gedichte von der wollust des dichtens…, 1989); es handelt sich um eine Suburb-Neighbourhood, geprägt von polylingualen Soundmixturen, wie seine Experimente beispielsweise mit dem tschechischen Immigranten-Dialekt, der dem Dichter vertraut war, zeigen. So ist die außergewöhnliche Sprach-Musikalität Artmanns für mich nicht überraschend, auch nicht, daß der Dichter den Kitsch des Wienerlieds in seinen Arbeiten immer wieder aufgreift und ironisiert. Auf die Spitze getrieben erscheint das Thema Wienerlied in den formal höchst konventionellen 70er-Jahre-Gedichten der Botanisiertrommel, wo es in schönster Alogik über „des wieners mütterlein“, und diesmal expressis verbis, heißt:
stets der braten ihr gelingt
weil sie wiener lieder singt.
In den späten Artmann-Gedichten, den alphabetisch sortierten gedichten von der wollust des dichtens in worte gefaßt, dem großartigen Spätwerk, ist Wien zweimal Thema und beide Male ist in sparsamen Versen die Stadt mit musikalischen Erinnerungen verbunden, beide Male tauchen (nostalgische) Musikinstrumente bzw. Instrumententeile auf. In „wien alt“, das mit einem poetischen Versatzstück („die schwalben jubilieren“) beginnt, und „im / oft besungenen wienerwald“ endet, gibt „ein goldenes klavierpedal“, das sich von dort bis dort erstreckt, ein überraschendes und schönes Bild für Außen-Räumlichkeit ab. Ich glaube, die Vermutung stimmt, wenn der Zeitendurchtaucher Artmann bei „klavierpedal“ an populäre Liedbegleitung – nicht an das Geschlossene, nicht an den Konzertsaal! – denkt; das Klavier, ein ortsgebundenes Trumm, hatte die traditionelle, mobilere Harfe um 1850 bei den Volkssängern und Volkssängerinnen abgelöst. „wien ost“, als Memoria-Instrument, gibt für Artmann eine „schattenmelodie“ ab; und allein durch die Nennung der fast isoliert dastehenden, in die vorletzte Zeile implantierten altmodischen „ziehharmonika“ und die abschließende, auf Geistes-Gegenwärtigkeit zielende, ironische – nicht nostalgische! – Frage („wie soll ich dich aktuell deuten?“) findet eine Zeit(en)-Vereinigung statt. Oder wird eine Zeit(en)-Diskrepanz festgestellt. In beiden Gedichten klingt das Verklungene mit; das Nichtsichtbare, oder das zunächst nicht Sichtbare, kann ja grundsätzlich im Gedicht seine Rolle spielen. So auch hier: die Ziehharmonika, der atmende Balg, wird vielleicht gerade gespielt und damit live gehört, vielleicht wird (an) ihr Spiel erinnert; das glänzende Klavierteil, an sich stumm und zur Klang- und Lautregelung, zur Soundsteuerung dienend, ist überhaupt nur zu sehen.
Ähnliches ist an dem jugendstilig-surrealistischen, der letztlich barocken Bilderabfolge des frühen Artmannschen „interior“-Gedichts zu beobachten, in dessen zeitlupenmäßig erfolgenden, überraschenden und irritierenden Metaphern-Überblendungen aus dem inszenierten Innen-Drin der Memoria gearbeitet wird (oder werden könnte); wo – wichtiger noch, da programmatisch aus dem guten alten Vorstellungsvermögen gearbeitet wird. Oder sagen wir: aus der inszenierten Wahrnehmung des Dichters wird das Wahrnehmungsinstrument Gedicht aufgerufen und hervorgebracht. So entsteht, wie Reinhard Priessnitz es für Artmann formuliert hat, „fiktive stellungnahme zur wirklichkeit“. Was erweiterbar wäre: wenn ich die Installation des Dichters – sein Rollen-Bewußtsein – gleichfalls als eine solche begreife.
Nachsatz:
Als ich aus Österreich zurückkam nach Düsseldorf trug ich über meinem schwarzgelben Wespenpullover Trachtenacke – obligatorisch war 1980 auf der Szene (Ratinger Hof) naturgemäß Leder. Dazu verwandte ich wienerische Spracheinfärbung. Zur Schau. Das reichte.
Thomas Kling, aus Thomas Kling: Botenstoffe, DuMont Verlag, 2001
Die vielfältigen Sprachmasken und
eigenwilligen Textsorten bei H.C. Artmann
ich bin am rhein geboren,
mein nam ist madigan.
ich säe dunkle lettern
aus hellem äroplan..
(Artmann 1993: 98)
I.
Was im ersten Anprall der Begegnung mit H.C. Artmanns Texten verwirren mag, ist ihre Vielfältigkeit und augenscheinliche Bezugslosigkeit zu Welt und Geschichte. Sowohl in dem, was sich traditionell als Beziehung zwischen Autor und poetischem Ich oder zwischen Autor und Erzähler versteht, wie auch darin, was die Standardgenres Lyrik/Prosa/Drama erwarten lassen, bietet sein Werk eigenartige Idiosynkrasien. Artmann verfügt über die Register seiner Kunst: „wer dichten kann, / ist dichtersmann“ – und doch eignet ihm weder ein typischer Stil noch eine lebenslang betreute Figur, wie sie etwa für J.W. Goethe dessen Faust, Wilhelm Meister oder Mignon vorstellen. Bei strengerer Analyse seiner Texte merkt man jedoch, wie dieser einmalige poetische Autor seine Zeit durchschaut und durchwirkt hat, wobei die auffallendste Figur bei Artmann er selbst ist, der an Textstellen immer wieder durch die Zeilen lugt, wie Baumeister Pilgram unter der Kanzel des Wiener Stefansdoms als Steinbüste aus dem Fenster schaut: „herr artmann kommt auf den vulkan“, „artmann an germania“, „meister artmann frauenlob“, um aus dem oben genannten Band der mittleren Periode seines Gesamtschaffens zu zitieren (Aus meiner Botanisiertrommel, Band 8 der Lyriksammlung Das poetische Werk). Wenn er sich nicht nennt, aber ein „Ich“ erwähnt, kann man gegebenenfalls vermuten, dass Poet und gewählte Figur identisch sind, zumindest aber Verbindendes in sich tragen, wie in einer Strophe eines anderen Gedichts dieses Bandes, „eine wäscherin von gamaschen“:
ich bin ein weiberjäger,
durchweibere die welt,
ob jungfrau, gattin, witwe,
ich lieb, was mir verfällt!
(1993: 53)
Die meisten „Ich“-Figuren stellen somit Rollen vor und in gewisser Weise Masken, wobei selten festzustellen ist, wer diese Maske trägt – der Poet selbst oder eine von ihm gestaltete Figur mit Maske. Die Maskenwelt des H.C. Artmann ist so reichhaltig wie eine Texte und deren Sorten, als typische Vertreter der drei literarischen Urgenres oder als deren Mischformen, ja zuweilen aus eigenwilliger Neugestaltung durch den Autor. Es stempelt ihn zu einem prototypischen Vertreter der Moderne in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie es selten einen gegeben hat; das soll hier exemplarisch kurze Betrachtung finden.
II.
Das zu Anfang zitierte Motto zeigt, wie sehr Artmanns Dichtung, seine „Poetik der Rosen“ etwa, dem von Jacques Derrida theoretisch erdachten Dekonstruktivismus geradezu ideal entspricht. Nichts gelangt in seiner modernen Auffassung dem Traditionellen gegenüber unverändert in die Gegenwart des Autors – und doch ist in seinem Gesamtwerk die Tradition zwar überkommen, doch niemals zu leugnen. Die Moderne bedeutet im Sinne Derridas keine simple Absage an das Hergebrachte, sondern ein auf Grund der innovativen Gegebenheiten erstelltes Amalgam eines entsprechend umwertenden, kreativen Prozesses. Hinter allen Masken und Texten Artmanns – den altertümlichen und barocken ebenso wie den modern skurillen und surrealistisch fantasmagorischen – steckt das Weltbild des Existentialismus und somit einer profanen Ansicht, die nach und seit Friedrich Nietzsche Gott als tot erklärt hat. Verstärkt wird diese liberale Nüchternheit durch das Erlebnis des Zweiten Weltkriegs, den Artmann und seine zeitgenössischen Autorenkollegen am eigenen Leibe erfuhren. Der Abstand zur Welt und die Unverbundenheit zur Realität im Sinne des in Zeitungen und Dokumenten festgehaltenen Tagesgeschehens entspricht dem Wunsch der modern schaffenden Autoren jener Ära, eine in Sprache und Bezug davon unabhängige Literatur- und Kultursphäre zu setzen.
So ist das „Ich“ im vorangesetzten Motto, der letzten Strophe des Gedichtes „es fällt aus alten briefen“ aus der Sammlung Aus meiner Botanisiertrommel, nicht mit dem Ich Artmanns identisch, sondern vielleicht von einem Film instigiert, deren Artmann viele sah, gedanklich weiter verarbeitete und somit thematisierte. Hingegen ergeben Flugzeug, Abwurf von Propagandamaterial, die sich daraus ergebende Doppeldeutigkeit von „dunklen“ Lettern, die schwarz an Farbe, aber auch dunkel in ihrer Wortabsicht sind, dann der deutsche sagenumwobene Haupt- und Nibelungenfluss ein Vokabular, das eine wie immer verschlüsselte, nachvollzogene Geschichtswelt der Autoren inklusive Artmanns reflektiert, doch textlich nicht direkt behandelt, sondern wortspielend collagenartig verdeckt. Dieses Distanz-Halten zu den Dingen mag mitunter ein Gefühl der Ohnmacht ausdrücken, sie nicht in den Griff zu bekommen und sie daher, wenn auch fiktiv beschreibend, nicht erfassen zu können. So werden die Dinge selbst zu einer Maskerade einer psychisch dominierten Welt, worin sich Träume und Phantasievorstellungen eher behaupten und das literarische Produkt erwirken. Das ergibt eine absolut eigenständige, individuelle Kunst, die zur Norm wird, obwohl ihr das Normative widerstrebt. Dieses Individualverfahren trägt zweifelsohne Elemente des Ver-rücktseins mit sich, so dass die Clownerie und das Narrenhafte der Gesellschaft antagonistisch begegnen. Entsprechend begründet sich die Rezeption dieser Literatur beim Leserpublikum am leichter Erfassbaren, was bei Artmann oft humorvoll und verschmitzt hervortritt, obwohl er es kritisiert und sogar indirekt oder direkt verspottet. Fügungen wie „dieses wabbelweiche sülzknie“ (1971: 31), „Im Schatten der Burenwurst“ (1983) „do gee r e liawa z fuas auf d hend“ (1993, III: 105), „sein herze hart wie marzipan“ (1975: 29), .. wäu ma d easchte en gschdis hod gern“ (1958: 17), „doch nun im tiefen grab gnügt mir dem augenlosen“ (1994: 35; „prologue“ zu „vergänglichkeit & aufferstehung der schäfferey“) und hunderte mehr bieten das Artmannsche Füllhorn seiner literarischen Unbeschwertheit, die bei aller Narrenfreiheit treffend in sprachliche Fassung setzt, wie der Juwelier edle Steine vorzeigt. Das so gesetzte Juwel Sprache feiert bei Artmann seine durchaus kostbare Einmaligkeit.
Die letztzitierte Fügung der gerade genannten Beispiele beleuchtet die Nähe des Lebens zum Tod. Es bedeutet das Limit der allein verstehbaren, doch schwierig zu beherrschenden Existenz, die die modernen Autoren in ihrer steten Frage nach Befindlichkeit sehr beschäftigt. Artmanns Dichtung bezeugt – wie viele Werke anderer Autoren der Moderne – die beständige Todesbedrohung, wobei er sie mit Ironie, Satire, Parodie, Travestie und Sprachmaskerade literarisch auf Distanz zu halten sucht. Schon in seinem ersten Band, der ihm zu Weltruhm verhalf, med ana schwoazzn dintn, teilt er durch die Rolle eines Wieners aus Ottakring oder Breitensee, wo ein zünftiger Arbeitersoziolekt einen eher verdunkelten Alltag belegt, von diesem Grenzbereich mit:
WAUN E SCHDEAM SOIT
waun i amoe a bangl reis
zu deidsch: de bodschn schdrek –
i hoff es dauad no a wäu
bis zu den leztn schrek –
waun i daun oesdan schdeabm soit
so bit ich eich nua r ans:
jo nua ka r eangrob aum zenträu!
i schdee ned auf so danzz..
(1958: 84; erste Strophe)
Prosadichtung ohne strenge Strophenform und Reim, doch mit gewissen prosodisch-rhythmischen Qualitäten kennzeichnet die deutsche Dichtung im Gefolge der Gruppe 47, die Artmann hier heranzieht. Die Dialektvariante weist jedoch eklatant auf den Fortschritt hin, den diese unverblümte, doch bildreiche Dichtung repräsentiert, so dass philologisch betrachtet der krasse Unterschied zur Standardsprache buchstäblich ins Auge sticht. Der Dialekt folgt hier nämlich nicht der Tradition, wo er oft in biederer Unterhaltung herangezogen und daher vom Leser nicht Ernst genommen wurde. Hier spricht das poetische Ich in einer Rolle, die unter Umständen hilflos, wenn doch ernst klingt. Die Rolle dieses hilflosen Menschen zeigt dessen Unfähigkeit, die Hochsprache zu verwenden.
Artmanns Einsatz der Verisimilität der Dialektsprache in seiner Dichtung vom damals noch stark präsenten Sprechzustand einiger Gesellschaftsschichten (wie hier der Arbeiterklasse) deutet auf sein Wissen um deren Bildungsdefizit zusammen mit anderen Emotionsdefiziten gegenüber einer höheren, meist bürgerlichen Bildungsschicht hin. Eine Bildungstradition im Sinne der gehobenen Ansprüche der Aufklärung war in Arbeiterkreisen der Nachkriegszeit kaum bekannt, obwohl die Volksbildungskampagne schon vor der Jahrhundertwende ins Leben gerufen wurde. Artmann äußerte sich als Selbst-Gebildeter – wobei er die Erfahrung des Volksbildungsheimes in seiner Jugend lobend unterstrich – wiederholt sehr negativ über den Dialekt, besonders den Soziolekt seines Heimatbezirks, und er beabsichtigte ihn durch seine Heranziehung zu ironisieren.1 Er wollte niemals Dialektdichter werden. Daher floh er die Dialektdichtung geradezu nach wenigen Jahren und publizierte nur mehr in der Hochsprache. Dennoch ließ er sich den unerwarteten Ruhm und die damit verbundene, lange vermisste finanzielle Besserstellung einige Zeit (von ca. 1958 bis 1962) gefallen, da er zum Volksdichter erhoben und auf viele erwünschte und unerwünschte Arten selbst nachgeahmt wurde.
Auf der positiven Seite rief sein Erfolg die bekannte Dialektwelle der sechziger und siebziger Jahre wach, die in meist gesellschaftskritische Literatur einschwenkte und in literarischer, linguistischer, soziolinguistischer und kulturgebundener Forschung umfassendes Zeugnis dazu abgibt. Das Missverständnis zeigte sich auf mehreren, anderen Wegen. Im gesellschaftlichen Bereich sahen sich einige Wiener Kreise nun berechtigt, „ihre“ Sprache der Hochsprache vorzuziehen, wie die in den sechziger Jahren monatlich erschienene Wiener Straßenbahnzeitung beweist, die einige Jahre in den Wagen der öffentlichen Verkehrsbetriebe zum Lesen aushing. Das rief aber jenes Gaudium hervor, das Artmann nicht zum Leben erwecken wollte und das den Dialekt in vielen Unterhaltungsbereichen zu seiner Abwertung führte und noch führt. Tatsächlich hat sich diese Seite heute wieder etabliert, so dass viele deutschsprachige Regionalbereiche ihren Dialekt in gutmütiger, lachhafter Weise vorführen; das verbindet sich mit Namen wie Thaddäus Troll aus dem Schwäbischen oder Volksbelustigern aus anderen Regionen.2
Artmann hingegen sah unter den ungebildeten Dialektsprechern und deren ungeschliffener Denkart symbolisch auch jene Kreise der Helfershelfer, die nur wenige Jahre davor die Gräueltaten der Nazis mitzutragen und auszutragen halfen. Wie weit sich diese These objektiv aufrecht erhalten ließe, bleibe hier offen, aber für Artmann galt sie als eine seiner Reaktionen zum Dialektgebrauch. Überhaupt kann die Auseinandersetzung der mit Artmann gleichgesinnten Autoren mit der Nazi-Vergangenheit und dem Zweiten Weltkrieg nicht genug unterstrichen werden. Dabei gilt das Kabarett des Carl Merz und Helmut Qualtinger, dem Artmann persönlich nahestand, mit der Galionsfigur des opportunistischen „Herrn Karl“ als fahnentragend in dieser Gesinnung. Das ließ die gesamte Autorengeneration ihres Schlages zu mutigen Kritikern der unmittelbaren Vergangenheit werden – zu einer Zeit, wo ein Großteil der meist schuldbewussten Bevölkerung das bekannte Gras über jene Zeit der Untaten wachsen sehen wollte.
Der Erfolg seiner Dialektdichtung erstaunte Artmann und seine Mitstreiter der Wiener Gruppe sowie andere Literaten. Gerade die Komponente des angenommenen Ungebildetseins dieser Figuren (was ein Maß an Unmündigkeit im Sinne der sittlichen Vorstellungen des deutschen Philosophen Immanuel Kant einschloss), gestattete einige Thesen der Moderne in tabula rasa-Sentenz rollenhaft vorzutragen. Das heißt, Artmann trug die Rolle der oben zitierten Todeseinsicht und des Wunsches, die entsprechende Trauerfeier nicht philisterhaft pompös auf dem Zentralfriedhof Wiens, sondern schlicht und frugal durch den Freundeskreis zu begehen, mit naiven Menschen vor. Der Tod gehörte in der Folge der Entdeckungen von Darwin, Freud und Heidegger zum Curriculum des höchsten Säugetiers Mensch und musste als logisch erfassbarer Abschluss der Existenz nicht weiter behandelt werden. In der Rolle eines naiven, einfachen Dialektsprechers „aus dem Volk“ stellt sich die Plattitüde vom Tod als ständige Lebensbedrohung natürlich und glaubhaft dar. Soweit zum Inhaltlichen.
Die sprachliche Seite der Artmannschen Dialektdichtung öffnet ein Register, welches die Einmaligkeit des Meisters demonstriert. Niemandem war es seit Johann Nestroy oder Karl Kraus gelungen, dem Österreichischen – wo selbst die Hochsprache, nach Walter Höllerer die „Sprache des Kalküls“,3 von Elementen der Alltagssprache durchdrungen ist – so viel Sprach- und Wortwitz zu entringen wie Artmann. Das Lob der Presse, selbst der Weltpresse bis hin zur London Times oder zum Corriere della Sera, spricht dazu Bände für alle Zeiten.4 Dazu hat die an sich spärliche Forschung über sein Werk in den letzten Jahren zwei Dissertationen (von Jacques Lajarrige und Marc-Oliver Schuster)5 geliefert, die sich mit dem Phänomen seiner Sprache sehr wesentlich kritisch auseinandersetzen.
Die autobiografische Tendenz in Artmanns Dichtung schimmert in jenen Zeilen des obigen Dialektgedichts hervor. In der Tat werden viele berühmte Wiener Künstler, Komponisten und Autoren auf dem Zentralfriedhof in Ehrengräbern mit gewissem Aufwand bestattet, einem Aufwand, der den Lebenden mehr geholfen hätte zu einer Zeit, als die öffentliche Hand besonders die Autoren der rebellischen, modernen Richtung nicht länger zu unterstützen bereit war. Artmann und seine Genossen – einschließlich der Kabarettisten Helmut Qualtinger und Carl Merz – wurden als Nestbeschmutzer lange Zeit gering geschätzt. Abgesehen vom Kabarett, das sich überall großer Beliebtheit erfreut, ist es eher der Förderung durch deutsche Verlage zu danken, dass österreichische Dichter der Nachkriegszeit erste Anerkennung und damit finanzielles Einkommen fanden. Artmanns Dialektband lieferte dazu die Ausnahme, wie auch das vom Dialekt geprägte Kabarett die begeisterte Unterstützung vom österreichischen Publikum fand. Der Erfolg der neuartigen Richtung blieb jedoch nicht aus und fand in dem 2004 verliehenen Nobelpreis für Literatur an Elfriede Jelinek, die sich offen zu ihren Wurzeln in den Ideen der Wiener Gruppe bekennt, einen weltweiten, nachhaltigen Widerklang.
III.
Die Todesthematik des Existenzialismus, wie sie Philosophen von Martin Heidegger bis Jean-Paul Sartre aufwerfen, dringt ganz klar in Artmanns Barockgedichten seiner frühen Jahre durch. Im Sinne Bertolt Brechts sah er im 17. Jahrhundert viele kriegsgeplagte Ähnlichkeiten zum 20. Jahrhundert, was Leben und Tod in enge Nachbarschaft brachte. Gleichzeitig zu den Dialektgedichten schrieb er nach Barockstudien in Wiens Nationalbibliothek zu Andreas Gryphius, Quirinus Kuhlmann und anderen Dichtergenossen schon in den fünfziger Jahren seine Sammlung treuherzige kirchhoflieder (1994, VI: 5–15) und seine neun epigrammata in teutschen alexandrinern (27–31). Von den kirchhofliedern sei hier eine typische Strophe zitiert:
o dunkler du o schwarzer wirt
muß ich dein krüglein trinken
so bleibt die nachtigall allein
zwischen gras und tauichtem efeu
und ich von deinem schattenwein
erstickt im neuen morgen. …
(1994, VI: 10)
Die antiquierte Sprachtönung, die odenartige Strophenform und die naturlyrische Anlage können die zeitlose, existenzbetonte Thematik nicht vollends maskieren, so sehr der Stil vergangene Positionen vortäuscht. Artmann folgte einer Wiener Tradition, die etwa in Werken des Malers Gustav Klimt zu Anfang der Moderne auf die Unmittelbarkeit von Leben und Liebe auf der einen und den dunklen Schatten des Todes auf der anderen Seite in byzantinischer Tradition seit dem Mittelalter aufmerksam macht. Daher soll das Leben bewusst voll ausgekostet werden, wie hier die zarten Momente der Nachtigall, die sich zwischen Wein und Efeu fest ans Dasein klammert. Die „XX Quatraine – auff einen kuß alß trojaner-pferd“ aus der Sammlung vergänglichkeit & aufferstehung der schäfferey (25 epigrammata in teutschen alexandrinern gesetzet) bezeugt das Idyll des lebensvollen, nach Friedrich Nietzsche dionysischen Augenblicks und taucht inselhaft vor den anderen, mehr todesbelasteten Quatrainen wie erhofft auf:
im wilden eichenthal die zarten turteltauben /
umflattern artman itzt / den seine nympfe küßt /
o kuß / trojanerpferd / im mund scheinst du gesüßt /
doch einmal drin im hertz / wirst du die ruh ihm rauben…
(1994, VI: 41)
Sofort blitzt der Hinweis auf sich selbst, „artman“, hervor – allerdings nicht stichhältig, da nur mit einem „n“. Der Topos des Kusses als Trojanisches Pferd, geborgt aus tiefster Tradition, maskiert ein Liebesleid des Dichters, hier irgendwie identisch mit dem poetischen Ich, sowie den kreativen Anlass zum Schreiben, was die zeitferne Barockart des Gedichts nicht wirklich verstecken kann. Dieser persönliche Rückhalt vor Erlebtem gilt besonders, wie erwähnt, der Zeit des vorangegangenen Kriegs und der Ohnmacht, in der sich deutsche Lande nach dem Horror des Zweiten Weltkriegs ganz allgemein befanden. Wie sollte ein Autor all das Unglaubliche sich und der Welt begreiflich machen? Da waren bisher ungeschürfte Sprachmittel von Nöten, wie sie Artmann alle mit mehr oder, was selten vorkam, weniger Erfolg, doch mit witzreichem Geist und metaphernreicher Sprache zum Vorbild seiner Mitstreiter und zur Genugtuung seiner Leser vorexerzierte.
IV.
H.C. Artmann gilt, da sich uns sein Lebenslauf (1921–2000) abgeschlossen darstellt, als Hauptvertreter der Moderne, die aus der seit Friedrich Nietzsche erkannten Unabhängigkeit des Kulturbereichs vom darzustellenden Alltag loslöst. Die Mittel zum Schaffen dieser kreativen Kunst schließen die Sprache selbst und somit die Literatur ein. Die Sprache schafft das Szenarium und beschreibt es nicht mehr – wie sehr das Beschriebene selbst in einer vorangegangenen Kunstära, etwa im Realismus, Fiktion gewesen sein mochte. Besonders klar erweist sich diese Richtung in Strömungen wie Futurismus, Dadaismus, Surrealismus, Neodadaismus, Konkretdichtung oder Pop-Art. Ein Zeitgenosse Artmanns, der im gleichen Jahr wie Artmann verstorbene Wiener Dichter und Schriftsteller Ernst Jandl, demonstriert in seinen Gedichten eindeutig, wie sich creative und beschreibende Sprache unterscheiden. Sein Gedicht „wien: heldenplatz“ vollzieht die Rede Adolf Hitlers am 15. März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz viel echter nach als die historische, durchaus wortgewandte, beschreibende und daher metasprachliche Darstellung von Heilmut Andics. Dieses eigenständige Textverfahren entdeckt man bei Artmann immer wieder, wenn auch – wie bei diesem Individualverfahren nicht anders zu erwarten – auf idiosynkratische Weise.
In seinem Einleitungskapitel zu „Schwebende Wirklichkeiten: Zur Lyrik H.C. Artmanns“ zeigt Klaus Reichert Artmanns Textverfahren auf:
Artmanns Ästhetik des Schwebens ist niemandem und nichts verpflichtet, außer sich selbst, sie folgt keinem Programm, gehört keiner Richtung an, folgt keiner Strömung, aber zugleich besteht sie aus lauter Kristallisationspunkten, in denen die poetischen Tendenzen des Zeitalters samt der modernen und postmodernen Verfügbarkeit über Traditionen und über eine mittlerweile global definierte Kultur sich schneiden. Gemeint ist damit nicht die Simulation von Stilen und Tönen […] – von „typischen“ Barockgedichten, keltischen Zauberformeln, Kavaliersgedichten, Kirchhofliedern, den Greguerías Gómez de la Sernas und dem Cante jondo Lorcas bis zu den japanischen Haiku oder persischen Quatrainen, um nur diese zu nennen. Gemeint ist vielmehr – und das gilt für die gelungensten Texte gleich welcher Gattung – das Kunststück eines Anspielungsreichtums, das die Tendenzen des Zeitalters wie in einem Brennglas oder einer Alchimistenkugel vereinigt.
(Reichert 1994: 38)
Das Zitat Klaus Reicherts enthält neben den Textbetrachtungen noch andere wichtige Momente zu Artmanns Leben und Dichtung, die zu beachten sind; doch hier geht es um die Textgestaltung Artmanns „gleich welcher Gattung“. In vielen Darstellungen der Forschung findet man die Bewunderung für seinen poetischen Grundton, der in Prosa und Drama ebenso durchkommt. Man könnte behaupten und an vielen Beispielen zeigen, dass ihm die sprachliche Schöpfung wichtiger war als ein gestaltendes Verfahren zu einem Roman, wie man ihn bei Thomas Bernhard findet, oder einem abendfüllenden Drama, wie es die Frühwerke Peter Handkes zeigen, also zweier geistesverwandter Autoren, die Artmann anerkannten. Das Sprachspiel im ernsten Sinne des Wortes bleibt das Hauptargument dieses Meisters. Die Begeisterungsstürme des Publikums bei Artmanns Lesungen stammen von diesen unzähligen Details seines Einfallsreichtums. Es war daher wichtig, ihn bei Lesungen zu erleben und ihn nicht nur vom Text her zu erfahren, und so werden auch seine Sprachmasken quasi dreidimensional. Seine Lesungen neigten offensichtlich dem Gesamtkunstwerk zu, und zum Glück sind etliche seiner Auftritte filmisch erhalten.6
Dass Artmanns Prosa (wie etwa in Die Anfangsbuchstaben der Flagge oder im memoirenartigen Roman Nachrichten aus Nord und Süd) oder seine dramatischen Produkte (z.B. vorgestellt in die fahrt zur insel nantucket) hinter seiner Lyrik stehen, wie einige Male in der Forschung vorgeschlagen wurde, hat seine Berechtigung. Er war in erster Linie Lyriker. Seine Geschichten und Dramen, meistens Einakter, fesseln durch die Sprachgestaltung. Die Sujets des Märchens, der Gruselgeschichte, der Sage, der Anekdote, des Bonmots stellen oft hergebrachte Stoffe auf den Kopf, aber das Dichtwerk der Sprache selbst, der sprudelnde Quell an Metaphern, Fügungen und Stimmungsbildern stellt bei Artmann alles andere in den Schatten.
V.
Wie entfaltete sich Artmanns Karriere in der zweiten Hälfte seines Schaffens seit den späten siebziger Jahren? Er hatte sich als Autor in der ersten Reihe der deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation unter Beweis gestellt und erlangte dadurch einen leichteren Zugang bei Verlagen. Es erschienen daher bis zu seinem Tod regelmäßig Werke, die nach wie vor im Sinne des hier gestellten Themas originell bis in die höchsten Ansprüche bleiben. Dennoch ereignete sich ab den achtziger Jahren das Phänomen der „Wiederkehr des Gefühls in der Literatur“, wozu es schon 1985 in Stockerau bei Wien ein eigenes Symposium7 gab. Eingeleitet durch Peter Handkes Romane seiner sog. Wende in den siebziger Jahren nach dem Selbsttod seiner Mutter (Die linkshändige Frau und Wunschloses Unglück), wendeten sich die jungen Schriftsteller weniger distanzierten Sujets aus dem Alltag zu. Vor allem die Romane von namhaften Autoren von Peter Rosei zu Robert Menasse und Josef Haslinger belegen diese Beobachtung. Artmann gefiel nach wie vor bei seinen Auftritten und Lesungen, der Absatz seiner Werke sicherte ihm jedoch noch weniger die Existenz als bisher. Als ich mit ihm 1994 bei etlichen Gläsern Kölscher Bier in Holzheim am Rhein einen Abend lang zusammen mit dem leider jung verstorbenen Poeten Thomas Kling sprach, Artmann dabei indirekt interviewend, beklagte Artmann, dass die Tantiemen für seine Werke von einem großen Verlag im Jahr zuvor keine zehn D-Mark betragen hatten; er könne nur von seinen Lesungen leben. In einem Moment des Alleinseins mit Kling gab dieser zu verstehen, dass die Literatur Artmanns nur mehr Liebhabern einer nun älter gewordenen Generation im deutschen Raum zusagte. Und solcher Kreise gab es immerhin noch genug, wie die Einladungen zu doch zahlreichen Lesungen andeuteten. Es war aber um ihn stiller geworden, wenn auch offizielle Ehrungen, etwa zu seinem 75. Geburtstag 1996, seine lange Zeit regierende Stellung als erstklassiger deutscher Poet in Erinnerung riefen.8
Die Situation seiner letzten Jahre bestätigt, dass er und sein Kreis doch mit der historischen und gegenwärtigen Realität seiner Generation und daher seiner vollen Lebensjahre, die das Erlebnis des Zweiten Weltkriegs einbezogen, lebendig verbunden war. Seine Sprachmasken und Textsorten reflektieren die Sorge und die Angst, um noch einmal von Heidegger zu borgen, eine sinn- und kulturvolle Existenz zu garantieren, die jener Krieg quasi zermalmt hatte. In den achtziger und neunziger Jahren machten sich Nachgeborene bemerkbar, die jene Horrorzeiten nur aus Erzählungen der Alten kannten und eher unverständig dem literarischen Rüstzeug Artmanns und seiner Zeitgenossen entgegentraten. Sic transit gloria mundi…
VI.
Überschaut man das Gesamtwerk dieses begabten literarischen Eigenbrötlers und vertieft man sich in seine meist skurille, durchaus melodische und farbenvolle Sprachwelt, muss man der Vielfalt des Gebotenen Reverenz erweisen. Durch ihre Distanzierung von der Wirklichkeit bleiben seine Sprachkompositionen zeitlos wie manche seiner Figuren von Dracula zum Yeti und zum Greißler Gschweidl im Einakter Kein Pfeffer – Czermak, eine widrige Figur des Mitmenschen, die angeblich den Herrn Karl und damit auf indirektem Wege die Figur des Archie Bunker in der amerikanische Fernseh-Serie All in the Family inspirierte.9 Dass die analytische literaturwissenschaftliche Forschung über ihn, abgesehen von lobenden Essays, relativ gering geblieben ist, liegt sicherlich an der im Wesentlichen losen Vielfalt seiner Einfälle. Im Vergleich dazu wimmelt es geradezu an Buchwerken, Artikeln, Dissertationen und Thesen über Thomas Bernhard, Peter Handke oder auch schon Elfriede Jelinek. Artmanns Einfälle über einen gemeinsamen Nenner zusammenzubinden erfordert sowohl viel Detailarbeit als auch Rücksicht auf die historische Zeit, in der er schuf, besonders weil sie bei ihm durch Masken und Textabsurditäten, wie immer reizvoll und ansprechend, verdeckt wird. Er liebte das kaleidoskopartig Chaotische und schrieb mir einst in mein Tagebuch, einen ihm nur durch Hörensagen bekannten Ort in Amerika charakterisierend: „Da chaos / in taos / is a wos!“ und fügte, amüsiert über seinen spontanen Einfall, noch hinzu: „gut? / oder? / H.C. 14. 5. 1894“10 (sic). Diese Spontaneität muss als seine eigentliche Stärke gelten. Man erzählt von seinen gelegentlichen Aufenthalten auf der Frankfurter Buchmesse, wo man sich rasch von Buchstand zu Buchstand in eine fröhliche Stimmung „biberln“ kann, dass er seine Kollegen stundenlang durch witzreiche Monologe köstlich unterhalten konnte. Diese Spontaneität belebte seinen Sprachsinn bei Übersetzungen aus fremden Sprachen und legte eine etymologisch-linguistische Ader in ihm bloß, die so fundiert war, dass ihm die Universität Salzburg den Ehrendoktor zuerkannte. Das ergab noch einmal die in sich erheiternde Sprachspielerei eines „Dr. H.C. H.C.“, denn seine Freunde nannten ihn stets einfach, was nun verdoppelt wurde, den „H.C.“, sprich „(da) Hatse“. Es offenbarte sich als Maske daselbst, weil einigen sein voller Name unklar blieb… In diesem Unklaren versteht sich ganz allgemein sein Œuvre bis heute, so dass es für die kritische Forschung noch viele Herausforderungen birgt.
Peter Pabisch, aus Marc-Oliver Schuster (Hrsg.): Aufbau wozu. Neues zu H.C. Artmann, Königshausen & Neumann, 2010
Peter Pabisch: Literaturverzeichnis
Der Mond isst Äpfel… sagt H.C. Artmann. Die H.C. Artmann-Sammlung Knupfer
Clemens Dirmhirn: H.C. Artmann und die Romantik. Diplomarbeit 2013
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Internet Archive +
Kalliope
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
Reportage + Gesellschaft + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.



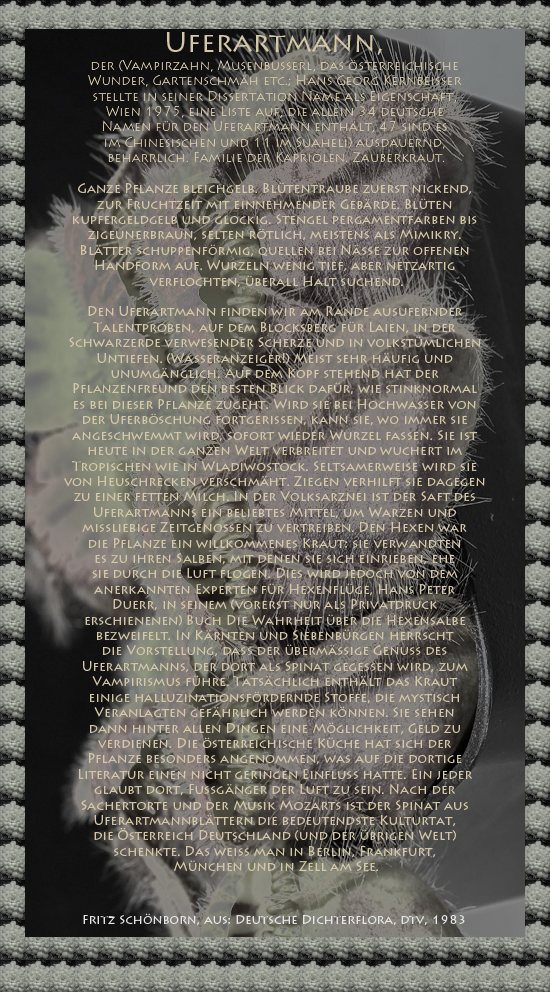












Schreibe einen Kommentar