H.C. Artmann: Das poetische Werk – Der Meister der Himmelsrichtungen
ACHT-PUNKTE-PROKLAMATION DES POETISCHEN ACTES
Es gibt einen satz, der unangreifbar ist, nämlich der, daß man dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben.
Vorbedingung ist aber der mehr oder minder gefühlte wunsch, poetisch handeln zu wollen. Die alogische geste selbst kann, derart ausgeführt, zu einem act von ausgezeichneter schönheit, ja zum gedicht erhoben werden. Schönheit allerdings ist ein begriff, welcher sich hier in einem sehr geweiteten spielraum bewegen darf.
1.
Der poetische act ist jene dichtung, die jede wiedergabe aus zweiter hand ablehnt, das heißt, jede vermittlung durch sprache, musik oder schrift.
2.
Der poetische act ist dichtung um der reinen dichtung willen. Er ist reine dichtung und frei von aller ambition nach anerkennung, lob oder kritik.
3.
Ein poetischer act wird vielleicht nur durch zufall der öffentlichkeit überliefert werden. Das jedoch ist in hundert fällen ein einziges mal. Er darf aus rücksicht auf seine schönheit und lauterkeit erst gar nicht in der absicht geschehen, publik zu werden, denn er ist ein act des herzens und der heidnischen bescheidenheit.
4.
Der poetische act wird starkbewußt extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische situation, die keineswegs des dichters bedürfte. In eine solche könnte jeder trottel geraten, ohne es aber jemals gewahr zu werden.
5.
Der poetische act ist die pose in ihrer edelsten form, frei von jeder eitelkeit und voll heiterer demut.
6.
Zu den verehrungswürdigsten meistern des poetischen actes zählen wir in erster linie den satanisch-elegischen C.D. Nero und vor allem unseren herrn, den philosophisch-menschlichen Don Quijote.
7.
Der poetische act ist materiell vollkommen wertlos und birgt deshalb von vornherein nie den bazillus der prostitution. Seine lautere vollbringung ist schlechthin edel.
8.
Der vollzogene poetische act, in unserer erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.
Editorische Notiz der Verleger
Die Idee zu einer mehrbändigen, aufgegliederten Ausgabe des damals schon auffällig vielschichtigen poetischen Œuvres von H.C. Artmann in der „Kleinen Reihe“ des Rainer Verlages – naheliegend erschien es damals – entstand 1967. Sie wurde – wie die meisten „Ideen“ von Verlegern – aufgrund dieser und jener Entwicklung (des Autors, seiner ständigen Wohnwechsel, des kleinen Verlages und seiner Probleme) ad acta gelegt, eigentlich aber nie aus dem Gedächtnis entlassen.
1969 erschien die von Gerald Bisinger mit Liebe und Fleiß betreute Sammlung Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire im Suhrkamp Verlag. 1978 auch in Taschenbuchform, die bis dahin vollständigste Zusammenstellung der Gedichte, welche bis heute Gültigkeit und Wirksamkeit erlangt hat.
Viele Jahre später, im Herbst 1991 also – was im Durcheinander der Frankfurter Buchmesse nicht möglich – nämlich bei einem Besuch der Renners bei Rainers im ungarischen Fünfkirchen, gerät diese „Idee“ wieder ins Blickfeld: ein mehrbändiges Werk, verteilt auf zwei Schultern.
Salzburg, Wohnort des H.C., liegt zwischen Fünfkirchen und München, zwischen Rainer und Renner. H.C. gibt also wenige Tage später sein Placet, bekundet Wohlwollen, avisiert gar seine Mitwirkung. Auch Klaus Reichert in Frankfurt am Main – nobilder und aufrechter Herausgeber vieler Werke H.C.s – wird sofort gewonnen.
1992 – Klaus Reichert hat seine nicht mühelose Arbeit angefangen, fortgeführt und mit H.C. abgestimmt – die, von den Verlegern übernommen, die Bandzahl der Gesamtausgabe auf zehn Stück (ursprünglich acht) ausgeweitet bzw. begrenzt. Die redaktionelle Arbeit des Herausgebers und des Autors ist vorläufig abgeschlossen.
Im Sommer 1993 beginnen Pretzell und Renner unter Nutzung der typographischen Vielfalt einer 1992 erworbenen leistungsfähigen Photosatz-Maschine die Ausführung der ersten Bände.
Frühjahr 1994 – Beendigung der Satzarbeiten. Die Drucklegung kann beginnen…
Klaus G. Renner und Rainer Pretzell, Nachwort
Beiträge zur Gesamtausgabe: Das poetische Werk
Fitzgerald Kusz: Kuppler und Zuhälter der Worte
Die Weltwoche, 18.8.1994
Andreas Breitenstein: Die Vergrößerung des Sternenhimmels
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1994
Thomas Rothschild: Die Schönheit liegt in der Abwesenheit von Nützlichkeit
Badische Zeitung, 15.10.1994
Franz Schuh: Weltmeister jedweder Magie
Die Zeit, 2.12.1994
Albrecht Kloepfer: Hänschen soll Goethe werden
Der Tagesspiegel, 25./26.12.1994
Karl Riha: Wer dichten kann, ist dichtersmann
Frankfurter Rundschau, 6.1.1995
Christina Weiss: worte treiben unzucht miteinander
Die Woche, 3.2.1995
Dorothea Baumer: Großer Verwandler
Süddeutsche Zeitung, 27./28.5.1995
Armin M.M. Huttenlocher: Narr am Hofe des Geistes
Der Freitag, 25.8.1995
Jochen Jung: Das Losungswort
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1995
Laudatio auf H.C. Artmann
Nun hat sie also auch H.C. Artmann erreicht – die Inthronisierung auf dem Olymp der großen Geister seines Landes, obwohl er doch wahrlich sein Leben lang alles getan hat, den Anruch des Olympiers zu vermeiden und den Anspruch, er könne gar einmal als Repräsentant dieser Kultur gelten – was mit dieser hohen Auszeichnung ja offenbar gemeint ist −, permanent und gezielt zu unterlaufen. Aber diesmal haben diejenigen, die ihm die Ehrung zuerkannten, nun ihm ein Schnippchen geschlagen, das heißt, sie haben von ihm gelernt, von seiner Fähigkeit, immer das gänzlich Unerwartete zu tun, denn wer hätte erwartet, daß der gänzlich Unintegrierbare dennoch sozusagen heimgeholt wird?
Artmann als Repräsentant österreichischer Kultur – läßt sich ein Reim darauf machen? Ist er nicht angetreten, zusammen mit den Freunden zunächst des Wiener Art Clubs, dann der Wiener Gruppe, im aggressiven Widerspruch zur damals herrschenden, immer noch herrschenden Kultur und ihrer Repräsentanten? Ist er dafür nicht ausgegrenzt worden, verhöhnt, bestraft durch Nichtpubliziertwerden? Hat er sein Land – nach dem ersten Ruhm, den ihm die Dialektgedichte einbrachten und der vermutlich auf einem Mißverständnis beruhte – hat er sein Land nicht verlassen und anderswo gelebt, in Schweden und Deutschland, in Frankreich und Italien, in Irland und der Schweiz? Die Länder wechselnd wie die stets modischen Anzüge? Nirgendwo zu Hause und überall, wenn er mit seinem Köfferchen und der Reiseschreibmaschine vor der Tür stand, „Ich wollte mal wieder vorbeischaun“ sagte und dann drei Wochen blieb, bis es ihn weiterzog zu anderen Freunden, die ihm Heimat waren, und in andere Landschaften? Hat ihn nicht sein eigenes Land überhaupt erst auf dem Umweg über das Ausland akzeptiert, nachdem er in Deutschland Verleger gefunden hatte und dort berühmt geworden war – was freilich für fast alle seiner österreichischen Kollegen galt?
Dennoch – wenn wir davon absehen, daß die deutschsprachigen Länder im Unterschied zu Italien und Frankreich seit jeher in einer Art Dauerkriegszustand mit ihren innovativen Dichtern und Denkern, Komponisten und bildenden Künstlern gelebt haben – ich sehe niemanden, der typischer für die österreichische Kultur ist als H.C. Artmann, geradezu ihr Inbegriff und Kulminationspunkt, die vielfältigen, oft weit auseinander liegenden Stränge und Möglichkeiten ihrer Geschichte, die offen greifbaren und die verdeckten, verknüpfend und weiterdenkend, weiterformend, zu einem Kosmos, einem Riesenreich, in dem die Sonne nicht untergeht. Dahinter steht freilich eine Idee Österreichs, die weniger mit den derzeitigen Bundesländern zu tun hat als mit der Vielsprachigkeit und Multimentalität Habsburgs. Artmann hat dessen räumliche Dimensionen in die Vielstimmigkeit der Zeitmaße seiner Verse, der wechselnden Rhythmen seiner Prosa, seines Theaters übertragen. Was so entstand, war der einzigartige Versuch, eine politisch verlorene Welt in der Sprache aufzubewahren, in der Sprache als dem einzig unverlierbaren Besitz. Einzigartig war der Versuch deshalb, weil hier nicht in erzählerischer Breite einer untergegangenen Welt ein Denkmal gesetzt wurde, sondern weil Polyphonie und Polyglossie zum Motor dieser Dichtung selber wurden, und zwar nicht im Sinne von Zitat und Montage, die zum Signum der poetischen Verfahrensweisen der Moderne wurden, vielmehr in einem ständigen Übersetzungsprozeß, einem Assimilationsvorgang sondergleichen, der das Fremde als das eigene erkennbar werden läßt.
Dabei finden sich im Werk Artmanns niemals Selbstdarstellung und Selbstbespiegelung, keine Konfessionen. Alles Deutsch-Tiefsinnige, Deutsch-Raunende, Deutsch-Selbstquälerische ist ihm fremd. Wörter wie Leid, Schmerz, Verzweiflung scheint es in seinem Wortschatz, diesem größten Thesaurus der neueren deutschsprachigen Poesie, nicht zu geben. Doch vielleicht weist gerade das Fehlen solcher Wörter in die Richtung, wo solches Schreiben herstammt: es waren ja immer die großen Melancholiker, die sich nicht in die Karten schauen ließen und den eigenen Abgründen die hochgebauten Türme ihrer oft so schwerelos und luftig gewirkten Sprachspielwelten entgegensetzten. Gerade das sprichwörtlich Halsbrecherische einer mit Wörtern spielenden Existenz setzt eine Artistik, setzt einen Balanceakt voraus, die umso gelungener sind, je weniger man ihnen anmerkt, daß ein Tritt daneben in die Tiefe gegangen wäre, meinetwegen auch in den verräterischen Tiefsinn, ins Bekenntnishafte also, was diese Form des Dichtens, eben als Überlebensstrategie, liquidiert hätte.
Aber lassen Sie mich, bevor ich selbst tiefsinnig werde, zurückkehren zu dem, was ich den Assimilationsvorgang als Signum des Artmannschen Werks genannt habe. Er ist von Anfang an Motor seines Schreibens und läuft gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Am offensichtlichsten ist es natürlich in seinen Übersetzungen, die einen integralen Bestandteil des Werks bilden. Es begann, wenn ich mich recht erinnere, in den späten 40er Jahren mit García Lorca und Gomez de la Serna. Das waren Entdeckungen – niemand im deutschen Sprachgebiet hatte von diesen Autoren gehört, niemand wollte von ihnen hören, da man vorgab, sich erst einmal mit sich selbst beschäftigen zu müssen und Artmann bezog damit zugleich seinen Standort in den Landschaften der europäischen Moderne, nicht im schottendichten Gehäuse irgendeiner Nationalliteratur. Man soll in diesem Zusammenhang auch ruhig daran erinnern, daß die Wiener Gruppe die einzige Unternehmung nach dem Krieg war, die die abgerissene Verbindung zur Tradition der Moderne wieder herstellte – also zum Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus – und von da aus zu ihren für den literarischen Biedermann so schockierenden Experimenten gelangte. Artmann hat durch seine Übersetzungen zweierlei geleistet: er hat neue literarische Türen geöffnet, die zu Wunderkammern führten, und er hat immer zugleich die Möglichkeiten des eigenen Schreibens erweitert. Vielleicht ist es nicht richtig, hier im strengen Sinn von Übersetzungen zu sprechen, denn was Artmann macht, ist im Grunde ein Weiterdichten – er leiht gewissermaßen Lorca seine Stimme, und die Zigeunerweisen, die er singt, sind nur noch von ferne andalusische, es sind deutsche, aber in nie zuvor gehörten Tönen, die auch Ungarisches hereinholen und sozusagen hochliterarisieren. Oder auch, in anderen Fällen, herunter.
Das beste Beispiel hierfür sind seine genialen Villon-Übertragungen. François Villon, man erinnere sich, der Dichter der Pariser Unterwelt des Spätmittelalters, hatte in einem Argot geschrieben, den alle Übersetzungen – aus Prüderie, aus Hilflosigkeit – wegretouchiert hatten, so daß Lesebuchstücke für Töchter höherer Stände dabei heraus gekommen waren. Artmann nun hatte den genialen Einfall, den Argot Villons in die Sprache der Wiener Gallerie zu übersetzen und hat damit zum erstenmal ein Äquivalent für den großen Franzosen gefunden: Zuhälterei und Verbrechen, Schmutz und Elend, Liebesjammer und Saufkumpanei – sie werden auf einmal hörbar, als habe ein begnadeter Clochard der Wiener Vorstädte sie besungen: es ist die Kehrseite der Wiener Gemütlichkeit, die da zu hören ist, und es ist zugleich authentischer Villon.
Ein wieder anderes Beispiel wäre der Schelmenroman des Spaniers Quevedo, aus dem 16. Jahrhundert, den er in die Sprache seines Zeitgenossen Fischart übertrug, also in eine Art vorbarockes Idiom, das heißt, Artmann hat Texte nicht nur herübergeholt, in einen präsenten kulturellen Zusammenhang, so als wären sie heute geschrieben, er hat es auch verstanden, uns zu ihnen hinzubewegen, zu ihnen zu entrücken. Das hängt vielleicht mit seinem eigentümlichen Geschichtsverständnis zusammen, dem nichts Vergangenes vergangen ist. Er, der ganz im Heute lebt und ihm bis in seine flüchtigsten Trivialformen folgt, lebt zugleich in den Stilen der Vergangenheit, als seien sie aktuell und eben erst erfunden. So gesehen verändert sich auch der Blick auf die Gegenwart: sie zeigt sich einzig in ihren Stilformen, die so nah und gleichzeitig so fern sind – wie durch die beiden Seiten eines Perspektivs gesehen – wie die der Vergangenheit: Möglichkeiten einer kurzfristigen Identifikation, wie bei einem Schauspieler, der nach getaner Arbeit seine Königskrone oder seinen Bettelsack wieder an den Haken hängt.
Es ist bisher nur von der hohen Literatur die Rede gewesen, zu der schließlich auch Villon gehört. Doch ist dies nur die eine Seite der Artmannschen Kunst – die Verfügung über die Mittel und Verfahrensweisen der europäischen Literaturen. Die andere Seite möchte ich die Assimilation sämtlicher Ausdrucksformen nennen, in denen Menschen ihr Bedürfnis nach Fiktionen artikuliert haben. Der Mensch ist ein Wesen, das in und von Fiktionen lebt, sonst könnte er nicht leben. Wer nicht träumt, stirbt. Unser Sinn für die Wirklichkeit ist immer bestimmt durch Vorstellungen, die wir uns von ihr machen und durch die wir sie überschreiten, korrigieren, veredeln, verkitschen oder verdunkeln. Nur der allergeringste Teil dieses Fiktionalisierungsbedürfnisses wird von der hohen oder erlesenen Kunst gestillt. Der weitaus größte Teil spricht sich aus in dem, was verächtlich als Massenkultur bezeichnet wird. Lange bevor die offizielle Germanistik sich herabgelassen hat, literarische Trivialformen der Analyse für würdig zu befinden, hat Artmann ihre Möglichkeiten erkannt und benutzt. Schauerromane, Detektivheftchen und Comics, die Welt des Jahrmarkts und des Kintopps, des Schlagers und der Fernsehserien, Kinderreime und Moritaten – sie sind ihm vertraut wie die Dichter der silbernen Latinität. Er hat die mythenbildende Kraft eines Dracula oder Frankenstein, eines Hanswurst oder einer Micky Mouse erkannt, gegen die längst kein antiker Götterhimmel mehr aufgefahren werden kann. Jede Zeit schafft sich ihre eigenen Mythen – das wußten Vergil und Dante, Shakespeare und Goethe. Nur heute, mit unserer gewalttätigen Trennung in eine U- und eine E- Kultur, ist dieses Wissen verlorengegangen. Indem Artmann Trivialformen benutzt, rehabilitiert er im Grunde nur, was jahrhundertelang gängige Praxis war. Er benutzt sie, das heißt, er schöpft aus dem unversiegbaren Brunnen der kollektiven Phantasie, er taucht nicht in ihm unter. Er verwandelt, was er da heraufzieht, in die unergründlichen Formen seiner Dichtung, zeigt, wie aus Trivialkunst große Kunst werden kann, die zugleich den Schwung des Vertrauten sich bewahrt hat, wie immer verrückt, metaphorisiert, auch dämonisiert sie sein mag. Als Vorläufer, das mag Sie überraschen, fällt mir dazu nur Gustav Mahler ein: Der Tod in Gestalt eines Ländlers, das Schauerliche als das Altbekannte und Geläufige. Man kann sagen, daß auch das eine Seite des Wienerischen ist, wie sie literarisch wohl erstmals in Artmanns Gedichten med ana schwoazzn dintn ans Licht getreten ist.
H. C. Artmann – der Wiener und Habsburger, der Europäer und Kosmopolit, in allen Zeiten lebend und in keiner, sondern nur in der je eigenen Zeit eines Gedichts, eines Prosastücks, der alles assimilierende und der doch selbst ganz unassimilierbare, der Dichter der Leichtigkeit und des Abgründigen, verspielt und todtraurig – ich denke, Österreich ehrt sich selbst, indem es H.C. Artmann ehrt.
Klaus Reichert anläßlich der Verleihung des Ordens Litteris et artibus 1991 in Wien, Erstdruck in Manuskripte Nr. 114, Graz, 1991.
Ich betrachte die folgenden texte…
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft.
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?
Auch die konventionelle science-fiction ist meist nichts anderes als in die zukunft projizierte vergangenheit (kenntlich allein schon am imperfektstil), obendrein dominiert der vergangenheitscharakter jedenfalls eindeutig in ihr.
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
Auf die frage, welche von diesen möglichkeiten mir selbst am meisten am herzen liegen, kann ich nur antworten: jene, die in die westliche, in die atlantische richtung weisen, jene abenteuer, die ich bei der lektüre der fragmentarischen altirischen dichtung er-lebte, durch-lebte und noch heute weiter-lebe.
H.C. Artmann, aus: Unter der Bedeckung eines Hutes, Residenz Verlag, 1974
Laudatio auf H.C. Artmann
Ein die Dimensionen, in denen wir ordnend zu denken gewohnt sind, so eklatant sprengendes Werk wie das des Dichters H.C. Artmann, widersetzt sich der Reduzierung auf eine einzige handliche Formel. Dennoch verlangt unser Unverstand bohrend danach, gerade die komplexesten Phänomene auf einen einfachen Nenner zu bringen. Um es in diesem Fall zu erreichen, und zwar ohne die Täuschung, das überdimensionale Werk in einer Nußschale untergebracht zu haben, bietet sich der ehrliche Trick an, an die Stelle des einfachsten Nenners den Namen des Dichters zu setzen, Artmann als die Formel für Artmann. Das bedeutet anzuerkennen, daß mit ihm in der Literatur ein neues Element aufgetaucht ist, unangebahnt durch historische Entwicklung und im Kombinationsspiel der gegenwärtigen Literatur nicht placierbar. Es bedeutet für den Augenblick den Verzicht auf jede pauschale Motivation der zu zollenden Bewunderung.
Die Zuordnung zur Wiener Gruppe – für ein Bild Artmanns von geringerer Konsequenz als für das Gruppenbild – zeigt Artmann, während einiger entscheidender Jahre, lediglich innerhalb der Gruppe fixiert, als deren Zentrum und Lehrmeister; nicht jedoch in irgendeinem Konnex außerhalb, wie es etwa bei Rühm und Achleitner durch Einbeziehung in das Feld der konkreten Poesie geschehen ist.
Unbegreiflich bleibt es, wie man bei aller spontanen und anhaltenden Begeisterung für die Dialektgedichte des damals 37jährigen Dichters mit dessen schattenhaft wahrgenommener Figur sogleich sich zufrieden geben und alsbald sich anschicken konnte, sie nach der eigenen unzureichenden Vorstellung auszumalen und abzugrenzen. Das gänzliche Fehlen auch einfach der Neugier, wer denn dieser Autor tatsächlich sei und was er über das soeben Bekanntgewordene hinaus zu bieten habe, hielt um Jahre das Erscheinen seiner in Hochsprache verfaßten Arbeiten hintan, bereits damals ein unvergleichlich reiches, inspiriertes und inspirierendes Werk, an dem sich die Kreativität seiner Freunde entzündete.
Noch 1966, also acht Jahre nach dem Erscheinen von Artmanns erstem, so erfolgreichem Buch, mußte ein unermüdlicher Verfechter des Artmannschen Werkes in der Bundesrepublik feststellen, es dringe „dieser seltsame Mann“ in die damalige westdeutsche Situation „nur zögernd ein“, was er in der Weigerung Artmanns begründet sah, „die Pflichtübungen der literarischen Gesellschaft zu absolvieren“. Es gab damals, aus einem Schweizer Verlag, bereits das imaginäre Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken, gewiß ein Schlüsselwerk zur Persönlichkeit des Dichters, mit dem inzwischen berühmt gewordenen Selbstporträt als Vorrede, das mit den Worten beginnt, „Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden meine laune launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, meine anliegen sprunghaft, meine sehnsüchte wie die windrose…“, und es „gab auch soeben aus demselben Verlag eine kleine, eher willkürlich anmutende Auswahl seiner Gedichte mit dem Titel verbarium und dem ratlosen Nachwort eines jungen Schweizer Autors. Das reichte nicht aus, und es bedurfte erst der beiden je 500 Seiten starken Bände des Jahres 1969, ein weißer brief aus lincolnshire. gedichte aus 21 jahren und die fahrt zur insel nantucket (die gesammelten Theaterstücke aus den Jahren 1952 bis 66), denen die als literarische Sensation aufgenommene, von Rühm herausgegebene Retrospektive Die Wiener Gruppe 1967 wegbereitend voranging und 1970 der wichtige, da bisher verstreute sowie als verloren geltende Schriften eischließends Querschnitt The Best of H.C. Artmann folgte – es bedurfte dieses massiven, zeitlich gedrängten Ausstoßes an Publikationen, um Artmanns Werk in seiner Größe und Tragweite erkennbar zu machen und Artmanns Ruhm ein für allemal zu begründen. Die genannten vier Titel zusammen mit Friederike Mayröckers Lyrik, Tod durch Musen, und Konrad Bayers Gesamtwerk, Der sechste Sinn beide 1966, schlossen den bis dahin von der Kritik und dem Publikum kaum wahrgenommenen Leerraum zwischen der fest etablierten Ingeborg Bachmann und dem heftig in die Szene drängenden Peter Handke. Erst jetzt gab es das Kontinuum, bis 1945 zurück, einer großen neuen österreichischen Literatur, die mit elementarer Gewalt in den gesamt-deutschsprachigen Zusammenhang einbrechen und dort alle Kategorien zum Wanken bringen konnte. Es ging, darüber möge man sich auch nach Artmanns großen Erfolgen nicht hinwegtäuschen, nicht mit offenen Armen zu, die ihn oder sonstwen ans große Verlegerherz gedrückt hätten, sondern es brauchte langwierige und zähe Kleinarbeit, der Autoren wie ihrer Mitstreiter, um auf dem Weg durch die allein von Idealismus genährten Kleinst-Zeitschriften und Miniaturpressen bis zur endlichen Eroberung der Großverlage fortzuschreiten. Und vor allem ein unerschütterliches Vertrauen war notwendig, in den Wert der eigenen Arbeit und den Wert der Poesie. Dieses Vertrauen, in Dichtung als einen absoluten Wert und in den Wert des eigenen Bemühens darum, haben nicht wenige, deren Name in der Literatur heute etwas gilt, von H.C. Artmann empfangen, durch das Beispiel seiner Standhaftigkeit und Unbeirrbarkeit, durch das Vorbild seiner Poesie, und nicht zuletzt durch seinen beharrlichen Zuspruch.
Die Beweglichkeit des Punktes Artmann auf der literarischen Karte, sein dauerndes Entgleiten ebenso wie seine Fähigkeit zu plötzlichem Auftauchen an mehreren Stellen zugleich, dieses enervierende Erlebnis für den Kartographen von Literatur, hätte ihn vermutlich alsbald in eine, wenn auch glänzende, Isolation treiben lassen, besäße er nicht so ausgeprägt die Anlage, sich durch überaus haltbare Fixierungen anderer Art ein Gegengewicht zu schaffen, nämlich durch Freundschaften von großer Beständigkeit. Diese sind in ihrem privaten Aspekt vielgestaltig und nicht summierbar, treten aber an markanten Stellen entschlossen aus dem Rahmen des Privaten. Das wird bezeugt durch die außerordentlichen Ergebnisse der Wiener Gruppe, und ebenfalls durch die Art, wie ein wesentlicher Teil von Artmanns Werk einzig publiziert werden konnte, nämlich in von engen persönlichen Freunden mit Akribie zusammengestellten und kommentierten Sammelbänden, denen wiederum die Sorgfalt von Manuskripte hütenden Freunden vorausging. Diesem Einsatz der Freunde verdanken wir die genannten, das bisherige Werk möglichst lückenlos präsentierenden Großbände, worüber das 1970 erschienene Buch Das im Walde verlorene Totem mit den Prosadichtungen der Jahre 49 bis 53 nicht vergessen werden darf. Hinzu kommen, in der nicht minder wichtigen Funktion von Herolden seiner Poesie, weitere persönliche Freunde, wie alle ausgestattet mit unbedingtem Vertrauen zu ihm als Dichter. Ihren Namen an den Artmanns gebunden zu haben, ist ihnen Ehre und erleichtert die Vergänglichkeit.
So kann Artmann, alias Jack Hawkensworth, in seinem neuesten Buch, dem phantasmagorischen Selbstporträt Die Jagd nach Dr. U. oder Ein einsamer Spiegel, in dem sich der Tag reflektiert, in Erweiterung seiner berühmten Selbstdefinition aus dem „suchen nach dem gestrigen tag“ mit gutem Grund erklären: „Mein vaterland liegt jeweils dort, wo ich gute freunde habe, demnach besitze ich also eine ziemliche menge sogenannter vaterländer – welche fahne soll ich abwerfen?“ – nämlich aus der Gondel seines Luftschiffes über dem Nordpol.
Von den sein Werk bestimmenden Zügen des Dichters läßt sich mit der geringsten Gefahr einer Verkennung die an Joyce und Pound gemahnende Vielsprachigkeit nennen, die in sein Kreatives derart einfunktioniert ist, daß seine Übersetzungen stets zugleich eigenständige poetische Leistungen darstellen die Einbeziehung fremden Idioms ins eigene Werk (und zwar sowohl von – vorzugsweise fernliegendem – Fremdsprachigem, als auch von Frühformen des Deutschen) ohne Einbuße an Eigensprachigkeit erfolgt. Anders gesagt: was an Sprache, ungeachtet woher, Artmann verwendet, wird unverwechselbar Artmann.
Dies zeigt sich besonders deutlich an seinen kühn innovativen Texten aus der Kooperationsphase innerhalb der Wiener Gruppe, die sich bei heutiger Betrachtung, nach nunmehr zwei Jahrzehnten, nahtlos ins übrige Werk einfügen, ohne Notwendigkeit des Verweisens auf die Bedingungen ihres Entstehens. Daß das gleiche im chronologischen Ablauf von Rühms Werk für diese Phase gilt, zeigt nicht nur Rühms Stärke, sondern läßt Rückschlüsse auf Artmanns Respektierung der Andersartigkeit eines großen Talents und damit auf seine Rolle innerhalb der Wiener Gruppe zu. (Erinnernd darf man ergänzen, daß Rühm die Gestik etwa der schäferischen Schwärmerei in Freundschaft zum Meister vorzüglich beherrschte, ohne sie deshalb ins eigene Werk einzubeziehen.) Artmanns Biographie zeigt ihn schon in frühesten Jahren die Fundamente seines Wirkens errichtend etwa indem er sich bereits vierzehnjährig dem Walisischen und Schwedischen zuwandte, zwei für ihn später sehr ergiebigen Sprachquellen.
Um nochmals an den Flug im Luftschiff anzuknüpfen: die Weisheit Artmanns ließ ihn nie auf den irdischen Kontakt verzichten – zu diesem Zweck bediente er sich der verschiedensten Muster aus der Volksdichtung und der Populärliteratur.
Auf seinen Reisen, vorzugsweise in die westliche Welt, schloß er sich an den pulsierenden Kreislauf der von ihm studierten und assimilierten Sprachen und Literaturen an, frischte sein Herz auf und schickte die Sprache, woher immer sie kam, zu ihrer weiteren poetischen Erziehung ins fremdländische Leben.
An die unüberbietbare Auszeichnung, die sein Werk ihm verleiht, schließen sich Zeichen der Anerkennung seines Wirkens für die Öffentlichkeit in Gegenwart und Zukunft: der Große Österreichische Staatspreis; die Aufnahme in die Akademie der Künste, Berlin; jetzt der Preis der Stadt Wien für Literatur. Es kann also nicht als Verletzung privaten Bodens mißdeutet werden, das Datum der heutigen Würdigung als zwölf Tage vor seinem neuesten Geburtstag liegend zu markieren, um mit dem Ruf zu schließen: Lang lebe Artmann!
Ernst Jandl, Literatur und Kritik, Heft 12, 1977
Die „Bibliothek H.C. Artmann“ als posthumer Epitext
I.
Es gibt ein Element in der Biografie von AutorInnen, das in Beziehung zu allen Façetten ihres Werks steht: ihre private Bibliothek. Die Autorenbibliothek ist der intertextuelle Brennpunkt, an dem die Fäden der ästhetischen und politischen Einflüsse von Autorinnen zusammenlaufen und die ein manifester Ausdruck ihres kulturellen und materiellen Kapitals ist (vgl. Bourdieu 1992), das über die Anzahl der vorhandenen Widmungsexemplare oder den finanziellen Wert der Bücher eingeschätzt werden kann. Anhand der in einer Bibliothek vorhandenen Druckschriften ist es möglich, Erkenntnisse über die von den AutorInnen betriebenen Quellenstudien und ihre Rezeption ästhetischer Vorlagen, kulturgeschichtlicher Phänomene und historischer und politischer Sachverhalte zu gewinnen. Darüber hinaus können über scheinbar nebensächliche Beobachtungen wie den äußerlichen Zustand der Bücher (Schäden, Einträge etc.) Rückschlüsse über den Grad der Verwendung einzelner Bücher und nicht zuletzt über das Verständnis von AutorInnen vom ideellen bzw. materiellen Wert eines Buches gezogen werden. Eine mehr oder weniger vollständige Bibliothek, d.h. die darin enthaltenen Bücher, stellen sozusagen ein Netz von Schnittpunkten zwischen der materiellen Realität der AutorInnen und der Fiktion ihrer Werke dar.
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Nachlassbibliothek Hans Carl Artmanns, die 2006 in einer Ausstellung der Wienbibliothek im Wiener Rathaus unter dem Titel „Wann ordnest Du Deine Bücher?“ Die Bibliothek H.C. Artmann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im Jahr 2004 erwarb die Wienbibliothek im Rathaus von der Witwe Artmanns, der Schriftstellerin Rosa Artmann, den Nachlass des Dichters, der aus einem kleinen Teil handschriftlicher Dokumente1 und zum größeren Teil aus seiner privaten Bibliothek2 besteht. Ein schön gestalteter Ausstellungsband, der den Titel der Ausstellung trägt, beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte der Ausstellung und einzelnen Buchexponaten. Sylvia Mattl-Wurm, die Leiterin der Wienbibliothek, umreißt in ihrem Vorwort den Wert der Ausstellung, aber auch die Probleme, die diese Art der Nachlassaufbereitung mit sich gebracht hat (Mattl-Wurm 2006). Die Bücher haben teilweise großen bibliophilen Wert, sind aber zum Teil in schlechtem Zustand, was Artmanns Auffassung von seinen Büchern als seinen Werkzeugen widerspiegelt. Mattl-Wurm geht auch auf die Besonderheit der Entscheidung ein, den Nachlass als Ausstellung zu präsentieren, die der Öffentlichkeit und vor allem der Literaturwissenschaft die Möglichkeit zu Einblicken in Artmanns persönlichen „Kanon“ gibt. Sie spricht aber zugleich das Problem der Unvollständigkeit der Bibliothek und der fehlenden Systematik in der Ursprungsbibliothek an. Vor allem die natürliche Unvollständigkeit von Nachlassbibliotheken relativiert natürlich die Ergebnisse bis zu einem gewissen Grad, was auch für die vorliegende Untersuchung gilt.
Der Begleitband, der notwendigerweise in seinem Betrachtungsspektrum stark eingeschränkt bleiben muss, enthält durchaus anregende Beiträge zu formalen Aspekten des Bestandes, wie den Widmungsexemplaren (Stefan Alker) oder den Comics (Stefan Winterstein), und beschäftigt sich mit Artmann dem Büchersammler und -verlierer (Marcel Atze und Hermann Böhm, Barbara Wehr), dem Leser (Marcel Atze) und Übersetzer Artmann (Christopher Frey und Klaas Ilse) sowie dem Barockaspekt in Artmanns Werk. Der Dichterpersönlichkeit Artmann sin die persönlich-subjektiven Beträge von Peter Rosei und Jean-Paul Jacobs gewidmet.
II.
Bekanntlich ist eines der Probleme der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Artmanns Werk, dass sich der Autor einer jeden Verortung im Kontext verweigert, sei es aus Abneigung gegenüber der Forschung, aus Gründen persönlichen Reflexionsunwillens oder als schriftstellerische Strategie, von schreibtechnischen Mängeln mit dem Hinweis auf die Einzigartigkeit des Texteffekts abzulenken. Im Bewusstsein der Unvollständigkeit des Bestandes, der nie alles enthalten könnte, was der Autor je gelesen hat, und der damit verbundenen Unmöglichkeit absoluter Ergebnisse lässt die Nachlassbibliothek dennoch wichtige Einblicke in die Arbeits- und Rezeptionsweisen diese der Literaturwissenschaft gegenüber so defensiven Autors zu und macht damit einen weiteren Schritt in der Annäherung an eine Verortung Artmanns in seinem historischer Kontext möglich.
Dieser Beitrag widmet sich daher auch dem Textsammler und „Akkumulator“ Artmann, der die Akkumulationstätigkeit und eine betonte Abwesenheit von Form zum poetischen Prinzip macht. Für ihn ist das Buch ein objet trouvé (Bürger 1974: 78), das von ihm in Besitz genommen, auch im haptischen Sinne begriffen und verwendet wird. Für ihn sind seine Bücher belebte Objekte in einem Universum, dessen Bezugspunkt der Sammler ist. In einem Interview im Jahr 2000 entgegnet Artmann auf die Frage des Interviewers, Lars Brandt, warum er in Wien lebe:
Ich muß. […] Ich hätte sie schon längst aufgegeben, die Wohnung. Aber ich kann die Bücher nicht aufgeben. Ich wollte ein Waisenhaus, ein Orphaneum für Bücher machen. Damit die Bücher nicht in alle Welt verstreut werden. Da sammelt einer ein ganzes Leben an Büchern, und dann, zack, stirbt er, und dann sind die völlig zerstreut, liegen die herum. […] Ich hatte mal einen Traum, da hatte ich die ganzen Bücher beieinander, und da war ich sehr begeistert. Irgendwo in einer deutschen Provinzstadt […]. In einem Gebäude, wo man hingehen kann.
(Brandt 2001: 26f)
In dieser Äußerung gibt Artmann den Rahmen für die Erhaltung seiner Bücher als Bibliothek vor. Da er die Bücher als Waisen bezeichnet, versteht er sich selbst offenbar als deren Vater im übertragenen Sinne. Er suggeriert, dass nicht nur er etwas aus den Büchern bezogen hat, sondern dass auch die Bücher durch ihren Besitzer eine neue Qualität erhalten haben, in dem sie in dessen „Familie“ (d.h. in das Werk) integriert wurden. Im selben Absatz des Interviews bestätigt er, dass seine Büchersammeltätigkeit keinen bestimmten Kriterien folgte und lediglich von „Laune und Lust“ bestimmt war (Brandt 2001: 27). Er sagt auch, dass diese wiederum gesteuert würden vom „Interesse an den Büchern. Der Geruch“ (27). Begleitet wird der Text von einem Foto des Schriftstellers, der sein Gesicht in einem Buch vergräbt und am Papier bzw. am Text zu riechen scheint. Auch auf die Frage, was poetische Substanz für ihn wäre, antwortet er:
Das ist eine reine Gefühlssache. […] Man riecht es förmlich. (111)
Diese Gesprächsstelle einschließlich der abgebildeten Pose des „sinnlichen Bücherliebhabers Artmann“ drückt deutlich ein essentielles Element seiner schriftstellerischen Motivation und einen Ursprung und Ausgangspunkt seiner poetologischen Praxis aus. Es zeigt, worum sich seine Existenz als Dichter gelagert hat bzw. welchem Verständnis von Material und Materiellem3 sie gefolgt ist, nämlich dem (An-)Sammeln von Büchern und seinem intellektuellen aber vor allem auch sinnlichen Vergnügen an ihnen und ihrem Inhalt, das er zu versprachlichen sucht. Marcel Atze bringt diesen Sammeltrieb zu Recht in Verbindung mit Artmanns Rezeption von Carl von Linné, an dem Artmann die poetische, aber auch die existenzielle Qualität der Kategorisierung faszinierte (vgl. Krüger 1992: 13f). Atze hängt der Beschreibung eines Gedichtbandes von Friedrich von Matthisson von 1810 aus der „Bibliothek H.C. Artmann“ (im Folgenden „Bibliothek HCA“ genannt) ein Foto einiger von Artmann gepresster Pflanzen an (Atze/Böhm 2006a: 86) und suggeriert damit, dass man diese Pflanzensammeltätigkeit als eine Art Nachahmungsversuch von Linnés Kategorisierungsarbeit sehen kann. In der Linné-Rezeption war sein Interesse auf das abenteuerliche und poetische Moment des Findens und Aufnehmens gerichtet, was spätestens seit Klaus Reicherts Ausführungen zu Artmanns „Poetik des Einfalls“ als „Grundzug der Verfahrensweise der Texte“ (1992: 120) und Mittelpunkt seines schöpferischen Verfahrens verstanden wird.
Auch Jörg Drews hat diesen Sammeltrieb als ästhetischen Prozess begriffen und sieht Artmanns künstlerischen Anspruch darin, „Sammelinkarnation“ aller Dichter und Dichtungen sein zu wollen (1992: 174). Artmann ist, wie die Forschung weiß, in mehrfacher Hinsicht ein Akkumulator. Er sammelt und vereint Dichterposen, Dichtermythen, Stoffe, Stile, Figuren, Namen und Diskurse und verdichtet sie zu atmosphärischen Texten. Daher sollte jede Beschäftigung mit seinem Werk auch eine intensive Beschäftigung mit Quellen, historischen Diskursen und Poetiken sein, da sie zu einem Subtext beisteuern, mit dem man unter anderem das Sinnliche an seiner Schreibweise annähernd verorten kann.
Dieser Subtext steht im Zentrum unserer Betrachtungen und basiert vor allem auf den Arbeits- und Gebrauchsspuren in und an den Büchern. Diese Spuren sind einerseits Unterstreichungen (einfach, doppelt) unter den Zeilen und Markierungen einzelner Wörter durch Einkreisung bzw. ganzer Absätze am unteren oder seitlichen Rand. Sie sind mit verschiedenen Schreibgeräten angebracht (Bleistift, Kugelschreiber, Leuchtstift: Artmanns Tendenz zur Selbstinszenierung und zur Inszenierung des Materials ist interessanterweise nicht im verhältnismäßig sorglosen Umgang mit seinen Büchern fortgesetzt, wie die teilweise eilig wirkenden Markierungen zeigen).4 Ein kleinerer Teil der Markierungen sind Satzzeichen (Frage- und Rufzeichen) und glossarartige Einträge, die im Ausmaß von einem Wort (besonders bei Übersetzungen) bis zu mehreren Sätzen, die oft nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Text stehen, variieren.
Der Ansatz, der es uns erlaubt, diese Arbeitsspuren als einen Text zu verstehen, ist Gérard Genettes Konzept des Epitexts, der definiert wird als
jedes paratextuelle Element, das nicht materiell in ein und demselben Band als Anhang zum Text steht, sondern gewissermaßen im freien Raum zirkuliert, in einem virtuell unbegrenzten physikalischen oder sozialen Raum. Der Ort des Epitexts ist also anywhere out of the book, irgendwo außerhalb des Buches […].
(Genette 1989: 328)
Die in Artmanns Bibliothek vorhandenen Bücher stellen, wie bereits angedeutet, einen beachtlichen Teil der Quellen für jene Inhalte und Formen dar, die als „Lesefrüchte“ des Autors von Artmann durch nichts als das Element der „wertfreien Gleichzeitigkeit (1970: 373), wie er es selbst ausgedrückt hat, strukturiert werden. Dieser Aspekt der „wertfreien Gleichzeitigkeit“ führt den Blick bereits über die Textgrenzen hinaus und schließt auch Elemente außerhalb des Textes, die nicht notwendigerweise auch ein Text sein müssen, mit ein. So können die einzelnen Quellen durch die in ihnen enthaltener Arbeitsspuren und Einlagen5 (handgeschriebene Zettel, Adressen, Artmanns eigene Visitenkarten, gepresste Blumen usw.) als Teil eines posthumen „öffentlichen Epitexts“ im Sinne Genettes rezipiert werden, d.h. sie können als Text begriffen und mit herkömmlichen Instrumenten der Textanalyse erfasst werden. Die literaturwissenschaftliche Spurensuche geht über den Text und seine Bezüge zu den Quellen hinaus und macht auch Phänomene, die ursprünglich kein Text im engeren Sinne sind (wie z.B. Besitzeinträge, von denen später noch die Rede sein wird, Widmungen, Markierungen und sogar Gebrauchsspuren, die die Gestalt des Buches verändern), urbar für eine Interpretation des Assoziationsgeflechts von Artmanns Leben und Werk.
Auch die Bibliothek in ihrer Gesamtheit ist, wie gleich deutlich werden wird, effektiv als Text zu verstehen, weil die Buchsammlung als solche durch die Ausstellung zu einem rezipierbaren Textkunstwerk erhoben worden ist, ähnlich einem Mosaik aus Texten, das aus zahllosen interpretierbaren Texteinheiten und -ebenen besteht. Die ordnenden Kräfte dabei sind Artmann selbst, der die Bücher zusammengeführt hat, und die Kuratoren der Ausstellung, Hermann Böhm und Marcel Atze. Die Entscheidung der Bibliotheksleitung und der Kuratoren, die Bibliothek nicht sofort in den Gesamtbestand zu integrieren und sie so gewissermaßen als museales poetisches Gesamtkunstwerk6 zu erhalten, das den Stellenwert der literarischen Quellen im Werk Artmanns hervorstreicht, würdigt posthum dessen Selbstbegriff als „abenteurer nicht dichter“ (zit. in Hofmann 2001: 25), für den der Lese- und Schreibprozess entscheidend von Abwechslung geprägt ist. Die Realisierung des Ausstellungsprojekts als solches ist bemerkenswert, weil es in rezeptions- und produktionsästhetischer Hinsicht nicht nur ein unbürokratisches Quellenstudium und eine ebensolche Nachlassbearbeitung in der Praxis ermöglicht, sondern auch zu interessanten theoretischen Überlegungen zum Verhältnis des Dichters zu seinem „Werkzeug“ anregt. Die Existenz der Ausstellung ist nicht nur ein deutlicher Ausdruck dafür, dass Artmanns Einfluss auf die Literatur auch von offizieller Seite her gewürdigt bzw. akzeptiert wird, was angesichts der Anfeindungen der Öffentlichkeit gegenüber den „Entartmännern“ (Atze/Böhm 2006a: 29) in den 1950er Jahren auch im Hinblick auf die Rezeption das Ende eines Lernprozesses darstellt. Sie ist zudem Ausdruck dafür, dass der Zusammenhang zwischen der „Dichterpersona“ Artmann und dem Werk, der von grundsätzlicher Bedeutung für seine poetische Praxis war, als poetisches Verfahren (Leben als Werk) akzeptiert ist. In der Aneignung durch den Dichter sind die Bücher Teil des Werkes geworden.
Mit Genette gesprochen rangiert die Bibliothek HCA zwischen einem „offiziösen allographen Epitext“ (1989: 332), – das sind der vom Autor autorisierte Epitext bzw. die Besitzeinträge und schriftlichen und persönlichen Posen, d.h. jene Einträge und Verhaltensmuster im Zusammenhang mit seinen Büchern, die sich an einen Rezipienten richten – und einem „privaten Epitext“ (354). Die Aura des Privaten manifestiert sich in den zahlreichen Bucheinlagen und den schon besprochenen Arbeitsspuren, die nur für seine eigenen Augen bestimmt waren. Paradoxerweise ist die Bibliothek HCA auch von ihm selbst als Ausstellung gewollt und wird so zu einem öffentlich zugänglichen Textkonvolut. Er wollte ein „Orphaneum“ für seine Bücher, seine Werkzeuge, sein Material, und hat damit auch ungewollt eine Brücke zu seiner Person geschlagen.
Die epitextuelle Lesart ist eine Möglichkeit, das greifbar zu machen, was Klaus Reichert als „Schwebende Wirklichkeiten […] imaginierte[] Sprachräume […] Die Pose als ein Schweben“ (2003: 750, 753, 755) bei Artmann bezeichnet hat und was er selbst u.a. unter dem „poetische[n] act“ (2003: 748) versteht: eine Dichterexistenz, die sich auch allein in einer Beziehung zum Material (Wort, Buch) manifestiert, ohne dass ein Wort geschrieben worden ist. Alles Geschriebene wird als „wiedergabe aus zweiter hand“ (748) abgelehnt und wird daher notwendig zu einer Annäherung an das wesentlich Poetische reduziert. Die „pose in ihrer edelsten form“ (749) aber ist ein poetischer Akt und ist daher weniger annähernd als das Wort; damit ist sie in seinen Augen präziser poetisch. Die Beschäftigung mit Artmann ist also immer auch eine Annäherung an die Annäherung und eine Beschäftigung mit dem Paradox, dass nämlich die Werkbeschreibung an Schärfe verliert, je mehr die Konzentration auf die Textstruktur gerichtet ist. So sind die Aspekte, die für seinen Poesiebegriff wesentlich sind, am ehesten über jene werkbezogenen Phänomene zu definieren, die an der Peripherie des Werks angesiedelt sind, wie die Bücher der Bibliothek HCA.
Es gibt ein Exponat in der Bibliotheksausstellung, das als Symbol für Artmanns, Literatur- bzw. Poesiebegriff gesehen werden kann und dass zugleich zum physischen Ausdruck für seine Pose als dichtender Abenteurer7 wird. Es ist ein an der Ostfront 1941 von Kugeln durchbohrtes Wörterbuch, das ihm das Leben gerettet haben soll. Laut Marcel Atze
hütete [Artmann] das Stück wie seinen Augapfel und war sehr wählerisch in der Frage, wem er den devotionaliengleich behandelten Gegenstand vorführte. Hans-Christoph Buch […] erinnert sich, daß der Band „nur wenigen Auserwählten“ gezeigt wurde. Diesen Betrachtern wird es schwergefallen sein, sich der auratischen Wirkung des Buches zu entziehen.
(Atze 2006a: 10)
Wir haben hier ein Buch, das Artmann inhaltlich (als Wörterbuch war es für ihn eine Art „Einfallsgenerator“; siehe Reichert zur „Rasterung“; 1992: 118), aber auch durch seine Geschichte (als lebensrettender Gegenstand in seinen historischen Kontext eingegliedert) stimuliert hat, und dessen existenzielle Symbolik, die aus der Engführung von Sprache bzw. Literatur und Tod resultiert, er durch eine devotionaliengleiche Behandlung des Buches perpetuiert. Der Akt des Herzeigens bestätigt, dass er die Bedeung dieses zufälligen Zusammentreffens von Buch und Gewehrkugel als schicksalhaft und etwas, das über den Zufall hinausgeht, interpretiert. So wird dieses Buch in der Bibliothek zu mehr als einer Textquelle. Es wird durch seine physisch veränderte Gestalt einer Quelle für Überlegungen zu seiner poetischer Motivation, die eng mit der Nahtodeserfahrung verknüpft ist. Eine genaue Untersuchung, wie der Einfluss dieser Erfahrung auf Artmanns Werk aussieht, steht noch aus. Es ist jedenfalls anzunehmen, dass die biografischen Einschnitte der Nahtodeserfahrung (diese Erfahrung wiederholt sich für ihn, als er 1945 wegen Desertion zum Tod verurteilt wird; Atze/Böhm 2006: 223) seine Konzentration, sein Drängen auf permanente Bewegung im ästhetischen und persönlichen Sinn, sehr beeinflusst, wenn nicht angeleitet hat. Das Schlimmste für Artmann ist es, in schriftstellerischer Hinsicht zu stagnieren und, wie er Kurt Hofmann erzählt, den folgenden Satz zu hören:
Sie haben Ihren Stil gefunden. Wie erbärmlich. (zit. in Hofmann 2001: 119)
Um seinen Stil eben nicht zu finden, verharrt er in der permanenten Annäherung an seine Quellen und bedient sich des literarischen Verfahrens der Appropriation.
III.
Die Appropriation ist im Gegensatz zur literarischen Adaption der Bezug auf eine Quelle, der im Rahmen einer Bewegung weg vom informativen Quellentext und hin zu gänzlich neuen kulturellen Produkten und Domänen geschieht. Oder auch: die Spuren der Quelle sind erkennbar, aber durch die Neuheit des Ergebnisses verwischt. In ihrer Einführung zum Thema beschreibt Julie Sanders die literarische Appropriation analog mit dem ursprünglich naturwissenschaftlichen Prozess der Infiltration als einen Schöpfungsprozess und assoziiert ihn mit einer organischen, aktiven Veränderung; Sanders unterscheidet hierbei zwischen „embedded texts“ und „sustained appropriation“ (vgl. 2006: 24ff). Letztere bezieht sich auf die Techniken, die unter den Begriff des „creative borrowing“ fallen, wie die bricolage, und die bewusst eine spielerische Herausforderung zur Quellensuche an die RezipientInnen stellen.
Artmann appropriiert den Inhalt der Bücher in seinem Besitz assoziativ oder kontrastiv, d.h. seine eigenen Texte tragen in sich Spuren aus diesen Quellen, die den Inhalt oder die Form ergänzen, oder die Spuren werden umgekehrt aus ihrem Sinnzusammenhang gelöst und, in extremeren Fällen, pervertiert. Die letztere Art der Textappropriation ist die quantitativ leichter identifizierbare, da alle Zitate, die er in sein Werk einschließt, im Grunde zum Zweck der Spurenverwischung und Leserirreführung immer im Kontrast zum Ursprungstext stehen. Ein deutliches Beispiel für so eine kontrastive Quellennutzung ist die deutschsprachige Groschenroman-Reihe Lord Percy vom Excentric Club, der Held und kühne Abenteurer in 197 geheimnisvollen Aufgaben, die ab 1914 bei Mignon in Dresden erschien und von der Artmann einen reprografischen Nachdruck (Foltin 1972) besaß, den er 1972 erworben hatte. Um den Kontrast in der Appropriation herausarbeiten zu können, kommen sowohl editionsgeschichtliche als auch biografische Details zum Tragen. Bei Artmann sind in der Geschichte „Ein gefährliches Abenteuer“ aus dem Band Die Anfangsbuchstaben der Flagge (1997, II: 355–361), der bereits 1969 erschienen ist, zwei direkte Verweise auf einen „Modern Eccentric Club“ zu finden (356f), wobei dieser Club, „dessen mitglieder fast durch die bank aus familien stammen, die bereits mit den pilgervätern ins land kamen“ (357), und der als Club per se als kulturelles Signal für upper-class-Elitismus und Snobismus verstanden wird, von Artmann im Rahmen einer Detektivgeschichte in ein Naheverhältnis mit kannibalistischen Praktiken gebracht wird:
Aber das, was der weißhaarige butler auf das silberne tablett legte, war nichts weniger als ein gepökeltes menschenbein! […] „Teufel, jetzt erkenne ich das wahre gesicht des Modern Eccentric Club […]“
(1997, II: 357).
Außerdem fließt die Idee des Eccentric Club auch als genrevorgebender Titel in eine Sammlung von Detektivgeschichten deutschsprachiger Autoren mit ein, die von ihm herausgegeben worden ist, das Detective Magazine der 13, da der „Club der 13“ synonym mit dem Eccentric Club ist.
Die Verwendung des Eccentric Club als Motiv ermöglicht also einerseits Aufschlüsse über Artmanns Verwendung populärkultureller Phänomene im Werk (auch im Hinblick auf das Verhältnis seiner Rezeption von Buch und Fernsehen), andererseits über sein Interesse an der kritischen Einführung dieser fiktionalen Phänomene in die Realität, etwa in der Engführung von herrschender Elite und Kannibalismus (der bei ihm ohnehin ein eigenes Thema ist, wie Jacques Lajarrige bereits nachgewiesen hat; 1992). Über den Quellentext wird uns so eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Clubbildungsphänomen und Artmanns gesellschaftskritischem Interesse daran erleichtert. Zudem lassen sich wiederum einige soziobiografische Schlüsse im Zusammenhang mit seiner Außenseiterposition in der Wiener Gruppe ziehen. Eine elitäre Haltung widerstrebte ihm, da sie eine gewisse Volksfremdheit und traditionelle Gebundenheit an das Bildungsbürgertum, dem er ursprünglich nicht entstammte, wiedergibt. Man kann annehmen, dass ein beträchtlicher Teil seiner bekannten Widerborstigkeit in den Fragen nach ästhetischen und biografischen Kategorisierungen seiner Person und seines Werkes durch diese Abneigung motiviert ist. So ist es weiter nicht verwunderlich, dass er auch die Existenz einer „Wiener Gruppe“ bestritt, die in gewisser Hinsicht auch als „Club“ rezipiert wurde (vgl. Krüger 1992: 15f) bzw. die sich selbst als ästhetisch elitäre Gruppierung gerierte, wie Gerhard Rühms Ausführungen im Vorwort zur Anthologie Die Wiener Gruppe bestätigen:
[Es gab das] bewusstsein eines exklusiven niveaus, auf dem nur unsere eigenen kriterien angemessen und akzeptabel waren. und eben eine kluft zwischen unseren und den kriterien oder fehlenden kriterien unserer kollegen setzte uns von ihnen als „gruppe“ ab.
(Rühm 1967: 12f)
Dieses Beispiel demonstriert, wie eine kontrastierende Textappropriation (der Modern Eccentric Club als Kannibalenvereinigung) interpretativ weitere Assoziationsketten ermöglicht. So lässt auch die Diskrepanz zwischen dem Erscheinungsdatum des Texte (der den Verweis enthält) und dem Erwerb des Quellentextes Rückschlüsse über verschiedenen Modi der Adaption in Artmanns poetischem Produktionsprozess zu. Der Impuls für ihn, diesen populären Stoff zu bearbeiten, erfolgte aus anderen Quellen, in diesem Fall war es wahrscheinlich die ZDF-Fernsehserie Perry Stuart (vgl. Krimiserien 2008), die ab dem 12.3.1969 erstausgestrahlt worden war. Artmann hielt sich 1968 in West-Berlin auf, sein Umzug nach Frankreich erfolgte im Jahr 1969, Barbara Wehr nennt den April 1969 als ersten Monat, in dem er eine Wohnung in Frankreich (Paris) gemietet hatte (Wehr 2006: 118). Es ist also wahrscheinlich, dass er die Erstausstrahlung in Deutschland verfolgt, das Eccentric Club-Motiv für Die Anfangsbuchstaben Flagge adaptiert und dann den Repro-Druck des historischen Originals aus den 1920ern erworben hat. Diese Vorgehensweise würde auch vermuten lassen, dass er einerseits in erster Linie immer an der Originalquelle interessiert war und dass die Originaltexte ihn andererseits eine gewisse „poetische Qualität“ besitzen mussten, die er für sein Werk für unabdingbar hielt, sonst hätte er das Buch nicht gleich nach Erscheinen der TV-Serie erworben und bei seinem Wegzug aus Rennes mitgenommen. Bei Wehr ist dokumentiert, dass er seine Bücher aus Rennes zum größten Teil zurückgelassen hat (118).
IV.
Im Unterschied zur Adaption resultiert die Appropriation in einer komplett überdachten Neuschöpfung. Das deckt sich mit Artmanns Grundanspruch, immer Neues zu schaffen. Seine primäre Motivation war es, „abgebrauchte Ausdrücke wieder auf[zu]frischen. […] [Es geht] nicht um den Inhalt – der Sinngehalt entsteht von selbst. Aber [es geht] um dieses syntaktische Erlebnis, das philologische Abenteuer“ (zit. in Schmölzer 1973: 28). So sieht er 1973 seine Prioritäten: ausschließlich in der Erneuerung bzw. der „Wiederauffrischung“ der Sprache oder eben, in Bezug auf die Definition von Appropriation, in neu geschaffenen Ursprungstexten. Die Wiederauffrischung ist die essentielle literarische Strategie in seiner poetischen Produktion und schließt die Verfahren der Imitation und der Übersetzung8 mit ein. In einem Gespräch mit Lars Brandt bemerkt er auch noch in seinem letzten Lebensjahr zum größten gemeinsamen Nenner seines Werks:
Der Grundtenor ist schon der gleiche. Es ist immer das Unerwartete, das Abenteuerliche. (Brandt 2001: 81)9
Die Perpetuierung des literarischen Abenteuers durch eine permanente und von ihm nicht näher definierte Erneuerung oder Anpassung der Sprache ist ihm wichtig. Das Abenteuerliche in der Sprache steckt aber in der Semantik, die eben nicht nur, wie er behauptet, „private Einzelheiten“ (1970: 375) sondern auch kollektiv konnotiert sind. Er adaptiert und erneuert in seinem Werk weit mehr als nur Morpheme bzw. Syntaxstrukturen,10 und der Sinngehalt seiner Texte ist durchaus gegeben, wenn auch vor allem in Formen, die die Texte auf der Bedeutungsebene unzugänglicher machen, wie z.B. im Fragmentarischen (vgl. das Register der Sommermonde und Wintersonnen) oder im Motivischen (z.B. dem Hexen-Motiv in Von einem verzauberten Husaren). Sein Werk ist das Ergebnis einer Kombination zahlloser sinntragender Inhalts- und kultureller Phänomenfragmente (z.B. dem Kannibalismus und den Weltschöpfungsmythen in Die Sonne war ein grünes Ei, der nordischen Mythologie in Die Heimholung des Hammers, dem barocken Heldentypus in Von denen Husaren und anderen Seil-Tänzern und verschiedenen Trivialmythen aus der Populärliteratur wie in Frankenstein in Sussex), die durch die Klitterungen literarischer Verfahren so verarbeitet werden, dass sie ihren Quellen und Kontexten komplett entfremdet sind.
Die Tatsache, dass dieses extensive und deutliche Sichhinwegsetzen über formale und kanonische Grenzen von einer persönlichen Motivation des Autors gespeist ist bzw. durchaus Bedeutung im historischen Zusammenhang hat, klammert Artmann unter dem Siegel der „Privatheit“ in seinen wenigen poetologischen Äußerungen aus, und die Frage bleibt, inwieweit dieses Vorgehen gewissen Mustern folgt oder vom biografischen Kontext beeinflusst ist bzw. wie zufällig seine „Einfälle“ wirklich sind. Auch hier vermag der posthume Epitext der Arbeitsspuren zu helfen, zumal er der Zufälligkeit der Einfälle einen Kontext gibt. Vor der Folie der Appropriation werden in diesem Beitrag Ansätze zu einer Untersuchung der Art und Weise angeboten, wie die Bücher der Bibliothek HCA eine kontrastive, ergänzende und assoziative Funktion als Materialsammlung und Assoziationsarsenal im Werk einnehmen.
Zuvor sollten jedoch ein paar Worte zur Rolle des Schriftbildes bei Artmann gesagt werden, weil seine Textaneignung bereits beim Schriftbild beginnt, dessen Wichtigkeit für seine Verortung in der Moderne sich durch die im Werk prominente Kleinschreibung manifestiert. In der Bibliothek HCA befindet sich eine große Zahl an Büchern, deren Besitzeinträge in Artmanns Handschrift (die sich im Lauf der Zeit ebenfalls verändert und zunehmend weniger kalligrafischen Anspruch zeigt) nicht nur Ort, Datum oder Jahr des Buchkaufs und seinen Namen zeigen, sondern auch teilweise in Anlehnung an den Inhalt oder die Sprache, in der der Text verfasst ist, formuliert sind.
Ein sehr schönes Beispiel dafür findet sich in Boris Manassewitschs Die Kunst, die arabische Sprache durch Selbstunterricht schnell und leicht zu erlernen (um 1900). Artmann macht zwei Einträge: „Hans Carl Artmann 56“ in kalligrafischer Anlehnung an die arabischen Schriftzeichen und einen Eintrag in arabischen Lettern. Es ist überhaupt allgemein zu beobachten, dass nur die frühen Besitzeinträge aus dem Jahr 1943 überwiegend in leicht leserlicher Schrift verfasst sind und Aufmerksamkeit für das Detail zeigen. Diese Sorgfalt der frühen Jahre lässt vermuten, dass er die Werke nicht nur in ihrem ideellen Wert sondern auch in ihrem Seltenheitswert schätzte, den viele Bücher auf dem Kriegsmarkt hatten.11 Spätere Einträge bestehen entweder ausschließlich aus in pragmatischer Schreibschrift verkürzt verfassten Besitzeinträgen, die nur den Namen, das Jahr und – wenn überhaupt – den Ort angeben, oder sie sind manierierte Einträge in anderen Sprachen (etwa der Eintrag „Hans Carl Artmann, julio 1950“ im Gedichtband Poemas Arábigoandaluces von Emilia García Gómez) mit zusätzlich kalligrafischem Einschlag, wie es eben in Manassewitschs Buch oder beim Eintrag „John C. Artmann / Vienna 16. Nov. 1945“ für einen Band aus der Reihe Altenglisches Theater (hg. von Robert Prölß) der Fall ist. Letzterer Eintrag ist in Großbuchstaben verfasst und stellt eine Mischimitation der Schriftarten/Fonts Bodoni und Baskerville Old Face dar. Beides sind Fonts, die ihren Ausgang im 18. Jahrhundert in Großbritannien nahmen, wo sie neue Druckstandards setzten. Der Engländer John Baskerville war seit 1758 mit der Cambridge University Press assoziiert und hatte den Font von Giambattista Bodoni, der seit 1768 der Hofdruckerei in Parma angehörte, adaptiert (vgl. Benton/McRae 2003; Pankow 1998). Diese Font-Imitation Artmanns weist darauf hin, dass er stark von der angloamerikanischen Literatur beeinflusst war, und sie zeigt, dass die Kulturtechnik der Kalligrafie, in der die Imitation eine Rolle als meditatives und ursprünglich sakrales Element spielt, das der Verinnerlichung bzw. Ehrerbietung dem Original gegenüber dient, offensichtlich auch Teil seines schriftstellerischen Formungsprozesses war.
Auf die Frage, worum es ihm beim Schreiben und im Leben gehe, lautet Artmanns Antwort,
um die Buchstaben […] Um das Sprachbild. […] Und unsere Schrift ist nicht so besonders schön, im Gegensatz zum Arabischen. Das ist herrlich, da kann man ja wunderschön schreiben. […] Jetzt rein vom Ästhetischen her schreibe ich klein […] Das ist keine Snobberei, kein Snobismus gewesen, daß ich das [i.e., Nachrichten aus Nord und Süd, Anm. d. Verf.] klein geschrieben habe und ohne Satzzeichen. Es ergeben sich Verbindungen nach hinten und nach vorne. […] Je nachdem, wie man es liest. Man kann mittendrin anfangen.
(zit. in Brandt 2001: 130, 132)
Auch zu diesem Zitat, das sich nahtlos in das ästhetische Beziehungsgefüge seines Werkes, in dem die Reduktion von Form auf ein Minimum betont wird,12 einordnen lässt, gibt es einen epitextuellen Anknüpfungspunkt in Manassewitschs arabischer Sprachlehre. Auf dem hinteren Buchdeckel innen findet sich ein handschriftlicher Vermerk Artmanns: „S. 16 fehlende Interpunktion“. Auf der besagten Seite 16 wiederum ist jener Absatz am Rand markiert, in dem es um den Mangel an Satzzeichen geht. Auffällig in diesem Text ist die eurozentrische Sicht der Dinge, in der davon gesprochen wird, dass „der Araber [nicht] das Bedürfnis [fühlt], dieselben [d.i. Satzzeichen] zur Darstellung zu bringen“; dass aber bei „einem tieferen Eindringen in die arabische Sprache […] auch der Ausländer die Interpunktionszeichen fast ebensowenig [vermisst] wie der Araber selbst“. Im Interview mit Lars Brandt wiederholt Artmann diesen Befund Manassewitschs fast wörtlich:
Im Arabischen gibt es auch keine Satzzeichen, keine Kommas. Nun, man liest sich schon ein. Es gibt da so Querverbindungen.
(2001: 83)
Diese inhaltliche Wiedergabe des Quellentexts zeigt deutlich, dass Artmann die Bücher, wie zu erwarten, zur sekundären Wissensvermittlung herangezogen hat. Zu bemerken ist hierbei der Grad der Zufälligkeit bei dieser Art der autodidaktischen Wissensvermittlung. Seine (Selbst-)Ausbildung war offensichtlich geleitet von den Quellen, die ihm zur Verfügung standen, und war nicht durch einen festgesetzten Korpus an Lehrwerken vorstrukturiert. Das Ergebnis ist eine nach Affinitäten angeordnete Ansammlung von Sekundärwissen, die sich im eklektischen poetischen Output, kontrastiv und assoziativ, widerspiegelt. Artmann stellt sozusagen eine neue Form des poeta doctus außer der Norm dar. In Kontrast zur Perspektive von Manassewitsch, scheinbar so überzeugt vom Wertegefälle zwischen den Sprachen des „Ausländers“ sprich Europäers und „des Arabers“, erhebt Artmann diesen „Mangel“ zur Tugend, u.a. auch weil er dem stream of consciousness-artigen Schreiben einerseits eine gewisse Schönheit abzugewinnen scheint und andererseits durch diese syntaktische Entgrenzung den Text zu einem großen Reaktionsraum für Wörter machen kann, frei nach seinem Anspruch, der „Zuhälter der Wörter“ (zit. in Hofmann 2001: 29) sein zu wollen, d.h. derjenige, der die Wörter und Ausdrücke miteinander re-/agieren lässt. Dieser Anspruch ist natürlich nicht neu und ein original Artmannsches Poetikkonzept, sondern eine Anlehnung an Poetiküberlegungen der Vergangenheit. In dem 1948 erschienenen Essay über das Wesen des Mythos Poesie von Robert Graves mit dem Titel The White Goddess, den Artmann laut Eintrag 1947 in München gekauft hat, ist u.a. eine Passage zum Thema „Sprachalchemie“ mit grünem Leuchtstift markiert (die im Anschluss unterstrichenen Teile entsprechen den Markierungen Artmanns):
Otherwise, the contemporary practice of poem-writing recalls the mediaeval alchemist’s fantastic and foredoomed experiments in transmuting base metal into gold […]
(Graves 1971: 17)
Durch den Aspekt der Magie bzw. Alchemie erhält Artmanns schriftstellerische Technik, die er „zerebral“ (zit. in Krüger 1992: 12) nennt, eine mythische Dimension, die seinem Werk nützt, weil sie ihm die Möglichkeit des plötzlich im Experiment unerwartet Entstandenen gibt. Sie suggeriert eine Literatur, die auf der Abwesenheit von Formgebung und Mustern gründet. Anhand einiger exemplarischer Beispiele wird nun gezeigt, wie die Bibliothek HCA genutzt werden kann, um über die Betrachtung approximativer Textfunktionen dennoch gewisse Muster im eigentlich nicht Rubrizierbaren zu finden.
V.
Das erste umfangreichere Beispiel, das die assoziative Verarbeitung des Quellenmaterials illustrieren soll, betrifft den Bereich des Surrealismus. Interessanterweise lassen sich keine Texte der Hauptgruppe der französischen Surrealisten André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard oder des Comte de Lautréamont in der Bibliothek HC finden. Unser Beispiel ist ein Text von Max Jacob, einem Autor, der eine weniger zentrale Position unter den Surrealisten einnimmt. Das Buch Jacobs, 1941 verfasst aber erst 1945 veröffentlicht, trägt den Titel Conseils à un jeune poète und ist eine Sammlung von Ratschlägen an junge Dichter im Hinblick auf die Entwicklung einer individualisierten Poetik, in der die Weigerung zentral ist, die Grenzen zwischen den Wirklichkeitsbereichen anzuerkennen (vgl. Thau 1972; Jens 1990: 522). Der zweite Text, auf den später eingegangen werden soll, ist Le Jardin d’Épicure von Anatole France (1921). Texte beinhalten fragmentarisch angeordnete, aphoristische Reflexionen zur Dichterexistenz, und es ist anzunehmen, dass Artmann beide Werke relativ früh, zwischen 1945 und 1955, rezipiert hat. Dafür sprechen unter anderem die Zeichen seines emotionalen Bezuges zu den Texten: bereits auf dem Titelblatt von Jacobs Ausführungen findet sich ein Eintrag Artmanns auf Französisch. Typisch für seine assoziative und akkumulatorische Arbeitsweise ist die Stelle mit Interpunktion aus einer anderen Sprache, dem Spanischen, versehen:
¡¡ah, la sagessel!
Dieser Eintrag repräsentiert voll und ganz die wesentlichen Charakteristika eines Epitexts. Er fungiert gleichermaßen als Überschrift außerhalb des Textes für seine Ansichten zur Dichterexistenz. In ihm klingt einerseits die deutliche Bewunderung eines Lehrlings für die Weisheit des Meisters an, andererseits auch die Freude über die Entdeckung dieser Weisheit (ausgedrückt durch die Rufzeichen), was darauf hinweist, dass man es mit einer frühen Stufe seiner Entwicklung zum Dichter zu tun hat. Zugleich verweist diese Anmerkung auf die problematische Situation junger Autoren und die kriegsbedingte Abwesenheit von „Lehrmeistern“ für das Dichterhandwerk in der österreichischen Nachkriegszeit. Den kulturgeschichtlichen Rahmen für die literarische Produktion der Nachkriegszeit definiert in diesem Zusammenhang Wendelin Schmidt-Dengler, der für diese Zeit einen „Kult der Interpreten“ identifiziert (1995: 98), was er als typisch für die Wien-zentrierte österreichische Kultur der 1950er bezeichnet. Laut Schmidt-Dengler waren „schöpferische[] Künstler im Vergleich zu den nachschaffenden oder reproduzierenden Künstlern marginalisiert“ (98).
Auch Artmanns schriftstellerische Produktion, die sich dezidiert einer Form der Nachschaffung verschreibt, ist so letztendlich Teil dieses „Kults“, wenngleich sie ihn in der Originalität der Ergebnisse bei weitem transzendiert. Seine Appropriationen stützen sich zwar auf alte Quellen und Traditionen, sind aber der Neuschöpfung verschrieben. Es ist kein Wunder, dass er aus diesem Umstand heraus oft missinterpretiert und missverstanden wurde, da der österreichische Nachkriegsmarkt ein Epigonentum geradezu forderte und er diesen Anspruch in seiner paradoxen Verwendung des Alten zur Erzeugung des (oft radikal anmutenden) Neuen auch zu erfüllen schien. Das subversive Potential seiner Texte lag u.a. darin, dass weder die Grenzen zwischen Epigonentum und sprachlichem „Kostümwechsel“ (Maier 1992: 187) noch das Wesen der Anknüpfung an das Alte zur Restauration des literarischen nachkriegsösterreichischen Marktes näher definiert waren. Man hatte schlicht nicht mit einem Autor wie ihm gerechnet, der über die alten Stile, Stoffe und Traditionen und sogar den Dialekt einen literarischen Mimikryeffekt erzeugen und sich damit auf dem Markt platzieren würde, ohne dass ihm der literarische Wiederaufbau auf den als adäquat erachteten Traditionen (vgl. Schmidt-Dengler 1995: 16–59) ein Anliegen gewesen wäre. Die Anfänge seines Dichterwerdungsprozesses sind in den Sprach- und Schriftbildimitationen und Besitzeinträgen in den Büchern der Bibliothek HCA illustriert, sowie in programmatischen Lesereinträgen wie in Jacobs Conseils oder Frances Jardin. Wie sich zeigen wird, sind seine Arbeitsspuren in Le Jardin d’Épicure mit denselben Themen assoziiert, die im Epitext zu den Conseils identifiziert werden: dem Verhältnis von Dichtung und Sexualität/Leidenschaft bzw. Religion und dem Antagonismus von Ignoranz/Naivität und Vernunft/Intellekt.
In den Conseils von Max Jacob hat der „Zuhälter“ Artmann, wie es scheint, erste Anregungen zum Thema Sexualität und Text13 bekommen. Er markiert in Jacobs Text nur zwei Stellen, eine mit einem doppelten Strich, eine andere mit einem Fragezeichen. Letztere Stelle, die ihn etwas verwirrt zu haben scheint, lautet:
A propos de chasteté. Savez-vous qu’il est ordonné aux magiciens de ne faire aucune operation avant le quarantième jour après le coït (volontaire ou non). Or une œuvre d’art est une operation magique. Sans commentaires.
(Jacob 1945: 41)
Etwas über die Keuschheit. Weißt du, daß die Magier ein Gebot haben, keinerlei Handlung vorzunehmen vor dem vierzigsten Tag nach dem Beischlaf? Nun ist aber ein Kunstwerk eine magische Handlung. Ohne Kommentar.
(Jacob 1985: 28)
Max Jacob rät hier jedem Dichter, der immer auch Sprachmagier ist („ein Kunstwerk ist ein magische Handlung“),14 mindestens 40 Tage keusch zu bleiben, bevor er ein weiteres Kunstwerk produziert. Das Fragezeichen suggeriert, dass der junge Artmann diese Regelung zur Kanalisierung der magischen oder künstlerischen Kräfte nicht nachvollziehen konnte – oder wollte (man kann davon ausgehen, dass sein Französisch gut genug war, um die Stelle zu verstehen). Wenn man weiß, wie wichtig es ihm später war, einerseits als „Sprachmagier“ anerkannt zu werden, andererseits als ein Autor zu gelten, für den das Schreiben ein erotischer Vorgang (vgl. Hofmann 2001: 23) und die Kunst respektive das Leben in Keuschheit undenkbar waren (69), dann machen die Arbeitsspuren und Artmanns Reaktion darauf ein weiteres Mal deutlich, wie sehr sein Verständnis von Dichtung von persönlichen Vorlieben und Ansprüchen angeleitet und wie inkonsequent und mit inhaltlichen Affinitäten fragmentarisch assoziiert seine Auswahl von poetischen Traditionsvorbildern und Identifikationsmustern war. Es ist im Hinblick auf die Rezeption zwar problematisch zu versuchen, diesen Autor über seine Vorbilder zu entschlüsseln, doch es sind die besten Anhaltspunkte, die uns für eine Poetikdiskussion bei Artmann zur Verfügung stehen.
Die zweite, durch einen Doppelstrich links oben,15 über dem Absatzanfang markierte Stelle in Jacobs Text befasst sich mit dem Staunen, der Verwunderung als zentralem Element künstlerischer Entdeckung:
Le geste de la sublime ignorance est l’etonnement. L’etonnement est la candeur et la candeur est la route de toutes les découvertes en art comme en science. „Laissez venir à moi les petits enfants car le Paradis est à ceux qui leur ressemblent.“ Or le Paradis est aussi sur terre. Le Paradis est la sagesse.
(Jacob 1945: 41)
Die Gebärde der erhabenen Unwissenheit ist das Staunen. Das Staunen ist die Einfalt, und die Einfalt ist der Weg zu allen Entdeckungen in der Kunst wie in der Wissenschaft. „Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn das Himmelreich ist derer, die ihnen gleichen.“ Das Himmelreich ist auch auf Erden. Das Himmelreich ist Weisheit.
(Jacob 1985: 27)
Diese Stelle propagiert drei Aspekte, die für Artmanns Dichterexistenz wichtig waren:
1. Der erste Aspekt ist die „ignorance is bliss“-Geste, die sich in vielen seiner Interviews als Engagementlosigkeit darstellt:
Mir sind die Parteien wirklich völlig Wurscht, die Linken wie die rechten, und als Dichter, mit einem Gedicht kann man ohnehin nichts bewirken. (zit. in Hofmann 2001: 167)
Sie ist v.a. in der „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes“ zu bemerken, wo der poetische Akt als Resultat „frei von jeder eitelkeit und voll heiterer demut“ (2003: 749) ist, d.h. jenseits jeglicher Berechnung, arglos („candeur“, Einfalt) und in dieser Hinsicht kindgleich (vgl. „les petits enfants“, die Kindlein). Bei Atze findet sich ein Verweis auf ein handgeschriebenes Einlageblatt Artmanns, auf dem er Exzerpte aus einem Text Johann Georg Hamanns, den „Kreuzzügen eines Philosophen“, festgehalten hat. Unter anderem steht da: „Kinder müssen wir werden“ (Atze 2006b: 144). Damit steht uns eine epitextuelle Ergänzung zu der Information, die wir aus den Conseils-Markierungen gewonnen haben, zur Verfügung, die wichtige Aufschlüsse über Artmanns dichterische und historische Naivität verspricht.
2. Die damit suggerierte Kontextlosigkeit der Schöpfung (das Staunen ist laut Jacob der einzige Weg zur Schöpfung in Kunst und Wissenschaft) deckt sich mit dem, was Reichert als Akzentverlagerung „vom Referenzcharakter der Sprache auf die Selbstbezüglichkeit des Materials“ beschreibt (2003: 752) und was wiederum einer Poetik des Spontanen Vorschub leistet. Wo die Welt mit den Augen eines Kindes wahrgenommen wird, so lautet der Schluss, ist alles neu, wunderbar und unbelastet.
3. Die markierte Stelle verweist schließlich auf den Zusammenhang von Religion und poetischer Schöpfungskraft, ein Thema, das Artmann sehr beschäftigt hat. Bei Jacob hat die Weisheit, die bar aller Berechnung und rein ist, paradiesische Züge, wie das Bibelzitat „Lasset die Kinder zu mir kommen […]“ (Mt. 19, 14) andeutet. Jacob suggeriert, dass dieses Paradies auf Erden zu finden sei und zwar in der Existenz des Reinen, des Staunenden, also des Dichters. Die Engführung von religiöser und weltlicher Schöpfung machten die poetische Kreation zu einem mystischen Produkt. Artmanns Anspruch an seine eigene Schöpfungskraft gründet zum Teil auch auf dem Mystischen, ist jedoch widersprüchlich. In typischer Verweigerung einer tiefergehenden, entscheidungserzwingenden Selbstreflexion sagt er von sich:
Ich bin sehr skeptisch. Und als Skeptiker kann man kein Mystiker sein. Aber ich bin zu mystisch, um ein richtiger Skeptiker zu ein. Ich bin lieber ein Skeptiker, nein, lieber ein Mystiker, aber da bin ich wieder zu skeptisch dazu, also so zwanglos irgend etwas anzuerkennen – ich weiß nicht. (Brandt 2001: 34).
Als faktisch „skeptischer Mystiker“, als einer, der glaubt, wann und wo er will, ermöglicht er sich selbst nach Belieben und Gutdünken dogmatische Grenzen außer Kraft zu setzen und aus den Praxen der Weltreligionen ad libitum zu entlehnen.
Arbeitsspuren in weiteren Büchern aus der Bibliothek HCA zeigen ergänzend dieses Interesse am Ursprung und an religiösen Entstehungsmythen, etwa in The Life of Mahomet des Schriftstellers Washington Irving (1850), das Artmann am 23. November 1943 in St. Pölten erworben hat. Artmann setzt sich hier mit dem Islam aus der Perspektive Irvings auseinander, der im 19. Jahrhundert den Amerikanern diese Religion in seiner Biografie des Propheten Mohammed näher bringt. Auf den Seiten 10 bis 302 sind Absätze und einzelne Wörter markiert, die sich mit der Kultur des Königreichs Saba beschäftigen und diese als „the most intellectual nation of antiquity“ (von Artmann markiert in: The Life of Mahomet, S. 11) ausweisen. Er markiert außerdem jene Stellen, die den mythischen Ursprung Mekkas (von Engeln gebaut) sowie des arabischen Heiligtums Kaaba erklären. Der Bau des Heiligtums ist das Ergebnis des Fehlverhaltens des Erzengels Gabriel, der aus dem Paradies verstoßen und zum heiligen Stein, zur Kaaba verwandelt wird, wie die unterstrichene Stelle zeigt. Artmanns Affinität zu Engeln, die als Boten Gottes gelten, ist in Kontrast zum Interesse an ihnen, das die Markierung vermuten lässt, allerdings beschränkt. Er sagt von sich:
ich bin ein paganer Mensch. Für mich gibt es Feen. Keine Engel! Aber Feen. Das Wort ,Engel‘ würde ich nie in den Mund bringen. (Brandt 2001: 33)
Engel tauchen im Werk als religions- und gesellschaftskritische Signale auf, zum Beispiel im Kurzdrama Erlaubent, Schas, sehr heiß bitte! von 1963 (1992: 420–429), wo der „Engel Sauber“ der Figur „Teuxl Pfui“ gegenübergestellt wird. Er erscheint nicht Affirmation eines inhaltlichen christlichen Diskurses, sondern fungiert als Ergänzung zum Figurenpanorama der scheinbar zeitlos und subtil bösartigen, antisemitischen Wiener Gesellschaft: neben Engel und Teufel und dem antisemitischen Gast „Lackl“ bzw. dem Personal des Kaffeehauses treten noch „Adolphus Hitler“ und „Moses (nur als Stimme)“ auf. Der Engel hat seinen Moment, als er sich gerade dann aus der Szene stielt, als der gealterte Hitler sie betritt. Diese Aktion kann man als Anspielung auf das Verhältnis der österreichischen Staatskirche mit der Führung des Dritten Reiches verstehen, das eher in verdecktem als in offenem Widerstand bestand. Was sie zeigt ist, dass die Religion eines Kulturraumes bei Artmann eine (wenn auch negative)16 Rolle – im wahrsten Sinne des Wortes – spielt, auch wenn sein Interesse am rituellen, am mystischen und weniger am konfessionellen17 Aspekt liegt und auch wenn diese Aspekte, wie oben gezeigt, in inhaltlich pervertierter Form im Werk auftauchen. Man kann daher annehmen, dass religiöse Figurationen bei Artmann größtenteils seine kritische Haltung gegenüber der v.a. katholischen Religion, die das Fundament einer Gesellschaft mitbildet, ausdrücken.
VI.
Wie zuvor erwähnt lässt sich aus den Arbeitsspuren in Le Jardin d’Épicure das gleiche Interesse für bestimmte Themenkomplexe herauslesen. Hinzu kommt ein Thema, das Artmanns Werk ebenfalls wesentlich prägt: es ist das Absurde, das er bei France im folgenden Zusammenhang markiert: „[…] et il faut vraiment ne penser à rien pour ne pas ressentir cruellement la tragique absurdite de vivre“ (France 1921: 51; „[…] und man darf in der Tat an nichts denken, um nicht die tragische Abgeschmacktheit des Lebens grausam zu empfinden“; 1906: 38f).
Für Anatole France, dessen schriftstellerische Entwicklung durch die Abwendung vom naturalistischen Vertrauen in die Wissenschaft geprägt war (Jens 1989: 748), bedeutet die Ignoranz bzw. die Abwendung von der Ratio die Erlösung aus der Tragik des absurden Lebens; er vertrat einen „radikalen, aber niemals Stellung beziehenden Skeptizismus“ (747), der von versteckter Sozialkritik in seinen Texten ergänzt wurde und der ihn auch dazu brachte, am Intellekt bzw. der Intelligenz zu (ver-)zweifeln. Eine Haltung, die man auch von Artmann, dem „skeptischen Mystiker“ kennt, wie das Zitat oben zeigt. Von den französischen Surrealisten wurde France als Abgrenzungsobjekt zu allem eingesetzt, was sie für überkommen und künstlerisch und kulturell verabscheuungswürdig hielten (vgl. Nadeau 2002: 71f). Es ergibt sich ein interessanter Kontrast daraus, dass die Pose und Manieriertheit, die Breton, Aragon, Éluard und Soupault vor allem anderen verachteten, bei Artmann in erweiterter Form, als Vorbedingung und Extempore zum „poetischen act“ (2003: 749) auftaucht – aber eben als Annäherung und nicht als ästhetisches statement. Er rezipiert Frances Jardin d’Épicure ganz, die Arbeitsspuren sind bis zum Schluss des Buches zu finden, was für sein Interesse am Text spricht. Bei Michael Horowitz ist belegt, dass er eine größere Anatole-France-Sammlung besessen hat, die er Anfang der 1950er Jahre versetzen musste (Horowitz 2001: 102). France taucht außerdem in einem Brief des von Artmann verehrten Horrorautors H.P. Lovecraft auf, den er im Inhaltsverzeichnis als interessant markiert hat (Lovecraft 1965: 254) und in dem France zusammen mit James Branch Cabell und Arthur Machen, beide Autoren der phantastischen Literatur, genannt wird. Bereits diese Verbindung von France und der Phantastik wäre es wert genauer betrachtet zu werden, was hier jedoch nicht möglich ist. Die Bedeutung des Werks und der Person Anatole Frances für Artmann zeigt sich schon in den Arbeitsspuren, die er als Schriftsteller am Anfang seiner Karriere in diesem Exemplar hinterlassen hat.
Es gibt insgesamt dreiundzwanzig Markierungen in diesem Text, von denen exemplarisch nur einige besprochen werden sollen, deren besondere Wichtigkeit für Artmann durch eine Doppel- oder Dreifachunterstreichung ausgewiesen ist und die eine epitextuelle Ergänzung zu den markierten Stellen aus Max Jacobs Conseils darstellen. Zur Erinnerung: bei Jacob waren die Themen Ignoranz bzw. das naive Erstaunen, die Religion und der Umgang eines Künstlers mit seiner Libido aufgetaucht. Die Auswahl an markierten Zitaten aus Frances Text von 1895, die diese Themen ergänzt, betrifft erstens die Themen der Ignoranz, Naivität und des Staunens, die von Artmann mit einer Lebenslust assoziiert werden, die im Diesseits begründet ist, wo es Hoffnung für die Menschheit gibt: „La vérite est que la vie est délicieuse, horrible, charmante, affreuse, douce, amère, et qu’elle est tout“ (France 1921: 67; „Die Wahrheit ist, daß das Leben herrlich, fürchterlich, entzückend, schrecklich, sanft, bitter, kurz, alles ist“; 1906: 50f). Das Leben ist alles, konstatiert France, und die Menschheit ist nicht dem Verfall preisgegeben: „Pour ma part, jene découvre dans l’humanité aucun signe de déclin, J’ai beau entendre parler de la décadence. Je n’y crois pas“ (1921: 87; „Ich für meine Person kann kein Zeichen des Niedergangs in der Menschheit entdecken; man kann mir nach Herzenslust von Verfall erzählen, ich glaube nicht daran“; 1906: 65).
Wohlgemerkt liegen zwischen dem Text und dem Leser Artmann gut 50 Jahre und die Erfahrungen zweier Weltkriege. Dass der Jahrhundertwende-Optimismus von France Artmann anzusprechen schien, ist ein interessanter Nebenbefund für sich. Die positive, diesseitslastige Weltsicht wird jedenfalls unterstützt durch den Religionsskeptizismus weiterer als besonders wichtig hervorgehobener Stellen: „Elles [d.i. les pauvres âmes] se traînent inertes et sans désir, Ne sachant ni vivre ni mourir, elles embrassent la vie religieuse comme une moindre vie et comme une moindre mort“ (France 1921: 121; „träge und wunschlos schleppen sie [d.i. die armen Seelen] sich hin. Da sie weder leben noch sterben können, erfassen sie das religiöse Leben als ein minderes Leben und einen minderen Tod“; 1906: 92). Religion ist für die armen Seelen der Verlorenen, denen auch die Fähigkeit zum Interesse und zum Verlangen abhanden gekommen ist. Dem Leser wird suggeriert, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Religiosität und der Existenz ohne Interessen und Libido besteht, was Artmann gefallen haben muss – wir erinnern uns an das Fragezeichen im Zusammenhang mit der Passage über die Keuschheit bei Max Jacob.
Klar ist nach der Lektüre dieser Stellen, dass Religiosität die Lebenslust und damit die Lebensqualität schmälert. Deutlich wird auch in den folgenden, von Artmann emphatisch markierten Stellen, dass der Glaube an einen Gott und die Kommunikation darüber meist zum formelhaften oder ritualisierten Sprichwort wird. France lässt einen Eskimo über Gottes double standards und den Ursprung materialistischen Reichtums in sehr deterministischer Art und Weise elaborieren, und Artmann dürfte besonders vom Formelhaften angesprochen gewesen sein: „UN ESQUIMAU. Dieu est très bon pour les riches et très méchant pour les pauvres. C’est done qu’il aime les riches et qu’il n’aime pas les pauvres“ (France 1921: 190f; „EIN ESKIMO. ,Gott ist sehr gut zu den Reichen und sehr schlecht zu den Armen. Er liebt also die Reichen und liebt nicht die Armen‘“; 1906: 156). Das Interesse an der Formelhaftigkeit in religiösen Dingen taucht auch in der Markierung des Zitats einer buddhistischen Stimme bei France auf, die das „Ying und Yang“-Wesen der menschlichen Seele ebenfalls von Gottes Wille abhängig macht: „UN BOUDDHISTE CHINOIS. Sachez que tout homme a deux âmes, l’une bonne, qui se réunira à Dieu, l’autre mauvaise, qui sera tourmentée“ (191; „EIN CHINESISCHER BUDDHIST. ,Wisset, daß ein jeder zwei Seelen hat, eine gute, die in Gott eingehen wird, und eine schlechte, die gepeinigt werden wird‘“; 1906: 156).
VII.
Liest man nun die angeführten Zitate aus den Conseils und dem Jardin sowie die anderen Beispiele für Artmanns Quellenrezeption zusammen, als Teil eines in diesen Fällen vom jungen Artmann akkumulierten Textes, so kristallisieren sich Ansätze zu Maximen eines Welt- und Poetikbildes heraus, die durch viele weitere Beispiele aus dem posthumen Epitext der Bibliothek HCA belegt werden könnten und die als Annäherungen an eine Struktur über die poetologische Skizzenhaftigkeit der „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes“ hinausweisen. So wird dieser Epitext zu der poetologischen Ergänzung in Textform, auf die man bei Artmann Zeit seines Lebens vergeblich gewartet hat. Es können in der Folge einige Maximen im Zusammenspiel von Werk, Arbeitsgesprächen mit Artmann und den hier exemplarisch angeführten Arbeitsspuren ermittelt werden, wobei diese Maximen dem posthumen Epitext entspringen, der durchaus erweiterbar ist:
Erstens: Poesie entsteht aus einer Haltung kindlicher Naivität heraus. Sie muss durch Abgrenzung von der „Welt der Erwachsenen“, d.h. der reflektierten Welt geschützt werden. Reichert bezeichnet die Grundanlage in Artmanns Werk und Person als „adoleszent“ (1992: 111). Auch er selbst verspürt eine gewisse „Panik“ vor dem Alt-Sein (zit. in Hofmann 2001: 37), die mehrfach gedeutet werden kann, unter anderem auch als Angst vor einer poetischen Stagnation als Effekt seiner Akzeptanz des Erwachsen- bzw. Alt-Seins. Er sieht sich selbst als theoretisch „geschichtslos“ (14) und als zeitlos, weil sein Poesieverständnis eine Entwicklung nicht erlaubt, da sie in jedem Fall der Reflexion bedürfte. Die Reflexion wiederum muss im historischen Kontext geschehen, muss Beschränkungen und emotional schmerzhafte Einsichten akzeptieren. Es ist anzunehmen, dass er dazu nicht bereit war. Dieser Befund kann erst weiterverfolgt werden, wenn man sich, wie gesagt, mit einer psychologischen Perspektive auf die Komplexe der Verdrängung und der kollektiven und individuellen Sublimation in Österreich nach 1945 auseinandersetzt, was hier nicht geschehen kann. Es sei jedoch festgestellt, dass die „alogische Geste“, für deren Erschließung Peter Pabisch einiges vorgelegt hat (1978), formal genau diese Scheu vor reflektierter Weiterentwicklung verteidigt und nicht nur die Todesangst, sondern auch Artmanns Angst vor dem reflektierten Umgang mit der eigenen Geschichte widerspiegelt.
Zweitens: In der Konsequenz sind die Ratio, die Wissenschaft und die Kritiker die Feinde der Poesie. Das wird unter anderem auch unterstützt durch markierte Stellen zum Thema literarischer Markt und Literaturkritik in den bereits erwähnten Briefen Lovecrafts (1965: 254f) und in Lessings Hamburgischer Dramaturgie (1856: vii), wo es um das Publikum geht, das sich durch seine Geschmacksurteile anmaßt, als selbsternannte „Kritikaster“ Urteile über Literatur zu fällen. Die Nicht-Vermittelbarkeit des „poetischen actes“ ist eine Reaktion auf diese Haltung. Artmann wehrt sich Zeit seines Lebens dagegen, der Wissenschaft, den „tüchtigen Burschen von der Germanistik“ (in Nachrichten aus Nord und Süd; 1997, III: 434), ihre Deutungsmacht zuzugestehen. Er sucht sogar Bestätigung in der Sprachwissenschaft. Er rezipiert die Untersuchung zur Sprachanalytischen Ästhetik von Jörg Zimmermann aus dem Jahr 1980 sehr genau, markiert Passagen, die sich mit der Möglichkeit der pragmatischen, rationalen wissenschaftlichen Diskussion von Kunst, Moral und Religion sowie der Sprachkritik Wittgensteins befassen und interessiert sich besonders für das Unterkapitel „2.3.2. Irreführung durch falsche Analogien“ (1980: 84–89), in dem der Semiotiker Zimmermann zu dem Schluss kommt, dass die Kunst eine Sprache sei. Artmann unterstreicht u.a. auch die folgende von Zimmermann zitierte Behauptung von Morris Weitz: „Ästhetische Theorie ist aus logischen Gründen ein vergeblicher Versuch, etwa zu definieren, was gar nicht definiert werden kann“ (zit. bei Zimmermann 1980: 99). Die von ihm teilweise großflächig markierten Stellen dieser semiologischen Untersuchung würden vor dem Hintergrund einer strukturalistischen Werkuntersuchung weitere interessante Ergebnisse bringen. Da dafür aber weder Zeit noch Raum ist, bleibt es jedoch nur wichtig zu bemerken, dass er gerade durch solche Absicherungs- und Abgrenzungsversuche das Interesse der Forschung auch von seinen Texten auf seine Person umleitet.
Drittens: Die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit Artmanns Werk ist eine Approximation der Approximation, d.h. dass präzise Aussagen über Artmanns Werk eigentlich nur über die Annäherung an seine annähernden literarischen Verfahren wie der Appropriation zu treffen sind. Seine Appropriation von Texten, Stilen, Diskursen und Formen erfolgt fragmentiert. Projektionsfläche ist dabei der Autor, auf dessen Person die Partikel der Texte, Stile, Diskurse und Formen treffen und der sie unter Einsatz seiner Person filtert – Artmanns poetische „Herkunft ist überall“ (zit. in Hofmann 2001: 17), wie er selbst weiß. Dabei werden die Bezüge zwischen Begriff und Bedeutung gewissermaßen zersplittert und neu zusammengesetzt, wobei das semantische Gefüge annähernd zerstört wird. Aber eben nur annähernd, es bleiben immer Spuren, die auf den Kontext zurückverweisen. Diese Spuren ermöglichen es der Forschung, in diesen Kontexten anzusetzen und aus den Kontrasten zwischen Text-, Stil-, Diskurs- und Formherkunft einerseits und Artmanns Position in der Geschichte andererseits Schlüsse zu ziehen. Die Arbeitsspuren im Nachlass sind hier sozusagen vergleichbar mit den Schärfereglern eines Zielfernrohrs. Ihr Einsatz macht es möglich, Annahmen über seine Quellenrezeption und -appropriation zu untermauern.
Viertens: Der posthume Epitext der Bibliothek bietet aber vor allem eine Möglichkeit, sich dem Aspekt in Artmanns Persönlichkeit anzunähern, der meiner Ansicht als die poetische Motivation, als treibende und gleichzeitig hemmende existenzielle Kraft seinen Ausdruck in der Abwesenheit und Verweigerung von Struktur und Form finded: dem Phänomen der Irritation.
Artmanns Entwicklungsprozess ist geprägt von einer gewissen Irritation, die sich in seiner Arbeits- und Schreibpraxis in der Vielfalt der Strukturen, der Diskurse, der Genreüberlappungen und literarischen Formen und im Grundcharakter des Dezentralen und Phantastischen in den Texten widerspiegelt. Überhaupt spielt der phantastische Aspekt eine große Rolle in seinem Werk, umso mehr, als er eigentlich nicht nur die Texte, aber auch das Weltbild hinter den Texten, das uns der posthume Epitext zu kontextualisieren hilft, mitstrukturiert, wie auch Reichert bestätigt (vgl. 1992: 119). Den Leser Artmann, dem oft nachgesagt wurde, er sei alterslos bzw. er arbeite dem Alter und der Einfallslosigkeit entgegen und bevorzuge die abenteuerlichen Konstellationen der Jugendlektüre (111), muss die phantastische Literatur der Moderne sehr geprägt und auch zugleich irritiert haben. Winfried Freund sieht in der phantastischen Literatur den Anspruch zu verwirren und keine Lösung für diese Verwirrung anzubieten, was zur Verstörung der RezipientInnen führen soll.18 Artmanns Werk zeigt eine starke Affinität zu phantastischen Themen, z.B. in den Phantasmagorien oder den Schauerromanen. Sein Streben nach ständiger poetischer „Wiederauffrischung“ des Sprachmaterials könnte man in diesem Zusammenhang als Folge einer Flucht vor dem Stillstand in die Unsicherheit der Phantastik zu sehen. Konkrete Ergebnisse könnte hier nur eine eingehende Beschäftigung mit den verschiedenen Ausprägungen der Reader-response- und der Rezeptionstheorie ergeben, da der Leser Artmann den Dichter Artmann mitproduziert.
Artmanns Werk ist symptomatisch für das Werk eines „irritierten“ Lesers und Dichters, der in seinen ersten poetisch aktiven Jahren zwischen 1944 und 1958 v.a. abseits der ausgetretenen Rezeptionspfade liest und arbeitet, wie der Katalog der Bibliothek HCA belegt. So fehlen in dieser Bibliothek nicht nur die bereits erwähnten surrealistischen Schlüsseltexte, sondern z.B. auch die Werke der romantischen Zentralfiguren Schlegel, Tieck und Novalis. Eine Abgleichung der diversen Epochenkanons mit der Bibliothek HCA wäre hier sicher erhellend, v.a. hinsichtlich seines Kanonverständnisses bzw. seiner Vorstellungen davon, was zu einem „romantischen Kanon“, einem „klassischen Kanon“ usw. gehört und was daraus Sprachmaterial und Lerninhalt werden könnte. Statt der Schlüsselwerke bekannter Epochen findet man unter den Büchern, die er vor 1960 erworben hat, eine große Anzahl an Enzyklopädien und Sprachlehren, sowie Literaturgeschichten aus Europa, Amerika und Asien und vor allem lateinamerikanische Poeten, wie Gómez de la Serna. Diese Zusammenstellung scheint als eklektische Ansammlung von breiter angelegtem Sprach- und Weltwissen symptomatisch für jemanden zu sein, der versucht, ein Wissensloch zu füllen bzw. seine Interessen autodidaktisch auszubilden. Was in dieser Ansammlung deutlich zum Vorschein kommt, ist die fehlende Systematik und Einheitlichkeit in der Themenwahl bzw. in der Wahl und Rezeption ästhetischer Vorbilder. Das einzig nachvollziehbare Ordnungsmoment ist, wie ganz am Anfang festgestellt, der Fundcharakter der Nachlassbibliothek, der als Ausdruck und Folge einer Art Verstörung im Bernhardschen Sinne, einem Zustand dialektischer Freiheit und Verlorenheit oder eben einer gewissen Irritation gedeutet werden kann.
Diese Irritation ist mit Sicherheit das Resultat des historischen Kontextes, in dem Artmann aufgewachsen ist (wir sprechen von den Jahren 1921 bis 1940, dem Jahr, in dem er neunzehnjährig zur Wehrmacht eingezogen wird; vgl. Atze/Böhm 2006: 222). Er war bereits dreizehn Jahre alt, als die Februarkämpfe des Jahres 1934 Österreich erschütterten und siebzehn Jahre alt, als der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland erfolgte. Die Irritation ist aber wohl auch nachhaltig geprägt von den Kriegserfahrungen des jungen Artmann, seiner Desertion und seiner Verurteilung zum Tod, dem er durch die historischen Umwälzungen 1945 nur knapp entkommen war (222). Ohne sich zu sehr in psychologischen Deutungen zu ergehen, kann man allein aus diesen biografischen Gegebenheiten durchaus schließen, dass seine ersten Lebens- und Leseerfahrungen im Österreich der 1920er und 1930er Jahre gleichzeitig geprägt waren von den Diskursen der deutsch-christlich-konservativen, sozialistischen und faschistischen Politik und auch dem Kanon der Hochliteratur bzw. der Populärliteratur dieser Zeit.19 Vor allem die politisch und gesellschaftlich instabile Situation im Österreich der Zwischenkriegszeit und die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg haben mit Sicherheit den Grundstein zu Artmanns existenzieller Irritation gelegt. Auch zwei deutlich markierte Stellen bei France illustrieren seine Sensibilität in dieser Hinsicht: „Un esprit qui n’est point anxieux m’irrite ou mennuie“ (France 1921: 89; „Ein Geist, der nicht beweglich ist, verstimmt oder langweilt mich“; 1906: 66).
France schildert hier mit der Angst eine Befindlichkeit, die in der Moderne individuell sehr verbreitet war, für die Menschen in den 1940er Jahren aber zur kollektiven Befindlichkeit wurde. Und zur individuellen Verstörung: Artmanns Angst ist dezidiert die Angst vor dem Tod (vgl. Pabisch 1978: 93), die literarisch verwertbar und verwandelbar ist: „Wenn es also so etwas gibt wie Glück, stell’ dir vor, du musst dann sterben, das ist Angst: Man spielt mit der Angst natürlich auch als literarischer [sic!] Trick“ (zit, in Hofmann 2001: 19). Bei France findet er Bestätigung, dass Angst ein existenzieller Motor ist, der der Dumpfheit entgegenwirkt, denn der Mensch, der keine Angst verspürt, ist langweilig, dumm und irritierend. Artmann hat gleich darauf eine zweite Stelle dick markiert, sie handelt von der Gutgläubigkeit bzw. Dummheit der Masse:
Cet homme aura toujours la foule pour lui. Il est sûr de lui comme de l’univers. C’est ce qui plaît à la foule; elle demande des affirmations et non des preuves. Les preuves la troublent et l’embarrassent. Elle est simple et ne comprend que la simplicité. Il ne faut lui dire ni comment ni de quelle manière, mais seulement oui ou non.
(France 1921: 95)
Dieser Mann wird stets die Menge für sich haben. Er ist seiner selbst sicher, wie der ganzen Welt. Das gefällt der Menge; sie verlangt Bestätigungen, keine Beweise. Die Beweise beunruhigen und verwirren sie. Sie ist einfach und faßt nur die Einfachheit. Man darf ihr nicht sagen wie, noch auf welche Art, sondern nur ja oder nein.
(France 1906: 70f)
Die Masse ist „einfach und faßt nur die Einfachheit“, schreibt France. Artmanns Vorliebe für Spurenverwischungen und LeserInnenverwirrung im Hinterkopf, kann man nachvollziehen, wie diese Stelle hier das Kontrastszenario zu all dem, was noch in seinem Werk folgen würde, bietet. Der Dummheit der Einfachheit kontert er mit der Komplexität seines Werks. Verwirrter Jugendlicher, irritierter Dichter. Als Signal für diese Irritation ist Artmanns Aussage, er schreibe „nie aus einer Situation heraus“ (Hofmann 2001: 153) zu werten. Denn die Situation, aus der man schreibt, ist selbstredend die persönliche Situation (siehe oben die Ausführungen zu persönlicher Entwicklung). Diese Feststellung drückt die Entscheidung aus zu schreiben, ohne sich formale Vorgaben zu setzen, und sie erwächst aus einem Gefühl des Kontrollverlustes, wie es eines in seiner Biografie (Desertion, Todesurteil, glückhaftes Entkommen) gegeben haben muss. Indem er seinem Werk durch Textappropriationen die Zerstreuung, die Fragmentierung und eine Materialverwertung, die immer an den offensichtlichen Anknüpfungspunkten zur Quelle vorbeizielt, als Grundcharakteristik verordnet, behält er allein vermeintlich die Kontrolle über sein Werk.
Artmann hat stets versucht, sich selbst Autorität in Fragen des Kanons, des Stils, des Geschmacks und schließlich auch in Fragen zu seiner eigenen Person zu sein, was meiner Ansicht nach in der profunden Irritation durch die Ereignisse seiner Jugend und Kriegszeit begründet ist. Das erratisch anmutende Selbstverständnis als Dichter und Abenteurer wird durch seine eklektische Lektürenauswahl ergänzt. Sein Werk ist das eines irritierten Lesers, der sich außerhalb eines Kanons bewegt, der in der österreichischen Wiederaufbauzeit ganz auf die Kontinuität einer Nationalliteratur ausgerichtet war (vgl. Kunzelmann/Liebscher/Eicher 2006: 8ff), der die Avantgarde nicht zuarbeiten wollte. Artmann wurde sich v.a. aus den oben ausgeführten Gründen persönlicher Befindlichkeit, aber auch mangels akzeptabler Vorbilder im Nachkriegsösterreich selbst zur Autorität und fällte kritische Urteile wie das folgende: „Poe ist sprachlich ein bißchen so schlampig wie Lovecraft. […] Sprachlich ist er nicht das, was ich mir unter einem guten englischsprachigen Schriftsteller vorstell’ […]“ (Hofmann 2001: 184f). Diese Gebärde war in jener Zeit möglich, da Artmann auf Grund des fehlenden Marktes an ausländischer Literatur tatsächlich eine gewisse Autorität in der Beurteilung der von ihm „entdeckten“ Literaturen darstellte. Er muss erkannt haben, dass dieser erratische Zugang zu Literatur ein gangbarer Weg für einen Autor seiner sozialen und ästhetischen Herkunft war.
Die Bibliothek HCA hatte diesen eklektischen, akkumulatorischen Zugang zu Literatur in ihrer ursprünglichen Gestalt illustriert, bevor sie durch die Kuratoren organisiert wurde. Ihr fehlte das, was die Sekundärliteratur auch in Artmanns Werk vermisst: das System. In diesem Licht gesehen hat die Frage „Wann ordnest Du Deine Bücher?“ weit mehr Bedeutung als ihre Einfachheit es suggeriert. Es ist nämlich die Frage nach einer Auseinandersetzung mit sich selbst, die einen Prozess selbstreflektorischer Dekonstruktion mit Auswirkungen auf das Werk eingeleitet hätte. In gewisser Hinsicht gibt der Nachlass der Forschung nun die Möglichkeit einer interessierten Dekonstruktion des Werkkomplexes unter Einbeziehung der Person des Autors, ohne dass Artmann persönlich mit einem schwierigen Reflexionsprozess konfrontiert ist.
VIII. Zusammenfassung
Artmanns eklektische Lern-, Lebens- und Schreibpraxis, die sich auch im Epitext seines Nachlasses manifestiert, wie man anhand der angeführten Beispiele sehen konnte, deutet darauf hin, dass wir es einerseits mit einem irritierten Leser zu tun haben, der jene Strukturen in seiner Textakkumulationstechnik kompensiert, die ihm aufgrund seines sozialen und historischen Kontexts und individueller biografischer Gegebenheiten als Zwischenkriegsjugendlicher und junger Kriegsteilnehmer verwehrt waren: Schulbildung, berufliche Ausbildung und eine ästhetische Ausbildung. Für Artmann bedeuten die Bücher alles, sie sind das Tor zur Welt, zum Wissen und sie bieten das Wortmaterial für den Dichter, das er in Endlosschleifen der Annäherung an die Quelle appropriiert.
Sein eklektischer Ansatz, geleitet von dem sich existentiell ausnehmenden Bedürfnis Unrubrizierbares zu schaffen und ausgeführt mittels der Verfahren der literarischen Annäherung, schafft sozusagen als Kollateralgewinn neue Traditionen; zum Beispiel einen Artmannschen österreichischen Surrealismus, der keine Neuauflage des historischen französischen Surrealismus ist, der ihm aber in seinen soziologischen Aspekten, der Selbstverweigerung, der Religions- und Sprachkritik, der Apotheose des Wunderbaren und des kindlichen Staunens (merveilleux) und der Grenzverwischung zwischen Kunst und Leben sowie zwischen Wirklichkeit und Fiktion sehr ähnlich ist. Die Abwesenheit der traditionellen Surrealisten in der Bibliothek HCA ist beispielhaft und bezeichnend für seine Tendenz, die Spuren zu seinen konkreten literarischen Vorbildern zu verwischen bzw. zu relativieren.
Artmanns Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden Materialien ist nicht linear nachzuvollziehen, etwa in der Herleitung intertextueller Verbindungen, ohne dass das Ergebnis der Interpretation als unbedeutend für das Gesamtwerk zu bezeichnen ist. Strukturalistische Werkuntersuchungen bieten sich aufgrund der Fülle der Verweise geradezu an und sind doch nicht unproblematisch, weil sie wieder das nur als Marginalie berühren, was Artmanns Werk grundsätzlich ausmacht: die Abkehr von der Form. Denn jeder positivistisch angelegte Interpretationsversuch muss notwendig daran scheitern, dass das Nicht-Vorhandene nicht fassbar ist. Die einzige Möglichkeit, das Wesen seines Werks mit akzeptablen Ergebnissen zum Verhältnis von Autor und Werk zu betrachten, muss daher über eine Methode erfolgen, die nicht versucht ins Zentrum zu treffen, sondern die die hermeneutische Distanz als Grundprinzip annimmt, so wie es eben in der Annäherung geschieht.
Die Forschung hat das im Grunde schon lange erkannt, wie u.a. die Beiträge in Bisinger (1972) und Fuchs/Wischenbart (1992) belegen, allen voran Klaus Reicherts Ansatz einer „Poetik des Einfalls“ (1992). Die Abwesenheit anderer Bezugspunkte als sie das Werk und die Autorengespräche darstellen, hat die Beschäftigung mit diesem so wichtigen und einflussreichen Autor ein wenig in eine Sackgasse geführt. Die Eröffnung der „Bibliothek H.C. Artmann“ ermöglicht jetzt aber neue Wege der Bezugnahme, und es gilt zudem die bereits ausgeschöpften älteren Forschungsansätze durch den Aspekt der Annäherung einer „Wiederauffrischung“ zu unterziehen.
Heide Kunzelmann, aus Marc-Oliver Schuster (Hrsg.): Aufbau wozu. Neues zu H.C. Artmann, Königshausen & Neumann, 2010
Heide Kunzelmann: Literaturverzeichnis
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Internet Archive +
Kalliope
Christian Bauer: Anleitung zum Diebstahl oder das Vergehen der Lektüren
Der Mond isst Äpfel… sagt H.C. Artmann. Die H.C. Artmann-Sammlung Knupfer
Clemens Dirmhirn: H.C. Artmann und die Romantik. Diplomarbeit 2013
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
Reportage + Gesellschaft + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Wiener Vorlesung vom 10.5.2022 – Zwei Dichter ihres Lebens: H. C. Artmann und Wolfgang Bauer. Lesung und Diskussion literarischer Schätze:
Daniela Strigl und Erwin Steinhauer. Gestaltung und Moderation: Maximilian Gruber
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


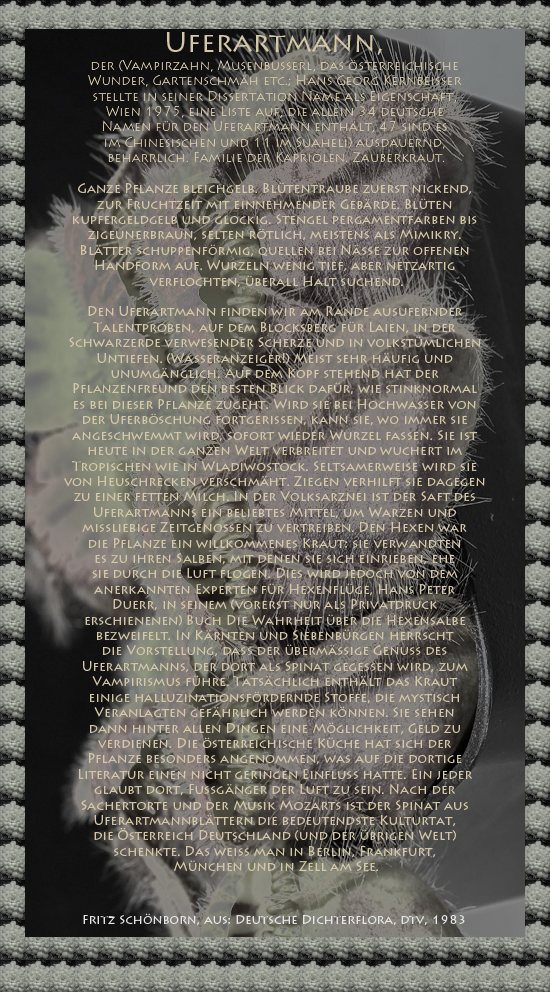












Schreibe einen Kommentar