H.C. Artmann: Das poetische Werk – Reime, Verse, Formeln
das atelier
der worte
steht offen..
wenn du
um das haus
herumgehst
kannst du
schon merken
wie tief wir
frühling
haben..
die vögel
sperren
den mund auf
und holen
satz um satz..
schon duftet
nahend nah
der flieder
einer diktion..
schon ist herb
und frisch
schnittlauch
für punkte
und komma..
gegen abend
werfen dir
die worte
eine kaskade
ins herz..
dann
verschließen
wir das haus..
es hat
geradezu
fröhliche
augen…
Editorische Notiz
Die gegenüber dem Band ein lilienweißer brief aus lincolnshire leicht veränderte Anordnung der Zyklen geht auf den Autor zurück, der auch aus reime, verse, formeln das Gedicht „sataniel lach nit“ herausgenommen hat, um es unter die kindergedichte in Band 7 einzureihen.
Die Entstehungsdaten der Gedichte finden sich Inhaltsverzeichnis.
Rainer Verlag und Verlag Klaus G. Renner
Editorische Notiz der Verleger
Die Idee zu einer mehrbändigen, aufgegliederten Ausgabe des damals schon auffällig vielschichtigen poetischen Œuvres von H.C. Artmann in der „Kleinen Reihe“ des Rainer Verlages – naheliegend erschien es damals – entstand 1967. Sie wurde – wie die meisten „Ideen“ von Verlegern – aufgrund dieser und jener Entwicklung (des Autors, seiner ständigen Wohnwechsel, des kleinen Verlages und seiner Probleme) ad acta gelegt, eigentlich aber nie aus dem Gedächtnis entlassen.
1969 erschien die von Gerald Bisinger mit Liebe und Fleiß betreute Sammlung Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire im Suhrkamp Verlag. 1978 auch in Taschenbuchform, die bis dahin vollständigste Zusammenstellung der Gedichte, welche bis heute Gültigkeit und Wirksamkeit erlangt hat.
Viele Jahre später, im Herbst 1991 also – was im Durcheinander der Frankfurter Buchmesse nicht möglich – nämlich bei einem Besuch der Renners bei Rainers im ungarischen Fünfkirchen, gerät diese „Idee“ wieder ins Blickfeld: ein mehrbändiges Werk, verteilt auf zwei Schultern.
Salzburg, Wohnort des H.C., liegt zwischen Fünfkirchen und München, zwischen Rainer und Renner. H.C. gibt also wenige Tage später sein Placet, bekundet Wohlwollen, avisiert gar seine Mitwirkung. Auch Klaus Reichert in Frankfurt am Main – nobilder und aufrechter Herausgeber vieler Werke H.C.s – wird sofort gewonnen.
1992 – Klaus Reichert hat seine nicht mühelose Arbeit angefangen, fortgeführt und mit H.C. abgestimmt – die, von den Verlegern übernommen, die Bandzahl der Gesamtausgabe auf zehn Stück (ursprünglich acht) ausgeweitet bzw. begrenzt. Die redaktionelle Arbeit des Herausgebers und des Autors ist vorläufig abgeschlossen.
Im Sommer 1993 beginnen Pretzell und Renner unter Nutzung der typographischen Vielfalt einer 1992 erworbenen leistungsfähigen Photosatz-Maschine die Ausführung der ersten Bände.
Frühjahr 1994 – Beendigung der Satzarbeiten. Die Drucklegung kann beginnen…
Klaus G. Renner und Rainer Pretzell, Nachwort
Ich betrachte die folgenden texte…
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft.
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?
Auch die konventionelle science-fiction ist meist nichts anderes als in die zukunft projizierte vergangenheit (kenntlich allein schon am imperfektstil), obendrein dominiert der vergangenheitscharakter jedenfalls eindeutig in ihr.
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
Auf die frage, welche von diesen möglichkeiten mir selbst am meisten am herzen liegen, kann ich nur antworten: jene, die in die westliche, in die atlantische richtung weisen, jene abenteuer, die ich bei der lektüre der fragmentarischen altirischen dichtung er-lebte, durch-lebte und noch heute weiter-lebe.
H.C. Artmann, aus: Unter der Bedeckung eines Hutes, Residenz Verlag, 1974
Beiträge zur Gesamtausgabe: Das poetische Werk
Fitzgerald Kusz: Kuppler und Zuhälter der Worte
Die Weltwoche, 18.8.1994
Andreas Breitenstein: Die Vergrößerung des Sternenhimmels
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1994
Thomas Rothschild: Die Schönheit liegt in der Abwesenheit von Nützlichkeit
Badische Zeitung, 15.10.1994
Franz Schuh: Weltmeister jedweder Magie
Die Zeit, 2.12.1994
Albrecht Kloepfer: Hänschen soll Goethe werden
Der Tagesspiegel, 25./26.12.1994
Karl Riha: Wer dichten kann, ist dichtersmann
Frankfurter Rundschau, 6.1.1995
Christina Weiss: worte treiben unzucht miteinander
Die Woche, 3.2.1995
Dorothea Baumer: Großer Verwandler
Süddeutsche Zeitung, 27./28.5.1995
Armin M.M. Huttenlocher: Narr am Hofe des Geistes
Der Freitag, 25.8.1995
Jochen Jung: Das Losungswort
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1995
Imaginäre Paysagen
– Laudatio auf H.C. Artmann zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises am 25. Oktober 1987. –
Wo sollte ich anfangen, wo beginnen, wo mich festlegen, wenn es mich doch ein ganzes leben lang wie die imme von blüte zu blüte, von kelch zu kelch trieb? Ich habe vieles gelesen und vieles geliebt, allein was hat das gefruchtet, welches eiland habe ich damit erreicht, welche lichtung eines immensen forstes habe ich entdeckt, welches sonnendurchflutete haus betrete ich nach all dieser irrsäligen suche, wo entledige ich mich meiner verstaubten stiefel, um mit muße durch ein helles fenster in den langerwünschten garten zu blicken?
Diese Sätze stehen in einem der ganz seltenen Texte H.C. Artmanns zur eigenen Person. Von Lesen und Lieben ist die Rede, in einem Atemzug – sie sind für ihn die zwei Seiten der einen Münze Leidenschaft. Leidenschaft hat mit Geduld, mit Ausdauer, mit Gemessenheit nichts zu tun – sie brennt und lodert, wenn der Funke überspringt, möchte alle Welt daran entzünden, und schürt doch morgen schon ein anderes Feuer. Ganze Wälder stehen im Schein dieser Doppelleidenschaft, vor allem westliche, insbesondere atlantische, von Spanien über den arthurischen Wald von Brocillande mit seinen Rittern und Damen, Lanzelot und Guinevere, bis Wales und Irland und von da, im Kielwasser des Heiligen Brendan und der Skalden, bis in das andere Indien. Lesen und Lieben – das sind die Voraussetzungen, das ist das Material der Dichtung Artmanns und nicht mit dieser zu verwechseln. Denn Artmann ist weder ein gelehrter Autor, der seine Lesefrüchte auslegungsbedürftig versteckt, um verstanden zu werden (wie Joyce, wie Arno Schmidt), noch ist er ein Authentizist, der meint, wenn er sein Herzblut an den Tag gebe, sei das Literatur. Das Gelesene ist vielmehr so sehr zum eigenen geworden – wie in den Jahrhunderten, Jahrtausenden, bevor der Originalschriftsteller seine Rechte geltend machte –, daß seine Stimme es wie neu erschafft. Schon gehört, aber mit den Echos verwackelter Lichtbilder. Und das Geliebte, die Geliebten, sie sind der Brennstoff, der das Gelesene entzündet, Richtgrößen, Vektoren, sie sind der fleischgewordene Geist, der diesen Buchstaben, dieser Lektüre, das Leben eingibt, aber umgekehrt wären sie nichts ohne diese Lese, Lektüre. Lesen und Lieben. Diffuse Voraussetzungen, aber eben die einzigen. Kein politisches Engagement, keine geschundene Kindheit, weder Kahlschlag noch Geschichtsphilosophie, weder Selbstsuche noch tiefere Bedeutung. Nur: Poesie.
„Wo sollte ich anfangen, wo beginnen, wo mich festlegen…“ Von Anfang zu sprechen, erübrigt sich fast, denn es gibt kein tastendes Frühwerk, keinen übermächtigen Schatten eines Vorbildes, der zum Verschwinden gebracht werden mußte – Artmann ist von Anfang an da, in voller Montur dem Haupte Apolls entsprungen. Das erste erhaltene Gedicht, 1949 geschrieben, beginnt mit den Versen:
Ich könnte viele bäume malen,
mit buntem laub träumend überhangen,
hinter einem blutdunklen zaun…
Das lyrische Werk beginnt also in der Möglichkeitsform, und ihr ist er bis heute treu geblieben. Es interessiert ihn nicht, eine anderswo vorfindliche Wirklichkeit abzubilden, nachzubilden, zu verdoppeln oder gar sie zu interpretieren – er schafft sich seine Wirklichkeiten selbst, singbare Wirklichkeiten, aus einem Reichtum von Tönen und Rhythmen, deren Zauber vergessen läßt, daß die Zeichen, aus denen sie bestehen, deutungslos sind. „Ich könnte viele bäume malen“ beginnt das Gedicht und entwirft in konjunktivischen Wendungen, wie ein Herbstgedicht aussehen könnte und widersetzt sich damit zugleich dem Indikativ, der damals in Mode kommenden Naturlyrik. Damals, die Jahre nach dem Krieg, das war die Zeit, in der Entsetzen und Elend zu Themen der Literatur wurden, manche stellten Wiederbelebungsversuche mit dem Wahren/Schönen/Guten an, andere entdeckten das Christentum und lieferten Sinngebungen des Sinnlosen, wieder andere pflückten die Kirschen der Freiheit oder flüchteten in die Natur als einer konfliktfrei gedachten Innerlichkeit. Nichts von alledem bei H.C. Artmann. Es geht von allem Anfang an nur um das eine: die Dichtung. Dichten als Existenzform, als ein tagtäglich neu eingegangenes Abenteuer mit stets offenem Ausgang, auf nichts gestellt als auf die Verhältnisse zwischen Wörtern. Ein Bild taucht auf für die Unpassendheit, Unangepaßtheit Artmanns im historischen Gewebe: in Orson Welles’ Film über die Trümmerstadt Wien, Der dritte Mann, hat Artmann einen Auftritt als Statist. Man sieht ihn in einem Publikum, das ausgerechnet von Joseph Cotton einen Vortrag über englische Literatur erwartet. Der stammelt und stottert, hat wichtigeres zu denken – Sie erinnern sich, er ist auf der Suche nach seinem auf rätselhafte Weise im Kriminellenmilieu verschwundenen Freund –, aber Artmann reißt die Geduld und er brüllt ihn mit flammenden Augen an: „Was halten Sie von James Joyce?“ Kein Satz wirkte deplazierter im Rahmen des Films, keiner brachte bündiger den Eigensinn Artmanns zum Ausdruck.
Was er und seine Freunde vom Wiener Art Club und von der inzwischen legendären Wiener Gruppe begriffen hatten, war, daß sich das Grauen der gerade erlebten Geschichte jeglicher Darstellbarkeit entzog. Sie begründeten das nicht, sie gingen davon aus. Das war Jahrzehnte vor der Krise der Repräsentation, vor dem Tod des Subjekts und des Autors, vor der postmodernen Verwischung der Grenzen zwischen Fakten und Fiktionen, lange vor dem linguistic turn in den Wissenschaften, wonach was Wirklichkeit heißt, nur in der Sprache erfahrbar ist. Das alles war den jungen Autoren um Artmann im zerstörten Wien geläufig, vielleicht weil die Tradition des Wiener Kreises um Moritz Schlick, um Wittgenstein nicht abgerissen war. Was abgerissen war, war die Verbindung zur Moderne, und es war vor allem Artmann, der sie wieder herstellte. Er entdeckte die Dadaisten und Surrealisten, entdeckte Lorca, Ruben Darío, Ramón Gomez de la Serna, Pound, die er als erster übersetzte. Er wollte dabei nicht vermitteln, wie es üblicherweise das Amt des Übersetzers ist, er hatte auch keine archivarischen Absichten – was ihn umtrieb war die Suche nach Möglichkeiten des Dichtens, die in der eigenen Sprache verschüttet oder nie versucht worden waren. Franz Rosenzweig hat behauptet, es gäbe nur Eine Sprache, und das einer bestimmten Sprache Eigentümliche sei auch in jeder anderen latent angelegt und müßte nur an den Tag gebracht werden, so wie er es in der gemeinsam mit Buber unternommenen Bibelübersetzung versuchte. Ähnlich waren für Artmann die fremden Dichtungen der Spiegel, aus dem eigene Möglichkeiten herausschauten, und zwar nicht in einer postmodernen Klitterung des beliebig Angelesenen, sondern gewissermaßen als O-Töne leidenschaftlicher Erleuchtungen. So hat er das Deutsche um den canto jondo Lorcas erweitert, fand in den kontextlosen Extremmetaphern Gomez de la Sernas, den Greguerias, den Anstoß für eine Kombinatorik und Akrobatik, die die Erfindungen eines Rimbaud oder Lautréamont als harmlose Kinderspiele erscheinen ließen, sah in Pound den Beweis, daß der Formenreichtum der Provençalen, der Troubadours, keineswegs einer vergangenen Epoche angehören mußte. Alle Einflüsse – wenn man von Einflüssen überhaupt sprechen darf, da sie ja gewissermaßen Lockerungsübungen waren, um Eigenes freizusetzen – kamen von solchen, die sich einen Kosmos aus Sprache gebaut hatten. Das mag weltvergessen klingen, realitätsblind, aber hatte nicht auch der Gott der Genesis die Welt aus Sprache geschaffen – er sprach und es ward, und er gab ihm dann Namen?
Die, die Artmann nach den Modernen entdeckte, die Dichter des Barock, wußten von dieser Nähe noch: Abschatz, Gryphius, der überdrehte Lohenstein, Quirinus Kuhlmann, der in seinem Kühlpsalter eine Art Weltmaschine durch Permutationen entworfen hatte, deren Benutzer sich in den damals noch allfällig geneigten Himmel emporläutern konnten. Bei keinen Sprachbaumeistern hat er wohl mehr gelernt als bei denen des Barock, den deutschen, französischen, spanischen, italienischen, denn sie praktizierten Extreme der Künstlichkeit, einer Entäußerung durch Stilisierung, so daß sich in der Maske sagen ließ, was als Selbstausdruck sich verbot. Es gibt wunderbare Schwermutsammlungen von ihm über Tod und Vergänglichkeit, vom Soldatenlos und von der Eitelkeit der Welt – es sind keine Pastiches, keine Stilübungen, die Gedichte, Prosastücke, Szenen sind vielmehr geschrieben von einem, der das Barock als Haltung und Verfahren neu erfindet, gebrochen und ergänzt durch die Entdeckungen der Moderne. Dies gilt besonders für die Schäferdichtung, bei der die Doppelrolle ja schon vorgegeben ist: Verkleidung und verkleidetes Partial-Ich. In der Bukolik ging es quer durch die Literaturen und zurück bis zu den Anfängen etwa bei Virgil. „Tityrus“ zitiert Artmann, natürlich auf lateinisch, „Tityrus, der du liegst unterm Dach der ausladenden Buche“, und er fährt fort:
Ja, es gab ein zischendes sausen und wolkiges schweben zwischen den sogenannten jahrhunderten, die mir doch nur einen einzigen augenblick meiner gegenwart bedeuteten.
Wem die Zeiten und Sprachen gleich nah, gleich gegenwärtig sind, der ist nicht ganz von dieser Welt, er ist der leibhaftige Geist der Poesie. Aber was fängt einer an mit so viel Gegenwart, so viel Gleichzeitigkeit, wenn er eben doch nicht der liebe Gott ist?
Fast über Nacht wurde Artmann 1958 berühmt mit seinen Gedichten in Wiener Mundart, genauer im Dialekt eines Wiener Kleinbürger- und Arbeiterviertels, med ana schwoazzn dintn. Mit diesen Gedichten führte er einen Wiener Dialekt als Literatursprache ein. Wer nur die manchmal moritatenhaften Sujets zur Kenntnis nimmt, überliest dabei leicht, wie hier mit dem Dialekt gedichtet wird, wie seine sprachlichen Möglichkeiten poetisch ernst genommen und ausgelotet werden wie die der Hochsprachen. Von der berühmten Wiener Gemütlichkeit, die sich gern in den Dialekt kleidet wie in ein Festspieldirndl, sind sie weltenweit entfernt. Es sind hinter allem Witz böse Gedichte, weil sie das Gemeine, das Abgründige an den unscheinbarsten Wendungen einer Alltagssprache hervortreiben, den normalen Faschismus.
Außer in manchen seiner Theaterstücke hat Artmann die Möglichkeiten des Dialekts später für eines seiner Meisterwerke benutzt: die Übertragung des Pariser Argots von François Villon in den Dialekt der Wiener Unterwelt, die Zuhälter- und Polizeisprache. Wer diese Übersetzung liest oder von Qualtinger gelesen hört, wird nie wieder zu Paul Zech oder K.L. Ammer greifen. Nun, der ihn abstempelnde Ruhm der schwoazzn dintn – manche angeblich literarisch Gebildeten legen ihn heute noch darauf fest – trieb Artmann in die Flucht und er lebte, selten länger seßhaft, wie ein mittelalterlicher Sänger und Vagant, in Deutschland, England, Irland, Frankreich, Schweden. Doch was die Abstempelung betrifft – gleichzeitig mit den Dialektgedichten entstanden die barockisierenden Husarengeschichten mit spanischem Hintergrund, in denen er sich die Sprache schuf, die wenig später zu seiner großen Übersetzung des Quevedoschen Schelmenromans, Der abenteuerliche Buscón, führen sollte, einer Übersetzung, die mit ihrem wuchernden Erfindungsreichtum in den Spuren Fischarts geht. Und manche dieser Märchen, Sagen oder Exempelgeschichten lassen schon den Zauber der künftigen Prosasammlungen ahnen. Ebenfalls im Umkreis der Dialektgedichte entstanden die Übersetzungen religiöser Dichtungen der Kelten, Der Schlüssel des heiligen Patrick. Ob es Übersetzungen sind oder Ahnungen von Übersetzungen, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls klingen sie, wie man sich vorstellt, daß keltische Gedichte klingen, nur poetischer als man es in den Versionen gelernter Keltologen las. Wieder probierte Artmann neue Formen aus: Gebete, Sprüche, Segens- und Beschwörungsformeln, Anrufungen, Preisungen. Sehr schlicht, archaisch, und manchmal taucht eine Wendung auf, ein Bild, ein Rhythmus, daß wir merken, dergleichen haben wir nie gehört. Die Kelten, spanisches Barock, Wiener Argot, Vulgäres, erlesen Arabeskes, Frommes, und alles in einem Kopf, zu einer Zeit.
Dichter sind seßhafte Leute geworden. Artmann hingegen reiste. Artmann reiste, mit nichts als ein paar Chrestomathien in der einen Hand und der alten Reiseschreibmaschine in der andern, allenfalls mit einer Muse im Gepäck, die vom nächsten Honorar, falls sich eines ergab, stilgemäß einzukleiden ritterlicher war als für den nächsten Mond das Auskommen zu thesaurieren. Artmann reiste nicht wie eine Kanonenkugel, um irgendwo anzukommen: „reisen bedeutet für mich“, schrieb er, „nicht fortbewegung, sondern wohnen dort, wo ich vorbeifahre“, und das klingt wie Zenons Paradox von der Bewegung als einer Addition fortgesetzter Ruhepunkte. Diese Ruhepunkte in der Bewegung schärften seinen Blick für das Einzelne, das Momentane, für neue Einfallswinkel auf die Jahrhunderte, die Sprachen, die Mythen in ihm.
Es war ein Glücksfall, daß ihm damals in Stockholm Carl von Linnés Lappländische Reise in die Hände fiel, das Tagebuch des angehenden Naturforschers, dem staunend eine neue Welt aufgeht. Artmann hat später über dieses Buch geschrieben:
Da gibt es listen von mineralien und holzarten, von kochrezepten und interieurs von rauchstuben, badekammern und auch ungewollt ,poetische notizen‘ über merkwürdige augenkrankheiten oder, meinetwegen, harnleiden, vogelarten, lurcharten, mitternachtssonnenerscheinungen, und alles in der wertfreien gleichzeitigkeit des daseins.
Daß er im jungen Linné seinesgleichen fand, wird aus diesen Zeilen deutlich: „… listen von mineralien und holzarten…“, man kann ergänzen: von Fischen und Insekten, von Gräsern und Kräutern und Blumen. Solche Listen haben Artmann von früh an interessiert – es gibt die Litaneien, die Formelgedichte, die Verbarien –, und man erinnert sich, daß sie zu den ältesten poetischen Verfahren überhaupt gehören, in den sumerischen und akkadischen Hymnen, den Schiffskatalogen Homers, den Geschlechterregistern der Bibel. In solchen Listen ist noch die archaische Magie des Namens spürbar, die Bannung durch den Namen und seine offenbarende Strahlkraft zugleich. Namen sind Aggregate, Machtwörter. Vielleicht kann man sie darum die reinste und knappste Form des Dichtens nennen, denn der poetische Akt ist ja ein Akt des Benennens, des Namengebens, und vielleicht ist darin immer noch ein Echo des ersten Namengebers ahnbar, damals im Garten Eden. Solches oder ähnliches mag Artmann als Bestätigung des Eigenen aus den Linnéschen Listen gelesen haben. Auch, zum Beispiel, daß Poesie wächst, wo sie will, etwa in einem wissenschaftlichen Tagebuch, daß sie also nicht der für sie vorgesehenen Formen bedarf. Artmann sprach von der „wertfreien gleichzeitigkeit des daseins“. Solche Aufmerksamkeit für das Besondere in der Gleichzeitigkeit des Verschiedenen hat die Übersichtlichkeit der Welt kaum befördert – dazu wären Reduktionen und Kategorisierungen nötig, Kohärenzunterstellungen –, sie hat aber eine ganze Milchstraße von Einfällen hervorgebracht, einer funkelnder als der andere. Denken und Dichten in größeren Zusammenhängen hat Artmann nie sonderlich interessiert, und das rührt vielleicht eben daher, daß ihm am Eigenrecht des Einzelnen, an der Lakonie des Konkreten, der Würde des Unscheinbaren oder Übersehenen mehr liegt als an irgendwelchen Hierarchisierungen, die für Zusammenhänge – insbesondere für das Erzählen – ja wohl nötig sind. Bei ihm ist sozusagen alles gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, und so gesehen macht es auch nichts, daß vieles der äußeren Form nach Fragment geblieben ist.
Artmann hat die Lappländische Reise übersetzt und sich von ihr zu einem eigenen – wie könnte es anders sein: imaginären – Tagebuch anregen lassen: das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken. Das ist keine Selbsterkundungs- oder Wichtigkeitsunternehmung gegenüber der eigenen Person. „Ich versuchte vielmehr“, schrieb er später, „den blick zu schärfen für die voluminösen einzelheiten dieses täglichen daseins: voluminös nota bene als qualitativer begriff“, und man darf vielleicht daran erinnern, daß ,Volumen‘ seiner Herkunft nach Schriftrolle und Buch heißt, dann Windung und Wirbel, Welle, Wechsel und Kreis. Das „dasein“ wird unter dem Gesichtswinkel der Bannungen seiner Einzelheiten wahrgenommen, Sache und Wort sind noch eins wie in manchen alten Sprachen, und bisweilen steht im Hintergrund die ungelöste Frage, wie sich denn die tausenderlei Augenblicke zur Linie eines Lebensabschnitts zusammenaddieren, außer durch den Trick der eher mechanischen Datierung. Gelesenes und Gelebtes werden in diesem Tagebuch ununterscheidbar, weil die Wechsel so rasch kommen im distanzierenden Gestus der poetischen Benennung. H.C. Artmann hat selber Linné und das eigene Tagebuch als Voraussetzungen für seinen wohl bedeutendsten Gedichtzyklus benannt, der 1966 in Berlin entstand, Landschaften. Es sind, schrieb er, „innere landschaften, imaginäre paysagen, die die worte sich selbst schaffen, oder die durch worte neu erstellt werden.“ Es sind langzeilige Gedichte, meist in daktylischem Maß, Paarverse, die eher vom walisischen cywydd herkommen als vom Couplet, und die relativ strenge Form, der gemessene Fluß der Silben ist kontrapunktiert durch blitzschnell wechselnde trigonometrische Punkte in Landschaften, zwischen denen Welten und Zeiten liegen, keltische und germanische Landschaften, griechische und römische, arthurische und empfindsame, der elegant schmachtende Ewald von Kleist im Havelland erhält ebenso eine Stimme wie der Liebesironiker und Versbaumeister Dafydd ap Gwilym, der für jedes Mädchen zu sterben bereit war, das Schlagen der Nachtigall ist ebenso vernehmlich wie das Abschlagen von Bierräuschen in Brennesselwäldern:
oh und die sorgsame stille der hände wenn der mond sich
verspinnt an geschlossenen blüten von blumen du dafydd
verstehst das hast diese sprache gelehrt in zeilen der
vorzeit wie wenn ich jetzt nicht begriffe hader fürchtete.
Wer kennt Ewald von Kleist, wer Dafydd ap Gwilym? Sie merken, die Traditionen, in denen Artmann dichtet, sind solche, die er sich selbst erschafft. Was man las, man zitierte, das war ja bereits abgelegt, registriert, konserviert, kein Morgenblick konnte darauf mehr fallen. Darum also: nicht Shakespeare, sondern eher der Jakobäer Cyril Tourneur mit seiner Tragödie der Rächer, nicht Chrestien de Troyes, sondern eher Layamons Brut. Wieder ist es das Übersehene oder über die Jahrhunderte unkenntlich Gewordene, das er für sich entdeckt und dem er eine Stimme gibt. Man könnte das, was Artmann gefunden – und das heißt bei ihm immer auch: neu erfunden – hat, durchaus eine Gegenkultur nennen, wenn man unter Kultur das versteht, was die Präzeptoren in ihren Kanonbildungen dafür ausgegeben haben. Von daher gesehen ist seine Kanonvorstellung unter aller Kanone, sub omnibus canonibus. Aber eben darum ist sie so lebendig, eben darum klingt Altes und Ältestes wie eben beim Wein der Muse entlockt.
Unter dem, was wir kennen, den Blick auf das Danebenliegende zu richten, hat auch seine Haltung zur Gegenwart bestimmt. Was da ist, ist wert, wahrgenommen und auf seinen möglichen formalen Zugriff hin geprüft zu werden. Also keine Ausschließungen prinzipiell, sondern sich der „wertfreien gleichzeitigkeit des daseins“ aussetzen – das tönt wie John Cage –, und das hieß damals, in den sechziger Jahren, alles das ernstzunehmen, was unter dem Stichwort Subkultur von der offiziellen Literatur und Kritik ignoriert oder verachtet wurde. Ich meine Artmanns Interesse an den Comics und Detektivheftchen, an Werwölfen und Vampiren, an Trivialmythen also oder der sogenannten popular culture. Das war ein großes unverbrauchtes Potential, das Artmann für die Literatur erschloß, zeitgleich mit den amerikanischen Künstlern der Pop-Art, etwa eines Roy Lichtenstein. Lange bevor Bram Stokers vielhundertseitiger Dracula-Roman irgendwo wieder aufgelegt und dann durch Verfilmungen weltbekannt wurde, hatte Artmann einen knapp elfseitigen Dracula-Roman geschrieben, mit altkirchenslawischen Lettern durchsetzt, der den gesamten Stoff zu einem literarischen Kabinettstück zusammenzieht, indem er die auch noch nie genutzten sprachlichen Möglichkeiten des Präsens der Stummfilmzwischentexte als Form entdeckt. Man könnte ein halbes Dutzend Bücher nennen, in denen Artmann aus Trivialformen und Alltagsmythen Literatur gemacht hat, nicht indem er deren Verfahren parodiert, sondern indem er ihre Möglichkeiten ernst nimmt, ihre Poesie und ihre Poetik frei legt. Urs Widmer hat einmal geschrieben:
Artmann schlägt sich so notwendig und liebevoll auf die Seite der Opfer, daß seine Arbeiten oft Plädoyers für das Schlechte sind. Für unterdrückte Sprachformen.
Und wieviel Kunstverstand dazu gehört, absichtsvoll schlecht zu schreiben, das ästhetisch Schöne am Schlechten vorzuführen, wissen wir spätestens seit dem Nausikaa-Kapitel des Ulysses.
Natürlich sind die Texte, die sich trivialer Formen bedienen, nicht Simulationen des Trivialen: sie schaffen keine Illusionsräume, machen keine Identifikationsangebote, sie lesen sich wie vielfach gebrochene Inszenierungen vergessener oder schlecht erinnerter Stücke, und wenn wir eine Figur wiederzuerkennen meinen, hat der Spielleiter ihr schon eine andere Maske aufgesetzt. Auch hier also die Brüche und raschen Wechsel. Der Blick wird vom Einzelnen gebannt oder von Einfällen, die in nie vorhersagbare Richtungen führen.
So sind selbst Abenteuergeschichten vor allem als Abenteuer der Sprache zu lesen, denn das sind eigentlich die einzigen Abenteuer, die Artmann sein Leben lang mit Leidenschaft gesucht hat, immer neu von Liebe entfacht, getrieben von der unendlichen Melodie des Utopischen. Im Vorwort zu den Montagen und Sequenzen Unter der Bedeckung eines Hutes schreibt Artmann:
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft.
In einem seiner letzten Bände, gedichte von der wollust des dichtens in worte gejaßt, steht ein Gedicht mit dem rätselhaftmagischen Titel „taprobane“ – es ist der griechische, dem Sanskrit nachgebildete Name der von dem Steuermann Alexanders entdeckten, an Schätzen aller Art reichen Insel Ceylon. Lassen Sie mich schließen mit diesem Gedicht:
wenn die kindheit fertig wird
nimmt sie die tischtücher
und faltet sie nett zusammen:
maritime karten für kommende
fort-reisen in meinen eigenen
augen die nicht anderer leute
fixsterne oder fenster sind
sondern flugbares im wind
bewegliches zwischen
den beiden starren polen
die mich einfassen wie ein
links und rechts
Klaus Reichert, in: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch 1997, Wallstein, 1998
H.C. Artmann proklamiert den poetischen Akt
„Die furcht, ein wertvolles instrument zu zerbrechen, liegt seit anbeginn in der musik“, heißt es in einem unveröffentlichten Manuskript von H.C. Artmann, der im Dezember 2000 in Wien an Herzversagen starb. Ich weiß nicht mehr, wann und wo ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, vermutlich im Winter 1963/64 im Berliner Zimmer einer weitläufigen Wohnung über dem Kleist-Casino, einem von Hubert Fichte frequentierten Schwulenlokal; weiß nur noch, dass wir im Schnee Rosen niederlegten an Kleists Grab und uns auf Anhieb gut verstanden, weil Artmann trotz des Altersunterschieds nicht gönnerhaft auf jüngere Autoren herabblickte. Als ich ihn im Herbst 1964 in Malmö besuchte, las er mir vor aus seinem in Entstehung begriffenen Buch Das Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heißen Brotwecken, kochte Kartoffelgulasch, das nie fertig wurde, und schleppte mich in einen Film, in dem eine Blondine es mit einem Schäferhund trieb – keine Pornographie, sondern der Versuch eines schwedischen Nachwuchsregisseurs, Ingmar Bergman zu übertreffen. Artmann lebte damals äußerst bescheiden von den Honoraren, die ihm seine Übersetzungen spanischer Barockromane und der Balladen von Carl Michael Bellman einbrachten, aber als er mich kurz darauf in Kopenhagen besuchte, war er gekleidet wie ein britischer Landedelmann, mit roter Weste und Schottenmütze, die er dem schwarzen Butler, der ihm die Tür öffnete, schwungvoll übergab, als sei er es nicht anders gewohnt. Artmann behauptete, alle Sprachen zu sprechen, besonders die skandinavischen, und knurrte, als man ihn auf den Straßen von Kopenhagen nicht verstand, in breitem Wienerisch:
Die sprechen ganz a verdorbenes Dänisch hier.
„Altritterlich“ war ein Lieblingswort des angeblich 1921 in St. Achatz am Walde geborenen Dichters Hans Carl Laertes Artmann, der sich nicht nur einen neuen Vornamen, sondern eine dazu passende Biographie erfand, in der die Information, dass er 1940 zur Wehrmacht eingezogen wurde, wie ein Fremdkörper wirkte; nur wenigen Auserwählten zeigte er die Feldpostausgabe des Hyperion – oder war es ein Spanisch-Wörterbuch? – in dem eine russische Kugel steckengeblieben war. Er trat in wechselnden Kostümen auf, als Baron Münchhausen oder Sir Phileas Fogg, König Artus oder Graf Dracula, und blieb doch immer er selbst, ein Bohémien der fünfziger Jahre, der in med ana schwoazzn dintn mehr als nur Wiener Mundartverse geschrieben hatte. Nur einmal runzelte er die Stirn, als ich ihm 1968 im Tegernseer Tönnchen bei Bier und Knödeln beichtete, dass es mir nach der Lektüre des Kommunistischen Manifests wie Schuppen von den Augen gefallen sei – wie so oft hatte Artmann recht!
Unsere Wege trennten sich, und als ich ihn Jahre später wiedersah, hatte er einen Fernsehfilm in Irland gedreht und redete Gälisch auf mich ein. Ich revanchierte mich mit Kreolisch und Lingala, der Verkehrssprache am Kongo, die Artmann zu seinem Leidwesen nicht verstand, obwohl er angeblich Kiswahili sprach. In den achtziger Jahren besuchte ich ihn im Waldviertel, der Heimat von Adalbert Stifter, wo er, trotz seines Ruhms verarmt; in einem Kätnerhaus lebte und außer Kartoffelgulasch nur flüssige Nahrung zu sich nahm, die aus mehr oder weniger hochprozentigem Alkohol bestand. Schon damals sah er aus wie einer, der nicht mehr lange zu leben hat, obwohl oder weil H.C. Artmann – das ist nur scheinbar ein Paradox – sich um Jahrzehnte verjüngte, sobald er eine neue Versform entdeckte, die er in seinem polyphonen und polyglotten Werk noch nicht ausprobiert hatte: Limericks, Haikus, Ghasele u.a.m. Es genügt, an dieser Stelle an die Kinderreime zu erinnern, die er unter dem Titel allerleirausch 1967 im Berliner Rainer Verlag veröffentlichte, oder an Die Heimholung des Hammers, eine kongeniale Fortschreibung der Edda, die, illustriert von Uwe Bremer, 1977 im Ernst Hilger Verlag in Wien erschien. The Best of H.C. Artmann – so der Titel eines 1970 von Klaus Reichert bei Suhrkamp edierten Sammelbands – ist in den Nebenwerken des Meisters zu finden. In seiner Rede zum Büchnerpreis bezeichnete er sich als „spätsterbenden“ Dichter, im Gegensatz zum frühverstorbenen Autor von Dantons Tod. Zumindest diese Voraussage ist wahr geworden.
Der grenzgänger, er kann abstürzen und er kann weitergehen, die gratwanderung lässt beides zu.
Mit diesem enigmatischen Satz verabschiedete sich der Poet von seinem Publikum.
PS
H.C. Artmann mied vordergründiges politisches Engagement, aber als er in einer Fußgängerzone in Salzburg zufällig Zeuge wurde, wie ein Polizist einen Liliputaner verhaftete, rebellierte sein soziales Gewissen. Er trat dem Beamten in den Weg und sagte mit blitzenden Augen – so stelle ich mir die Szene vor – und mit vor Erregung gesträubtem Schnurrbart:
Loss das Zwergl i Ruh, sonst kriagst’s mit mir zu tun!
Artmann wurde wegen Beamtenbeleidigung verhaftet und verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Am nächsten Morgen berichteten die Zeitungen in großer Aufmachung darüber, und nach der Freilassung wanden Verehrerinnen seiner Kunst ihm einen Lorbeerkranz und trugen den poeta laureatus im Triumphzug auf den Schultern durch Salzburgs Innenstadt: ein praktisches Beispiel für die Theorie des poetischen Aktes, mit dessen Proklamation Artmanns Schriftstellerkarriere 1953 begann. Darin heißt es:
Der poetische Akt wird vielleicht nur durch Zufall der Öffentlichkeit übermittelt werden.
Was hiermit geschehen ist.
WER LACHT HIER, HAT GELACHT?
Eine Reminiszenz
Das schallende Gelächter von Walter Höllerer
das wiehernde Gelächter von Hubert Fichte
das bärbeißige Lächeln von Uwe Johnson
die meckernde Lache von Peter Rühmkorf
der grimmige Humor von Peter Weiss
das verschlagene Grinsen von Hermann Piwitt
die Lachkaskaden des Hans Magnus Enzensberger
im Rohr krepierende Lachsalven von Günter Grass
das homerische Gelächter von Johannes Bobrowski
das prustende Gelächter von Günter Kunert
das lautlose Lachen von Friedrich Christian Delius
das ansteckende Lachen von Peter Schneider
das bellende Gelächter von Fritz J. Raddatz
Klaus Wagenbachs gackerndes Gelächter
das grollende Gelächter von Erich Fried
das selbstzufriedene Lächeln von Siegfried Unseld
das fauchende Lachen von H.M. Ledig-Rowohlt
die grundlose Heiterkeit des Peter O. Chotjewitz
die stille Heiterkeit von Renate Höllerer
das heisere Lachen von Nicolas Born
Heiner Müller der pausenlos Witze erzählt
über die Jochen Schädlich nicht lachen kann
das Mona-Lisa-Lächeln der Gisela Elsner
Ingeborg Bachmann der das Lachen im Hals stecken
bleibt auf- und abschwellendes Lachen der Gruppe 47
das aus der geschlossenen Tür des Plenarsaals dringt
dumpf dröhnendes Gelächter auf dem Podium Allen
Ginsberg und Gregory Corso lachen um die Wette
sekundiert von Robert Creeley und Ted Joans ein
Lachkanon in den Artmann nicht einstimmt auch Ernst
Jandl bleibt ernst ersticktes Lachen am Caféhaustisch
lautes Gelächter in der Bar Kichern am kalten Büfett
Lachen im Turmzimmer Gelächter auf dem Bootssteg
des Colloquiums wo Michel Butor eine Angel auswirft
während Alain Robbe-Grillet sich das Lachen verbeißt
Hans Christoph Buch, aus Hans Christoph Buch: Tunnel über der Spree. Traumpfade der Literatur, Frankfurter Verlagsanstalt, 2019
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Internet Archive +
Kalliope
Der Mond isst Äpfel… sagt H.C. Artmann. Die H.C. Artmann-Sammlung Knupfer
Clemens Dirmhirn: H.C. Artmann und die Romantik. Diplomarbeit 2013
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
Reportage + Gesellschaft + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Wiener Vorlesung vom 10.5.2022 – Zwei Dichter ihres Lebens: H. C. Artmann und Wolfgang Bauer. Lesung und Diskussion literarischer Schätze:
Daniela Strigl und Erwin Steinhauer. Gestaltung und Moderation: Maximilian Gruber
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


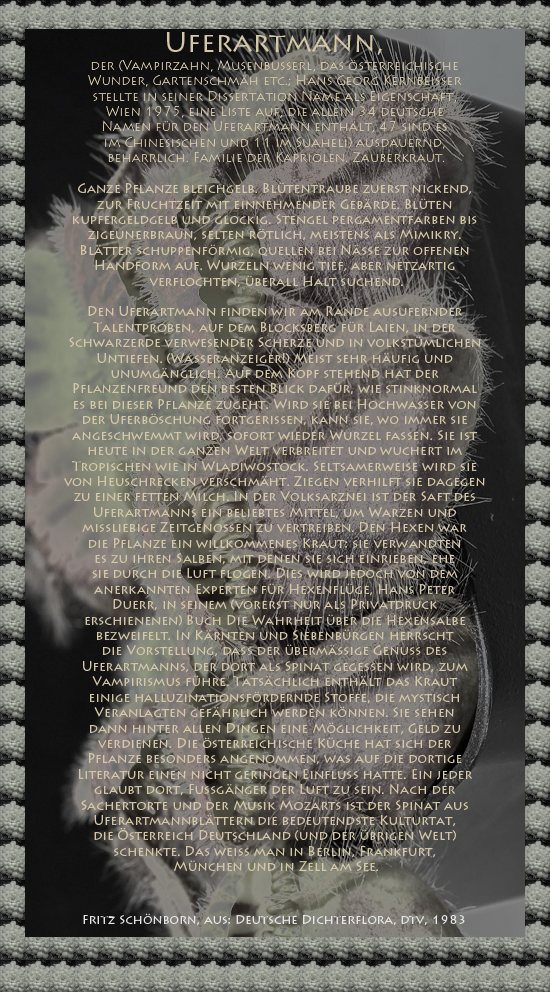












Schreibe einen Kommentar