H.C. Artmann: Sämtliche Gedichte
IRGENDWO:
frag mich um meinen namen
ich will ihn dir beichten
kein ort ist mir ähnlich:
bin honig unter kanditen
bin vergoldeter zuckerhut
eigentlich bin ich biene
wabengebilde immenhäusle
eigentlich bin ich brief
adresse postporto stempel
ich antworte dir wie noah
ein rebstock ein zauberer
sieh ich verändere mich:
caruso besingt mich als
colibri turteltaube aar
robinson schilt mich als
natter skarabäus mikrobe
bin eiland im weltenall
bin kraft echter aktien
des altai nashorn das gnu
des ural der gobi makaki
kein spiegel wirft mich
kein film zeigt mich auf
ich bin der ort nirgendwo
Nur wenige Dichter deutscher Zunge haben ihr Publikum
so oft überrascht und inspiriert wie H.C. Artmann. Er war ein Ariel im Reich der Sprache, und es war das Leichte und Luftige, das Unangestrengte und Helle, was seine Kunst auszeichnete, auch da, wo sie dunkel grundiert war. Seine Entdeckung der reichen Möglichkeiten des Wiener Dialekts machte ebenso Schule, wie sein sprachspielerisches Genie unnachahmlich blieb. Nirgendwo läßt sich das besser nachvollziehen als in Artmanns Gedichten, die in ihrer formalen Vielfalt und ihrem Reichtum an Tönen auch für den vermeintlichen Kenner noch zahlreiche Überraschungen bereit halten: vieles von diesem 1000-Seiten-Schatz ist ungehoben.
Die Ausgabe entspricht jener Sammlung, die Klaus Reichert noch gemeinsam mit H.C. Artmann und nach dessen Vorstellungen konzipiert hat, selbstverständlich unter Ergänzung durch den später entstandenen Band „Von der Wollust des Dichtens“ und verstreuten Einzelfunden.
Jung und Jung Verlag, Ankündigung, 2003
Sieben Mal läuten
− Eine neue Lyrik-Edition erinnert an den großen Wiener Dichter H.C. Artmann. −
Es gibt unzählige Geschichten über H.C. Artmann, und es gibt ein geheimes Zentrum, um das sich all diese Geschichten drehen: Der Mann war ständig unterwegs. In ganz Europa hat sich Artmann herumgetrieben – zu einer Zeit, als dies noch nicht als eine höhere Form des Tourismus galt, sondern als Vagabondage. Wenn er seinen Pass verloren hatte, stieg er schon einmal zu Fuß über ein Grenzgebirge. Wenn er Geld besaß (und entgegen den vielen Mythen, die sich um ihn ranken, besaß er nicht selten welches), legte er auf erste Klasse Wert. Als Dracula trat er bei Lesungen in allen wichtigen deutschsprachigen Städten auf. Einmal fuhr er mit dem Taxi von Klagenfurt die ganze Wegstrecke nach Paris.
An der Wohnungstür in Berlin war ein Schild angebracht: „Hans Carl Laertes Artmann – 7mal läuten“. In späteren Jahren hat er sich in ebenjenem Wien niedergelassen, von dem aus er Ende der fünfziger Jahre ins nördliche Europa aufgebrochen war. Die Automobile von Freunden und Bekannten brachten ihn am Wochenende aufs Land: Fahrten ins Blaue, die kein Ziel, aber eine gemeinsame Richtung hatten, entlang abseitiger Spuren. Wer mit H.C. Artmann reist, reist auf ungewöhnlichen Routen: mit Linné durch Lappland, mit dem Wurstel durch Wien, mit Menschenfressern durch nächtliche Städte, mit Nosferatu durch schattige Gassen oder mit Fantomas in schnellen Autos. Aus welchen Gegenden die Kameraden auch kommen mochten, der Dichter wusste über ihre Herkunft Bescheid: „ich bin die liebe mumie / und aus ägypten kumm i e.“
Trotz seiner scheinbar so starken Verwurzelung in Wien ließ sich H.C. Artmann lieber als einen deutschen Dichter denn als einen österreichischen Schriftsteller bezeichnen. Gruppen mied er, auch wenn es sich dabei um so honorige Vereinigungen wie die Gruppe 47 handelte. Die Einladung zur Mitwirkung schlug er mit dem Hinweis aus, dass er im Alter von zehn Jahren bei den Pfadfindern gewesen und seither keinem Verein mehr beigetreten sei. Auch von der Wiener Gruppe, als deren Vater er gilt, behauptete er, dass es sie eigentlich niemals gegeben hat. Als H.C. Artmann vor drei Jahren starb, wurde schlagartig klar, dass dieser große Einzelgänger ohne eigentlichen Nachlass geblieben war. Nur ein bescheidener Stapel mit einigen vergessenen Manuskripten hat sich in den Wohnungen in Wien und Salzburg gefunden. Alles andere war verstreut oder verschmissen worden.
Für entsprechende Textsammlungen bedurfte es eines sorgsamen Herausgebers. In Klaus Reichert hat das Werk von H.C. Artmann einen solchen gefunden. Nach der mehrbändigen Prosasammlung Grammatik der Rosen (1979) liegt unter seiner Herausgeberschaft jetzt ein umfangreicher Lyrikband vor, der alles versammelt, was greifbar war, und der ein echtes poetisches Testament bildet. Artmann selbst hat an der Gliederung des Bandes noch mitgewirkt, die Zusammenstellung folgt den einzelnen Gedichtzyklen und Buchveröffentlichungen, an einigen Stellen ist es zu Umstellungen gekommen. Eine dieser nachträglichen Korrekturen ist mir aufgefallen, weil sie mein Lieblingsgedicht aus dem Band Aus meiner Botanisiertrommel (1975) betrifft. Von Artmann wurde der Text, der wie alle Gedichte dieses Buches nach dem Muster der deutschen Volksliedstrophe geformt ist, aus dem ursprünglichen Zusammenhang genommen und von Reichert in die letzte Abteilung mit Verstreuten Gedichten gestellt: „ganz versteckt in wildem wein / haust des wieners mütterlein, / schneeweiß weht ihr blondes haar, / weil sie nie beim zahnarzt war. // witwe sein voll müh und plag, / ist kein schöner namenstag, / doch ein gärtlein in stadlau / reicht zum trost der alten frau […].“
Wer hätte sich Mitte der siebziger Jahre dieser belasteten Form annehmen und sie in einer solchen Leichtigkeit einsetzen können, wenn nicht H.C. Artmann? Und wer hätte zwanzig Jahre vorher im Wiener – oder exakter gesagt: Breitenseer – Dialekt schreiben können, ohne nicht sofort als reaktionär gebrandmarkt zu sein? Der neue Sammelband, der mit seinem roten Einband und seinem kompakten Satzspiegel wie eine Bibel wirkt, macht es in der ganzen Fülle der Gedichte klar: Artmann war ein unendlich formbewusster Dichter, dessen Spektrum vom „teutschen“ Alexandriner über Epigramme und persische Quatrainen bis zu den reihenden Verfahren der konkreten Poesie reicht.
Anders als es in dem avantgardistischem Umfeld üblich war, dem Artmann kurze Zeit angehörte, werden die lyrischen Formen hier nicht zerstört, sondern mit neuen und teilweise recht ungewöhnlichen Inhalten gefüllt. Der Witz kommt neben die Melancholie, das Triviale neben das Gelehrte und das antiquiert Gekünstelte neben den letzten Modeschrei zu stehen, sofern dieser nur schräg genug ist, um vom Autor wahrgenommen zu werden.
Die Mode ist eines der Stichworte zu einem heutigen Verständnis der Artmannschen Gedichte: Auf seltsame Weise vermochte und vermag in diesen Texten alles, was sich der Mode entzieht, doch noch zu einer speziellen Mode zu werden. Als einer der letzten europäischen Dichter zog Artmann sich europäische Kleider an, ohne dass sie ihm um die Knie schlotterten. In den Gedichten bleibt der Fundus lebendig, gerade auch deshalb, weil er vom Autor immer nur punktuell eingesetzt wird. Ein Gewand, das Artmann nach Belieben an- und eben auch wieder ausziehen konnte, stellen auch die Dialektgedichte dar. Dem auswärtigen Publikum erschließt sich med ana schwoazzn tintn im vorliegenden Band sprachlich durch ein Glossar und inhaltlich dadurch, dass diese Gedichte auf nichts anderes als das Klischeebild der goldenen Wiener-Stadt bezogen sind. In den beschriebenen Gestalten (allen voran jenem unvergesslichen Ringelspielbesitzer, der in Wahrheit ein Blaubart, das heißt Frauenmörder ist) kommt ein Sadismus der Heimat zum Vorschein, von dem ich wetten möchte, dass er eben nicht nur auf diese eine Heimat beschränkt ist. Auch in seinen hochdeutschen Gedichten, die den bei weitem größeren Teil ausmachen, gibt sich Artmann als ein Nostalgiker ohne jegliche Nostalgie. Die althergebrachten Formen und die verwendeten Redestile werden nicht als ein äußerer Zwang erlebt, sondern als Mittel zur Durchsetzung poetischer Freiheit genutzt.
Das Beste an H.C. Artmann ist, dass der geneigte Leser weder die speziellen Inhalte noch die verwendeten Formen kennen muss, um an ihnen Freude zu haben. Sein Wissen um die Baupläne der Poesie ebenso wie jenes um fremde Sprachen und Kulturen lässt Artmann nicht im Triumphzug durch die Gedichte ziehen. Es ist darin verborgen, und manchmal gewinnt man den Eindruck, als sei es in einer fast schon geheimnistuerischen Weise in sie eingenäht. Für die Schuhfirma Humanic, die zur Überraschung des Fernsehpublikums in ihren Werbespots der späten siebziger Jahre echte Dichter zu Wort kommen ließ, verfasste H.C. einen Spruch, der sich den Österreichern meiner Generation eingeprägt hat und von dem man bis heute lernen kann, was denn nun genau ein Haiku ist: „bei de japana / drogns papiarene schtiefö / des hast daun: gedicht.“
H.C. Artmann fasst die Sprache manchmal mit Glacéhandschuhen an, dann wieder hält er sie in festem Griff. Er lässt die Wörter miteinander und das Ganze mit den eigenen Sprachmasken reagieren. Am Ende ist eines sicher, es heißt wunderbarerweise immer wieder: Gedicht.
7-mal musste man läuten, um in Artmanns Wohnung zu gelangen. Nachdem man mehr als 700-mal umgeblättert hat, ermisst man die Spannweite seines einzigartigen lyrischen Werks: „Jetzo / fällt mir / ein stein / vom herzen / pardautz! / da liegt er.“
Klaus Kastberger, Die Zeit, 2003
So tief im heiklen Fleisch
− Die gesammelten Gedichte des Genius H.C. Artmann. −
Reichlich fünfzig Jahre war der H.C. Artmann als Poet präsent, und zwar äußerst leibhaft, und sein nicht eben übersichtlich publiziertes Werk umfasst mindestens ebenso viele Bände und Bändchen, viele Schallplatten (er bleibt der großartigste Rezitator der eigenen Verse), auch Hörspiele, Theater, wenige Essays, viele Übersetzungen. Berühmt wurde der vor drei Jahren Verstorbene mit seinen Dialektgedichten med ana schwoazzn dintn (1958), jeder zweite Lyrikleser verging sich danach am Wienerischen. Zusammen mit Konrad Bayer und Gerhard Rühm bildete er 1953 die „Wiener Gruppe“. Sein Bekenntnis zum modernen Gedicht ist der Haltung Gottfried Benns vergleichbar, der kühl befand, ein Gedicht werde nicht aus Gefühlen, sondern aus Worten gemacht. Der Verlag Jung und Jung hat nun die 1994 erschienene zehnbändige Werkausgabe, die Klaus Reichert in Abstimmung mit dem Autor organisiert hat, in einen Band mit zehn Abteilungen gebracht, handlich und unentbehrlich für jeden Lyrikfreund. Der Anfang zeigt vor allem, wo Artmann es her hatte: Der Dadaismus machte ihm das gute Gewissen für die „alogische Geste“, die sein Kennzeichen wurde, und auch der Expressionismus stand Pate. „Ich bin so bett“, das könnte auch von August Stramm gesagt sein. Es gibt hübsche Nonsenseverse, Vortragslyrik fürs Brettl, Pseudoromanzen und makabre Schauerballaden, die durchaus ihre Aktualität behalten, als eine Redeform, die der makabren Gegenwart noch am ehesten beikommt: „Im felde wo / die kugel spritzt / und manchem bald / im herzen sitzt / so tief / im heiklen fleisch…“ Andere Gedichte fangen mit dem Verlust von einem Ei an und sind nach wenigen Versen schon beim Nachruf auf den Kopf.
Wie es sich für einen österreichischen Autor gehört, wird die Kritik an Gesellschaft und Staat passend vorgetragen, zum Beispiel als „requiem viennense“. Das „agnus die“ dürfte nicht so schnell seine Geltung verlieren: „jetzt samma / jetzt samma / jetzt samma aus n schneida / und wuaschtln / und wuaschtln / und wuaschtln wieda weida“. Das Zitat kann einem die Angst vor den Dialektgedichten nehmen. Sie sind deftig-körnig, witzig, böse und heiter, bestes Volksvermögen.Artmanns Signatur bleibt durch die makaber-grotesken Verse bestimmt. Die Strophen des „Frauenzerstücklers“ überbieten jeden Wedekind. Wo lyrischer Herzton aufkommt, ist’s eher peinlich: “ein bittrer schnee / aus himmelstiefe / hat dich verweht”. Bedeutend seine Zuwendung zum Barock, was ja überhaupt für die moderne Lyrik konstitutiv ist. Klaus Renner hat im Manesse-Verlag ein eigenes Buch daraus machen können: Auf Todt & Leben. Eine barocke Blütenlese. Da gibt es eine Abenteurerzählung wie bei Johann Beer, Variationen auf Kirchenlieder, Epigramme, Schäferlieder und auf Husarenstückchen.Artmanns Lyrik ist überreich an Einfällen, denen sich die Unbekümmertheit der Elster in der Übernahme guter Funde gesellt. Doch er macht auch etwas damit. Die frech-böse Umdichtung der gängigen Kinderlieder legt den geheimen Sadismus und den sexuellen Spaß an der Unschuld bloß, die sie oft genug grundieren. Doch meint er das nicht als Aufklärung, eher als „schwoazzn“ Spaß. Seine Parodien und Travestien, die auch die Naturlyrik, einen besonders hehren Bezirk des deutschen Gedichts, nicht auslassen, suchen immer wieder den Kontakt mit dem Publikum. Seine Vortragskunst lässt viele Gedichte wie eine Partitur erscheinen, erst die Aufführung bringt sie zu sich.
Entsprechend hat Artmann den poetischen Akt betont: Er sei, „in unserer erinnerung aufgezeichnet, einer der wenigen reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können“. Auch sein Bekenntnis zur „Wollust des Dichtens“ stellt sich dazu. So wird man in seinen Reisegedichten, die den Band beschließen, vergeblich Städteporträts oder Landschaftsbeschreibungen suchen: „kein ort ist mir ähnlich“, findet er, „ich bin der ort nirgendwo“. Das ist immerhin eine sehr anmutige Form der bestimmten Negation. Sie baut eine Welt um das Ich, das sich gar nicht unbedingt wiederfinden möchte – es sei denn in Gedichten.
Alexander von Bormann, Frankfurter Rundschau, 3.5.2003
Jetzt als amtlicher Klassiker
− 800 Seiten, Dünndruck, Lesebändchen. Sauber gesetzt auf feinem Klassikerpapier mit lesefreundlicher Vanilleeistönung: H.C. Artmanns sämtliche Gedichte in einem Band. −
Jetzt ist er also ein amtlicher Klassiker: 800 Seiten, Dünndruck, Lesebändchen. Sauber gesetzt auf feinem Klassikerpapier mit lesefreundlicher Vanilleeistönung. Der Salzburger Verlag Jung und Jung hat, wie es so schön heißt, „Sämtliche Gedichte“ von H. C. Artmann in einen repräsentativen Band gestaucht. Das ist gut, weil man das ganze wunderbare Zeug jetzt auch ohne Rucksack mit sich herumtragen kann. Das ist aber auch nicht übermäßig sensationell, weil es sich dabei um die elegant recycelte Version einer Ausgabe handelt, die schon 1993 in zehn umschuberten Einzelbänden beim Renner Verlag, selig, erschienen ist.
Klaus Reichert hatte damals, noch zu Lebzeiten und mit Hilfe Artmanns, die weit verstreuten Texte eingesammelt und in eine sinnvolle, chronologisch-thematische Ordnung gebracht. Zehn Abteilungen, von den frühen, vornehmlich in Zeitschriften erschienenen Gedichten bis zur „Wollust des Dichtens“, Artmanns letztem Band. All das ist eine Fundgrube, eine ziemlich tiefe zumal. „wer dichten kann / ist dichtersmann“ hatte Artmann geschrieben, und nicht erst zum Büchnerpreis 1997 hieß es, Artmann könne einfach alles. Kaum eine Form, die ihm fremd gewesen wäre, kaum eine Tonlage, die er sich nicht hätte anverwandeln können. Süßliches Pathos und gewitzte Albernheit; Epigramme, freizeilige Langgedichte, gestochene Alexandriner. Überhaupt das Barocke: nicht nur als Formspiel, sondern vor allem als formsprengende Lust an der Sprache und ihrer Sinnlichkeit, bis hin zum Reden in Zungen in eigens erfundenen Sprachen.
Das alles kann man jetzt wieder und neu lesen: ausgreifende Serien wie die „Landschaften“, die legendären Dialektgedichte „med ana schwoazzn dintn“, die sich auch einem Nichtwiener erschließen, wenn man sie nur laut vom Blatt liest. Oder vielleicht die Geschichten um den „bösen caspar“:
caspar
ist im stande
eine gaslaterne
mit einer tulpe
zu erschlagen –
er ist ein meister
der unglaublichsten
vergehen…
Und immer wieder erstaunt diese scheinbare Voraussetzungslosigkeit seiner Dichtung. Keiner Schule zugehörig, trotz aller konspirativen Umtriebe der Wiener Gruppe. Nur seiner Kunstfertigkeit und seinem eigenen Wortschatz respektive den Wörterbüchern verpflichtet, schrieb Artmann mit einer Leichtigkeit und Offenheit, die vermutlich eben darum gerade auch die Traditionslinien der Poesie zu bündeln vermochte.
An diesem Band ist jetzt gut zu sehen, wie Artmann sich gefunden hat, woher die Initialzündungen stammen. Vom Dada der Hang zum gehobenen Blödsinn und die Lust, sich einer herkömmlichen Textlogik zu verweigern. Vom Expressionismus die starken Bilder und kühnen Fügungen: Es gibt in den frühen Gedichten Genitivmetaphern, die so oder ähnlich auch bei Trakl hätten stehen können. Aber sie standen eben nicht bei Trakl, sondern direkt in Artmanns eigener Diktion.
Man könne, so Artmann in der „acht-punkte-proklamation des poetischen actes“, ein Dichter sein, „ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben“ – es ging ihm in der Poesie primär um eine Haltung, die Haltung des Dichters und die der Wörter. Dass er dennoch so viel geschrieben hat, ist vielleicht nur eine Laune der Natur. Man sollte ihr nachgeben.
Nicolai Kubus, taz, 1.7.2003
Im deutschen Verlagswesen gibt es den schönen Brauch,
die gesammelten Gedichte namhafter Poeten in schmucken Dünndruckbänden zu edieren, die in der Hand liegen wie weiland das Kirchengesangbuch (man denke nur an Paul Gerhardt!). Bei Suhrkamp/Insel gibt es von Goethe und Heine bis zu Rilke und Brecht solche Bände, Haffmans hat sich mit einem entsprechenden Robert Gernhardt hervorgetan, Diogenes mit Ringelnatz, Zweitausendeins gerade jetzt mit Bukowski, und nun können wir also auch H.C. Artmann (1921-2000), den singulären Wiener Poeten, in zierlicher Gestalt nach Hause tragen. Klaus Reichert hat die Dialekt- und Kindergedichte, die Epigrammata, Quatrainen und Haiku, die Gedichte aus der Botanisiertrommel und die von der Wollust des Dichtens kompiliert und trefflich erschlossen. Es ist eine Wunderwelt: Artmann, der listig, verträumt und multilingual alles seinem poetischen Kosmos einverleibte, war Formalist und Visionär zugleich, wilder Fabulierer und robuster Erotiker, ein manischer Wortsammler und doch auch wieder ein Meister der Verknappung, ein Inventionist und Inventarist von trunkenem Überschwang, mit einem Wort: ein wahrer Dichter.
Neue Zürcher Zeitung, 23.3.2003
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jörg Drews: Das Bett, wo die Wörter kopulieren
Tages-Anzeiger, Zürich, 27.5.2003
Christoph Bartmann: Aus dem Ärmel geschüttelt
Süddeutsche Zeitung, 28./29.6.2003
Hans Christian Kosler: Am weissen Strand des Papiers
Neue Zürcher Zeitung, 19./20.7.2003
Michaela Schmitz: „Des wird a Dichta“ – lyrische verbarien von H.C. Artmann
michaela-schmitz.de
Cornelius Hell: Es ist immer Artmann
Die Furche, 20.11.2003
Schwebende Wirklichkeiten
− Zur Lyrik H.C. Artmanns. −
In einem seiner äußerst seltenen essayistischen Texte – es ist ein Vortrag aus dem Zyklus „Ein Gedicht und sein Autor“ in der Berliner Akademie der Künste 1967 – charakterisiert H.C. Artmann den Stil des Lappländischen Tagebuchs von Carl von Linné, das er selbst kurz zuvor aus dem Schwedischen übersetzt hatte: „Es sind vorfabrikate an worten und erscheinungsketten, erfahrungsbrocken, abgegrenzt und in der abgegrenztheit spontan und versehen mit dem reiz des spontanen, den das feinsinnige, langsame beobachten und aufschreiben kaum zu erreichen vermag.“ Diese Charakteristik bringt auf die bündigste Formel, wie sein eigenes Schreiben demjenigen erscheinen mag, der darin nach Erlebnisspuren, nach Abbildern von Emotionskurven sucht, sozusagen nach dem Leben, bei einem Dichter, der die Grenze zwischen Dichtung und Leben nie anerkannt hat.
Im Vorspruch der „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen actes“ von 1953 heißt es: „Es gibt einen satz, der unangreifbar ist, nämlich der, daß man dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein wort geschrieben oder gesprochen zu haben.“ Und Punkt 5 der Proklamation beginnt: „Der poetische act ist die pose in ihrer edelsten form.“ Aber was heißt Pose? Dem Wörterbuchliebhaber Artmann wird kaum entgangen sein, daß das Wort im Adelung noch nicht vorkommt und daß der Grimm darunter nur den unbeschnittenen Federkiel verzeichnet, aus dem Niederdeutschen, immerhin ein erster Hinweis auf die Zurüstung zum konkreten Akt des Schreibens, den der Dichter, der Ähnlichkeitserzeuger zwischen Unähnlichem, womöglich mitgemeint hat, als er das späte französische Lehnwort benutzte. Pose in diesem Sinn bezeichnet ursprünglich die Stellung eines Modells in einem zu malenden Akt – und wird von daher nicht auch der poetische Akt zu einem Zeichen erotischer Zurschaustellung, zu einem Reiz, einer Betörung, schamlos, lüstern, und zugleich hinter dem unsichtbaren Schleier des Entrückten, des nicht Erreichbaren hienieden, verborgen? Poetischer Akt und malerischer Akt bilden freilich keine Wirklichkeit ab – darum ist die Suche nach Erlebnisspuren höchstens ein sekundärer Lustgewinn −, sondern sie stellen Wirklichkeit her, stellen sie konkret her, eben als Pose, als künstliches Arrangement, das nach der Posierung sich wieder in seine Teile auflöst, aber in der Erinnerung Dauer hat wie die hochgezogenen Schultern Charles Laughttons in „Zeugin der Anklage“ oder die klappernden Augenlider Asta Nielsens in der „Freudlosen Gasse“. Ich, das gute alte lyrische Ich, steht also immer in Anführungszeichen, und selbst wenn in diesen Texten ein H.C. Artmann namentlich genannt ist, kann der Leser sicher sein, daß ein erkennungsdienstlich unter dem gleichen Namen zu behandelndes Subjekt damit nicht gemeint ist.
„Sie sehen, meine damen und herren“, sagte Artmann im Berliner Vortrag, „ich rede nicht von meinen gefühlen; ich setze vielmehr worte in szene und sie treiben ihre eigene choreographie.“ Worte als Poseure also, wir sprachen davon, die Stellungen vorführen, unter denen die sogenannten natürlichen nur ein Grenzfall sind. Degas, der Choreograph der Linien und Farben, der flüchtigsten, aber zur Pose erstarrten Bewegungen, der ungewöhnlichsten Perspektiven, hat berichtet, er habe Mallarmé einmal vorgeschlagen, ihm ganz außerordentliche Ideen zu Gedichten liefern zu können, was dieser als törichtes Mißverständnis zurückgewiesen habe: Gedichte werden aus Worten gemacht, Monsieur, nicht aus Ideen. Diese Gründungsanekdote des modernen Gedichts, die den Akzent verlagert vom Referenzcharakter der Sprache auf die Selbstbezüglichkeit des Materials, findet ihren Reflex in den zitierten Worten Artmanns, der sich damit mit der ihm eigenen eleganten Mühelosigkeit in die Tradition der Moderne einschreibt – mühelos, jedoch nicht bruchlos, denn Mallarmésche Positionen mußten in den vierziger Jahren, als Artmann zu schreiben begann – nach den Jahren der teutonischen Purgierung der Sprache zum Zwecke einer Rebarbarisierung ihrer Inhalte, und während der Jahre der Restauration der Sprache zu einem puren Vehikel christlich oder existentiell eingefärbter Innerlichkeit, Wesenhaftigkeit −, erst neu erobert werden, gegen die Widerstände einer offiziellen und offiziösen Verlags- bzw. Kritikerpolitik, die Publikationen auf Jahre hinaus nur klandestin erlaubten.
Angesichts der Möglichkeiten des heutigen anything goes und der marktgängigen Erfolge eines raschen Schocks, ist der poetische Akt damals – die Pose als Akt der Verweigerung des Bestehenden und als Akt der Restitution aufgegebener, nicht zu Ende gedachter Möglichkeiten – nicht hoch genug anzusetzen, bedeutete er doch den sowohl künstlerischen wie wirtschaftlichen Ostrazismus: die Pose als Akt eines auch politisch fundierten Einspruchs gegen die herrschende Art der Verwendung von Sprache. Im Kreis der Wiener Gruppe, gelegentlich sogar in Gemeinschaftsarbeiten mit den Freunden Konrad Bayer, Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner, wurde mit Sprache als Material experimentiert, wurden sozusagen ungegenständliche Schreibweisen erfunden und ausprobiert, indem zum Beispiel – analog zu bestimmten Verfahrensweisen der Neuen Musik – sprachliche Parameter isoliert und für sich bearbeitet wurden, also etwa Lautsequenzen, rhythmische Abläufe, syntaktische Strukturen. Solches Experimentieren, konsequent betrieben, hat oft zu Dogmatismen und Bornierungen geführt, so als sei Schreiben überhaupt nur noch in dieser Form ernsthaft zulässig, als dürften einmal erreichte Avantgardepositionen nicht wieder geräumt werden. Zum Glück war Artmann nie konsequent, zum Glück hat er eine Stellung immer nur so lange gehalten wie es ihm Spaß machte, hat die Fahnen und die Farben je nach Lust und Laune gewechselt. Artmann hat nämlich nie, auch im Experiment nicht, auf die Semantisierbarkeit des sprachlichen Materials verzichtet, im Unterschied etwa zu Gertrude Stein. Selbst reine Lautgedichte entwerfen Räume, deren Koordinaten die Einbildungskraft des Hörers in ganz konkrete Richtungen lenken. Solche imaginierten Sprachräume sind nur herstellbar, weil sie in Vorstellungen gründen, die Erinnerungen aufrufen oder sie suggerieren. Daß er das kann, hängt zusammen mit seinen phänomenalen Sprachkenntnissen, durch die er – einmal ganz abgesehen von seinen Übersetzungen aus einem Dutzend Sprachen – die Ausdrucksmöglichkeiten der eigenen Sprache stets erweiterte, ihre Grenzen verschob. Sprachkenntnis bedeutet für Artmann zuvörderst Kenntnis der Baugesetze einer Sprache, ihre Lautlehre und Morphologie, Verbalsysteme, Grammatik, Syntax, samt ihrer historischen Entwicklung und ihrer möglicherweise dialektalen Varianten. Wie Sprache gemacht ist, interessiert ihn, gemacht im Sinne des poiein, das von den Griechen für die Tätigkeit des Handwerkers ebenso verwendet wurde wie für die des Dichters. Dieser Strenge der Gesetzmäßigkeiten gegenüber macht sich die Semantik, dieses flatterhafte und unstete Wesen, gewissermaßen von selbst, oder anders: sie ist das Reich, über das der Dichter, übrigens seit jeher, fast unumschränkt herrscht, despotisch und rücksichtslos, ohne Verfassung und schon gar nicht auf Konsensfähigkeit angewiesen. Nur manchmal ist die Semantik aber auch dem Leser oder Hörer ganz anheimgestellt, freilich innerhalb der Koordinaten des genannten akustischen Raums. So finden sich denn unter den experimentellen Texten Gebilde, die wie arabisch klingen oder bretonisch oder malaiisch oder türkisch und die die Assoziationen in Richtung der 1001 Nächte lenken oder der arthurischen Ritter, Conradscher Dschungelmesser oder Nasreddins, Assoziationen, die sich im Sagenhaft-Exotischen ebenso verlieren können wie sie durch die streng komponierte Lautung des Arabischen etwa wieder auf den festen Boden des Unverständlichen heruntergeholt werden. Willkürlich oder beliebig sind diese Unverständlichkeiten nie, am allerwenigsten solche, in denen er mit gälischem Material arbeitet. Sein Piktisch, die verlorene Sprache eines untergegangenen hochschottischen Keltenstammes, ist ebensowohl Erfindung wie Rekonstruktion auf Grund der genauen Kenntnis erhaltener keltischer Sprachsysteme – so könnten die Pikten gesprochen haben, jedenfalls in ihren Träumen. Und derlei Rekonstruktion ist, weil poetische Erfindung, allemal überzeugender, weil gespielt, als die akademische des Ur-Germanischen oder des Indogermanischen. Wenn Artmanns Sprachen also Jacob Grimm als „onlie begetter“ haben, dann muß ihre Mutter eine Tochter Gertrude Steins und des Comte de Lautréamont gewesen sein.
Auch Piktisch ist eine Pose, wie Arabisch und Bretonisch, wie das Lykanthropische oder die Werwolfsprache, wie das Wienerische der „Schwoazzn dintn“ – Sie merken an dieser Zusammenstellung, daß die Kategorien nicht mehr stimmen, oder anders: daß das Spektrum vom Unvertraut-Vertrauten – dem Unheimlichen der Wiener Gedichte bis zur Kolonisierung eines gänzlich Fremden reicht, eines Fremden, an dem momentweise – wie im Unheimlichen, wie im Traum, wie im Witz – die Meduse des Verdrängten aufblitzt und im schauerlichen Gelächter alsbald wieder untergeht. Posen sind Herrichtungen eines Als-Ob, aber nicht im Sinne der Simulation des anderswo Auch-Wirklichen, sondern im Sinne der Übersetzung aus einem Original, das es nicht gibt, also einer Künstlichkeit, die die Aufmerksamkeit ganz auf sich zieht und sich doch dabei nicht beruhigt. Denn Posen sind Schwebezustände, Balanceakte, Momente des angehaltenen Atems – folgt auf einen Schritt auf dem Seil noch ein nächster oder öffnet sich der Abgrund? Die Pose als ein Schweben – es ist die bis zum Zerreißen ausgehaltene Pause zwischen einem Davor und einem Danach. Das Davor können Sätze gewesen sein, der intertextuelle Radius fremder Stimmen, gegen die die eigene sich setzt, sich erhebt, aufsteigt in die Lüfte wie der Vogel. Das Davor kann aber auch der Horror der weißen Seite sein, das Tohuwabohu, was wörtlich das Leere und Ungeformte heißt, worüber aber, wiederum wörtlich, der Atem Gottes schwebt, den die Christen in Geist transformiert haben. Im Wort Inspiration ist dieser Atem noch mächtig. Daß der Schöpferatem mit dem Schweben zusammengefühlt ist, enthält bereits die spannungsgeladene Pose aus Bewegung und Stillstand, wie im Kreisel, mit dem Nicolaus von Cusa einmal Gott verglich, eine Pose, die in jede Richtung hin sich zu öffnen, zu lösen vermag: sie kann in sich zusammensacken wie der nistende Adler, sie kann sich ihrer selbst entäußern und Dinge ins Leben rufen, auf daß sie wirklich werden – die Gräser und Kräuter, Fische und Vögel −, aber schon die zweimalige Erschaffung des Menschen – erst Mann und Männin, dann Adam und Eva – zeigt, daß das Konkretwerden eines Schöpfungswillens eine zweischneidige Sache ist, die vielleicht, wie im Fall des Menschen, besser unmaterialisiert geblieben wäre. Die Pose – und Pause als ein Heraustreten aus gegebenen Wirklichkeitsmanifestationen – die Pose und Pause des Schwebens in ihrer „edelsten form“, das Wort stammt von Artmann, und er setzt hinzu: „frei von jeder eitelkeit und voll heiterer demut“, benutzt also die mönchischen Theologoumena „superbia“ und „humilitas“ – diese Pose ist die der Möglichkeitsformen des Dichters. Das heißt eimnal, daß er solche Wirklichkeiten erschafft – auf dem Papier, mit der Stimme, in der Phantasie −, die er sofort wieder preisgibt, in andere transformiert, in einem ständigen Taumel setzender und in-Frage-stellender Choreographie das ist am deutlichsten in den Landschafts-Gedichten, auf die die Berliner Rede sich bezieht −, und sie bedeutet andererseits, diese Möglichkeitsform des Schwebens, dieses riskante Sich-Aussetzen an das Nicht-Gegebene, das Haltlose, das von nichts Greifbarem Gestützte, Fragwürdige oder Fragunwürdige, Verlorene in den Höhen oder Tiefen, das ist gleich, sie bedeutet die stete Gefahr der Abstürze und Abbrüche, die Angst, die Flügel könnten erlahmen. Vieles im Werk Artmanns ist fragmentarisch und erklärt sich vielleicht daraus. Das Fragmentarische ist dabei nicht nachträglich zu einer eigenen Kunstgattung im Sinne der Romantik hochstilisiert worden, sondern blieb stehen als das, was es war – abgebrochenes Wagnis, das die Spuren seiner Tollkühnheit, seiner artistischen Selbstentblößung, durch keine sekundäre Bearbeitung getilgt hat.
Artmanns Ästhetik des Schwebens ist niemandem und nichts verpflichtet, außer sich selbst, sie folgt keinem Programm, gehört keiner Richtung an, folgt keiner Strömung, aber zugleich besteht sie aus lauter Kristallisationspunkten, in denen die poetischen Tendenzen des Zeitalters samt der modernen und postmodernen Verfügbarkeit über Traditionen und über eine mittlerweile global definierte Kultur sich schneiden. Gemeint ist damit nicht die Simulation von Stilen und Tönen, die herzustellen ihm freilich auch mühelos und virtuos gelingt – von „typischen“ Barockgedichten, keltischen Zauberformeln, Kavaliersgedichten, Kirchhofliedern, den Greguerias Gomez de la Sernas und dem Cante jondo Lorcas bis zu den japanischen Haiku oder persischen Quatrainen, um nur diese zu nennen. Gemeint ist vielmehr – und das gilt für die gelungensten Texte gleich welcher Gattung – das Kunststück eines Anspielungsreichtums, das die Tendenzen des Zeitalters wie in einem Brennglas oder einer Alchimistenkugel vereinigt. Da fallen Zitat und authentische Stimme in eins, das Zitat klingt nur so als wäre es eines, und unter der eigenen Stimme klingt immer die andere hindurch, in einem Aneignungs- und Austauschprozeß, wie es ihn nur vielleicht erst einmal, in der hebräischen Poesie des spanischen Mittelalters, gab, die dann zu den Ausdifferenzierungen in Troubadourlyrik und Minnesang führte. Ähnlich kann, was im Brennspiegel Artmannscher Texte gebündelt ist, sich wieder ausziehen lassen in die klare Benennbarkeit lyrischer Dezisionen. Der Schwebezustand hingegen ist bestimmt durch die Gleichmöglichkeit und Gleichgültigkeit der Richtungen, was auch heißt, daß Fragen der Stilhöhen, des Hochtonigen und des Banalen, des emphatisch Lyrischen und des Trivialmythos, aufhören, mit Wertungs- und Geltungsfragen verknüpft zu sein. Schwebe heißt radikale Enthierarchisierung. Schwebe ist ein Dazwischensein, nicht im Himmel und nicht auf der Erde, doch beiden sich nähernd in wechselnder Lust oder Bedürftigkeit. Schwebe ist die reinste Form eleganter Leichtigkeit, die nur dann gelungen ist, wenn man ihr nicht anmerkt, wie schwer sie herzustellen ist. Schwebe ist Bewegung und Stillstand in einem, eine Überlistung der Natur wie im Kreisel des Cusaners, der Stillstand im einmaligen Glanz einer unerhörten Formulierung, die Bewegung im Rauschen der sich bildenden und wieder zerfließenden Formen. Der unstillbare Widerspruch der Schwebe treibt Gestalten hervor, Schwebewesen, die in der Schöpfung nicht vorgesehen waren, Wesen wie die ägyptischen Götter – hunds- und ibisköpfig – oder wie die Grotesken auf den Pergamentseiten melancholischer Mönche, die damit das Bilderverbot nicht brachen und es doch umgingen. Schwebewesen sind Geschöpfe einer Wirklichkeit, die nur momentweise als Möglichkeit aufscheint, unendlich reicher und vielgestaltiger in ihren Erscheinungsformen als die katalogisierten Arten und Gattungen, die uns umgeben, aber wie diese nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern im Augenblick ihres Erscheinens schon in andere Formen und Bilder übergehend. Es sind Geschöpfe einer Wirklichkeit, die aus ihrer irisierenden Nicht-Existenz, ihrer Flüchtigkeit und Vergeblichkeit, ihren Glanz und ihre Dauer beziehen. Mit der ihm eigenen Konkretheit hat H.C. Artmann im Berliner Vortrag beschrieben, wie solche Geschöpfe in die Wirklichkeit seine Wirklichkeit, gelangen: „Ich habe vorstellungen und setze sie ein. Dieser einsatz entfremdet mir in gewisser weise meine privaten vorstellungen: denn worte haben eine bestimmte magnetische masse, die gegenseitig nach regeln anziehend wirkt; sie sind gleichsam ,sexuell‘, sie zeugen miteinander, sie treiben unzucht miteinander, sie üben magie, die über mich hinweggeht, sie besitzen augen, facettenaugen wie käfer und schauen sich unaufhörlich und aus allen winkeln an. Ich bin kuppler und zuhälter von worten und biete das bett; ich fühle, wie lang eine zeile zu sein hat und wie die strophe ausgehen muß.“
Was H.C. Artmann auch geschrieben hat und wie oft wir darin wiederzuerkennen vermeinen, was wir immer schon kannten, es sind „innere landschaften, imaginäre paysagen, landschaften, die die worte sich selbst schaffen“, in der Schwebe des Artisten, der ohne Netz seinem Siebentagewerk nachgeht.
Klaus Reichert, in H.C. Artmann: Der Meister der Himmelsrichtungen, Rainer Verlag und Verlag Klaus G. Renner, 1994.
Nachwort
„Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa…“, so beginnt H.C. Artmanns Schlüsselwerk, das in seinem schwedischen Winter 1963 geführte imaginäre Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken. Der anderthalbseitige Vorspruch, eine Aufzählung nach dem Grundmuster rhythmischer Permutation, hält sich anfangs noch an biografische Reminiszensen, um dann aber immer mehr ins Fantastische auszuschweifen, bis schließlich nur noch der assoziative Einfall, die Alliterationen und Assonanzen den Fortgang des Textes konstituieren. Dieser Prolog enthält auch in nuce bereits den „ganzen Artmann“: das Biografische einerseits, das Wunschbiografische auch, das dann zum Material und Sprungbrett für poetische Exkurse wird, und die Bemühungen, das Poetische zum essentiellen Bestandteil seines Lebens zu machen. Städtenamen deuten auf Weitläufigkeit und ein literarisches Traditionsbewußtsein, das die Grenzen der deutschsprachigen, ja europäischen Literatur überschreitet, und doch ist der Dichter, wie manche seiner Kollegen vor und mit ihm, auf eine besondere, unnachahmliche Weise mit dem Österreichischen, Wienerischen verknüpft.
Artmann gehört zu jener Handvoll Dichter, die jahre-, ja jahrzehntelang unbekümmert und unbehelligt von den Produktions- und Reproduktionsmechanismen des allgefälligen Literaturbetriebs die Nischen des Experimentellen in der Literatur besetzt hielten. Inzwischen hat der Ruhm ihn eingeholt mit dem Großen Österreichischen Staatspreis (1975), dem Preis für Literatur der Stadt Wien (1977) und wachsenden Buchauflagen. Ob etabliert oder geschmäht, ein Außenseiter ist er geblieben, und die Laudatien bezeugen ein gerüttelt Maß an Mißverstehen und Mißtrauen.
H.C. Artmann, der sich 1945 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft beim Ausfüllen eines Fragebogens selbst zum Dichter ernannte, wurde 1921 in Wien als Sohn eines Schuhmachers geboren. Biografische Details, falls man auf Faktisches, Nachprüfbares versessen ist, sind spärlich und schwer zu bekommen, verbürgt sind seine Sprachbegabung und seine enorme Belesenheit. Seine Lektüre dürfte freilich kaum von bildungsbeflissenen Eltern oder Erziehern nach pädagogischen Gesichtspunkten vorgesteuert gewesen sein. Das literarische Sammelsurium, das der nimmersatte Allesverschlinger sich einverleibt und anverwandelt, läßt bereits ahnen, was später bruchstückhaft oder als synkretistischer Flickenteppich in seinen Texten wieder zum Vorschein kommen soll: die damals beliebten Tom-Shark-Heftchen, die Sagen des Artuskreises, irisches und walisisches Mittelalter, Minnesang, sehr viel Barock, die Schauer- und Ritterromane des 19. Jahrhunderts, Sprachbücher, Wörterbücher, Grammatiken, Poes Gedichte, Jean Paul und immer wieder Grimms Märchen. Als sein Geburtsort gefällt ihm Sankt Achatz am Walde, unbekümmert darum, daß niemand zu sagen weiß, wo es liegt. Doch sogar seriöse Literaturlexika gestehen ihm sein Sankt Achatz am Walde als Geburtsort zu, eine komisch-unfreiwillige Reverenz an den Dichter und sein erster Erfolg, sich der ihn umgebenden Wirklichkeit als Artefaktum entgegenzustemmen.
Kurz nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft stößt Artmann in der Bibliothek des Vaters eines Freundes auf die klangvollen Namen der europäischen Avantgarde der zwanziger und dreißiger Jahre, die Expressionisten, Surrealisten und Dadaisten mit Péret, Breton, Tzara, Rigaut, aber auch Dylan Thomas, Lorca, Alberti. Seine autodidaktisch erworbenen Sprachkenntnisse gestatten es ihm, sich mit den bis dato in Deutschland weitgehend unbekannten und unübersetzten verfemten Dichtern binnen kurzem bekannt und sie sich zu eigen zu machen. Die Begegnung mit der europäischen Moderne, der die Sprache nicht nur Gegenstand der Problematisierung und des Mißtrauens in ihre Kommunikationsfähigkeit, sondern zugleich auch Material spielerischen Umgangs zur Schaffung poetischer Gegenwelten ist, ist für Artmann nicht nur ein Lektüreerlebnis. All dies bildet die Matrix für seine späteren eigenen literarischen Produktionen, gibt seinen eigenen Obsessionen, Träumen und Ängsten, seinem instinktiven Unbehagen an einer Kleinbürgerlichkeit, der er selbst entstammt und zu entkommen entschlossen ist, Ausdruck und Struktur. Mit der Entdeckung dieses bisher unbewußten Traditionszusammenhangs, dieser Seelenverwandtschaft, findet Artmann einen Weg, seinen Persönlichkeitsbegriff zu radikalisieren.
„er war mir anschauung, beweis, daß die existenz des dichters möglich ist“, bekennt Konrad Bayer, einer seiner früh verstorbenen Dichterfreunde aus der nach ihrem Hinscheiden zu literaturgeschichtlichen Legende gewordenen Wiener Gruppe, in der Artmann integrierende Figur und überragender Promotor war.
Jedenfalls ist Artmann aus dem Kreis der Wiener Nachkriegsavantgarde nicht wegzudenken. Im Leben extrem antibürgerlich und provokant, im Schreiben prätentiös anarchisch, bot Artmann dem Kreis der jungen Wiener Dichter Anregung und Material zu autonomer, distanzierender Äußerung ihres Lebensgefühls. Die Öffentlichkeit, vertreten von der etablierten Kritik, reagierte mit kruder Animosität. Das Wort „entartet“ war immer noch geläufig und rasch bei der Hand. Kein öffentliches Auftreten Artmanns und seiner Mitpoeten (Zeitschriften und Buchverlage waren ihnen ohnehin verschlossen), das nicht in Tumulten und Beschimpfungen endete. „Ent-Artmänner in der Sezession!“, diese Überschrift einer „Besprechung“ zu einem Leseabend der Wiener Gruppe deutet die Niederungen an, aus denen es herauftönte. Die dichterischen Aktivitäten Artmanns und seiner Freunde in den fünfziger Jahren haben auf eine Weise als Provokation gewirkt, die sich mit Bürgerschreck nicht erklären und auf bloß Literarisches nicht eingrenzen läßt: die Artikulation bürgerlichen Krisenbewußtseins mit solchen poetischen Mitteln, die den Konsens der Rezeptionsgewohnheiten verletzen und also nicht mehr auf ästhetischer Ebene kompensierbar sind, verleiht den Texten eine außerliterarische Brisanz.
Aufschlußreich für Artmannsches Dichten und Leben in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren, in seiner Phase als Protagonist der geschmähten sprachexperimentellen Wiener Subkultur also, ist die 1953 verfaßte Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes.
„Es gibt einen Satz“, so hebt Artmanns Manifest an, „der unangreifbar ist, nämlich den, daß man Dichter sein kann, ohne auch nur irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. (…) Der poetische Act ist Dichtung um der reinen Dichtung willen (…), frei von Ambitionen nach Anerkennung.“ Er wird „starkbewußt extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische Situation, die keineswegs des Dichters bedürfte“.
Die sektiererische Kostümierung dieses deutlich von Dada und Surrealismus beeinflußten Quasi-l’art-pour-l’art-Pamphlets täuscht leicht über den Ernst hinweg, mit dem Artmann, gegen die Spielregeln zeitgenössischen Literaturbetriebs, dieses Konzept verfolgt hat, zugleich wird auch ein selbstironisches, parodierendes oder imitatorisches Moment deutlich, das Artmanns Umgang mit literarischen Mustern; ebenso eignet wie seinen poetischen Konfessionen. Ungeachtet dessen bleibt ein Widerspruch evident, der auch Artmann nicht entgangen sein dürfte: die Favorisierung einer poetischen Haltung als Lebensform bei Mißachtung dessen, was diese Haltung erst rechtfertigt: die Produktivität. Die Aufhebung des Widerspruchs ist das beträchtlich angewachsene Lebenswerk Artmanns, das sich in einem poetischen Freiraum bewegt, ein Freiraum, den er sich durch die Berufung auf die aller produktiven Zwänge enthobene Künstlerexistenz geschaffen hat.
Die Wiener Jahre des zügellosen Experimentierens mit jeglicher Art sprachlichen Materials werden von unvermutetem literarischem Erfolg und (einseitigem) Ruhm gekrönt. Artmanns Experimente mit dem Wiener Dialekt brachten eine Synthese aus Vorstadtmundart, schwarzem Humor und surrealer Montage zustande, mit der er die Mauer durchbricht, die öffentliche Kommunikation und poetisches Experiment für gewöhnlich strikt voneinander trennt. „Artmanns Gedichtbändchen med ana schwoazzn dintn (1958) wurde das seltene Ereignis eines lyrischen Bestsellers.
Artmann löst sich 1961 von der herausfordernden Enge der Wiener kulturellen Szene und beginnt ein Wanderleben durch das westliche Europa, unterbrochen von längeren Aufenthalten in Schweden und Westberlin. Auch hier fällt wieder das spielerische, ja parodistische Moment auf: nicht nur seine literarischen Motive verfallen einer Verkünstlichung, auch die Konstituenten seiner Biografie haben in einer ästhetischem Selektion zu bestehen. Nach den wilden Jahren der Bohème, der Kaffeehäuser; der möblierten Zimmer und der rebellisch-anarchischen Experimente und Aktionen nun die Weitläufigkeit des Dandys, das Umgetriebensein als Spiel.
Seit einigen Jahren lebt der Dichter in Salzburg. Seine unbekümmert verstreute literarische Produktion ist von treuen Herausgeberfreunden sorgfältig wieder zusammengetragen, renommierte Verlage haben ihm mit Sammelbänden und Werkausgaben ein schwergewichtiges Standbild errichtet.
Es wäre sicherlich aufschlußreich und ein ergiebiges Betätigungsfeld einer künftigen Artmann-Philologie, all jenen Quellen nachzuspüren, die Artmann entweder schlicht erfunden oder mit weitgefächerter seitab ausschweifender Lektüre sich anverwandelt hat und die in seinen Texten verkappt, imitiert, parodiert, travestiert oder sonstwie verschlüsselt wieder zu überraschendem Vorschein kommen. Da haben wir leuchtend düsteres Barock, biedermeierliche Idyllen, das Grauen der schwarzen Romantik und Neoromantik von Bram Stoker und Mary Shelley bis Poe und Lovecraft, die nordischen Sagenkreise und immer wieder die legendären Figuren der Comic-Poesie und Groschenheftchenmythen der, letzten dreißig, vierzig Jahre mit Tom Shark, Donald Duck, Lord Lister, Tom Parker, Frisco Kid und all den anderen.
Die frühe Begegnung mit dem französischen Surrealismus, die Artmanns frühe Texte sehr stark beeinflußt, verliert sich auch später nicht ganz. Im Gegensatz zu seinen französischen Vorgängern um André Breton, bei denen die Trauminhalte den Text quasi von selbst evozieren, wird von Artmann die Traummechanik bewußt gehandhabt (vgl. die Betonung auf „starkbewußt“ in Artmanns Manifest). Wie alle anderen poetischen Verfahren und literarischen Grundmuster benutzt Artmann das surrealistische Prinzip lediglich imitatorisch oder selektiv.
Doch geht es Artmann mitnichten um die Reproduktion oder Wiederbelebung von Vorgegebenem, auch nicht um dessen Parodie. Die Benutzung dieser Muster erlaubt es Artmann, einerseits seine Phantasie zu strukturieren und andererseits seine Sprachartistik in einem Balanceakt zwischen getreulicher Einhaltung und prätentiöser Übertretung der den Vorlagen innewohnenden Regeln zu erproben.
Bei aller üppigen Fülle des Artmannschen poetischen Arsenals kehren jedoch immer bestimmte Motive wieder, die mehr oder weniger maskiert Ausdruck der Vorlieben des Dichters sind: da ist das Motiv der Ausfahrt, der Verwandlung, der See- und Luftreise (vorzugsweise mit Verkehrsmitteln der „guten alten Zeit“) in exotische Gegenden oder – als Gegenstück – das Motiv des Einsiedlers. Diese Grundmotive konstituieren in ihrer Verknüpfung eine Eigenweltlichkeit und sind Ausdruck des Behauptungswillens eines Subjekts in einer poetischen Gegenwelt; in der es schließlich immer Artmann selbst ist, ein omnipotenter Phantasie-Artmann, der in den verschiedensten Maskierungen auftritt.
Die Tücke der Eigenweltlichkeit besteht darin, daß sie jedesmal neu heraufbeschworen werden muß, so erwächst der Eindruck von Entwicklungslosigkeit, positiv ausgedrückt: ewiger Adoleszenz. Das Beharren auf Jugend und Alterslosigkeit ist Artmanns wohl stärkste Obsession, dazu gehört ein scheinbares Verweigern jeglicher Erfahrung, bzw. die Erfahrung muß in einem immer angestrengteren „poetischen Act“ maskiert, verwandelt werden, um sich gegenüber der ästhetischen Selektion, der die Motive unterzogen werden, zu behaupten, das beweist die zunehmende Demaskierung Artmanns mit dem Anwachsen seines Werkes und dem Älterwerden. So spricht er mitunter Klartext, wenn er unumwunden in einem Text von 1978 bekennt: „das leben hat nicht mehr den ,richtigen sound‘ und den guten sechziger Jahren nachtrauert und sich mit schlecht verhohlener Furcht vor dem Alter als „guterhaltenen mittfuffziger“ deklariert. Ein anderes Beispiel ist die explikative Vorrede zu den Montagen in Unter der Bedeckung eines Hutes von 1973.
Die Manier, in der Artmann mit den Mustern verfährt, den preziösesten wie den trivialsten, könnte vielleicht mit Poetik des Scheins auf den Begriff gebracht werden. Schein nicht in dem Sinne, daß mit allerlei Blendwerk und Flitterkram Kostbarkeit vorgetäuscht wird, sondern daß die Motive einer weitgehenden Verkünstlichung verfallen, mitunter auch nur dem Spiel mit der Verkünstlichung oder gar dem Spiel mit diesem Spiel. So entstehen durch Mehrfachbrechung kunstvolle Gebilde; die vermeintlich altbekannten Klischees bekommen neues Leben eingehaucht und entwickeln ungeahnte Dimensionen.
„Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbener kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?“
Rainer Fischer, Mai 1983, aus: H.C. Artmann: Der handkolorierte Menschenfresser, Verlag Volk und Welt, 1984.
FÜR H.C.
eine rose
aaawie eine wolke
aaaaaawie eine rose
ein berliner zimmer
aaavoll sonne
aaaaaaflügelschlag
und fröhlichen gästen
frische Gedichte
aaaauf einer wäscheleine
ein geburtstagsgruß
aaawie ein soufflé
aaaaaaaus samt und seide
von elfriede
Elfriede Gerstl
GELEGENHEITSGEDICHT NR. 3
es-Kamotage für Hans Carl Artmann 1966
ists
es ist
was ists
das ists
ists das
das wärs
gibts das
das gibts
was gibts denn da schon wieder
da gibts was
ists denn das
wenns das wäre
das wärs
es sei denn daß
was solls
solls denn was
was solls
Helmut Heißenbüttel
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Internet Archive +
Kalliope
Der Mond isst Äpfel… sagt H.C. Artmann. Die H.C. Artmann-Sammlung Knupfer
Clemens Dirmhirn: H.C. Artmann und die Romantik. Diplomarbeit 2013
Adi Hirschal, Klaus Reichert, Raoul Schrott und Rosa Pock-Artmann würdigen H.C. Artmann und sein Werk am 6.7.2001 im Lyrik Kabinett München
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
Reportage + Gesellschaft + Archiv + Sammlung Knupfer +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope + IMDb + KLG + ÖM +
Bibliographie + Interview 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Michael Horowitz: H.C. Artmann: Bürgerschreck aus Breitensee
Kurier, 31.5.2021
Christian Thanhäuser: Mein Freund H.C. Artmann
OÖNachrichten, 2.6.2021
Christian Schacherreiter: Der Grenzüberschreiter
OÖNachrichten, 12.6.2021
Wolfgang Paterno: Lyriker H. C. Artmann: Nua ka Schmoez
Profil, 5.6.2021
Hedwig Kainberger / Sepp Dreissinger: „H.C. Artmann ist unterschätzt“
Salzburger Nachrichten, 6.6.2021
Peter Pisa: H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“
Kurier, 6.6.2021
Edwin Baumgartner: Die Reisen des H.C. Artmann
Wiener Zeitung, 9.6.2021
Edwin Baumgartner: H.C. Artmann: Tänzer auf allen Maskenfesten
Wiener Zeitung, 12.6.2021
Cathrin Kahlweit: Ein Hauch von Party
Süddeutsche Zeitung, 10.6.2021
Elmar Locher: H.C. Artmann. Dichter (1921–2000)
Tageszeitung, 12.6.2021
Bernd Melichar: H.C. Artmann: Ein Herr mit Grandezza, ein Sprachspieler, ein Abenteurer
Kleine Zeitung, 12.6.2021
Peter Rosei: H.C. Artmann: Ich pfeife auf eure Regeln
Die Presse, 12.6.2021
Fabio Staubli: H.C. Artmann wäre heute 100 Jahre alt geworden
Nau, 12.6.2021
Ulf Heise: Hans Carl Artmann: Proteus der Weltliteratur
Freie Presse, 12.6.2021
Thomas Schmid: Zuhause keine drei Bücher, trotzdem Dichter geworden
Die Welt, 12.6.2021
Joachim Leitner: Zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann: „nua ka schmoezz ned“
Tiroler Tageszeitung, 11.6.2021
Linda Stift: Pst, der H.C. war da!
Die Presse, 11.6.2021
Florian Baranyi: H.C. Artmanns Lyrik für die Stiefel
ORF, 12.6.2021
Ronald Pohl: Dichter H. C. Artmann: Sprachgenie, Druide und Ethiker
Der Standart, 12.6.2021
Maximilian Mengeringhaus: „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“
Der Tagesspiegel, 14.6.2021
„Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“
wienbibliothek im rathaus, 10.6.2021–10.12.2021
Ausstellungseröffnung „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt!“ in der Wienbibliothek am Rathaus
Lovecraft, save the world! 100 Jahre H.C. Artmann. Ann Cotten, Erwin Einzinger, Monika Rinck, Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch Lesungen und Gespräch in der alten schmiede wien am 28.10.2021
Sprachspiele nach H.C. Artmann. Live aus der Alten Schmiede am 29.10.2022. Oskar Aichinger Klavier, Stimme Susanna Heilmayr Barockoboe, Viola, Stimme Burkhard Stangl E-Gitarre, Stimme
Wiener Vorlesung vom 10.5.2022 – Zwei Dichter ihres Lebens: H. C. Artmann und Wolfgang Bauer. Lesung und Diskussion literarischer Schätze:
Daniela Strigl und Erwin Steinhauer. Gestaltung und Moderation: Maximilian Gruber
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


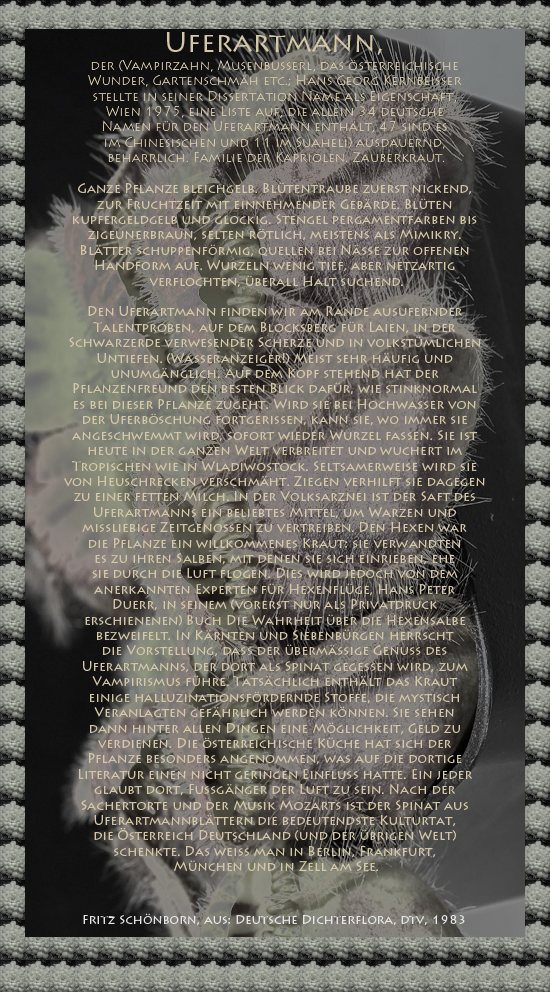












Sehr geehrte Damen und Herren!
Danke für die informative Artmann-Seite.
Hier ein Hinweis auf die Website der Internationalen H. C. Artmann Gesellschaft [IGHCA] und weiterführenden Informationen zu Artmann:
https://www.hcartmann.at/
Es wäre toll, wenn wir uns gegenseitig verlinken könnten.
Mit freundlichen Grüßen, Alexandra Millner (Präsidentin der [IGHCA] )
Sehr geehrte Frau Millner,
Wie man im Impressum von planetlyrik.de lesen kann, fühlen wir uns der 8-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes von H.C. Artmann besonders verpflichtet. Deshalb ist er auch gut dokumentiert. Die Verlinkung zur IGHCA finden sie bei den Angaben zum Autor am unteren Ende der Beitragsseite unter „Gesellschaft“.