Hans Magnus Enzensberger: blindenschrift
COUNTDOWN
hundert klafter tief in der erde
hundert faden tief im meer
zählt jener dort unsre sekunden
von zehn bis null.
meine pfeife brennt eine halbe stunde
wenn sie nicht ausgeht.
mein kopf ist noch gut
für ungefähr dreißig jahre.
der nagel den ich in die wand schlage
hält doppelt so lang.
was ich hier schreibe vergilbt
wenn es nicht feuer fängt
ungelesen, vielleicht erst
in sehr fernen zeiten.
die steinerne schwelle
verwittert nicht leicht.
länger als alles (abgesehen
vom meer, von der erde, vom moos
und gewissen himmelserscheinungen)
am längsten dauert der mensch:
solang
bis jener dort in der tiefe
unsre sekunden gezählt hat
von zehn bis null.
Hans Magnus Enzensberger / blindenschrift
Zur Provokation kann man sich kaum ein für allemal verpflichten. Zumal im Gedicht, das den Gegner nicht genau und nicht hart genug packen kann, scheint sich die Geste des Zorns schnell zu verbrauchen, „lab dich an deiner ohnmacht nicht, / sondern vermehre um einen zentner / den zorn in der welt, um ein gran“, so hieß es 1959 in der „anweisung an sisyphos“. (Verteidigung der Wölfe) „geduldig / festhalten den schmerz der negation“, so heißt es 1964 in einer poetischen Sympathieerklärung für Adorno. Aus dem Verdammten im Hades ist der prominente Philosoph in Frankfurt geworden. Diesem wird niemand den Zentner-Stein des Sisyphos zumuten. Mit dem Mythos von Sisyphos schwindet auch der Mythos der Verzweiflung, den jener beschwört. Das läßt die Sprache der beiden Gedichte spüren. Eine Gänsehaut mochte kriegen, wer Enzensbergers Ruf nach den Männern vernahm, „rollend ihren zorn auf die berge“; Adornos „schweißtuch der théorie“ erregt allenfalls distanzierten Respekt.
Solchen Absturz poetischer Mythologie in die Prosa des Benennbaren wird nur bedauern, wer vom Gedicht nichts weiter will, als daß es Stimmung habe und mache. Es kennzeichnet den neuen Gedichtband von Enzensberger, daß er dem vagen Zorn, der vielen seiner frühen Gedichte den Elan gibt, nicht länger traut. Küchenzettel, Abendnachrichten, Notizbuch heißen die Gegenstände, an denen sich eine neue poetische Nüchternheit zu bewähren versucht. Anders als etwa in dem früheren „sozialpartner in der rüstungsindustrie“, wo das Detail nur dazu da war, um von einer weitausholenden poetischen Gebärde weggefegt zu werden, wird ihm jetzt Zeit zur Entfaltung gelassen :
an einem müssigen nachmittag, heute
seh ich in meinem haus
durch die offene küchentür
eine milchkanne ein zwiebelbrett
einen katzenteller.
auf dem tisch liegt ein telegramm.
ich habe es nicht gelesen.
Freilich wird mit dem unaufdringlichen Reiz dieser Verse auch ein neues Problem von Enzensbergers Lyrik deutlich: kaum etwas unterscheidet diese Verse noch von Prosa, so diskret ist das Poetische darin geworden, daß es nahezu unkenntlich ist. Noch die Phrasierung des Kurzberichtes in Verszeilen folgt dem Duktus des gewöhnlichen Sprechens. Erst die letzten Zeilen des Gedichtes entreißen es der Beiläufigkeit. Unerwartet mischt sich die Subjektivität des Dichters ein und gibt dem zufällig Gesehenen Geschichte:
durch die offene küchentür
seh ich vergossene milch
dreißigjährige kriege
tränen auf zwiebelbrettern
anti-raketen-raketen
brotkörbe
klassernkämpfe.
links unten ganz in der ecke
seh ich einen katzenteller.
Aber gerade diese Zeilen, die die poetische Form des Prosaischen zu rechtfertigen hätten, stellen sie doppelt in Frage. So vielerlei Bedeutendes wird da im Unbedeutenden gesehen, daß eine Vermittlung nicht zustande kommt. Der Dichterblick, der den dreißigjährigen Krieg im Plural mit Raketen und Klassenkämpfen über einem Katzenteller zusammensieht, sieht weder das Historische noch den Katzenteller — allzu pauschal wird das Unbehagen, das zu den Raketen noch dreißigjährige Kriege zitieren muß, um genug Unbehagliches beisammen zu haben.
Der ästhetische Widerspruch in diesem Gedicht hätte so breit nicht vorgetragen werden dürfen, wäre er nicht symptomatisch für Enzensbergers neue Gedichte. Denn einerseits ist die Entwicklung zu einer poetisch tragbaren Sachlichkeit unvermeidlich für einen engagierten Dichter, der es bei der bloßen Gebärde der Betroffenheit nicht belassen will. Andererseits widersetzt sich das Objekt solcher Sachlichkeit, je schärfer es gefaßt wird, desto energischer der poetischen Behandlung. Die Anstrengung, das, „was der Fall ist“, festzuhalten und ihm dennoch ein poetisches Bild abzugewinnen, ist den meisten Gedichten der blindenschrift anzumerken. Die deutlichsten Spuren dieser Anstrengung tragen die Metaphern Enzensbergers. Am Eindeutigen und nicht weiter Interpretierbaren sucht er ihnen Halt. Darin meldet sich eine Unsicherheit gegenüber der Metapher. Aber statt sie zu retten, führt diese Unsicherheit zu unsicheren Metaphern: „der zufall mit seinem gewisper“ — das war nie ein gutes Bild. Vollends fade aber wird dieses Bild, wenn es durch eine Aufzählung von Namen, die aus einem alten Notizbuch auftauchen, vorbereitet wird.
Zu solchen Fehlschlägen kommt es nicht von ungefähr. Gerade weil Enzensberger in seinem dritten Gedichtband versucht, die Metapher poetisch zu analysieren, tritt eine Seite an ihr hervor, die seit je problematisch ist: immer wieder dient die Metapher in Enzensbergers Lyrik dazu, Privates und Gesellschaftliches unauffällig zu vermischen. Dieser Dienst, den die Metapher immer schon versah, scheint es zu sein, der sie heute so verdächtig macht. Sie setzt eine Solidarität jedes Einzelnen mit dem Dichter voraus, die nur ein poetisches Gemüt noch voraussetzen kann. Um auf das Beispiel zurückzukommen: die Tatsache, daß einer über den Namen und Daten seines alten Notizbuches besinnlich wird, läßt sich durch den Appell an den Zufall mit seinem Gewisper wohl undeutlicher, aber nicht bedeutsamer machen, als sie ist.
Von hier aus läßt sich die schon angedeutete Entwicklung Enzensbergers zur Sachlichkeit näher bestimmen. Es kennzeichnet diese Entwicklung, daß in seinen neuen Gedichten die Metapher überall dort zurücktritt, wo das Gedicht Privates nicht zu beschreiben und also auch nicht zu vertuschen hat, so etwa in „middle class blues“:
wir haben nichts zu verheimlichen
wir haben nichts zu versäumen
wir haben nichts zu sagen
wir haben.
Das Gedicht wird aus den Redewendungen montiert, die dem Thema zugehören. Das macht seine sprachliche Gestaltung und den Angriff, der darin steckt, einfach. In dieser Einfachheit bewährt sich ein Sprachtalent, das die sprachlichen Finessen gut genug beherrscht, um sie langweilig zu finden. In den gelungenen Versen der blindenschrift, und zumal in den polemischen, ist diese Einfachheit zu spüren. Freilich ist Enzensberger nicht nur mit den Mitteln seiner polemischen Gedichte sparsam geworden, er spart auch mit polemischen Gedichten. Das ist die Konsequenz eines Dichters, dem es mit seinem Ärger zu ernst war, als daß er ihm die Poesie nicht geopfert hätte. Die Aggressivität haben die meisten seiner Gedichte an seinen Essay-Band Einzelheiten abgeben müssen. Das ist den Aggressionen Enzensbergers bekommen; zu fragen ist, ob es auch seinen Gedichten bekommt. Wenn es auch nicht charakteristisch für die Gedichte der blindenschrift ist, so ist es doch aufschlußreich, daß Enzensberger die Welt, der poetisch zu zürnen er sich nicht mehr erlaubt, von ihrer harmloseren Seite zu zeigen beginnt. Vom „kirschgarten im schnee“ geht der Vers, vom „wollgras am düsteren wasser“, von Dingen also, an denen schon ihrem Begriff nach nichts auszusetzen ist. Auf die Elstern wälzt Enzensberger schließlich eine Verantwortung ab, die ihm im Gedicht zu schwer wurde:
mich meine herren
könnt ihr vielleicht widerlegen
aber mehrere elstern im schnee
sind ein beweis.
So listig sind die Verse eines Dichters geworden, dessen Zorn in Verse nicht mehr finden will. Daß er für seinen Zorn die Prosa gefunden hat, ist wichtig. Daß er sich in seinen Gedichten nun an ruhigere Gegenstände hält, ist ihm – und den Gedichten – zu gönnen.
Peter Schneider, Neue Rundschau, Heft 3, 1965
Das männlich-pessimistische Credo Enzensbergers
Hans Magnus Enzensberger galt bisher als der zornigste aller jungen Männer in Deutschland, als der einzige legitime Nachfolger Bert Brechts, als „vitales politisches Gewissen“. Man lobte ihn wegen seiner wortgewandten Aggressivität und seiner absoluten Unbotmässigkeit. Werner Weber, wohl der überzeugendste Apologet Enzensbergers, hob die Wachsamkeit „gegen Falsches im Gefühl“ hervor; und er wies nach, dass Enzensbergers Wirkung vor allem dadurch zustande kam, dass sich in seinen Gedichten gesellschaftskritisches Engagement und eine besondere Art der Wortkombinatorik auf das Glücklichste verbanden:
Seine Sprache stellt keine Kammern her, in denen die Brocken aus dem Alltag zur Lagerhausruhe kommen und niemandem mehr im Wege sind; sie nimmt die Brocken auf den Rücken und trägt sie grundsätzlich jedermann in den Weg…
Und an anderer Stelle sagt Weber:
Enzensberger gräbt mit Sprache Gruben, und alles sieht aus wie Scherz: man fällt hinein wie zum Scherz und merkt: das war ein Urteil und sein Vollzug.
All diese Definitionen treffen auf Hans Magnus Enzensbergers dritten Gedichtband blindenschrift aber nur noch bedingt zu. Denn die Arbeiten dieser Sammlung sind leiser geworden, monologischer, elegischer. Fast nirgendwo begegnet uns noch der Tribun, der richtend, verdammend, und anfeuernd zu einem kollektiven Publikum spricht. Der neue Enzensberger – und das wird für die Marxisten wohl ein Grund zur Enttäuschung und für die richtungsloseren Anhänger, vor allem für die Fans und die snobistischen Mitläufer, Anlass zur Verwirrung sein – ist vielmehr jemand, der das lyrische Ich wieder entdeckt hat: das lyrische Ich und dessen geduldigsten und zuverlässigsten Partner, das menschliche Du.
Nichts Pauschales mehr, kein „ratschlag auf höchster ebene“ und auch keine Verhaltensregeln „ins lesebuch für die oberstufe“. Das Aufrührerische und das Imperativische sind fast vollständig verschwunden. Und ähnlich wie bei Neruda (der, nachdem er seine Friedenskampffront-Phase durchlaufen hatte, zu relativieren begann: „Zweifellos, alles ist recht gut, / und alles ist sehr schlecht, zweifellos“) zeigt sich auch bei Enzensberger eine unverkennbare Wir-Müdigkeit.
Da gibt es zwar immer noch gesellschaftsbezogene Arbeiten, wie etwa den „middle class blues“ oder wie das „bildnis eines spitzels“. Aber niemand darf sich darüber täuschen, wie politisch defensiv auch solche Gedichte im Grunde genommen sind:
wir können nicht klagen.
wir haben zu tun.
wir sind satt.
wir essen.
das gras wächst,
das sozialprodukt,
der fingernagel,
die vergangenheit.
die strassen sind leer.
die abschlüsse sind perfekt.
die sirenen schweigen.
das geht vorüber…
Dass Enzensberger heute kaum noch hofft, die Sozietät mittels des dichterischen Worts zu verändern, veranschaulicht unter anderem ein Text wie „doomsday“, der darüber reflektiert, wie nutzlos die (an sich kaum zu erwartende) Nachricht wäre, alle nuklearen Vernichtungsmittel würden verschrottet. Sogar in einem solchen Fall wäre auf die Dauer noch nichts gewonnen; es wäre nur die Ausgangssituation vor der Erfindung der Kernwaffen da:
wir stünden am anfang.
Nun kommt freilich diese Entwicklung nicht völlig überraschend. Auch in den früheren Bänden Enzensbergers hatte es schon skeptische und resignierende Töne gegeben; denn, anders als linientreue marxistische Schriftsteller, hatte Enzensberger niemals einen Zweifel daran gelassen, dass er darum Bescheid wusste, wie wenig korrigierbar die Welt als Ganzes ist. Hier könnte man ein Gedicht wie „anweisung an sisyphos“ anführen, in dem die Revolte eher etwas wie eine moralische Trotzhandlung im Camus’schen Sinne ist als eine pragmatische Aktion mit Sozialrevolutionären Ziel. Es war einfach so: Enzensberger lebte von Anfang an zwischen den Ideologien und den Systemen. Und wenn er sich dem einen oder anderen Ismus oder Dogma einmal stärker näherte, so nur, um ethisch verletzt, bald wieder abgestossen zu werden.
Auch passten Gedichte wie „früher garten“, „tragödie“, „candide“, und „klage um ingo ledermann“ ja nie oder nur teilweise in die Schablone vom engagierten Dichter Enzensberger. Und so kam es denn auch, dass diese Arbeiten, obwohl sie zu den besten aus verteidigung der wölfe geboren, nicht die gebührende Anerkennung fanden. Noch rigoroser wurden gewisse Züge und Tendenzen, die in Enzensbergers Wesen und Talent lagen, übersehen, als dann 1960 landessprache erschien. Man mass auch diesen Band wieder nur an Brecht, und in vielen Fällen fand man ihn sogar zu brechtianisch. Was man nicht bemerkte, was man einfach ignorierte, waren ganz eindeutig pessimistische Töne:
das zarte erdherz, die sellerie, menschlicher als der mensch, frisst nicht seinesgleichen…
Eine kaum weniger misanthropische Lebenshaltung und ein keinesfalls erfreulicheres Weltbild tritt uns auch aus „wortbildungslehre“ entgegen, einem Gedicht, mit dem Enzensberger sich den Sprachexperimenten und der Silberkybernetik Heissenbüttels, Benses, Mons und Frieds auf sehr individuelle Weise nähert:
in den toten hemden
ruhn die blinden hunde
um die kranken kassen
gehn die wunden wäscher
und die waisen häuser
voll von irren wärtern
leihn den fremden heimen
ihre toten lieder…
Das Gedicht endet noch hoffnungsloser als es beginnt:
in den toten kassen
in den toten häusern
in den toten heimen
in den toten liedern
ruhn die toten toten
Das ist keine Sozialkritik mehr, keine Anleitung zum Handeln, keine Lehrdichtung, die noch behauptet zu wissen, wie man die Welt besser, wärmer und wohnlicher machen kann. Es ist vielmehr die düstere und bedrängende Einsicht darin, dass das Universum nichts als eine amoralische und im Wesentlichen unreparierbare Maschinerie ist. Deshalb sehnt sich Enzensberger in „gespräch der substanzen“ folgerichtigerweise danach, sein menschliches Bewusstsein loszuwerden und einzutauchen in die Chemie niederer Prozesse:
warum kann ich nicht konten und feuer löschen,
abbestellen die gäste, die milch und die zeitung,
eingehn ins zarte gespräch der harze,
der laugen, der minerale, ins endlose brüten
und jammern der stoffe dringen, verharren
im tonlosen monolog der substanzen?
Jener Enzensberger, der sich also schon in landessprache der sozialen Kämpfe und der politischen Mentalitäten so müde zeigte „hier schiesst der leitende herr den leitenden herrn mit dem gesangbuch ab“ und „das gewimmer… das historische, überflüssige, glor- und sinnlose heulen…“ und „ich will euch nicht ändern! vergelts gott! das lässt mich kalt! das hat keinen zweck!“), beherrscht nun unübersehbar den dritten Band. Das Engagement ist der Schwermut gewichen, das politische Pathos der Resignation:
riesiger zaddik
ich seh dich verraten
von deinen anhängern:
nur deine feinde
sind dir geblieben…
Das sagt Enzensberger in einem Gedicht über Marx. Und in einem anderen (Adorno gewidmeten) Text wird das männlich-pessimistische Credo noch präzisiert:
ungeduldig
im namen der zufriedenen
verzweifeln
geduldig
im namen der verzweifelten
an der verzweiflung zweifeln
ungeduldig geduldig
im namen der unbelehrbaren
lehren.
Ueberhaupt nimmt Enzensberger in seinen neuesten Gedichten oft ein noch dialektischeres Verhältnis zur Wirklichkeit ein. Er sieht oft keine Sache mehr, ohne nicht zugleich auch ihres Gegenteils gewahr zu werden. Das hat sich vor allem in dem Gedicht: „zweifel“ ausgeprägt, worin nacheinander die verschiedensten geistigen Positionen bezogen werden; bis es zwischendurch heisst:
ist es erlaubt, auch an den zweifeln zu zweifeln?
Enzensberger setzt also den Optimismus wie den Pessimismus gleichermassen ins Unrecht. Er billigt einem jeden Standpunkt nur zu, Standpunkt zu sein: Pol, der einen Gegenpol hat (und braucht). Tief verachtet Enzensberger diejenigen, die es sich gemütlich machen bei raschen Urteilen, Vorurteilen und Gelegenheiten; die in ihrem Kopf „eine heile welt“ spazierentragen und dort etwas Haltbares finden möchten, „sagen wir: drei pfund zement“. Diesen Leuten, die ohne Denkschablonen und ohne (wie immer geartete) Lebenslügen nicht auskommen können, werden höhnische Worte entgegengesetzt:
was wollt ihr, ich bin geständig.
unter meinen haaren
will es nicht hart werden.
unter der wolle getarnt
mein konspirativer apparat:
todfeind all dessen,
was uns heilig zu sein hat…
Eines der neuen Gedichte Enzensbergers ist Günter Eich gewidmet, und das scheint mir bedeutungsvoll zu sein. Schliesslich zeigt Enzensberger, genau wie Eich, keine Neigung, irgendeine Ideologie anzuerkennen und ein staatliches „Schlachthaus mit Geranien zu schmücken“. Auch Enzensberger versucht die Welt zu topographieren und das Leben so parteiisch wie nötig, aber so unparteiisch, so objektiv und so total wie möglich zu betrachten:
HISTORISCHER PROZESS
die bucht ist zugefroren.
die fischkutter liegen fest.
das besagt nichts.
du bist frei.
du kannst dich hinstrecken.
du kannst wieder aufstehen.
es ist nicht schade um deinen namen.
du kannst verschwinden und wiederkommen.
das ist möglich.
auch wenn einer stirbt
kommen noch briefe für ihn
es ist nicht viel zu vereiteln.
du kannst schlafen.
das ist möglich.
über nacht wird der eisbrecher da sein.
dann laufen die kutter aus.
die fahrtrinne ist schmal.
über nacht friert sie wieder zu.
das besagt nichts.
es ist nicht schade um deinen namen.
Eine solche Interpretation der Historie ist gewiss nicht im Sinne der tagespolitischen Exegeten des historischen Materialismus und der Fürsprecher des sozialistischen Realismus. –
Besonders einige Gedichte aus dem letzten Zyklus „schattenwerk“ ähneln der detailbesessenen, aber von einem geistig frei gewühlten Standpunkt aus operierenden Lyrik des Amerikaners William Carlos Williams, den Enzensberger vor einigen Jahren mit glücklicher Hand ins Deutsche übertrug und dem sich sein Werk nun zwar keinesfalls untergeordnet, aber ein wenig angenähert hat: in dem Masse etwa, in dem es sich von den beiden anderen Fixsternen Neruda und Brecht entfernte. Das Gedicht hat seinen Ursprung in halblauten Worten, wie sie der Arzt jeden Tag von seinen Patienten vernehmen kann. Diese Sentenz Williams’ könnte auch jene unter Enzensbergers Gedichten charakterisieren, die („flechtenkunde“, „mehrere elstern“, „kirschgarten im schnee“, „schattenreich“ und „schattenwerk“) – wie mit leiser, zögernder Stimme hingesprochen wirken. Da blitzt zwar gelegentlich Ironie auf, aber sie hat nichts mehr von dem Zynismus und der barschen Wut der früheren Gedichte:
mich, meine herren,
könnt ihr vielleicht widerlegen,
aber mehrere elstern im schnee
sind ein beweis
Verse wie dieser Schlussabschnitt der Elstern-Folge weisen über Williams, Pound, Stevens und das amerikanische Imago-Gedicht zurück – bis hin auf den Haiku, das (mehr wissende als aussprechende) konzentrierte Kurzgedicht der Japaner.
Hans-Jürgen Heise, Die Tat, 20.11.1964
Hans Magnus Enzenbergers langer Weg nach Westen
Wer war oder ist Hans Magnus Enzensberger? Obwohl ich ihn seit über einem halben Jahrhundert kenne und nie aus den Augen verlor, bleibt seine Persönlichkeit mir so rätselhaft wie seine literarische Physiognomie. Beim Schreiben seines Erinnerungsbuchs mit dem sprechenden Titel Tumult muss es ihm ähnlich ergangen sein, denn der Blick zurück auf die Zeit um 1968, eine wichtige Weichenstellung seines Lebens, fördert zwar unbekannte, wissenswerte und überraschende Einzelheiten zutage, aber Enzensberger tut sich schwer, zu sagen, was er wollte und wer er war. Beim Häuten der Zwiebel hat Günter Grass das jedem Memoirenschreiber vertraute Dilemma genannt, doch der Verfasser der Blechtrommel blieb seiner Geburtsstadt, sich selbst und der SPD treu und legte, von Buch zu Buch, neue und aktualisierte Versionen der Danzig-Trilogie vor. Anders Hans Magnus Enzensberger, der sich in jeder Schaffensphase neu erfand, bis er selbst nicht mehr wusste, hinter welcher Facette seiner multiplen Persönlichkeit das Ich des Autors sich verbarg:
Sein wahres Wesen kennen wir nicht; ein Geschöpf, an dem seine und unsre Einbildungskraft nicht weniger teilhat als die Geschichte: ein Kobold und Bürgerschreck, Komödiant, erotisches Genie, genialer Sammler wunderbarer Geistesschätze, aber auch ein radikaler Artist, der Verse ohne Vorbild schrieb, auf der Höhe seines Lebens von einer Bekehrung ereilt, die sein Leben in zwei Stücke gespalten hat, unberechenbar, nie ganz zu durchschauen…
Ich habe mir die Freiheit genommen, stark verkürzt aus Enzensbergers Doktorarbeit über Brentano zu zitieren, ohne den Dichter beim Namen zu nennen, um deutlich zu machen, wie verblüffend genau der in den fünfziger Jahren geschriebene Text den Werdegang seines Autors vorwegnimmt, einschließlich der politischen Bekehrung, die diesen zehn Jahre später „ereilte“.
Damit nicht alles falsch wird, eine Einschränkung: Enzensbergers Wandlung vom Dichter zum Revolutionär geschah nicht über Nacht, und anders als etwa Peter Weiss hat er sich nie zum „real existierenden“ Sozialismus bekannt und blieb auch in seiner dogmatischen Phase ein Nonkonformist. Aber es gibt einen Text vom Februar 1968, der einer Konversion zum Marxismus nahekommt, ein politisches Fanal, das Enzensberger nachträglich zu bagatellisieren versuchte mit dem Hinweis, der offene Brief an den Präsidenten der Wesleyan University sei ohne sein Zutun an die Öffentlichkeit gelangt:
Herr Präsident, ich halte die Klasse, die die USA beherrscht, und die Regierung, die ihr als Werkzeug dient, für die gefährlichste menschliche Gruppierung der Erde… Sie führt gegen mehr als eine Milliarde Menschen einen nicht erklärten Krieg… Ihr Ziel ist es, ihre politische, ökonomische und militärische Vorherrschaft über jede andere Macht der Welt zu errichten. Ihr Todfeind ist die revolutionäre Umwälzung… Ich habe mich entschieden, nach Cuba zu gehen und dort geraume Zeit zu arbeiten. Das bedeutet für mich kaum ein Opfer; ich fühle einfach, dass ich vom cubanischen Volk mehr lernen und dass ich ihm von größerem Nutzen sein kann als den Studenten der Wesleyan Universität.
Ich weiß noch, mit welcher inneren Erregung ich diese Sätze las. Ich studierte damals am Writers’ Workshop der University of Iowa und erwog ernsthaft, mein Stipendium aufzukündigen, statt einer verbrecherischen Großmacht als Feigenblatt zu dienen. Für Autoren meiner Generation war Enzensberger eine unbezweifelte Autorität, und ich beneidete ihn um das Privileg, nach Kuba zu gehen, damals eine terra incognita, deren Betreten wenigen Auserwählten vorbehalten war. Dass Enzensbergers Kuba-Aufenthalt zum Fiasko werden würde, ahnte weder er noch ich. Aber es kam noch dicker: Im nächsten oder übernächsten Kursbuch, der Hauspostille der Neuen Linken, empfahl Enzensberger jungen Autoren wie mir Günter Wallraff als Vorbild und verkündete den Tod der Literatur mit den Worten:
Für literarische Kunstwerke lässt sich eine wesentliche gesellschaftliche Funktion in unserer Lage nicht angeben.
Beim Wiederlesen dieses und anderer Texte von 1968 fällt auf, dass sie ein dadaistisches Element enthalten: Die Lust an der Provokation geht einher mit der augenzwinkernden Versicherung, es sei nicht so ernst gemeint. Enzensberger hielt sich eine Hintertür offen: Statt ihn zu lähmen, scheint die These vom Tod der Literatur seine Produktivität beflügelt zu haben. Mir ging es umgekehrt; ich war zutiefst verunsichert, als habe man mir den Boden unter den Füßen weggezogen, denn seit der ersten Begegnung mit ihm blickte ich bewundernd zu Enzensberger auf. Gegen die einschüchternde Kritik von Ernst Bloch, der mich auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen wollte, verteidigte Enzensberger meinen Text mit den Worten, es handle sich um Kaspertheater. Auch die Studentenrevolte war Kaspertheater – bekanntlich folgt auf die Tragödie die Farce. Aber statt weiter herumzualbern, studierte ich marxistische Theorie, die – von Marx bis Marcuse – weit entfernt war von linksradikaler Verachtung der Literatur: Klassisches Erbe hieß der Fachausdruck dafür.
Was erlebte Enzensberger in Kuba? In einem im Kursbuch abgedruckten Aufsatz bekannte er sich halbherzig zur kubanischen Revolution, und man musste sehr genau zwischen den Zeilen lesen, um die Desillusion zu spüren, die der Autor dabei empfand. Der Text war eine lustlose Pflichtübung – nicht nur wegen der Rekordernte von einer Million Tonnen Zuckerrohr, für die Enzensberger selbst die Machete schwang: ein von Castro diktiertes Produktionsziel, das Kubas Wirtschaft um Jahre zurückwarf. Schlimmer noch war die Verhaftung des mit Enzensberger befreundeten Dichters Padilla, der zu demütigender Selbstkritik gezwungen wurde; noch schlimmer die von Che Guevara lancierte Kampagne gegen Schwule, die in Umerziehungslager gesteckt wurden, weil sie „die Reinheit der Revolution beschmutzten“. Doch es dauerte Jahre, bis Enzensberger Tacheles redete – nicht im Kursbuch, sondern dort, wo man es am wenigsten erwartete, in seinem Poem vom „Untergang der Titanic“:
Schuhe gab es nicht und keine Spielsachen
und keine Glühbirnen und keine Ruhe,
Ruhe schon gar nicht, und die Gerüchte
waren wie Mücken. Damals dachten wir alle:
Morgen wird es besser sein, und wenn nicht
morgen, dann übermorgen. Na ja –
Wir wussten nicht, dass das Fest längst zu Ende,
und alles Übrige eine Sache war
für die Abteilungsleiter der Weltbank
und die Genossen von der Staatssicherheit.
Enzensberger nennt hier die Dinge beim Namen. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war Gastprofessor in Havanna und bekam am Ende des Semesters mit großer Geste eine Papiertüte mit sechzehn Dollar überreicht, dem Spitzengehalt eines Chefarztes – Prostituierte verdienten in einer Nacht zehnmal so viel. „Das höchste Stadium der Unterentwicklung“: So nannte Enzensberger, auf Lenin anspielend, seine Abrechnung mit dem Realsozialismus, die nicht mehr im Kursbuch, sondern in Transatlantik zu lesen war – schon der Titel des an amerikanischen Vorbildern orientierten Magazins signalisiert, dass der Autor auf seinem langen Weg im Westen angekommen war.
Auf Kursbuch und Transatlantik folgte Die Andere Bibliothek – jeder Band war ein Geniestreich, für den Enzensberger ein Logenplatz im Pantheon der Herausgeber und Verleger gebührt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, die offizielle Geschichte, deren inoffizielle Version er in den Memoiren erzählt, wo er dem Leser erstmals Einblick in sein sorgsam abgeschirmtes Privatleben gewährt.
Russischer Roman heißt der Hauptteil seines Buchs, den er in einem Schuhkarton im Keller entdeckt haben will, Aufzeichnungen von Reisen der sechziger Jahre in die UdSSR, wo Enzensberger seiner zweiten Frau Maria Makarowa begegnete und zusammen mit Sartre und anderen Koryphäen der Literatur Nikita Chruschtschow vorgestellt wurde. Das Porträt des bauernschlauen Parteichefs ist ein Kabinettstück präziser Beobachtung, gipfelnd in der Feststellung:
Von seiner größten politischen Leistung ahnt er nichts. Sie liegt in der Entzauberung der Macht… Den Personenkult dementiert er nicht allein ideologisch, sondern durch seine Person.
Dramatischer als jede Haupt- und Staatsaktion aber war die Liebe zu Mascha, der Tochter des Schriftstellers Alexander Fadejew, die Enzensberger, bürokratische Hürden überwindend, in Moskau heiratete und die sich Jahre später in London, dem Beispiel ihres Vaters folgend, das Leben nahm.
Anders als gewöhnliche fellow travellers ließ Enzensberger sich kein X für ein U vormachen und hatte den Propagandaschwindel durchschaut, noch bevor er die oben erwähnte Konversion vollzog. Der Verfasser der Memoiren bekennt seine Ratlosigkeit angesichts dieser Paradoxie, die er nachträglich so kommentiert:
Auch der Mensch war mir fremd, den ich in den Papieren, die ich in meinem Keller fand, angetroffen habe… Ich sah nur eine Möglichkeit, mich ihm zu nähern: Ich wollte ihn ausfragen. Doch war mir weder an einem Verhör noch an einer Beichte gelegen… Das Einzige, was mich interessierte, waren seine Antworten auf die Frage: Mein Lieber, was hast du dir bei alledem gedacht?
„Sag mir wo du stehst“, lautete ein besonders dümmlicher Refrain aus der ehemaligen DDR, und wer Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhofft (Warum schreiben Sie? Wen oder was wollen Sie mit Ihren Büchern erreichen?), der ist bei Enzensberger an der falschen Adresse. Auch Liebhaber erotischer Indiskretionen kommen nicht auf ihre Kosten: Nur einmal vergreift der sonst so stilsichere Autor sich im Ton, wenn er von „nie gevögelten Mädchen“ spricht. „Notwendige Fehler sind solche, die jeder andere würde vermieden haben“, schreibt Lessing in seinem Laokoon-Essay, und dazu gehören gelegentliche Ausrutscher wie die Gleichsetzung Saddam Husseins mit Hitler oder die Aufforderung an alle, Handys und Smartphones in den Mülleimer zu werfen. Der Dichter braucht „einen Restbestand von Naivität“ heißt es im Schlusskapitel seines Erinnerungsbuchs – gerade das sei es, was der Literatur ihren Freiheitsgrad verschafft. Und Enzensberger setzt hinzu:
Ein Schriftsteller, der Vorschriften für andere Schriftsteller aufstellt, ist ein Idiot.
Demgegenüber meinte Walter Benjamin, ein Schriftsteller, der andere Schriftsteller nichts lehrt, lehre niemanden etwas. Diesen Satz könnte ich Enzensberger entgegenhalten, aber ich lasse es bei der Drohung bewenden.
Hans Christoph Buch, aus Hans Christoph Buch: Tunnel über der Spree. Traumpfade der Literatur, Frankfurter Verlagsanstalt, 2019
Blindenschrift
Willkommen zu Folge sieben der TÜV-Prüfung! Welcher Dichter könnte ihr am besten gerecht werden, der magischen, der doppelsilbigen, der trochäisch-jubiläischen Sieben? Ein raunender Sprachschamane im Zwielicht seiner hermetischen Hütte? Ein schallender Sänger mit strahlendem Timbre, umbrandet vom Beifall des Publikums / Ein bebrillter poeta doctus, der sein eigenes Werk besser interpretiert als jeder wohlbestallte Exeget? Keiner von diesen soll es sein. Ihr ölverschmierter Prüfer vom Lyrik-TÜV mußte im Vorfeld der heutigen Folge mächtig aussieben, ehe er im Geknäul der Sechzigerjahrelyrik eines würdigen Kandidaten ansichtig wurde. Wolf Die Drahtharfe Biermann, Erich Zeitfragen Fried und der kleine eugen gomringer kamen bei aller grundsätzlichen Wertschätzung im Sinne christlicher Nächstenliebe schon einmal nicht ein Frage – der vermaledeiten „Gedichte“ wegen. Ernst Jandl hätte ich durchaus gern an dieser Stelle gesehen, wäre sein Debütband laut & luise (1966) nicht dummerweise eines seiner schwächeren Bücher.
Fündig bin ich dann bei einem geworden, der mit jedem seiner acht weiteren Gedichtbände genausogut beim Lyrik-TÜV hätte vorfahren können. Nun also ist es die 1964 erschienene Blindenschrift, die in meiner Erstausgabe mit der wohlfeilen Avanciertheit vergangener Zeiten noch blindenschrift heißt (der Dichter hat den Mißstand später selbst behoben). Der magischen Sieben wird unser Dichter auch dadurch gerecht, daß er auf seine Art ein rechter Zauberkünstler ist, der neben der Kleinschreiberei noch so manchen anderen Effekt im Ärmel hat. Seinen Paradetrick führt er uns in Blindenschrift freilich noch nicht vor. Erst sechzehn Jahre später, in dem Band Die Furie des Verschwindens, wird das inzwischen wohlbekannte Kunststück erstmals vor ein größeres Publikum gebracht. Es trägt den Titel „Der Fliegende Robert“ und geht so:
Eskapismus, ruft ihr mir zu,
vorwurfsvoll.
Was denn sonst, antworte ich,
bei diesem Sauwetter! –,
spanne den Regenschirm auf
und erhebe mich in die Lüfte.
Von euch aus gesehen,
werde ich immer kleiner und kleiner,
bis ich verschwunden bin.
Ich hinterlasse nichts weiter
als eine Legende,
mit der ihr Neidhammel,
wenn es draußen stürmt,
euern Kindern in den Ohren liegt,
damit sie euch nicht davonfliegen.
Man merkt es dem lakonischen Tonfall an, daß hier kein graziös taumelnder Hochseilartist und Reimfetischist à la Peter Rühmkorf am Werk ist, sondern ein gut geerdeter Pragmatiker, der mit gleichwohl beachtlichen levitatorischen Fähigkeiten beeindruckt. Und wer würde dieser Beschreibung eher gerecht als unser heuriger Kandidat, Hans Magnus Enzensberger. Seit fünf Jahrzehnten begleitet dieser Schriftsteller unseren bundesdeutschen Wohlstandsstaat mit seinen meist vielbeachteten Einwürfen. In den sechziger, siebziger Jahren hat mancher in ihm deshalb schon eine Art deutschen Lehrmeister sehen wollen, einen linken praeceptor germaniae.
Daß Enzensberger ein unerwachsener Mensch sei, gehört schwerlich zu dem Bild, das eine größere Öffentlichkeit sich von ihm macht. Trotzdem beharrt der Held des zitierten Gedichtes auf einer gewissen Kindlichkeit. Schon der Titel deutet es an: „Der Fliegende Robert“ ist eine Figur aus dem Kinderbuchklassiker Struwwelpeter des Dr. Heinrich Hoffmann. Dessen bebildertes opus magnum wird heutzutage oft ein wenig vorschnell der Rubrik „Schwarze Pädagogik“ zugeordnet. Doch mit gepfefferten Stellungnahmen gegen Rassismus, Jagdwahnsinn und Tierquälerei ist das Buch auch nach hundertfünfzig Jahren noch hoch-, top- und megaaktuell. Die rabiaten Strafen, mit denen ein lehrreiches Fatum kindliche Fehltritte im Struwwelpeter ahndet, wurden des öfteren kritisiert, meist von Menschen, die eine sehr viel biedermeierlichere Vorstellung vom Kindsein hegen als der aus dem Biedermeier stammende Verfasser selbst. Doch das Bild vom Hasen, der die Flinte auf den Jäger richtet, gehört auf jede Jagdhütte, in jedes Forstamt und gern auch auf die Nachttischchen unserer lieben Kleinen.
Auch das lyrische Ich unseres Gedichtes scheint den Struwwelpeter für ein Werk mißgünstiger Erwachsener zu halten. Diese langweiligen Menschen neiden den Kindern ihre Fähigkeit zum Davonfliegen und wollen ihnen mit Schreckensgeschichten das Hinausstürmen bei schlechtem Wetter vermiesen: Spielverderber, denen es ein Schnippchen zu schlagen gilt! Gottlob hat unser Held sich seine kindlichen Talente nicht abtrainieren lassen. Noch als „Großer“ beherrscht er den Trick mit dem Fliegen und entzieht sich damit bei Bedarf allen Zumutungen der Erwachsenenwelt.
Von euch aus gesehen,
werde ich immer kleiner und kleiner,
bis ich verschwunden bin.
Die entscheidenden Worte lauten hier natürlich: „Von euch aus“, was im Umkehrschluß soviel heißen dürfte wie: „Von mir aus gesehen schrumpft ihr.“ Der Trick mit dem Fliegen ist also in Wahrheit ein Verschwindetrick, ein doppelter sogar. Folgerichtig findet sich das Gedicht vom Fliegenden Robert in einem Gedichtband, der – mit Hegels plastischer Wortprägung – Die Furie des Verschwindens heißt. Als das Buch im Jahr 1980 erscheint, gilt Enzensberger manchem linken Gesinnungsgenossen von einst schon als Renegat. „Eskapismus“, rufen ihm jene zu, die glauben, daß er die gemeinsame Sache verraten habe. Enzensberger wäre nicht, der er ist, wenn er nicht eine ebenso kühle wie wohlformulierte Antwort für sie bereithielte. In seinem Essay „Das Ende der Konsequenz“ heißt es 1981:
Wer von Prinzipientreue spricht, der hat bereits vergessen, daß man nur Menschen verraten kann, Ideen nicht.
Wer ist dieser Mann, dem manche Freunde – wie etwa der schwedische Schriftsteller Lars Gustafsson – eine reptilienhafte Kälte zusprechen, manche Kontrahenten hingegen – wie etwa Peter Weiss – größte Sensibilität? Der seit fünfzig Jahren in der literarischen Szene der Bundesrepublik so stetig präsent ist wie kaum ein anderer und dennoch immer wieder für überraschende Eskapaden gut? Gibt es neben den geschriebenen auch gelebte, sprich: biographische Spuren, die zu ihm führen? Wir wollen versuchen, dem Fliegenden Robert auf seiner schäumenden Luftspur zu folgen und ihm, wer weiß, vielleicht sogar ein bißchen auf die Schliche zu kommen.
Im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit soll ein früher Gedichtband Enzensbergers stehen: Blindenschrift. Als dieses Buch 1964 erscheint, hat Enzensberger die literarische Szene der jungen Bundesrepublik bereits im Sturm erobert. Ein Jahr zuvor ist ihm, dem Dreiunddreißigjährigen, als bislang jüngstem Empfänger der Büchner-Preis zugesprochen worden. Nun, in seinem dritten Lyrikband, überrascht und irritiert er mit einem Tonfall, den man bislang nicht von ihm kannte. Der Fliegende Robert, so könnte man sagen, spannt zum ersten Mal den Regenschirm auf. Schauen wir, wohin der Wind ihn trägt.
*
Das Gedicht vom Fliegenden Robert findet sich im Band Die Furie des Verschwindens auf der vorletzten Seite. Als Finale folgt das Titelgedicht, in dem Enzensberger die Bewegung der Auflösung mit großer Geste vom Persönlichen ins Allgemeine überführt. Die Furie, die hier ihren Auftritt hat, ist zwar dem grammatikalischen Geschlecht nach weiblich; ansonsten ist sie jedoch ein höchst seltsames Zwitterding, halb Fabelwesen, halb Abstraktion, halb sexy Sadie:
Sie sieht zu, wie es mehr wird,
verschwenderisch mehr,
einfach alles, wir auch;
wie es wächst, über den Kopf,
die Arbeit auch; wie der Mehrwert
mehr wird, der Hunger auch (…)
Sie tut dies in der ruhigen Gewißheit, daß ihr letztlich sowieso alles zukommt, was da wächst und gedeiht. Und so lautet der Schluß des Gedichtes:
ohne die Hand auszustrecken
nach dem oder jenem,
fällt ihr, was zunächst unmerklich,
dann schnell, rasend schnell fällt, zu;
sie allein bleibt, ruhig,
die Furie des Verschwindens.
Das ist nun allerdings eine bedrohlichere Art des Verschwindens, als „Der Fliegende Robert“ sie zuvor praktiziert hat. Dennoch sind beide Stücke nahe Verwandte; ihre gemeinsame Ahne findet sich in einem anderen Gedicht Enzensbergers. Was uns zu unserem erklärten Hauptgegenstand bringt, dem Band Blindenschrift: Auf Seite zweiundsechzig meiner dunkelgrau kartonierten Erstausgabe entfaltet die Ahnfrau aller Robertiaden ihre erstaunliche Wirkung. Ihrem Würdentitel, „die windsbraut“, macht sie bei diesem furiosen Auftritt alle Ehre:
sie schlägt die türen zu
sie reißt die türen auf
sie wirft dir sand in die augen
ihr haar ist dunkel wie die vernunft
sie stöhnt und ist taub
gegen dein stöhnen
sie ist ein atem der atem raubt
und atem schenkt
Interessante Frau, mag man sagen, ob Sie mich der mal vorstellen könnten? Doch schon die nächste Strophe läßt ahnen, daß diese temperamentvolle Brünette eher etwas ist, was man sich selbst vorstellen muß:
sie kommt mit staubwolken auf der stirn
und zerfetzt die fahnen
alte zeitungen neue
jagt sie über den roten platz
Keine Furie des Verschwindens, sondern der Furor des Vernichtens macht mit solchen Aktionen von sich reden. In seinen Schredder geraten vorzugsweise überkommene Gewißheiten: Nichts ist so alt wie die Fahne von gestern. Daß dieses Verlieren von Gesinnungsballast eine durchaus lustvolle Angelegenheit sein kann, zeigt der weitere Verlauf des Gedichtes, in dem der reinigende Wirbelsturm wieder zu einer lockenden Wind in mythischen Zuschnitts changiert:
sie ist schön
sie denkt auf biegen und brechen
sie umarmt die wurzeln und rauft sie aus
sie empfängt den flüchtigen samen
Es folgt so etwas wie ein mythologisch übersteigerter Geschlechtsakt. Die Windmetaphorik wird selbst beim Clinch mit der raufenden Frau bis in die aerodynamischen Einzelheiten aufrechterhalten:
stämme dich gegen sie
und sie trägt dich
gib dich hin
und du fällst
Ratschläge, die auch beim Segelfliegen von Nutzen sein dürften. Wie das Gedicht „Die Furie des Verschwindens“ ist „die windsbraut“ ein virtuoses Spiel mit dem Doppelsinn, der sich aus einer Abstraktion und ihrer weiblichen Personalisierung ergibt. Was dort der Vater des Weltgeistes leistete, unternahmen hier des Weltgeists naive Kinder in ihrem animistischen Aberglauben, daß in Wirbelstürmen ein weibliches Prinzip walte. Enzensberger lieferte zur semantischen Zweideutigkeit die lyrische Extrapolation.
Noch steht freilich die behauptete Verbindung zum „Fliegenden Robert“ aus. Erst ganz zum Schluß des Gedichtes vermählt sich die Windsbraut mit ihrem widerständigen Gegenpart, und die Hochzeitsreise geht wohin? Richtig, in die Lüfte:
sie weht
sie erhebt sich
sie wiegt dich
sie wirft dich
stämme dich auf ihre brust
nimm Sie
sie trägt dich
sie trägt dich fort
Womit auch dieser frühe Vorläufer des „Fliegenden Robert“ sich glücklich verflüchtigt hätte. Wir sehen, daß Enzensberger das Motiv des Verschwindens über die Jahre hinweg immer wieder aufgegriffen und abgewandelt hat. Ähnlich wie Beethoven in seinen Variationen auf einen launigen Walzer Diabellis erreicht unser Dichter dabei eine erhebliche Variationsbreite auf schmaler Grundlage: Zwischen luftigem Scherz und dem Ernst der Vernunft ziehen seine Fluchtgedichte ihren klaren Kurs.
Und der Flug geht weiter bis in die Gegenwart. Ein im Jahr 1999 erschienener Gedichtband Enzensbergers trägt den Titel Leichter als Luft – da wird die Methode fast schon zur Masche. Der Gedanke an Flucht und Auflösung weist neben neckischen aber auch schmerzliche Ausprägungen auf. Im 1995 erschienenen Kiosk ist es eine „Gedankenflucht“ in vier Teilen, die den Band durchzieht und strukturiert. „Gedankenflucht“ – ein schön doppeldeutiger Titel ist das, der offenläßt, ob es die Gedanken selbst sind, die fliehen, oder ob die Flucht sich in der Vorstellung vollzieht. So leicht wie einst fällt das Verschwinden jedenfalls nicht mehr. Eine neue Unübersichtlichkeit ist an die Stelle der überkommenen Schemata getreten, und wer aus dem Links-Rechts-Stechschritt von einst ausschert, ist nurmehr einer von vielen:
Als wäre gleich hinter Helsinki
oder Las Palmas alles ganz anders,
überall Umzüge, Fluchtgedanken.
Ganze Ortschaften kommen abhanden.
Wohin fliehen angesichts solcher Völkerwanderungen? Abhauen wäre ja schon mitmachen. In dieser Zwickmühle artikulieren Bedenken sich vorzugsweise als Fragen, die eine gespaltene Seele im inneren Zwiegespräch an sich selbst richtet:
Auch du, mein Alter, läßt dich bewegen,
bewegst dich. Bei aller Liebe.
Wozu? Was suchst du? Dollars,
Maniok, Spaß, Munition?
Oder nur deine Ruhe?
„Ich suche eine Erklärung.“
Im dritten Teil der „Gedankenflucht“ wendet sich Enzensbergers lyrischer Held probehalber vom Tagesgeschehen ab und der Natur samt ihren Wissenschaften zu. Doch siehe, auch hier ist alles auf Wandel angelegt:
Daß es nicht dabei bleibt,
gilt auch für die Steine.
Das Gebirge dehnt sich, fließt,
pulsiert, rauscht, reißt,
wenn auch langsam.
Was heißt schon langsam
bei einem Berg?
In einer Zeit, da ständige Veränderung das einzig Sichere zu sein scheint, stellt sich Enzensbergers lyrisches Subjekt die Frage nach der eigenen Haltung. Früher reichte schon ein Regenschirm nebst „Sauwetter“, um sich fröhlich über die Dinge zu erheben. In den neunziger Jahren bleibt die Erkenntnis, daß bei aller Wendigkeit eine Flucht letztlich nicht möglich ist. Da hilft es wenig, auf der eigenen Beweglichkeit zu beharren.
Du ziehst um, fliehst,
vermischst dich mit dem,
was der Fall ist.
Auf Weiterungen
heißt es gefaßt sein.
Bei uns bleibt es nicht.
Letztlich, so gibt Enzensberger zu verstehen, ist jegliche Individualität nur eine winzige Schattierung in einer keineswegs unendlichen Menschheitsgeschichte. Bei soviel gefaßtem Geschichtspessimismus verwundert es nicht, daß der vierte Teil der „Gedankenflucht“ noch einmal jene Bewegung nachvollzieht, die bereits die beiden Schlußgedichte des Bandes Die Furie des Verschwindens nahmen: vom sich auflösenden Individuellen ins personalisierte Abstrakte, vom „Fliegenden Robert“ zur „Furie“. Wiederum wird das Enthobene durch eine weibliche Rollenzuschreibung versinnbildlicht.
Die kleine Pilgerin da
auf ihrer chaotischen Bahn,
dieses umherirrende,
glimmende Nichts –
wie war doch der Name gleich? –
und was sucht sie nur,
die bis auf weiteres
unsterbliche Seele?
Sie wühlt im Müll,
unermüdlich, nach Weisheiten,
die plötzlich weg waren,
zerkrümelt in endlosen Permutationen,
vermoderten Paperbacks.
Ob es wirklich die Seele der Seelsorger ist, die Enzensberger hier mit Assoziationen umkreist! „Gedankenflucht“ ist ein Dokument der Ratlosigkeit, und ein wenig ratlos läßt das Gedicht auch den Leser zurück.
Eines jedoch dürfte sich mit einiger Gewißheit abgezeichnet haben: daß Hans Magnus Enzensberger nicht nur der wohlbekannte, wache und wendige Geist ist, der die Geschichte der Bundesrepublik mit beständiger Wandelbarkeit begleitet hat. Hinter seinen kleinen und großen Fluchten steckt vielmehr eine komplexe Künstlerpersönlichkeit, die in Gedichten immer wieder ihre dunklen Seiten ausleuchtet. So erfolgreich ist sie damit, daß mancher vom poetischen Werk schon auf ein sonniges Gemüt des Poeten schließen wollte. Ihr Lyrik-TÜV rät da zur Vorsicht, denn auch das haben wir dem Gedicht „die windsbraut“ entnehmen können: Die Vernunft ist dunkel.
*
Enzensbergers Spiel mit dem Erscheinen und Verschwinden ist nicht nur ein künstlerisches Motiv, sondern auch eine biographische Strategie. Seine Kollegen haben das Sichauflösen und Neuformieren der Enzensberger-Person am eigenen Leib erlebt. Peter Rühmkorf schreibt in seinem autobiographischen Memoband Die Jahre die Ihr kennt:
Wenn wir uns zufällig einmal trafen, entwich er alsbald in dringende Termine, Verabredungen auf Flugplätzen, Besprechungen in Hotel-Lobbys, Projektkonferenzen für alle Medien und auf allen Wellenlängen. Vermutlich ist er überhaupt kein Festkörper sondern ein Luftwesen, das Prinzip Hoffnung auf Rädern, der Weltgeist auf Achse, sich den Zeitströmungen auf eine seglerhafte Art akkomodierend.
Fliegender, segelfliegender Robert also auch hier. Rühmkorf malt das Bildnis des Dichterkollegen als eines Mannes der Zwischenräume. Der Vielbeschäftigte versteckt sich hinter seinen vielen Beschäftigungen: Ich ist woanders.
Man könnte auch einen weniger aeronautischen Vergleich finden: Zickzack heißt im Jahr 1997 ein Essayband unseres Probanden. Der Zickzacklauf ist eine bekannte Fluchtstrategie des heimischen Feldhasen. In Enzensbergers Hauswappen, falls es denn eines gäbe, müßte dieser erfolgreiche Vertreter der Gattung lepus gleich neben dem „Fliegenden Robert“ seinen Platz finden. Wenn Enzensberger das Hasenpanier ergreift, flaggt er deshalb freilich nicht gleich weiß. Er gehört – siehe Dr. Hoffmanns Ausführungen zu diesem Thema – zu jener Unterart von lepus europaeus, die schießen kann – notfalls mit Spatzen auf Kanonen und bei Bedarf sogar auf die eigenen Leute.
Hakenschlagen ist eine für Boxer wie Hasenfüße gleichermaßen nützliche Fähigkeit. Peter Weiss hat Enzensbergers Künste in dieser Disziplin erlebt und ihre Durchschlagskraft schriftlich bezeugt. In einem Notat vermerkt er über den Kollegen:
Immer dieses ungute Gefühl: man weiß nie, wo man ihn hat, aber das ist eben seine Stärke, daß niemand ihn kennt, er hält mir ja auch vor, daß ich mich allzu leicht zu erkennen gäbe. Daß er kommt, wenn’s ihm paßt, geht, wenn ihm danach ist, das macht seine Überlegenheit aus. Er ist der Ungebundne, sich zu engagieren, das ist lächerlich. Und doch: wahrt er diesen Abstand nicht aus einer Verletzbarkeit heraus? Wer hätte mehr Sensibilität als er?
Merken wir uns einstweilen die Stichwörter „Überlegenheit“, „Verletzbarkeit“, „Sensibiliät“. Ich habe so eine dunkle Ahnung, daß im Verlauf dieser Nachforschungen noch öfter auf diesen bemerkenswerten Dreischritt – zickzack! – zurückzukommen sein wird.
Weiss’ Notat ist bemerkenswert vor allem dort, wo es eine Vorhaltung Enzensbergers kolportiert:
Das ist eben seine Stärke, daß niemand ihn kennt, er hält mir ja auch vor, daß ich mich allzu leicht zu erkennen gäbe.
In der Tat dürfte unser Dichter die Arbeit an seinem Bild in der Öffentlichkeit stets als integralen Teil seiner Schriftstellertätigkeit verstanden haben. Der kokette Verweis auf das biographische Ich und dessen Widersacher im Gedicht „Der fliegende Robert“ ist eines von vielen Puzzleteilen der öffentlichen HME-Imago, wenngleich Werbeleute bei soviel planvoller Selbstvermarktung wohl eher von „Image“ sprechen würden. Daneben gibt es jedoch auch eine biographisch belegte Unrast bei Robertus Magnus, die tiefere Gründe als eine planvoll verfolgte Karriere und das lustvoll narzißtische Vexierspiel mit vielerlei Selbstbespiegelungen haben muß.
An Rupturen und Migrationen auf Zeit herrscht bei Enzensberger in der Tat kein Mangel. Zumindest in den ersten Jahren seiner staunenswerten Karriere ist unser Mann dauernd auf Achse. Im Jahr 1958 zieht er, knapp dreißigjährig, nach Stranda in Norwegen. Ein Jahr später, 1959, folgt die Umsiedlung nach Lanuvio in Italien. Ein weiteres Jahr später, 1960, geht es zurück nach Deutschland, wo er für ein Jahr in Frankfurt am Main wohnt. Das darauffolgende Jahr sieht ihn wieder in Norwegen, nun allerdings auf der Insel Tjøme. Hier hält es ihn, von Reisen unterbrochen, immerhin gut drei Jahre lang, ehe er 1965 in Berlin-Friedenau Domizil nimmt. 1968 folgt dann ein einjähriger, ziemlich desillusionierender Aufenthalt auf Fidel Castros Revolutions-Kuba, ehe er wieder nach Berlin geht (zur dauerhaften Heimat der späteren Jahrzehnte wird bekanntlich München). Macht insgesamt sechs Wohnorte in vier verschiedenen Ländern, auf zwei Kontinenten, innerhalb eines Jahrzehnts. Selbst in Enzensbergers Ehen mag man die Sehnsucht nach einer Befreiung vom eigenen Vaterland gespiegelt sehen: Seine erste Frau ist Norwegerin, die zweite Russin. Erst die dritte Heirat bringt ihn mit einer Deutschen zusammen.
Apropos „Vaterland“: Günter Grass hat sich gegenüber seinem Biographen Michael Jürgs zur Problematik der in den späten zwanziger Jahren Geborenen geäußert, und es ist sicherlich kein Zufall, daß Enzensberger dabei namentlich erwähnt wird:
Wir alle, die damals jüngeren Lyriker der fünfziger Jahre, Rühmkorf, Enzensberger, Bachmann, waren uns deutlich bis verschwommen bewußt, dass wir zwar nicht als Täter, doch im Lager der Täter zur Auschwitz-Generation gehörten, dass also unserer Biographie, inmitten der üblichen Daten, das Datum der Wannseekonferenz eingeschrieben war.
Interessant, daß Grass das Wort „Biographie“ im Singular verwendet – so, als ob Rühmkorf, Enzensberger und Bachmann einen völlig identischen Lebenslauf hätten, der die genauere Unterscheidung überflüssig machte. Etwas seltsam weht einen auch die Formulierung „im Lager der Täter“ an, um so mehr, als gleich darauf Auschwitz erwähnt wird: Im Lager befanden sich doch wohl die Opfer, nicht die Täter. Noch die Prägung „Auschwitz-Generation“ läßt eine seltsame Vermengung von Täter- und Opfer-Perspektive erkennen.
Beim jungen Enzensberger äußert sich die Zugehörigkeit zur Flakhelfergeneration nicht in verwaschenen Äußerungen, sondern in pointierten politischen Gedichten. Seine ersten beiden Gedichtbände, Verteidigung der Wölfe von 1957 und Landessprache von 1960, beziehen ihre Dynamik wie auch ihre Wirkung auf das zeitgenössische Publikum ganz überwiegend aus einem beträchtlichen Zorn auf die Nachkriegsgesellschaft. Es scheint freilich, als sei Enzensberger die Lust am Wettern recht bald vergangen. Im Jahr 1958 gibt der Achtundzwanzigjährige in einem Suhrkamp-Prospekt über sein gegenwärtiges Tun Auskunft. Da heißt es zunächst:
Praktisch, bei der Arbeit des Gedichteschreibens, und theoretisch, als Essayist, bewegt mich in diesen Monaten die Frage nach dem politischen Gedicht.
Das ist die Pflicht, doch nun folgt die Kür:
Vor eine zweite, weniger grimmige poetische Aufgabe stellt mich (…) meine sieben Monate alte Tochter. Auch sie verlangt Gedichte; auch sie ist mit dem bloß Gutgemeinten nicht zufrieden. „Es war einmal ein Männchen, / das kroch in ein Kännchen, / dann kroch es wieder raus, / und jetzt ist die Geschichte aus.“ Solche Verse verlangt sie.
Es sei dahingestellt, ob ein sieben Monate altes Mädchen schon so artikuliert nach Versen fragen kann; die meisten Kinder sind in diesem Alter noch ganz mit dem Übergang von flüssiger zu fester Nahrung beschäftigt. Ziemlich sicher sehnt sich aber der stolze Vater des frühreifen Kindes nach „solchen Versen“. Dahinter steckt nichts anderes als der Wunsch nach „schöpferischer Verwandlung“.
Die uralten Kinderreime, ihr oft absurder Witz, ihre rhythmische Potenz, ihr einfacher Glanz, das alles kann für einen Gedichtschreiber nicht nur eine Quelle der Erheiterung und des Vergnügens, sondern auch der schöpferischen Verwandlung sein.
Es fällt auf, wie klar unser Dichter die Arbeit am „politischen Gedicht“ von den Quellen „der Erheiterung und des Vergnügens“ abgrenzt. Jenes, so spüren wir, ist für ihn das Seriöse, der Brotberuf, dieses das Vergnügen, welches er gegenüber einem sich vorzugsweise tiefernst und staatstragend gebärdenden Literaturbetrieb vorsichtig verteidigt. Halten wir einstweilen fest, daß Enzensberger sich offenbar schon als knapp Dreißigjähriger nicht mehr hundertprozentig im Einklang mit seiner Rolle als seriöser, avancierter und politisch einflußnehmender Poet und Essayist fühlt, daß er vorerst aber nicht anders als in widerstreitenden Kategorien denken kann, wenn es um die Verbindung des spielerisch Zweckfreien mit dem gesellschaftlich Zweckgebundenen geht.
Den Grundstein für die anstehende Wandlung legt dann bezeichnenderweise nicht der Lyriker, sondern der Theoretiker Enzensberger. In seinem Essay „Poesie und Politik“ lesen wir 1962:
Literaturkritik als Soziologie verkennt, daß es die Sprache ist, die den gesellschaftlichen Charakter der Poesie ausmacht, nicht ihre Verstrickung in den politischen Kampf. Bürgerliche Literaturästhetik verkennt oder verheimlicht, daß Poesie gesellschaftlichen Wesens ist. Entsprechend plump, entsprechend unbrauchbar die Antworten, die beide Lehren vorzuschlagen haben auf die Frage, wie der poetische zum politischen Prozeß sich verhalte.
Das ist gute alte Wildwestmanier: erst einmal links und rechts die Nebenbuhler ausschalten, ehe man um die schöne Tochter des Sheriffs anhält. Daß das Ganze auf Entlastung hinausläuft, ja auf eine fast schon Thomas Mannsche Schreibruhe, macht wenige Seiten später der folgende Satz deutlich:
Der revolutionäre Prozeß der Poesie entfaltet sich, so steht zu vermuten, eher in stillen, anonymen Wohnungen als auf den Kongressen, wo dröhnende Barden in der Sprache dichtender Kaninchenzüchter die Weltrevolution verkünden.
Mehr Abgrenzung, mehr Entlastung geht nicht, wenn man denn nicht gleich den gesamten „revolutionären Prozeß“ in der Kunst verabschieden will. So weit ist Enzensberger im Jahr 1962 noch nicht. Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, daß er erste Übungen im Davonfliegen wagt.
*
Es gibt von Julian Barnes ein ganz wunderbares Buch, eine Art poetologischen Romans namens Flauberts Papagei, darin sich Barnes’ Held Geoffrey Braithwaite ausgiebig mit seinem Lieblingsschriftsteller, Gustave Flaubert natürlich, befaßt. Fünfzehn Kapitel lang umkreist Dr. Braithwaite, ein englischer Arzt im Ruhestand, den gewichtigen Gegenstand seines pensionären Interesses in immer neu strukturierten Varianten: Es gibt eine „Schriftliche Prüfung“ („Für alberne oder überheblich kurze Antworten… Punktabzug“), es gibt „Braithwaites Wörterbuch der übernommenen Ideen“ (Stichwörter in alphabetischer Reihenfolge von „Achille“ bis „Zola, Emile“), und es gibt gleich zu Beginn eine Chronologie in mehreren Teilen.
Teil eins schildert ein an Triumphen reiches Schriftstellerleben vom Elternhaus („aufgeklärtes, anregendes Milieu“) über rauschende literarische Erfolge („Salammbô liefert sogar den Namen für eine neue Sorte petit four“) bis an die tränengetränkte Bahre („Hochgeehrt, allseits beliebt stirbt Gustave Flaubert in Croisset“); Teil zwei bietet das Kontrastprogramm vom Durchfall an der Pariser Juristischen Fakultät über Epilepsie, Syphilis und Depression bis zu Einsamkeit, Schreibhemmung und Mißerfolg („Veröffentlichung von L’Education sentimentale; bei der Kritik und auch kommerziell ein Flop“). Ein größerer Gegensatz läßt sich schwer denken, und dennoch sind beide Teile vollkommen wahr.
Kurzum, ein ausgezeichnetes Buch, das mit Hans Magnus Enzensberger nicht das geringste zu tun hat. Daß ich hier darauf zu sprechen komme, hat zwei Gründe: Zum einen will mir scheinen, daß jede der bislang von uns auf diesen Seiten betrachteten Künstlerbiographien diese beiden Seiten aufweist. Hinter dem Glanz des Glückens steht oft genug das Verzweifeln des Scheiterns oder, schlimmer noch, die Mediokrität der Zwischenzeiten. Zum anderen, und um wieder auf unseren Gegenstand zurückzukommen, gibt es bei Hans Magnus Enzensberger, wenn schon keine doppelte Biographie, so doch eine doppelte Bibliographie von ähnlicher Polarität wie die zwei Leben des Gustave Flaubert. Veröffentlichungen mit bedeutsamen Titeln wie Politik und Verbrechen, Deutschland, Deutschland unter anderm oder Einzelheiten I: Bewußtseins-Industrie stehen andere gegenüber, die Allerleirauh und Edward Lears kompletter Nonsens heißen oder ihre hochgreifenden Titel (Mittelmaß und Wahn) zumindest durch heitere Untertitel wie „Gesammelte Zerstreuungen“ konterkarieren – Enzensbergers ganz eigene „Andere Bibliothek“, wenn man so will.
Wie erklären wir uns diese Janusköpfigkeit in Enzensbergers Werk? Es scheint, als würde sich der schnell aufgebaute Erfolgsdruck der frühen Jahre in einem gewissen Unbehagen des Dichters an seiner eigenen Rolle im Literaturbetrieb niederschlagen. Hinzu kommt, daß für einen Lyriker von seinen Ansprüchen das Schreiben eine schwierige Sache ist und bleibt. Der Kulturjournalist Jörg Lau präsentiert in seiner sehr lesenswerten Biographie Hans Magnus Enzensberger – ein öffentliches Leben eine Selbstaussage aus dem Jahr 1960, in der Enzensberger Antwort auf eine Umfrage der Zeitschrift konkret gibt:
Übrigens arbeite ich sehr ungern, es ist sehr mühselig, zu schreiben, ich brauche also, abgesehen von der Zeit, die ich meinem Beruf widme, Zeit, um nichts zu tun, darauf lege ich Wert. Wohin aber soll ich diese Zeit, die wichtigste, rechnen – ist das „Erhaltung“ oder „Produktion“? Sie sehen, es ist nicht so einfach. Aber hungern muß man dabei nicht, wie mir scheint; ich kann es mir sogar leisten, kein Auto zu besitzen.
Das ist souverän und mit Witz gesagt. Enzensberger deutet eine durchaus prekäre schöpferische Situation an „übrigens arbeite ich sehr ungern“ –, verbittet sich dann aber besorgte Nachfragen – keine Angst, „hungern muß man dabei nicht“ –, ehe er beidem, der Entlastung und der Schreibproblematik, mit einer kleinen gesellschaftskritischen Volte ein Schnippchen schlägt. Zickzack.
Vergleichen wir diese Selbstaussage von 1960 mit der oben zitierten von 1958, so ergibt sich ein Bild Enzensbergers, das zu seinem damaligen Image als zorniger junger Mann in einigem Gegensatz steht. „Schöpferische Verwandlung“, „Zeit, um nichts zu tun“ – das sind nicht eben Formulierungen, wie man sie von einem voranstürmenden Junggenie erwarten würde. Augenscheinlich hält sich Enzensberger bereits in den Jahren zwischen seinem ersten und zweiten Gedichtband kleine Fluchten offen, in denen er dem wachsenden Erfolgsdruck entwischen kann.
Daß sein Zickzackkurs keine unproblematische Sache ist, hat Enzensberger bei einem Treffen der Gruppe 47 erfahren müssen. Anfang der sechziger Jahre ist er der beneidete und weithin akzeptierte Jungstar der Gruppe; entsprechend selbstbewußt tritt er auf. Doch mit dem Aufstieg wächst auch die Fallhöhe. Im Jahr 1961 findet das Gruppentreffen in der Nähe von Lüneburg statt. Ausgerechnet in einem Jagdschloß wird Hans Magnus Enzensberger seinen Zickzackkurs ausprobieren und eine „schöpferische Verwandlung“ versuchen. Was dann geschieht, schildert Jörg Lau wie folgt:
Enzensberger liest hier aus seinem Drama „Die Schildkröte“. Es wird ein schrecklicher Reinfall, der erste und einzige dieser Art in Enzensbergers Karriere. „Als er seine Lesung beendet hatte“, schreibt Hans Werner Richter in seinen Erinnerungen an die Gruppe, „setzte lähmendes Schweigen ein.“ Wolfgang Hildesheimer meldet sich und sagt nur einen Satz: „Schmeiß es in den Papierkorb“ – ein Rat, den Enzensberger spontan befolgt. Wolfdietrich Schnurre äußert sich in seinem Tagungsbericht in der Welt ungewöhnlich scharf über Enzensbergers „Pennäler-Sketches“: „Hier ist einer, der es sich nicht leisten dürfte, vor der Wirklichkeit in den reinen Infantilismus zu fliehen. Sicher, es ehrt Enzensberger, daß er seinen Durchfall mit Fassung ertrug, doch die Fassungslosigkeit derer, die auf ihn setzten, ist weitaus größer gewesen.
Fast also hätte Enzensberger neben Dr. Hoffmanns Fliegendem Robert und schießendem Hasen noch eine Schildkröte in sein Wappen aufnehmen können. So wie die Dinge sich entwickeln, wandert die Schildkröte in den Papierkorb, und ein hochbegabter junger Dichter lernt, daß allzu offenes Entwischen aus dem eigenen Rollenbild manchen scheinheiligen Kollegen umgehend zum Halali blasen läßt. Fortan setzt Enzensberger das Spielerische nur noch unter genau bedachten Vorkehrungen ein.
Hier einige weitere Beispiele aus der „zweiten“ Bibliographie, die in den nachfolgenden Jahrzehnten trotz verschärfter Sicherheitsbedingungen entstanden ist:
– In den achtziger Jahren steuert Enzensberger den neunten Band zu seiner Anderen Bibliothek bei: Das Wasserzeichen der Poesie ist eine fulminante Anthologie der Les- und Spielarten von Lyrik, deren Ruhm in den Jahrzehnten seit ihrem Erscheinen noch gewachsen ist. Enzensberger befreit seine Leser aus der Ehrfurchtsstarre vor den Werken der Dichter und zeigt, daß Gedichte Spaß machen können. Als Herausgeber der Sammlung firmiert ein pseudonymes Alter ego namens „Andreas Thalmayr“. Aufmerksame Leser des Essaybandes Politische Brosamen von 1982 ahnen, wer sich hinter der Maske verbirgt – wir werden noch darauf zu sprechen kommen.
– In den neunziger Jahren schweigt Andreas Thalmayr vielleicht weil es Enzensberger nunmehr keinerlei Schwierigkeiten bereitet, die Eingebungen seiner spielenden Muse unter Klarnamen zu veröffentlichen. So sei an dieser Stelle denn auch freudig der vorläufige Höhepunkt einer Hasenkarriere im Zickzack vermerkt: Im Jahr 1993 erscheint in Zusammenarbeit mit Irene Dische eine Buch namens Esterhazy. Eine Hasengeschichte. Auf dreißig Seiten geht es, in Form einer Fabel für Kinder und Erwachsene, um altes Abendland und neues Europa, um Mauerfall und Zeitenwende – ein „Watership Down“ en miniature. Hier, so möchte man sagen, ist der Hase im Ziel eingelaufen, und zwar einige Löffellängen vor seinem krummbeinigen Mitläufer Zeitgeist.
– Noch besser trifft Enzensberger den Ton der eben anbrechenden Harry-Potter- und Sofies-Welt-Zeit mit einem Edutainment-Titel des Bücherjahres 1997. Der Zahlenteufel heißt im Untertitel Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben und ist Enzensbergers, wie er selbst sagt, einziger „richtiger“ Bestseller. Wie bewußt er sich der Kreuz- und Querverbindungen in seinem Werk ist, können wir dem Namen des kindlichen Helden in Der Zahlenteufel ablesen: er heißt Robert.
– Zwei Jahrzehnte nach Das Wasserzeichen der Poesie reaktiviert Enzensberger sein Alter ego Andreas Thalmayr. Im Jahr 2004 erscheint der Band Lyrik nervt, ein Vademekum für die, die Gedichte nicht lesen (aber, wenn wir Enzensberger recht verstehen, gut daran täten), im darauffolgenden Jahr ein sprachkritischer Essay unter dem Titel „Heraus mit der Sprache“. Nun wird auch dem letzten klar, daß die ursprünglich zum Schutz der eigenen Person erfundene Persönlichkeitsspaltung längst den Charakter eines fröhlichen Rollenspiels angenommen hat soweit sie das nicht schon von Anfang an war.
*
Als Blindenschrift im Jahr 1964 erscheint, nehmen deutsche Gesinnungsgenossen mit einiger Verwunderung die Gedichte aus dem norwegischen Naturidyll wahr, in dem Enzensberger seit drei Jahren lebt. Das erste Gedicht trägt den Titel „küchenzettel“ und wirkt fast wie eine buchstäbliche Umsetzung der Programmatik aus Poesie und Politik:
an einem müßigen nachmittag, heute
seh ich in meinem haus
durch die offene küchentür
eine milchkanne ein zwiebelbrett
einen katzenteller.
auf dem tisch liegt ein telegramm.
ich habe es nicht gelesen.
in einem museum zu amsterdam
sah ich auf einem alten bild
durch die offene küchentür
eine milchkanne einen brotkorb
einen katzenteller.
auf dem tisch lag ein brief.
ich habe ihn nicht gelesen.
in einem sommerhaus an der moskwa
sah ich vor wenigen wochen
durch die offene küchentür
einen brotkorb ein zwiebelbrett
einen katzenteller.
auf dem tisch lag die zeitung.
ich habe sie nicht gelesen.
durch die offene küchentür
seh ich vergossene milch
dreißigjährige kriege
tränen auf zwiebelbrettern
anti-raketen-raketen
brotkörbe
klassenkämpfe.
links unten ganz in der ecke
seh ich einen katzenteller.
Wir erinnern uns, wie das in Prosa lautete:
Der revolutionäre Prozeß der Poesie entfaltet sich, so steht zu vermuten, eher in stillen, anonymen Wohnungen als auf den Kongressen.
„küchenzettel“ ist zweifelsohne eine Impression aus einer „stillen Wohnung“. Mit dem „revolutionären Prozeß“ ist es jedoch so eine Sache; ihm wird ziemlich kurzer Prozeß gemacht.
Was hier und heute in meiner Küche geschieht, so gibt das lyrische Ich zu verstehen, das ist mehr oder weniger dasselbe wie auf dem Stilleben eines alten Meisters „in einem museum zu amsterdam“. Die Zeitläufte mit ihren „anti-raketen-raketen“ und „klassenkämpfen“ scheinen das abgeschiedene Idyll nicht zu gefährden, sondern seine angenehme Überschaubarkeit noch zu steigern. Irgendwo auf der Welt, so der lyrische Held, findet sowieso immer etwas Schreckliches statt, davon verdirbt mir die Milch nicht. Aus dieser Perspektive werden sogar „dreißigjährige kriege“ austauschbar.
Enzensbergers intensive Beschäftigung mit der Poesie der internationalen Moderne macht sich in seinem dritten Gedichtband verstärkt bemerkbar. Ein „Inventar“ finden wir vor Günter Eich bereits bei Jacques Prévert; in der Übersetzung von Kurt Kusenberg ist es 1960 auch in Enzensbergers Museum der modernen Poesie enthalten. Die ersten beiden Strophen des Gedichtes könnten mit ihrem aufgelockerten Bilanzduktus das Modell für den „küchenzettel“ abgegeben haben.
Ein Stein
zwei Häuser
drei Ruinen
vier Totengräber
ein Garten
Blumen
ein Waschbär
ein Dutzend Austern eine Zitrone ein Brot
ein Sonnenstrahl
eine Sturzwelle
sechs Musiker
eine Tür mit Fußabtreter
ein Herr mit der Rosette der Ehrenlegion
noch ein Waschbär
Am stärksten setzt sich in Blindenschrift jedoch der Einfluß des Nordamerikaners William Carlos Williams durch. Enzensberger hat kurz zuvor eine Auswahl aus dessen lyrischem Werk übertragen. Im Jahr 1962 ist der Band Die Worte, die Worte, die Worte bei Suhrkamp erschienen, darin enthalten Williams’ berühmtes „Nur damit du Bescheid weißt“. Auch dieses Gedicht ist nichts anderes als ein Küchenzettel.
Ich habe die Pflaumen
gegessen
die im Eisschrank
waren
du wolltest
sie sicher
fürs Frühstück
aufheben
Verzeih mir
sie waren herrlich
so süß
und so kalt
Williams ist einer, der genau hinsieht. Er destilliert Gedichte aus dem Stoff des Lebens, statt poetische Sauce über die Welt zu gießen. Genaue Beobachtung verbindet sich bei ihm mit einer knappen, alltagsnahen Sprache. In Enzensbergers Nachwort zu Die Worte, die Worte, die Worte ist das Erstaunen über die innere Freiheit dieses Dichters noch deutlich spürbar:
Er schrieb ganz unabhängig von der jeweils kurrenten Literatursprache und scheute jeglichen Jargon, den der Gebildeten ebenso wie seine Antithese, den Slang. (…) Das Raffinement seiner Schreibweise wird durch das scheinbar Alltägliche eines solchen Sprachgebrauches gleichsam getarnt. Die Gedichte wirken auf den ersten Blick eher unscheinbar. Der Grad von Verdichtung, den sie erreichen, wird erst beim genaueren Zusehen deutlich.
„Unscheinbarkeit“ konnte man Enzensbergers eigener Lyrik bislang schwerlich nachsagen. Sein Frühwerk will – daran ist nichts Verwerfliches – auftrumpfen und Effekt machen. In dem berühmt gewordenen Titel- und Schlußgedicht des Debütbandes Verteidigung der Wölfe nimmt er mit einigem rhetorischen Furor die großen Schurken vor den kleinen Mitmachern in Schutz.
Wer näht denn dem General
den Blutstreif an seine Hose? Wer
zerlegt vor dem Wucherer den Kapaun!
Wer hängt sich stolz das Blechkreuz
vor den knurrenden Nabel? Wer
nimmt das Trinkgeld, den Silberling,
den Schweigepfennig? Es gibt
viele Bestohlene, wenig Diebe; wer
applaudiert ihnen denn, wer
steckt die Abzeichen an, wer
lechzt nach der Lüge?
Das sind, zwölf Jahre nach Kriegsende, durchaus ungewohnte Worte in der deutschen Lyrik – vor allem, weil man sie so lange nicht gehört hat. Die Massenverachtung des jüngeren Benn trifft auf die didaktische Rhetorik des mittleren Brecht, und die Wucht des Aufpralls ist beträchtlich. Das „Alltägliche eines solchen Sprachgebrauches“ hält sich freilich in Grenzen: „Blutstreif“ und „Schweigepfenning“ sind nicht eben Wörter, die man beim morgendlichen Brötchenkauf wechselt. Wie früh Enzensberger gelernt hat, mit Sprache zu prunken, belegt zudem eine Passage aus dem autobiographisch gefärbten Roman Was ist Was des zwei Jahre jüngeren Bruders Christian Enzensberger. Der halbwüchsige Bruder wird darin wie folgt porträtiert:
Er kennt Wörter, die noch nie jemand gehört hat. Nonsens, sagt er, Betisen. Völlig inhibiert der Mann. Bärbeißerisch. Betucht. Zwielichtig. Kompatibel. Louche. Montgolfiere. Brouillon. Adlat. Und mit jedem dieser Wörter zieht er eine niegesehene Muschel an Land. (…) Brauch ich alles für später, sagt er. (…) Ich werde Dichter.
Merke: Ungewöhnliche, schwierige, nur wenigen bekannte Wörter machen für den jungen Hans Magnus das Dichterische aus. Obendrein bieten sie sich als der scheinbar schnellste Weg aus der Dunstglocke der deutschen Nachkriegszeit an.
Bei W.C. Williams lernt Enzensberger, wie man auch ohne prunkvolles Vokabular weitreichende Wirkung erzielen kann. Doch nicht nur die Sprache, auch die Thematik hat sich unter dem Einfluß des Amerikaners geändert. Folgende Sätze aus seinem Williams-Essay lesen sich fast wie eine Gebrauchsanweisung für Enzensbergers dritten Lyrikband:
Seine Fähigkeit, Tonfälle und Gesten dichterisch zu transponieren, erlaubte es Williams übrigens, einer überall herrschenden literarischen Konvention den Garaus zu machen, die es für ausgemacht hielt, daß die Familie, der Alltag eines gewöhnlichen Hauses, die Intimität einer Küche oder eines Badezimmers in einem modernen Gedicht nicht erscheinen dürfe. Ein absonderliches Tabu schien es den Poeten der ersten Jahrhunderthälfte nahezulegen, daß der Nordpol, die Atombombe und der Minotaurus ihrer Aufmerksamkeit würdiger wären als das Handruch, der Kühlschrank und die Nachttischschublade.
Noch in Enzensbergers zweitem Gedichtband spielte die Atombombe eine tragende Rolle. Das Gedicht „küchenzettel“ liest sich nun wie eine Befreiung von den Zumutungen der Zeit an das Gedicht. Daß diese Befreiung nicht mit Weltflucht gleichzusetzen ist, zeigt indes schon das dritte Stück des dritten Gedichtbandes, „abendnachrichten“. Hier haben wir nicht mehr das souverän weltabgewandte Ich aus „küchenzettel“ vor uns, sondern eines, das vom Zeitgeschehen buchstäblich heimgesucht wird.
massaker um eine handvoll reis,
höre ich, für jeden an jedem tag
eine handvoll reis: trommelfeuer
auf dünnen hütten, undeutlich
höre ich es, beim abendessen.
auf den glasierten ziegeln
höre ich reiskörner tanzen,
eine handvoll, beim abendessen,
reiskörner auf meinem dach:
den ersten märzregen, deutlich.
Merke: Emigrieren führt nicht in die Idylle, selbst wenn es in die schönsten Gegenden der Welt führt. Daß Enzensberger auf einer norwegischen Insel lebt, sichert noch nicht sein Entkommen aus allen Weltzusammenhängen. Mit dem Radiogerät bleibt der Flüchtige auf Empfang. Hinzu kommen die ganz eigenen Gefahren der Abgeschiedenheit. Das Gedicht „abgelegenes haus“ faßt noch einmal die norwegische Mischung aus Schrecken und Freuden der Einsamkeit zusammen:
ich setze das wasser auf.
ich schneide mein brot.
unruhig drücke ich
auf den roten knopf
des kleinen transistors.
„karibische krise… wäscht weißer
und weißer und weißer…
einsatzbereit… stufe drei…
that’s the way i love you…
montanwerte kräftig erholt…“
ich nehme nicht das beil.
ich schlage das gerät nicht in stücke.
die stimme des schreckens
beruhigt mich, sie sagt:
wir sind noch am leben.
Man mag sich fragen, ob das Geplärr des Radios wirklich „die Stimme des Schreckens ist“ oder nicht eher die Stimme der Banalität. Für solche Unschärfen entschädigt der wunderbar dräuende Schluß, der auch auf der Tonspur eines subtilen Gruselfilms guten Effekt machen würde.
das haus schweigt.
ich weiß nicht, wie man fallen stellt
und eine axt macht aus flintstein,
wenn die letzte schneide
verrostet ist.
Die Stille der Wildnis wirkt auf den Kulturanpasser Mensch bedrohlicher als alle Nachrichten von neuen Schrecken und alten Trivialitäten. Darin mag durchaus ein ironischer Selbstkommentar stecken: Der Essayist Enzensberger hat sich in den frühen sechziger Jahren als scharfzüngiger Medienkritiker etabliert, dem vom Spiegel bis zum Versandhauskatalog kein Gegenstand zu widrig oder zu niedrig ist. Hier nun sehen wir, wie der Medienkritiker am Rand der Wildnis die sedierende Wirkung des Radios plötzlich zu schätzen lernt.
Gegen Beschaulichkeit hält Enzensberger noch ein anderes probates Mittel bereit: die Sprache. In ausnahmslos allen Gedichten der Blindenschrift schlägt er einen betont nüchternen Tonfall der Beobachtung und Aufzählung an. Wie der Blinde die Schrift des Monsieur Braille abtastet, so tastet Enzensberger die Welt mit Wörtern ab.
Es sind einfache, unverstellte Wörter. Farbige Adjektive wie bärbeißerisch, betucht und zwielichtig kommen in diesen Gedichten nicht vor, erlesenes Vokabular wie kompatibel, Louche und Montgolfiere ebensowenig. Der genialische Jungdichter hat die Dreißig hinter sich gelassen. Rechtzeitig merkt er, daß man nicht immer frühreif bleiben kann und daß auch Wunderkinder das Altern nicht verpassen dürfen.
Wie ernst es Enzensberger mit seiner lyrischen Persönlichkeitswandlung ist, wie tief die Selbstirritation geht, zeigt das Gedicht „notizbuch“. Das Ich dieses Gedichtes sinnt den längst vergessenen Personen nach, die hinter den Namen in seinem abgewetzten Brevier stehen:
olga, roberto, claudine:
wer mag das gewesen sein?
Zum Schluß richtet sich der Blick auf den Sprechenden selbst. Auch seinem Namen ergeht es irgendwo auf der Welt nicht anders:
so steht der meinige, leicht
berieben, älter als ich,
in anderen büchern:
wer mag das gewesen sein?
wer Immer es war,
streicht ihn aus.
*
Neben dem mißtrauisch umkreisten und umreisten Vaterland spielt der leibliche Vater in Hans Magnus Enzensbergers Werk eine wichtige Rolle – um so mehr, als sich der Dichter sonst in allen privaten Belangen sehr bedeckt hält. Etwas von dieser Diskretion zeigt sich noch in Jörg Laus Biographie, die nicht einmal die Geburtsorte und -jahrgänge der Eltern vermerkt. Immerhin ist dem Band zu entnehmen, daß Andreas Enzensberger von Beruf Ingenieur war, daß er den Rang eines Oberpostrates bekleidete und 1934 aus beruflichen Gründen der NSDAP beitrat. Zu den pöbelhaften Nazis soll dieser auf Manieren bedachte Mann freilich in großer innerer Distanz gestanden haben.
In dem Band Kiosk ist 1995 ein Gedicht namens „Der Geist des Vaters“ enthalten, das so doppeldeutig ist wie sein Titel: Zum einen schildert es den Vater als Geistererscheinung, zum anderen reflektiert es dessen geistiges Erbe. Was ist, unter diesen Vorzeichen, dem Sohn im Gedächtnis geblieben?
An manchen Abenden sitzt er da,
wie früher, leicht gebückt,
summend am Tisch
unter der eisernen Lampe.
Die Tuschfeder schürft
über das Millimeterpapier.
Ruhig zieht sie, unbeirrt,
ihre schwarze Spur.
Manchmal hört er mir zu,
den schneeweißen Kopf geneigt,
lächelt abwesend, zeichnet weiter
an seinem wunderbaren Plan,
den ich nicht begreifen kann,
den er niemals vollenden wird.
Ich höre ihn summen.
Der „wunderbare Plan“ hat, wie wir bei Jörg Lau erfahren, die Verbesserung der Welt am Beispiel der Eisenbahn im Sinn. Oberpostrat Enzensberger widmet sich in den Nazijahren einem seltsamen Hobby:
Er arbeitet, über Karten und Tabellen gebeugt, an einem Plan zur Verbesserung des Kursbuches – auch dann noch, als draußen schon die Truppentransporte und Deportationen laufen und die Gleisanlagen bombardiert werden. Abend für Abend zieht er sich an seinen Schreibtisch zurück, um den Fahrplan der Deutschen Reichsbahn zu rationalisieren – ganz so, als habe ihm eine höhere Vernunft den Auftrag erteilt.
Eine Fotografie aus dem Jahr 1966 zeigt Andreas Enzensberger in der beschriebenen Positur: „Schneeweiß“ sitzt der alte Herr am Schreibtisch, konzentriert sich auf eine Schreib- oder Rechenaufgabe und wirkt auf leicht entrückte, silbergraue Art präsent – auch eine Art von innerer Emigration. Entsprechend schwer erreichbar erscheint der Vater dem Sohn:
Manchmal hört er mir zu,
den schneeweißen Kopf geneigt,
lächelt abwesend, zeichnet weiter
an seinem wunderbaren Plan,
den ich nicht begreifen kann (…)
Das ist freundlich und diskret gesagt, heißt aber bei Licht besehen nur, daß der Vater seinem Ältesten oft nicht zuhörte und sich – wenn auch lächelnd – von ihm abwandte. Der Sohn seinerseits steht in der Position eines Bittstellers vor dem Vater. Zwischen die beiden schiebt sich ein Nichtbegreifen: Jener lebt in einer eigenen Welt, an der er diesen nicht teilhaben läßt.
Diese Distanz bleibt offenbar lebenslang gegenwärtig. Warum sonst hätte Hans Magnus Enzensberger, zum Zeitpunkt der Gedichtveröffentlichung immerhin selbst schon über sechzig Jahre alt, eine Szene auswählen sollen, welche die Vater-Sohn-Konstellation in die Gegenwart rückt: Der Vater ist jetzt als Geistererscheinung anwesend, und das kann ja wohl nichts anderes heißen, als daß das unerlöste Vater-Sohn-Verhältnis fortlebt und sich jederzeit in Erinnerung rufen kann. In der Tat zieht sich eine deutliche „Vaterspur“ durch Enzensbergers Werk, und in mancher Hinsicht mutet sein kritisches Verhältnis zum Vaterland wie ein Ersatzschauplatz für eine fällige Auseinandersetzung mit dem Vater an.
In seinem bereits erwähnten Roman Was ist Was schildert der Bruder Christian Enzensberger die Rückkehr des Vaters in den ersten Nachkriegstagen. Dabei wird deutlich, daß dessen Abgewandtheit auch eine weniger lächelnde Form als in dem Gedicht „Der Geist des Vaters“ annehmen konnte.
Wir sitzen bei unserem gewohnten stummen Abendessen aus Pellkartoffeln und Quark, als er in einer umgenähten Uniform bei uns eintritt. Er grüßt beiläufig wie immer. Mit einem Schlag kehrt die verlorengegangene Erinnerung an ihn zurück. (…) Er steht da, ruhig, sichtlich gealtert, ohne Anspruch, Vorwurf, oder auch nur Neugier. (…) Unser Jubel, unsere Umarmung, die große Wallung von Liebe und Dankbarkeit – alles nur ausgedacht.
Eine kalte, ruhige, selbstbezogene Autorität – das ist der Vater in Christian Enzensbergers Schilderung. Am lautstärksten begehrt offenbar der älteste Sohn auf: Christian Enzensberger porträtiert den fünfzehn jährigen Bruder als ungebärdigen Halbwüchsigen.
Mitten auf der Königsstraße schreit er laut natüür! natüür! und kräht den Nonnen nach kikeriki! Wo man geht und steht, muß man sich mit ihm genieren. Er liest Dostojewski. Er poussiert mit der Helga. Was fällt dir ein! ruft die Mama. (…) Ich bin fünfzehn, antwortet er. Er liest Dostojewski. Ist das auch was für dich? fragt die Mama. Er schweigt. Er hilft nie beim Abspülen. Dazu bist du dir wohl zu schade, sagt die Mama. Er schweigt. Eigentlich mußte man jetzt Nazisachen an die Amis verscherbeln, sinniert er. Was sagst du da! schreit die Mama. Wieso denn nicht? Bloß weil der Alte auch in der Partei gewesen ist? – Um Gotteswillen Kind schweig, sagt die Mama.
Den Vater-Sohn-Konflikt, der hier kräftig aufscheint, hat Enzensberger später künstlerisch sublimiert: Das Bild vom kleinbürgerlichen Oberpostrat, der jahrzehntelang an einer niemals verwirklichten Eisenbahnreform arbeitet, taucht in den unterschiedlichsten Inkarnationen auf. Oft handelt es sich um kleine, versteckte Gesten der Anerkennung, die ihrerseits um Anerkennung nachzusuchen scheinen. Nachfolgend ein paar Beispiele.
Im Lyrikdebüt Verteidigung der Wölfe findet sich der HME-Klassiker „Ins Lesebuch für die Oberstufe“, beginnend mit dem berühmt gewordenen Wort:
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne:
sie sind genauer (…)
Es folgt ein Ratschlag, wie man in Zeiten der Diktatur überlebt:
Versteh dich auf den kleinen Verrat,
die tägliche schmutzige Rettung.
Das ist die eine Seite der inneren Emigration. Doch auch „Wut und Geduld sind nötig, / in die Lungen der Macht zu blasen / den feinen tödlichen Staub (…)“. Man kann das ebenso als ambivalente Hommage an den Vater lesen wie als Selbstrechtfertigung des mit Oden befaßten Sohnes. An diesen ergeht im Gedicht die bezeichnende Bitte:
Lern unerkannt gehn, lern mehr als ich:
das Viertel wechseln, den Paß, das Gesicht.
Das Odenmotiv taucht auch im Folgeband, Landessprache, auf, und wiederum wird es mit fast verächtlicher Geste abgehandelt: „oden an niemand“ lautet der Titel eines Kapitels, und in dem abschließenden Langgedicht, „gewimmer und firmament“, heißt es:
schreib deine oden selber, kanallje!
Ein weiterer Kapiteltitel liefert dementsprechend „gedichte für die gedichte nicht lesen“. Bei aller zeitaktuellen Brisanz dieser Stücke läßt sich darin auch ein Stück privater Familiengeschichte mitlesen: Es ist offenbar nicht ganz einfach, als Sohn eines Fahrplanfanatikers Dichter zu werden.
Der grundsätzliche Zweifel am Wert der Dichtung läßt sich bis in die späten sechziger Jahre hinein verfolgen, als Enzensberger – aus skeptischer Distanz – in den allgemeinen Abgesang auf die Literatur einstimmt. Der wird dann augenfälliger als anderswo in einer von ihm selbst begründeten Zeitschrift ausgetragen, dem Kursbuch. Der Titel des 1965 erstmals erschienenen Periodikums ist eine weitere Hommage an den Vater, dessen unvollendet gebliebenem Kursbuch der Sohn nun sein eigenes, tatsächlich existierendes entgegensetzt: Es soll noch einer sagen, Odenleser brächten es zu nichts.
Wo Vätern auf so zweischneidige Art gehuldigt wird, sind auch Ersatzväter meist nicht weit. Bei Enzensberger ist das Väterliche eng mit dem Politischen verknüpft, seine geistigen Vorfahren sucht er gern unter Revolutionären. „karl heinrich marx“ ist so ein „großer Vater“, und das ihm gewidmete Porträtgedicht aus Blindenschrift beginnt folgerichtig mit den Worten:
riesiger großvater
jahvebärtig
auf braunen daguerreotypien
ich seh dein gesicht
in der schlohweißen aura
selbstherrlich streitbar
und die papiere im vertiko:
metzgersrechnungen
inauguraladressen
steckbriefe
Ähnlich ehrfurchtgebietend und jahvebärtig figuriert später Fidel Castro im Hintergrund des Dokumentarstückes „Das Verhör von Habana“ – seltsam genug, wenn man bedenkt, daß Enzensberger zu diesem Zeitpunkt bereits aus eigener Anschauung die trübe Realität der kubanischen Revolution kennt.
Unverfänglicher als die erfolgreichen Revolutionäre sind die gescheiterten Umstürzler. In seinem Montageroman Der kurze Sommer der Anarchie ist es Enzensberger um die gescheiterten spanischen Anarchisten des Sommers 1936 zu tun. Gegen Ende des Buches beschreibt Enzensberger, wie diese in Würde gealterten Männer im Heute des Jahres 1972 leben und denken.
In ihren Wohnungen gibt es nichts Überflüssiges. Verschwendung und Warenfetischismus sind ihnen unbekannt. (…) Das Analphabetentum einer Szene, die sich von Comics und Rockmusik bestimmen läßt, betrachten sie ohne Verständnis. Die „sexuelle Befreiung“ (…) übergehen sie mit Schweigen (…) Das sind keine kaputten Typen. Ihre physische Verfassung ist ausgezeichnet. Sie sind nicht ausgeflippt, sie sind nicht neurotisch, sie brauchen keine Drogen. (…) Die alten Männer der Revolution sind stärker als alles, was nach ihnen kam.
Das sind nun freilich wahrhaft konservative Rebellen, deren Verhältnis zu allem neumodischen Kram dem der Generation deutscher Kriegsteilnehmer verdächtig ähnelt. Im Vergleich zu dieser genießen sie allerdings den entscheidenden Vorzug, politisch unkorrumpiert zu sein.
Nach dem Flirt mit den alten Spaniern richtet sich Hans Magnus Enzensbergers Augenmerk in den achtziger Jahren wieder verstärkt auf den eigenen Vater. Andreas E. wird nun gar zum Helden eines höchst vergnüglichen Prosastückes. In seinem Essay „Zur Verteidigung der Normalität“ tritt Hans Magnus Enzensberger im Jahr 1982 eben dazu an: das vermeintlich doofe Mittelmaß zu verteidigen gegen all jene, die sich durch ihre lauthals zur Schau gestellte Verachtung des Durchschnittlichen in den Ruch des Besonderen bringen wollen. Eingebaut in den Text sind Skizzen der Lebensläufe einiger Alltagshelden. Neben der Raumpflegerin Gretel S. und dem vormaligen Obergefreiten Mollenhauer finden wir dort auch einen Oberpostdirektor Thalmayr:
1957, einen Tag vor seiner Pensionierung – seine zwei Söhne aus zweiter Ehe haben inzwischen ihr Hochschulstudium abgeschlossen, und er verdient nun als Oberpostdirekror laut Besoldungsordnung DM 1.720 –, eröffnet Thalmayr die Netzgruppe Cham (Oberpfalz). (…) Damit ist das letzte bayerische Ortsnetz an den Selbstwählverkehr angeschlossen. (…) Nach der Einweihung (…) gewährte Thalmayr einem Mitarbeiter des Oberpfälzer Boten ein Interview. Das Gespräch wandte sich auch den historischen Bedingungen seiner Arbeit zu. Auf die Frage, wie er die gesellschaftliche Bedeutung seines Projekts einschätze, antwortete Thalmayr: „Telephonieren wollen sie alle.“
So also sind sie gestrickt, die Helden nach Enzensbergers Geschmack: wortkarg und handlungsstark. Wir erkennen die Melodie, nur der Text hat sich ein wenig geändert. Man ersetze das Wort „Revolution“ durch „Selbstwählverkehr“, und schon erhält man den neuen Refrain: Die alten Männer des Selbstwählverkehrs sind stärker als alles, was nach ihnen kam.
Festzuhalten bleibt, daß der ironische, bürgerliche, sich selbst in seiner Bürgerlichkeit hinterfragende Enzensberger der achtziger und neunziger Jahre näher bei sich selbst zu sein scheint als der rastlose, manchmal auch ratlose Kulturmigrant der fünfziger und sechziger Jahre. Da ist es nur angemessen, daß sich aus dem fiktiv-realen Oberpostrat Thalmayr und dem realen Andreas Enzensberger Mitte der achtziger Jahre jener pseudonyme Andreas Thalmayr amalgamiert, der in seinen bislang drei Büchern das Odenlesen und die Sprachsensibilität selbst wortvergessenen Tatmenschen schmackhaft zu machen versucht. Offenbar ist Hans Magnus Enzensberger mit Vater, Vaterland und Sohnesrolle endgültig ins reine gekommen.
*
Was aber ist denn nun von Blindenschrift zu halten? Sagen wir es so: Der Band bezeichnet einen Wendepunkt in der Entwicklung Hans Magnus Enzensbergers. Mit seinem dritten Gedichtband stellt er sich den Freischein für eine ambivalente Persönlichkeit aus: Was der Essayist und Citoyen wichtig findet, muß den Lyriker nicht ohne weiteres interessieren. Umgekehrt erlaubt sich der Lyriker Empfindungen, die dem enragierten Öffentlichkeitsmenschen suspekt sein müssen. Eine Rückkehr zu den Quellen der Posie!
Ja, aber auch ein Anschluß an die Weltsprache der internationalen Lyrik. In seiner Komposition und Konzeption ist dies der wohl geschlossenste Gedichtband unseres Dichters: Der doppelte Enzensberger verbündet sich mit sich selbst. Es entsteht ein Werk von einiger Kargheit und Klarheit, das sich aus der politisch aufgeheizten Atmosphäre der sechziger Jahre eigensinnig ausklinkt und gerade deshalb die vergangenen vier Jahrzehnte in bemerkenswerter Frische überstanden hat. Ich kann mir gut vorstellen, daß sich daran in den nächsten vierzig Jahren nicht viel ändern wird. Falls dann noch jemand Gedichte liest.
Steffen Jacobs, in Steffen Jacobs: DER LYRIK TÜV, Eichborn Verlag, 2007
Nachexistenzialistische Lyrik von Links
nach nirgendwo
Wenn jemand glaubt, dass alle wesentlichen Fragen bereits gestellt sind, dass die meisten davon semantisch fragwürdig sind, dass es auf die Frage nach dem Sinn nur Schweigen als Antwort gibt, wenn jemand also nachexistenzialistisch verortet ist, schreibt er wie Hans Magnus Enzensberger. Das Ergebnis ist, dass eine Frage, die eigentlich nicht gestellt werden darf, so kunstvoll in der Schwebe gehalten wird, dass bloß(!) keine Antwort erkennbar wird. Denn eine Antwort zu dulden, hieße, der Frage untreu werden, welche durch ihre unbeantwortbare Stellung, die einzig rechte Erkenntnis darstellt.
Wer mit solchen Haltungen, die Schriftbild werden (allerdings nicht Braille!), etwas anfangen kann, kann auch Enzensbergers Lyrik genießen.
Kankin Gawain, amazon.de, 13.6.2010
Wichtige Station
Enzensbergers dritter Gedichtband markiert vielleicht nicht einen Wendepunkt aber zumindest einen spürbaren Wandel in seiner poetischen Produktion. Hatte er sich zuvor durch teilweise aggressiv vorgetragene sprachgewaltige Verse mit dem Gestus des „angry young man“ als Kritiker der restaurativen Bundesrepublik bekannt gemacht, so kehrt nun eine gewisse Ruhe ein. Das betrifft einerseits den Stil: Metaphern und andere Stilmittel werden wesentlich sparsamer verwendet, seine Diktion wird nüchterner wo nicht gar prosaischer und lässt den Ton seiner späteren Gedichte schon ahnen. Zum andern steht die Kritik der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse nicht mehr so sehr im Zentrum: da gibt es auch Gedichte über Naturerscheinungen und schlichte Dinge wie Holzhütten, Leuchtfeuer und trigonometrische Punkte. Das heißt allerdings nicht, dass Enzensberger nunmehr vom politischen Gedicht zur Naturlyrik schwenkt, es wird keine Idylle heraufbeschworen: Gefahren lauern im Unter- oder Hintergrund und andeutungsweise kommt auch eine postapokalyptische Welt ohne Menschen in den Blick. Der Dichter bleibt zudem im Dialog oder in Auseinandersetzung mit Leitfiguren wie Brecht, Adorno oder Marx (und wird sich nur ein Jahr später als Herausgeber des Kursbuch wieder richtig in den linken Diskurs einbringen) – behält sich aber Zweifel und einen eigenen Standpunkt vor, der auch im Rückzug auf eine norwegische Insel und in eine kärglich ausgestattete Hütte bestehen kann.
Das macht für mich diesen Gedichtband auch nach einem halben Jahrhundert noch so sympathisch – es ist bestimmt einer seiner besten.
B. Gutleben, amazon.de, 12.8.2015
Alles ist vergänglich, also erkenne dich selbst
oder „Schatten sind meine Werke“
Ich sage: Fast alles was ich sehe,
könnte anders sein. Aber um welchen Preis?
Die Spuren des Fortschritts sind blutig.
Sind es die Spuren des Fortschritts?
Meine Wünsche sind einfach.
Einfach unerfüllbar?
Hans Magnus Enzensberger, einer der wichtigsten deutschen Intellektuellen und virtuoser und vielfältiger Verfasser beinahe jeder Art von Prosa, Lyrik und Dramatik, ist neben seiner sicherlich wichtigen Stellung als Essayist auch einer der bekanntesten deutschen Dichter der Nachkriegszeit. Seine Poesie ist in der Mitte zwischen subtilem Gedankengut und sprachlicher Ausdrucksmechanismen angesiedelt und schwankt oft zwischen Abstraktion und Klarheit.
Nach den rabiateren Bänden Verteidigung der Wölfe und dem kritisch-verdüsterten Gemisch Landessprache ist Blindenschrift fast schon so etwas wie eine erstaunliche Kehrtwende oder ein Neuanfang. 1964, also vier Jahre nach Landessprache entstanden, hat es die klecksende und gewaltige, Ehrfurcht gebietende Stimme dieser Gedichte abgelegt und sich einer, manchmal schon fast resignierten, oft labyrinthischen, Klarheit und Schlichtheit zugewandt. Die ist jedoch niemals sachlich oder nüchtern; eher schneidend, lauernd und meist komprimiert.
Was thematisch am meisten auffällt sind die Symbole und Antagonismen der Vergänglichkeit. Im Ganzen ist der Band ein bisschen wie ein langes Selbstgespräch von Enzensberger mit sich selbst, darin Augenblicke, Betrachtungen und vor allem Fragen.
Was soll da auftauchen aus der Flut,
wenn wir darin untergehen?
Noch ein paar Fortschritte
und wir werden weitersehen.
Bestechend ist mal wieder die bleibende Aktualität seiner Dichtung. Nach dem dritten Gedichtband, den ich jetzt nun von ihm lese, kann ich schon absehen, dass die besten seiner (auch seiner engagierten, kritischen) Gedichte und Zeilen, zeitlos sind. Vor allem in Blindenschrift sind sie es.
Gedichte sind wichtig für das Verständnis von Schönheit und für die Selbstreflexion. Beides können sie stärken und beides können sie auch in sich tragen. Enzensbergers Gedichte sind keine klar gestaffelten Bekenntnisse oder schlichte Ansagen; ebenso wenig sind sie unzugänglich oder kryptisch. Jedes von ihnen hat so etwas wie einen inneren Schlüssel, eine eigene innere Logik, die sehr wohl zu erreichen ist. Hat man diese innere Logik erstmal erkannt, ist es ein leichtes seine Symbole zu verstehen.
Als wäre nichts geschehen
erscheint täglich neu
unser rührender schmutziger
knallharter frommer Roman.
Fortsetzung folgt, und kein Ende.
Blindenschrift ist sicherlich kein besonders schöner und auch kein besonders beeindruckender Gedichtband. Aber er hat eine leicht kritische Stimme, eine besondere Essenz, die ihn trotzdem sehr einzigartig macht. Und gleichsam finde ich persönlich, dass er auf seine Art auch sehr stimmungsvoll und weise ist und das mancher Text sehr zum Nachdenken anregt: Über das Können, das Wollen, das Denken – wie schrieb Enzensberger:
Nimm die Binde ab
König Mensch und lies
unter der Blindenschrift
deinen eigenen Namen.
Ich kann bezeugen, dass das in manchem Text gut funktioniert.
Zuletzt noch ein paar Zeilen, die zeigen sollen, dass es sich über Gedichte nachzudenken lohnt:
Denkbar immerhin,
wenn auch nicht glaublich:
Die Katastrophe wäre da,
wenn über uns käme die Nachricht:
dass sie ausbleiben wird
für immer
Verloren wären wir:
Wir stünden am Anfang
Timo, amazon.de, 4.3.2012
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Alfred Andersch: Dort ist ein Feuer
Merkur, Heft 202, 1965
Hans Bender: Das schwierige Vergnügen an Gedichten Enzensbergers
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24.11.1964
Madeleine Gustafsson: Radikalare än sin dikt
Stockholms-Tidningen, 8.3.1965
Deutsch in: Über H.M. Enzensberger (1970), Radikaler als seine Dichtung
Michael Hamburger: Digesting poetry’s new diet
The Times Literary Supplement, 3.9.1964
Joachim Kaiser: Enzensbergers lyrische Antwort
Süddeutsche Zeitung, 7./8.11.1964
Hans Mayer: Sprechen und Verstummen der Dichter
Hans Mayer: Das Geschehen und das Schweigen, 1969
Heinrich Vormweg: Vom Ende des lyrischen Ich
Vormweg: Die Wörter und die Welt, 1968
Kurt Oppens: Blühen und Schreiben im Niemandsland
Merkur, Heft 202, Januar 1965
Elvis RROJI: Enzensbergers frühe politische Lyrik
Masterarbeit, Karl-Franzens-Universität Graz, 2010
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Tae-Ho Kang: Poesie als Kritik und Selbstkritik. Hans Magnus Enzensbergers negative Poetik, Dissertation März 2002
Hans Egon Holthusen: Chorführer der Neuen Aufklärung. Über den Lyriker Hans Magnus Enzensberger, Merkur, Heft 388, September 1980
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
EINEM KIND ERKLÄREN WAS BLINDHEIT IST
Für Hans Magnus Enzensberger
Wie viele Nächte
die nahtlos miteinander verwachsen,
wie viele Flammen
die sich vermischen bis sie
ein großes Feuer geworden sind,
wie eine bunte Tapete
die sich langsam mit Tusche bedeckt,
wie ein schmieriger Ruß unter dem
der glitzernde Schnee verschwindet,
wie hundert schwarze Fliegen
die ein weißes Stück Käse verzehren,
wie ein funkelnder Aluminium-Zug
den ein hungriger Tunnel verschluckt,
wie helle Vögel im Zoo,
Goldammern, Kolibris, Papageien
und Schnee-Eulen denen plötzlich
ein schwarzes Gefieder wächst
und sie werden zu Raben,
wie der einzige Fernseher auf der Welt
ohne Schirm, wie Sonne Mond und Sterne
die alle auf einmal in ein schwarzes Loch
am Himmel gestürzt sind…
Felix Pollak
Übersetzung Hans Magnus Enzensberger
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Archiv +
Internet Archive + KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


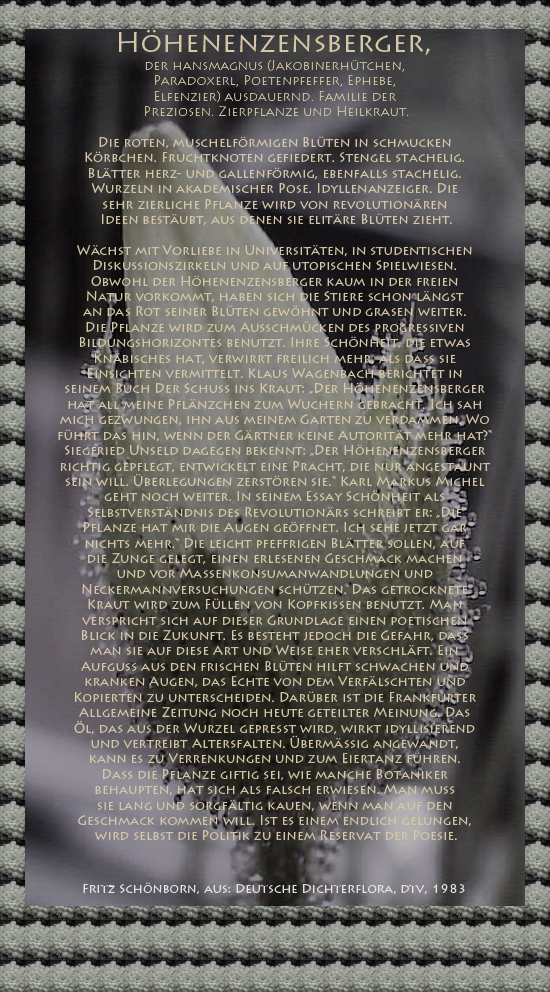
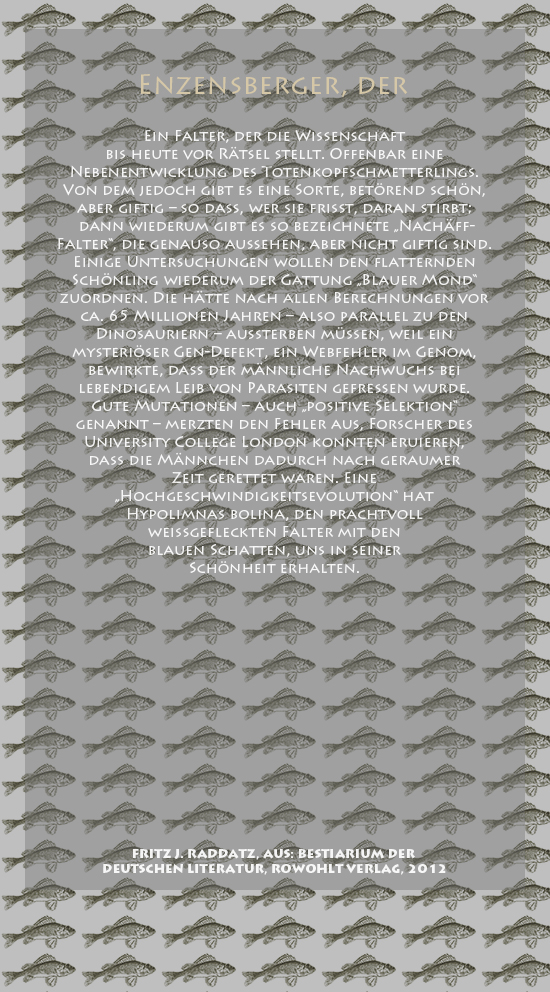












Schreibe einen Kommentar