Hans Magnus Enzensberger: Gedichte 1950 – 2010
ANGEWOHNHEITEN
Wie oft mußte Plato sich schneuzen,
der heilige Thomas von Aquin
seine Schuhe ausziehen,
Einstein sich die Zähne putzen,
Kafka das Licht ein- und ausschalten,
bevor sie zu dem kamen,
was ihnen aufgetragen war?
Ganze Wochen, aufs ganze gesehen,
bringen wir damit zu,
unsere Hemden auf- und zuzuknöpfen,
unsere Brillen zu suchen
oder das, was wir zu uns nahmen,
wieder auszuscheiden.
Wie flüchtig sind unsere Meinungen
und unsere Werke, verglichen mit dem,
was wir miteinander teilen:
Kochen, Waschen, Treppensteigen –
unscheinbare Wiederholungen,
die friedlich sind, gewöhnlich
und unentbehrlicher als jedes chef d’œuvre.
„Was da unaufhörlich tickt /
und feuert, das soll ich sein?“ Die Neugier auf die Erfahrung seiner selbst und auf die Rätsel, die „ihm der Alltag und die Philosophie und die Biologie zuspielen“ DER SPIEGEL, hat sich Hans Magnus Enzensberger seit der verteidigung der wölfe (1957), seinem ersten Gedichtband, nicht nehmen lassen. In all den Jahrzehnten seither ist sein Werk wie wenige andere zu einem poetischen Vademecum für Zeitgenossen geworden. „Wir wüßten keinen, mit dem wir uns lieber einen Reim auf diese Welt machen würden“, schrieb einmal die Neue Zürcher Zeitung – voilà: Enzensbergers persönliche Auswahl seiner Gedichte aus sechs Jahrzehnten.
In dieser Auswahl mischt Enzensberger gegenüber den gesammelten Gedichten von 2005 die Karten neu: Auf einiges darin mochte er aus der Sicht von 2010 verzichten, anderes aus der Geschichte der Wolken(2003) und vor allem aus dem zuletzt erschienenen Gedichtband Rebus (2009) hat er hinzugenommen. So schreibt sich die Auswahl seiner Gedichte fort als die Geschichte eines Zeitgenossen, der die Systeme hinter sich läßt und der unfaßlichen Monstrosität der ‚Realität‘ (s)eine Sprache gibt.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2010
Dichter der ersten Dinge
– Hans Magnus Enzensbergers Poesie und Ethik der Nähe (1991–2009). –
first things first: / Thousands have lived without
love, not one without water.
In jüngeren Studien zu Hans Magnus Enzensbergers Lyrik der letzten beiden Jahrzehnte wird die Auffassung vertreten, der Dichter wende sich mit zunehmendem Alter den „letzten Dingen“ zu. Auf den folgenden Seiten wird dieser Deutungsvorschlag anhand einer Interpretation der letzten fünf Gedichtbände Zukunftsmusik, Kiosk, Leichter als Luft, Geschichte der Wolken und Rebus zurückgewiesen. Anhand einer Rekonstruktion zentraler Gedankenstränge, die das gesamte Textkorpus wie ,Leitfäden‘ durchziehen, lässt sich nachweisen, dass sich Enzensbergers Schaffen vielmehr an einer Poesie und einer Ethik der „ersten Dinge“ orientiert.
1 Poesie der letzten Dinge
Nicht erst in der „Coda“ seines Gedichtbandes Rebus setzt sich Hans Magnus Enzensberger mit dem Problem des Utopieverlusts auseinander. Die Utopie – hier adressiert als die utopische Größe „Alles Mögliche“ – kann aus zwei Gründen nicht mehr als Orientierungsgröße dienen: zum einen, weil sie intellektuell unzugänglich ist („Alles Mögliche – niemand weiß, was das ist“), zum anderen, weil sie real unerreichbar ist (weil „Alles Mögliche unmöglich ist“). Auch wenn die Utopie deshalb nicht rundweg verschwindet („Totzukriegen ist das Mögliche nie“; „Die Wunde / des Möglichen blutet noch“), so hat sie doch ihren Orientierungscharakter wenigstens für die Sprechinstanz der Gedichte vollständig eingebüßt:
Ach, sie steht mir nicht zu, die Wut,
(…)
die mir ins Ohr sagt: Alles, was möglich wäre,
wenn… Doch ich bin nur ein Vorübergehender,
der vorübergehend beobachtet, was der Fall ist,
(…)
und der kaum etwas ausrichtet.
Die Sprechinstanz versteht sich nicht mehr als eine hochmotivierte geschichtsprägende Figur („Ja, ich habe es vermieden, / bis zur letzten Patrone zu kämpfen“), die sich womöglich an Utopien ausrichtet („davor zurückgeschreckt, / die Welt zu verbessern“); sie tritt nur noch als eine das Faktische vorübergehend und unaufgeregt beobachtende Instanz auf, als eine Übergangsfigur in einer Geschichte ohne Richtungspfeil („Keiner von uns / ist der Richtige. Mehr schlecht als recht / nehmen wir die Plätze der Toten ein / und derer, die nach uns kommen“). In „Coda“ wird der Bruch von Utopie und Post-Utopie durch die Entgegensetzung des konsequent großgeschriebenen utopischen „Möglichen“ und des konsequent kleingeschriebenen post-utopischen „möglichen“ markiert. Das „Mögliche“, das im Sinne von „Alles Mögliche“ eine geschichtsphilosophische Zielvorstellung ist, wird von dem „möglichen“ abgelöst, das sich zwar als „Winziges, Vorläufiges“ erweist, das dafür aber „menschenmöglich“ ist und sich deshalb wenigstens tatsächlich „ausrichten“ lässt.
Die Einsicht in das Ende der Utopien und die sich daraus ergebende Ausrichtung am ,Menschenmöglichen‘ ist bereits – meist mit ausdrücklichem Bezug auf Odo Marquards ähnliche Überlegungen – als Abschied von der Geschichtsphilosophie gedeutet worden. Dabei wird freilich deutlicher, wovon die Abkehr erfolgt als wohin sich das geschichtsphilosophisch enttäuschte und utopieverdrossene Subjekt wendet.
Klar wird, dass der weite geschichtsphilosophische Zeithorizont von einem engeren alltagsnahen Zeithorizont abgelöst wird, denn die Perspektive nach dem Abschied von der Geschichtsphilosophie reicht gerade mal „bis zum nächsten Tag, an dem es, / wer weiß warum, etwas zu feiern gibt“. Das „Feiern“ lässt deutlich werden, dass die Abwendung von der Utopie auch eine Abwendung von einer umfassenderen Gesellschaftskritik ist. Weder „Wut“ noch „Klage“ erweisen sich in „Coda“ als angemessene Umgangsformen mit der Gegenwart: Es wird nicht geklagt, denn „wer sich beklagt, / wehe ihm, der ist schon verloren“. Auch wenn es durchaus Gründe gibt, es „alles satt“ zu haben, bleibt doch die Bewunderung der Tatsache, dass das „Leben einfach so weiter“ geht, dass auch diejenigen „nicht aufgeben“, die ihr Leben an keiner Utopie ausrichten wollen oder können; empfohlen wird mit Emphase:
Eiserne Gutmütigkeit!
Anstelle von Gesellschaftskritik also Bewunderung und Dankbarkeit angesichts der Möglichkeit einer Welt, die zwar nicht die beste aller möglichen Welten, wohl aber „besser als gar nichts“ ist. Die Dankbarkeit für das, was ist, überwiegt in der Perspektive dieser Sprechinstanz („Neuerdings ertappe ich mich dabei / zu bewundern, (…) Immer schwerer gelingt mir / Haß, Neid und Verachtung“); für ihre Dankbarkeit vermag sie im „Nachhall der Systeme“ allerdings keinen Adressaten mehr zu finden:
EMPFÄNGER UNBEKANNT
Retour à l’expediteur
Vielen Dank für die Wolken.
Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel.
Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn
und für allerhand andre verborgne Organe,
für die Luft und natürlich für den Bordeaux.
Herzlichen Dank dafür, daß mir das Feuerzeug nicht ausgeht,
und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern.
Vielen Dank für die vier Jahreszeiten,
für die Zahl e und für das Koffein
und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller,
gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf,
für den Schlaf ganz besonders,
und, damit ich es nicht vergesse,
für den Anfang und das Ende
und die paar Minuten dazwischen
inständigen Dank,
meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch.
Der „inständige Dank“, der sich an einen unbekannten (möglicherweise aber doch nicht inexistenten) Empfänger richtet, ist laut jüngeren Überlegungen ein deutlicher Hinweis darauf, dass Enzensberger sich in seinem „Spätwerk“ einem „ernsthaften und sehnsuchtsvollen Nachdenken über die Möglichkeit von Transzendenz“ zuwende. Die jüngere Literaturkritik und Literaturwissenschaft sieht in den letzten Gedichten Enzensbergers deutliche Hinweis auf „religiöse“ Gehalte, konstatiert „ein zögerndes Geöffnetsein (…) für letzte Dinge“ und nennt den späten Enzensberger sogar „weltfromm, schöpfungsfromm“. Die Zuschreibungen einer neuen „Schöpfungsfrömmigkeit“ in den letzten Gedichtbänden Enzensbergers operieren häufig mit der Kategorie des „Alterswerks“, der „Alterslyrik“, des „Spätwerks“ oder „Spätstils“?
Für die Position, der „Spätstil“ Enzensbergers sei von einem Interesse für die letzten Dinge geprägt, lässt sich auf drei Ebenen argumentieren. Erstens auf einer thematischen Ebene: In den letzten Gedichtbänden nimmt die Anzahl der Verse zu, die mehr oder weniger direkt altersaffine Themen berühren wie Tod, Zeitmangel, Krankheiten, Gebrechlichkeiten und generell materielle Abnutzungserscheinungen; auch wird die Marginalität des Dichters („Die Auflage ist gering / das Publikum exquisit“) und die Entbehrlichkeit des dichterischen Schaffens thematisiert („Sie können sich gar nicht vorstellen, / sagte er, wie entbehrlich Sie sind“); auch wenn punktuell betont wird, dass Lyrik gelegentlich „haltbarer“ sei als bauliche Strukturen oder politische Systeme, dass auch von Dichtungen „das beste vielleicht / (…) hält“, lautet das lakonische Fazit:
Besonders schwer
wiegen Gedichte nicht.
Zweitens auf einer formalen Ebene: In der Lyrik der letzten 20 Jahre findet eine ,Selbsthistorisierung‘ des Dichters statt, womit weniger der poetische Rückblick auf das eigene Leben gemeint ist (dafür ist Frühschriften ein gutes Beispiel) als eine Historisierung des lyrischen Werks durch rückblickhafte Wiederaufnahmen und Selbstbearbeitungen. Der Dichter beginnt mit einer poetischen Inventur seines eigenen Werks: das Gedicht „Das waren Zeiten“ ist eine Reprise von „Kurze Geschichte der Bourgeoisie“, „Unausbleiblich“ in Rebus ist eine Revision von „Unausbleiblich“ in Die Geschichte der Wolken, und „Arbeitsteilung“ aus Die Geschichte der Wolken greift den Problemhaushalt von „Arbeitsteilung“ aus Leichter als Luft auf. Drittens sei auf der Ebene des textimmanenten Adressaten eine Hinwendung zu „Gott“ bemerkbar: Der „unzustellbare“ Dank, der in „Empfänger unbekannt – / Retour à l’expéditeur“ in der Apostrophierung eines unbekannten Gegenübers ausgesprochen wird, sei ebenso wie die Adressierung eines als „Verschwender“ bezeichneten Schöpfers in „Ein Vowurf“ ein Hinweis darauf, dass sich Enzensbergers „Alterswerk“ den letzten, göttlichen Dingen zuwende. In dem Eindruck, dass „Gott die Menschen niemals / in Ruhe läßt, umgekehrt auch nicht“, werde nicht nur ein unspezifischeres „metaphysisches Bedürfnis“ artikuliert, sondern drücke sich ein handfestes theistisches Interesse für Gott und die letzten Dinge aus. Der späte Enzensberger, so lässt sich dieser Deutungsvorschlag insgesamt pointieren, nähere sich in der Beschäftigung mit Tod und Vergänglichkeit, der Inventarisierung seines Lebens und Werks und der Adressierung eines Weltschöpfers einem religiösen Weltverhältnis.
Die Beobachtung, dass „Gott“ in Enzensbergers Gedichten der letzten 20 Jahre eine wichtige Rolle spielt, ist für sich genommen treffend. Die Deutung dieser Beobachtung als eine Annäherung an religiöse, möglicherweise sogar im Sinne der christlichen Konfessionen reformulierbare Denkweisen muss allerdings zurückgewiesen werden. Trotz der hohen Dichte an Verweisen auf religiöse oder religionsnahe Gehalte – was in Rebus schon an Gedichttiteln wie „Die Zerknirschung“ ablesbar ist – richtet sich der Blick des von „Wut und Verzweiflung“ geplagten enzensbergerschen Sprechers dort, wo er „gen Himmel“ schaut, bezeichnenderweise nicht auf das Ewige, sondern auf das Weltliche und Flüchtigste, nämlich auf die Wolken.
Gott übernimmt in der neueren Lyrik Enzensbergers keine religiöse, sondern eine spezifisch epistemisch-poetische Funktion, die sich als Totalisierungsfunktion charakterisieren lässt: Die imaginierte Perspektive Gottes erlaubt, die Totalität der Welt für den poetischen Blick, für die dichterische Beschreibung verfügbar zu halten. Während der erste Gedichtband der 1990er Jahre (Zukunftsmusik) mit dem „Weltgeist“ nochmals die bereits stark geschwächte Geschichtsphilosophie als Totalisierungsoption aufruft („Was hast du dir, Weltgeist, / dabei gedacht?“), wird das Ganze später aus der Perspektive Gottes wahrgenommen. Gott dient dabei gerade nicht als tröstliches Versprechen der Transzendenz, sondern als perspektivisches Instrument, um die Grenzen der humanen Immanenz beobachten und beschreiben zu können:
Je größer die Perspektive,
desto kleiner wird alles.
Aus der Totalansicht, die Enzensberger gelegentlich „Gott“ nennt, lässt sich etwa beobachten, dass „Gott“ den Menschen als Gattungswesen aufgrund seiner (kosmologisch gesehen) kurzen Existenz möglicherweise sogar „verschlafen“ haben wird. „Gott“ ist für Enzensberger ein Konzept, das erlaubt, wenn schon nicht die Nichtigkeit der Welt insgesamt („Gebenedeit / sei die Nichtigkeit“), so doch wenigstens die Vergänglichkeit und Entbehrlichkeit des in ihr lebenden Menschen, die Begrenztheit seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten dichterisch zu erfassen.
Aus der kosmologischen Totalansicht, die man „Gott“ nennen kann, aber nicht muss, stelle sich der Mensch als „Wichtigtuer“ heraus, der nicht zur Kenntnis nehme, dass er allenfalls „Mittelmaß“ sei. Die Gedichte rufen aber nicht immer notwendig diese Totalansicht auf, wenn in ihnen unterstrichen wird, „daß der Mensch / das Mittelmaß aller Dinge ist“. Auch in kleinerem Maßstab, etwa aus erdhistorischer oder evolutionshistorischer Perspektive erweist sich, dass das „Säugetier“ beziehungsweise „höhere Wirbeltier“ Mensch insofern „Mittelmaß“ ist, als es weder die (höhere) Vergänglichkeit der Wolken erreicht noch die (niedrigere) Vergänglichkeit der Pflanzengattungen zu erlangen vermag. Die Vergänglichkeit des Menschen und die Entbehrlichkeit des von ihm Geschaffenen („Das meiste, / fast alles, wäre auch ohne uns da“) lassen sich in dramatisierender Absicht in einen großen theologisch-kosmologischen Rahmen einspannen; sie erweisen sich aber schon innerweltlich, wenn entlang der Opposition von Natur einerseits und Technik (bzw. Kunst) und Geschichte andererseits die Überlegenheit der Natur gegenüber dem von Menschen Gemachten und Erdachten am Beispiel von Löwenzahn, Radieschen und Knabenkraut, Schachtelhalm, Rosskastanie und Flieder dargestellt wird.
„Gott“ verweist in Enzensbergers Lyrik der letzten beiden Jahrzehnte nicht auf eine Annäherung an ein religiöses Weltverständnis, sondern erweist sich als einer von mehreren verfügbaren epistemisch-poetischen Standpunkten, die einer anthropologischen Totalisierung dienen sollen: Nach dem Abschied von der Geschichtsphilosophie führt Enzensbergers Weg nicht zu einer poetischen Theologie der letzten Dinge, sondern zu einer lyrischen Anthropologie der ersten Dinge.
2 Poesie der ersten Dinge
Die Dankbarkeit für die ,ersten‘ Dinge wie „Winterstiefel“, die in Enzensbergers Gedichten der letzten 20 Jahre immer wieder evoziert wird, ist nicht im Horizont eines Nachdenkens über Transzendenz und eines Geöffnetseins für letzte Dinge zu interpretieren. Hinweise für eine alternative Deutung finden sich bereits in Beiträgen, die diese Dankbarkeit für „unerhörte Privilegien“ wie die, „daß mein Zimmer geheizt ist, / daß ich Wasser habe, viel Wasser, / klares, sauberes Wasser, kalt oder warm“ als eine „regelrechte Vollkommenheitslehre des Geringfügigen“ oder als „Poetik des Alltags“ beschrieben haben.
Die Dankbarkeit für die nur scheinbar geringfügigen ,ersten‘ Dinge weist unterschiedliche Aspekte auf. Zunächst scheinen die ,ersten‘ Dinge durch den Vorzug ihres ebenso alltäglichen wie evidenten Gebrauchtwerdens ausgezeichnet. Gebrauchsgegenstände wie der „Schneepflug“ oder „Essig und Öl, Pfeffer und Salz“ werden hier ebenso hervorgehoben wie bestimmte Berufsgruppen, die diese Gebrauchsgegenstände herstellen beziehungsweise zur Verfügung stellen wie der Bäcker, der Glaser, der „Gefängnisdirektor“, der „Mann mit der Isolierzange“, die „Wahrsagerin“, der „Müllkutscher“ oder der „Medizinmann“.
Der unmittelbare Nutzen, die Unentbehrlichkeit der ,ersten‘ Dinge wird in den Gedichten Enzensbergers auch durch ihre Absetzung von allem Entbehrlichen – vor allem der Entbehrlichkeit der „Letzten Dinge“ („zu allem Überfluß noch / die Letzten Dinge“) – herausgestellt. Besonders deutlich wird diese Entgegensetzung in einem Gedicht, das bereits im Titel auf den „Vorrang der ersten Dinge“ verweist:
FIRST THINGS FIRST
Grundsätzlich haben wir nicht viel einzuwenden
gegen Fegefeuer, Reinkarnation, Paradies.
Wenn es sein muß, bitte!
Vorläufig allerdings
haben wir andere Prioritäten.
Um das Katzenklo, den Kontostand
und die unhaltbaren Zustände auf der Welt
müssen wir uns unbedingt kümmern,
ganz abgesehen vom Internet
und von den Wasserstandsmeldungen.
Manchmal wissen wir nicht mehr,
wo uns der Kopf steht
vor lauter Problemen.
Immerzu stirbt jemand,
dauernd wird jemand geboren.
Da kommt man gar nicht richtig dazu,
sich Gedanken zu machen
über die eigene Unsterblichkeit.
Erst einmal ein rascher Blick
in den Terminkalender,
dann sehen wir weiter.
Die Entgegensetzung von ersten Dingen („Katzenklo, (…) Kontostand (…) die unhaltbaren Zustände auf der Welt“) und letzten Dingen („Fegefeuer, Reinkarnation, Paradies“) ist ein wichtiges Strukturmerkmal der letzten Gedichtbände Enzensbergers; ein Strukturmerkmal, das darüber hinaus mit einer Bewertung des Verhältnisses von ersten und letzten Dingen zugunsten der ersten Dinge einhergeht – auch wenn das Stilmittel der inkongruenten, häufig auch asyndetischen Reihung, das Enzensberger hier („Katzenklo“, „Kontostand“, „unhaltbare Zustände auf der Welt“) und an vielen anderen Stellen (z.B. „Schmerz, Schnee, Lust, / Kartoffelsalat und Tod“) verwendet, eine eindeutige Bewertung dieser Entgegensetzung erschweren soll.
Der Vorrang der ersten Dinge ist in Enzensbergers Gedichten nicht nur etwas, das sich in der Alltagswelt beobachten lässt, sondern auch etwas, das Rückschlüsse auf eine den ,ersten‘ Dingen eigene Würde zu ziehen erlaubt. Gedichte wie „Angewohnheiten“ betonen, dass sich ,erste‘ Dinge wie das „Kochen, Waschen, Treppensteigen“ als „unentbehrlicher als jedes chef d’œuvre“ erweisen:
ANGEWOHNHEITEN
Wie oft mußte Plato sich schneuzen,
der heilige Thomas von Aquin
seine Schuhe ausziehen,
Einstein sich die Zähne putzen,
Kafka das Licht ein- und ausschalten,
bevor sie zu dem kamen,
was ihnen aufgetragen war?
Ganze Wochen, aufs ganze gesehen,
bringen wir damit zu,
unsere Hemden auf- und zuzuknöpfen,
unsere Brillen zu suchen
oder das, was wir zu uns nahmen,
wieder auszuscheiden.
Wie flüchtig sind unsere Meinungen
und unsere Werke, verglichen mit dem,
was wir miteinander teilen:
Kochen, Waschen, Treppensteigen –
unscheinbare Wiederholungen,
die friedlich sind, gewöhnlich
und unentbehrlicher als jedes chef d’œuvre.
Schlussendlich hat also nicht das lyrische „chef d’œuvre“ in unserem Leben Gewicht, sondern die ,ersten‘ Dinge des Alltags. Was am Ende bleibt, sind „ein paar alte Rechnungen und eine Zahnbürste“. Dieser augenzwinkernde Blick, der die Werke eminenter Geistesgrößen gegen die unscheinbaren, darum aber nicht weniger unentbehrlichen ,ersten‘ Dinge des Alltags ausspielt, die alle Menschen mit diesen Größen teilen, richtet sich auch auf Dichter wie Homer, Horaz, Rilke und Mallarmé, die einen Lobgesang auf die Kartoffel vermissen lassen:
EIN ERDFARBENES LIEDCHEN
Noch ein Gedicht über den Tod usf. –
gewiß, aber wie wäre es mit der Kartoffel?
Begreiflicherweise kommt sie nicht vor
bei Homer oder Horaz, die Kartoffel.
Doch was ist mit Rilke und Mallarmé?
War sie ihnen zu stumm, die Kartoffel?
Reimt sich zuwenig auf sie,
erdfarben wie sie ist, die Kartoffel?
Mit dem Himmel hat sie wenig im Sinn.
Geduldig wartet sie, die Kartoffel,
bis wir sie ans Licht zerren
und ins Feuer werfen. Der Kartoffel
macht es nichts aus, aber vielleicht
ist sie den Dichtern zu heiß, die Kartoffel?
Ja, dann warten wir eben noch ein Weilchen,
bis wir sie essen, die Kartoffel,
ein Weilchen besingen und wieder vergessen.
Das dieses Lob der Kartoffel, verfaßt in der (parodierten) Form eines Ghasels, ,ironisch‘ gebrochen ist, ändert nichts daran, dass Enzensberger sich hier darum bemüht, die üblicherweise nicht als Gegenstände der Dichtung vorgesehenen ,ersten‘ Dinge, wie profan sie auch sein mögen („Mit dem Himmel hat sie wenig im Sinn“), in ihrem spezifischen Gewicht literarisch zu würdigen, Am deutlichsten formuliert er dieses Anliegen dort, wo die ,ersten‘ Dinge – verknüpft mit einem wiederholten „obwohl“ – fast als Einwand gegen die gemeinhin für viel wichtiger gehaltenen Dinge weltpolitischer Dimension in Stellung gebracht werden:
UNPOLITISCHE VORLIEBEN
Dieses kleine Lächeln der Cellistin
nach der Kadenz im zweiten Satz,
obwohl soeben der Sicherheitsrat
zusammengetreten ist;
der tiefe Ernst, mit dem sich die Frau dort
in den Trümmern ihrer Wohnküche schminkt,
obwohl im Regierungsviertel
noch immer geschossen wird;
der Ehekrach dieser Achtzigjährigen,
wegen der Katzenhaare im Bett,
obwohl die Friedensverhandlungen
die entscheidende Phase erreicht haben;
das heulende Elend wegen der Jubiläumstasse,
die das Dienstmädchen zerschmettert hat,
obwohl der Währungsfonds im selben Moment
den Beistandskredit verweigert;
und hinter der Scheune das Liebespaar,
vor Eifer besinnungs- und atemlos,
obwohl
Die prinzipielle Unvermittelbarkeit der kleinen und der großen Dinge, die unüberwindbare Unübersetzbarkeit des alltäglichen und des weltpolitischen Geschehens (die tägliche Toilette und die weltpolitischen Ereignisse lassen sich nicht gegeneinander ,aufrechnen‘), sind hier nicht als ein Einwand gegen die kleinen, nahen, alltäglichen Dinge zu verstehen, denen gerade durch die fünfte Strophe ein Eigenrecht zugeschrieben wird.
Die dichterische Darstellung der Inkommensurabilität des nahen Kleinen und und des fernen Großen erreicht im lyrischen Werk Enzensbergers dort einen bemerkenswerten Höhepunkt, wo er mit „Auguren“ ein regelrechtes Gegengedicht zu dem im vorangehenden Gedichtband veröffentlichten „Astrale Wissenschaft“ schreibt. In „Astrale Wissenschaft“, dem zuerst publizierten Gedicht, war es ganz im Sinne einer Dichtung der ,ersten‘ Dinge noch der „Kartoffelsalat“ der „hiesigen Welt“, der „die mathematischen Märchen, / die Gleichungen“ des entrückten Naturwissenschaftlers „verdunsten“ ließ:
ASTRALE WISSENSCHAFT
Seine Welt aus fast nichts und nichts,
aus spukhaften Superstrings
im zehndimensionalen Raum,
Strangeness, Colour, Spin und Charm –
doch wenn er Zahnweh hat,
der Kosmologe;
wenn er in St. Moritz
über die Piste stiebt;
Kartoffelsalat ißt
oder einer Dame beiwohnt,
die nicht an Bosonen glaubt;
wenn er stirbt,
verdunsten die mathematischen Märchen,
die Gleichungen schmelzen,
und er kehrt aus seinem Jenseits zurück
in die hiesige Welt
aus Schmerz, Schnee, Lust,
Kartoffelsalat und Tod.
Im einige Jahre später veröffentlichten Gegengedicht „Auguren“ sind dann die Naturwissenschaftler dafür verantwortlich, dass die ,hiesige Welt‘ des Vertrauten uns „vor den Augen verdunstet“ („Ganz ohne Hokuspokus / tasten sie sich im Dunklen voran, / unsere Lichtbringer (…) bis uns, worauf wir vertraut haben, / Liebschaft, Bewußtsein, Materie / sowie der gestirnte Himmel, / gleichsam vor den Augen verdunstet“). Die Sinnlichkeit der alltäglich erfahrenen Umwelt („hiesige Welt“) und die Unsinnlichkeit der mathematisch erfassten Natur („Jenseits“) lassen sich nicht ineinander übersetzen: Das Faktum der Inkommensurabilität von Alltagserfahrung und naturwissenschaftlicher Erfahrung rückt eine Vermittlung der beiden Sphären aus dem Bereich des Möglichen; auch hier bewegt dieses Faktum die Sprechinstanz dazu, „Partei“ zu ergreifen und das Eigenrecht der „hiesigen Welt“ mit „Schmerz“ und „Lust“ zu betonen. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn ein Gedicht ausführt, dass die menschliche Haut Temperaturunterschiede zu spüren vermöge, die kein Thermometer erfassen können:
TEMPERATUREN
Temperaturen gibt es, die kein Thermometer mißt,
nur die Haut kann sie unterscheiden:
Den lauen Babydunst, der nach Buttermilch riecht,
den kühlen Hauch der Pfirsiche aus dem Kühlschrank,
den rötlichen Ausschlag der Wut, die uns die Masern in das Gesicht treibt,
und die kalte Eisblume, die dem Kind auf der neugierigen Zunge brennt;
ferner die fiebrige Glut der Eifersucht in den Fingerspitzen,
die hitzige Scham, die das Gehirn überschwemmt,
und was nie und nirgends sonst vorkommt in unserer Galaxie:
die beiden Wärmen der im Bett aneinander sich schmiegenden Schläfer.
Es überrascht genau bedacht nicht, dass ein Thermometer Temperaturen nur messen, nicht aber die von ihm gemessenen Temperaturen auch fühlen kann. Die von Enzensberger auch an anderer Stelle aufgenommene Problematik, dass sich das subjektive phänomenale Bewusstsein nicht ohne Weiteres in die naturwissenschaftlichen Beschreibungsmodelle der Welt (und des Menschen) übersetzen lässt (und umgekehrt), ist auch an dieser Stelle mit einem bestimmten Wertungsindex versehen. „Temperaturen“ schlägt sich auf die Seite der ersten Dinge, wenn es die Empfindung des „kühlen Hauchs der Pfirsiche aus dem Kühlschrank“ oder der „Eisblume, die (…) auf der (…) Zunge brennt“ aufführt, um die Grenzen des physikalischen Messgeräts aufzuweisen.
Die überzogenen Ansprüche auf Würde seitens der „Letzten Dinge“ werden hier nicht nur in ihrer wissenschaftlichen, sondern gerade auch in ihrer religiösen Dimension („Fegefeuer, Reinkarnation, Paradies“) nachdrücklich infrage gestellt. Die These einer späten Zuwendung zum Religiösen verträgt sich nicht mit Enzensbergers „Profanen Offenbarungen“, die den Kühlschrank (als Metonymie für die Befriedigung fundamentaler ,erster‘ Bedürfnisse) gegen den Altar (als Metonymie des christlichen Glaubens) ausspielen:
Altar oder Kühlschrank:
vor die Wahl gestellt,
so mancher frommer Glaube,
glaubt mir, geriete ins Wanken.
Mit den ,letzten‘ Dingen, mit „dem Unendlichen ist nicht gut Kirschen essen“, überhaupt ist alles, was Ansprüche darauf macht, „ewig“ zu sein, suspekt:
Ja,
sogar die Verdammnis, die ewig ist,
sowie das ewige Leben, beide wären sie
nur zu genießen mit äußerster Vorsicht.
Allerhand nämlich hat es für sich,
daß das, was vorbei ist, vorbei ist.
Die Gedichte grenzen das Unbeschränkte und Ewige gegen das Endliche, Sichtbare und Greifbare, unmittelbar Ess- und Genießbare ab; gewürdigt wird dann neben der Kartoffel oder dem Pfirsich auch die Kirsche:
(…) von der Natur (…) gilt
immer erst in der Beschränkung zeigt
die Meisterin sich, in diesen Kirschen
zum Beispiel, dort auf dem Teller,
endlich vielfarbig, wie sie sind
lack-, scharlach-, türkisch-,
granat-,
mohn-, wein- und blutrot:
Morgen schon ist es auch mit ihnen,
aus und vorbei.
Du mußt sie essen
jetzt oder nie.
Die Evokation der ,ersten‘ Dinge wie „Kastanie“, „Sommerregen“ oder „Elster“ verweist allein auf die Immanenz, denn es handelt sich bei ihnen um „Vergünstigungen, / welche die Erde zu bieten hat“. Enzensberger verfolgt, wie das Beispiel der vielfarbigen Kirschen zeigt, keinen Mystizismus der ,ersten‘ Dinge; die ,ersten‘ Dinge verweisen nicht auf eine übergreifende Schöpfungsordnung, die von einem „Gott“ verantwortet wird. Die ,ersten‘ Dinge sind einfach nur das, als was sie uns entgegentreten: Als Evidentes und Offensichtliches bergen sie kein großes Geheimnis, das nur der tieferen Einsicht des außerordentlichen Dichters zugänglich wäre; der Dichter, den seine Aufmerksamkeit, seine Wachheit auszeichnet, zeigt im Modus poetischer Rede vielmehr nur das, was im Alltag häufig übersehen wird, obwohl oder vielleicht gerade weil es das uns Nächste ist.
3 Ethik der ersten Dinge
Enzensberger entwickelt nicht nur eine Poesie, sondern auch eine Ethik der ersten Dinge – was nur aus der Perspektive einer Literaturkritik und Literaturwissenschaft überraschen kann, die in Enzensberger vor allem den gewieften Ironiker, kosmopolitischen Skeptiker und unberechenbaren Intellektuellen sehen wollen, der auch in seiner Lyrik immer nur in ,Rollen‘ spricht. Tatsächlich enthält auch das dichterische Werk „viele allgemein formulierte Texte“ mit ethisch-politischer Pointe, wie sich an generellen lyrischen Reflexionen über die „Reichen“ und „Armen“, die „Besiegten“ und „Sieger“, die „Gewinner“ und „Verlierer“ ebenso nachweisen lässt wie an den umfassenden Deutungsansprüchen, die mit der häufigen Verwendung des Ausdrucks „alles“ einhergehen – etwa wenn versichert wird, dass letztlich „alles beim alten“ bleibe („bei alle dem / bleibt alles beim alten“) oder letztlich „alles ganz eitel“ sei.
Nach der Abkehr von einem geschichtsphilosophisch verankerten Normrepertoire stellt sich die Frage, welche Instanz ein derartiges Normgefüge noch abzusichern vermag. Enzensbergers in der Diskussion seit 1990 keineswegs singuläre Position ist eine ,negative‘, die sich an der Evidenz des Unerwünschten ausrichtet. Auch wenn ein ,positiver‘ Orientierungsrahmen nicht mehr zu gewinnen ist, läßt sich laut dieser Position wenigstens angeben, was unter allen Umständen vermieden werden muß: das „Böse“ in der Erscheinung extremer Gewalt. ,Negative‘, mehr oder weniger anthropologisch fundierte Minimalethiken, die auf philosophische und kulturanalytische Theorien des Bösen zurückgreifen, richten das individuelle oder kollektive Handeln nicht mehr an einem geschichtsphilosophisch vorgegebenen ,positiven‘ Ziel aus, sondern an der Vermeidung von extremer Gewalt. Enzensbergers Lyrik der letzten 20 Jahre kreist ganz in diesem Sinne immer wieder um das „Massaker“ und seine Vermeidung.
Diese intensive Auseinandersetzung mit extremer Gewalt fällt schon in den Gedichtbänden Kiosk und Leichter als Luft auf, die mit umfassenden Reflexionen über Gewalt und Krieg einsetzen. Die Thematisierung extremer Gewalt und des „Massakers“ kehrt auch in den Folgebänden mit unterschiedlichen Akzentuierungen wieder. Einerseits findet sich die Kritik extremer Gewalt verknüpft mit einer Kritik neuerer Medien, wenn das „Massaker im Kino“ ebenso kritisiert wird wie die „ewigen Werbespots für Mord und Totschlag“ in einem Fernsehprogramm, das „immer wieder / dasselbe Massaker“ zeige. Andererseits wird das „Massaker“ von bestimmbaren historischen (auch medienhistorischen) Rahmenbedingungen abgekoppelt und als anthropologische Grundkonstante fixiert. Die Motive dafür, anderen Gewalt anzutun, scheinen zu zahlreich, um das „Massaker“ analysieren zu können; skizzenhafte Erklärungsversuche für das Fortwähren des „Massakers“ verweisen auf den „Eifer, andern und sich / ein Ende zu machen“, auf „fixe Ideen“ wie „der Neue Mensch, / die Lust am Massaker, / um Gottes willen, / das Vaterland oder die Apokalypse“, und, noch grundsätzlicher, auf die fatalen Auswirkungen von Gruppenbildung entlang der Unterscheidungen von erster und dritter Person Plural:
immer gibt’s da die einen
und immer die andern, und immerzu
führt das zu Mord und Totschlag
Auch wenn die Motivlagen sich ändern mögen (revolutionäre, nationalistische oder religiöse Motive), „Mord Gift Krieg“ beziehungsweise „Hunger Mord Totschlag etcetera“ sind Grundkonstanten menschlichen Lebens. Deshalb wundert es die lyrische Sprechinstanz auch, dass in der Gegenwart „niemand massakriert“ wird:
Du gehst aus dem Haus, und nur
in den seltensten Fällen spaltet dir eine Axt den Schädel, nur gelegentlich
werden Stiefel geleckt,
gegen alle Wahrscheinlichkeit läufst du frei herum, und all
diese Wunder wundern dich nicht.
Der überraschende, geradezu ,unwahrscheinliche‘ Sachverhalt, nicht mit extremer Gewalt konfrontiert zu sein, sorgt für Staunen und motiviert ein „Optimistisches Liedchen“
Vormittags wimmelt es auf den Straßen
von Personen, die ohne gezücktes Messer
hin- und herlaufen, seelenruhig,
auf der Suche nach Milch und Radieschen.
Diese staunenswerten gewaltfreien Momente sind allerdings allenfalls vorübergehende „blaue Stunden“ („die blaue Stunde, vorübergehend, / bevor der nächste Versager beginnt, / in die Menge zu feuern“); irgendwo finden immer die nächsten „Vorbereitungen zum Massaker“ statt. Nur soviel ist sicher: Im Hinblick auf extreme Gewalt ist „kein Ende in Sicht“; irgendwo ist immer Krieg. Sucht man einen Ort außerhalb dieser Gewaltgeschichte, als die sich die Menschheitsgeschichte für Enzensberger darstellt, muss man sich der Natur zuwenden. Nur die „Geschichte“ der Naturdinge – so heißt es am Beispiel der Wolken – sei „unblutig (…). / Historiker, Henker und Ärzte / brauchen sie nicht, kommen aus lohne Häuptlinge, ohne Schlachten.“
In der Lyrik Enzensbergers verweist das „Massaker“ als anthropologische Kategorie nicht auf konkrete historische Konstellationen, sondern auf eine konstante Realität menschlichen Lebens. Der Abschied von geschichtsphilosophischen (und daraus abgeleiteten gesellschaftskritischen) Orientierungsmustern führt zu einer ,anthropologischen‘ Perspektive, die aus großer Distanz in den unterschiedlichsten historischen Ausprägungen von Gewalt nur ein einziges, von kurzen Pausen unterbrochenes „Massaker“ zu erkennen vermag. Daraus ergibt sich eine Minimalethik, die (als Negation des evident Negativen) einer Vermeidung des Übels extremer Gewalt gilt – und dies durchaus auch mit Verweis auf die deutsche Geschichte („Daß alles viel schlimmer war, / früher, wenigstens hier“). Wenn nur zeitweise sichergestellt werden kann, dass das größte Übel nicht eintritt und für eine „blaue Stunde“ kein „Massaker“ stattfindet, ist, so scheint es, schon sehr viel geleistet.
Aber: Es handelt sich bei der Vermeidung des „Massakers“ nicht um etwas, das sich in engerem Sinne von jemanden ,leisten‘ ließe. Der Umgang mit der Möglichkeit des „Massakers“ beschränkt sich bei Enzensberger auf das „Davonkommen“ und auf das schiere Glückhaben:
Ausgerichtet habe ich nichts. Keinen Diktator umgebracht,
kein Massaker verhindert.
Glück gehabt, im großen und ganzen.
Niemand von euch hat mich geteert,
mir sein Messer in die Leber gerammt.
Auch angesichts eines immer drohenden „Massakers“ geht es Enzensberger nicht mehr um die Formulierung einer anspruchsvollen Gesellschaftskritik („sogar deine Feinde / sind dir abhanden gekommen“), sondern um die Beschreibung des „Wunders“ des „Davonkommens“, gerade auch „gegen alle Wahrscheinlichkeit“, um die Bewunderung also der wenigen Momente eines in seiner gelebten Alltäglichkeit „eklatanten Friedens“.
Die in Enzensbergers Lyrik der letzten beiden Jahrzehnte bewunderten, gelegentlich sogar gefeierten ,ersten‘ Dinge stützen damit eine Minimalethik, die sich an der Devise „First things first“ ausrichtet. Diese Minimalethik der ,ersten‘ Dinge zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstens mit Evidenzen operiert und zweitens vom Einzelnen wenig mehr als den Rückzug verlangt. Ebenso, wie jeder an die Güte der ,ersten‘ Dinge wie Wasser oder Brot glaubt, und zwar „genau so fest / wie an den Backenzahn, / der ihm weh tut, und daran, / daß heute Donnerstag ist“, soll auch die Notwendigkeit der Vermeidung des „Massakers“ für jeden evident wie „Zahnweh“ sein. Um ein ethisches „Minimialprogramm“ handelt es sich hier also auch hinsichtlich des Begründungsaufwands, auf den eine solche Position sich aufgrund ihrer hohen Evidenz beschränken zu können glaubt.
Der Vorrang der ,ersten‘ Dinge sowohl in poetischer als auch in ethischer Perspektive und der lebensweltliche Rückzug auf die ,ersten‘ und nahen Dinge treffen sich dabei nicht in dem voltaireschen Aufruf zur Kultivierung des eigenen Gartens. Enzensbergers lyrische Sprechinstanzen bedienen sich hier einer noch passiveren Tonlage, wenn sie versichern: „Noch am ehesten auszuhalten / war es unter dem Birnbaum / zu Hause“; dies nicht zuletzt, weil „es anderswo / noch viel ungemütlicher ist“, weil das Nahe und „das Übliche (…) eine Art Trost“ sind. Wenn Enzensberger Odo Marquard mit der Devise zitiert, es komme nicht darauf an, die Welt zu verändern, sondern sie zu verschonen, wird damit wie bereits bei Marquard nicht nur jeder Bedarf einer umfassenderen gesellschaftsverändernden Intervention zurückgewiesen, sondern dem Rückzug auch eine ethische Dimension zugewiesen. Der Rückzug unter „den Birnbaum“, die Gesten des Unterlassens und Schonens werden als ethische Positionen aufgebaut; die Rückzugsgesten sind deshalb nicht nur „apathische Anfälle“, sondern verweisen auf eine „Kunst“ des „Rückzugs“, des „Desertierens“, des „Sich-Entziehens“, gar auf eine „Wissenschaft der Unterlassung“. Diese Ethik des Verschonens, Versäumens und der Verminderung läuft darauf hinaus, dass Unterlassen allemal besser sei als Tun („Nirgends aufzutauchen, / das Meiste zu unterlassen“) eine Position, die hinsichtlich des „Massakers“ als evident „Böses“ zu überzeugen vermag (jedenfalls solange dies bedeutet, die Mitwirkung an einem „Massaker“ zu unterlassen), sonst aber kaum mehr als ein schwaches Postulat sein dürfte.
Enzensbergers Darstellung des mühelosen „Sich-Entziehens“ findet in den letzten Lyrikbänden seine gestalterischen Höhepunkte, wo er Leichtigkeit und Schweben versprachlicht und die Choreographie des fallenden Schnees und der ziehenden Wolken dichterisch erfasst; auch dort, wo er das „mühelose“ Gleiten auf dem Fluss beschreibt:
FAHRWASSER
aaaaa– – – dazwischen,
nicht mehr so ganz zugehörig.
Viel Betrieb links und rechts –
aaaaaAlle Achtung!
Aber dieser da paddelt weiter,
aaaaadazwischen,
vorbei an Bemühungen
um Renditen und Kopfpauschalen,
sonderbar mühelos
langsam stromabwärts.
Alles, was wichtig ist,
zieht am Ufer vorbei –
Oberlandesgerichte, Tankstellen,
Mehrzweckhallen.
Dieser da paddelt weiter, –
aaaaaist hosianna –,
da, wo nichts los ist,
dazwischen.
Beeindruckend, wie die Sprechinstanz „sonderbar mühelos“, „vorbei an Bemühungen“ auf dem Wasser gleitet und sich reibungslos „stromabwärts“ treiben lässt. Die Gelassenheit, mit der sie „paddelt“, die Leichtigkeit, mit der „Alles, was wichtig ist“ an ihr vorbeizieht, evoziert das Schweben eines Moments „dazwischen, / nicht mehr so ganz zugehörig“. Gerade weil Enzensberger das „Weiterschwimmen“ nicht immer so leicht fiel wie hier, kann man das mühelose Treiben stromabwärts durchaus als späte „stoische Gelassenheit“ beschreiben.
Diese „mit heiterer Stirn“ formulierten Verse ließen sich mit rückhaltlosem Gefallen lesen, wenn sie nicht den Eindruck erweckten, dass sie in ihrem Rückzug von „Ufer“ und „Betrieb“ die „Oberlandesgerichte, Tankstellen, / Mehrzweckhallen“ bestenfalls umrisshaft wahrzunehmen vermögen. Die stringent entwickelte und künstlerisch überzeugend umgesetzte Poesie der ersten Dinge kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Ethik der ersten Dinge, die nur noch im Nahen Verläßliches zu finden vermag und sich im Rückzug auf die ersten und evidenten Dinge einen direkten und unproblematischen Zugang zur Welt offenzuhalten versucht, eine anti-politische Stoßrichtung aufweist („Ich meine das nicht politisch“), die jedes Interesse an „Bemühungen“ außerhalb des ethischen Nahbereichs verloren hat.
Carlos Spoerhase, aus: Text+Kritik. Hans Magnus Enzensberger Heft 49, edition text+kritik, November 2010
Hugo Loetscher: hans magnus enzensberger
DU, Heft 3, 1961
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
ENZENSBERGER LYRIK
MUSTER-ROTKÄPPCHEN
Pfeifen Husten Tapsen Gammeln Stampfen Schnalzen
Drücken Röcheln Klopfen Klöppeln Stupsen Stöckeln
Rümpfen Knicken Bündeln Hetzen Kriechen Hocken
Blödeln Japsen Kreischen Blubbern Grabschen
Wimmern Heulen Boxen Suchen Finden
Hasten Haschen Häschen huschen
(1955/1957/1960/1961/1967/1968/1973/1980/1983-1.Halbjahr/1983-2. Halbjahr/1984/1986/1988/1989-2. Halbjahr(!!)/1990/1994/1996/1997)
Peter Wawerzinek
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Archiv +
Internet Archive + KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


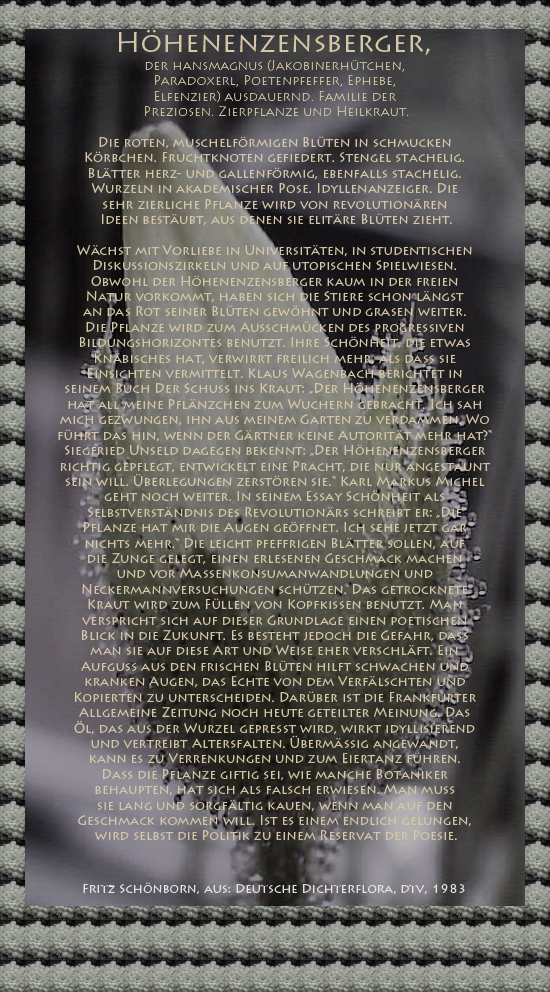
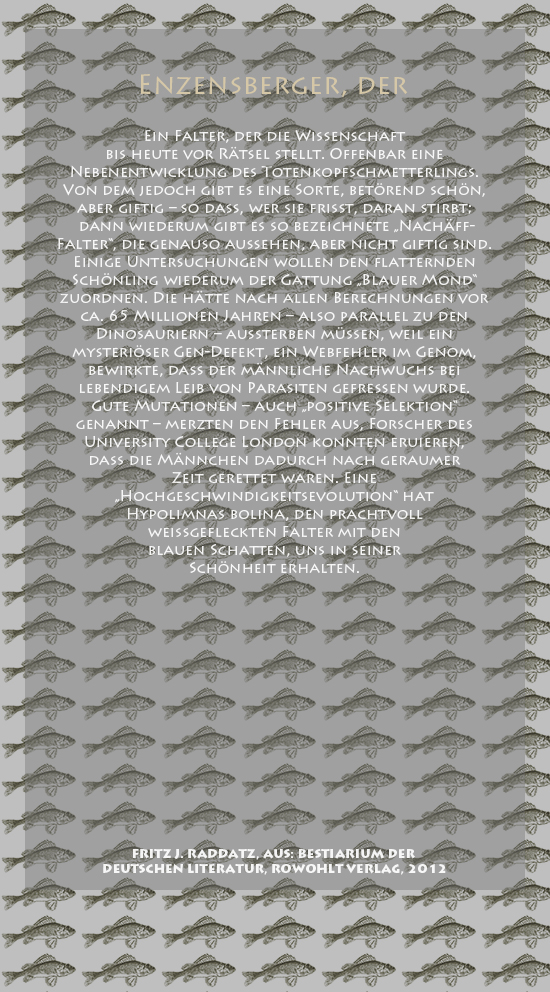












frage: ich will in der außenpolitik – zeitschrift INTERNATIONAL das gedicht “unpolitische vorlieben” abdrucken – wer ist “zuständig”? welche quellenangabe?
dann sollten sie sich an den suhrkamp verlag wenden.