Hans Magnus Enzensberger: Landessprache
ANWESENHEIT
hier verharre ich wie eine auster,
hier wo ich bin. hier war ich einst,
einst werd ich hier sein, an einem tag
ohne geiz, an einem tag auf der erde.
die abdecker kommen und gehn,
die erbsen verfallen dem herbst,
die eilboten fiebern. ich,
ich gehe nicht fort, ich bleibe,
mildherzig unter den wurzeln,
wie eine auster im meer, und harre,
und lausche in meinen bronchen
dem süßen wind, wie ein strauch.
hier bin ich, ein schiff aus rauch,
hinter dem mond zuhaus, ein mann
unter den wurzeln des meers, bewohnt,
wie ein totenacker, ein totenstrauch,
von nattern und tauben, zuhaus
im blühenden sternsarg, allein
im feuer der windrosen wohnend
bei meinen lidern, den tauben im wind.
ich bin ein einstiger mann.
einst ist mir niemand erschienen,
einst wird er wiederkommen. ich harre
und warte nicht, sondern harre nur:
niemand wie eine monstranz,
niemand, ein schiff aus wind,
niemand unter den wurzeln, hier,
an einem tag ohne geiz,
wie eine auster aus rauch.
Hans Magnus Enzensberger liest Gedichte aus Landessprache.
gebrauchsanweisung
1. diese gedichte sind gebrauchsgegenstände, nicht geschenkartikel im engeren sinne.
2. unerschrockene leser werden gebeten, die längeren unter ihnen laut, und zwar so laut wie möglich, aber nicht brüllend, zu lesen.
3. das längste gedicht in diesem buch hat 274 zeilen. es wird an lukrez erinnert, der sich und seinen lesern 7415 zeilen abverlangt hat.
4. zur erregung, vervielfältigung und ausbreitung von ärger sind diese texte nicht bestimmt. der leser wird höflich ermahnt, zu erwägen, ob er ihnen beipflichten oder widersprechen möchte.
5. politisch interessierte leute tun gut darin, vorne anzufangen und hinten aufzuhören. für die zwecke der erwachsenenbildung, des vergnügens und der rezension genügt es, kreuz und quer in dem buch zu blättern. lesern mit philosophischen neigungen wird empfohlen, die lektüre im krebsgang, von hinten nach vorne vorzunehmen.
6. die motti sollen darauf hinweisen, daß der verfasser nichts neues zu sagen hat, und avantgardistische leser abschrecken. gründliche liebhaber der alten schriftsteller finden sie auf diesem blatt so gut übersetzt, wie sie der verfasser verstanden hat. im übrigen können die gedichte auch ohne motti benutzt werden.
Enzensberger schreibt Zeitgedichte
und beruft sich auf Lukrez. Er reiht mit berserkerhafter Emphase die groteskesten Bilder aneinander – und lächelt dazu. Er nimmt die Positur Savonarolas ein – und nennt seine zornigen Schreie: Gebrauchsgegenstände. Er plündert das Arsenal der Umgangssprache, spricht von Tarifpartnern, Wellpappe, Cellophan, Plombierzange, Schlußverkauf, Nahkampfspangen, von „geigerzählern und alten meistern“ – und bettet das ganze Vokabular, Jargon-Abfall und Cockney-Splitter, in Zusammenhänge, die den zerkauten Alltagsworten unversehens neue Bedeutung geben, sie gleichsam denunzieren und zur enthüllenden Selbstbezichtigung zwingen.
Walter Jens, Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1969
Einer der auszog, das Fürchten zu verlernen
Da ich ein sehr ansässiger Mensch bin, fällt es mir natürlich besonders auf, daß Enzensberger es nirgends lange aushält. In den Gedichten summieren sich dann die vom Schreck diktierten Wörter. Ist einer irgendwo zu Hause, kann er sich halbwegs einrichten, muß der Schreck zum zähen Belagerungskrieg übergehen, muß sich dünn machen, um einzudringen, die Kampfart wechseln, List hilft auch ein bißchen, die Furcht wird eine Art Landregen, ein monotones Geräusch. Aber Enzensberger kann sich offensichtlich nicht einrichten. Er verläßt einen Ort um den anderen, kein Wunder, daß er von jedem Gewitter auf offenem Feld angetroffen wird.
Wie jeder Mensch, versucht er es mit Namengeben. Was ihm zuwider ist, tauft er, gibt ihm den rechten Namen, wehrt es so, ab, zahlt ihm so den erlittenen Schrecken heim. Das Fürchten wird er natürlich nicht verlernen, aber bei so viel Fahrt in unheimlichem Wald lernt er das Singen, lernt es immer besser. Was da zuerst da war, die Schreckhaftigkeit oder der Spaß am Singen, läßt sich bei Enzensberger leicht entscheiden. Beides war von Anfang an da. Zum Glück. Es gibt genügend Gedichte von Enzensberger, die er nicht zeitgenössischer Schreckhaftigkeit verdankt, sondern der ursprünglichen Lust, mit Namen und Wörtern um sich zu werfen und auch noch das Hinfälligste dingfest zu machen.
Lyriker, das weiß man ja, nehmen die Sprache ernst, halten sich an die Wörter, im Guten und im Bösen. Die besten unter ihnen unterwerfen die Sprache einem andauernden Kreuzverhör. Die Geständnisse notieren sie. Die Sprache vertritt dabei die Wirklichkeit. Die Lyriker halten sich zwar an die Sprache bei ihrem Verhör, aber ihr „Schuldig“ oder „Schön“ gilt der Wirklichkeit.
Setzen wir das fort, unterwerfen wir die Sprache Enzensbergers einem Verhör, denn in seiner Sprache muß ja aufbewahrt sein, was ihm begegnete. Halten wir uns an Wörter, das ist vorerst einfacher als von Satzbau oder Rhythmus zu reden, und es ist bei Enzensberger besonders naheliegend. Ich kenne keinen, der die Wirklichkeit so deutlich in Wörter aufgeteilt hat, in Wörter des Widerwillens und in Wörter der Zuneigung. So wie er seinen ersten Gedichtband verteidigung der wölfe einteilte in „freundliche Gedichte“, „traurige Gedichte“, „böse Gedichte“, so kann man alle seine Wörter einteilen in Wörter für Angenehmes und Unangenehmes. Nicht „schwarz“ und „weiß“, sondern angenehm und unangenehm oder freundlich und schrecklich. Zum Beleg: eine willkürliche Folge von Hauptwörtern, die inzwischen schon jeder halbwegs Interessierte als einen Katalog Enzenbergerschen Unmuts erkennt:
„Abdecker“, „Staatsbanken“, „Speichel“, „Kongreßteilnehmer“, „Tränengas“, „Baracken“, „Kontoauszug“, „Bidet“, „Generalstäbe“, „Warzen“, „Schweiß“, „Makler“, „Eilboten“, „Schaum“, „Jauche“, „Hauptversammlungen“, „Schlachthöfe“, „Gebärmutter“, „Privatpatient“, „Zuchtbullen“, „Fistel“, „Orden“, „Drüsen“, „Handelsspannen“, „Pudding“, „Totschläger“, „Sahnebaiser“, „Cheftexter“.
Ich wählte absichtlich keine von Enzensberger geprägte Metaphern, sondern einfach ein paar Hauptwörter, die bei ihm vorkommen: die noch deutlicher werden, wenn man ihnen einen Katalog der Anmut gegenüberstellt, der zeigt, wovor Enzensberger nicht erschrickt, wohin er also auszieht, um Schlachthöfe, Orden und Warzen zu vergessen:
„Auster“, „Gesell“, „Dünung“, „Glanz“, „Fels“, „Perlmutt“, „Korken“, „Brise“, „Jäger“, „Spargel“, „Großmut“, „Sellerie“, „Zauber“, „Robben“, „Windhaar“, „Gletscher“, „Blauwal“, „Spatzen“, „Bratäpfel“, „Meer“, „Ottern“, „Wüste“, „Schiffschaukel“.
Verhören wir noch ein paar Tätigkeits- und Eigenschaftswörter. In der Welt der Abdecker und Geigerzähler finden sich da, zum Beispiel:
„fett“, „feucht“, „klebrig“, „zäh“, „farblos“, „gedunsen“, „blutig“, „räudig“, „triefend“, „schmierig“, „geifernd“, „eiternd“, „mickrig“, „fies“, „feist“ und „poliert“.
In der Welt der Blauwale, Spargel und Gesellen dagegen:
„gefiedert“, „trocken“, „beharrlich“, „neu“, „fest“, „furchtlos“, „fein“, „weiß“, „widerstrahlend“, „feierlich“, „gläsern“, „gesalbt“, „schwebend“, „blühend“, „klar“, „stark“ und „kalt“.
Könnte man so gegensätzliche Kataloge aus jedem Gedichtband zusammenstellen? Und wenn man es könnte, so deutlich würden die Gedichte selbst sich kaum irgendwo trennen lassen in solche traurig oder böse hingesagten Widerwillens und solche trauriger oder liebender Werbung.
Mir ist es immer komisch zumute, wenn ich wieder einmal irgendwo lese, Enzensberger sei ein zorniger junger Mann. Diese Marke haben die Kritiker bei uns für ihn geprägt. Sie mußten dazu zuerst einen englischen Markennamen schlecht übersetzen, dann hatten sie endlich eine Elle, mit der sie junge Autoren messen konnten. Sie haben Enzensberger auch zum politischen Dichter und zum Muster-Non-Konformisten gestempelt. Nun sind Leute, solange sie eine Kritik schreiben, oft unfreiwillig berufstätig, sie haben gerade keine andere Möglichkeit, also sollte man das auch nicht zu ernst nehmen. Ich bin mit Enzensberger befreundet, soweit ein Seßhafter mit so einem Fahrenden befreundet sein kann. Ich lese die Gedichte, die er irgendwo geschrieben hat, und lese da viel mehr Klage als Anklage. Ich sehe: Da wehrt sich einer seiner Haut, die er andauernd auf fremden Märkten bedroht sieht. Ich lese da, daß er eigentlich gern in einer Gitarre schlafen möchte, der April könnte ihm gar nicht lang genug dauern, er hätte auch gern ungestörten Umgang mit Ziegenhirten und Ballerinen, in der Zeitung müßte vielleicht stehen: Theresia von Konnersreuth hat den Lenin-Friedenspreis bekommen, oder noch besser: Sämtliche Atombomben sind plötzlich von einer unerklärlichen Virusinfektion dahingerafft worden.
Aber, wie bekannt. Die Welt ist nicht danach. Sie ist nach wie vor, und wahrscheinlich für immer: voller Schrecken. Man macht es sich zu leicht, wenn man alle fällige Empörung an einen zornigen jungen Mann delegiert, der dann sozusagen auch gar nicht mehr so ernst zu nehmen ist, weil es nun einmal seines Amtes ist zu schimpfen. Der Ekel, der einen Teil der Enzensbergerschen Gedichte hervorgebracht hat, ist nicht engagiert.
Es ist nicht nötig, Enzensberger in Schutz zu nehmen; es passiert ihm ja nichts, wenn er engagiert und zornig genannt werden müßte. Aber um ihn richtig einzuschätzen, um ihn nicht zum gewohnheitsmäßigen Protestierer zu degradieren, muß man sehen, daß sich in seinem Widerwillen gegen die veränderungsbedürftige Welt nicht viel Hoffnung und Hinweis ausspricht. Deshalb wird, was als Anklage beginnt, immer wieder Klage. Die Klassifizierer sollten ihn weniger Brecht als Nestroy zugesellen. Es erinnert nur sehr äußerlich an Brecht, wenn er sich als Kirschendieb ins Geäst setzt, aber es ist der Rückzug Nestroys, wenn er, von dort aus, dem „apokalyptischen Aas“ „lächelnde Steine“ in die „welken Rippen“ spuckt.
Besser, wir verzichten auf diese ungefähren Einkreisungen mit fertigen Namen. Es ist Enzensbergers gutes Recht, am meisten sich selbst zu gleichen und uns mit jedem Gedicht deutlicher zu werden. Und er macht es uns leicht, von seinen Gedichten auf sein Gesicht zu schließen. Das ist ein Glücksfall. Ionesco zum Beispiel sah ich einmal mit Gummimantel und dünner Aktentasche oberhalb Heidelbergs über den Neckar fahren und glaubte zuerst, hier begebe sich ein braver Installateur nach Feierabend noch zum Angeln. Anouilh dagegen sieht aus, als habe er Ionescos Stücke im Auftrag einer Untergrundorganisation geschrieben. Enzensbergers Gedichte passen in sein Gesicht. Wenn er die gepflegten und brutalen Verwalter unserer Welt auf ihren Terrassen auch mit noch so heftigen Schmähworten eindeckt, man spürt doch immer, daß er eigentlich sagen will: Ist es nicht fürchterlich, daß es so was wie euch gibt! Gebt doch zu, daß das fürchterlich ist! Und am lautesten höre ich ihn sagen: Warum muß alles, was widerlich ist, gerade mir auffallen! Ich würde meinen Bedarf an Häßlichkeit doch viel lieber mit erdachten Hexen decken, warum dringt ausgerechnet auf mich, der ich soviel Freude an einer schönen Küstenlinie habe, alles Gedunsene und Widerwärtige ein! Dann schreibt er seine Gedichte vielleicht fast in der Hoffnung, die Angegriffenen würden sich zur Wehr setzen, würden sich trennen von ihren Erscheinungen und Praktiken und würden sich ihm freundlicher nähern und sagen: Wir sind ja gar nicht so, wir sehen vielleicht so aus, da hast du recht.
Bitte, das ist eine Vermutung. Sie beruft sich auf Enzensbergers Gedichte und auf sein Gesicht. Dieses Gesicht hat Übung im Staunen, im skeptischen und bösen Lächeln. Man sieht aber sofort, mit diesem Gesicht wäre sehr viel Freundliches, Liebenswürdiges und Charmantes anzufangen, auch Spitzbüberei und Frechheit, bloß ist dazu nicht immer Anlaß. Öfter scheint es zu schmollen oder ängstlich zu sein. Das wirkt sich auf den Mund aus. Sehr, sehr viel später wird es einmal gut zu diesem Gesicht passen, daß Enzensberger schlecht hört; jener listige und zweifelnde Ausdruck, den der Schwerhörige annimmt, um sich einen Satz noch einmal wiederholen zu lassen, ist in diesem Gesicht jetzt schon zu Hause: Das kommt, weil er es einfach nicht begreifen kann, daß alles so ist, wie es ist. Und weil er den Zustand der Welt offensichtlich nicht für den bestmöglichen hält, weil er glaubt, daß er schlecht abschneidet, wenn er sich in dieser Welt so aufführt, wie er eigentlich möchte, weil also die Welt kein Fjord ist mit einer angenehmen Temperatur, deshalb wappnet er sich, zieht sich eine Wolfskappe über sein allgäuisches Arielgesicht, bleckt, wo er eigentlich lachen möchte, und wird traurig, wenn er bemerkt, daß die Welt in ihm einen Egoismus züchten will, vor dessen Dürftigkeit ihn schaudert.
Ich habe mich schon seinetwegen geniert. Wenn ich mit ihm etwa die Bahnhofshalle in Hamburg-Dammtor durchquerte und er plötzlich kleine heulende Schreie ausstieß. Aus Übermut. Aus eher traurigem Übermut. Das klang halb nach einem Hund, halb nach einer Eule. Passanten sahen sich besorgt nach uns um. Nun sah er, langbeinig, dünn und mit viel Geschick bekleidet, neben mir sowieso aus wie ein Windhund, für den ich die Steuer nicht bezahlt haben konnte. Seine kleinen Schreie bewiesen mir, daß er auf mich keine Rücksicht nehmen wollte oder konnte. Das paßt zu ihm, dachte ich. Ihm ist es gerade danach zumute, also stößt er kleine Schreie aus. In der Bahnhofshalle wirkte es fast wie eine Provokation, zumindest wie eine Aufforderung, auch in solche Schreie auszubrechen. Irgendeinen Grund hätte wahrscheinlich jeder gehabt. Aber vielleicht nicht die Stimme, die nötig ist, um diese Art Schreie so lange hervorzustoßen, daß sie hängen bleiben zwischen Klage und Frechheit. Falls Sie einmal sowas hören in einer überfüllten Bahnhofshalle oder auf dem Trottoir und dann noch ein Mann in der Nähe ist, der seine hagere Figur mit Erfolg bekleidet hat und der auf eine zielbewußte Weise zwischen Ihnen hindurchschlenkert und -pendelt, dann ist es ziemlich sicher Hans Magnus Enzensberger.
Martin Walser, Die Zeit, 15.0.1961
Einatmen – Ausatmen
Als der 30jährige deutsche Lyriker Hans Magnus Enzensberger Anfang dieses Jahres von Rom nach Frankfurt übersiedelte, um dem Suhrkamp Verlag als Lektor zu dienen, bekam er einen „Schock“. So jedenfalls nennt er das, was er nach fast dreijährigem Italienaufenthalt angesichts der florierenden Stadt am Main empfand.
Die literarische Frucht dieses Schocks war „Landessprache“, ein sieben Buchseiten langes politisches Poem, Titelgedicht seines soeben erschienenen zweiten Versbandes. Der Verfasser sei „in der Tat ein bedeutender Lyriker, der einzige vielleicht, der sich – heute, zornig und zart, ,ein‘ Erbe Bertolt Brechts nennen darf“, begeisterte sich flugs Enzensbergers Kollege von der Gruppe 47, Walter Jens, in der Zeit.
Wenn der Vergleich mit Brecht auch etwas hochgegriffen erscheint, so ist doch sicher richtig, daß politisch engagierte oder interessierte Lyriker in der Bundesrepublik heute dünn gesät sind. „Gräserbewisperer“, wie Gottfried Benn die Naturlyriker boshaft nannte, und pseudo-avantgardistische Wortklauber nach Art der movens-Bande (SPIEGEL 37/1960) beherrschen die literarische Szene.
Enzensberger jedoch, dessen Laufbahn so modisch-konventionell wie die vieler seiner jungen Dichterkollegen begann – mit einem Förderungspreis der Hugo-Jacobi-Stiftung (1956) und mit Beiträgen für die Anthologien Junge Lyrik, Jahresring und Transit –, legt heute großen Wert darauf, nicht als „Jung“, „modern“ oder gar „avantgardistisch“ zu gelten. In einer „Gebrauchsanweisung“, die er, nicht ohne Koketterie, seinem neuen Gedichtband beilegen ließ, erklärt Enzensberger, „avantgardistische Leser abschrecken“ zu wollen. Die seinen Versen vorangestellten Zitate klassischer Autoren, wie zum Beispiel Plinius, Heraklit und Vergil, sollten „darauf hinweisen, daß der Verfasser nichts Neues zu sagen hat“.
1957 hatte Enzensberger einen Freiplatz in der Villa Massimo in Rom bereits nach wenigen Wochen, im Stich gelassen:
Das ist deutsche Inzucht. Ich mietete mir ein Haus bei Rom.
Auch einen zweiten Förderungspreis lehnte er ab.
Statt dessen gab sich Non-Avantgardist Enzensberger dem „Einatmen“ hin – so nennt er seine diversen Auslandsaufenthalte. Ehefrau – Dagrun aus Norwegen und das mittlerweile dreijährige Töchterchen Tanaquil atmeten mit, bis 1957 in einem Blockhaus im norwegischen Stranda, später in jenem Landhaus bei Rom. Der Zeitpunkt des „Ausatmens“ war gekommen, als Enzensberger, von Frankfurt schockiert, eine Verlagswohnung im vornehmen Frankfurter Westend bezog. Und solcherart waren die Atemstöße, in deutsche „Landessprache“ übersetzt:
hier geht es aufwärts,
hier ist gut sein,
wo es rückwärts aufwärts geht,
hier schießt der leitende herr den leitenden herrn mit dem gesangbuch ab,
hier führen die leichtbeschädigten mit den schwerbeschädigten krieg,
hier heißt es unerbittlich nett zueinander sein.
Enzensberger selbst ist alles andere als nett zu seiner Umwelt. Auf seiner Schwarzen Liste lyrischer Schmähungen stehen unter anderem: blindekuhspielende Polizisten, amtliche schmierige Adler, Bewohner schmutziger Nebensätze, ein bestochenes Jüngstes Gericht, Päpste in Leihwagen, abgeschabte Genies, unaufhörlich fressende Leichen bei Kranzler, Schaumgummihochhäuser in Düsseldorf, Nobelpreisträger in Rudeln, automatische Bachwochen, Gesichter aus Mayonnaise und Kitt sowie Kapuziner, die rosig ihre Gebete gurgeln.
Des Preisens würdig ist dem Lyriker Enzensberger allenfalls das Firmament,
… das zehnmal zehntausend faden hoch
harrt,
nirgends nämlich,
das unser und seiner geschwelgt und königlich labt
den nächstbesten, der sonstwie heißt
oder iljitsch, pius, philemon
oder enzensberger, fremdbrödler von beruf,
im gewimmer
wohnhaft, mikrobenbeet,
umsonst getauft,
unter doppelgängern zuhaus.
Gelegentlich fällt auch ein kleines Lob für die Lachse; die Wale, das Nordlicht, den Sozialismus oder die Sellerie ab. Zwiespältig dagegen ist Enzensbergers Haltung zu seinem zwiegespaltenen Vaterland, das er einmal als „arischen Schrotthaufen“ besingt:
deutschland, mein land, unheilig herz der völker,
ziemlich verrufen, von fall zu fall,
unter allen gewöhnlichen leuten:
meine zwei länder und ich, wir sind geschiedene leute,
und doch bin ich inständig hier,
in asche und sack, und trage mich.
was habe ich hier verloren?
Eine Dichterlesung im April dieses Jahres in Leipzig, von dem ostzonalen Germanisten Professor Hans Mayer geleitet, ließ Enzensberger diese „zwei Länder“ am eigenen Leib erfahren. Eine interne Diskussion zwischen den eingeladenen Autoren – Peter Huchel (Potsdam), Stephan Hermlin (Ostberlin), Ingeborg Bachmann (Zürich) und Hans Magnus Enzensberger – war ein glatter Mißerfolg. Enzensberger:
Hermlin und ich redeten in zwei verschiedenen Sprachen. Ich kam sehr deprimiert zurück. Es ist noch viel schlimmer drüben, als es in der FAZ zu lesen ist.
Die stets von ihrer Würde durchdrungene Frankfurter Allgemeine ist dem politischen Dichter Enzensberger überhaupt ein Ärgernis. So dichtete er zum Beispiel in „Landessprache“:
… verloren an dieses fremde, geschiedne geröchel,
das gepreßte geröchel im neuen deutschland,
das frankfurter allgemeine geröchel
(und das ist das kleinere Übel),
ein mundtotes würgen, das nichts von sich weiß
Sorgte sich Enzensberger beim Erscheinen seines Buches:
Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre eine gute Kritik von (Friedrich) Sieburg.
Obwohl ihm solches Ungemach vermutlich erspart bleiben wird – in der Frankfurter Allgemeinen kritisierte inzwischen Rudolf Krämer-Badoni den landessprache-Autor als einen „Mann mit bewundernswerten Gehirnpartien und mit klirrender, manchmal scheppernder, manchmal treffender Stimme“ –, will der lyrische Atemtechniker Enzensberger in etwa achtzehn Monaten das Land, wo man „unerbittlich nett zueinander“ ist, wieder verlassen und zu neuem Luftholen fern der Heimat aufbrechen.
Vorher jedoch wird der fleißige und vielseitige Dichter, der sich neuerdings zur Schonung seiner strapazierten Handgelenke einer elektrischen Schreibmaschine bedient, mindestens noch eine internationale Lyrik-Anthologie unter dem Titel Museum der modernen Poesie, ferner eine Übersetzung der Beggar’s Opera von John Gay sowie ein Hörspiel Der Mittelmäßige und schließlich auch noch eine Sammlung von Kinderreimen ausatmen.
Anonym, Der Spiegel, 28.9.1960
landessprache
Der 1960 veröffentlichte Gedichtband landessprache ist Hans Magnus Enzensbergers zweiter Lyrikband. Thematisch beziehen sich die Gedichte auf die westdeutsche Wirtschaftswunderwelt der 50er Jahre, zu der Enzensberger eine nonkonforme Haltung einnimmt. Seine Gedichte zeichnen das Bild eines Landes, das von „Anpassungsdruck und Mitläufertum, […] Aufstiegsdenken und […] Wohlstandeuphorie“ und „selbstgerechter Ignoranz“1 geprägt ist. Enzensberger charakterisiert Deutschland einerseits als „Musterland“2 und andererseits als „Mördergrube“ (S. 9). Damit ist landessprache der Versuch einer „intellektuellen Standortbestimmung“ (KLG, S. 3) innerhalb einer Gesellschaft, in der „es aufwärts geht, aber nicht vorwärts“ (S. 7).
Jedem der fünf Abschnitte des Gedichtbandes ist ein Zitat in Originalsprache vorangestellt. Nach Aussagen des Schriftstellers sollen die Zitate vor allem verdeutlichen, dass er in diesem Gedichtband nichts Neues mache, denn schon die alten Griechen hatten Schriften verfasst, in denen sie scharfe Kritik an ihren Landsleuten und der Politik zum Ausdruck brachten. Dies lässt sich exemplarisch besonders gut am ersten Zitat aufzeigen:
Er [Parrhasius] wollte sie [seine Landsleute] so darstellen, wie sie ihm vorkamen: also von gescheckter Art, reizbar, ungerecht, zum Opportunismus neigend; dabei leicht zu beeinflussen, weichherzig, gutmütig, selbstlos, hochtrabend, eingebildet, gemein, blindwütig, hasenfüßig – und zwar all das auf einmal und zugleich.
(Plinius, Hist. Nat. XXXV, X).
Somit stehen die Zitate zwar in Zusammenhang mit den Gedichten, da sich in ihnen die zeit– und gesellschaftskritische Thematik der Lyrik deutlich widerspiegelt, zum direkten Verständnis der Gedichte seien sie, so der Autor, jedoch nicht vorausgesetzt. Dies erklärt auch, warum die deutschen Übersetzungen der Zitate dem Buch nur in Form eines losen Blattes unter dem Titel gebrauchsanweisung beigefügt sind. In dieser gebrauchsanweisung gibt Enzensberger an, dass seine Gedichte „Gebrauchsgegenstände, nicht Geschenkartikel“ (ebd.) seien, und er betont, dass das Ziel seiner Gedichte „nicht Erregung, Vervielfältigung oder Ausbreitung von Ärger“ (ebd.) sei. Vielmehr solle der Leser über seine Gedichte nachdenken, und dann selber entscheiden ob er ihnen zustimmt oder nicht.
Aus heutiger Sicht ist landessprache als ein wichtiges Werk der deutschen Nachkriegsliteratur einzustufen; im Erscheinungsjahr 1960 jedoch war Enzensbergers Lyrikband alles andere als unumstritten, sondern löste heftige Kontroversen aus. Diese Kontroversen bezogen sich gerade auf die Aspekte der Gedichte, die sie rückblickend so bedeutsam machen: erstens Enzensbergers Verständnis von einem politischen Gedicht und zweitens die modernen Stilmittel, die er verwendet.
In landessprache setzt Enzensberger die in seinem späteren Aufsatz „Poesie und Politik“ (1962) deutlich zur Sprache gebrachten Grundsätze zum Verhältnis von Literatur und Politik bereits in die Praxis um. Laut Enzensberger müsse „der politische Aspekt der Poesie […] ihr selber immanent sein. Keine Ableitung von außen vermag ihn aufzudecken.“ (KLG, S. 6) Ferner sei es der „politische Auftrag“ jedes Gedichtes, „sich jedem Auftrag zu verweigern und für alle zu sprechen noch dort, wo es von keinem spricht, von einem Baum, von einem Stein, von dem, was nicht ist. […] Das Gedicht, das sich […] verkauft, ist zum Tod verurteilt.“ (ebd.) Durch diese Grundsätze bestimmt sich Enzensbergers lyrikgeschichtlicher Standort, sie sind, zumindest für die ersten drei Lyrikbände, ein Markenzeichen seiner Gedichte und verleihen ihm in der Poesie der Nachkriegszeit klares Profil: politische Analyse und Kritik sind nicht unmittelbar und parteiergreifend, sondern ein immanenter Bestandteil seiner Lyrik. Doch nicht nur inhaltlich, auch stilistisch verfeinert Enzensberger mit landessprache seine Technik der Collage und der Montage, mit der er in verteidigung der wölfe neue Wege in der Nachkriegslyrik gegangen war. Er „mischt mehrere Ebenen: Losungen der Boulevard–Presse […], Reklame, Ikonen der Konsumgesellschaft, […] ramponierte Reste einer Bildungssprache […], ironisch gewendete Gebetsformeln, [und] schließlich Zeitungsphrasen […]“ (KLG, S. 4) – all diese Ebenen werden zusammengefügt. Durch diese Collage– und Montagetechnik „erweitert er die Sprache des Nachkriegsgedichts um einen Bereich, der [zuvor] noch häufig […] verborgen war.“ (KLG, S. 4)
1969 erschien eine Neuausgabe von landessprache im Taschenbuchformat in der edition suhrkamp (Nr. 304). In der sechsbändigen Ausgabe der Gedichte von 1999 sind die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen der Zitate merkwürdiger Weise nicht enthalten.
Hans Magnus Enzensberger-Projekt
Die Sprache des Hans Magnus Enzensberger
Was habe ich hier verloren
in diesem Land,
dahin mich gebracht haben meine Älteren
durch Arglosigkeit?
So fragt Hans Magnus Enzensberger am Anfang seines Gedichts „Landessprache“ auf der ersten Seite des gleichnamigen Gedichtbandes. Es ist sein zweiter und nach dem virtuosen, vielschichtigen Start mit Verteidigung der Wölfe auch ein ungleich politischeres und auf gesellschaftliche Kritik fixiertes Werk (erschienen 1960), insbesondere im zweiten Teil „Gedichte für die Gedichte nicht lese“ und eben in diesem ersten Gedicht „Landessprache“ in dem Enzensberger fortfährt:
Was habe ich hier? Was habe ich hier zu suchen,
in dieser Schlachtschüssel, diesem Schlaraffenland,
wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts,
wo der Überdruss ins bestickte Hungertuch beißt,
wo in den Delikatessengeschäften die Armut, kreidebleich,
mit erstickter Stimme aus dem Schlagrahm röchelt und ruft:
es geht aufwärts!
Heute, nach über 50 Jahren, ist ein Gedichtband, der so einsetzt und dessen Autor sich seither mehrmals in seiner politischen und künstlerischen Einstellung (letztere nur unwesentlich) umentschieden hat, mit Vorsicht zu genießen. Enzensbergers Sprache steht bar jeder Kritik noch immer modern und aktuell da. Aber wie ist es mit den Themen?
Nun: Enzensberger scheint, auch in diesem Band, zwar ein kritischer, aber nicht doktrinärer Dichter (gewesen) zu sein. Denn seine gesellschaftlichen Gedichte nehmen sich auch heute noch im Allgemeinen als warnend und darstellerisch trefflich aus. Das bemerkt man schon am Anfang des Gedichts „Die Scheintoten“:
Die Scheintoten warten vor den Kartellämtern,
sie warten, ohnmächtig, aus beiden Lungen rauchen,
vor den Eichämtern und vor den Arbeitsämtern.
Ihr bleicher, farbloser Jubel weht
wie eine riesige Zeitung im Wind
gegen die vielen vergitterten Schalter.
Gewiss, heute könnten solche Gedichte wahrscheinlich nicht mehr geschrieben werden (vor allem aber wohl wegen der heutigen Ästhetik der (politischen) Poesie), aber sind sie deshalb heute nicht immer noch zutreffend? Und ist nicht gerade dies Gedicht, sein Anfang, sogar mit den Jahren gewachsen? 7 Regierungen sind über dieses Gedicht gegangen, politische Kurswechsel und 50 Jahre gesellschaftlicher Geschichte – und dennoch hat dies alles die innewohnenden Symbolik und Botschaft dieses Gedichts nicht eliminieren können.
Weiter in der Mitte steht das längere, überbordende Gedicht „Schaum“. Es bildet die Brücke zwischen dem ersten engagierten und dem zweiten, nicht weniger kritischen, aber oft ungleich abstrakteren Teil „Oden an Niemand“. „Schaum“ selbst ist eine Art intelligente Tirade, Namedropping und Analyse wechseln sich ab, Momente der Offenheit, gehen über in Rundumschläge. Es ist ein bizarres Gedicht, bei dem man trotzdem das ungute Gefühl nicht losführt, es enthülle langsam aber sicher eine (vielleicht furchtbare) Wahrheit, unter all dem Schaum.
alle wunden Wäscher
in den kranken Kassen
ruhn mit blinden Hunden
in den toten Hemden.
Bei manchen Dichtern hat man das Gefühl, dass sie mit uneinnehmbarem Ernst dichten, andere dichten allein mit ihrer Freude. Bei Enzensberger kann man es nur aus den einzelnen Zeilen herauslesen und nicht aus dem Gedicht insgesamt. Sicherlich war er stets mit seinen Gedichten um Engagement und/oder sogar Schönheit bemüht, wie die wenigen, seltenen, fast zärtlichen, bildhaften Gedichte beweisen, in denen er Szenen der Einsamkeit oder des Zusammenseins einfasst. Doch bei vielen anderen, eher abstrakten Gedichten, meint man doch den Verspielten im Ernst der Verse zu erblicken.
Gealtert ist dieser Gedichtband, aber gut gealtert. Natürlich gibt es an den Rändern noch mehr zu entdecken, als ich hier offenbaren und verzeichnen kann. Enzensbergers Poesie lebt auch von einer gewissen Unberechenbarkeit, die gerade in deutschen Landen (bei Dichtern, die nicht komisch Dichten) selten ist, und die jedes Gedicht zu einer eigenen Erscheinung macht. Das kann man auf die schlechte oder die gute Seite der Waage legen, wie es einem beliebt.
Enzensberger wird beides nicht stören…
Hier bin ich, ein Schiff aus Rauch,
hinter dem Mond zu Haus, ein Mann
unter den Wurzeln des Meeres, bewohnt
wie ein Totenacker, ein Totenstrauch
von Nattern und Tauben, zuhaus
im blühenden Sternsarg, allein
im Feuer der Windrosen wohnend
bei meinen Lidern, den Tauben im Wind.
Timo Brandt, amazon.de, 3.3.2012
„Landessprache“
Hans Magnus Enzensberger hat mit seinem ersten Gedichtband einer politisch und gesellschaftlich entarteten Welt einen Spiegel vorgehalten, daß es ihr die Stimme verschlug, zu fragen, wer die schönste sei im ganzen Land. Man hatte es mit einem Autor zu tun, der nicht bequem war und der den Wölfen im Schafspelz den übergezogenen Balg herunterriß. Die allgemeine Ratlosigkeit war groß, als sich herausstellte, daß dieser Schriftsteller um keinen Preis bereit war, den Konformismus mitzumachen.
Auch sein zweiter Gedichtband ist eine Provokation. In scharfen Episteln geht Enzensberger mit der leeren und verlogenen Geschäftigkeit eines Musterlandes ins Gericht. Aufgedeckt wird mit sprachlichen Mitteln, die der kursierenden „Landessprache“ entlehnt sind, der sich Fraktionsmitglieder und Tarifpartner, Vertreter und Abgeordnete bedienen, ein Knäuel von Beschönigungen in einem desparat geschiedenen Land. Enzensbergers vitales politisches Gewissen entlädt sich über dem „ewigen Frühling der Amnesie“. Freilich werden sich die leitenden Herren dadurch nicht stören lassen und, nach dem einigermaßen Besten trachtend, so tun, als ob nichts geschehen sei. Enzensberger ist kein Revolutionär. Er glaubt nicht an Umwälzungen, die proklamiert werden, und ist viel zu gewitzigt, um Ideologien ins Garn zu gehen. Dennoch stellt er der skrupellosen Welt eine andere gegenüber: die Welt, die indirekt gemeint ist, ist die Utopie der Unbefangenheit und Freiheit. Das Wort Freiheit hat unausgesprochen eine zentrale Bedeutung bei Enzensberger. Wäre ihm das geschichtliche Geschehen gleichgültiger, er würde es nicht als Moralist mit hämmernden Anklagen zur Rechenschaft ziehen.
Enzensberger hat alle Evasionen ausgeschlagen und sich einer Wirklichkeit gestellt, von der andere nur zu gern wegsehen. Er lehnt die Palliative ab, die von der Massengesellschaft angeboten werden. Sein Zorn richtet sich auf die Mitläufer, eine Kaste, die von Cummings, mit dem er manches gemeinsam hat, mostpeople genannt wurde. In dem berühmt gewordenen Gedicht; an den „unbekannten Staatsbürger“ hat W.H. Auden diesen Typ dargestellt, der gehorsam die Individualität gegen das genormte Dasein verkauft. Für Enzensberger ist der kollektive Mensch ein Scheintoter, von dem er trocken konstatierend berichtet. (Er, der Vergil zitiert, scheint sich gegen die pietas zu wehren.) Schlimmer aber sind die „Ordner der Welt, die vorgeben, die Macht für uns erwerben zu müssen“ (Eich). Er nimmt sie in bissigen Satiren aufs Korn, das heuchlerische Dekorum ihres Tuns dekuvrierend.
Er hat ein neues Vokabular in die deutsche Lyrik eingeführt: von poetischen Reminiszenzen unberührte Worte wie Butt und Sellerie, Glimmer und Malm werden von ihm inauguriert. Er tritt für die „wehrlosen Zeugen der Welt“ ein und verleiht ihrer schmucklosen Gestalt in seiner Sprache unvermutete Schönheit. Die einfachen Dinge, erhalten plötzlich eine neue Kostbarkeit:
die stumme muschel hat recht,
und der herrliche hummer allein
recht hat der sinnreiche seestern.
Der Prozeß der Geist.
Cyrus Atabay, Die Tat, 13.8.1960
Enzensbergers problematische Gebrauchsgegenstände
– Gedichte, zur Kritik herausfordernd – Ein Kommentator mit verstellter Stimme. –
Schon Enzensbergers erstes Gedichtbuch Verteidigung der Wölfe bedeutete den Sonderfall, daß hier ein Lyriker nicht nur die Tabus der gesellschaftlichen Absprachen lädierte, sondern darüber hinaus die freiwillige Selbstquarantäne unserer zeitgenössisch-zeitentzogenen Poesie durchbrach. Sein neuer Versband Landessprache ist in beiderlei Sinn Zuspitzung und Bestätigung.
Im krassen Gegensatz nämlich zu allen Definitionen von Lyrik als einer Kalmen-Kunst, bekennt sich Enzensberger zur ästhetischen Zweckform: „diese gedichte sind gebrauchsgegenstände“, und „der leser wird höflich ermahnt, zu erwägen, ob er ihnen beipflichten oder widersprechen möchte.“
Solch brechtische Vorgabe legt nun allerdings die Frage nah, ob hier nicht einer der Skylla des Formalismus mit Macht entstrebte, um sich dann getrost dem Sog der Charybde anzuvertrauen, dem verführerischen Sog von Brechts hymnischer Didaktik, und in der Tat scheint denn bereits ein erstes flüchtiges Blättern den Verdacht aufs gröbste zu bestätigen.
Da stoßen wir vornehmlich auf syntaktische Eigentümlichkeiten, die auch uns bei Brecht so überaus gefielen, eine besondere Art zu verkürzen und zu schachteln, zu fügen und zu verschieben, Intimitäten des Satzbaus und Spezialkonstruktionen also, die ohne Umschweif auf das Vorbild verweisen („seid mild, ihr richter, verzeiht dem schwächeren / zu erhaben der vorsatz, zu klein seine kräfte / ist er gescheitert.“ – „die wer sie sind nicht wissen noch wissen wollen“ – „aber bedenkt: auch das, / was weniger wimmern wird, / wimmert allenfalls, also zuviel, / also ungeheuerlich mehr“).
Wir können uns aber dann bei eingehenderer Lektüre davon überzeugen, daß solche Aneignungen doch in der Minderzahl sind und daß der Anwurf der bloßen Nachfolger-, gar Nachäfferschaft in keiner Weise gerechtfertigt wäre. Überdies widerlegt sich sehr bald die Befürchtung, es könne hier auf die ausgeleierte Antithetik von arm und begütert und ähnliche Konterpaarungen hinauslaufen, da eben Enzensbergers Kritik dort ansetzt, wo das alte Schema – das Schema Brechts – nicht mehr fassen will, wo kein Hunger mehr zählt und der Wohlstand beschlossene Sache ist: bei der Situation der Bundesrepublik im Jahre 1960.
Nun mag, wer diese fette Aue als soziales Arkadien empfindet, meinen, daß es läßlich sei, dort abzutragen, wo es doch so ermunternd aufwärts gehe, und Gegensätze zu schüren, wo sich soziale Spannungen glatterdings von selbst mäßigen – hier, aber gerade hier nährt sich der Unwille eines jungen Dichters, der den prometheischen Traum von einer Entwicklung des Menschengeschlechts zu Sitte, Bildung und Humanität an diesen armseligen, diesen „blühenden boom“ verraten sieht:
was habe ich hier? was habe ich hier zu suchen,
in dieser schlachtschüssel, diesem schlaraffenland,
wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts,
wo der überfluß ins bestickte hungertuch beißt,
wo in den delikateßgeschäften die armut, kreidebleich,
mit erstickter stimme aus dem schlagrahm röchelt und ruft:
es geht aufwärts!
Das ist nicht nur Überdruß am Überfluß, nicht nur das Unbehagen an der aufstrebenden Behaglichkeit, das zweifelt hier und im folgenden durchaus am Fundamente; sagen wir: an dem Sinn einer Gesellschaft, die außer der Lust am wuchernden Wohlstand kaum eine Wertvorstellung zu entwickeln und in gesellschaftliche Realität umzusetzen fähig war. Diese Freiheit zu allem und nichts, was förderte und wessen Sache betrieb sie denn? Wo verwirklichte sich im Gehege unausmeßbarer Freistatt das freie Individuum, und wo an Gemeinschaftlichkeit mehr als daß eine Hand die andere wäscht?
Die Frage nach dem Wogegen schärft die Neugier aufs Wie. Schon der vorausgeschickte Hinweis, daß es sich um Nutz- und Lehr-Lyrik handele, deutet auf die Zweckformen Flugblatt, Manifest, Plakat – allerdings ist gleich an dieser Stelle zu betonen, daß Enzensberger keineswegs beim Plakat stehenbleibt, vielmehr Zwitterformen entwickelt, Manifest und Ode miteinander kreuzt, dem Kampf-Päan die Flugblatt-Folie unterlegt und das Plakat ins Sittengemälde ausweitet und vertieft. Und gerade dadurch, daß Aufruf und Mitteilung von vornherein als ein formales, als Problem der Schreibweise einkalkuliert werden, verhindern sich unfreiwillig komische Verschlierungen von Gesang und Leitartikel, von Missionarismus und Geträller.
Enzensberger entgeht solcher Gefahr, sagten wir, und wir können das Lob um den Hinweis erweitern, daß die Artikulation hier sehr häufig die Definition einschließt, und daß sich die Art zu stilisieren und der Wille zu werten oft seltsam entsprechen. Wo Enzensberger nämlich eine nach seinen Maßen verkehrte Welt darstellt, bedient er sich folgerichtig der literarischen Verkehrung, und der Bruch zwischen luzidem Traum und roher Praxis offenbart sich in schneidenden Interferenzen und gewalttätigen Montagen.
Er spricht mit verstellter Stimme, spricht ironisch vom wirtschaftlichen Aufschwung: „hier ist es gut sein / wo es rückwärts aufwärts geht“: er redet nicht über die Mißlichkeiten, sondern mißt den zwielichtigen Erscheinungen das passende Paradox an: „unaufhörlich fressende leichen“, „ruinen auf vorrat“, „der embryo in seinem warmen, zuckenden sarg“, „gemütliches elend“, „nette zufriedene grube“, „die nächste sintflut wird seicht sein… eine dürre flut“: er apostrophiert sein Vaterland, indem er einen antiquarischen Enthusiasmus parodierend verstellt:
deutschland, mein land, unheilig herz der völker.
Nun lebt allerdings auch eine Poesie des Widerspruchs nicht allein vom kunstvollen Verdrehen, sondern im letzten von der Kraft und Originalität ihrer Metaphorik. Es ist die Metapher ja keineswegs der dichterische Versuch, es dem Maler gleichzutun, vielmehr eine ganz und gar literarische Form des Vergleichs; hier zeigt sich, wie weit einer zu spannen und gleichzeitig zu fügen vermag und ob einer die neuen Erfahrungs- und Denk-Wirklichkeiten sichtbar zu machen fähig ist.
Es scheidet den nur konservierenden, den Traditionsmeier vom schöpferischen Experimentalmann, daß dieser heute wie eh Sonnenstrahl und Pfeil, Auge und Brunnen, Rose und Mund in Beziehung treten läßt, jener aber Geschiedenheiten überlagert, wie es kein Muster vorgibt und keine Konvention von vornherein als gesichert erscheinen läßt: „nach phlox und erloschenen resolutionen riecht der august“, „bleicher farbloser jubel weht wie eine riesige zeitung im wind“, „wo die zukunft mit falschen zähnen knirscht“, „in den staatsdruckereien rüstet das tückische blei auf“.
Das schert sich wenig darum, was bislang als poetisch galt oder als desintegrabel angesehen wurde, das schöpft und schürft von allem verfügbaren Sprachmaterial.
Allerdings darf an dieser Stelle die Einschränkung nicht verschwiegen werden, daß mancher Vers Enzensbergers auch ein Zuviel an Stoff aufnahm, mehr als er zu tragen und ästhetisch zu verdauen fähig war; auch, daß so mancher kühne Griff ins Umgangswelsch, manche flott gepolte Antithese und manche flinker Hand gedrehte Verfremdung im billigen Effekt enden und verenden:
oben im licht macht die jury den tod
und den kultursalat an, jupiter
verkauft sich unter den lampen,
es jubeln posaunenchöre, überall pfeifen die schiedsrichter schon
zum letzten elfmeter…
So etwas ist denn nur mehr Eintagsschreibe, und es bekümmert just den aufrichtigen Bewunderer eines Revisionisten der modernen Poesie, diesen hier und häufig der Leichtfertigkeit unterliegen zu sehen.
Peter Rühmkorf, Welt 23.11.1960
Rezension in der Landessprache
(hans magnus enzensberger, landessprache
suhrkamp verlag frankfurt/m sechstes bis siebentes tausend 1962)
Du bist der Neuste von uns! da steigst du nun
Gleich Afrodite endlich aus Amoks Schaum
Auf auf in die wirbelnde Welt! Und Hurra! ein Knabe!
Ein Stammhalter unerhörtesten Stammtischgeschlechts!
überm Kreuzwort der Zungen: neu steigen die Rätsel der Menschen!
O neuer Zungenschlag! Und neue Liebe jeweils im Mai!
Endlich läßt du, Kolumbus, das Ei aus dem Sack
Für die Pfanne des Volks. Spiegelei. Seitdem
Hat DIE ZEIT ihre Hoffnung
Du bist der Mutigste von uns – na und?
Steht nicht der Grashalm aufrecht vor der Sense?
Geht nicht manche mutig den Strich lang? schreit nicht der stolze
Eichwald unterm elektrischen Fallbeil? oder die lustigen
Zeitungen: preisen sie nicht die Continental-Reifen
Auch der Überfallwagen? war denn
Michel Kohlhaas nicht tollkühn, das heroische Kalb?
Schlägt nicht die Windmühle um sich – und
Legt sie den Wind?
Du bist der Ehrlichste von uns – ah! ehrlich
Wie der sterbende Gallier, wie ein medizinisches
Wörterbuch: das sagt eben alles, grundehrlich
Wie Z I N N 40, wie den Fangspruch fügt
Eubulides, dein Spießgeselle, ja wie ein
Regenwurm fast: er erbleicht auf offnem
Bürgersteig! wie die Nichtmehrgeliebte: holt nicht die dritte
Tortur der Verzweiflung alles raus, und zwar
Mehr als die Wahrheit?
Du bist der Unbestechlichste von uns – du beherrschst
Die objektive Syntax. Sein Bewußtsein
Bastelt der Kenner in Heimarbeit! Und es macht nichts, daß du
Zufällig Deutsch kannst – Rundspruchabonnent
Unterm Flick-Himmel! vom Schlagwort Getroffner in
Niemandes Land! Sprachpfleger am Rück-Spiegel, werdet
Starkritiker um einen Preis: tragt wieder
Kleinere Übel! Der Fliege auch tut
Der Leim wohler, den sie verhöhnt
Du bist der Konsequenteste von uns, du gehst ans Ende
Deiner Weisheit. Der Kämpfer gegen die Schlächter
Bleibt in der Schlachtschüssel. Und das Skalpell erst denkt
Scharf genug von der Menschheit. Von Freitag zu Freitag
Den Stab gebrochen über die allgemeinunmenschlichere Welt!
Side-step und Siebenjahrplan! Mischt mit, geleimte Erzengel
In der Zweifrontenschlacht! wider jeglichen Panzer der Henker
Und Aktivisten! her mit dem zwiefach gespitzten
Pfeil, dem unvoreingenommenen!
Konstruiert die Welt in den Nullpunkt! Schlagt die Realität kahl!
Tauscht mit der Tollwut treu den Eheschlagring!
Du bist der Tollste von uns! in den Sprachgaskammern
Feilschen die Hau-Sahne-Fressen lüstern um neue
Stabgereimte Hilflosigkeit. Ein neuer
Luxus bricht aus vor dem letzten Krieg: das Gedicht!
Erblind in Tränen, kluger Kyklop, Tränen
Feuchten die Luft fein fürs Treibhaus, fast schon
Grüßen dich Kleingärtner
Gegensatz
Geschieden bist du von unsern zwei Ländern: wie das Wasser
Weit aus der Wüste: sie wächst zu ihm
Das sie flieht. Wie die Liebenden im Schlaf:
Einer ist Traum des andern: geschieden wie der Ast
Kühn am Baum und die weiße Wurzel: auf sie baut
Was da blüht. Wie der Fuß – wohin, in
Welche Zonen trägt er uns? Geschieden ist so der Vers –
Auf tausend Lippen wieder gewogen, wird er
Das Notwendige wagen
Volker Braun
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Walter Jens: Paukenschlag und Kantilene
Die Zeit, 5.8.1960
Auch in: Dichten und Trachten, Heft 16, 1960
Rudolf Krämer-Badoni: Der Mensch, den es noch nicht gibt
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.8.1960
Rudolf Hartung: Zorn als Landessprache
Neue Deutsche Hefte, Heft 77, 1960
Hellmuth Karasek: Die Verteidigung der Biber
Stuttgarter Zeitung, 17.9.1960
Eberhard Horst: Zornige Landessprache
Rheinische Post, 11.3.1961
Dieter Schlenstedt: Aufschrei und Unbehagen. Notizen zur Problematik eines westdeutschen Lyrikers
Neue Deutsche Literatur, 1961
Alfred Andersch:
Bücherbrief, Heft 10, 1960
Auch in: Über H.M. Enzensberger (1970)
Hans Bender: Die Weisheit der unausgesprochenen Worte
Merkur, Heft 189, 1961
Karl Krolow: Zorniges Dichten
Der Tagesspiegel, 11.9.1960
Elvis RROJI: Enzensbergers frühe politische Lyrik
Masterarbeit, Karl-Franzens-Universität Graz, 2010
Hans Magnus Enzensberger
Die Enzensberger ist eine ordinäre Eintagsfliege, die nach dem Genuss türkischen Kaffees in unbewohnten Küchen und durch Wohnungen wirbelt wie eine eingesperrte Libelle und deshalb fälschlicherweise für das letzte Exemplar einer seltsamen Libellenart gehalten wird. Sie nährt sich von Abfällen, die aus Brechthaufen, Weyrauchresten, Gottfrieds Bennereien und Bachmann-Krümeln stammen, und gedeiht dabei wesentlich besser als manche brave Stubenfliege.
Derart wenig respektvoll und nicht übermässig witzig liess sich, offensichtlich angeregt von Franz Bleis inzwischen legendär gewordenem Bestiarium Horst Hartmann unter der Ueberschrift Viecher aus dem literarischen Zoo über den Lyriker und Essayisten Hans Magnus Enzensberger vernehmen, der heute zu den umstrittensten Autoren der Bundesrepublik gehört. Kein Nachtprogramm, keine Zeitschrift, die auf sich hält, kein Feuilleton – von Konkret bis zur Süddeutschen Zeitung, vom Spiegel bis zur Frankfurter Allgemeinen – scheint ohne Beiträge von oder über Enzensberger auszukommen. Die Zahl der Enzensbergerschen Publikationen ist kaum noch zu überblicken, zumal der Autor die bewundernswerte Fähigkeit hat, einzelne Aufsätze gleichzeitig in den verschiedensten Blättern, Büchern und Rundfunkanstalten unterzubringen. Nach Gottfried Benn ist es ihm sogar als zweitem deutschen Poeten gelungen, eine Schallplatte mit eigenen Gedichten, die von Jazz untermalt werden, als Jazz und Lyrik herauszubringen, er wird zitiert, imitiert und parodiert, (nur eine Rowohlt-Monographie scheint noch auszustehn, um seinen Ruhm zu krönen).
Das sicherste Kennzeichen bundesdeutscher Publicity, das gelegentliche Auftauchen im Spiegel, spricht eindeutig für Enzensberger. Mit grosser Liebe nimmt sich das Nachrichtenmagazin regelmässig des Dichters an und lässt ihn in Wort und Bild auftreten, ähnlich wie Günter Grass, der, wie Enzensberger, von dem Kritiker Günther Blöcker als „Kleinkunstkadett“ eingestuft wurde. Im Gegensatz zu Grass aber, der nur gelegentlich in einzelnen Zeitungen Offene Briefe publiziert und sich ansonsten zurückgezogen seiner Danziger Heimat literarisch widmet, hat Enzensberger die Möglichkeit, regelmässig einmal im Monat im Spiegel ein Buch seiner Wahl zu rezensieren, wobei er es sich einmal sogar gestattete, einen Aufsatzband zu besprechen, zu dem er selbst einen Beitrag geliefert hatte.
Dabei hatten Enzensbergers Beziehungen zum Spiegel gar nicht so freundlich begonnen. 1957 war er nämlich in einem Vortrag über die Sprache des Spiegel scharf gegen das Nachrichtenmagazin zu Felde gezogen, dem er nachwies, dass es kein Nachrichtenmagazin sei, den Leser desorientiere, keine wirkliche Kritik übe und bei seiner story-Technik, bei der die Verstrickung von Information und Kommentar zum System geworden ist, in angestrengter Humorigkeit bei einzelnen Personalmeldungen die Mitte zwischen Zote und Ehrabschneiderei halte. Der Spiegel, statt H.M.E. zu ignorieren, druckte den Vortrag ab. Selbst in seine im letzten Sommer erschienene Aufsatzsammlung Einzelheiten nahm der neue Spiegel-Mitarbeiter die Attacke von 1957 ungescheut auf.
Allerdings bewiesen dabei nicht alle Zeitungen soviel Verständnis wie der Spiegel. Enzensbergers erster Gedichtband von 1957 verteidigung der wölfe, in der er die konsequente Kleinschreibung praktizierte, erregte mit seiner Einteilung in „gute“, „traurige“ und „böse gedichte“ beträchtliches Aufsehen, das nicht auf die Literaten beschränkt blieb, sondern auch politisch Interessierte ansteckte. Es war der Oeffentlichkeit ganz offensichtlich neu, dass man über Sozialpartner, Konjunktur und Bildzeitung Gedichte schreiben und von Politikern sagen konnte:
sie tragen zu euch die liebe
des metzgers zu seiner sau.
Noch wenig Jahre zuvor hatte der 1929 in Kaufbeuren geborene Bayer Enzensberger, der sich über Volkssturm und Schwarzhandel bis zum Abitur und Studium in Paris, Erlangen und Hamburg durchgeschlagen hatte, in Studentenzeitungen Gedichte wie „In der fonda von Palacios / Am Guadalquivir, / Da spielte unverdrossen ein / Elektrisches Klavier“ veröffentlicht. Nach der Promotion über Brentanos Poetik, im Jahre 1955, die er etwas überarbeitete und als Buch veröffentlichte – bei der Bearbeitung gelang ihm allerdings nach eigener Aussage „die Uebersetzung der Promotion vom Germanistischen ins Deutsche“ nicht –, war Enzensberger Redakteur am Süddeutschen Rundfunk und Gastdozent an der Ulmer Hochschule für Gestaltung.
Bis zum Erscheinen seines zweiten Lyrikbuches Landessprache im Jahre 1960 hielt er sich 1957 in den USA und Mexico, vom Sommer 1957 bis 1959 in Norwegen auf, ausserdem in Rom, wohin ihn ein deutsches Villa-Massimo-Stipendium verschlagen hatte. Aus der römischen Villa war der Lyriker aber schon bald mit der Begründung „Das ist deutsche Inzucht!“ ausgezogen und hatte sich in der Nähe Roms ein Haus gemietet. Später kehrte er als Lektor seines Verlages Suhrkamp nach Deutschland zurück.
Diese Rückkehr nach Deutschland versetzte Enzensberger nach seinen eigenen Worten einen „Schock“, der ihn zur Niederschrift des Gedichtes „Landessprache“ antrieb, das dem neuen Buch seinen Titel gab. In diesen Gedichten wurde Enzensberger noch böser als in den „bösen gedichten“ seines ersten Buches, für das ihm die Kritiker, an Brecht und Heine messend, zum grösseren Teil gute Zensuren ausgestellt hatten. Dem zweiten Gedichtband legte Enzensberger in einem Anflug von snob-appeal eine in der Diktion gelegentlich an Brecht erinnernde „Gebrauchsanweisung“ in sechs Punkten bei. Punkt eins:
diese gedichte sind gebrauchsgegenstände, nicht geschenkartikel im engeren sinne.
So fühlten sich auch diejenigen Kritiker, die weniger auf dem poetischen als auf den politischen Gehalt sahen, nicht beschenkt, wenn sie lesen mussten:
was habe ich hier verloren,
in diesem land
… wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts,
… wo wir uns finden wohl unter blinden.
Den Gipfel bildeten Ausdrücke wie „arischer schrotthaufen“, „mördergrube“ („hier schiesst der leitende herr den leitenden herrn mit dem gesangbuch ab“) und „deutschland, mein land, unheilig herz der völker“. Dem standen die Kritiker recht hilflos gegenüber, zumal, wenn sie sich an einem poetischen Vorfahren des Lyrikers Walther von der Vogelweide aus dem 13. Jahrhundert orientierten, der sich zum Thema Deutschland und die Deutschen ganz anders geäussert hatte:
Tiusche man sint wol gezogen…
Tugent und reine minne,
swer di suochen wil,
der sol komen in unser lant: da ist wünne vil!
lange müeze ich leben dar inne!
Vor allem die Redakteure der Frankfurter Allgemeinen (FAZ) hatte Enzensberger durch die Bemerkung vom „frankfurter allgemeinen geröchel“ verärgert. Diesen Kinnhaken erwiderte Rudolf Krämer-Badoni bei einer Rezension von Landessprache in der FAZ, indem er, anspielend auf eine Autorenlesung im April 1960 mit Peter Huchel, Stephan Hermlin und Ingeborg Bachmann in Leipzig, von Enzensberger als von einem Dichter sprach, der „in Leipzig Sympossen reisst“, und ihm als einem „Mann mit bewundernswerten Gehirnpartien“ die „flotte Mache“ seiner Gedichte vorwarf, die „eine Breitseite in die Fresse des Westens mit ein paar schelmischen Seitenhieben nach Osten als Mindestsoll“ darstellten. Solch kräftige Sprache ward in der FAZ seit langem nicht vernommen. Enzensberger revanchierte sich auf eine sehr subtile Art. In seinem Essayband Einzelheiten analysiert er auf 46 mit 66 Anmerkungen gespickten Seiten den politischen Teil der FAZ und weist der Zeitung die „Technik der Heuchelei“, die Vermischung von Tatsache und Meinung und die Unterschlagung wichtiger Nachrichten nach. Dabei hat er es gar nicht nötig, auf braune Flecke auf der schwarz-rot-goldenen Weste der FAZ-Redaktion zu deuten, ihm genügt die reine Analyse des Blattes und der Vergleich mit anderen grossen Tageszeitungen der Welt. Als Fazit seiner Bemühungen gibt Enzensberger den Rat, sich statt auf die FAZ auf eins der grossen Blätter der Welt zu abonnieren, die sich noch an die journalistischen Spielregeln hielten.
Nach einer derart vernichtenden Analyse, in der es Enzensberger, wie der Romancier Reinhard Baumgart, in der Süddeutschen Zeitung schrieb, gelang, die doppelte Zunge im Munde der FAZ zu entdecken, griff die FAZ zum schwersten Geschütz und liess Benno Reifenberg, der gerade seinen siebzigsten Geburtstag feierte, einen langen Erwiderungsartikel schreiben, der zum Teil gar nicht aufgestellte Behauptungen mit viel Scharfsinn zu widerlegen unternahm und über Enzensbergers Angriff nicht mehr zu sagen wusste als:
Was uns angeht, so bemitleiden wir ihn.
Auch später liess sich die FAZ keine Gelegenheit entgehen, es Enzensberger heimzuzahlen, wobei sie allerdings Polemik bisweilen mit hilflosem Gebell oder gar Anpöbelei verwechselte, so etwa, wenn Günther Blöcker in der FAZ anlässlich einer Rezension eines Buches von Benn Enzensberger in Anspielung auf dessen Benn-Rezension im Spiegel einen „Naseweis und professionalen Zeterer“ nannte. Ein anderer Kritiker, der Krämer-Badoni und Blöcker sicherlich nähersteht als Enzensberger, Hans Egon Holthusen, hatte sich schon 1958 dem Dilemma ausgesetzt gesehen, dem Lyriker Enzensberger eine gewisse Bewunderung nicht versagen zu können, den Polemiker aber ablehnen zu müssen, den er mit „Bürgerschreck“, „rabiater Randalierer“ und „schäumender Hassprediger“ mit „einer nicht mehr zu überbietenden Schnodderschnauze“ titulierte. Holthusen wich auf die unverbindliche Formel aus, die Moral der Enzensbergerschen Lyrik heisse „Glück“, seine Idee „Utopie“ und erkannte erstaunlicherweise „in seinen Gedichten den Sinnertrag eines ursprünglichen Menschseins“. Nach Enzensbergers eigener Aussage entspringt sein Engagement seinem Bedürfnis nach Bequemlichkeit:
Ich will nicht Angst haben müssen vor Raketen, ich will nicht, dass ich mich vor Flugzeugen fürchten muss.
Er sei nicht aus Albert-Schweitzer-Geist, vielmehr aus Egoismus und Bequemlichkeit engagiert. Mit dem gleichen Argument, nämlich Bequemlichkeit, erklärt er seine Vorliebe für die Kleinschreibung in seinen Gedichten, die er gleich in die rot-graue elektrische Schreibmaschine tippt, ohne für Grossbuchstaben umschalten zu müssen.
Enzensberger sorgt regelmässig für Ueberraschungen bei seinen Lesern. So legte er ihnen statt böser Gedichte oder bissiger Polemiken 1961 ein wohlausgestattetes Buch mit 777 Kinderreimen vor, die er unter dem Titel Allerleirauh versammelt hatte. Den vom Militär und Kommersbuch adaptierten und vom Gebrüll der Hitlerjugend zu Tode geschrieenen Volksliedern stellt er die Kinderverse als „prima, poesis eines jeden Menschenlebens“ gegenüber, die ihren anarchischen Humor bewahrt haben. Neben ewigen Wahrheiten wie „Lirum larum leider, / die Butter, die ist teuer“ und „Ix, ix und ein Zett, / die Studenten sind nett, / ein Zett und ein Ix, / aber taugen tuns nix.“ finden sich Balladen, „Kribbelmärchen“ und die Verse, mit denen katholische Kinder die evangelischen verspotten: „Hier in diesem Sudder / liegt Doktor Martin Luther“, worauf diese nicht weniger poetisch antworten: „Und noch etwas teifer drein / liegt der Papst, das dicke Schwein.“ Enzensbergers eigenen Anschauungen dürfte ein anderer Vers entsprechen:
Rufst du, mein Vaterland,
gib mer e Wurst in d Hand
und e Glas Wein,
tu mer kei Wasser drein,
dass ich mag fröhlich sein.
Zum Sammeln von Kinderreimen fühlte sich Enzensberger angeregt, als er selbst, verheiratet mit einer Norwegerin, für die prima poesis seiner Tochter zu sorgen hatte. Dr. phil. Enzensberger – „Der Titel ist gut, wenn man in einem überfüllten Hotel noch ein Zimmer will.“ – lebt mit seiner Familie jetzt wieder in Norwegen auf einer Insel im Oslo-Fjord. Sein Auszug aus der Bundesrepublik gab dem Neuen Deutschland am 19. September 1961 Anlass zu der besorgten Frage „Musste Enzensberger emigrieren?“ Und der DDR-Autor Peter Hacks versuchte, Enzensberger in einem Offenen Brief den Kommunismus mit Marx-Zitaten und der interessanten Bemerkung schmackhaft zu machen:
Damit der Mensch seinen Spass haben kann, darum machen wir ja den Kommunismus.
Im übrigen versicherte er Enzensberger:
Es ist aber leider, was Sie schreiben, dummes Zeug.
Da ist Martin Walser, wie Enzensberger Suhrkamp-Autor und Mitglied der Gruppe 47, allerdings anderer Ansicht. Im Rundfunk und in der Zeit verriet er nicht nur seine Sympathie zu dem Verteidiger der Wölfe, sondern liess die Leser und Hörer auch wissen, dass Enzensberger gelegentlich in Bahnhofshallen oder auf dem Trottoir „kleine heulende Schreie“ ausstosse. Im übrigen sei der Ekel, der einen Teil der Enzensbergerschen Gedichte hervorgebracht habe, nicht engagiert, deshalb werde, was als Anklage beginne, immer wieder zur Klage. Uebrigens schrieb auch Enzensberger für die Zeit und den Funk über Martin Walser, getreu dem Motto von Dr. Murke beziehungsweise Heinrich Böll: verfeaturest du mich – verfeature ich dich.
Nach dem Band Einzelheiten, in dem sich Enzensberger ausser mit FAZ und Spiegel auch noch mit der Wochenschau, dem Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie – dem er rät, statt zweifelhafte Kunstpreise zu verteilen, lieber einwandfreie Industriegüter zu produzieren und Luft und Wasser nicht zu verschmutzen, den Taschenbüchern, Günter Grass, dem Herbstkatalog des Versandhauses N (Neckermann), der Gruppe 47, Pablo Neruda, Böll, Johnson, Walser und Nelly Sachs beschäftigt hatte, wendet er sich in letzter Zeit wieder einem Vorhaben zu, das er schon 1960 mit dem Buch Museum der modernen Poesie begonnen hatte. Hier hatte er 350 Gedichte aus der Zeit von 1910–1945 in 16 Sprachen vorgelegt, die Sprache des Originals stand jeweils neben der deutschen Uebertragung. Enzensberger selbst hatte dabei aus dem Spanischen, Französischen, Englischen, Schwedischen, Norwegischen, Holländischen und Italienischen übersetzt.
Jetzt setzt er dieses Unternehmen, das die „Entstehung einer poetischen Weltsprache“ aufzeigen soll, mit, der Buchreihe Poesie fort, die Lyriker des Auslandes im Original und Uebertragungen vorstellen wird. In den ersten vier erschienenen Bänden hat er Gunnar Ekelöf, Fernando Pessoa, Giorgos Seferis und David Rokeah vorgestellt, dessen hebräische Gedichte neben Enzensberger auch Paul Celan und Friedrich Dürrenmatt übersetzt haben. Als bisher letztes Unternehmen Enzensbergers ist das Buch Vorzeichen erschienen, in dem er neue Autoren einführt.
Auch Vorzeichen wird, wie alle anderen Bücher Enzensbergers, der Aufmerksamkeit, der literarischen Oeffentlichkeit sicher sein können. Ein Buch allerdings, das Enzensberger 1960 veröffentlichte, blieb ziemlich unbekannt, wird bei der Aufzählung seiner Werke meist vergessen und gelangte weder zu Bestseller-Ehren noch wurde es von Rudolf Krämer-Badoni in der FAZ rezensiert: Zupp, der Li-La-Löwe, ein buntes Kinderbilderbuch mit Texten von Hans Magnus Enzensberger.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 14.6.1963
Letzter Leseabend im Schauspielhaus Zürich
während der Juni-Festwochen
Dem Vernehmen nach war der dritte Autorenabend im Schauspielhaus die erste der ausverkauften Veranstaltungen dieser Festwochen. Wenn man gefürchtet hatte, diese Dichterlesungen würden nur schwer ein genügendes Publikum anlocken, so hat man sich getäuscht. Es herrschte starke Spannung auch an diesem letzten Abend, der der jüngsten Generation der schon Erfolgreichen vorbehalten war: Krolow, Ingeborg Bachmann, Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger ließen sich von unserem Dürrenmatt auf die Bühne locken und saßen da, wie es sich für einen heutigen Lyriker schickt, den man wie den Löwen im Zoologischen Garten dem Publikum zur Schau stellt: etwas unwirsch, etwas unselig – man ist vielleicht in Wirklichkeit recht liebenswürdig, aber man „trägt“ das zur Zeit nicht. Auch unter den Lyrikern herrschen die zornigen jungen Männer. Dürrenmatt übernahm die Vorstellung, und nach dem Schema: mal was anderes! stellt er uns Zürcher Publikum den fremden Gästen vor. Er sagte ihnen Dinge, die sie vielleicht lieber hörten als wir, vielleicht auch eher glaubten als wir. Jedenfalls versuchte er sich im weltmännischen Zeremoniell und wußte zu seinem Trost zu berichten, die Menschenfresser hätten ganz besonders fein gesponnene Rituale der Vorstellung bei ihren mörderischen Veranstaltungen. So waren wir denn gewarnt und konnten bei dem Folgenden nur aufatmend feststellen, ganz gefressen habe uns Dürrenmatt denn doch nicht. Jedenfalls hatten wir noch die Kraft zu applaudieren, ihm und den Dichtern, die nach ihm zu uns sprachen.
Wie schon Emil Staiger kam auch Dürrenmatt auf die Schwierigkeit des heutigen Schweizers, sich mit dem heutigen Deutschen zu verständigen. Dieser habe die Sintflut für einmal hinter sich gebracht, wir seien davor verschont geblieben, nun schon zum mehrten Mal, so seien wir vorsintflutliche Menschen, die sich vor der Sintflut fürchteten, jene aber Nachsintflutliche, die neue Hoffnung schöpften. Wir lebten im Frieden, uns bereitet durch viel Glück und einigen Verstand, seit hundertfünfzig Jahren, aber der Sinn stehe uns immer noch nach Heldentum, und so bedächten wir denn weder Marignano noch Napoleon, sondern fühlten uns als Nachfahren der wilden Reisläufer als wenigstens potentielle Helden. Emsig flickten wir die lecken Steilen unseres Schiffes, ein Feind sei uns noch ein Feind – jene aber seien die Schiffbrüchigen, in deren Weltbild der Feind längst bloß ein Mensch geworden sei. Was uns rette in unserer geistigen Lage, das sei der Selbsthumor – ohne ihn könne man nur schwer ein Schweizer sein. Dürrenmatt hat diesen Humor, er hatte ihn auch für uns und malte uns nicht ohne groteske Züge an den Theaterhimmel. Oft traf er ins Schwarze, manchmal etwas daneben. Denn er hatte wohl vergessen, daß das Publikum, das sich hier versammelt hatte, ein recht anderes war als an den Premieren: sehr viele junge Leute, noch mehr Lehrer, als er schon vermutete – aber ist das nicht ein ganz lebendiges Weltstädtchen, das zu Dichtern dieses Kalibers, Dürrenmatt inbegriffen, noch mehr als die von diesem berechneten 18 Prozent Pädagogen schickt? Man kann diesen wohl kaum Scheuklappen andichten. Dürrenmatt versuchte dann doch noch, uns auch in wenigen Worten diese deutschen und österreichischen Dichter in ihrer bezeichnendsten Wesensart vorzustellen: er wies auf ihre unablösbare Bindung an die Politik hin, auf den ihnen unerläßlichen Mut, auf ihre Gänge auf den Schleichwegen zur Freiheit und auf ihre einzige, wirklich bindende und tragende Heimat, die Sprache. Ihr Gedicht sei ohne ästhetisches Programm, sei Gedicht vom Menschen an den Menschen. Schön sei gleich notwendig, vollkommen sei gleich gefährlich, ein richtendes Wagnis sei es, sich dem Gedicht zu unterwerfen. Denn unser Sein sei weitgehend ein Akt der Entscheidung.
Schön war es, daß Hans Magnus Enzensberger mit einigen wenigen seiner Gedichte den Beschluß des Abends machte. Dinge wie seine Beschwörung der Kirschblüte sind von wirklicher Gültigkeit, es ist da eine Lyrik, deren Vorbild die Sichtbarkeit einer zarten Versteinerung zu sein scheint, ein gewichtiges Schweben, Bild unmittelbar aus Worten. Enzensberger las seine Gebilde auch vorbildlich, die ausschwingende Vereinzelung des Wortes, in der auch noch das scheinbar unbedeutendste Werkelement gewogen wird, erwies hier ihr ganzes Recht. So endete denn diese persönliche Begegnung mit heutigem deutschem Schrifttum auf höchst wesenhafte Weise. Gerade weil die dramatischen Gaben dieser deutschen Festwochen vorwiegend vom politischen Inhalt aus bestimmt waren, wurden die Nichtdramatiker als Gegengewicht nötig. Aber darüber hinaus hat der Zusammenklang von Bühnenwort und auf sich allein gesteltem Wort ganz besondere Kraft des Aufschlusses.
ebs., Die Tat, 1.7.1961
Hans Magnus Enzensberger
Noch nicht fünfunddreißig Jahre alt, ist Hans Magnus Enzensberger der Sphäre objektiv-kühler Kritik bereits entronnen. Wird sein Name genannt, ist Emotion im Spiel. Die einen vibrieren vor Empörung, andere sind hektisch begeistert. Selbst ein Polemiker, ist er Gegenstand der Polemik geworden. Ob dies zum Heile des Autors Enzensberger ausschlägt, kann heute noch niemand wissen. Persönlich ist er tolerant, einsichtig, ja, zur Sanftmut neigend und vernünftigen Argumenten zugänglich. Vertritt er hingegen einmal eine gewonnene Ansicht öffentlich – in seinen Schriften oder im gesprochenen Kommentar –, so ist er bestimmt, unerbittlich, aggressiv und von einem gewissen Hochmut. Er ist Bayer und betont es selbst gern. Mag sein, daß seine Lust, sich intellektuell anzulegen, auch auf diese Herkunft zurückzuführen ist: sublimierte bayerische Rauflust. Sie ist es jedenfalls, die sein Bild in der Öffentlichkeit derzeit bestimmt.
Von ihr sei jedoch zunächst abgesehen. Denn viel spricht dafür, daß Enzensberger, au fond, nichts anderes ist als ein aufgeschreckter Träumer. Zwar hält er selbst nicht viel von Analysen, in denen der Begriff der „Generation“ eine Rolle spielt; seltsamerweise, da ihm das soziologische Rüstzeug doch sonst höchst willkommen ist. Aber wer wollte leugnen, daß die Schicksale seines Jahrganges – und seine eigenen – ihre Rolle dabei gespielt haben, und daß er „aufgeschreckt“ wurde. Dabei ist unverkennbar, daß er andere Sehnsüchte hat und sie, mindestens, anerkennt. In seinem Essayband Einzelheiten charakterisiert er seinen Freund Martin Walser:
Mit Vorliebe stellt Walser sich als den letzten freiwilligen Provinzler hin, als einen Kleinstädter mit dem Horizont der Kirchtürme von Wasserburg… Wasserburg ist sein Dublin, sein Triest, sein Illiers, der Nabel seiner Welt. Die Dutzend-Journalisten schwarzbrauner Couleur, sie machen mich lachen, wenn sie heute schon wieder von den „wurzellosen Literaten“ fabeln. Günter Graß aus Danzig, Uwe Johnson aus Cammin in Pommern, Martin Walser aus Wasserburg – wie tief stecken sie allesamt in ihren Herkünften!
Und, so wird man hinzufügen dürfen, wie tief steckt Enzensberger aus Kaufbeuren in den seinen! Die Rückbeziehung des Objektes Walser auf das Subjekt Enzensberger erscheint beim ersten Hinsehen vielleicht gewaltsam. Schließlich ähnelt sein Lebenslauf, jedenfalls bisher, eher dem des „fahrenden Sängers der Romantik“ von Brentano, über den er seine Doktorarbeit schrieb, als dem des ansäßigen Walser. Polyglott, gewandt, ein poeta doctus par excellence, nicht ohne modische Attitüde, ist er überdies weder dem elementaren Günter Graß noch dem rätselhaften Johnson vergleichbar. Auch dürften sich jene „Dutzend-Journalisten“ in ihren postulierten Behauptungen gewissermaßen bestätigt fühlen, wenn sie – oberflächlich – das eine oder andere Enzensbergersche Gedicht lesen, etwa das Titelgedicht aus dem Band landessprache und dort folgende Zeilen finden:
was habe ich hier verloren,
in diesem land,
dahin mich gebracht haben meine älteren
durch arglosigkeit?
eingeboren, doch ungetrost,
abwesend bin ich hier,
ansäßig im gemütlichen elend,
in der netten, zufriedenen grube.
was habe ich hier? und was habe ich hier zu suchen,
in dieser schlachtschüssel, diesem schlaraffenland,
wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts…
Doch sollten die „Dutzend-Journalisten“ nicht nur oberflächlich lesen, zornige Vokabeln wie „schlachtschüssel“ und ironische wie „schlaraffenland“ [man beachte die Allitteration] nicht zornbebend registrieren. Schließlich trägt, wer da schreibt: „eingeboren, doch ungetrost“, die Sehnsucht mit sich herum, getröstet zu werden, überdies dort, wo er geboren wurde.
Zwar endet dieses Gedicht Enzensbergers, dem ein Schlüsselwert für sein Verhältnis zu Deutschland zukommt, mit den Worten:
… musterland,
mördergrube, in die ich herzlich geworfen bin
bei halbwegs lebendigem leib,
da bleibe ich jetzt,
ich hadere aber ich weiche nicht,
da bleibe ich eine zeitlang,
bis ich von hinnen fahre zu den anderen leuten,
und ruhe aus, in einem ganz gewöhnlichen land,
hier nicht,
nicht hier.
Doch kann man in ihm auch lesen:
denn dieses land, von hunger rasend,
zerrauft sich sorgfältig mit eigenen händen,
dieses land ist von sich selber geschieden,
ein aufgetrenntes, inwendig geschiedenes herz,
unsinnig tickend, eine bombe aus fleisch,
eine nasse, abwesende wunde:
deutschland, mein land, unheilig herz der völker,
ziemlich verrufen, von fall zu fall,
unter allen gewöhnlichen leuten…
Wer hier nicht spürt, wie Enzensberger getroffen ist, der wird den Schmerz nie nachempfinden können, von dem ein Moralist herausgefordert und, bisweilen, zur Unmäßigkeit angestachelt wird.
Eine Sprache wie diese ist in Deutschland lange nicht mehr geschrieben worden. Sie ist die eines verletzten und [bewußt] verletzenden Unmuts, einer empörten Trauer; dabei federnd, klar, schmucklos; dabei aufgeladen mit Bildern unerhörter Prägekraft. Welch eine Metapher:
Deutschland, eine Bombe aus Fleisch!
Dennoch ergeben solche Metaphern nicht den geheimen Sinn dieses Gedichtes [und den anderer]. Sie verdecken eher den unter ihnen verborgenen Enzensberger. Zu finden ist er schon mehr in der öfter wiederkehrenden Vokabel „gewöhnlich“: „gewöhnliches land“, „gewöhnliche leute“. In ihr wird eine doch allgemein äschetisch-soziologisch empfundene Wendung zu einer moralischen Kategorie erhoben. „Gewöhnlich“ könnte für „gut“ stehen, freilich nicht im naiven, unreflektierten Sinn.
Von hier aus lassen sich Querverbindungen ziehen: vom Studenten Enzensberger, der sich mit dem Romantiker Brentano beschäftigte; vom Lyriker, der seine Sehnsucht zum „gewöhnlichen“ Leben bekennt, der in seinen Poemen Volkslied-Zitate verfremdet einsetzt [„Wo wir uns finden wohl unter blinden“] – hin zum Sammler und Herausgeber „vieler schöner Kinderreime“, in deren Nachwort er an Kleists Begriff einer zweiten Naivität erinnert. Auch der Verfasser einer Geschichte für Kinder, „Zupp“, gehört dorthin, obwohl sich in ihr jene „zweite Naivität“ so recht nicht einstellen will. Sogar das imponierende Museum der modernen Poesie, darin er Gedichte der letzten fünfunddreißig Jahre aus aller Welt mit Fleiß und Kenntnis zusammengetragen hat, korrespondiert mit jener vertrackten und komplizierten Sehnsucht, die sich ein Einverständnis herbeiwünscht.
Wasserburg, Illiers, Dublin, die „gewöhnlichen Leute“ in einem „gewöhnlichen Land“, die „zweite Naivität“ und schließlich die „Weltsprache der Poesie“, die es gewiß gibt, sicher aber nicht in dem von Enzensberger postulierten Grade [es sei denn, es werde alles auf einen im Grunde unwandelbaren, milieu-unabhängigen Menschen zurückbezogen, den der Soziologe und Polemiker Enzensberger wiederum keineswegs voraussetzt] – es sind alles Kehrseiten ein und derselben Sache. Enzensberger wünscht, „mit ziegenhirten im regen zu kauern“ und sich mit „ballerinen und korbmachern zu besprechen“.
Enzensberger leidet, wie alle Moralisten, an dem Mangel der Übereinstimmung seiner Vorstellungen mit den Wirklichkeiten. Er ist ein ähnliches Doppelwesen, wie Heinrich Heine, mit Anklängen übrigens an Novalis, doch überdies ausgerüstet mit einem Verstande, dem alle dialektischen Denkmethoden fast schon allzu mühelos zu Gebote stehen. Von dorther bezieht er seine motorischen Kräfte, seine geschliffene Empörung. Und, er ist sich dieses Umstandes genau bewußt.
Seine Polemiken – auch viele seiner „bösen“ Gedichte und andere, die nicht expressis verbis den Stempel des Zornes von ihm selbst verliehen bekommen haben, sind von einer unbestreitbaren, grandiosen Brillanz. Freilich sind sie bisweilen auch nur schillernd, Freilich verraten sie hier und dort auch eine Attitüde, von der aus sich’s halt trefflich streiten läßt. Sie pflegt sich dann auch sprachlich zu enthüllen, etwa in Wortspielen, hinter denen nicht viel mehr steht, als der momentane Einfall. Doch verraten die meisten von ihnen einen fruchtbaren Denk-Ansatz, dem sich selbst nicht entziehen kann, wer Enzensberger dessen Ergebnisse streitig machen will. Ihn allerdings in die Ecke des disqualifizierenden Nihilismus zu boxen, ist ein nicht sonderlich faires Unterfangen, solange eine neue, auf unsere Zeit bezogene Definition des Nihilismus – es wäre die erste seit Nietzsche – aussteht. Enzensberger ist zwar, mitunter verwirrend, gegen die Macht und die Mächtigen. Doch installiert er sich dadurch auf einem alten Topos der Poesie, wie er freilich, mit der anderen Hand, den nicht minder alten Topos des Herrscherlobes verschmäht. Als vehementer Kritiker einiger Zeiterscheinungen bedient er sich der Methoden und Ergebnisse, die Wissenschaftler erarbeitet haben. Schriftstellerisch folgt er dabei den Spuren berühmter Vorbilder, allerdings in einer sprachlich wie denkerisch selbständigen Art. In seinem Band Einzelheiten hat er sich vornehmlich der „Bewußtseins-Industrie“ angenommen und sich dabei als erster daran gewagt, nicht deren Phänomene allgemein zu analysieren, sondern ganz bestimmte und genau zu kontrollierende Objekte. [Als erster jedenfalls mit dieser Konsequenz und Besessenheit.] Es sind dies: eine bedeutende deutsche Tageszeitung, ein Nachrichten-Magazin, die Taschenbuch-Produktion, die Wochenschauen, ein Versandhaus-Katalog. Außerdem der „Tourismus“: hier ist die Grenze zwischen exakter, am Gegenstand orientierter Analyse und allgemeiner Kulturkritik bereits überschritten.
Man braucht Enzensbergers Deduktionen wahrhaftig nicht im einzelnen zu folgen. In den meisten Fällen aber haben sie Durchblicke gegeben, die zum Durchdenken der Einrichtungen zwingen, denen sie gelten. Daß bei ihnen oft genug ein schwer zu durchschauendes Wechselspiel zwischen persönlichem Aristokratismus und politischem Fortschritt-Willen zutage tritt, liegt nicht nur an der Denkmethode, sondern auch in der Natur der Dinge und des Menschen selbst.
Die folgenden Sätze aus dem einleitenden Aufsatz „Bewußtseins-Industrie“ mögen den Denkansatz, aus dem sich alles weitere ergibt, illustrieren:
Die Zweideutigkeit, die darin liegt, daß die Bewußtseins-Industrie ihren Konsumenten immer erst einräumen muß, was sie ihnen abnehmen will, wiederholt und verschärft sich, wenn man ihre Produzenten, die Intellektuellen, ins Auge faßt. Zwar verfügen sie nicht über den industriellen Apparat, sondern der Apparat verfügt über die Intellektuellen; aber auch diese Beziehung ist keineswegs eindeutig… Ihre primären Energien können der Bewußtseins-Industrie ihre Beherrscher, wer sie auch seien, nicht mitteilen; sie verdanken sie eben jenen Minderheiten, zu deren Elimination sie beauftragt ist: den Urhebern, die sie als Randfiguren verachten oder als Stars petrifiziert und deren Ausbeutung die Ausbeutung der Konsumenten erst ermöglicht. Was für die Abnehmer gilt, gilt erst recht für ihre Produzenten: sie sind ihre Partner und ihr Feind zugleich. Beschäftigt mit der Vervielfältigung von Bewußtsein, vervielfältigt sie ihre eigenen Widersprüche und vergrößert die Differenz zwischen dem, was ihr aufgetragen ist, und dem, was sie ausrichtet. Jede Kritik an der Bewußtseins-Industrie ist unnütz oder gefährlich, die diese Zweideutigkeit nicht erkennt…
Man sieht die Methode. Und in diesen Sätzen ist nun freilich nichts mehr von einer Möglichkeit zur „zweiten Naivität“ enthalten, die das Individuum Enzensberger anstreben mag, die es aber der Gesellschaft nicht einräumen kann, da er sie in sich selbst verstrickt sieht. Hier nun – ganz abgesehen von der, methodisch und tatsächlich fragwürdigen Flucht in anonyme Mächte – liegt auch die Schwäche des denkerischen Prozesses, den zu verfolgen Enzensberger nicht müde wird: Höchstens am Rande, sehr beiläufig gesteht er hier und dort ein, daß die Produkte der „Bewußtseins-Industrie“ zum mindesten auch individuell – nun gut: konsumiert werden. Daß also, wer immer aus der Perspektive des Begriffes der „Massengesellschaft“ und ihrem „Bewußtsein“ argumentiert, nicht ungestraft vollends innerhalb dieser Kategorien verharren kann, sobald der individualisierte Vorgang der Rezeption im Spiele ist.
Doch was tut es eigentlich? Den Fallstricken der Dialektik sind schon bedeutendere Gestalten als Enzensberger erlegen. Sie haben dennoch mit dazu beigetragen, daß die Menschheit den beschwerlichen und gefahrenreichen Weg einer reflektierten Vernunft eingeschlagen hat und zunehmend in der Erkenntnis lebt, daß Fortschritt und Verharren einander bedingende, komplementäre Größen sind. Enzensberger kommt aus der Romantik. An unserem widersprüchlichen Verhältnis zu ihr werden auch wir ihn zu messen haben.
Hans Schwab-Felisch, aus Schriftsteller der Gegenwart. Dreiundfünfzig Porträts. Herausgegeben von Klaus Nonnenmann, Walter-Verlag, 1963
Tae-Ho Kang: Poesie als Kritik und Selbstkritik. Hans Magnus Enzensbergers negative Poetik, Dissertation März 2002
Kurt Oppens: Pessimistischer Deismus. Zur Dichtung Hans Magnus Enzensbergers, Merkur, Heft 186, August 1963
Hans Egon Holthusen: Chorführer der Neuen Aufklärung. Über den Lyriker Hans Magnus Enzensberger, Merkur, Heft 388, September 1980
Hugo Loetscher: hans magnus enzensberger
DU, Heft 3, 1961
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
H. M. E. BEIM WIEDERLESEN
Landnahme war es, hineingeboren,
Anmaßung, selbstverständlich.
Und als auch ich dem zwanzigsten Jahrhundert
entronnen, paarundfünfzig Prozent Wasser,
das losere Gewebe mit auf den Rutsch,
war Zeit schon nicht mehr die alte Fessel.
Wir haben uns überlebt als Kommentatoren,
einander Bekanntes mit Staunen zuwispernd,
in blühenden Wiesen der Rost unsrer Helme,
die tragen wir auf den bald kahlen Schädeln.
Dass ich mich angehörig wähnte
einer Generation, war damals ein Witz.
Uwe Kolbe
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Archiv +
Internet Archive + KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


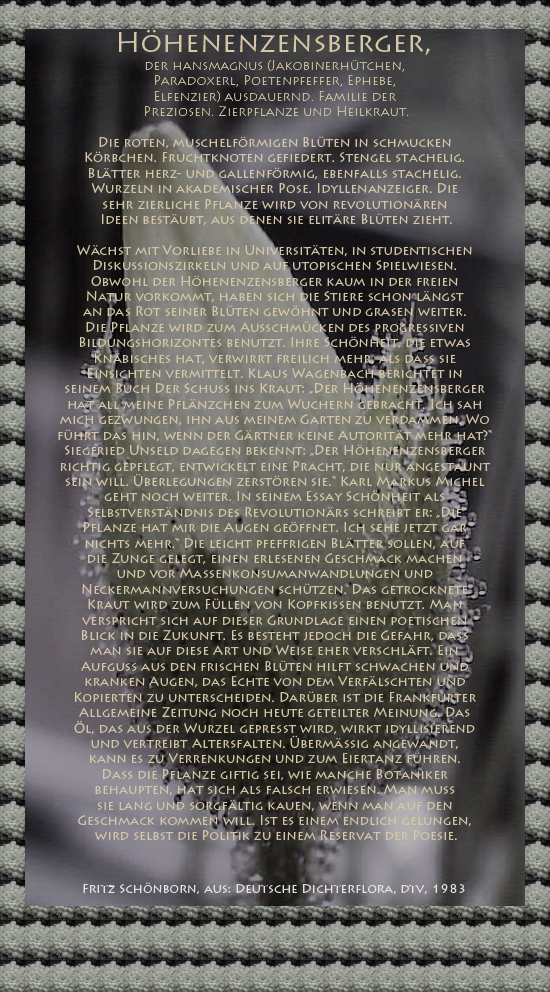
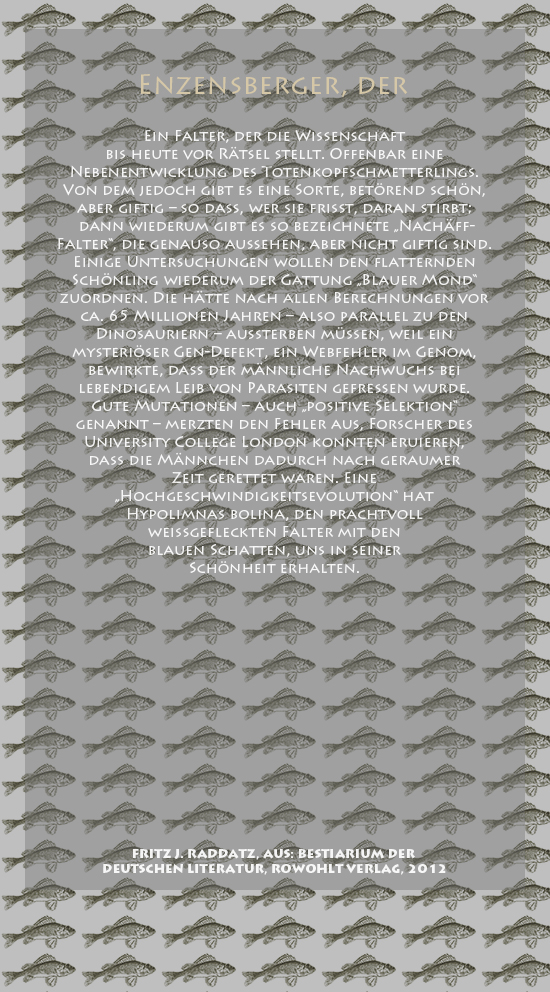












Schreibe einen Kommentar