Hans Magnus Enzensberger: Rebus
ZUR ERINNERUNG AN PROFESSOR KURZWEIL
(1926 – )
Kleiner Mann, Halbglatze, randlose Brille,
kariertes Jackett, immer gut aufgelegt.
Es gibt Momente, da ähneln wir ihm,
wenn er z.B. sagt:
„Ich möchte lieber nicht sterben“,
oder wenn er in die Tasten greift
und auf seinem wunderbaren Synthesizer spielt:
On the Sunny Side of the Street.
Aber dann, wenn er im Badezimmer
sein Ebenbild sieht,
wirkt er sehr unzufrieden.
Daß er ein Säugetier ist,
mißfällt ihm. Wozu das alles:
Verdauung, Hormone,
Zahnplomben! Dieser Körper:
als Betriebssystem unzulänglich!
Er weiß es besser. Eine neue Software,
und man kopiert sich
auf einen Memorystick.
Es ist eine Art digitaler Ewigkeit,
was ihm vorschwebt.
Nur die Löschtaste fehlt.
Falls er uns überleben sollte, geschrumpft
auf einen winzigen Prozessor:
Wir hätten nichts dagegen.
Inhalt
Als ein riesiges Rebus, das es zu entziffern gilt, versteht der Dichter seine Umgebung. Wovon aber handelt dieses Rebus? Nicht gerade einfach zu sagen: „De rebus quae geruntur“ umschrieben es die alten Lateiner in ihrer präzisen Sprache, auf gut deutsch:
Es handelt von dem, was eben geschieht.
Aber ein solches Rebus wäre nicht es selbst, wäre es eindeutig. „Dire en rébus“ definiert ein französisches Wörterbuch des 19. Jahrhunderts die Anwendung von Wortspiel und Wortwitz. Und so nähern sich denn auch diese Gedichte mit den Mitteln der uneigentlichen und mehrbödigen Rede dem monströsen Bilderrätsel der ‚Realität‘.
Mit den freundlichen, traurigen und bösen Gedichten von verteidigung der wölfe setzte Hans Magnus Enzensberger vor fünfzig Jahren eine entschiedene Zäsur in der bundesdeutschen Literatur. Wie damals schneiden seine Gedichte, so reflektiert wie unbedenklich, in den kalten Spiegel der Zeit, schonen weder Ich noch Du, sei es nun „Feind“ oder „Bruder“. Ein Bilderbogen aus Wörtern und Worten mit einer gesalzenen Coda, einem ebenso grimmigen wie gutgelaunten Gruß an „sie“ und „euch“ alle: an die falschen Freunde und die richtigen Feinde.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Doch geizige Götter gibt es nicht
– Er wird vielleicht am Ende noch gebraucht: In seinem neuen Gedichtband Rebus macht Hans Magnus Enzensberger Inventur und begreift die Wirklichkeit als Rätsel. –
Hans Magnus Enzensberger ist ein Kind der Kriegs- und Nachkriegszeit. Geboren 1929 (im November feiert er seinen achtzigsten Geburtstag), hat sich die karge Trümmerwelt der vierziger Jahre tief in seine Erinnerung gebrannt, wobei er in der Zerstörung die Chance auf den Neubeginn erkannte. Aufgewachsen im Ende 1944 schwer verheerten Nürnberg, der „Stadt der Reichsparteitage“, sieht Enzensberger die Diktatur, ihre Schranken und Zwänge im Bombenhagel untergehen; die mageren Schwarzmarktjahre erlebt er als Aufbruch; den materiellen Verheißungen des Wirtschaftswunders steht er hingegen, in seinen ersten epochalen Lyrikbänden ist es nachzulesen, distanziert bis angewidert gegenüber.
Man muss an diese Anfänge erinnern, weil man sonst dazu neigt, die Brüche und Widersprüche übermäßig zu betonen in dieser kurvenreichen, das Zickzack zum Programm erhebenden Biographie. Bei der Lektüre seiner neuesten Gedichte sieht man sich mitunter in die Zeit des Kahlschlags zurückversetzt:
Hier, in dieser Zelle,
bist du willkommen,
solange du zahlen kannst.
Da ist die Seife, der Stuhl,
das leere Bett, der offene Koffer,
das Röhrchen mit den Tabletten.
Die müde Kunst,
die dich pink angähnt,
ein Telefon, das nicht klingelt –
das ist alles.
Günter Eichs „Inventur“ gibt diesem „Holiday Inn Blues“ die Richtung vor.
Doch wo Eichs Bestandsaufnahme am Ende in den dichterischen Neuanfang führt, in die mühsame, aber unumgängliche Wiedererschaffung der Welt mit simpelstem Demiurgenwerkzeug („die Bleistiftmine“, „mein Notizbuch“), da denkt Enzensbergers lyrisches Du an Selbstmord „in der gelblichen Badewanne“, der allerdings „nicht höflich“ wäre:
Am Ende, wer weiß,
wirst du vielleicht noch gebraucht?
Das klingt alles andere als selbstgewiss, doch auch ein bisschen kokett. Das Alter zwingt zu einer peniblen Sichtung der Bestände, auch des eigenen Körperzustands („Das letzte Hemd“), doch sind Enzensbergers Temperament und Sprachwitz weit davon entfernt, vor den Mühen des Alters zu kapitulieren – in der Gewissheit, gebraucht zu werden unter anderem als lyrischer Stichwortgeber zur geistigen Situation der Zeit.
Vanitas-Motive gibt es im neuen Band viele. Die Ängste vor Demenz und Tod führen zu einer Reprise des Bilanztons der Nachkriegsjahre, allerdings ohne die (wie immer fragile) Zukunftsgewissheit der Kriegsheimkehrer von damals. Rückbau ist das Thema, Reduktion von Komplexität. „Wenn wir den Rückzug antreten / in die gekachelte Einsamkeit, / kehrt, was wir verloren haben, / wieder: Fassung, Konzentration, / Entspannung“, heißt es in einem Gedicht, das ganz dem Stuhlgang gewidmet ist („Wo sich Pilatus die Hände wusch“).
Solche Körperlichkeit ist ungewohnt beim Gedankenlyriker Enzensberger, wird aber schon deswegen nicht peinlich, weil auch solche Selbstbeobachtungen an Sprachreflexionen zurückgebunden werden. Einfachheit ist Trumpf. Wozu etwa „Transurane“, wenn es auch die „alten vier“ Elemente tun:
„Haben Sie Feuer?‘ – „Bitte sehr.“
Ein Glas Wasser, nur selten
wird es dir einer verweigern.
Luft schnappen, immer noch
ist es ohne Kreditkarte möglich,
und auch die Schaufel Erde
auf deinen Gebeinen, wenigstens
für dich ist sie gratis.
Nur Spott hat Enzensberger übrig für die digitalen Unsterblichkeitsvisionen eines Ray Kurzweil:
Falls er uns überleben sollte, geschrumpft
auf einen winzigen Prozessor:
Wir hätten nichts dagegen.
Rein virtuelles Vegetieren ist zuviel der Reduktion, besteht Leben doch überwiegend aus den „unscheinbaren Wiederholungen“, dem „Kochen, Waschen, Treppensteigen“, die unentbehrlich sind verglichen mit der Flüchtigkeit von „Meinungen“ und „Werken“. Auch das ist kokett, sicherlich, aber auch Resultat von Erfahrungen, die für Enzensberger stets als Korrektiv idealistischer Überhöhung dienen.
Das Leben bleibt ein Rätsel, das „Rebus“ des Titels, und noch mehr das Bewusstsein, zumal sich die verschwenderischen Götter, denen es „auf ein paar Milliarden Milchstraßen hin oder her“ gar nicht ankommt, um uns nicht scheren („Ohne Rücksicht auf Verluste“). Religiöse Themen klingen mehrfach an, jedoch mehr in der Form des Agnostizismus. Fest steht nur:
Geizige Götter gibt es nicht.
In „Unwahrscheinlich“ heißt es:
Da fragt man sich, ob wir jemals begreifen werden, wer oder was mit uns würfelt.
Dieses „wir“, die auffälligste lyrische Sprechweise Enzensbergers, umfasst hier das Menschheitsganze. Es gibt aber sogar einen Zyklus, der direkt „Erste Person Plural“ betitelt ist und dem Leser die größten Rätsel aufgibt.
Wer zu uns gehört und warum,
und wie viele wir sind:
ein gut gehütetes Geheimnis.
Wir wissen es selber nicht.
Ausdrücklich (und recht schulbuchhaft) werden auch in dem kurzen Prosastück „Selbstgespräche eines Verwirrten“ die Kategorien „wir“ und „die anderen“ ad absurdum geführt.
Wem aber gelten dann die zeit- und kulturkritischen Seitenhiebe dieser gar nicht altersmilden Texte?
Alle die Pendler da draußen,
hungrig in ihre weit entfernten
Premieren eilend, beneideten uns.
Oder:
Die Funkstreife hämmerte an die Tür,
aber sie wollte nur unsere Bärte kontrollieren.
Oder:
Wir aber, statt die Türen aufzubrechen,
nahmen das alles klaglos hin.
Oder:
Die meisten von uns waren beschäftigt
mit ihren Bandscheiben,
oder sie hatten ihre Geheimzahl vergessen.
Beispiele aus vier verschiedenen Gedichten, die sich vielfach vermehren ließen. Indem Enzensberger die Sprecher veruneindeutigt – seine Generation, die Bundesbürger, die Besserverdienenden? –, wird auch der Adressat der unterschwelligen Kritik diffus.
Was aber als Unverbindlichkeit erscheinen könnte, als Verweigerung, Ross und Reiter zu nennen, ist eine treffende Beschreibung einer politischen Gemengelage, in der Zuständigkeiten und Verantwortungen verwischt werden – bis hin zur Finanzkrise, in der man schließlich selbst eine Kollektivschuld auf der Kreditkarte wie ein schlechtes Gewissen herumträgt. Plötzlich sieht man, wie viel junge avancierte, sozial- und medienkritische Lyriker wie Daniel Falb oder Ron Winkler bei diesem Dichter gelernt haben – und dass seine Gedichte auch in ihrem Formanspruch immer noch auf der Höhe der Gegenwart sind, die man heute wieder ohne Ironie als Spätkapitalismus beschreiben darf.
„Nur die Niederlagen sind ohne Zweifel“, heißt es in dem Langgedicht „Coda“, das den Band beschließt und (soweit es dieser sphinxhaften Erscheinung möglich ist) sogar eine vorläufige Lebenssumme zieht. Enzensberger kommt uns auch heute nicht mit langweiligen oder dubiosen Gewissheiten, sondern mit bohrenden Fragen und einem mitreißenden Dennoch.
Richard Kämmerlings, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.4.2009
Jenseits der Erregungsbaustellen
– Er hat uns nun schon ein halbes Jahrhundert betört: mit seinem Esprit und seiner Heiterkeit und seiner Kunstfertigkeit als Impresario poetischer Schwebezustände. Einem Meister der gelassenen Weltbetrachtung wie Hans Magnus Enzensberger kann man gar nicht zürnen, auch wenn er in seinem Alterswerk doch erkennbar die Zügel schleifen lässt und sich in einer behaglichen Ironie einrichtet. –
In den vorangegangenen Gedichtbänden hatte sich bereits eine gewisse Selbstgefälligkeit angedeutet, gab es schon die Tendenz, brillante rhetorische Zauberkunststücke zum Gedicht aufzublähen und sich in einem gigantischen Pointen-Dropping über Weltverbesserer jedweder Couleur zu amüsieren.
Die „leichte“, die „mozartisch schwerelose Hand“, die der Enzensberger-Leser Alfred Andersch bereits 1957 dem Verfasser des Gedichtbands verteidigung der wölfe attestierte – sie ist auch im neuen Gedichtband Rebus federführend. Der bald 80-jährige Dichter, der bei seinen Auftritten noch immer mit intellektueller Gelenkigkeit zu überzeugen weiß, ist wie stets mit der sanften Dekonstruktion von Utopie und Pathos beschäftigt. In seinen neuen Gedichten „paddelt“ er wieder demonstrativ ungerührt an den neuesten Erregungsbaustellen der Gegenwart vorbei, um das unspektakuläre „Dazwischen“ aufzusuchen. In seinem boshaften Abgesang auf die „Gegenwartsnarren“ am Ende des Bands, einer etwas ausschweifenden „Coda“, präsentiert er sich wie gewohnt als den bescheidenen „Vorübergehenden“, der – so wörtlich – „beobachtet, was der Fall ist, / der nur redet … / und der kaum etwas ausrichtet“.
Diesen abgeklärten Ironiker, der die Welt lieber verschont anstatt ihr mit verbissenen Heilsbotschaften zuzusetzen, kennt man bereits aus den Gedichtbänden Zukunftsmusik, Kiosk oder zuletzt Die Geschichte der Wolken. Im neuen Band Rebus hat Enzensberger seine Reflexionseleganz nicht weiter verfeinert, sondern lebt von seinen eigenen Beständen, walzt die bekannten Denkbilder noch ein weiteres Mal aus. Seine lyrischen Hauptdarsteller sind Wiedergänger aus früheren Büchern. Da gibt es wie gewohnt die Repräsentanten der Normalität mit ihren unerfüllbaren Wünschen. Ich zitiere: „Der Nachtportier, ein alter Trotzkist“, „der glatzköpfige Kassierer…, / der sich den Kopf zerbricht / weil sein Sportauspuff rostet“ oder „Tante Olga im Altersheim“ – das sind die bekannten lyrischen Stellvertreter des Autors, manchmal aber auch nur Pappkameraden jener „Gewöhnlichkeit“, die dieser Dichter seit Jahrzehnten zu glossieren trachtet. Dabei macht es Enzensberger sich und seinen Lesern oft viel zu leicht. Er überlässt sich ohne größere Sprach- und Selbstzweifel dem Glanz seines Pointenfeuerwerks, das schnell abgefackelt ist.
Dennoch: Es gelingen ihm noch immer brillante Porträts und treffliche Gedankengedichte, wie das von den „schweren Koffern“, die funktionslos, ohne ihre früheren Besitzer, in einem Hinterhof zurückbleiben. Oder er schreibt wunderbar leichthändig ein Gedicht über die ewige Nicht-Identität mit sich selbst und über die Unerreichbarkeit des „Richtigen“. Zu den stärksten Texten in Rebus zählen die selbstironischen Meditationen über das Alter und die Vergänglichkeit . Hier ist Enzensberger auf der Höhe seiner Kunst der skeptischen Selbstbegrenzung.
Was einen beim Lesen verstimmt, ist die nicht geringe Zahl bloß kalauernder, auf billige Belustigung angelegter Gedichte, die sich mit dem nächstbesten Slapstick zufrieden geben. So etwa der sehr komödiantische Bericht über einen „Berliner Empfang“. Ich zitiere:
Der Innenminister kam an,
schwungvoll wie immer,
nur wir nahmen keine Notiz von ihm.
Die meisten von uns waren beschäftigt
mit ihren Bandscheiben,
oder sie hatten ihre Geheimzahl vergessen.
In dieser Manier verfallen Enzensbergers Gedichte einer bisweilen unkontrollierten Pointensucht, ganz so, als wäre hier ein lyrischer Humorist für ernüchterte Altlinke am Werk.
Als intellektuellen Komplizen hat der späte Enzensberger das Lachen rekrutiert – das Lachen über sich selbst , aber vor allem das Lachen über die Sinnsucher um ihn herum, die sich am Unabänderlichen abarbeiten. Dabei scheut er leider nicht das Geläufigkeitspalaver, das zwar gelegentlich Heiterkeits-Effekte generiert, aber vor lauter Begeisterung über die eigene Brillanz auf widerständige Fügungen verzichtet.
So etwa in der extrem boshaften Karikatur eines Landes im Sicherheitswahn. Ich zitiere das Gedicht „Die Sicherheitsmaßnahme“:
Die Funkstreife hämmerte an die Tür,
aber sie wollten nur unsere Bärte kontrollieren.
Wir kamen ungeschoren davon,
doch es war knapp.
Wir boten ihnen Tee und Kekse an.
Unsere Hündchen Belinda und Sarah,
haben sie trotzdem mitgenommen.
Sie waren unser ganzer Stolz.
Aber ihr Visum war abgelaufen.
Wir überlegten, ob es nicht irgendwo
eine Lichterkette gäbe,
die uns trösten könnte.
Ein Rebus ist ja ursprünglich ein vertracktes Bilder- oder Buchstaben-Rätsel. Das Problem von Enzensbergers Gedichten ist aber nicht ihr opakes Schimmern in Mehrdeutigkeiten, die der Titel des Bandes für sich beansprucht, sondern eine manchmal enttäuschende Rätsellosigkeit. Dabei wünschte man sich doch von diesem Autor genau jene grüblerische Anstrengung des Entzifferns der Welt, die ein Titel wie Rebus vorgibt.
Man kann sich prächtig amüsieren mit diesen Gedichten, in denen sich ein intellektueller Narziss über die Welt beugt und die Vergeblichkeiten unserer Heils-Suche persifliert. Aber man kann auch peinlich berührt sein über so viel eitle Koketterie.
Michael Braun, Deutschlandfunk, 16.5.2009
Erregungsbaustellen
– Dem stoischen Meister kann man nicht zürnen: In Rebus hat Enzensberger seine Reflexionseleganz nicht weiter verfeinert, eher lebt er von seinen eigenen Beständen, walzt die bekannten Pointen aus. –
Er hat uns nun schon ein halbes Jahrhundert betört: mit seinem Esprit und seiner Heiterkeit, mit seiner Hartnäckigkeit als Verteidiger der Normalität und als Impresario poetischer Schwebezustände. Einem stoischen Meister wie Hans Magnus Enzensberger kann man gar nicht zürnen, auch wenn er in seinem Alterswerk doch erkennbar die Zügel schleifen lässt, auf Selbstdisziplin verzichtet und sich in einer behaglichen Ironie einrichtet.
In den vorangegangenen Gedichtbänden hatte sich eine gewisse Selbstgefälligkeit bereits angedeutet, gab es eine Tendenz, brillante rhetorische Volten zum Gedicht aufzublähen und sich in einem gigantischen Pointen-Dropping über Weltverbesserer jedweder Couleur zu amüsieren.
Die „leichte, mozartisch schwerelose Hand“, die der Enzensberger-Leser Alfred Andersch 1957 dem Verfasser des Gedichtbands verteidigung der wölfe attestierte – sie ist auch im neuen Gedichtband Rebus federführend. Der bald 80-jährige Dichter, der bei seinen Auftritten noch immer mit (nicht nur) intellektueller Gelenkigkeit zu brillieren weiß, ist wie stets mit der sanften Dekonstruktion von Utopie und Pathos beschäftigt. In seinen neuen Gedichten „paddelt“ er wieder demonstrativ ungerührt an den neuesten Erregungs-Baustellen der Gegenwart vorbei – „vorbei an Bemühungen / um Renditen und Kopfpauschalen“ –, um das unspektakuläre „Dazwischen“ aufzusuchen.
In einem boshaften Abgesang auf die „Gegenwartsnarren“ (Botho Strauß) am Ende des Bands, der etwas ausschweifenden „Coda“, präsentiert er sich wie gewohnt als der bescheidene „Vorübergehende“, der „beobachtet, was der Fall ist, / der nur redet (de rebus quae geruntur), / und der kaum etwas ausrichtet“.
Diesen abgeklärten Ironiker, der die Welt lieber verschont anstatt ihr mit verbissenen Heilsbotschaften zuzusetzen, kennt man bereits aus den Bänden Zukunftsmusik (1991), Kiosk (1995) oder Die Geschichte der Wolken (2003). In Rebus hat Enzensberger seine Reflexionseleganz nicht weiter verfeinert, eher lebt er von seinen eigenen Beständen, walzt die bekannten Pointen noch ein weiteres Mal aus. Seine lyrischen Hauptdarsteller sind Wiedergänger aus früheren Büchern. „Der Nachtportier, ein alter Trotzkist“, „der glatzköpfige Kassierer, / der sich den Kopf zerbricht / weil sein Sportauspuff rostet“ oder „Tante Olga im Altersheim“ – das sind die lyrischen Stellvertreter, manchmal aber auch nur Pappkameraden jener „Gewöhnlichkeit“, die dieser Dichter seit Jahrzehnten zu glossieren trachtet. Dabei macht es Enzensberger sich und seine Lesern oft viel zu leicht. Er überlässt sich ohne größere Sprach- und Selbstzweifel dem Glanz seines Pointenfeuerwerks, das schnell abgefackelt ist.
Dennoch: Es gelingen ihm noch immer blendende Porträts und treffliche Denkbilder, wie das von den „schweren Koffern“, die funktionslos, ohne ihre früheren Besitzer, in einem Hinterhof zurückbleiben. Oder er schreibt wunderbar leichthändig ein Gedicht über die ewige Nicht-Identität mit sich selbst und die Unerreichbarkeit des „Richtigen“ („Stellvertreter“): „Keiner von uns ist der Richtige.“ Zu den stärksten Texten in Rebus zählen die selbstironischen Meditationen über das Alter und die Vergänglichkeit. Hier ist Enzensberger auf der Höhe seiner Kunst der skeptischen Selbstbegrenzung. Auch die schöne poetische Kasuistik über „die einen und die andern“ gehört in die Reihe der mehrdeutigen Wort- und Satz-Übungen.
Was verärgert, ist die nicht geringe Zahl bloß kalauernder, auf billige Belustigung angelegter Gedichte, die sich mit dem nächstbesten Slapstick zufrieden geben. Wie der komödiantische Bericht über einen „Berliner Empfang“:
Der Innenminister kam an,
schwungvoll wie immer,
nur wir nahmen keine Notiz von ihm.
Die meisten von uns waren beschäftigt
mit ihren Bandscheiben,
oder sie hatten ihre Geheimzahl vergessen.
So verfallen Enzensbergers Gedichte ihrer unkontrollierten Pointensucht, ganz so, als wäre hier ein Robert Gernhardt für ernüchterte Altlinke am Werk.
Als intellektuellen Komplizen hat der späte Enzensberger das Lachen rekrutiert – das Lachen über sich selbst, aber vor allem das Lachen über die Sinnsucher und Weltdeuter um ihn herum, die sich am Unabänderlichen abarbeiten. Dabei scheut er leider nicht das Geläufigkeits-Palaver, das zwar gelegentlich Heiterkeits-Effekte generiert, aber vor lauter Begeisterung über die eigene Brillanz auf widerständige Fügungen und Doppelbödigkeiten verzichtet. So etwa in der extrem boshaften Karikatur eines Landes im Sicherheitswahn:
Die Funkstreife hämmerte an die Tür,
aber sie wollten nur unsere Bärte kontrollieren.
Wir kamen ungeschoren davon,
doch es war knapp.
Wir boten ihnen Tee und Kekse an.
Unsere Hündchen Belinda und Sarah,
haben sie trotzdem mitgenommen.
Sie waren unser ganzer Stolz.
Aber ihr Visum war abgelaufen.
Wir überlegten, ob es nicht irgendwo
eine Lichterkette gäbe,
die uns trösten könnte.
Das Problem dieser Gedichte ist nicht ihr opakes Schimmern in Mehrdeutigkeiten, die der Titel des Bandes für sich beansprucht, sondern ihre Rätsellosigkeit.
Man kann sich prächtig amüsieren mit diesen Gedichten, in denen sich ein intellektueller Narziss über die Welt beugt und die Vergeblichkeiten unserer Heils-Suche persifliert. Oder man ist peinlich berührt über so viel eitle Koketterie.
Michael Braun, Frankfurter Rundschau, 11.5.2009
Hans Magnus Enzensbergers virtuos verspieltes Alterswerk
Hans Magnus Enzensberger steht für Lyrik der intelligenten Art. Seine Gedichte sind unpathetisch und nachdenklich im Ton, variantenreich und ohne Hang zum Kreuzreim in der Form. Das gilt umso mehr für seinen ausgesprochen gelungenen jüngsten Gedichtband Rebus, der gerade bei Suhrkamp erschienen ist.
Enzensberger wird am 11. November 80 Jahre alt. Rebus ist also ein Spätwerk, aber eines, das „reif“ zu nennen, ganz falsche Assoziationen wecken würde.
Seine Lyrik ist alles andere als in die Jahre gekommen. Das Spiel mit der Sprache beherrscht er wie eh und je. Manche Verse werden ganz ohne Absicht zum Aphorismus, wie bei der Frage, warum Bilder einen Rahmen haben:
Weil sie das, was sie abbilden, gar nicht fassen können.
Im selben Gedicht über die Jahreszeiten beweist Enzensberger, wie genau er beobachten kann: Der Sommer ist da, das Rieseln des Sandes zwischen den Zehen, verdutzte Kühe, krächzende Staumeldungen, das Aroma des Schattens unter der Palme. Beim Lesen läuft im Kopf ein Film ab, der den Dichter auf dem Weg in den Urlaub zeigt.
Andererseits reflektiert Enzensberger in Versform auf einem Niveau, das mancher Essay nicht erreicht: über das System, das an allem schuld sein soll zum Beispiel. Aber Enzensberger ist kein Intellektueller, der Gedichte nutzt, um auf bequeme Weise seine Gedanken loszuwerden. Er ist auch ein Sprachspieler voller ungewöhnlicher, manchmal skurriler Ideen. Der Spaß, den seine Lyrik macht, beruht auf solchen unerwarteten Pointen: Da kann ein Dichter seine eigenen Texte nicht mehr lesen und sucht nach seiner Brille, „sucht und sucht, doch stattdessen findet er einen Hirschkäfer (eine bedrohte Art) in der Schublade“. Im nächsten Vers preist ein Vertreter im Altersheim Schachuhren an, hat im Musterkoffer aber auch „Gebisse in allen Tönungen, von Schneeweiß bis Buttergelb“.
Dass Enzensberger auch ein Gedicht über die Arbeit von Archäologen geschrieben hat, ist gar nicht so verwunderlich. Sie graben in Tiefenschichten und suchen nach Spuren der Vergangenheit. Das macht der Autor auch. Gerade das Kapitel „Schwere Koffer“ ist voller solcher Expeditionen in die Vergangenheit. „Schwere Koffer“ ist auch der Titel eines Gedichts: Sie stehen im Hinterhof, zerfleddert, mit Schnüren zusammengehalten. Wer sie öffnet, kann darin nach den Zeiten stöbern, in denen ihr Leder geglänzt hat.
Oft erinnert sich Enzensberger an die eigene Kindheit: an die Bunker, in denen er nach der Schule Versteck gespielt hat, die verrottete Munition im Sand, die toten Zünder, den „blechernen Napf eines Arbeitssklaven“. Als der Zweite Weltkrieg begann, war der Autor neun Jahre alt. Sein Blick zurück wird nicht durch Nostalgie getrübt:
Nach Bratäpfeln hat es manchmal gerochen, da wo ich herkomme. Sonst gab es wenig zu essen. Und doch bin ich groß und stark geworden.
Ein Glück, nicht nur für Enzensberger selbst: Die deutsche Literatur verdankt ihm eine Reihe gelungener Gedichte. Rebus legt in dieser Hinsicht noch einmal nach.
Andreas Heimann, Berliner Literaturkritik, 30.4.2009
Doppelbödige Denk-Rätsel
– Der bekannte Lyriker und Essayist Hans Magnus Enzensberger gibt in seinem neuen Gedichtband Rebus schlitzohrige Denk-Rätsel auf. Auf diesem Wege wird die Realität in fünf thematischen Abschnitten doppelbödig gespiegelt. –
Rebusse haben Konjunktur. Ein Rebus ist eine Art Bilderrätsel, das in spielerischer Denk-Form mit der Realität hantiert. Man muss um mehrere Ecken denken, um den Sinn des Rätsels in die richtigen Worte zu fassen. Indem der Lyriker, Romancier, Essayist und Kinderbuchautor Hans Magnus Enzensberger seine Sammlung von Gedichten unter diesen Titel stellt, fordert er zu einem spannungsreichen Spiel auf. In den Überschriften der fünf Abteilungen werden die Themenbereiche angedeutet: „Gleichgewichtsstörung“, „Es gibt Probleme“, „Schwere Koffer“, „Erste Person Plural“ und „Coda“.
Enzensberger fragt ketzerisch und mit Hintersinn nach den verschwiegenen, unsichtbaren Zuständen menschlicher Existenz. Er spricht Tabus an und zweifelt an dem, was wir Erkenntnis oder Wissen nennen. Erweisen sich doch vor allem die Funktionen des menschlichen Körpers als reinstes Chemielabor. So führen bereits 100 Milligramm C12H18O dazu, dass die „intimen Habseligkeiten“ wie Bewusstsein, freier Wille und Vernunft abhanden kommen.
Überhaupt kommt Enzensberger zu ganz erstaunlichen poetischen Erträgen. So wird im Gedicht „Unter der Hirnschale“ das, was dort „tickt“ als ein „Ich“ registriert, das seine eigene Wirtschaft führt.
Nicht immer macht mein Gehirn,
was ich will. Missverständnisse,
Kräche bleiben nicht aus.
Wenn es dunkel wird,
versuche ich, es ganz einfach
abzuschalten. Vergebens.
Während philosophisch betrachtet, eine „vollkommene Leere“ von höchst spektakulärer Brisanz ist, sollte sie rein physisch besser vermieden werden.
Die vollkommene Leere
Ein erhabenes Ziel, gewiß,
nur meine Lunge
will nichts davon wissen.
Das lyrische Ich versucht sich angesichts der Tatsache, dass wir weniger im Griff haben, als wir meinen, in Gelassenheit zu üben. Doch es gelingt ihm nicht. Denn es denkt und dichtet unentwegt in seinem Kopf und zu viele Fragen drängen sich auf.
Wie oft musste Plato sich schnäuzen, der heilige Thomas von Aquin
seine Schuhe ausziehen,
Einstein sich die Zähne putzen, Kafka das Licht ein- und ausschalten
Schließlich fühlt sich das Ich in einen tragischen Widerspruch verstrickt: während der Körper sichtbar altert, scheint das Gehirn immer jünger zu werden. Das macht diese Gedichte zu einem Kraftpaket, in dem schlitzohrige und doppelbödige Sprach- also Denk-Rätsel zu entdecken sind. In diesem Paket, das von einem Rebellen verschnürt wurde, steckt reichlich Widerstandspotenzial.
Enzensberger führt mit eleganten Sprachgesten in Welten, die uns vertraut scheinen, aber durch den Filter der Poesie von Gewissheit und Selbstzufriedenheit befreit sind. Seine Gedichte bedeuten eine wohltuende Atempause, in der das Alltägliche und Selbstverständliche auf Distanz rückt. Denn „Gebenedeit/ sei die Nichtigkeit“ und Ich ist sowieso ein „anderer“.
Carola Wiemers, Deutschlandradio Kultur, 11.6.2009
Niemand weiß, was möglich ist
– Rebus – Hans Magnus Enzensberger nähert sich den Bilderrätseln der Welt mit menschenfreundlichen Gedichten, ohne deshalb ein freundlicher Dichter zu werden. –
Es ist keine drei Jahre her, da stellte Hans Magnus Enzensberger eine Auswahl seiner Lyrik aus über einem halben Jahrhundert unter dem nüchternen Titel Gedichte 1950–2005 zusammen. Eröffnet hat er die Sammlung mit einer Art fantastischem Preislied, das er schrieb, als er seinen zwanzigsten Geburtstag noch nicht lange hinter sich hatte. Es heißt „Utopia“ und feiert eine farbenfrohe Wunschwelt, in der Prokuristen „durch die Wolken radschlagen“, Päpste „aus den Dachluken zwitschern“ und das Glück „wie eine Meuterei“ ausbricht.
Ein vielsagender Beginn. Politische Utopien sind mittlerweile stark im öffentlichen Kurs gesunken, und Versuche, sie Realität werden zu lassen, stehen gemeinhin im Ruf robespierrehafter Zwangsbeglückung. Allerdings konnte man in diesem Auftakt zu der von Enzensberger selbst gezogenen lyrischer Lebenssumme eben auch so etwas sehen wie die Erinnerung des gereiften Dichters an den Überschwang jener frühen Jahre, in denen er als beobachtender Animateur der Studentenbewegung das Kommandowort „Revolution“ großzügig unter seinen Zuhörern austeilte.
Doch diese Zeit des Überschwangs ist lange her. Auch für Enzensberger. Nach dem Ende der Studentenbewegung hat er so entschieden und klar wie kein anderer deutscher Schriftsteller am Imageverlust der Utopien und anderer großer politischer Erzählungen mitgewirkt. Ein Jahrzehnt nach 1968 konstatierte er knapp, was sich linke wie rechte Revolutionäre hinter die Ohren schreiben sollten, nämlich dass „wir die Gesetze der Geschichte nicht kennen“, dass deshalb der Verlauf der Geschichte „unvorhersehbar ist“ und dass wir, „wenn wir politisch handeln, nie das erreichen, was wir uns vorgesetzt haben, sondern etwas ganz anderes, das wir uns nicht einmal vorzustellen vermögen“.
Folgerichtig hat Enzensberger bis heute für große Weltveränderungsentwürfe außer Hohn wenig übrig und plädiert ebenso scharfsinnig wie scharfzüngig für eine Politik des Sichdurchwurschtelns, des pragmatischen Flickwerks und der Improvisation.
Daran ändert sich in seinem neuen Lyrikband Rebus wenig. Auch hier stimmt er sein Loblied an nicht auf allumfassende Konzepte oder allumstürzende Ideen, sondern auf die zahllosen tagtäglichen Anstrengungen, die das Leben lebbar machen, auf das fortgesetzte mühsame Stückwerk der Humanität.
So etwas kann Enzensberger wie kein anderer: Die Leichthändigkeit und zugleich der Ernst, mit denen er hier – zwei, drei Striche genügen ihm – Situationen und Schicksale skizziert, dazu ein Empfinden für die Riesenhaftigkeit weltweiten Elends weckt und das Argument anklingen lässt, dass die Selbstorganisation des Nächstliegenden allemal jeder staatlichen Verordnung fürs Große und Ganze vorzuziehen sei. In seinem geräumigen Dichterherzen ist auch heute, kurz vor dem achtzigsten Geburtstag, noch immer eine Kammer für anarchistische Leidenschaften reserviert.
All den Hymnen, die derzeit angesichts der Finanzkrise auf den Staat als Retter und Aufseher angestimmt werden, hält er seine Warnung vorm „Leviathan“ (wie er mit Thomas Hobbes den Staat nennt) entgegen, vor „unserem riesigen Mitesser“, der „als Massenmörder unübertroffen“ ist und den wir trotz allem nie loswerden:
Für uns spricht es nicht, daß wir ihn nötig haben, diesen ewigen Langweiler.
Enzensbergers Tonfall ist bei all dem merklich gelassener geworden. In jüngeren Jahren war das Wort „schneidend“ eine seiner Lieblingsvokabeln, wenn es darum ging, die Sprache eines von ihm bewunderten Autors zu beschreiben. Und wer auf den Gedanken verfiel, diesen Begriff auf Enzensbergers Gedichte oder Essays anwandte, hatte mit seinem Groll nicht zu rechnen. Er schliff seine Sätze, bis sie den Gedanken eine ebenso elegante wie messerscharfe Kontur gaben, und seine Verse, bis sie Erfahrung so eindrucksvoll wie zugespitzt auf den Punkt brachten. Das ist bis heute der unverwechselbare Enzensberger-Sound. Zum Beispiel wenn er als Verteidiger der Wölfe den Lämmern vorhält:
Gelobt sein die Räuber: ihr,
einladend zur Vergewaltigung,
werft euch aufs faule Bett
des Gehorsams. Winselnd noch
lügt ihr. Zerrissen
wollt ihr werden. Ihr
ändert die Welt nicht.
Wer als Leser nicht flink genug war auf den Beinen, konnte von diesem pointenblitzenden, bendenden Sichelwagen der Lyrik schnell überrollt werden.
Verglichen damit klingen Enzensbergers Gedichte heute ruhiger, gefasster. Aber es wäre nicht nur ungerecht, sondern schlicht falsch, deshalb von Altersmilde oder Resignation zu sprechen. Auch ein Ausdruck wie Abgeklärtheit beschreibt ihre Tonlage nur dann richtig, wenn man darunter ein zunehmendes Klarwerden dieses Autors über die eigene Aufgeklärtheit versteht: „Du willst es ja nicht anders haben“, ruft er sich zu, „gib’s doch zu! Du brauchst, / woran du krankst, den Spaß, / die Angst, den Haß und deine Ruh, / die Frau, das Geld, den Streß.“
Mit anderen Worten: Enzensbergers neuer Lyrikband hat, zumal in seinem ersten Zyklus „Gleichgewichtsstörung“, eine demonstrative Neigung zur Selbstreflexion. Der Dichter betrachtet sich hier als Rätsel. Aber er richtet sich deshalb nicht ein in den zähen Grabenkämpfen der Innerlichkeit, sondern nimmt sich vielmehr bissig an die Kandare:
Psyche, Ego, Identität –
ziemlich fremde Worte.
Je mehr du herumbohrst
in diesem Sumpf,
desto sinnloser.
Ja, er macht sich lustig über die eigene Psyche:
Sie ist ja so sensibel, die Ärmste.
…
Schon ist sie gekränkt,
beklagt sich, droht mit Migräne.
…
Unzertrennlich sind wir,
bis daß der Tod uns scheide,
meine Psyche und mich.
Wenn Enzensberger, wie hier, Gedanken an den Tod häufiger nicht nur durchschimmern lässt, sondern sehr direkt anspricht, ist das bei den Gedichten eines bald Achtzigjährigen nicht weiter verwunderlich. Bemerkenswert ist jedoch die Vogelperspektive, aus der er dabei nicht selten den Blick auf sich selbst richtet. Fast scheint es so, als würden verschiedene Haltungen durchprobiert, in denen dem eigenen Ableben entgegengetreten werden kann, um nach der persönlich angemessenen Ausschau zu halten.
Doch zurück zum eingangs angesprochenen Verhältnis zur Utopie: Denn zur Selbstreflexion des Zweiflers und Spötters Enzensberger gehört, dass er auch zweifelt am Prinzip des Zweifels und das Prinzip des Spottes verspottet. Und ebenso reizt auch die eigene Skepsis gegenüber den politischen Utopien ihrerseits seine Skepsis. Wie schon in seinem Essay „Vermutungen über die Turbulenz“ fragt er danach, ob nicht gerade in der Unvorhersagbarkeit der Zukunft, in der unberechenbaren Vielfalt der Möglichkeiten eine überraschende Chance liegen könne? Sicher, der Turmbau zu Babel, jenes Urbild einer Utopie, ist gescheitert, aber „daß wir seither / nicht alle dasselbe reden, in einerlei Zunge, / hat auch sein Gutes. Mißverständnisse, Krach, / ja, das ist mühsam, doch sagen am Ende nicht / fünftausend Sprachen mehr als die eine?“
Der neue Band endet mit einem Langgedicht mit dem Titel „Coda“, das den Klang eines Resümees, ja eines vermächtnishaften Fazits annimmt. Immer wieder umkreist Enzensberger hier die Frage nach dem, was möglich, was erreichbar ist. Man darf das durchaus politisch verstehen. „Alles Mögliche – niemand weiß, was das ist.“ Damit beginnt dieses Gedicht, und auch das redet keinen ideologischen Großprojekten das Wort. Es schwärmt vielmehr von jenem Glück, das in der Abwesenheit des vermeidbaren Elends besteht, vom Glück des geheizten Zimmer, des klaren, sauberen Wassers und lobt fast wie Brecht die schlichte Freude an der Kastanie im Hof oder am Geruch eines Sommerregens.
An solchem bescheidenen Luxus aber kann sich, ungetrübt von tagtäglicher Not, nur ein kleiner Teil der Menschheit erfreuen:
Daß nicht alles Mögliche möglich ist,
tut mir leid. Ihr tut mir leid,
liebe Genossen.
Doch, muss man sich damit abfinden?
Moment mal, sagt das Gehirn,
ungläubig wie es ist, maybe sagt es,
…
noch ist das Spiel nicht zu Ende.
Totzukriegen ist das Mögliche nie.
Mit politischer Agitation hat das nichts zu tun, wohl aber damit, die Idee der politischen Utopie nicht verloren zu geben, sie weiterhin als Aufgabe, ja als Auftrag zu betrachten und ihr so einen Platz frei zu halten – denn niemand weiß, was das Mögliche ist. Hier reicht der fast achtzigjährige Hans Magnus Enzensberger dem Nachwuchslyriker gleichen Namens, der „Utopia“ schrieb, über sechs Lebensjahrzehnte hinweg die Hand.
Beeindruckend ist die Sicherheit, mit der Enzensberger nach wie vor seine literarischen Mittel handhabt. Auch in diesem Band bleibt er dem reimlosen, freirhythmischen Gedicht fast durchgehend treu. Formale Experimente sind seine Sache nicht. Lieber bündelt er seine Gedichte zu Zyklen, die durch die zahllosen Anspielungen, Parallelen, Kontraste, Widersprüche der einzelnen Texte untereinander zu einem schillernden, schwer festlegbaren Ganzen werden. Enzensbergers Sprache bleibt bei all dem leicht und schwingend, klar und doch konzentriert. Er ist ein Meister des einfachen und doch doppelbödigen Vokabulars. Die Bedeutungsnuancen, die er in seinem Abschlussgedicht „Coda“ der Rede vom „Möglichen“ abgewinnt und der Notwendigkeit etwas „auszurichten“, dürfte noch manche literaturwissenschaftliche Interpretationsdebatte befeuern.
Aus all dem spricht eine menschenfreundliche Haltung, aber Enzensberger ist deshalb noch lange kein freundlicher Dichter. Trotz seines nicht mehr schneidenden, sondern inzwischen gelasseneren Tonfalls, trotz seines Plädoyers für das Stückwerk der Humanität und für bescheidene Vorstellungen vom Glück ist Enzensberger nicht zur Mutter Theresa der Gegenwartslyrik geworden. Er beherrscht und bevorzugt nach wie vor auch die schroffen Gesten. „Euch zu beichten – kommt nicht in Fragen“, teilt er uns mit und:
Nein, ich lasse mich nicht provozieren,
ich rege mich, verdammt noch mal,
nicht mehr auf über euch,
denn ihr könnt mich mal.
Klare Worte. Doch selbst die sind nicht Enzensbergers letztes Wort, denn selbst in ihnen schwingt noch ein Gutteil Ironie mit. Denn gerade in diesem Band gewährt er, auch wenn er tatsächlich nie in den Ton einer Beichte verfällt, den Lesern einige für seine Verhältnisse ungewöhnlich intime Einblicke. In manchen Gedichten spricht er nahezu ungeschützt und deshalb umso anrührender von seinen Depressionen, seiner Todesangst und Todeslust. Vom „schneidenden“ Enzensberger der frühen Jahre ist hier fast nichts mehr zu spüren, statt dessen von einer Verletzlichkeit, die er zuvor kaum je erkennen ließ.
Uwe Wittstock, Die Welt, 18.4.2009
Glück der Leichtigkeit
– In seinem neuen Gedichtband Rebus lässt Hans Magnus Enzensberger die Bilderrätsel seines Lebens vorbeiziehen. –
Für seine große lyrische Lebensbesichtigung hätte er keinen passenderen Titel wählen können als diesen: Rebus. Hans Magnus Enzensberger, der wohl bedeutendste und einmischungsfreudigste Dichter der Nachkriegszeit, nebenbei ein Mathematik-Fan, liebt die Rätsel, die ihm der Alltag und die Philosophie und die Biologie zuspielen.
Mit Sicherheit ist er der flexibelste Intellektuelle des ominösen 1929er Jahrgangs, des letzten Aufgebots im Untergang. Mit knapp achtzig versprüht er immer noch Jungenhaftigkeit, Staunensfähigkeit, und er strahlt ein manchmal hinterhältiges Lächeln aus darüber, dass er sich den Truppen der ideologischen Ausdeuter entziehen konnte.
„Rebus“ also, ein Bilderrätsel: Schon im Umschlag materialisiert sich die Lust an der Mehrdeutigkeit. Das Cover sieht aus wie psychedelisches Geschenkpapier, farbenfroh, ornamental, schön – und ist eine poetische Irreführung, denn auf der letzten Seite erfährt man, dass dieses Bild aus der Histologie stammt: Es ist die Aufnahme einer Großhirnrinde.
Viele Gedichte sind derart zerebrale Untersuchungen, Selbstbeobachtungen eines Künstlers – wir schauen dem Kopfarbeiter Enzensberger dabei zu, wie er versucht, das Rätsel Enzensberger zu lösen.
Was da unaufhörlich tickt
und feuert, das soll ich sein?
Genauso unbeeindruckt auch das Gedicht „Salomonisch“:
Psyche, Ego, Identität –
ziemlich fremde Wörter.
Je mehr du herumbohrst
in diesem Sumpf,
desto sinnloser.
Oder auch, sarkastischer:
Sie ist ja so sensibel, die Ärmste…
meine Psyche und ich.
Enzensberger hasst es, sich allzu ernst zu nehmen, und wenn er andere dabei beobachtet, wie sie es tun („Der Berliner Empfang“), ist er überaus komisch. Es ist der lässige, abgeklärte Enzensberger-Sound, der die Kämpfe hinter sich weiß.
Ein weiter Bogen spannt sich in diesen Gedichten – von den Schrecken der Vernichtung und den Nachkriegsspielen der Jugendlichen in verlassenen Bunkern über die Kämpfe der sechziger Jahre, deren polemischer Wortführer er war mit seinen durchaus so gemeinten Kursbüchern, bis hin schließlich zum enzyklopädischen Gelehrten, der sich selbst ironisch als „Stubenhocker“ beschreibt und aus dem Fenster Schlittschuhläufern zuschaut.
Er verkündet, ausgerechnet er, der Debattenführer, das Glück der Leichtigkeit, das Lob der Mitte, etwa in dem Gedicht „Fahrwasser“:
Alles, was wichtig ist,
zieht am Ufer vorbei –
Oberlandesgerichte, Tankstellen,
Mehrzweckhallen.
Dieser da paddelt weiter, ist –
hosianna –,
da, wo nichts los ist,
dazwischen.
Sicher, die alten Grabenkämpfe flackern noch ab und zu über dem Horizont auf. Als es um „wir“ und „ihr“ ging, um das „System“:
Wir hatten keine Ahnung,
waren viel zu dumm,
um es zu verstehen,
und viel zu intelligent,
um ihm zu entkommen.
Das nannte man Dialektik.
Doch jetzt ist es ein großes Loslassen – um die Beobachtungen des nagenden Zerfalls herum und um die letzten Fragen, ein Stoßgebet, ein „heimliches“ womöglich kurz vor dem „Scherbengericht“. Das Haar, „ein tierisches Andenken, / das wächst und wächst, unaufhaltsam, auch dann noch, wenn das Gehirn / sich schon lange verabschiedet hat.“ Oder „Das letzte Hemd“:
Zuerst franst der Kragen aus,
dann die Manschetten. Hör auf,
an diesem losen Faden zu ziehen!
Es ist nicht so, dass Enzensberger völlig ausgesöhnt wäre mit dieser Welt. In seiner Leserbeschimpfung „Coda“, die auch die Selbstbeschimpfung eines Intellektuellen in der Komfortzone ist, heißt es:
Nur manchmal, nachts, holt die alte Wut
mich ein, hinterrücks
…
Selbstverständlich: der Kampf geht weiter.
Ich meine das nicht politisch,
ich meine nur diesen kleinen Kerl da,
der das, was ihr zerfetzt habt,
beharrlich zusammenflickt…
Rebus ist ein Geflecht aus Träumen und Argumenten, aus Erinnerungen an Reisen und Hotelzimmer und Töne. An den Glaser mit dem Kitt an den Fingern, an einen alten Koffer in einem Schuppen, zu dem Spuren führen im Schnee.
Statt der großen Weltgebäude nun die kleinen Routineverrichtungen:
Wie oft mußte Plato sich schneuzen,
der heilige Thomas von Aquin
seine Schuhe ausziehen
…
Wie flüchtig sind unsere Meinungen
und unsere Werke, verglichen mit dem,
was wir miteinander teilen:
Kochen, Waschen, Treppensteigen –
unscheinbare Wiederholungen,
die friedlich sind, gewöhnlich
und unentbehrlicher als jedes chef d’oeuvre.
Gleich zum Auftakt lenkt Enzensberger den Blick auf den Reichtum, den wir „verwöhnten Geschöpfe“ umsonst genießen. Er evoziert die Sensationen der Jahreszeiten, die Wasserfarben des Himmels, kalkige glühende Farben, das Glück der Überfülle.
Warum haben so viele Bilder einen Rahmen? Weil sie das, was sie abbilden, gar nicht fassen können.
Der Schnee zum Beispiel, die vielen Tüpfel. Die Wolken – „schon sind sie weitergewandert“. Der Wind – unsichtbar. Man kann den Frühling hören im Flattern der Wildgänse, den Sommer spüren im Rieseln des Sandes, den Herbst schnuppern im beizenden Rauch der Kartoffelfeuer.
Alle Jahreszeiten zugleich, wer weiß, wie viele es sind, ziehen vorbei unter geschlossenen Lidern.
Das ist Enzensberger als Lyriker, der mit Meisterschaft sein Instrument vorführt.
Matthias Matussek, Der Spiegel, 4.5.2009
Gepanzerte Gelassenheit
– Gar nicht rätselhaft: Hans Magnus Enzensbergers neuer Gedichtband Rebus. –
„Eiserne Gutmütigkeit!“ oder auch, an einer anderen Stelle in Hans Magnus Enzensbergers neuem Gedichtband Rebus: „gußeiserne Gutmütigkeit“. Die schöne Wortfügung taucht in den letzten Jahren bei Enzensberger immer wieder einmal auf; als hätte sich da im lyrischen oder biographischen Ich eine bestimmte Haltung gefestigt, von der man die Welt nicht ungern in Kenntnis setzt. Wenn Gutmütigkeit „eisern“ ist oder geworden ist, dann erscheint sie weniger als eine Frage des Naturells als der Disziplin.
Und als disziplinierte kann natürlich die Gutmütigkeit so gut gar nicht sein, wie sie es als eine Eigenschaft des Charakters wäre. Die eiserne Gutmütigkeit, die uns Enzensberger in letzter Zeit gern suggeriert, ist, wie könnte es anders sein, weder eisern noch gutmütig. Eher könnte man sagen, dass hier jemand spricht, der sich von nichts und niemandem mehr aus der Gelassenheits-Reserve bringen lässt, nicht einmal von sich selbst. Solche Gedichte, in denen der aufgeregten Welt der Meinungen und Kämpfe noch einmal ostentativ der Rücken gekehrt wird, muss man sich leisten können.
Sie müssen, um nicht bloß als Null- oder Leermeldungen dazustehen, sich abheben von den Aufgeregtheiten der anderen respektive von den eigenen Aufgeregtheiten zu einer anderen Zeit. Was Enzensberger angeht, so war er zwar Jahrzehnte lang meinungsbildend (ein „early adopter“ dessen, was andere ge- und erfunden hatten), aber dabei niemals aufgeregt. Insofern heben sich seine neuen Gedichte in ihrem Unaufgeregtheitston weniger vom früheren, auch schon aufreizend entspannten Enzensberger als von denen ab, die sich noch immer aufregen können und wollen, zum Beispiel über „1968“.
„Envoi“ heißt ein repräsentatives Gedicht dieses Bandes, eine typische Abregungs-Etüde.
Ja, damals in der guten alten Zeit
sind einige von uns unangenehm aufgefallen.
Nicht immer haben wir uns beherrschen können.
Da wo wir waren, gefiel es uns selten.
Und am Ende von vier mal vier Zeilen dann die folgende Konklusio zum Thema „Nachwelt“:
Dann waren wir auf einmal verschwunden:
Kein Anschluß unter dieser Nummer.
Jeder von uns hinterließ der Nachwelt
ein paar alte Rechnungen und eine Zahnbürste.
Die Leidenschaften und Anstrengungen sind zur Ruhe gekommen, auch die, so scheint es (auch wenn sich die Platitüde aufdrängt, diese Gedichte seien von „virtuoser Einfachheit“), die der Kunst: nein, diese Gedichte sind nicht virtuos einfach, sie sind nur einfach. Sie sind nicht scheinbar banal, sondern hin und wieder nur banal. Ein Gedicht wie „Bringschulden“, in dem ein bisschen die Verbvalenz und Idiomatik von „bringen“ durchgespielt wird, kann man sich wirklich nur leisten, wenn man Enzensberger heißt.
Es muss schon etwas anderes und Schwereres in der Waagschale liegen, damit die koketten Nichtig- und Luftigkeiten dieser Lyrik einigermaßen bekömmlich bleiben.
Wie flüchtig sind unsere Meinungen
und unsere Werke, verglichen mit dem
was wir miteinander teilen:
Kochen, Waschen, Treppensteigen.
Wie wahr, aber wieso dann doch immer neue Werke? Wir seien alle „Stellvertreter“, gibt ein anderes Gedicht zu bedenken:
Auch dieses Gedicht steht natürlich
nur an der Stelle des richtigen
das noch auf sich warten lässt.
Wie wahr, aber müsste man nicht vielleicht auf der möglicherweise erfolglosen Suche nach dem richtigen Gedicht noch einmal richtig arbeiten? Man könnte zum Beispiel auch einmal mit einem Konzept wie dem titelgebenden „Rebus“ richtig Ernst machen. Ein Rebus ist bekanntlich ein Bilderrätsel, aber in diesen Gedichten gibt es, was man nicht nur beklagen muss, gar keine Rätsel.
Als man schon fast die Hoffnung aufgegeben hat, in diesem Band etwas zu finden, das über das Lob des Treppensteigens hinausgeht, langt man bei einer fast zehnseitigen „Coda“ an, die einen dann doch wieder etwas versöhnlicher stimmt. Hier darf man doch noch einem Ich begegnen, das etwas in sich herumträgt, das überhaupt an etwas trägt und also mit seinem Gepäck doch geringfügig schwerer ist als Luft.
Die „Coda“ ist eine Art Selbstgespräch über ein Motiv namens „Alles Mögliche“. Man müsste, sagt sich der Sprecher, jenseits von Gelassenheit und Ironie schon noch einmal etwas tun. Sogar die „alte Wut“ ist nicht ganz vorbei. „Manchmal, nachts“ holt sie „mich ein/ hinterrücks. Wie früher hat sie / gewöhnlich recht. Aber merkt sie nicht / daß es keinen Zweck hat, daß sie stört, / daß ich sie nicht haben will? Sie weiß doch, / daß alles, was menschenmöglich ist, womöglich nicht reichen wird, um uns zu retten?“ Gibt es womöglich doch einen lyrischen und Lebens-Zustand nach der „eisernen Gutmütigkeit“? „Ich bleibe dabei / vorläufig wenigstens“, vermelden die letzten Zeilen. Das „vorläufig“ lässt hoffen.
Christoph Bartmann, Süddeutsche Zeitung, 16.7.2009
Rebus
– Elfter Lyrikband von Hans Magnus Enzensberger. –
Schon sein erster Gedichtband erregte großes Aufsehen. Der 1957 erschienene Band machte den damals 28-Jährigen schlagartig bekannt. Heuer ist der insgesamt elfte Lyrikband des Dichters erschienen: Rebus. Am 11. November 2009 feiert er seinen 80. Geburtstag.
Das längste Gedicht steht am Ende. „Coda“ nennt Hans Magnus Enzensberger diesen zehnseitigen Text, der seinen neuen Gedichtband beschließt. Er handelt von Wut, Glück und Hohn, vom schlechten Gedächtnis und vom Gewissen, das „eine schöne Erfindung der Juden“ ist, von „eiserner Gutmütigkeit“ und vom Kampf, der weitergeht, von den „tristen Verlierern“ und den „noch viel tristeren Siegern“, von allem, was möglich wäre, und allem Möglichen, das unmöglich ist.
„Ich bin nur ein Vorübergehender, / der vorübergehend beobachtet, was der Fall ist“, bilanziert das lyrische Ich, ein Vorübergehender, „der nur redet (…) / und der kaum etwas ausrichtet.“ Und in Klammern dazwischengeschoben die lateinische Sentenz „de rebus quae geruntur“ – „von Sachen, die sich ereignen“. Rebus – so ist denn auch der Titel dieses Bandes, mit Gedichten der Rückschau, der Selbstbetrachtung, der erinnerten Ereignisse.
„Dieses Rebus, viele Leute kennen das gar nicht mehr, das ist ein Buchstaben- und Bilderspiel“, erklärt Enzensberger. „Dem entspricht das Schreiben auf der einen Seite, die Metaphorik auf der anderen.“
Rebus versammelt knappe, lapidare, selbstironische Betrachtungen des bald 80-jährigen Dichters, der sich hier keineswegs in Altersmilde und aphoristischen Lebensweisheiten gefällt – wenn er auch gelegentlich ins leicht Kokette driftet: „Jeder von uns hinterließ der Nachwelt / ein paar alte Rechnungen und eine Zahnbürste“ heißt es in dem resümierenden Gedicht „Envoi“.
Rebus, das sind kurze, saloppe, spielerisch-leichtflüssige Gedichte des Übergangs und des Vorübergehens, der Reminiszenzen und Reflexionen, die keineswegs nur dem Rätsel der Sprache gewidmet sind, dem Bildhaft-Uneindeutigen des dichterischen Ausdrucks, sondern auch dem Rätsel der Existenz, dem Rätsel der Erkenntnis. Ob wir „jemals begreifen werden, / wer oder was mit uns würfelt“, wird in einem Gedicht gefragt. Es trägt den Titel „Unwahrscheinlich“.
Rebus präsentiert Altersgedichte – ohne Alterslarmoyanz. Von Herzbeschwerden ist die Rede, von „gastritischer Krise“, von Medikamenten, vom Dichter, der schon wieder die Brille verloren hat. „Die meisten von uns waren beschäftigt mit ihren Bandscheiben oder sie hatten ihre Geheimzahl vergessen“, heißt es in einem Gedicht. Doch von Bitterkeit, Verzweiflung oder Melancholie keine Spur. „Glück gehabt“, wird konstatiert. „Es hätte schlimmer kommen können.“
„Mag ja auch daran liegen, dass man Leute kennt, denen es schlechter geht als einem selbst“, meint Enzensberger. „Das ist auch ein Stück Empathie.“
Im Rückblick relativieren sich die Leistungen, wächst auch die Skepsis gegenüber jenen, die geistige Führerschaft beanspruchen. In dem Gedicht mit dem Titel „Angewohnheiten“ werden „unseren Werken“ und „unseren Meinungen“ Tätigkeiten wie „Kochen, Waschen, Treppensteigen“ gegenübergestellt – unscheinbaren Wiederholungen, die, wie es heißt, „friedlich sind, gewöhnlich / und unentbehrlicher als jedes chef d’oeuvre“. In einem anderen wird das Verblasene eines Philosophen, das Hochtönende eines Dichters, das Apodiktische eines Politikers gekontert durch die trockenen Einlassungen einer Tante Cäcilie.
„Jeder Mensch hat ja wahrscheinlich auch eine Tante und eine Großmutter“, so Enzensberger. „Und diese Sätze von der Großmutter, die sind ja banal, die kennt ja jeder, die reißen einem nicht vom Stuhl. Aber es ist ja meistens etwas dran, an dem, was die Tante sagt. Ich will das eine gar nicht gegen das andere ausspielen. Man braucht ja beides.“
Enzensberger hat seinen Band in vier Abschnitte eingeteilt. „Gleichgewichtsstörungen“ heißt der erste. Von den Jahreszeiten ist hier die Rede und von den vier Elementen, von Aussetzern des Gehirns und körperlichen Insuffizienzen, von der Psyche, „dieser ewigen Nörglerin“, und dem „blendenden Schmerz“, von Hotelzimmern, Herzflimmern und Erfahrungen des „zu spät“, von Missverständnissen und Krächen… Das Leben ist eine Rutschbahn, der Körper eine Baustelle, das Dasein ein Rätsel.
„Es gibt Probleme“ ist der Titel des zweiten Abschnitts, der von Sprachenvielfalt und verschwenderischer Schöpfung spricht, von Unglauben und Unglaublichem, von „putzmunteren Versagern“ und dem Gewinsel der Ratsuchenden, von der ewigen Wiederkehr der Niederlagen, Peinlichkeiten, Schocks.
„Schwere Koffer“ schließlich heißt der dritte Teil – über Scherben, Spuren und Relikte der Vergangenheit: den heruntergekommenen Spielplatz der Jugend, den „schwarzen Schrank meiner Kindheit“, die alten Koffer im Hinterhof.
Das „wahre Leben“, das woanders stattfindet, das Warten, das Reisen und das Unterwegssein, das Zustandegebrachte und das Hinterlassene: Das sind Themen des letzten und längsten Teils. Aber auch das Problem der Zugehörigkeit, des Ich-selber-Seins, der Einteilung in „die Einen“ und „die Anderen“. „Erste Person Plural“ lautet die Überschrift.
„Dieses Personalpronomen ,Wir‘ ist ja höchst mehrdeutig“, sagt Enzensberger.
Es gibt ein ausschließendes Wir und es gibt ein einschließendes Wir… Wer gehört dazu, und wer gehört nicht dazu? Ob das jetzt um Nationen, Gesellschaftsschichten, Klassen und so weiter geht.
„Am liebsten wäre ich ich selber, aber das ist leider unmöglich.“ Mit dieser Erkenntnis schließt ein in die Gedichte eingestreuter kurzer Prosatext, der „Selbstgespräch eines Verwirrten“ heißt, über ein Subjekt zwischen Ich und Wir, zwischen Selbstbestimmung und Vereinnahmung. Replik eines Intellektuellen, der sich vom kämpferischen Linken zum zurückhaltenden Pragmatiker wandelte und sich aus Öffentlichkeit und Politik mehr und mehr herauszuhalten sucht.
„Der Körper altert, das Gehirn wird jünger“, heißt es in „Coda“, dem Schlusstext von Rebus. Er verweist auf den Widerspruch zwischen der Hinfälligkeit des Körpers und der Aktivität des Geistes, attestiert dem lyrischen Ich eine Perspektive und Zukunft, besser als die des 17-Jährigen, der „in diesem Moment auf sein nagelneues Motorrad steigt“, und räumt ein, dass auch die „alte Wut“ nicht völlig verraucht ist. In Rebus hat der 80 Jahre junge Autor, der unermüdliche Hans Magnus Enzensberger, nachgedacht über das eigene Leben und Denken und Dichten, über die Sachen, die sich ereigneten: unsentimental und ohne eitle Nabelschau, in hellen, unangestrengt klingenden Texten voller Hintersinn und Witz.
Wolfgang Seibel, OE1, 17.5.2009
Der große und der kleine Untergang
„Das letzte Hemd“ heißt eines der Gedichte aus Rebus, und es endet mit den Zeilen:
und wenn du dich nach der Decke streckst,
geht ein Riß durch die Achsel.
Da ist er wieder, der Riß, den wir schon aus Enzensbergers Untergang der Titanic kennen. Nur daß er dieses Mal nicht plötzlich auftaucht und gleich ein ganzes Schiff versenkt, sondern zum vorläufigen Höhepunkt eines schleichenden, unaufhaltsamen Niedergangs wird. Natürlich läßt es der Autor auch hier an Warnungen nicht fehlen:
… Hör auf,
an diesem losen Faden zu ziehen!
Am losen Faden der Vergangenheit, denkt man, und ahnt schon vor dem Schlußvers, daß sich eine, wenn auch kleine, Katastrophe anbahnt. Der Riß ist, wie in der Titanic, der Anfang vom Ende. Ob dieses Ende mehr ist als nur der Verfall eines Kleidungsstücks, muss der Leser, je nach Stimmungslage, selbst entscheiden. Für den Autor scheint sich ein schöpferischer Kreis zu schließen. Daß es ihm auf so leichte, diskrete und ironische Weise gelingt, ist beeindruckend.
Rebus enthält noch 72 weitere Poeme, über die sich Ähnliches sagen läßt. Zwischen Kurz- und Langzeile und mit charmanter Untertreibung breitet Enzensberger seinen geistigen Kosmos aus, wo sich erlebte und reflektierte Zeiten wie Sedimente in der Sprache ablagern. Der Autor wird zum Archäologen des eigenen Bewußtseins, das wie die Gegenwart, wen wundert’s, ein „Rebus“, also ein Rätsel ist und bleibt. Dieses Somnambul-Doppeldeutige macht den Reiz der Sammlung aus, und sicher trägt ein Gedicht nicht umsonst den Titel „Der Doppelgänger“.
Kritisch angemerkt sei nur eins: Hin und wieder kommt dem Lyriker Enzensberger der Essayist in die Quere, dann klingt manches nach Meinungsäußerung. Diese Gefahr droht jedem Dichter, der sich aufs Glatteis der Weltanschauungen wagt. Leider schafft es auch der virtuose Enzensberger nicht immer, diese prosaischen Klippen zu umschiffen.
Dennoch: Rebus ist ein Erlebnis, das sich kein Lyrik-Fan entgehen lassen sollte.
Milena Mühl, amazon.de, 26.7.2009
Heitere Größe
Gedichtbände, selbst solche bekannter Autoren, vermögen oft nicht durchgehend zu begeistern. Man kommt häufig nur mit einer letztlich doch relativ kleinen Zahl der abgedruckten Gedichte in engeren Kontakt (was man nicht beklagen muss). Das ist bei Enzensbergers Rebus anders. Diese Gedichte demonstrieren nicht intellektuellen Highflyerstatus und bieten auch keine entsprechende Komplizenschaft an. Es wurden ferner keine hermetischen Dornenhecken um sie herum wachsen gelassen. Man ist also herzlich eingeladen, sich auf diesen Autor und seine Bilder einzulassen. Was da gleich am Anfang an Anschaulichem zu unseren Jahreszeiten geboten wird, ist berührend schön und weckt die Erinnerung daran, wie es ist, lebendig zu sein.
Wer glaubt, dass über den Kampf mit dem eigenen Ich schon alles gesagt ist, wird dies nach Lektüre der Gedichte dieses Bandes in Zweifel ziehen. Besonders eindrucksvoll hierzu die vielen lyrischen Gedanken zu den Anderen, von denen wir uns immer abheben wollen, an deren Fersen wir uns heften – vielleicht auch deshalb, um Dispens von der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich zu erhalten. Humor taucht immer wieder auf – wenn lahme Wallfahrer ihre Krücken fortwerfen und den Erzbischof ein Hexenschuss durchfährt, ist das schon sehr witzig.
Vermutlich wird es auch für Enzensberger nicht das reinste Vergnügen sein, älter und älter zu werden. Aber welch eine Heiterkeit hat er dennoch aufzubieten, welch eine unaufdringliche Beobachtungsgabe! Und dann noch irgendwas, das jenseits der Worte liegt.
Harry Wintergreen, amazon.de, 17.8.2010
Intellektueller Genuss
Der ästhetische Moment als fest eingebautes Interieur fehlt nie in den lyrischen Werken dieses Dichters. Was mit verteidigung der wölfe begann, setzte Hans Magnus Enzensberger seither unbeirrt und scheinbar unbeirrbar fort.
Wer dem virtuosen, ja beinahe artistischen Gebrauch seiner lyrischen Sprache folgt, begegnet Kabinettstückchen der seltenen Art. Die Kunst der unmerklichen Perspektivenverschiebung beherrscht kaum einer, wie er.
Ja, möchte man sagen, Hans Magnus Enzensberger ist immer noch für eine Überraschung gut!
Was das Werk dieses Dichters ausmacht, der – ganz Realist – auch in seinem essayistischen Werk zu überzeugen weiß, lässt sich schwer nur mit wenigen Worten fassen. Gewiss ist aber, das auch Rebus zu überzeugen weiß: intellektueller und ästhetischer Genuss vom Feinsten, genau das ist der Stoff, mit dem der Autor seine Leser zu begeistern weiß.
M. Heinen-Anders, amazon.de, 25.8.2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
KS: Stellvertreter auch seiner selbst womöglich
sandammerr.at 4/2009
Volker Weidermann: Nur die Niederlagen sind ohne Zweifel
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 26.4.2009
Wilhelm Hindemith: Gebenedeit sei die Nichtigkeit
Badische Zeitung, 9.5.2009
Rainer Hartmann: „Sie ist ja so sensibel, die Ärmste“
Kölner Stadt-Anzeiger, 16./17.5.2009
Hans-Dieter Schütt: Das Mögliche
Neues Deutschland, 25.6.2009
Eberhard Falcke: Bei Enzensberger ist sogar das ,Stille Örtchen‘ poesiefähig
Tages-Anzeiger, 30.6.2009
Peer Trilcke: Keiner von uns ist der Richtige
Literaturen, Heft 6, 2009
„obwohl Alles Mögliche unmöglich ist“
– Poetologische Gedichte Enzensbergers seit den 1990er Jahren. –
Hans Magnus Enzensbergers frühe Gedichtbände, verteidigung der wölfe (1957), landessprache (1960) und blindenschrift (1964) bis hin zu Die Furie des Verschwindens (1980), sind reich an poetologischen Figuren der Selbstthematisierung. Das lyrische Ich steht als ein ausdrücklich poetisches in großer Nähe zum Autorsubjekt, etwa im Gedicht „landessprache“ aus dem gleichnamigen Band, wo es heißt:
Was soll ich hier? und was soll ich sagen?
in welcher Sprache? und wem?
Diesem lyrischen Ich ist als notwendiger Zuhör- und Gesprächspartner oftmals ein Du zugesellt, dem der Sprecher konkrete Handlungsanweisungen gibt, wie im Fall von „Ins Lesebuch für die Oberstufe“:
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne:
sie sind genauer.
Die Existenz eines solchen Lesers/Hörers ist so zwingend, dass in einem Text wie „Gedicht für die Gedichte nicht lesen“ dieser Partner näher definiert wird:
Er ist es,
für den ich dies in den Staub ritze,
er, der es nicht entziffert.
Diese Figur, auf die sich der Ich-Sprecher hinorientiert, „zu denen / rede ich kalt wie die Nacht und beharrlich“, entpuppt sich als ein intendierter Leser, der nicht nur als letzte Instanz im Gedicht genannt wird, sondern den Dichter mit sich selber aufzehrt:
Von Lebern,
meiner und deiner, zehren sie,
Leser, der du nicht liest.
In landessprache liefert Enzensberger die deutlichsten Hinweise, in welcher Weise er den Leser als notwendigen Nutzer seiner Gedichte verstanden wissen möchte. Gedichte seien „Gebrauchsartikel, nicht Geschenkartikel im engeren Sinne“; sie verlangen nach einem Leser, der wahlweise sowohl „unerschrocken“ und „politisch interessiert“ als auch „mit philosophischen Neigungen“ ausgestattet sein kann, aber auch „avantgardistisch“ oder „Liebhaber der alten Schriftsteller“ sein darf. Aus diesen Ecksetzungen kann man eine recht eindeutige poetologische Position Enzensbergers ermitteln.
Ein Gedicht wie „Das leere Blatt“ aus der Sammlung Zukunftsmusik von 1991 markiert jedoch einen Einschnitt. Eine Interpretation im Sinne der bisherigen Enzenberger-Poetik wird sich an diesem Gedicht die Zähne ausbeißen. Denn das Gedicht lehnt sich geradezu dagegen auf, durchschaut, verstanden, gedeutet zu werden, indem es selbst vielfältige Lösungen anbietet, die sich entweder widersprechen oder in ihrer Häufung auswechselbar sind. Diesem Entzug der gewohnten Leseerfahrung korrespondiert die Auflösung eindeutiger Inhalte in der asyndetischen Reihung des Banalen, immer schon Vorhandenen. Zugleich entwickelt das Gedicht wie zur absichtlichen Verwirrung des Lesers ein zweites Zeichensystem neben dem der gewöhnlichen Schrift. Erweist sich Ersteres als vergänglich, als spuren-, bedeutungs- und wirkungslos, obwohl oder weil es mit der gewohnten Intention des sich Ausdrückenwollens auftritt, so leuchtet darunter ein Zweites, nämlich das des Wasserzeichens, dem nun wieder alle Merkmale poetischen Schreibens zugesprochen werden: Bedeutungshaftigkeit als „Zeichen“, Entzifferbarkeit und Sinnbildlichkeit in der Hoffnung auf Dauerhaftigkeit „vielleicht, tausend Jahre“.
In „Das leere Blatt“ gilt allerdings noch die ungestörte Kommunikation zwischen dem lyrischen Ich und seinem mitwirkenden Du. Seit Zukunftsmusik oder Kiosk. Neue Gedichte (1995), seit Leichter als Luft. Moralische Gedichte (1999), Die Geschichte der Wolken. 99 Meditationen (2003) und Rebus, Gedichte (2009) tut man sich jedoch schwerer, eindeutige poetologische Positionen zu rekonstruieren. Im Gedicht „Der und der hat das und das gesagt“ diskutieren A und B über die Sinnlosigkeit eines Satzes im Gedicht. Was sich daran anspinnt, ist eine sich verstrickende Logik, die an Kafkas Parabel „Von den Gleichnissen“ erinnert, aus der es keinen logischen Ausweg außer der Schleife eines dauernden Textrekurses gibt. Auch bei Enzensberger gilt für die Frage nach richtig und falsch: „Aber nur in diesem Gedicht“ – eine Argumentationsfigur, die wörtlich in dem Gedicht „Poetik der Lüge“ aus der Sammlung Leichter als Luft von 1999 auftaucht: „Dieses Gedicht fängt an mit den Worten: / Ich nehme alles zurück“; die darin enthaltene oder nur behauptete Lüge bleibt jedoch textimmanent:
Aber das gilt selbstverständlich
nur in diesem Gedicht.
Hier allerdings erweitert Enzensberger Kafkas in sich kreisende Diskussion der Parabel um die Wahrhaftigkeit von Aussagen, verkompliziert durch die Verwirrung um „ich“ und „du“, die von den beiden Sprechern ausgeht.
Noch raffinierter ist dieselbe Denkfigur in „Macht nichts“ durchgeführt. Vier Strophen umkreisen die Erfahrung, dass ein „es“ am Werk ist:
Es hat aufgehört, von selbst,
es richtet sich ein, ist eingerichtet,
so und nicht anders, unabsichtlich.
Die zweite Strophe verweist auf die poetologische Dimension dieses Vorgangs:
Es handelt sich darum, dass die Wörter
kommen, die Farben, ich kann nicht,
das Blut, ich kann nichts dafür,
es richtet sich ein, ab, hier, auf,
es dichtet, malt, zeigt sich, ich
zeige mich, es kommt dazu, ich neige
dazu, ich entblöße es, es spricht,
es spricht alles dagegen, es kommt
etwas dazu, es sticht, sticht zu
Das Gedicht endet mit einem scheinbar resignativen Gestus:
ich habe etwas davon, habe es,
habe es nicht gewollt, Habenichts, ich
es ist so gekommen, es macht nichts.
Die besondere Pointe steckt aber darin, dass das Ich nur scheinbar verschwunden ist, denn es verbirgt sich in fast jedem zweiten Wort des Gedichts: „Gedicht“, „spricht“, „Habenichts“, „eingerichtet“ oder „unsichtbar“ und „unabsichtlich“ (zweimal).
Schon längst hat die literaturwissenschaftliche Forschung für das 20. Jahrhundert gefragt: „Wohin ist das lyrische Ich entschwunden?“ Das Gedicht „Sich selbst verschluckende Sätze“ schlägt einen anderen Weg bei der Demontage des Ichs ein. Diesmal ist das Ich ausdrücklich „einer“, dessen ausgesprochene Sätze im Verlauf des Gedichts ins Unrecht gesetzt werden, Wer behauptet, er stottere nie, verliert auch mit seinen anderen Aussagen jede Glaubwürdigkeit:
(…) Glaubwürdig,
wie ich bin, und bewußtlos, darf ich,
glaube ich, von mir sagen: Ich
widerspreche mir nicht. Ich
bin nicht da. Ich f-f-f-fehle.
Das Gedicht „Gutes Zureden“ enthält schon im Titel einen ersten Reflex darauf, dass die Selbstreflexion eines lyrischen Ichs über seine „Liebe zum Beruf“ mit dem Selbstverständnis eines Dichters zu tun hat. Der erste Teil des Gedichts weist in einer Strophe mit 13 Versen angebliche Verpflichtungen zurück, um dann in einer zweiversigen, gleichsam als Symmetrieachse angelegten Strophe auszurufen:
Aber ich kann doch nicht
aus meiner Haut heraus!
Die letzte Strophe antwortet mit einem Zugeständnis, das zugleich eine Neupositionierung darstellt:
Zugegeben. Aber deshalb
brauchst du noch lange nicht
herumzureiten auf deiner berühmten
Identität, die nichts weiter ist
als eine tönerne Schelle
und ein Klappern im Wind.
Du könntest auch anders.
Es käme, denk es, o Seele,
auf den Versuch an.
Die Infragestellung all dessen, was bisher die Dichter-„Identität“ ausgemacht hat, hängt nur oberflächlich am ironischen Adjektiv und an dem ausgedehnten Vers mit dem anschließenden Zeilensprung in den vierten Vers, so daß dieser ironisierte Identitätsbegriff noch weiter auf „nichts“ reduziert wird, Die zusätzlich genannten Eigenschaften prunken mit hochgradiger Intertextualität. Im Bibelzitat vom tönernen Erz und der klingenden Schelle steckt zugleich eine Anspielung auf den Schluss von Thomas Manns selbstbezüglicher Poetik-Novelle Tonio Kröger, die mit diesem Postulat endet. Das „Klappern im Wind“ mag einem umgangssprachlichen Ausdruck geschuldet sein, lässt sich aber auch als Verweis auf die im Winde klirrenden Fahnen am Ende von Hölderlins Ode „Hälfte des Lebens“ verstehen. Doch damit nicht genug, Mörikes titelloses Gedicht am Schluss seiner Erzählung „Mozart auf der Reise nach Prag“, dessen vorletzter Vers bei Enzensberger wörtlich als ebenfalls vorletzter Vers zitiert wird, versteht sich zweifellos poetologisch, mag er auch Mozarts problematisches Künstlertum und dessen Vorausahnung des nahenden Todes nur als „Versuch“ begreifen. Nimmt man alle diese Anspielungen ernst, dann gerät Enzensbergers Du-Figur als Ratgeber für sein lyrisches Ich ins Zwielicht. Einerseits macht sich diese Instanz über das hohl gewordene dichterische Selbstverständnis des Ich-Sprechers lustig, andererseits schlägt sie ihm dafür eine vertrackte Alternative vor: Statt „[l]ebenslänglich herumirren als Sandwichmann / Für die eigenen Eigenschaften“, also einer Todesorientierung in der Nachfolge der Lyrik Mörikes nachzuspüren, bleibt ein im Irrealis gehaltener „Versuch“ übrig.
Was bleibt am Ende vom Dichter? In „Die Visite“ erscheint dem Schriftsteller-Ich, „[a]ls ich aufsah von meinem leeren Blatt“, statt der zu erwartenden traditionellen Muse „ein ganz gemeiner Engel, / vermutlich unterste Charge“, der ihm klarmachen möchte, „wie entbehrlich Sie sind“. Das Ich nimmt diese Aussage entgegen der Erwartung des Engels „auf Widerspruch, auf ein banges Ringen“ ohne Widerstand an, es verweigert also das biblische Ringen und akzeptiert seine Überflüssigkeit.
Enzensbergers Gedichtband von 1999 Leichter als Luft. Moralische Gedichte greift schon mit dem Titel einen Gedanken auf, der sich durch die späte Lyrik wie ein roter Faden zieht. Das titelgebende Gedicht der Sammlung bindet diese Formulierung leitmotivisch zunächst an die Lyrik („Besonders schwer / wiegen Gedichte nicht“), dann an ein Ich („Leichter als Luft, / (…) / ist natürlich das Ich“), das erst über ein „soviel ich weiß“ in der nächsten Strophe an den lyrischen Sprecher gebunden wird. Die letzte Strophe rundet dann, inclusive des präzisen Selbstzitats im zweiten Vers und des wiederholenden Wortspiels im dritten, die Leichtigkeit des Seins in ein Paradox, das das Ich in ein Größeres einschließt:
Vieles bleibt ohnehin
in der Schwebe.
Am leichtesten wiegt vielleicht,
was von uns übrigbleibt,
wenn wir unter der Erde sind.
Was bleibt also einem Dichter unter so widrigen Umständen zu sagen? Das Gedicht „Optionen für einen Dichter“ weiß bündigen Rat:
Mit anderen Worten
dasselbe sagen,
immer dasselbe.
Mit immer denselben Worten
etwas ganz anderes sagen
oder dasselbe ganz anders.
Vieles nicht sagen,
oder mit nichtssagenden Worten
vieles sagen.
Oder vielsagend schweigen.
Zweifellos sind die genannten Sprechmöglichkeiten des Dichters mit dem Höhe- und Endpunkt des Schweigens steigernd angeordnet; sie folgen damit Kurt Tucholskys Textgrafik „Eine Treppe“: „Sprechen – Schreiben Schweigen“.
Eine Verweigerung, sich festzulegen, lässt sich nicht bloß auf eine zunehmende Altersskepsis Enzensbergers gegenüber Sinn, Nutzen und Wirkung von Lyrik zurückführen. In die späten Gedichte Enzensbergers sind auch die Konsequenzen aus den Experimenten mit automatisch und/oder elektronisch generierter Poesie eingegangen. Denn der Umgang mit „Poesie-Automaten“ erzeugt keine reduzierte, sondern eher eine radikalisierte Ästhetik. Enzensberger erfindet, besser findet mit Hilfe einer solchen Maschine „dreidimensionale Texte“, allerdings ohne die Vorstellung aufzugeben, ein poetischer Text müsse über maschinell generierte Lexika und syntaktische Regeln hinaus eine „poetische Sekundärstruktur“ enthalten und „ein Minimum von kompositorischen Forderungen respektieren“. Damit ist freilich keinem traditionellen Weiterdichten neben und unbeeindruckt von den Algorithmen einer Maschine das Wort geredet, im Gegenteil. Zumindest die Konsequenzen dieses neuen Produzierens und ihre Folgen sind nicht rücknehmbar. Während das Buch den Text konserviert, „löscht der Poesie-Automat mit jedem neuen Text, den er anzeigt, dessen Vorgänger aus“. Außer dem Zweifel am Werk-Charakter eines Textes stellt sich die Frage nach dem Autor eines maschinenproduzierten Gedichts ganz anders: Wer ist der tatsächliche Autor, der Verfasser des Programms oder der Besitzer der Maschine?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus Überlegungen, die durch fortgeschriebene Programme und neue Programmiertechniken zugespitzt werden? Der Versuchung, sich der Dekonstruktion anzudienen und mit ihr die selbst wieder zum Ritual gewordene Gegenlesung, Zerlesung und Zerstörung des Textes zu betreiben, weichen Enzensbergers spätere Gedichte aus. Die Sammlung Geschichte der Wolken mit dem Untertitel „99 Meditationen“ von 2003 sowie die Sammlung Leichter als Luft lassen schon im Titel viele Gedichte in der Schwebe. In „Ein erdfarbenes Liedchen“ versucht sich Enzensberger scheinbar ganz spielerisch und bloß komisch an der orientalischen Form des Ghasels. Eduard Mörike war ihm da 1836 mit dem Hexametergedicht „Alles mit Maß“ vorausgegangen. Bei Mörike galt der durchgängige Reim dem „Schweinsfuß“, bei Enzensberger ist es die Kartoffel:
Noch ein Gedicht über den Tod usf. –
gewiß, aber wie wäre es mit der Kartoffel?
Begreiflicherweise kommt sie nicht vor
bei Homer und Horaz, die Kartoffel.
Doch was ist mit Rilke und Mallarmé?
War sie ihnen zu stumm, die Kartoffel?
Reimt sich zu wenig auf sie,
erdfarben wie sie ist, die Kartoffel?
Mit dem Himmel hat sie wenig im Sinn.
Geduldig wartet sie, die Kartoffel,
bis wir sie ans Licht zerren
und ins Feuer werfen. Der Kartoffel
macht es nichts aus, aber vielleicht
ist die den Dichtern zu heiß, die Kartoffel?
Ja, dann warten wir eben noch ein Weilchen,
bis wir sie essen, die Kartoffel,
ein Weilchen besingen und wieder vergessen.
Im Unterschied zu Mörike, der sein Lieblingsgericht in der hohen Form bedichtet und dadurch die komische Wirkung erzielt, schafft Enzensberger keine zum Schmunzeln einladende Geselligkeitspoesie, sondern eine hochgradig selbstreflexive Struktur mit poetologischen Implikationen. Diese bestehen nicht nur darin, dass das Gedicht das Bedichten der Kartoffel thematisiert, also im letzten Vers vorführt, wovon das Gedicht behauptet, dass es nicht geschehe. Enzensberger reizt auch die klanglichen Möglichkeiten weit über das Schema des Ghasels hinaus aus. So wandert nicht nur, wie es für diese orientalische Liedform Vorschrift ist, das dauernd wiederholte Reimwort durch das gesamte Gedicht. Auch die anderen Verse sind durch Assonanzen, Fast-Reime so eng verbunden, dass man genau hinhören (vgl. Vers 1 und 3) oder den Binnenreim (vorletzter und letzter Vers) erkennen muß. Auf „Kartoffel“ reimt sich in diesem Gedicht nicht nur „zu wenig, sondern gar nicht – nur sie sich selber. Dieser Hinweis macht deutlich, dass das Gedicht auch ein Gedicht über den Tod ist (vgl. Vers 1 und 8: „erdfarben“), über das poetische Verstummen (Vers 6) und Vergessen (letzter Vers).
„Mir fehlen die Worte“, ein Gedicht, das die Semantik des Wortstamms durchdekliniert und auf ein „letztes Wort“ hinausläuft, schließt sich ebenso daran an wie „Die Wörter, die Wörter“, die das lyrische Ich wie ein „Mückenschwarm“ bedrängen und nur durch „Stille“ gebändigt werden können. Das Gedicht „Parlamentarisch“ übersetzt die Entstehung eines Gedichts sogar in die Sprachfloskeln des Gesetzgebungsverfahrens:
Erst wenn der Entwurf soweit ist,
bringe ich eine Vorlage ein.
Ich bin nämlich federführend.
Allerdings, alle Fraktionen
wollen mitreden, sogar
die Hinterbänkler, Anhörungen,
Zwischenrufe von links,
im Plenum Unruhe,
Änderungsanträge
in letzter Minute.
(Diese Zeilen zum Beispiel
waren heftig umstritten.)
Dann wird die Sitzung vertagt.
Im Zweifelsfall rufe ich
den Vermittlungsausschuß an.
Dann kommt es zur Kampfabstimmung.
Noch vor der Sommerpause
wird das Gedicht verabschiedet,
in letzter Lesung. Natürlich,
im entscheidenden Augenblick
ist der Saal wieder mal gähnend leer.
Am Ende lasse ich dann den Text
im Bundesgedichtblatt verkünden.
Die Auflage ist gering,
das Publikum exquisit.
Die Parallelen sind erschreckend und komisch zugleich. Was besagt es für den parlamentarischen Prozess, wenn er nach poetischen Regeln abläuft? Was bedeutet es für ein Gedicht, dass seine Entstehung analog zum Gesetzgebungsverfahren beschrieben werden kann? Oder gibt es nur vage Analogien, sodass der Umgang mit Lyrik auch mit Begriffen beschrieben werden kann, die ihr eigentliches Wesen verfremdeten? Das politische Vokabular entlarvt sich dann als Worthülse, die für alles und jedes, auch für das Entfernteste verwendet werden kann, weil es eben alles und Jenes, das heißt nichts konkret erfasst.
Ebenfalls an der Wirklichkeitserfahrung ist das Wesen des Schreibens in „Der Autobiograph“ ausgerichtet:
Er schreibt über die andern,
wenn er über sich selbst schreibt.
Er schreibt über sich selbst,
wenn er nicht über sich selbst schreibt.
Wenn er schreibt, ist er nicht da.
Wenn er da ist, schreibt er nicht,
Er verschwindet, um zu schreiben,
Er schreibt, um zu verschwinden.
In dem, was er schreibt,
ist er verschwunden.
Autobiografisches Schreiben fasst das Gedicht nicht in eine Ich-Stimme, sondern in eine dritte Person. Autobiografisches Schreiben ist offensichtlich nicht nur verfehlt, sondern löst einen Prozess aus, der nach (vierfachen) Bedingungen abläuft und den vorausgehenden Vorgang genau umkehrt. Nur Schreiben über andere ist werthaltig, jedes Schreiben über sich ist negativ bestimmt. Die Argumentationskette endet schließlich im Verschwinden als doppeldeutiges Ergebnis. Der Schreibende erreicht durch das Schreiben erfolgreich sein Ziel, zu verschwinden. Zugleich existiert er im von ihm verfassten Text, ohne dass er auffindbar wäre.
Lässt sich an Enzensbergers Lyrik seit den 1990er Jahren eine Entwicklung aufzeigen, die sich am lyrischen Ich festmachen lässt? Vielleicht ist dieses lyrische Ich nur ein grobschlächtiges Hilfsinstrument der Lyrikanalyse. Stattdessen sollte man eher wechselnde Stimmen sprechen lassen, die in unterschiedlichen Graden das Denken und Empfinden des Autors repräsentieren. Gewollte Ich-Aussagen werden dann durch die Textfigur des lyrischen Ichs nicht zur reinen literarischen Rollenrede abgeklemmt, sondern erhalten die Spannung zwischen der Textgestalt und der realen Person des Autors. Der Gedichtband Rebus von 2009 benennt mit seinem ersten Abschnitt „Gleichgewichtsstörung“ die austarierte Balance eines Schwebezustands; er verlängert die Leichtigkeit und die Wolken-Sinnbildlichkeit der vorausgehenden Bände. Poetologische Selbstaussagen treten immer mehr zurück zugunsten allgemeiner Weltaussagen wie zum Beispiel über den Status des Denkens („Unter der Hirnschale“), die Rolle des Zufalls („Unwahrscheinlich“) und die Frage, ob die babylonische Sprachverwirrung „wirklich ein Fluch ist, oder ein Segen“ („Polyglotte frage auf deutsch“). Versteckt oder eingebaut in solche Weltaussagen tauchen poetologische Stellungnahmen durchaus auf, etwa in dem Gedicht „Drei Versager“, das von einem „Nachtportier“, einem „Vertreter / im Altersheim“ und eben auch einem Dichter handelt:
Der Dichter im sechsten Stock,
der sein eignes Gekrakel
nicht mehr entziffern kann –
schon wieder hat er die Brille verloren.
Der Dichter als Abklatsch von Spitzwegs Armem Poeten führt sogar die Selbstreferenz des Schreibens ad absurdum; schließlich scheitert er an der Lektüre des eigenen Textes. Die letzte Strophe wirft dann schließlich alle drei Versager in einen Topf:
Lauter hoffnungslose Fälle,
Und doch – zwar falsch, aber putzmunter
singen sie alle wieder,
kaum daß der Morgen graut,
unter der Dusche.
Diese Position gehört ins Konzept einer Auflösung der poetischen Individualität mit dem Verschwinden des lyrischen Ichs und seinem Aufgehen in einem Kollektiv, das sich einer eindeutigen Zuordnung verweigert. Das Gedicht „Erste Person Plural“ – so ist auch ein Abschnitt des Bandes überschrieben – definiert:
Wir sagen wir nur aus Höflichkeit.
Wer damit gemeint ist,
ist nicht ganz klar.
Präludiert wird dieses Bild im Prosatext „Selbstgespräch eines Verwirrten“, in dem es am Ende heißt:
Manchmal weiß ich selber nicht mehr, ob ich einer von den einen bin oder einer von den anderen. Das ist ja das Schlimme. Je länger ich darüber nachgrüble, desto schwerer fällt es mir, zwischen uns und den andern zu unterscheiden. Jeder von den einen sieht, wenn man genauer hinschaut, den anderen verdammt ähnlich, und umgekehrt. Manchmal weiß ich selber nicht mehr, ob ich einer von den einen bin oder ein anderer. Am liebsten wäre ich ich selber, aber das ist natürlich unmöglich.
Fortgeführt ist dieser Gedankengang im Gedicht „Die unsichtbare Loge“:
Wer zu uns gehört und warum,
und wie viele wir sind:
ein gut gehütetes Geheimnis.
Wir wissen es selber nicht.
Wenn das Ich schon nicht weiß, wofür es steht, kann auch dem Gedicht keine richtige Stelle zugewiesen werden; so endet das Gedicht „Stellvertreter“ folgendermaßen:
Auch dieses Gedicht steht natürlich
nur an der Stelle des richtigen,
das noch auf sich warten läßt.
Aufschluss verspricht das lange Abschlussgedicht unter der Überschrift „Coda“, eine Art Selbstgespräch, das sich aber als ein Gespräch mit den als „meine Lieben“ oder als „Komplizen“ Angeredeten darstellt. Dieser Ich-Sprecher ist ausdrücklich Lyriker und erklärt uns auch gleich die Bedeutung des Buchtitels:
(…) Doch ich bin nur ein Vorübergehender,
der vorübergehend beobachtet, was der Fall ist,
der nur redet (de rebus quae geruntur),
und der kaum etwas ausrichtet.
Die Doppelsinnigkeit des zweimal genannten Vorübergehens schleppt das lyrische Ich fast unhörbar mit (letzter Vers) in das Leitmotiv dieser Abrechnung, das „Alles Mögliche“, auch wenn „niemand weiß, was das ist“. Robert Musil wusste es schon, denn aus seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften stammt der Einfall, dass es, wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, auch einen Möglichkeitssinn geben müsste. Am Ende dann zieht der Sprecher Bilanz, „vorläufig“, widerwillig und voller Skepsis:
Eiserne Gutmütigkeit! Aber trotzdem,
ich bleibe dabei, vorläufig wenigstens,
mache weiter, sogar wider Willen,
obwohl Alles Mögliche unmöglich ist,
und ich lache sogar noch, über euch
und über mich, denn wer sich beklagt,
wehe ihm, der ist schon verloren.
Der Wandel des Ich-Sprechers in Enzensbergers später Lyrik, die Rücknahme der Ich-Figur zugunsten einer Wir-Figur und das Aufgehen in den Dingen künden von einer veränderten poetologischen Position, die sich nicht auf eine schwebende Unentschiedenheit zwischen allem und jedem reduzieren lässt.
Rolf Selbmann, aus: Text+Kritik. Hans Magnus Enzensberger – Heft 49, edition text + kritik, November 2010
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Archiv +
Internet Archive + KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


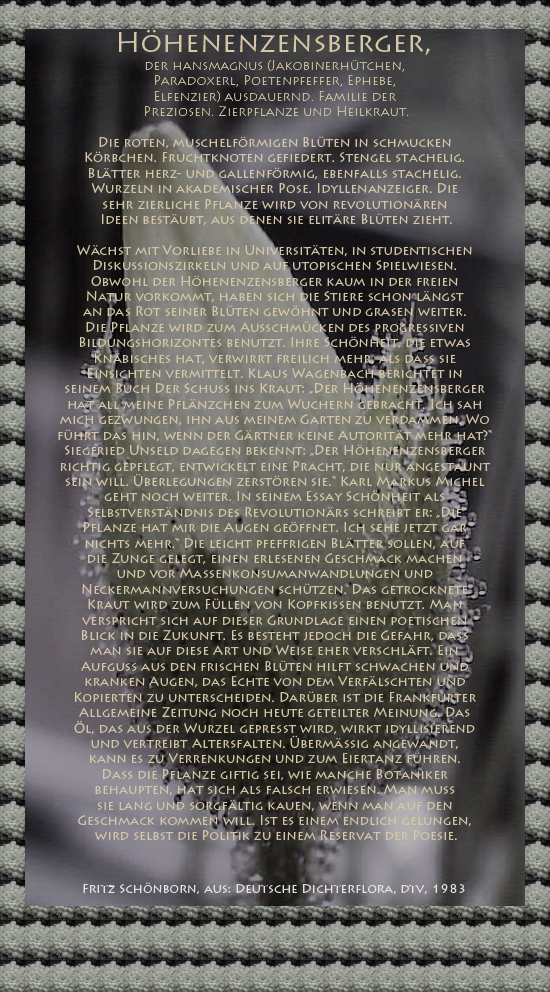
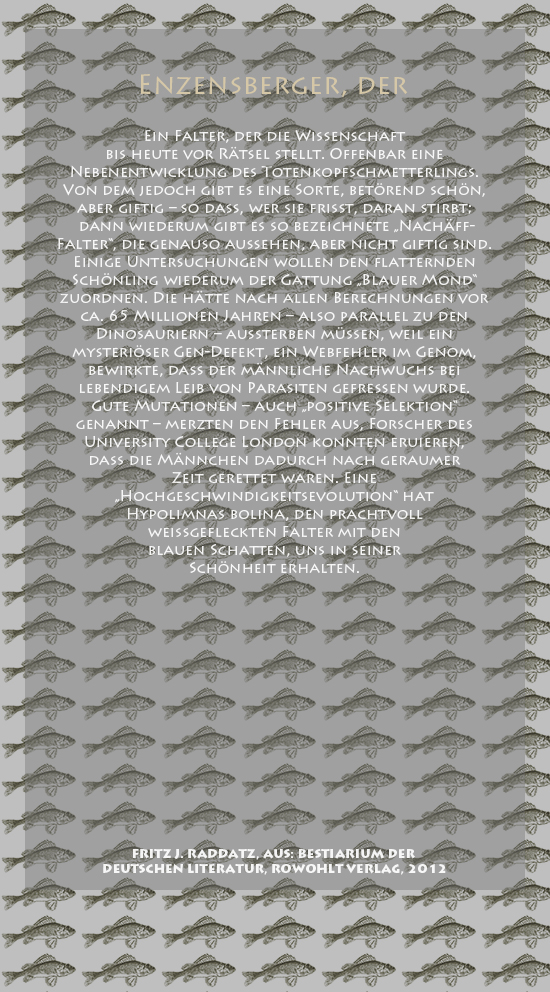












Schreibe einen Kommentar