Hans Magnus Enzensberger: Zukunftsmusik
ZUKUNFTSMUSIK
Die wir nicht erwarten können,
wirds lehren.
Sie glänzt, ist ungewiß, fern.
Die wir auf uns zukommen lassen,
erwartet uns nicht,
kommt nicht auf uns zu,
nicht auf uns zurück,
steht dahin.
Gehört uns nicht,
fragt nicht nach uns,
will nichts von uns wissen,
sagt uns nichts,
kommt uns nicht zu.
War nicht,
ist nicht für uns da,
ist nie dagewesen,
ist nie da,
ist nie.
Inhalt
Seit einem Jahrzehnt hat Hans Magnus Enzensberger kein neues Gedichtbuch veröffentlicht. Diese Zurückhaltung mag daran liegen, daß die Wiederholung nicht seine Sache ist.
Die mehr als fünfzig neuen Texte, die er hier vorlegt, setzen also nicht nur ein poetisches Programm fort, das mit seinem ersten Auftritt 1957 glänzend begonnen hat; sie betreten ein ungesichertes und ziemlich herrenloses Gelände. Das politische Pathos der Verteidigung der Wölfe ist dem Pathos der Distanz gewichen. Die neuen Gedichte sprechen mit der gleichen Selbstverständlichkeit und im selben Tonfall von alten Ehepaaren und von Weltuntergängen, von chinesischen Akrobaten und von den Geheimnissen des Kehlkopfs. Insofern sind sie nicht aktuell.
Enzensberger hat sich gelegentlich über Dichter gewundert, denen die Dummheit als Inspirationsquelle dient. Scharfsinn, behauptet er, sei kein literarisches Verbrechen; im Gegenteil, die Sinnlichkeit der Sprache gehe am liebsten mit der Intelligenz ins Bett. Ob es um die Paradoxien unserer Wahrnehmung geht oder um das Los zweier alter Verkäuferinnen in einem Eisenwarenladen, um den politischen Terror oder um die rätselhafte Zeichnung einer Wanderdüne: die Poesie ist nicht nur, wie Novalis sagt, eine „Gemütserregungskunst“, sie kann auch das Denken beschäftigen. Die Höhenräusche der Mathematik gehen ihr ebenso unter die Haut wie die Niederlagen des Alltags. In manchen dieser Gedichte, wo die Luft dünner wird, herrscht eine eigentümliche Spannung. Aber die Mühelosigkeit, mit der sie zwischen dem Trivialen und dem Erhabenen vermitteln, täuscht. Denn mit einem plötzlichen Sprung stürzt das intellektuelle Spiel in die Evidenz ab, und die philosophische These sieht sich mit ein paar lakonischen Worten sabotiert:
Was der Berg ist, weiß ich nicht
zu sagen.
Aber ich sitze auf dem Berg.
Für den Blitz bin ich entbehrlich.
Er ist mir gegeben.
Das genügt.
Ja, der einfache Satz, der aus dem komplexen Sprachspiel hervortritt, macht die virtuose Beherrschung der Mittel überhaupt erst erträglich; er sucht und findet
die materielle Seele,
die in der kleinen Mulde
über dem Schlüsselbein
schimmert.
Auch auf den analytischen Gestus dieser Gedichte ist also kein Verlaß, und es kommt ihnen nicht darauf an, ihr Können vorzuzeigen. Ihre Kunst hat nur eines im Sinn: das Schwere leicht zu machen, es in der Schwebe zu halten und auf dem zu bestehen, was sich, wie die Zukunft, nicht auf einen Nenner bringen läßt.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1991
Der Hase im Rechenzentrum
– Diagnose der Gegenwart, aus ihrer Sprache erstellt: Enzensbergers Lyrik. –
Alles nimmt ab auf der Welt, nur die Kunst nicht. Sie nährt sich sogar von den Formen und Farben der Welt im Verschwinden. Durchaus nicht bloß Echo, Nachhall und Abgesang, blüht sie mitunter frischer und prächtiger, als je die Welt erschien. Diese Vitalität gehört zu den beständigsten Irritationen moderner Kunst seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Den Dichtern rinnen die Worte durch die Verse, und kein Sinn bleibt mehr hängen. Aber indem sie die Überreste der zerfallenden Wortwelten in den episodischen Ordnungen der Poesie versammeln, schaffen sie dem Sog des Schwindens ein Gegenüber von zumindest zeitweilig verzögernder Wirkung.
Am Schluß von Hans Magnus Enzensbergers Gedichtband Die Furie des Verschwindens, der vor gut zehn Jahren als eine Summe der vorausliegenden Dekade erschien, stand eine Allegorie auf den Titel des Buches. Dessen Gedichte erscheinen von diesem Ende her darauf zugesprochen, und doch verschwinden sie selbst nicht, sondern bleiben zitierbar:
Ohne die Hand auszustrecken
nach dem oder jenem,
fällt ihr, was zunächst unmerklich,
dann schnell, rasend schnell fällt, zu;
sie allein bleibt, ruhig,
die Furie des Verschwindens.
Auch in dem neuen Gedichtbuch, das nun nach einem weiteren Dezennium erschienen ist, steht das Titelgedicht am Schluß: „Zukunftsmusik“. Es nimmt das Thema der Furie des Verschwindens wieder auf und variiert es. Anstelle der allegorischen Person steht Zukunft nur mehr als Stichwort im Wörterbuch von Gemeinplätzen:
Gehört uns nicht,
fragt nicht nach uns,
will nichts von uns wissen,
sagt uns nichts,
kommt uns nicht zu.
War nicht,
ist nicht für uns da,
ist nie dagewesen,
ist nie da,
ist nie.
An der Zukunft besteht kein Zweifel, aber es ist nichtig, sich auf sie zu berufen. Ihre Wirkung reicht nicht weiter als die Phrasen, die über sie in Umlauf sind.
Im selben Verhältnis wie der Gemeinplatz über die Zukunft zur Allegorie des Verschwindens steht das neue Buch insgesamt zu den früheren: selbst Schwundstufe einer ehedem pathetisch aufgeladenen Rede. So vollzieht sich auch in der Form, wovon die Gedichte häufig sprechen. Die Lebenskräfte konzentrieren sich in Blindgängern, verkrümeln sich in Kriechströmen, versickern durch Haarrisse. Gelegentlich fällt der terminus technicus, der seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts für diese Allgegenwärtigkeit bedeutender Energien bei gleichzeitigem Verlust ihrer Wirkungskraft steht: Entropie.
Deren Bilder sind anschaulich nur zum Schein. Der Kriechstrom kriecht nicht, sowenig wie der Blindgänger geht, und nirgendwo sind die Risse zu besichtigen, durch die das Leben flieht. Das Aussterben, so liest man hier, ist eine „langwierige Obliegenheit“, die „eine Generation nach der andern / mit ihrem Adieu beschäftigt, so wie am gestirnten Himmel / die eifrig ihrer Selbstverbrennung hingegebenen Galaxien“. So müssen die Bilder das weit Auseinanderliegende abstrahierend zusammenraffen, ist die Erkenntnis der Sinne eingeschränkt, weil sie sich nur immer auf das Hier und Jetzt beziehen können.
Auf die Kompetenz der Sinne ist hier überhaupt wenig Verlaß. Die Großmannsträume von Durchblick und Überblick, Aussicht und Aufsicht ersetzt Enzensberger durch eine Optik des Anscheins, stets gewärtig, daß Vorder- und Hintergrund sich plötzlich vertauschen, tote Winkel aufgeklärt werden und neue entstehen, innere Bilder an Stelle der äußeren treten oder Spiegelreflexe die Unterscheidung von Wirklichkeit und Abbild verhindern. Gewißheiten sind Mangelware. Von Entropie sind nicht bloß die vitalen Lebensimpulse betroffen, sondern zuallererst die Vermögen der Wahrnehmung selber. So läßt sich nicht unterscheiden, ob die Erfahrung, daß das Leben abnimmt, ihren Grund tatsächlich in der gegenständlichen Welt oder nicht vielmehr in der zunehmenden Selbstrelativierung der Wahrnehmung hat:
Alles verbirgt sich, Offenbarungen
an jeder Straßenecke.
Große Affekte können hier kaum entstehen. Worauf sollten sie sich auch richten? Kein Jauchzen also, aber Verzweiflung auch nicht. Das Jahrhundert verdämmert in gemischten Empfindungen. Es hätte schlimmer kommen können. „Restlicht“ ist ein Gedicht überschrieben, das mit der Versicherung beginnt:
Doch, doch, ich gehöre auch zu denen,
die es hier aushalten.
Noch gibt es auch Reste von Landschaft, von Flüssen, Sträuchern, die Hondas „kindlicher Selbstmörder“ heulen um einen Platz, Lebenszeichen auch sie, und zur Not hilft das Fernsehen als „farbiger Wattebausch über den Augen“ gegen Langeweile:
Im halben Licht vor dem Einschlafen
keine Kolik, kein wahrer Schmerz.
Wie einen leichten Muskelkater
spüren wir gähnend, sie und ich,
die von Minute zu Minute
kleiner werdende Zeit.
Im Haus der Temperamente wohnt Enzensberger mit diesem Gedichtband bei den Melancholikern. Des Lebens besserer Teil scheint vorbei. Der Tod nimmt zu, während die Zeit abnimmt. Bedingter Trost kommt nicht von dieser Welt, sondern von den Künsten.
Gegen Entropie, diese Neutralisierung von Energie durch Umverteilung, wirkt die Poesie durch Vergegenwärtigung von Inbildern. Sie ruft auf, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was denn? Von Utopien ist nicht mehr die Rede. Kein Imperativ, schon gar kein kategorischer, weist die Richtung:
Wie die Glühbirne ringe ich nach Fassung…
Aber die Erleuchtungen bleiben aus; Verfinsterungen auch. Die Katastrophen dieses Universums sind keine Apokalypsen, ja das Katastrophische selbst ist nicht ganz ohne:
Man sieht manches,
wenn das Licht ausgeht.
Diese Gedichte sind ein philosophischer Einspruch gegen die Schwarzweißmalerei. Die Inbilder entstehen vor dem inneren Auge, und sie überdauern dort, wenn das äußere Auge, das natürliche, aufgibt: weder Schwarz noch Weiß, Schemen statt dessen, in denen die geschaffene Welt ein apokryphes Nachleben zu führen scheint. Wenn alles zerfällt, Satz, Sinn und Schicksal, bleibt womöglich das Beste, was keiner geschrieben hat,
das Beste ist: ein Fisch, ein Salzfaß, ein Stern,
ein Einhorn, ein Elefant oder ein Ochsenkopf
Zeichen des Heiligen Lukas; das, was erscheint,
wenn du es gegen das Licht hältst – hält,
vielleicht, tausend Jahre, oder noch eine Minute.
In den Wasserzeichen des Papiers erscheinen die einfachen Dinge wie Abkürzungen von Jerusalem: „Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit“, hat Clemens Brentano, Enzensbergers Pate bis heute, gedichtet. Aber Enzensberger ist nicht plötzlich fromm geworden – wortfromm war er immer schon. Das Eingangsgedicht gilt einem Gemälde von Gillis van Coninxloo: eine Geschichte der Heiligen Schrift, die Verstoßung der Hagar, in einer Landschaft. Das Sujet ist nichtssagend, befremdend sogar. Aber es ist Anlaß für die Vision einer Welt, die durch Abwesenheit glänzt, eine Landschaft, über die das Altern keine Gewalt hat. Die Motive sind schlicht, eine Frau mit Schürze, ein Fischer am Teich, spielende Hunde, aber „Unter der Brücke schäumen, frischer als Wasser, / Grünspan, Bleiweiß und Malachit“.
Die Künstler sind Schaumschläger, ob mit Farben oder Worten, und jeder weiß es und ist doch bezaubert. Was abgesunken oder vertilgt ist, können auch sie nicht zurückbringen. Wie aber, nach kabbalistischer Lehre, nichts in der wirklichen Welt geschieht, was nicht zuvor in der Sprache schon zu Wort kam, so scheint dieses wirkliche Geschehen in der Sprache auch eine Weile noch zu vibrieren, nachdem es tatsächlich erloschen ist. Ja, mitunter gewinnt das Vergangene in den Gedächtnisworten eine Leuchtkraft, die es zu Lebzeiten nie besaß, eine späte Genugtuung, die in diesem Buch „verschwundener Arbeit“ zuteil wird: Waidmüller, Pfragner und Schlözer, der Köhler vor dem Quandel, der Mollenhauer mit dem Beitel führen einen Geisterzug auf, an dessen Schluß die Poesie selbst daherzukommen scheint:
Aber den schimmernden Quader aus Licht
habe ich selbst noch gesehen,
mit eigenen Augen, zauberhaft
mühelos in die Höhe geworfen
am eisernen Haken
auf das lederne Schulterblatt
des Eismanns, am Mittwoch,
pünktlich, die Splitter
schmolzen mir feurig
im kalten Mund.
Der eisige Glasquader macht das Licht sichtbar, das ohne solche Spiegelungen nicht wahrnehmbar wäre. Wenig zuvor war von den verschollenen Berufsbezeichnungen die Rede, die heute als Personennamen ihren fernen Ursprung „wie in Bernstein“ verschließen. Im Mund des Dichters schmilzt das Eis und gibt mit den alten Worten auch die Erinnerung frei, die ohne die Namen keinen Halt hätte.
Neben dem Echo der alten Namen und Bezeichnungen steht das Geistergespräch mit der poetischen Tradition: „Es windet / für deine Vene der Schlauch sich schon“, rühmt ein Vers der Zukunftsmusik Vorzüge der Zivilisation eingedenk des Todes. Mörike nennt statt dessen „Tännlein“ und „Rosenstrauch“:
Sie sind erlesen schon,
Denk es, o Seele,
Auf deinem Grab zu wurzeln
Und zu wachsen.
In „Mozart auf der Reise nach Prag“ stehen die Verse als tränenlösendes Orakel. Enzensberger läßt sie anklingen, um das Schwinden von Beseeltheit in einer Vorsorge zu bezeichnen, die noch die Bratsche am Sarg als versicherungsfähig ausweist.
„Chinesische Akrobaten“ steht in der Zukunftsmusik über einem Bild-Gedicht, das die Wort-Kunst der Dichter dem Jonglieren vergleicht, dem wechselseitigen Überbieten „des Hungers der Angst“ und der Angst-Lust. Am Ende „vergißt die Angst ihren Hunger / und die Lust ihre Angst“. Das Gedicht bezieht den Platz von Rilkes Fünfter Duineser Elegie, „den wir nicht wissen“. Es ist ein idealer Ort, an dem die Akrobaten der Liebeskunst – Rilkes Gedicht ist auf die Artistengruppe eines Gemäldes von Picasso geschrieben – zu ihrem Können finden. Die „Türme aus Lust“, die in der Elegie von den Liebenden nur „auf unsäglichem Teppich“ gebaut werden können, weil diese nicht wirklich zu lieben verstehen, gelingen dem Chinesen Enzensbergers. Warum? Sie gewinnen ihr heikles Gleichgewicht aus der Verneinung:
Während hier unten
Banditen
immer mehr Banditen
Kaiser Japaner Warlords
wüten.
Das Artistische ist eine Kunst des Überlebens, oder es ist gar nichts.
Enzensbergers indirekte Zitate sind unsentimental. Ob er an Benn denkt: „Am Ende der Zertrümmerung / ,äolische Formen‘: ruhelos wandernd“, oder an Paul Celan: „Ammonshorn, Gürtel, Mandelkern / ein dunkles Gedächtnis, / das sich seiner selbst / nicht erinnern kann“ – nie verdoppelt das Zitat den Sinn des Zitierten, immer strebt es nach Ähnlichkeit. Daß die Worte der Dichtungen von heute aus den Worten der gestrigen gemacht sind, ist eine Binsenwahrheit. Wie sollte es anders sein? Hier hat aber das Selbstverständliche poetische Methode. Der dunkle Schleier, den der Melancholiker über die Welt wirft, wird zum Schleppnetz, in dem das Ähnliche sich verfängt. So erhält das An- und Aufrufen der literarischen Tradition noch einen anderen Sinn als den bewußt geübter Recycling-Ökonomie. Der poetische Blick für das Ähnliche wirkt der entropischen Verflüchtigung durch Erinnerung entgegen. Sie hat Enzensbergers Lyrik seit je ihren besonderen Klang gegeben, und auch Leser, die das Anklingende nicht erkennen, nehmen an der Intonation ein halb Verwehtes wahr.
Auf subtile Weise arbeitet die Form solcher Assonanzen dem Eindruck von Literarisierung entgegen. Nicht Literaturgeschichte wird hier aber aufgerufen, sondern die Naturgeschichte der Poesie in Worten und Wendungen mit vorliterarischer Aura. Wenn der Kliniktod mit dem Schlauch in der Vene in einem Satzschema Mörikes ins Auge gefaßt wird, so hatte ja dieser bereits seiner Todesahnung einen Volksliedklang gegeben. Im Gebildeten sucht Enzensberger das Vorgebildete, im Artistischen das Naturhafte. Hier eben sind die Wahlverwandtschaft mit Brentano und – im Verein mit diesem – die Aufmerksamkeit für Sage, Märchen und Volkslied, Spruchdichtung und Kinderreim begründet. Der komplizierte Reiz von Enzensbergers Gedichten liegt in der widersinnigen Frische, mit der Schwermut, Langeweile und Melancholie zur Sprache kommen, dieser dreifache Abgrund moderner Seelengeschichte.
In diese Poetik fügt sich der stilistische Balanceakt zwischen hoher Tradition und Alltag, wie er mit solchem Können und so zuverlässigem Gelingen in deutschsprachiger Lyrik gegenwärtig kaum anderswo zu beobachten sein dürfte. Wie früher schon schreibt Enzensberger seine Gedichte in freien Rhythmen. Seit Klopstock, dem jungen Goethe und Hölderlin, in unserem Jahrhundert vom Expressionismus über Brecht bis Volker Braun, wird in dieser Form von Freundschaft, Liebe und Tod, über Volk, Vaterland und das Verhältnis zu den Göttern gesprochen, eine Symbolform von besonderem Würdeanspruch, immer auch in dichter Nähe zum lebendigen Leben, das im unruhigen Herzschlag dieser Rhythmen – statt im schulgemäßen Metrum – im häufigen Zeilensprung und im kühnen Zugriff auf einen vorliterarischen Wortschatz ein Gleichnis findet. Dazu paßt, daß Fernsehen, knatternde Hondas und Kolikenschmerz gegenwärtig sind, wenn Zeit und Ewigkeit gemessen werden; daß saurer Mundgeruch, feuchte Laken und die versagende Prostata Zeichen der Posthistorie sein können; daß auf dem Auge des gischtigen Strudels, in dem das Worträtsel sich verbirgt, ein naßgesogener Teddybär tanzt.
Seit dem Erscheinen der verteidigung der wölfe im Jahr 1957, der ersten Gedichtsammlung Enzensbergers, ist dessen lyrisches Werk – über Landessprache (1960), Gedichte. Die Entstehung eines Gedichts (1963), Blindenschrift (1964), Gedichte (1971) und Die Furie des Verschwindens – zu einem poetischen Vademecum für Zeitgenossen geworden. Das Zeitgenössische kommt hier nicht in erster Linie durch zeitnahe Themen und Stellungnahmen zustande, obwohl auch diese bis in die letzten Veröffentlichungen hinein zahlreich sind. Enzensbergers Zeitgenossenschaft bewährt sich aber auch, ohne daß er überall dabei ist, denn sie ist als eine literarische Qualität seinen Gedichten inwendig. Jenseits der längst legendär gewordenen Opposition von engagierter oder absoluter Kunst, ja abseits selbst von irgendeiner Tagesaktualität, ist das Zeitgenössische zuallererst eine ungeminderte Präsenz im Gegenwärtigen: Geistesgegenwart.
Diese äußert sich eher unscheinbar, doch folgenreich, etwa in gewissen Wahrnehmungsweisen: daß er von Hohem nicht sprechen kann, ohne die Umgebung mitzusehen, in der es sich zeigt. So werden Tabus der Grenzüberschreitung durchbrochen und Hierarchien entwertet, deren Niedergang für die heute lebenden Generationen eine prägende Erfahrung ist. Sie zeigt sich in der Scheu vor großen Worten, die er kaum einen Atemzug lang aushält, ohne sie durch einen Lapsus ins sprachliche Abseits zu irritieren. Sie kommt in der Vertrautheit mit den zentralen Erfahrungen und Denkformen des Alltags und zugleich des avancierten theoretischen Bewußtseins zum Ausdruck. Diese intensive Geistesgegenwart erlaubt es, daß dessen Themen – Entropie, Relativität von Raum und Zeit, Hirnfunktionshypothesen, das Paradoxon als Denkstruktur – als Hintergrund spürbar werden, auch wo davon gar nicht ausdrücklich die Rede ist. Die hohe Intelligenz von Enzensbergers Gedichten ergibt sich nicht etwa daraus, daß er die Theorien dieses Zeitalters in Lyrik kleidet, sondern daß er Formen findet, die den Zwiespalt zwischen theoretischem Wissen und alltäglicher Wahrnehmung darstellen – meist zugleich auch den Widerspruch zwischen avancierter Moderne und Ärchaik.
Ihre Realitätstüchtigkeit ist in ihrer beobachtenden Nüchternheit angelegt, die sich katastrophische Exzesse ebenso versagt wie fromme Wunschträume. So entstehen Miniaturen der Gegenwart, wie das Bild des Hasen im Rechenzentrum, der, „die großen Augen starr auf den Bildschirm gerichtet“, des Nachts in Panik gerät, nachdem der letzte Plasmaphysiker nach Hause gegangen ist:
Weicher Feigling,
fünfzig Millionen Jahre
älter als wir!
Dem Blutdurst der Jäger,
der Ramme, dem Gas,
dem Virus entkommen,
schlägt er ungerührt seine Haken.
Aus dem Eozän hoppelt er
an uns vorbei in eine Zukunft,
reich an Feinden,
doch nahrhaft und geil
wie der Löwenzahn.
Neben solchen Medaillons mit Emblemen der Gegenwart wartet Enzensbergers Zukunftsmusik mit Sprachetüden auf, denen die alten klangvollen Worte so fremd gegenüberstehen wie der Hase den Großrechnern. „Litanei vom Es“ heißt eines. Sie führt die Allgegenwärtigkeit dieses Wörtchens vor, dessen Geheimnis in seiner schlechthin universellen Konvertibilität liegt. Es kann für jeden denkbaren Sachverhalt und jede Erfahrung stehen, die es in sich zum Verschwinden bringt:
Es ist schon wieder so weit. Es ist zum Heulen.
Es ist eben so.
Die Frage nach dem Was zu unterdrücken kann zur stillschweigenden Übereinkunft werden, um Erfahrungen zu neutralisieren, deren Mitteilung nicht bloß aus Bequemlichkeit unterbleiben mag, sondern auch um die Nerven zu schonen. Die Sprache verliert aber an Welthaltigkeit. was sie an kommunikativer Geschwindigkeit zu gewinnen scheint.
Wie Heidegger in Sein und Zeit stellt Enzensberger in seinem neuen Buch dem „Man“, dem „Gerede“ bis in seine feinsten sprachlichen Verästelungen nach, und wie dieser faßt er seine Beobachtungen nicht mehr nur in die Form einer gewissen Ideologiekritik, sondern als eine Aussage über die Gegenwart überhaupt; darin weniger politisch, stärker philosophisch als in früheren Jahren. Der Weltverlust im Jargon mag um so weniger bemerkt werden, als die Sprache ihn durch eine chimärische Scheinlebendigkeit verbirgt, wie es eine Etüde über „fassen“ nahelegt: „Ich fasse zu, an, auf, / die Gelegenheit fasse ich / in Worte, in Verse, beim Schopf“, und eine andere über „machen“:
Er macht weiter
Sie macht viel durch.
Er macht sie herunter, schlecht, ein, mies,
macht ihr angst, macht sie krank, fertig, irre.
Sie macht das nicht länger mit,
sie machts nicht mehr lange.
Er macht kehrt, er macht sich davon, aus dem Staub.
Sie ruft, Mach, daß du verschwindest.
Machs halblang, ruft er, Machs gut.
Da ist eben nichts zu machen.
Zukunftsmusik, das ist die Diagnose der Gegenwart, aus ihrer Sprache gestellt. Sie fällt so differenziert und – so unterhaltsam aus, wie es Sprachen gibt. Nicht zu den geringsten Qualitäten des Bandes gehört die Kunst seines Autors, zuzuhören, sich selbst aber ins Wort zu fallen, sobald das Nötige gesagt ist. So schafft die Lektüre Kurzweil und ein melancholisches Vergnügen.
Gert Mattenklott, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.3.1991
Der Sänger und sein Widergänger
– Zu Hans Magnus Enzensbergers „Zukunftsmusik“. –
Was sind das für Zeiten, wo die Besprechung eines Gedichtbändchens uns augenblicklich in so prosaische Fragen wie die nach der ideologischen Vertrauenswürdigkeit seines Verfassers verwickelt? Immer fassen wir uns in Langmut, es sind seit Olims Zeiten unsere Zeiten, und die sie uns mit einer gewissen Lust am Hakenschlagen alle paar Jahre wieder aufnötigen, sind der Dichter Hans Magnus Enzensberger und sein politisch räsonierender Widergänger. Letzte Beispiele seiner Verwirrkunst: ein nach meiner Meinung etwas an den Schnurrbarthaaren herangezogener Vergleich zwischen Saddam Hussein und Adolf Hitler („Was die Deutschen begeisterte, war nicht allein die Lizenz zum Töten, sondern mehr noch die Aussicht darauf, selbst getötet zu werden. Ebenso inbrünstig äußern heute Millionen von Arabern den Wunsch, für Hussein zu sterben“) und ein bemerkenswert friedlich gesonnenes Gedichtbuch im Suhrkamp Verlag („Das Wort ,Samt‘ zum Beispiel, / fühlt es sich nicht wie Samt an? / Etwas Weiches, Pelziges / auf der Zunge“), weiß der Himmel, ob der vorangegangene Lärm im Spiegel nicht nur der Aufreißer für ein eher stilles Poesiealbum war.
Überraschend kommt uns beides nicht. „Nutzlos“, „aussiohtslos“ und in allen Tonlagen „harmlos“ lauten die mehr oder minder pejorativen Eigenschaftswörter, die unser Dichter der zeitgenössischen Poesie zu deren Mißvergnügen alle naslang anhängt, und wer die Botschaft bisher noch nicht richtig verstanden hatte, dem tönt sie aus seiner neuen Zukunftsmusik nun entgegen wie ein unüberhörbares Vesperläuten. Weltbewegende Umbruchszeiten, historische Augenblicke, gar dramatische Völkerschlachten nebst angeschlossenen Heiligen- und Märtyrerlegenden sind ihm schlichtweg ein Greuel. Da verliert er sich schon lieber in der Trosteinsamkeit von „sandigen Liegenschaften. / trostlos schön / wie ein verlassener Bahndamm“ oder sinnt der noch nicht durch fleißige Menschenhände verunzierten Bildung eines sanften Dünenzuges nach:
Reine Kunst, die keinen Künstler braucht,
unaufhaltsam beweglich bewegt.
Was die Menschheit seit Urvätertagen wie eine Zwangsvorstellung verfolgt und was sie in allen Sprachen der Welt („kmer, Zulu, arabisch, deutsch“) mit nicht endenwollendem Jubel begleitet, die „Suche nach ,gloire‘“, entlockt ihm allenfalls ein saures Aufstoßen. Aber wo es nur irgendein geknicktes Hälmchen aufzurichten gibt, eine Winkelexistenz zu ermutigen, einen aussterbenden Beruf zu feiern oder eine Abwegigkeit wie einen „Hasen im Rechenzentrum“ zu bestaunen, ist er augenblicklich mit von der Partie, nein, da ist er im wahrsten Sinne des Wortes Partei, Partei einer unvermuteten Aberration („Die bebende Oberlippe, zuckend im Neonlicht“), Partei einer regelwidrigen Kuriosität („Im Zickzack zwischen den Monitoren“), Partei des größten anzunehmenden Absurditätsfalls („Weicher Feigling,… der Ramme, dem Gas, / dem Virus entkommen, / schlägt er ungerührt seine Haken“) – Grund genug, statt an ferne Raubtierwelten lieber an Morgensterns irregeleitetes Huhn in der Bahnhofshalle zu erinnern:
Wird dem Huhn
man nichts tun?
Hoffen wir es! Sagen wir es laut:
daß ihm unsre Sympathie gehört,
selbst an dieser Stätte, wo es – ,stört‘!
Wen solche Nachbarschaft überrascht, der hat freilich Enzensbergers frühere und früheste Gedichte nicht mit dem nötigen stereophonischen Feingefühl gelesen oder sich von einer Zweideutigkeitschiffre wie „verteidigung der wölfe gegen die lämmer“ voreilig in die Büsche locken lassen. Ein furioser Schlachtenmaler der sozialen Klassen- und der kapitalistischen Verteilungskämpfe immer nur einerseits, war er zugleich ein versonnener Liebhaber des lyrischen Pastorale, heißt, des weltentrückten Hirtengedichts, der sich schon gern einmal in ein „vlies aus weichen zotteln“ hineingeträumt hat („für lot, einen makedonischen hirten“). Obwohl eine autobiographische Notiz zu seinem Erstlingsbuch nachdrücklich darauf hinweist, daß Enzensbergers Heimatstadt Nürnberg auch die Stadt der „Reichsparteitage“ war („Im Nachbarhaus wohnte Streicher“); scheinen andere lokale Spezialitäten auch nicht spurlos an ihm vorübergegangen, ein „Nürnberger Spielwarenmuseum“ zum Beispiel oder eine literarische Pläsierlichkeit wie die „Nürnberger Pegnitzschäfer“ des siebzehnten Jahrhunderts. Es bedarf beinah keiner besonderen hermeneutischen Hörhilfen, um den Nachklang von Lautpoesie und lyrischer Naturmalerei auch aus Enzensbergers frühen Gedichten herauszulesen, kiwit, kiwit.
Seit seiner berühmten Auswahl von Kinderversen Allerleirauh von 1961 und gewiß seit Erscheinen seiner poetischen Kuriositätensammlung Das Wasserzeichen der Poesie (1985) ist es allerdings heraus – und, wie ich meine, herum –, daß sich die Vorlieben des Verfassers sachte, aber sicher, umverteilt haben und der literarische Wildemann seinen Taktstock/Zauberstock gern einmal an einen koboldhaften Gegenspieler hinleiht. Während es in einer „anweisung an sisyphos“ von 1957 noch einigermaßen herausfordernd heißt:
lab dich an deiner ohnmacht nicht,
sondern vermehre um einen zentner
den zorn der welt, um ein gran
scheinen ihm solche Titanenmühen nun kaum noch des Schweißes der Edlen wert. Statt weiter auf radikal-demokratisches Steinewälzen zu setzen, richtet sich sein interesseloses Wohlgefallen nun auf die Kunststücke eines „Fliegenden Robert“ oder die „aah“ – „aaah!“ – atemberaubenden Fertigkeiten von „Chinesischen Akrobaten“.
Ob das moralisch weniger wiegt als Drücken, Reißen, Stoßen, möchte ich vom Trampolin meiner eigenen Schreibtischplatte aus lieber nicht entscheiden. Da sich beide Disziplinen offensichtlich auf dem Papier abspielen und insofern nur in effigie gelten, scheint es mir förderlicher, statt der politischen Moral lieber einmal die Wahl der literarischen Mittel zu betrachten, sportlich gesprochen: das Überwechseln von einer zirzensischen Kategorie zu einer anderen, was sich bei einem Mimetiker der Sprache vorzugsweise im veränderten Muskel- und im Mienenspiel seiner poetischen Grammatik ausdrückt.
CHINESISCHE AKROBATEN
Ein Wort in die Luft werfen
das Wort schwer
ist leicht
Ein Zeichen in die Luft zu tuschen
das Zeichen unmöglich
ist nicht unmöglich
Oder Strich auf Strich
Bambus oder Lust oder Teller zu setzen
Silbe auf Silbe auf Silbe
zu balancieren
immer höher und höher
aah!
Aber selber so leicht zu werden
wie ein Strich
eine Silbe
ein Zeichen am Himmel
eine Minute lang
zu schweben
ist schwer
Unmöglich
so hoch oben
zu atmen
während hier unten
Banditen
immer mehr Banditen
Kaiser Japaner Warlords
wüten
Tausend Jahre lang
hungert die Angst
ängstigt die Lust sich
und schaut zu
atemlos
aaah!
wie am Himmel die Körper
immer leichter und leichter
schweben
immer höher und höher
balancieren
Hand
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBambus
Teller
aaaaaaaaKnie
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFrau
Tusche
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaStrich
aaaaaaaaaaaaBambus
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHand
Zeichen
aaaaaaaTeller
aaaaaaaaaaaaStange
aaaFrau
aaaaaaaa aBambus
aaaaaaaaStrich
aaaaaaaaaaaSilbe
aaaaaaaaKnie
Bitte noch einen Strich!
ruft die Lust
Noch einen Teller!
die Angst
bitte nicht
bitte doch
Aaaah!
wie leicht!
wie leicht das schwankt!
knickt
bricht
kippt
stürzt
Bitte nicht!
Die hohen Körper
atmen
eine Minute lang
während sich schneller und schneller
und höher und höher
immer mehr
leere Teller drehn
geisterhaft
leicht
am Himmel
aaaaaaah!
vergißt die Angst ihren Hunger
und die Lust ihre Angst
Ein tolles Kunststück, absolut apart in unserer lyrischen Zirkuskuppel, wobei die optisch einleuchtende Verwendung der Mittelachse als Balancierbalken alles andere als eine bloße Formalität ist. Auf ihr, auf ihm kann das Gedicht sich nämlich dialektisch tänzelnd voranbewegen, ohne sich bei jeder Gedankenkehre linksbündig abstützen zu müssen. Von ihr, von ihm aus läßt sich eine mit Worten/Wörtern eigentlich nur schwer zu behauptende Equilibristiknummer ganz konkret als eine vergleichbare poetische Bemühung um Gleichgewicht und inneren Gleichmut vorführen. Denn nur darum kann es einem sich seiner Mittel bewußten Sprachakrobaten gehen: sich ein erhebendes Beispiel wortwörtlich zu Herzen zu nehmen und einem Nonplusultra an Körperbeherrschung ein äußerstes an literarischer Virtuosität entgegenzusetzen.
Daß das „leicht“ ist im Vergleich, sagt er selbst, und er äußert es neidlos, bewundernd, ohne auch nur den geringsten Anhauch von Koketterie. Dabei ist Enzensbergers mimetisches Einfühlungsvermögen in jeder Hinsicht enorm und sein Gespür für die Verhältnismäßigkeit der Mittel gar nicht zu überschätzen. Wie er in dem „sisyphos“-Gedicht mit wieder und wieder nachgeschobenen Imperativen Druck zu machen sucht („finde dich nicht damit ab“ – „lab dich an deiner Ohnmacht nicht“ und so fort), lenken die feineren Jonglier-Abwägungskünste folgerichtig zu einer kippligen Gratwanderung zwischen dem zeichenhaften Sein und der körperlichen Unerheblichkeit der Wörter über, bei, der schon minime Gewichtsverlagerungen augenblicklich die wundersamsten Bedeutungsverschiebungen nach sich ziehen.
Ein Gedicht wie „Chinesische Akrobaten“ braucht ganz offensichtlich seinen Platz, es braucht Raum, es braucht Luft, aber die Luft ist nun einmal sein Medium, und da scheint mir praktisch kein Millimeter vertan, weder mit leeren Wörtern noch mit hohlrauschenden Kunstpausen. Daß sein Tanzmeister und Dirigent an einer Stelle den Theatervorhang fast gewaltsam aufreißt und einen Blick auf die betrübliche Weltenbühne freigibt („Banditen, Kaiser, Japaner, Warlords“ allerwege), gehört bei Enzensberger sozusagen zum Programm, und es gibt seinen artistischen Wertvorstellungen erst die richtige Schärfe und Verve.
Kaum daß uns das verfängliche Wort entschlüpft ist, möchten wir es allerdings schon wieder zurückrufen, zumindest es relativieren, denn in der Tat beschränkt sich Enzensbergers moralische Kategorienlehre keineswegs auf den tendenziös herausgearbeiteten Gegensatz von holden Kunsterscheinungen und blutigem machtpolitischen Ordnungswesen. Auch die „Chinesischen Akrobaten“ sind für ihn nur ein herausgehobenes Beispiel unter anderen Mut machenden, Vergnügen spendenden. Das bezaubernde Gaukelwerk in der Arena nur ein einzelnes glänzendes Kettenglied in dem langen Katalog seiner Lob- und Preisgegenstände. Er hat die „sellerie“ besungen, noch in seiner Kleinschreibezeit („ehre sei der sellerie“), und der mühsam und unauffällig sich durchs Leben krumpelnden Flechte eine fünfseitige Eloge gewidmet („sie kämpft um ihr leben / unbewaffnet / und kaum besieglich“). Er hat die „dronte“ und den „zobel“ und den „albatros“ mit einseitiger Sympathienahme über ihre Verfolger erhoben („verstummt aus ekel vor uns“) und schließlich sogar der viel verlästerten „Scheiße“ ein paar positive und pazifistisch eingefärbte Seiten abgewonnen („Seht nur, wie sanft und bescheiden / sie unter uns Platz nimmt!… eigentümlich gewaltlos / ist sie von allen Werken des Menschen / vermutlich das friedlichste“).
In „Ein letzter Beitrag zu der Frage ob Literatur?“ hat er sich später noch einmal mit einer besonders unerbaulichen Spielart menschlichen Fortschrittsstrebens auseinandergesetzt, dem Typus des theorieverbissenen Tugenddespoten, und wenn mir die eine oder andere Zeile seinerzeit etwas reichlich relativistisch erschien, ist mir das ganz gewiß nicht betriebskonforme „Fürchtet euch nicht!“ bis heute in den Ohren hängengeblieben.
Warum gebt ihr nicht zu
was mit euch los ist
und was euch gefällt?
Ein einziges Mal,
nur ein Vierteljahr lang,
zur Probe!
Dann wollen wir weitersehen.
Die wir heute um zwanzig Jahre weiter und, zugegeben, auch etwas älter geworden sind, stellen mit ahnungsvollem Erstaunen fest, daß dieser wandelhafte Geist sich bemerkenswert treu geblieben ist und der neueste Enzensberger der Zukunftsmusik dem alten Enzensberger der verteidigung der wölfe und der landessprache wohl als ein würdiger Nachfolger hätte erscheinen können. Was uns Die Furie des Verschwindens vor nunmehr auch schon wieder einem Jahrzehnt an drohenden Rationalisierungsverlusten und Fortschritts=Abschreibungsgewinnen vor Augen malte, zieht des Dichters abwehrend gesträubten Blick zwar immer noch mit in die Flucht; es scheint nur andererseits so, daß er dem Sog der Sintflut nun mit einem eher noch gesteigerten Bewahrungseifer entgegentritt. Beinah jedes Gedicht eine kleine Arche, auf der Hans Noah Enzensberger die Reste seiner Lieben (auch Vorlieben) zu versammeln sucht, um sie bei Anruf ihres Namens in den Rang einer Rarität zu erheben.
Fast schon zwanghaft und in jedem Fall schwelgerisch sein Vergnügen, sich „die ausgestorbenen Fertigkeiten“ des „Pfragners“, des „Waidmüllers“, des „Schlözers“, des „Zedlerss“, des „Mollenhauers“, des „Schirrmachers“ oder der „Kremplerin“ noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und dem sang- und klanglos Untergegangenen ein tönendes Denkmal zu setzen.
Wie weit solches nostalgische Geisterzitieren einer schon etwas allgemeinen und gegen den technischen Fortschritt gerichteten Rückdrift entspricht, könnte vielleicht eines kritischen Nachfragens wert sein, ich möchte es mir lieber verkneifen. Daß unser Jahrgang und die ihm benachbarten das von Enzensberger beschworene Atlantis noch mit eigenen Augen gesehen, noch mit eigenen Füßen berührt haben, scheint mir jedenfalls unbezweifelbar, und wer wollte schon leugnen, daß es unsere eigene magisch erlebte Jugendzeit ist, die uns aus jedem antiquarischen Rührstück so verrückt wie verwunschen anblickt.
Aber den schimmernden Quader aus Licht
habe ich selbst noch gesehen,
mit eigenen Augen, zauberhaft
mühelos in die Höhe geworfen
am eisernen Haken
auf das lederne Schulterblatt
des Eismanns, am Mittwoch,
pünktlich, die Splitter
schmolzen mir feurig
im kalten Mund.
Ja, er kann loben, er kann preisen, kann Verworfenes aus der Versenkung hervorzaubern und Was-objektiv-weg-vom-Fenster-ist überraschend in einen neuen Leuchtrahmen setzen. In dem teilnahmsvoll bis andächtig von ihm ausgeteilten „Restlicht“ erscheint Hans Magnus Enzensberger dann manchmal sogar wie ein richtiger Weltanschauungsautor oder was man früher einen Dichter mit Botschaft nannte. Sein von Abschiedswehmut leise behauchter Blick in einen weltentrückten „Eisenwarenladen“ („Zwei ältliche Waisen, / die ihn geerbt haben, / neunzehnjährig, / vor neunzehn Jahren“) läßt ein in den normalen Verwertungsvorstellungen gar nicht mehr geführtes Glück-im-Winkel wie eine Oase aufleuchten, Genre ist sein Name.
Sein Philemon-und-Baucis-Idyll „Alte Ehepaare“ überrascht uns gar mit etwas derart Unzeitgemäßem wie einem Hohelied auf die Nachsicht, die aus der naheliegenden Scharfsicht rührt:
Wer so lange geblieben ist,
macht sich wenig vor.
…
Man sieht manches, wenn das Licht ausgeht.
Leicht zu besingen sind solche scheinbaren Unerheblichkeiten jedenfalls nicht, liebe Lyrikleserin, lieber Leser, und wer sich trotzdem traut, erweckt manchmal den Anschein einer selbst schon ausrangierten Spezies.
„Wie kann einer singen von dem was nicht singt, vom stummen“, das ist eine Frage, die Enzensberger sich schon in jungen Jahren gestellt hat, und er hat sie sich zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Büchern unterschiedlich beantwortet. Die Begeisterung, die Lebensfreude, der Jubel, der Taumel, die Liebeslust tönen immerhin fast von sich aus und bedürfen als Dauerbrenner der Gattung kaum der besonderen Erwähnung. Auch der gemeine Weltschmerz, die Melancholie und die friedhöfliche Nichtigkeitsanwehung finden als sozusagen ewige Motive des lyrischen Einzelgesanges leicht zu einem verständlichen Grabeston und somit zu ihrem Publikum.
Schwieriger wird es da schon mit dem, was nun wirklich nicht singt, sagen wir: dem bedenkenvoll wackelnden Kopf, der achselzuckenden Resignation, dem leise und leiser werdenden Atem, der stummen Entgeisterung vor einer zunehmend unverbesserlich erscheinenden Welt – wie läßt sich dem eigentlich noch eine tröstliche Botschaft entnehmen, eine anrührende Stimme verleihen? Ganz zu schweigen – beziehungsweise eben nicht zu schweigen – von dem stoischen Sich-abfinden-Müssen mit dem eigenen, schon etwas zaghaft verflackernden Lebenslicht.
In den praktisch nie auszulesenden Briefen Theodor Fontanes stieß ich unlängst auf eine vor vielen Jahren angestrichene Stelle:
Das Leben, Gott sei Dank, ist kein Tummelplatz großer Gefühle, sondern eine Alltagswohnstube, drin das sogenannte Glück davon abhängt, ob man friert oder warm sitzt, ob der Ofen raucht oder guten Zug hat.
Das scheint mir zum Beispiel solch ein halb heroischer Unerheblichkeitston, der ziemlich direkt zu Herzen geht und trotzdem schwer zu treffen ist. Und wenn er sich über den späten Benn dann auch auf den älter gewordenen Enzensberger übertragen hat, dann erkennen wir beinah beglückt, daß man sich auch in fortgeschrittenen Jahren noch allerhand zu sagen hat.
„Ich weiß, daß ich nichts weiß“: so etwas ist für Enzensberger fast schon um einen Tick zu dick und ein Begriff wie „Fassung“ zunächst einmal eine artistische Herausforderung für ein „Thema mit Variationen“. In einer seiner methodisch anregenden Sprachetüden (man könnte sie auch Capriccios nennen) klimpert er das fragwürdige Wort z.B. in allen nur denkbaren Kombinationen und Bedeutungszusammenhängen durch, „ich fasse zu, an, auf… Ich fasse mich kurz, in Geduld, fasse Haß, Fuß, Zutrauen, Essen, Mut, einen Vorsatz… Wie die Glühbirne ringe ich nach Fassung, kann mich vor Freude, vor Überraschung kaum fassen…“, bis dem Verfasser auch sein eigenes Treiben und Schreiben schließlich immer fragwürdiger wird und er „was nicht zu fassen ist“ am Ende grundlos in einem „Faß ohne Boden“ „auf sich beruhen“ läßt.
Solche Versuchsreihen finden sich bei Enzensberger häufiger, und man kann sie sich als literarische Probiercharaktere unschwer ins Philosophische übersetzen. Was von unseren Tugend-, Moral- oder Wertbegriffen letzten Endes zu halten sei, läßt sich für einen ausgefuchsten Relativisten allenfalls abwägungsweise ermitteln, heißt, durch unermüdliches Herumjonglieren oder Austarieren. Daß das nicht immer mit der gleichen glücklichen Hand geschieht, kann man freilich nicht ganz übersehen, überhören. Manchmal klaviert er seine Piècen auch ein Stückchen über den eigentlichen Klingelpunkt hinaus, und man denkt, was man in Zweifelsfällen so denkt: Na-na-na oder nee-nee-nee, aber das passiert einem ja gelegentlich sogar bei Heine, wenn das Vergnügen des Artisten an seinen Effekten nicht mehr registriert, wann man die Tasten lieber loslassen sollte.
Ewige Wahrheiten, letzte Willenserklärungen und testamentarische Verfügungen sind von unserem Dichter also kaum zu erwarten, und wie sollten sie auch, wo er eigentlich nur „Haltungen“ vorführen möchte, am liebsten gelungene Schwebezustände. Die Ironie der Gedichttitel „Zukunftsmusik“, „Schöne Aussichten“, „Alles Gute“ und „Zum ewigen Frieden“ spricht dabei ihre eigene zweideutige Sprache: ein Unsicherheitsidiom, das wir allerdings nicht als Hohn mißverstehen sollten. Die bedeutenden Parodisten der literarischen Moderne stehen ausnahmslos in einer magischen Korrespondenz zu ihren Anspielungsgegenständen. Bei einem ernstzunehmenden Ironiker wird sich immer auch etwas von dem Ernst und sogar der Erhabenheit seiner Vorbilder wiederfinden lassen, weshalb wir in einem Gedicht „Zum ewigen Frieden“ auch besser keinen zu Königsberger Klops verhackstückten Kant erwarten sollten.
ZUM EWIGEN FRIEDEN
Dieses Zeug, das aus dem dunklen
Himmel hell fällt, leicht,
gleichmäßig, lautlos, ohne
Aufenthalt tänzelnd, setzt sich
auf alles, ohne Eile, was eckig
ist, Hochhaus, Briefkasten, Sarg.
Alles, was eckig war, wird
rund, langsam bauschen sich
Mauern, der Abdruck der Schuhe
füllt sich, geht unter, mild,
es versinkt die Schaufel,
langsam, langsam, alles, was
zählbar war, spitz, distinkt,
fließt ineinander, Dachziegel,
Köpfe, behaubt sich, es unterliegt
das Schroffe dem Weichen, es weicht
der Unterschied, niedrig, hoch,
flach, erhaben, böse, gut. Da
der Hügel war vor Wochen, Tagen,
Minuten ein Puff, eine Bretterbude,
ein Schneepflug. Auch die Zeit
ist zu Watte geworden. Hie und da
noch ein Wetterhahn, eine Antenne.
Die leichte Wölbung am Horizont
undeutlich, von Flocken verschluckt,
muß das Matterhorn sein, oder
der Ararat. Es verschwindet der Krieg
im Frieden, weiß und vollkommen,
Alles gleichmäßig wie der Schnee,
nur der Schnee nicht. Jeder Kristall
für sich, verschieden von
jedem Kristall: Ein Blick
durch das Mikroskop genügt, nur
schade, daß es versunken ist,
das Mikroskop, und das Auge
verdunkelt vom Schnee.
Kritisches Fazit? Aber nein, aber bitte doch jetzt nicht mehr. Denn wer möchte bei einem uns derart hypnotisch einmummelnden Gedicht noch an so abstoßende Gestalten denken, wie sie uns am Anfang unserer Betrachtung noch vor Augen standen, Schwamm drüber, Schnee drüber, und überhaupt scheinen uns unsere eingangs geäußerten Bedenken schon ein bißchen der Schnee vom vergangenen Februar. Nur eine letzte bescheidene Frage möchte ich vielleicht noch nachtragen dürfen. Sie ist dezent und richtet sich direkt an den friedeliebenden Poeten Hans Magnus Enzensberger, den wir eben noch so vorteilhaft gesoftet durch die Schneebrille haben aufscheinen sehen: Warum – zum Teufel, oder bei allen Nachtmahren, Widergängern und Inkubussen – beliebt es ihm neuerdings, sich auf solche Spiegelgefechte gegen „den Feind der Menschheit“ einzulassen, statt sich locker der Friedensbewegung anzunähern, die im allgemeinen wie im besonderen genau dem von ihm in Liebe gemalten Sinnbild entspricht:
Alles gleichmäßig wie der Schnee,
nur der Schnee nicht. Jeder Kristall
für sich, verschieden von
jedem Kristall.
Peter Rühmkorf, aus Peter Rühmkorf: Tabu I. Tagebücher 1989–1991, Rowohlt, 1995
Das alte Lied?
Hans Magnus Enzensberger hat einen neuen Gedichtband veröffentlicht, allerdings nicht – wie der Klappentext verlautbart – den ersten „seit einem Jahrzehnt“. Bereits im Wasserzeichen der Poesie, einer Anthologie, die Enzensberger unter dem Pseudonym Andreas Thalmayr 1985 herausgegeben hat, finden sich viele neue Gedichte von Enzensberger, zuweilen unter diesem, zuweilen unter anderen Pseudonymen wie Serenus M. Brenzengang, einem Anagramm aus dem Namen Hans Magnus Enzensberger. Und so ist es nicht verwunderlich, daß die Gedichte aus dem neuen Band Zukunftsmusik inhaltlich vielfaltig mit den Enzensberger-Gedichten aus Wasserzeichen verknüpft sind. Seinen Variationen auf Brechts Gedicht „Radwechsel“ („Ich sitze am Straßenrand / Der Fahrer wechselt das Rad. / Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. / Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. / Warum sehe ich den Radwechsel /mit Ungeduld?“) in der Anthologie Wasserzeichen (Seite 301ff. unter dem Pseudonym A. T.) fügt er in der Zukunftsmusik weitere Variationen hinzu:
Du weißt nicht, woher
Du ihn hast, wohin
er geht, wozu
er dient.
Ohne ihn wärst du wenig.
Auch sonst sind die neuen Gedichte voll der Anspielungen auf ältere. In dem Gedicht „Litanei vom Es“ wird das Motiv eines Gedichtes aus dem Jahre 1963 variiert, das mit folgenden Worten begann: „Etwas, das keine farbe hat, etwas, das nach nichts riecht, etwas zähes…“ („An alle Fernsprechteilnehmer“). In einer Anamnese seiner Gedichtproduktion hatte Enzensberger über die Entstehung dieses Gedichtes und damit über die Bedingungen des Lyrischen überhaupt geschrieben:
Vor mir liegt eine leeres Blatt. Ich schreibe darauf: ,Etwas, das…‘ Ein magerer Zustand. (…) Ein Mann, der von ,etwas‘ spricht, weiß nicht genau, wovon er redet, kann es nicht fixieren, auf Anhieb eindeutig namhaft machen; sonst käme ihm das unbestimmte Pronomen gar nicht in den Sinn. (…) Der Schreiber findet sich nicht damit ab, das Unbekannte unbekannt sein zu lassen. Er versucht es zu qualifizieren, sich seiner zu bemächtigen, indem er Worte dafür sucht, die ihm noch nicht zur Hand sind. Er stellt dem namenlosen Etwas eine Falle, indem er einen Relativsatz anhängt.
Auch auf diese Beschreibung gibt der neue Gedichtband ein Echo; das Gedicht heißt „Das leere Blatt“ und beginnt:
Das, was du jetzt in der Hand hältst, ist beinahe weiß,
aber nicht ganz; etwas ganz Weißes gibt es nicht;
es ist glatt, hart, zäh, dünn, und für gewöhnlich
knistert es, fließt, knirscht, reißt, beinah geruchlos
So gibt es für den Enzensberger-Philologen viel zu entdecken, höchst amüsante Kreuz-Wort-Rätsel zu lösen – und doch kann dieses Buch jene Erwartungshaltung, die – u.a. in der zitierten „Anamnese“ – zur Sprache kam und die Enzensberger in seiner lyrischen Praxis – u.a. in dem zitierten Gedicht – zur Sprache gebracht hat, nicht zufriedenstellen. Und das hat drei Gründe: Das Gedichtbuch versammelt hauptsächlich Gedichte dreier Genres: 1. die Gedankenlyrik, 2. die gesellschaftskritischen Lieder, 3. die Alltagslyrik.
Die Gedankenlyrik hat eine lange Tradition – Brecht oder Schiller oder sogar Walther von der Vogelweide. Das Problem ist nur, daß Gedankenlyrik heute in einer Form mit wissenschaftlichem Denken (und seinen mittlerweile sehr vielfältigen Formen) konkurrieren muß, wie es zu Walthers, aber auch noch zu Schillers Zeiten und in gewissem Sinne auch noch zu Brechts Zeiten nicht zu beachten war. Wissenschaftsprosa ist längst nicht mehr, das zeigen die Arbeiten solch unterschiedlicher Autoren wie Wittgenstein oder Adorno, steriles Klappern einer lebensfremden Terminologie, sondern auf gewisse Weise sinnlichkeitsgesättigt und formal eigenwillig. Und so muß, wer heute Gedankenlyrik schreiben will, sich mit diesem Problem auseinandersetzen. Das betrifft zum Beispiel die Gedankenlyrik über ein Thema, das immer wieder zu Gedichten Anlaß gab, über die Frage nach Sprache und Erkenntnis. Eben dies ist ein Gebiet, dem Enzensberger zahlreiche (und zugleich programmatisch die ersten) Gedichte der Sammlung gewidmet hat. Nur werden die einst geweckten Erwartungen nicht erfüllt. Denn das Erstaunen Enzensbergers darüber, daß Sprache paradox werden kann („Dieser Satz ist sinnlos“), ist nun gerade in der sprachwissenschaftlichen Reflexion nicht so arg neu („Alle Kreter lügen, sagte der Kreter“), daß sich ein Gedicht noch lohnte. Enzensberger vermag der Sprachproblematik, weil er eben nur reflektiert, in seinen Gedichten (z.B. Seiten 9, 11, 20, 22, 28), nichts Eigenes hinzuzufügen. Die Reflexionen, die Enzensberger, nur durch den Zeilenbruch zum Gedicht verurteilt, bietet, sind Standards sprachkritischen Denkens. Statt (völlig korrekt) zu sagen, wo die Sprache endet, hätte Enzensberg er vormachen sollen, wohin sie führt. Gedankenlyrik heute kann nicht mehr naiv diskursiv sein – sie muß sinnlich sentimentalisch sein, nämlich die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit literarisch reflektieren.
Die anderen Bedenken richten sich gegen die Gedichte, die man 1968 sicherlich „engagiert“ genannt hätte:
Pilgerscharen
in der Fußgängerzone
auf der Suche nach Identität
und Südfrüchten.
Das liest sich, als hätte Enzensberger Enzensberger nachgemacht: „Gewissenhaft arbeiten Partner an der Hinrichtung einer Ehe“ – nach zwanzig Jahren Frauenbewegung und einer ganzen Bibliothek von bovaryschen Büchern ist derlei doch zu wohlfeil, dient eher als ein Bonmot, mit dem man die Lyrik nicht belasten sollte. Niemand wird sich ob solcher Einsichten berührt fühlen. Weise wird er nicken, ja, so ist die Welt. Böse ist sie halt. Aber oft, allzuoft riskiert Enzensberger nicht mehr als diese Allgemeinplätze:
Blutlachen stehen
vor mikroskopischen Kinos,
die Blutlachen zeigen.
Daß Enzensberger derlei Einzelheiten selbst kaum noch ernst nehmen kann, ändert nichts daran, daß er sie schreibt:
Das
hört sich schlimmer an, als es ist.
Woran liegt es nun, daß sich bei einem Autor, dem einmal doch der Titel des „zornigen jungen Mannes“ ehrenhalber zu Recht verliehen wurde, derlei Allgemeinplätze („wie einen leichten Muskelkater / spüren wir gähnend, sie und ich, / die von Minute zu Minute / kleiner werdende Zeit.“) häufen? Das Buch gibt eine Antwort:
Sehnsüchtig sucht der greise Krieger
den Horizont ab nach einem Angreifer.
Aber die Kimm ist leer. Auch der Feind
hat ihn vergessen.
Hätte Enzensberger eben diese Einsicht zur Grundlage seiner lyrischen Produktion gemacht (und nicht nur abstrakt behauptet) – es hätte ein verstörendes Gedichtbuch entstehen können. So wirkt es wie die Ruhe nach dem Palaver.
Diese Kritik betrifft besonders die dritte Gruppe von Gedichten, nämlich die über die kleinen Freuden des Lebens. Es sind, was man in den Siebzigern „Alltagsgedichte“ genannt hätte, Gedichte, die sich über Vergeßlichkeit wundern („Verwechselung“), über den Herbst des alten Handwerks („Verschwundene Arbeit“), über das Altern („Alte Ehepaare“) und die flüchtigen Wonnen der Erotik („Fetisch“, „Kopfkissengedicht“) und schließlich darüber, daß die Worte nicht mehr treffen, was da ist:
Dafür, daß du gegangen
und gekommen bist, und für alles,
was ich nicht von dir weiß, sind meine einsilbigen Silben
zu wenig, oder zuviel.
Daran ist sicherlich nichts falsch, macht es aber eben ungeeignet für ein Gedicht. Verwunderlich ist allein das Erstaunen, das in. den Gedichten zur Verteidigung der Normalität spürbar ist, und so sind diese Gedichte nicht einfach nur Dinggedichte, sie wollen nicht einfach nur beschreiben, sondern ihnen wohnt ein unangenehm belehrender Duktus inne. Die Freuden des Mittelmaßes werden dem Leser mit leicht moralingesäuertem Unterton ans poetische Herz gelegt, ganz so wie einstmals die Empfehlung, nicht Gedichte zu lesen, sondern handlungsorientierte Fahrpläne und Kursbücher zu studieren. Nunmehr heißt die Maxime, die es zu befolgen gilt:
Es ist mir gegeben.
Das genügt.
Statt der Verteidigung der Wölfe nunmehr die Verteidigung der Lämmer. Aber statt solch brave Tierkunde zu betreiben („Eigentümlichkeiten eines höheren Wirbeltieres“), wäre es besser, Enzensberger schriebe wieder Gedichte; denn sonst ist auch seine Zukunftsmusik nur die alte Leier.
Volker Ladenthin, neue deutsche literatur, Heft 468, Dezember 1991
Hans Magnus Enzensberger: Zukunftsmusik
Seit mehr als zehn Jahren hat Enzensberger kein Gedichtbuch veröffentlicht, und so ist man auf diese gut 50 neuen Texte mit Recht gespannt. Die vier Abteilungen („Das leere Blatt“, „Alles Gute“, „Zum Ewigen Frieden“, „Abtrift“) zeigen die Virtuosität, das Formgefühl und die Vorliebe für eine betont intellektualistische Behandlung des Wortmaterials, wie man es von Enzensberger kennt. Aber die Grundstimmung ist eine andere, bissige Zeitkritik ist der melancholischen Geste gewichen.
Was Könnertum immer noch leistet, es sogar bis zur lyrischen Akrobatik steigert, zeigen einige Gedichte aus der ersten Abteilung, etwa „Chinesische Akrobaten“, ein Text mit überraschenden formalen Entsprechungen, die sich fast zu einem Figurengedicht auswachsen. Ein anderer Text (aus der zweiten Abteilung) erreicht seine Pointe über geistreiche Variationen mit dem Verb ,machen‘. Wieder andere entwickeln das barocke Summationsschema weiter, manchen jedoch (in der Machart an Erich Fried erinnernd) droht der Leerlauf bzw. der Kalauer.
Enzensbergers Ironie, die ihm auch früher die Distanz erlaubte, hat sich nicht verloren. Die beiden letzten Abteilungen haben es auch nötig – „Ja, / das Ableben! Ein zeitraubender Sport!“ Aber da ist die ständige Bedrohung des Untergangs und die kaum verhohlene Trauer über das Früher und das Vorbei. Was läuft da an Belanglosem ab zwischen der beschwichtigenden Zeile „Doch doch, ich gehöre auch zu denen, / die es hier aushalten“ und dem Schluß: „die von Minute zu Minute / kleiner werdende Zeit“! Hier nistet sich nun die Melancholie ein. Wo Hoffnungsreste auszumachen sind, bergen sie nicht mehr, wollen sie sich nicht mehr zu einer heilen Haut zusammenfinden, mit der man davonkäme – „Die blaue Vene tickt, / ein rotes Wunder geht auf, / das wir nicht erleben. Die Wunde / des Möglichen blutet noch“. Darüber rettet man sich nicht so leicht mit Ironie hinweg, allenfalls mit Akrobatik für den Augenblick.
Es sind solche Momente, die hier bei Enzensberger zum erstenmal in dieser Dichte begegnen, die uns die wichtigen Dinge des Lebens, die Erfahrung der Liebe etwa („Kopfkissengedicht“), als notwendige Ruhepunkte wahrnehmen lassen. Leben ist ja nur als Gegenwart von Belang, eine „Zukunftsmusik“ gibt es lediglich als schöne Metapher – „War nicht, / ist nicht für uns da, / ist nie dagewesen, / ist nie da, / ist nie“.
Ferdinand van Ingen, Deutsche Bücher, Heft 1, 1992
Zukunftsmusik
Nachdem Enzensberger ein Jahrzehnt lang keinen Lyrikband mehr veröffentlicht hatte, wagte er mit Zukunftsmusik 1991 einen lyrischen Neuanfang. Auf dem Einband und den Buchdeckeln innen breitet sich vor dem Auge des Betrachters eine in facettenreiches Blau getauchte, phantastisch wirkende und räumlich scheinbar unbegrenzte, vielleicht nächtliche Wüstenlandschaft aus. Sie erweckt ein Gefühl der Harmonie und Ruhe. Die Symbolik des Bildes umfasst jedoch auch andere Perspektiven. Die Wüste birgt Gefahren, wie Hunger, Durst und Sandstürme. Diesen Gefahren war in der biblischen Geschichte das auserwählte Volk Gottes ausgesetzt. In Bezug darauf kann die Wüste als ein von Gott verlassener Ort gesehen werden. Gleichzeitig ist sie aber auch Symbol der Prüfung und Reinigung. Ebenso hat die Farbe blau, die das Bild dominiert, positive und negative symbolische Elemente. Es ist die Farbe des Meeres und des Himmels. Beide scheinen unendlich zu sein und binden eine ins Unendliche gehende Sehnsucht an sich. Im Gegensatz dazu gilt Blau aber auch als die Farbe der Trauer und des Unheils. Vordergründig leicht und unbeschwert, verbirgt das Bild eine sich im Hintergrund haltende Schwere und Gefahr.
Den vier Zyklen des Bandes „Das leere Blatt“, „Alles Gute“, „Zum ewigen Frieden“ und „Abtrift“ sind insgesamt 56 Gedichte zugeordnet. Die Titel der Teilbereiche wie auch der Bandtitel entsprechen jeweils einem Gedichttitel. Dem Leser erschließen sich in den Gedichten unterschiedliche Szenen und Themenbereiche, so z.B.: Straßenszenen, Mathematik, Politik, Phonetik, ausgestorbene Berufe etc. Dabei wird nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit thematisch einbezogen. Allerdings scheut der Autor sich, dem Leser einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Zum einen, weil bereits die Gegenwart als Zustand der Leere und Sinnlosigkeit beschrieben wird, zum anderen, weil besonders das letzte Gedicht des Bandes, mit dem Titel Zukunftsmusik, eine negative Zukunftserwartung suggeriert:
Die wir auf uns zukommen lassen,
erwartet uns nicht,
kommt nicht auf uns zu,
nicht auf uns zurück,
steht dahin.
Gehört uns nicht
Der Titel Zukunftsmusik geht anscheinend auf Richard Wagner zurück. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, trug eine Musikkomposition diesen Titel. Durch Tradierung wurde der Begriff zum Schlagwort.1 Dieses Schlagwort hat sich bis in die gegenwärtige Alltagssprache erhalten. Beim Lesen der Gedichte wird deutlich, dass der fortschrittsoptimistische Titel nur als Ironie des Autors verstanden werden kann. „Die Ironie des Titels gilt einer Gegenwart, deren Perspektive längst verschwunden ist, die sich aber gerade in diesen Zustand der Aussichtslosigkeit eingefunden hat.“2
Enzensberger distanziert sich in Zukunftsmusik weitgehend von dem anklagenden, lauten und aggressiven Ton der früheren Werke. Peter Rühmkorf bemerkte „ein bemerkenswert friedlich gesonnenes Gedichtbuch“.3 Weiterhin sprechen viele Rezensenten dem Werk eine „ungeheure Leichtigkeit“ (ebd.) zu. Inhaltlich jedoch spricht der Gedichtband dem Menschengeschlecht sowohl die kulturelle als auch die historische Zukunft ab. Dadurch entsteht beim Lesen ein tiefes Gefühl der Resignation. Dieses Gefühl wirkt sich jedoch nicht unbedingt beunruhigend aus, weil gerade der schwerelos wirkende Schreibstil, die Schwere des Gedankens aufhebt. Dies steht wahrscheinlich in einem engen Zusammenhang mit der äußerlichen Gestaltung des Bandes. Die Leichtigkeit des Äußeren verdeckt die drückende Schwere des Kerns.
Hans Magnus Enzensberger-Projekt
Nein, hoffentlich keine Zukunftsmusik
Enzensberger dreht sich selbst die Worte im Mund herum
Ich sehe was, was du nichts siehst.
Alle außer dir haben recht,
aber das siehst du nicht ein.
Ich schwanke tatsächlich sogar noch zwischen 2 und 3 Sternen, denn was Enzensberger hier abgeliefert hat, dass ist auf Weite strecken platt, platter als platt und definitiv weder Poesie noch sonst irgendwas Konstruktives. Ich meine, es gibt ja Dichtungen, die sind komplex, andere sind kryptisch, manche sogar hermetisch. Aber keins von dreien trifft auf die Gedichte in Zukunftsmusik zu. Sie sind einfach platt und ja, ab und zu auch ein wenig lächerlich.
Es geht weiter, es kommt, kommt mir,
es raucht, es sind Farben da, Falten,
Narben, es wiederholt sich, selbst,
immer wieder, da hinten, tot
ist es nicht, ach, es sagt, ach,
röchelt, wunderbar, ach, ich habe,
ich habe etwas davon, habe es,
habe es nicht gewollt, Habenichts, ich,
es ist so gekommen, es macht nichts.
Ich wünschte, es gäbe auch noch einiges Positives zu sagen. Gewiss, es gibt noch ein paar gute Gedichte, sogar ein-zwei bestechende. Ich glaube, was mich wirklich stört ist die scheinbare Belanglosigkeit, mit der die Schlechten aufs Papier geworfen wurden. Sie scheinen wie nebenbei erdichtete Farcen und Fresken, ohne eigentliche Bezüge. Und ich habe wirklich versucht, durch mehrfach lesen, Symbolanknüpfung, Anschluss zu finden, aber vergeblich – und das lässt den Gesamteindruck einfach sehr verzerrt und schief hängen.
Wer aber eine verquere Herausforderung will, nun ja, kann es ja mal versuchen.
Reine Kunst, die keinen Künstler brauch,
unaufhaltsam beweglich bewegt,
neu und unfruchtbar,
reine Zeichnung, die niemand sieht,
die sich einzeichnet
in sich selber, schön,
öde, Unterhaltung für Götter.
Auch diese Zeilen stammen aus diesem Band, von Enzensberger selbst verfasst und vielleicht ein kleines Eingeständnisses, seiner neuen Poesie. Dies ist der 5. Gedichtband, den ich von Enzensberger gelesen habe und es ist eindeutig der schlechteste, enttäuschendste. Er mag einige gute Zeilen haben („z.B.: Kleider machen blind, Gelegenheit macht Liebe“), aber ansonsten ist er voller abgegeigter Allgemeinplätze, voller sprachlich verwirrender Gedichte, in denen nur noch die Sprache selbst, ohne Stimme, zu reden scheint und voller floskeliger Themen. Er ist einfach nicht gut. So muss man es sagen.
Timo Brandt, amazon.de, 6.3.2012
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Joachim Kaiser: Enzensbergers wahre Meisterschaft
Süddeutsche Zeitung, 21.3.1991
Peter Rühmkorf: Der Sänger und sein Widergänger
Die Zeit, 22.3.1991
Wolfram Schütte: Ohne Sichtblenden
Frankfurter Rundschau, 30.3.1991
Tobias Heyl: Hasen, nahrhaft und geil
Falter, Heft 19, 1991
Volker Ladenthin: Das alte Lied?
Neue Deutsche Literatur, Heft 12, 1991
Sibylle Cramer: Die Angst vergißt ihren Hunger
Der Tagesspiegel, 31.3.1991
Heinz Czechowski: Zukunftsmusik
Leipziger Tageblatt, 16.8.1991
Martin Meyer: Geglückte Nähe
Neue Zürcher Zeitung, 5.4.1991
Peter Rühmkorf: Der Sänger und sein Wiedergänger
Die Zeit, 22.3.1991
Elke Schmitter: Handkäs mit Musik
Die Tageszeitung, 30.3.1991
Tae-Ho Kang: Poesie als Kritik und Selbstkritik. Hans Magnus Enzensbergers negative Poetik, Dissertation März 2002
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
ENZENSBERGER BZW. WER, WENN NICHT ER?
Wer zweifelt so smart durchs Abendland?
So lyrisch, so chic, so sehr richtig?
So kosmopolitisch-schwerelegant?
So Herr-Lehrer-ich-weiß-was!-gewichtig?
Wer geht schön schlau seinen Bildungsweg?
Spielt Avantgarde auf der Mitte der Straße?
Wer sitzt in der Anderen Leihbibliothek
Als Buddha des Trends an der Kasse?
Wer surft freizeitanimationsgerecht
– Aber kritisch! – über doppelten Boden?
Schlägt als transatlantischer Mehrzweck-Brecht
Den Schaum der jeweiligen Moden?
Wer verteidigt schneidig Wolf gegen Lamm?
(Der Wolf heißt Hans Magnus, das Lamm heißt Saddam.)
Na? Wer?
Wenn nicht Er:
Hans Feingeist ist es, er deckt den Bedarf.
Ist er auf das Bundesverdienstkreuz scharf?
Wiglaf Droste
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Archiv +
Internet Archive + KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Ulla Berkewicz: HME zu Ehren
Sinn und Form, Heft 5, 2023
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


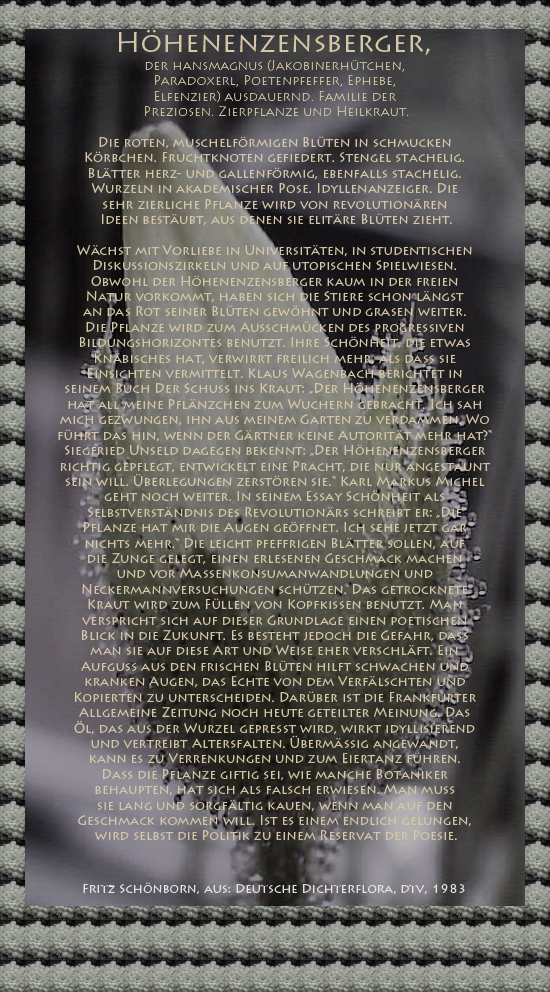
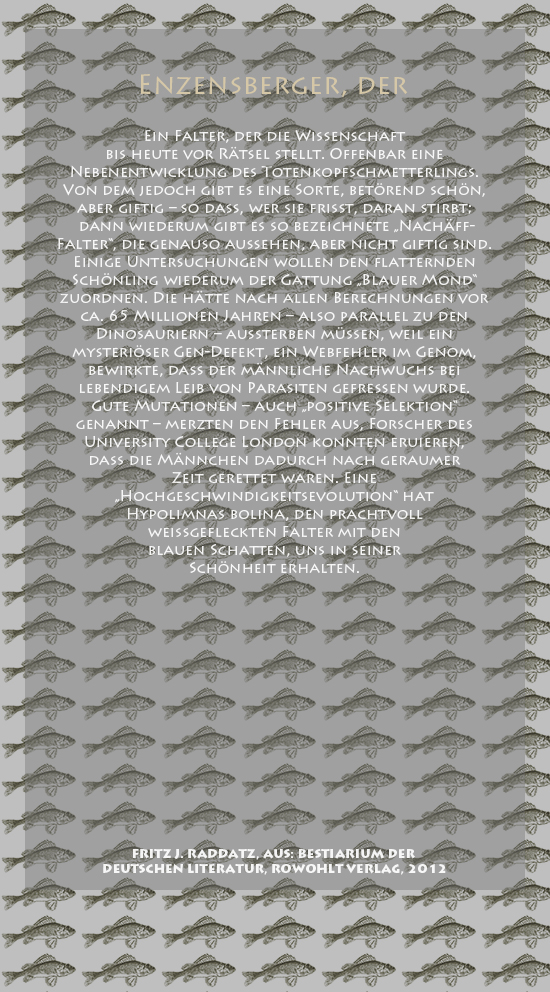












Schreibe einen Kommentar