Hans Raimund: Porträt mit Hut
„Nimbus aus Eis“
7
ICH VERSCHWINDE auf dem Teppich aus Luft
Auf dem Teppich aus Luft
An die Reling der Fransen gelehnt … Ich roll
Wann ich will übern Rand und fallen wie toll
Weit weg – von wo? – auf die Deichsel des Karrens
Auf die Deichsel des Karrens
Ins Wiehern der Pferde ins Hecheln der Hunde
Ins Lauern der Geier … Und keine Kunde
Von mir dringt mehr durch – zu wem? – … Ich verschwinde
Ohne HüteLüften KüsseWerfen Winken … Ich verschwinde
Im Flug gebeutelt von Böen schwebend
Keine Frage stellend – wem? – keine Antwort gebend
– Auf welche Frage? –
Seine Gedichte
sind vom Amerikanischen zum Albanischen, vom Italienischen zum Bulgarischen in viele Sprachen übersetzt; und doch gilt es, Hans Raimund in Österreich, im deutschen Sprachraum erst richtig zu entdecken. Trotzig verweigert er das Einverständnis mit dem Kulturbetrieb, während er doch die Kommunikation mit dem Leser durchaus sucht.
Sein neuer Gedichtband handelt von den großen Themen der Menschen und den kleinen, unscheinbaren Dingen des Lebens. Unerbittliche Bilanz des Scheiterns wird da gezogen, doch gleichzeitig das Weitermachen, das Standhalten gerühmt. Der Liebe sind viele von Raimunds Gedichten gewidmet, die doch gleichzeitig den existentielle Raum der Einsamkeit vermessen.
Hans Raimunds Lyrik ist eine hohe Schule der Wahrnehmung, in der die Geduld gelehrt wird. Der langsame, geduldige Blick ist der seine, er übt ihn an Orten der Stille, in der Natur, aber auch unterwegs, auf Reisen, in den Städten. Hans Raimund beherrschte souverän die lyrischen Formen der Tradition, um sie immer wieder zu überschreiten und eine unverwechselbare, hochmusikalische Sprachkunst zu entfalten.
Otto Müller Verlag, Klappentext, 1998
Vielstimmiger Virtuose
Hans Raimund stellt seinen Band mit dem sehr suggestiven Titel (das gehütete und sich hütende Porträt) unter ein Motto von Leonard Cohen:
Läute die Glocke, die noch läuten kann.
Vergiss dein perfektes Angebot.
In allem ist ein Riss
. Dadurch kommt das Licht herein.
Der „Sprung“ geht durch die Glocke, dein vermeintlich perfektes Opfer, durch alles geht er, und so (nur so?) dringt Licht ein. Am Licht, vom Schimmer bis zur Erleuchtung, fehlt es in diesem Band nicht; manches ist heller und somit lesbarer als anderes, bisweilen ist man aufs Rätseln angewiesen (etwa während jener „Reise zu Balthus“), im Grunde aber: viel Helles, Lichtes und Gescheites, aber auch Kritisches und Böses von einem wirklich hellen Lyriker.
Zeitlebens habe ich mich gegen „österreichisch“ und „schweizerisch“ oder etwa „deutsch-amerikanisch“ oder alles, das deutsch geschriebene Lyrik unterteilen sollte, gewehrt. Bei diesem Band zum ersten Mal nicht. Er ist, so helfe Gott den Deutschen und Schweizern unter den Lesern, sehr österreichisch. Sichtbare und unsichtbare Paten und Hausgötter sind Österreicher – Jandl, Mayröcker, Kafka („Obwohl er“), die Grazer, die Wiener. Wie man heutzutage von Rühm, Bayer und Artmann spricht, wenn es um die Entwicklung der neueren Lyrik geht, so wird man in Zukunft von Hans Raimund sprechen müssen. Österreichisch ist seine tiefere Melancholie, die höhere Raunzerei, seine Freude am Wortspiel (obschon der Konkreten Poesie einmal nicht verfallen), an der Großschreiberei aller Nominalsegmente (StillStandSpur), der gelegentlich sehr bösen Verwendung des Dialekts („This is Vienna speaking“), schließlich der unendlichen Vielfalt der Verweise und Anspielungen. Unter „Travelling light“ z.B. reichen sie vom tiefsten Märchen aus der Sprache überhaupt hinaus. Raimund nimmt sich sehr ernst, aber dann wieder überhaupt nicht, siehe das bereits apostrophierte Titelgedicht. Es kommt immer darauf an, welchen Klangzwängen er vor unseren Augen und Ohren verfällt; mitunter täten’s auch weniger.
Ich weiß, das Unterstreichen in Rezensionen begreift immer eine gewisse Zurücksetzung ein, es geht aber nicht anders, denn das lange Lob ist ermüdender als der lange Verriss, zumindest in Österreich! Also herausgegriffen sei die alle Kaniden feiernde und verewigende „Lena ,of the windy hill‘“. Joycisch ist das Motto „Porträt des Hundes als Welpe in Italien“ – elf Seiten Einfälle, die hervorpurzeln wie der junge Hund selbst, im Grunde ein Raimundsches HohesHundeLied, jedenfalls gibt es heute nichts Vergleichbares in der ernstzunehmenden Lyrik. Herausgegriffen seien auch die reimnahen „Gelegentlich nur lese er“-Folgen (acht Seiten!).
Das Überzeugende, ja das Große an dem Band ist seine Vielstimmigkeit, seine thematische und prosodische Vielfalt, sein Balancieren zwischen Zuvielreden und Verstummen, seine zahllosen separaten Etüden und Variationen – allein dies unterscheidet ihn von allem, was ich an neuester Lyrik kenne. Gedichte, die man sich auch als nicht geschrieben, aber beim ersten Anblick sofort als überzeugend vorstellen kann. Es sind in der Tat die „fatti inquietanti“, die ihn am Schreiben halten: solche Texte wie der über den Vater („Gespräch über ein Foto“; „Vater 2“; „Vater 3“), vieles „verspielt“ in einem Wort-Sinn. Die Evokation Duinos ganz anders als die eines früheren Schlossbewohners. Und „Gieß die Blumen“, „Nimm den Veitschi“ und „Am Fenster“ sind wahre Kabinettstücke.
Noch einmal zum Reim: manchmal, wie schon erwähnt, geistert er durch ein paar Strophen (z.B. „Vertan!“). Man rechnet mit ihm, und er kommt nicht („Ich bin in einer Stadt“). Mitunter erscheint er in sehr zurückgenommener Form und (für Raimund) uncharakteristisch lakonisch:
ZU SAGEN
Ich will
Es wagen
Macht still
Das Schweigen
Der Keim
Des Klangs
Das Wachsen
Im Reim
Der bindet
Der Ahnung
Des Sangs
Sich beugen
…
Gewogen
Gemessen
Verschwindet
Der Text
Vergessen.
Das sind Verse, zugleich in und aus aller Tradition, und, auf dem Weg ins Verschwinden, dieser aufregende Text. Auf der Umschlag-Rückseite heißt es, H.R., „noch immer zu entdecken“, sei „ein großer österreichischer Dichter“. Das erste Zitat ist angesichts des bereits Publizierten inkorrekt, das zweite ist hochgemut und trifft zu.
Richard Exner, Literatur + Kritik
Hans Raimund –, wer ist das?
Seine Gedichte sind zwar in viele Sprachen übersetzt worden; seine Lyrikbände und Übersetzungen wurden u.a. mit dem Georg-Trakl-Preis für Lyrik und dem Wystan-Hugh-Auden-Übersetzerpreis 1992 ausgezeichnet; im deutschen Sprachraum aber bleibt er offenbar noch zu entdecken und ist hier mit einer Kurzbiographie vorzustellen: 1945 in Niederösterreich geboren, studierte er in Wien Musik, Anglistik und Germanistik, war von 1972–1984 als Lehrer, anschließend als freier Autor und Übersetzer in Duino bei Triest bis 1997 tätig und lebt seither in Wien und Hochstraß im Burgenland.
Der sorgfältig edierte Band ist in drei Kapitel gegliedert. Diesen untergeordnet sind bildhafte Texte mit fließenden Grenzen zu rhythmischer, konziser Prosa, gelegentlich gereimt oder assoziativ und formal ansprechend wie gut lesbar aufgelöst. Besonderheiten der eigenwilligen wie eigenständigen Handschrift Raimunds sind u.a. oft doppelte Spatien zwischen Wörtern als Ersatz für Kommata und die Großschreibung der Grundwörter in Zusammensetzungen.
Die thematische Spannweite der Gedichte weist den sprachkundigen Autor als einen sehr nachdenklichen und genauen, kritischen, aber menschenfreundlichen, tierliebenden und humorvollen Beobachter mit viel Gefühl für Farben und Bilder aus, dem Liebesgedicht ebenso gelingen wie die Strophen über „Lena, Of the Windy Hill“, die „lächelt mit dem Schwanz“, oder das kolportagehafte „VersFeuilleton“ mit einer unerwarteten Pointe. Und doch. Am Ende – Fazit aller Lebenserfahrung? – stehen Texte, aus denen uns ein Hauch von Resignation anweht.
Der Ausgabe fehlen leider drei leserfreundliche Hinweise: auf das Erscheinungsjahr des Vorgängerbandes; auf den Zeitraum, in dem die vorliegenden Texte entstanden sind; und auf „Balthus“, mit dem wohl der bildende Künstler gemeint ist, der 1998 seinen 90. Geburtstag feierte.
Margret Czerni, blickpunkte, II/1999
Unterwegssein
Der vorliegende Gedichtband des niederösterreichischen Georg-Trakl-Preisträgers Hans Raimund bietet sich an, einen österreichischen Dichter zu entdecken, dessen Texte zwar schon in mehrere Sprachen übersetzt und mit einigen Preisen ausgezeichnet worden sind, der aber hierzulande kaum bekannt ist.
Seine Gedichte handeln vom Scheitern und Gelingen, von der Vielfalt menschlicher Eigenschaften und Spezifika und wenden sich im Handumdrehen dem immer wiederkehrenden Thema jedes Dichters zu: der Liebe. Dennoch steht die Liebe nicht im Mittelpunkt seiner Lyrik. Raimund durchleuchtet mit leichtfüßiger Feder das unüberschaubare Umfeld einer ganzen Gefühlswelt, der wohl einzig und allein die Poesie eine Zunge verleiht. Manche Texte erinnern durch ihre Form an antike Epen, obwohl der Autor sich beinahe gänzlich dem Zeitgenössischen widmet und dabei oft komplette Geschichten erzählt. „Gtschssn! Gtschssn!“ / VersFeuilleton“ erzählt die brutale Geschichte des obdachlosen Amerikaners Ronald, der durch ein medizinisches Wunder zum Medienstar wird und nach jahrelanger Ausnutzung einen verstümmelten Satz zu seinem prosaischen Ende bringt.
Hans Raimunds Übersetzertätigkeit spiegelt sich in manchen Gedichten wider, wo sich italienische, französische Sätze nahtlos in deutsche Poesie fügen, und ein Gedicht gänzlich in englischer Sprache geschrieben ist. Sein Sprachentalent wird aber auch in vielen Texten spürbar, denn der Klang und die Melodie seiner Lyrik ist getragen von jenem Horizont, der sich erst öffnet, wenn der Umgang mit der eigenen Sprache durch die Kenntnis anderer leichtfüßig wird.
Die Gedichte des vorliegenden Bandes sind in drei Kapitel unterteilt, wobei das letzte „Von Unterwegs“ den gesamten Zyklus des Unterwegsseins umfasst. Hier vertiefen sich die poetischen Fertigkeiten Raimunds zur wahren Dichtkunst, der in „Nimbus aus Eis“ meint:
FROST auf den Halmen der euch die Lippen verbrennt
Blast ihr Eindringlinge euer falsches Lied darauf
Rudolf Kraus, Morgen 2/99 ebenso in Podium, Heft 100, Dezember 1998
Zu entdecken
„Trotzig verweigert er das Einverständnis mit dem Kulturbetrieb, während er doch die Kommunikation mit dem Leser durchaus sucht.“ – Verlags-Hinweis auf die Person des Niederösterreichers Hans Raimund – Germanist, Autor, Übersetzer, mehrfacher Preisträger: Trakl-Preis für Lyrik, Auden-Preis für Übersetzer. Kompetent also in vieler Hinsicht. Im Literaturbetrieb tatsächlich nicht so sehr vordergründig präsent. Deshalb sei aufmerksam gemacht auf seinen Lyrik-Band Porträt mit Hut. Ein Breitband-Produkt. Von der minimalistischen Kürze zum „VersFeuilleton“, einer Art Weiterführung der Moritat mit freier syntaktischer Form. Gesellschaftskritik und Liebeslyrik finden nebeneinander Platz und haben gleich dichte emotionale Glaubwürdigkeit. Bis hin zur extremen Einfachheit, mit der eine Botschaft vermittelt wird, ohne banal zu werden:
Ich reise sinnlos
Der Leib ist hier
Der Sinn die Sinne
Sind bei dir
Gefühl, auf ein Text-Telegramm verknappt.
23.10.1998
Hans Raimund: Porträt mit Hut
Mit so einem Klappentext kann man keinen Erfolg haben. Der Otto-Müller-Verlag teilt uns auf dem Innencover von Hans Raimunds neuem Lyrikband Porträt mit Hut die erstaunliche Tatsache mit, daß die Gedichte des Autors vom Amerikanischen bis zum Albanischen übersetzt worden seien und dass sich diese Lyrik den „großen Themen der Menschen“ und den „kleinen Dingen des Lebens“ zuwende. In Österreich hingegen sei Raimund vergleichsweise unbekannt; nun ja, bei einem solchen Marketing verwundert das kaum.
Raimund wurde 1945 in Niederösterreich geboren und lebt seit vielen Jahren in Duino bei Triest, an jenem Ort also, an dem Rainer Maria Rilke den ersten Teil seiner Duineser Elegien geschrieben hat. Mit Rituale legte der Autor 1981 einen vielversprechenden Band mit expressiven Kurzprosaarbeiten vor, seither sind mehrere Gedichtbände erschienen. Auch im Porträt mit Hut ist keine einheitliche Stimmlage festzustellen, der hohe Tonfall fehlt gänzlich, auch wenn eines der Gedichte „Blake“ heißt und in einem anderen „Rilke (gott)väterlich segnend…“ einen kurzen Auftritt hat. Solche innerliterarischen Bezüge sind bei Raimund jedoch nicht sehr ausgeprägt. Eine Stelle ließe sich als eine kleine Parodie auf James Joyce („Porträt des Hundes als Welpe in Italien“) verstehen, bei einem anderen Gedicht gibt ein – heute fast vergessener – Werbetext den Titel vor: („Mittwoch ist SubstralTag!“).
Um zu dichten, ist dem Autor offensichtlich ein jeder Tag recht. Keine besonderen Vorbereitungen sind vonnöten, kein spezielles Formgesetz will erfüllt werden. Dichtung ist bei Raimund zu einer alltäglichen Verrichtung geworden. Beobachtungen, Entdeckungen und Gedankensprüche werden ganz nach Bedarf vermerkt. Dies ergibt eine autodidaktisch gewachsene Poesie, die mit Genauigkeit und Witz arbeitet und dies alles auch noch an den kleinsten Dingen festzumachen versteht:
GIESS DIE BLUMEN gieß sie
Die Getopften Ausgesetzten Wilden! …
Pilze sprießen schon
Weide dich an Knospen!
Schweig in Blüten! … Insgeheim
Schließt das Heer der Pflanzen
Den BelagerungsRing um uns:
Klaus Kastberger, literaturhaus.at, 21.10.1998
Porträt mit Hut. Gedichtband von Hans Raimund
Das Messer in der Brust
Steigt morgens er aufs Trampolin
Nimmt springend Schwung katapultiert sich
Blindlings weg: hinaus … hinein …
Hinein in das Gedicht und hinein in die Vertracktheiten, die Sprache für uns bereithält, so wäre zu ergänzen.
Die Gedichte des Lyrikers Hans Raimund sind nicht nur kleine Exkurse über das Schreiben und Reden, sondern auch Miniaturen über das Anfangen und das Beenden, über das Gehen und Kommen, über das Reisen und das Sich-Erinnern – kurz: Es sind Gedichte über das, was wir uns angewöhnt haben, „das Leben“ zu nennen.
Dieses Leben findet bei Hans Raimund in unterschiedlichen geographischen Winkeln Europas statt – was nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, daß Hans Raimund ein in Wien aufgewachsener Österreicher ist, der ein gutes Jahrzehnt lang in Duino bei Triest gelebt hat und sich überdies als literarischer Übersetzer vor allem aus dem Italienischen einen Namen machte. Die mehrsprachige Existenz und die Auseinandersetzung mit den Verwerfungen der Geschichte Europas in diesem Jahrhundert hat in den zahlreichen zu Büchern gebündelten Gedichten Raimunds immer schon ihre Spuren hinterlassen. Der jüngst erschienene Lyrikband mit dem Titel Porträt mit Hut reflektiert jedoch all dies auf neue, konzentrierte Art und Weise. So etwa verklammern sich in der archaisch-spröden Karstlandschaft des Rilke-Ortes Duino die Spuren des geschichtlichen Stillstands mit der detailgenauen Wahrnehmung des lyrischen Ichs:
Die immer offene Türe zum Balkon schlägt an
Die Mauer gibt mir durch
Die disparaten Botschaften des Winds
Die zu entschlüsseln ich noch immer
Nicht imstande bin…
heißt es in einem von mehreren Duino-Gedichten. Und auch die anderen Orte in Raimunds Gedichten verschließen sich der Deutungsabsicht ihres Besuchers: ob Lissabon, Venedig, Zagreb oder Amsterdam.
ICH BIN IN EINER STADT
Ich sprech die Sprache nicht
Der Menschen hier Ich kenn
Zwar einen aber den
Auch nur dem Namen nach
schreibt Raimund. Was hier allenfalls gekannt und wahrgenommen werden kann, das sind die Namen, nicht ihr Sinn.
Um die Wahrnehmung – die eigene und die fremde – ist es Hans Raimund in seinen Gedichten immer schon zu tun. Der genaue, geduldige Blick auf die Dinge, die Orte und die Landschaften fördert die Doppelbödigkeit der Sprache ebenso zutage wie die Zweifel an allen möglichen Gewissheiten.
Hans Raimund schreibt nicht im schnellen Rhythmus der short cuts und der stakkatohaften Pointierung. Seine Szenerien entfalten sich im ruhigen Fluß der Sprache – und sind dennoch keine Idyllen, sondern beunruhigende Parabeln unserer Gegenwart und Vergangenheit.
„This is Vienna speaking“ ist ein Monolog betitelt, in dem einer einem anderen den Tod in Hitlers KZ wünscht in ganz und gar nicht gemütlichen Wiener Dialekt. Wien überhaupt ist in den Texten Raimunds immer zugegen – und sei es nur als genuin wienerisch anmutende Melancholie: ein charakteristisches Schweben zwischen Traum und Trauma, zwischen sprachspielerischem Impuls und derbem Dialekt, amerikanischer Rock-Ballade, Rilke-Anspielungen und finaler Sprachskepsis. Wien – das ist die in langen Habsburger-Jahrhunderten gewonnene Erkenntnis, daß alles Mühen um die Wirklichkeit des Lebens letztlich vergeblich ist. Was zurückbleibt, ist eine schier bodenlose Müdigkeit, die sich lähmend auf die Augenlider des Sprechenden legt:
SO MÜD DES ATMENS müd
des Essens Trinkens Schlafens…
heißt es im Text, wo einer aber auch des „MüdSeins“ selbst müde ist. Und auch das titelgebende „Porträt mit Hut“ entpuppt sich letztlich als traditionsgesättigter Betrachter-Blick in einen leeren Spiegel:
DIE GESTE FÄLLT DIR AUS
Der Hand
Das Lächeln rinnt dir aus
Dem Mund:
Dir wetterwendischem
In all
Den Farben schillerndem
Poseur –
aaaaaastets auf
Der Hut.
Das Misstrauen als lyrische Haltung steckt zwischen den Zeilen der Raimundschen Gedichte. Aufmerksame Leser sind ihnen zu wünschen.
Dagmar Lorenz, DeutschlandRadio, 2.12.1998
Das österreichische Gedicht
zwischen Zaubersprüchen und Alltagsbewältigung.
Hans Raimund hat von den hier vorgestellten lyrischen Neuerscheinungen wohl am ehesten seinen Platz in den Bücherregalen gefunden und kann inzwischen auch in verschiedenen Sprachen gelesen werden, seine Gedichte sind ins Englische ebenso übersetzt wie ins Albanische, Italienische und Bulgarische. Hierzulande wird er – abseits der Moden – wohl nicht in dem Ausmaß zur Kenntnis genommen, wie es ihm zukommen würde. Auf diese Situation trifft wohl auch das Gedicht „Obwohl er“ zu:
Obwohl er
– Nun da er sich mutwillig für immer jede Möglichkeit
Zur Erlangung eines unkündbaren BeamtenPostens
verscherzt hat –
Sich durch diverse Mitgliedschaften Preise
Fast zwei Dutzend Bücher Etliche SchreibMaschinen
Einen Computer Stapel von grünem gelbem weißem
Papier
in seiner nie ganz geklärten Absicht bis auf weiteres
bestätigt glaubt
(…)
Zu glauben gewillt ist
Daß ihm der Große Sprung unter gehörigem
TrommelWirbel
Eines Tages doch noch gelingen werde.
In den Gedichten finden sich viele Ansätze, diesen „Großen Sprung“ trotzdem zu wagen, trotz der mißglückten Versuche, trotz des Scheiterns. Es sind Selbstvergewisserungen, es noch einmal zu versuchen:
ES IST DIE ZEIT JETZT aufzustehen
Der erste Hahn hat schon gekräht…
Vergiß den Wunsch des Abends morgens
Nicht mehr aufzuwachen
(…)
Bei KlappMesser einhundertdrei knurrt
Dir der Magen schon vor Hunger
Auf den Tag…
In unserer Auswahl verschließt sich sein Bändchen Porträt mit Hut wohl am stärksten einfachen Anwendungen. Die Welt wird hier nicht lyrisiert, sondern zum Teil neu erschaffen, mit sprachlichen Mitteln, abgesteckt mit lyrischen Koordinaten, aber auch hermetisiert. Fast scheint es so, als sollte sie abgedichtet und geschützt werden vor einfachen Zugriffen. Dies geht nicht ohne Arbeit ab, eine Arbeit, die auch vom Leser gefordert wird, und ein Bemühen, das nicht immer von Erfolg gekrönt ist – zumindest nicht beim Rezensenten, und ein böses Wort lauert: Nabelschau, Beliebigkeit. Oder liegt es nur am fehlenden Schlüssel?
Hab keinen Schlüssel der
Mir Türen öffnet hab
In meiner Hand nur die
Gelochte Karte für
Das Zimmer im Hotel.
Und doch kommen Botschaften an: „Sekundenkurz die SchattenSkizze eines jungen Baumes“, dazwischen auch immer wieder die Bekräftigung, daß diese Welt nicht zur Gänze betreten werden kann:
Keiner wird je den eisigen Keller betreten… HerzHälften
Lähmen den absteigenden Fuß nötigen halbwegs zur
Umkehr.
Robert Streibel, Die neue Furche, 25.3.1999
Das Problem mit der Schönheit
„Niemand weiß, was ein Gedicht ist. Aber alle wissen ganz genau, warum eigentlich keine mehr geschrieben werden dürften.“ Mit dieser These eröffnet der Schweizer Germanist Peter von Matt einen Band über „Dichter und Gedichte“, der geeignet ist, sich grundsätzlich und exemplarisch der Frage nach dem Stiefkind der Literatur, der Lyrik, zu widmen. Keine Frage: Das Gedicht führt ein Schattendasein. Lyrikbände sind keine Bestseller, die Auseinandersetzung mit Gedichten findet auch in den großen Feuilletons kaum statt.
Autoren, die sich auf das Schreiben von Gedichten beschränken, gelten als exotische Randfiguren des Literaturbetriebs.
Und dennoch unterliegt die Lyrik wie keine andere Gattung einem strengen poetischen Moralkodex, der genau vorschreibt, was gerade noch und was eigentlich alles nicht mehr geht: Reime sind indiskutabel, tradierte Formen wie Sonette oder Terzinen gehen nur, indem sie experimentell unterlaufen werden, die poetische Verklärung von Natur, Welt oder Leid ist a priori verdächtig, und wer auf den hohen Ton, auf Schönheit aus ist, kann nur reaktionär sein.
Das Gedicht, so die These Peter von Matts, ist ein Ärgernis. Und es ist deshalb ein Ärgernis, weil es, allen Tendenzen der Moderne zum Trotz, schön sein will. Dieser lyrische Wille zum Schönen ist für Peter von Matt allerdings ein „anthropologisches Ereignis“, deshalb auch von keiner wie auch immer gerichteten Kunsttheorie außer Kraft zu setzen.
Das Gedicht ist Ausdruck jener Urerfahrung des Menschen, die Peter von Matt die „zweite Beute“ nennt: die Sehnsucht nach Vollkommenheit.
Seit der Mensch denken kann, ist die Vollkommenheit die zweite Beute, auf die er, neben den erlegten Tieren und den erschlagenen Feinden, auf immerwährende Jagd zieht.
Vollkommen aber ist nur etwas, was der Zeit widersteht. Schönheit ist Ausdruck einer Intensität, die unzerstörbar sein will.
Das Gedicht wird so zum stummen Protest gegen die „Herrschaft der offiziellen Geschwindigkeit“, das Insistieren des Gedichts auf seine wahre Gestalt muß zur Provokation werden. Das Gedicht ist jeher dem Verdacht ausgesetzt, „Lüge und Luxus“ zu sein, wo es doch überall angeblich um Wahrheit und Nützlichkeit geht, und es kann diesem Verdacht – aller demonstrativer Gesinnungs- und politischer Gebrauchslyrik zum Trotz – nicht entkommen. Es bleibt ein Störfaktor, der – und dies gehört zum Charakter von Provokationen im Zeitalter der Beliebigkeiten – nicht weiter stört.
Die Thesen Peter von Matts, die er selbst durch eine Reihe subtiler Gedichtinterpretationen konkretisiert, lassen sich auch durch einen Blick auf avancierte Gegenwartslyrik jederzeit verifizieren. Vor kurzem erschien ein Gedichtband von Hans Raimund, der sich als Autor und Übersetzer, unbeirrt von den Geistern und Moden der Zeit, in exemplarischer Zurückgezogenheit der Lyrik widmet. Porträt mit Hut ist eine Sammlung von Gedichten unterschiedlicher Thematik und Bauart, die, virtuos und bescheiden zugleich, einen verklärenden und in der Verklärung gebrochenen Blick auf die Welt freisetzen.
Für die lyrische Evokation gibt es keinen besonderen Gegenstand. Alles kann Hans Raimund zum Motiv für ein Gedicht werden, und oft ist es das Unscheinbarste: Eine Zugfahrt, ein Spaziergang, ein Haus, ein Dorf, Lissabon, eine flüchtige Begegnung, ein Wetterbericht, ein Sondermüllcontainer, eine Zeitungsnotiz, eine Photographie. Immer wieder aber bricht dazwischen, oft nur leise angedeutet, ein Zentralmotiv Raimundscher Dichtkunst und Movens aller großen Lyrik auf: eine Liebe, die im Gedicht um ihre Dauer ringt:
Ich reise sinnlos
Der Leib ist hier
Der Sinn die Sinne
Sind bei dir.
Ohne prätentiös zu sein, sind Hans Raimunds Gedichte in hohem Maße formbewußt. Vom strengen, abgezirkelten Rhythmus über sublim angedeutete tradierte Formen bis zur melodischen Prosa und dem Risiko des offenen Reims reichen seine Möglichkeiten, er beherrscht die Ausdrucksvaleurs des elegischen Tons ebenso wie die der sarkastischen Rede, und nicht selten blitzen überraschende Metaphern auf, ohne daß sie je im reinen Experiment versandeten. Nichts demonstriert dies vielleicht besser als das mit Bedacht gewählte Gedicht, das dem Band den Titel gab: „Porträt mit Hut“:
DIE GESTE FÄLLT DIR AUS
Der Hand
Das Lächeln rinnt dir aus
Dem Mund:
Dir wetterwendischem
In all
Den Farben schillerndem
Poseur –
aaaaaastets auf
Der Hut.
Konrad Paul Liessmann, ALBUM, 8.1.1999
Hans Raimund
Der Niederösterreicher Hans Raimund hat in seiner Lyrik eine eigene Sprache mit ungewöhnlichem Satzgefüge entwickelt. Porträt mit Hut (Otto Müller Verlag) heißt sein neuer Band, in dem er Themen wie Liebe, Einsamkeit, Existenz und Reisen aufgreift. Raimund ist einer, der genau hinsieht und hinhört und diese Wahrnehmungen subtil umsetzt. Die Texte hinterlassen Spuren: kleine Kratzer im Gedächtnis, Wunden, die aber wieder heilen und zum Weiterleben animieren. Raimund – ein zeitgenössischer Dichter von Großformat.
Flachgauer Nachrichten, 15.10.1998
Zum 70. Geburtstag des Autors:
David Axmann: Wider-Klang der Welt-Betrachtung
Wiener Zeitung, 3.4.2015
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram +
ÖM + Kalliope
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Raimund im Interview mit Gerhard Winkler für die Literatur-Edition-Niederösterreich am 13.4.1999 in Hochstraß.



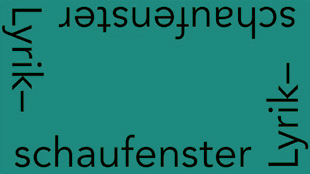
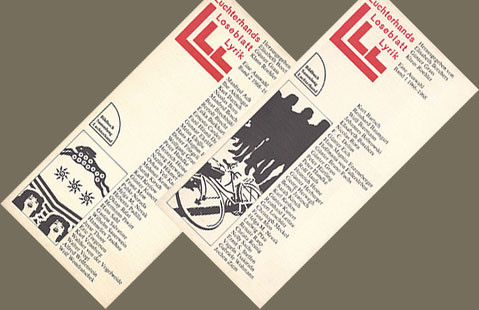



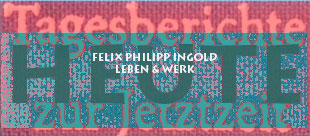
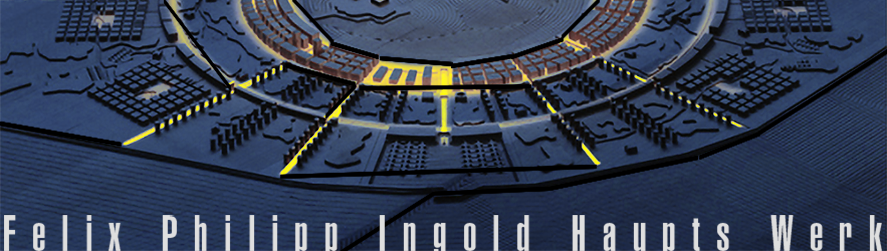
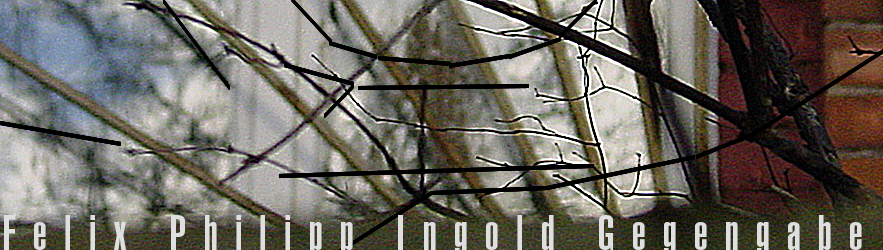
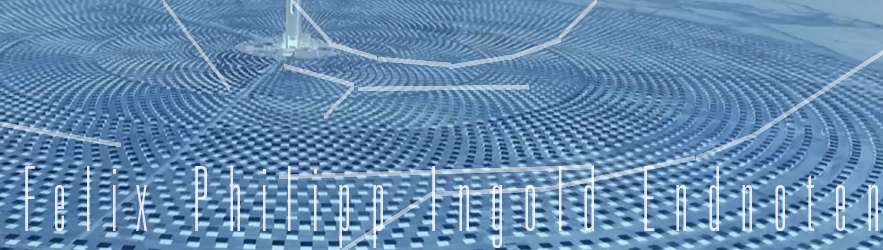

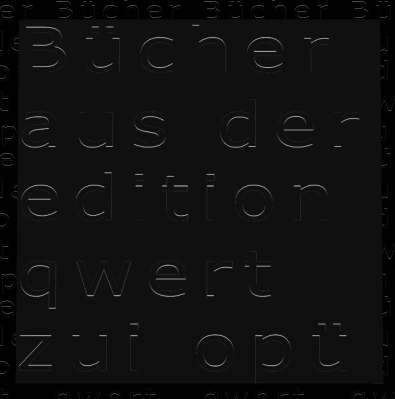
Schreibe einen Kommentar