Hans Raimund: Trauer träumen
(POETIK)
Um vieles könnte es in dem Gedicht gehen
Um ein Amselnest in den Weigeliabüschen
Um die Enttäuschung über das Fehlen gesprenkelter
Eier … Um einen Storch verbellt vom Hund
Eine Hängematte voller Birkensamen und einen Stuhl
Aus Metall Der Hund der dürfte nicht vergessen werden
Wie er den Kopf auf einen Querbalken des Tisches legt
Und daß irgendwer auf eine Pfote tritt unabsichtlich
Das Seufzen der prompte Entzug des Laufs … Auch
Nicht das Hochwerfen der Münze Kopf oder Adler?
Das unauffindbare Geldstück Die Erleichterung …
Ein Nachbar könnte ans Hoftor schlagen unerwartet
Einen Sack getrockneter Pilze vom Herbst in der Hand
Eine Delikatesse in der Rahmsuppe mit viel Kümmel
Er könnte die erste Zeile der nächsten Strophe sagen :
Ich habe nicht vergessen dass ihr so gern Pilze eßt
Es könnte regnen oder schneien in dem Gedicht
Oder es könnte auch so bleiben wie es schon lang ist
Unbeständig aber ohne nennenswerte Niederschläge
Die der Alte von gegenüber sonst in Zentimetern mißt
Es könnte jemand auf einem Klavier spielen
Irgendwo in einem Stall mit niedriger Holzdecke
So daß es trotz geschlossener Türen und Fenster
Bis auf die Dorfstraße zu hören ist Aber niemand
Bliebe stehen um zuzuhören als ob ein Klavier
Im Dorf etwas Ungehöriges wäre Auch die Stimme
Die zu laut begleitet erklänge bliebe ungehört :
Vorwärts und nicht vergessen die Solidarität …
Zum Glück auch der Rhythmus des Marschlieds
So anders als die Märsche örtlicher Musikkapellen
Unnötig wäre es die Anzahl der Zeilen in einer Strophe
Zu erhöhen etwa durch die Wiederholung einer Wendung
Deren Wortlaut jedesmal leicht abgeändert wird
Unbedingt sollte aber der Korb Nüsse erwähnt werden
Aus dem täglich fünf Stück die Ration für die Eichhörnchen
Genommen und auf dem Scheunenstaffel ausgelegt werden
Auch ein Gast des Hauses könnte zu Wort kommen
Selbst wenn es zugegebenermaßen schwer fiele einen Satz
Zu finden den nur er gesagt haben könnte Was die Gäste
So sagen zeichnet sich doch zumeist dadurch aus daß es
So oder anders von vielen schon oft gesagt worden ist
Aber der Ton mit dem der Gast das Oftgesagte leise aber
Deutlich spräche klänge zugegebenermaßen einzigartig
Würde alle die es hören und lesen überzeugen wovon
Das ist gleichgültig Ist doch der Ton das Ausschlaggebende
Vielleicht wäre es das Beste das worum es in dem Gedicht
Gehen könnte den Wettern auszusetzen dem Regen
Dem Schnee den Stürmen der Schwüle … den Zufällen
Der Witterung eben dem Zufall um den Formulierungen
Eines Rezensenten zu entsprechen der über den Autor sagt :
Um zu dichten ist dem Autor ein jeder Tag recht Keine
Besonderen Vorbereitungen sind vonnöten kein spezielles
Formgesetz will erfüllt werden Dichtung ist bei ihm zur
Täglichen Verrichtung geworden Beobachtungen Entdeckungen
Und Gedankensprüche werden ganz nach Bedarf vermerkt Also
Könnte es im Gedicht um irgendwas gehen … um eine Wohnung
Irgendwo in Wien ein Zimmer voller Büchern in dem gerade
Die Platte mit Poulencs Trio für Klavier Oboe und Fagott
Gespielt wird um ein paar junge Franzosen Theaterleute
Ein Mädchen ganz glücklich Französisch reden zu können
Das von einem zum anderen geht lächelnd sich in ihrem
Element wissend … Oder vom selben Mädchen das irgendwann
Beim Überqueren der Straßenbahngleise von einem Wagen
Erfaßt durch die Luft geschleudert auf das Pflaster prallt
Mit gebrochenem Genick liegen bleibt sterbend während
100 Meter weit weg in der Wohnung jemand wartet auf sie
Die nicht geahnt hatte daß sie sich zu den Toten aufmachte
Tatsächlich dort auch ankommen würde … Von der Unfähigkeit
Zu trauern könnte die Rede sein von der Unmöglichkeit
Des Trauerns überhaupt der Scham des Überlebenden von der
Unverändert jungen Gegenwart des Mädchens in den Träumen
Des auf sie Wartenden bis heut nach so vielen Jahren … Um
Die obligaten Trauervokabeln … Und dass sie Unbilden aller
Arten ausgesetzt von den Türmen den Giebeln den Wipfeln
Den Sockeln heruntergerissen werden durcheinandergewirbelt
Zerbrochen zerstampft zersplittert zermahlen … zernichtet
Der Verlust eines geliebten Menschen prägt,
und das Geschehene zwingt den Über- und Weiterlebenden nach vielen Jahren Bilanz zu ziehen, über die Zeit vor und nach dem Unglück. In seinem neuen Buch stellt sich der Autor Hans Raimund einer langen inneren Auseinandersetzung um den Tod seiner ersten Frau vor mehr als dreißig Jahren.
Die Unfähigkeit zu trauern und die Unmöglichkeit, die beständige Gegenwart dieser Frau aus den eigenen Träumen zu verbannen, finden hier ihre unvergleichliche Sprache.
Der eigene Hof, ein Streckhof im burgenländischen Hochstraß, wird dem Autor zum schöpferischen Ort: unscheinbare Dinge des Alltags rücken in den Vordergrund, wiederkehrende Erinnerungen, Träume, bizarr wie verstörend, durchziehen die Gedichte und Prosastücke, aus denen Angst und Resignation, Trotz und Melancholie sprechen.
Erneut zeigt Hans Raimund seine Souveränität im (musikalischen) Umgang mit der Sprache, die er zur eigenen, unverwechselbaren Sprachkunst verwandelt. In der Verschiedenartigkeit der Töne vertiefen sich die Eindrücke. Hans Raimund versteht es, Gehalt und Atmosphärisches in eine tönend bewegte Form zu übertragen.
Otto Müller Verlag, Klappentext, 2004
Oder vom selben Mädchen
– Trauer träumen: Hans Raimunds Gedichte über die vielen kleinen Dinge und die eine große Tragödie. –
Der österreichische Schriftsteller Hans Raimund, der so alt ist wie unser Frieden, hat erst spät, mit seinem 1989 veröffentlichten Gedichtband Der lange geduldige Blick, einige Anerkennung gefunden. Damals lebte er in Duino bei Triest, abgeschieden vom Kulturbetrieb und doch offen für seine Umgebung und ihre literarischen Geheimnisse. In Italien hat er Virgilio Giotti, Umberto Saba, Lucio Piccolo, Rocco Scotellaro, Attilio Bertolucci für sich entdeckt und diese Entdeckungen mittels Übersetzungen, Aufsätzen und Empfehlungen auch anderen mitgeteilt. Überhaupt ist er ein Autor, dessen stolzes, ja trotziges Beharren auf Distanz mit einem wachen Interesse am Bemühen anderer korrespondiert. Eitelkeit ist ihm fremd, das merkt man seinen Prosastücken und Gedichten an, auch wenn sie ausschließlich aus eigenem Erleben und Empfinden schöpfen.
Im autobiografischen Bericht „Landnahme“ erinnerte sich Raimund eines Augenblicks der Hilflosigkeit, die ihn bei der Frage überkommen hatte, wo er sich denn eigentlich zu Hause fühle.
Sonst nicht auf den Mund gefallen, reagierte ich gar nicht schlagfertig, auch deswegen, weil ich, um ehrlich zu sein, um eine Antwort verlegen war, fühlte ich mich doch überall, wo ich einmal längere Zeit gelebt hatte, zu Hause: voll Widerwillen in der Stadt Wien, die ich zu gut kenne, voll Faszination, die vom Fremden ausgeht, in Italien, voll Euphorie im Burgenland.
Dort, im mittleren Burgenland, im alten Streckhof eines Weilers nahe Lockenhaus, ist Hans Raimund seit genau zehn Jahren also tatsächlich zu Hause, immer noch euphorisch gestimmt. Davon kündet glaubhaft schon das erste Gedicht „aus den Hochstrasser Heften“. Darin beschreibt er das Haus, die „sechs durch offene Türen / Zu einem Raum gestreckten Räume“, mit bloßen Füßen, „behutsam aufgesetzt, um ja nicht Fliege / Spinne oder Assel zu zertreten“.
Den langen geduldigen Blick wendet Raimund immer noch an Menschen, Tiere, Gerätschaften. Aber mir scheint, er ist in den letzten Jahren barmherziger geworden, sorgsamer, milder: Er nimmt das, was er sieht, nicht nur im gegenwärtigen Zustand wahr, sondern auch in den Möglichkeiten, die dem Gesehenen innewohnen. Im Pendlerdorf wird der zugereiste Dichter, auch das teilt sich in Versen mit, nicht mehr nur geduldet und misstrauisch beäugt, sondern als zugehörig anerkannt – ohne dass er hierfür das Opfer der leutseligen Verstellung erbringen musste. In einem langen, schlichten, gleichwohl raffiniert komponierten Gedicht, „(Poetik)“ überschrieben, benennt er die äußeren Bedingungen seiner Befindlichkeit, in einer Art Bestandsaufnahme des geruhsamen Alltags, sowie Anlass und Vorgang des Schreibens. Aber das Gedicht geht ja weiter, weg von hier und heute, 30 Jahre zurück, nach Wien, an die Seite eines Mädchens, das „lächelnd sich in ihrem / Element wissend“ in einer Wohnung Gäste betreut.
Von diesem erinnerten Glück, meint Hans Raimund, könnte das Gedicht künden.
Oder vom selben Mädchen, das irgendwann
Beim Überqueren der Straßenbahngleise von einem Wagen
Erfasst durch die Luft geschleudert auf das Pflaster prallt
Mit gebrochenem Genick liegen bleibt sterbend.
Das ist das eigentliche Thema des Gedichtbandes: der frühe Tod von Raimunds erster Frau, der Mutter seiner Tochter, seine Erinnerung an sie, seine Träume von ihr, seine behauptete Unfähigkeit zu trauern, seine Scham, sein Altern – und die „unverändert junge Gegenwart des Mädchens“. Vor diesem Zyklus, oder dazwischengestellt, erhebt sich die andere Gegenwart, Dorfleben, Zivilisation und Natur ineinander verschachtelt, ein totgefahrener Marder, Vogelschreie, Wildschweinschemen, im blinden Winkel des Sehenden seine jetzige Gefährtin, die zweite Frau, deren Menschenfreundlichkeit er – im Buch Strophen einer Ehe – rau und zärtlich zugleich gerühmt hat.
Erstaunlich, wie straff und konzentriert dieser Gedichtband wirkt, obwohl sein Autor alle möglichen Strophenformen, Rhythmen, Tonhöhen, Sprechweisen, musikalischen Strukturen und metrischen Systeme verwendet und immer wieder vom Thema abschweift, zurücktritt oder nach vorn, indem er sich selbst beobachtet, Lektüreeindrücke mitteilt, sein „Leben mit dem Tier“ (Hundefreunde können hier ihre Seele wiederfinden!) kommentiert, das eigene poetische Credo verkündet: „Form“, so behauptet er, sei für sein Schreiben seit je wichtiger als „Inhalt“. Die Formulierung ist allerdings missverständlich; gemeint ist, glaube ich, dass Raimund jedesmal aufs Neue um die künstlerische Gestalt ringt, er hat keine Mulde, in die er von Mal zu Mal seine lyrischen Ergüsse klatscht. Er hat was mitzuteilen, Schreiben ist ihm Verständigung. Aber wie er sich zu verständigen versucht, das ergibt höchst eigenwillige und überraschende Gedichte.
Das tote Mädchen hat im Buch keinen Namen, nur Initialen: E. R., und Lebensdaten, wie auf Grabsteine gemeißelt: „(1947 bis 1973)“. Es wird auch nicht lebendig, in den Versen dessen, der ihrer gedenkt und in immer neuen Anläufen das Unmögliche versucht, auch wenn er weiß, dass alle Anstrengung vergebens ist, und dieses Wissen hinausschreit oder haucht: das Leben des Mädchens E. R. zu retten, seinen Unfalltod schreibend aufzuheben, wenigstens ein paar Atemzüge, zwei, drei Verse lang. Aber immerhin:
Noch ist es Zeit das Leben von
Einst in der grammatikalisch
Korrekten gebräuchlichen Form
Der Vergangenheit als etwas
Abgeschlossenes das noch mit
Gehöriger Anstrengung erinnerbar ist
Zu erzählen.
Tatsächlich hat Hans Raimund mit diesen einfachen wie komplizierten, manchmal gefälligen, dann wieder vielfach zerfurchten und zerfetzten Gedichten ein Werk geschaffen, das sich wie eine Erzählung liest: über viele für gering erachtete Dinge und eine große Tragödie.
Hans Raimund liest am Mittwoch, dem 24. November, um 19 Uhr im Literarischen Quartier der Alten Schmiede, Schönlaterngasse 9, Wien I, aus seinem neuen Buch.
Erich Hackl, Die Presse, 13.11.2004
Trotzige Trauer
Es gibt Dichter, zu deren wachsendem Ruf es gehört, unentdeckt zu sein. Zu ihnen gehört auch der Österreicher Hans Raimund. Bei zumeist kleineren Verlagen erscheint Gedichtband auf Gedichtband. Es ist dies eine geschäftliche Regelmäßigkeit, die vom profunden Außenseitertum des österreichischen Lyrikers beinahe schon wieder ablenkt. Trauer träumen hat Hans Raimund sein jüngstes Buch genannt. Es ist ein großer Abgesang auf die eine Liebe, eine trotzige Trauer, die sich nicht in poetische Couture zu hüllen versucht. Das Raue in mir heißt ein Essayband Hans Raimunds. Das Unversöhnliche ist darin ein autobiografisches Element, das in Raimunds Poetik überhaupt bestimmend ist. Etwas authentisch Unversöhntes hat es auch, wenn Trauer träumen in einer Vielzahl von Stimmlagen daherkommt. Da gibt es „Versuche im, hohen Tone‘“ und von schlichtem Zorn getragene Rekurse auf den Nazi-Vater, es gibt Träume in Prosa, barock wirkende Formzertrümmerungen, vor allem aber, und in vielerlei Gestalt, Nänien auf die Liebe eines Lebens. Der verunglückten ersten Frau Hans Raimunds gelten diese Gedichte, wie der Klappentext erzählt. In genuesischen Landschaften und in der Natur überhaupt findet sich die Spur des Todes, „die Saat der malignen Male“ geht noch in den harmlosesten Bildern auf. Hans Raimunds Trauer träumen ist Poesie einer Zumutung, kraftvoll und elegisch. Ab und zu bleibt noch „das jähe Sehnen“, bleiben hoffnungslose Wünsche, die „das enthüllte Heu zu grünem Gras zurück verwandeln“.
Jdl, Neue Zürcher Zeitung, 15./16.1.2005
Buchbesprechung
Um so vieles „könnte es in dem Gedicht gehen“, dass es tatsächlich nicht nötig ist, „die Anzahl der Zeilen in einer Strophe zu erhöhen, etwa durch die Wiederholung einer Wendung“: Ein Geldstück, ein Amselnest, ein vom Hund verbellter Storch könnten vorkommen. Auch um eine Wohnung in Wien, um ein Zimmer voller Bücher könnte es gehen. Oder um ein Mädchen, „das irgendwann beim Überqueren der Straßenbahngeleise von einem Wagen erfasst durch die Luft geschleudert auf das Pflaster prallt, mit gebrochenem Genick liegen bleibt, sterbend, während 100 Meter weit weg in der Wohnung jemand wartet auf sie…“
„Poetik“ heißt dieser Text von Hans Raimund in der Sammlung Trauer träumen. Dieses „Gedicht“ ist zu einem Teil tatsächlich eine „Poetik“, spricht also „theoretisch“ vom Schreiben, etwa in der Bemerkung über das künstliche Strecken von Strophen. Der Text ist aber auch eine humorvolle Auseinandersetzung mit Literaturkritik – ganz einfach dadurch, dass der Autor in einer Strophe aus einer Buchkritik zitiert, und die dort vermerkten „Gedankensprünge“ als Legitimation nimmt für weitere solche:
Also könnte es im Gedicht um irgendwas gehen.
Dieses „irgendwas“ erweist sich als die Geschichte des Autors, der noch heute auf das Mädchen wartet, das da umgekommen ist, und der voll Trauer „von der unverändert jungen Gegenwart des Mädchens in den Träumen“ erzählt. Sieben dieser Träume erzählt der zweite Textblock.
„Das Mädchen“ ist die erste Frau des Autors, die vor dreißig Jahren verunglückt ist. Die Auseinandersetzung mit dem Verlust, die „Unfähigkeit zu trauern und die Unmöglichkeit, die beständige Gegenwart dieser Frau aus den eigenen Träumen zu verbannen“, sind Thema der „Lyrischen Texte aus den Hochstrasser Heften“. In burgenländischen Orten wie Hochstraß und in Wien lebt der Autor. Dorf und Stadt, Häuser und Höfe, Bewohner und Wohnungen sind Thema der Texte. Auch fremde Landschaften kommen vor.
Der vierte Textblock ist eine Art soziologischer Studie in gebundener Sprache: „s5erhaus“ und „Häuserblock“ schildern, nur durch Auflistung, das Miteinander und Nebeneinander von Menschen jeglicher Konfession und Profession. Durch den Text „Erbe“ (Untertitel „Der Hitler is mei Himmivata“) werden auch die vorhergehenden Texte in einen politischen Kontext gestellt: Was ist mit dem jüdischen Glaser Kraus im 6erhaus und dem „vormals Schuster Kolehar“?
Alle Text erfordern gründliche Auseinandersetzung, machen Lust aufs Dechiffrieren – sei es inhaltlich oder „poetologisch“ durch Ausfindigmachen der Zeilensprünge, die sich häufig im Zeileninneren aufhalten. Kaum ein Text lässt sich „überfliegen“ – und jeder einzelne ist ein Meisterwerk eines Sprachvirtuosen.
Heidemarie Klabacher, drehpunktkulter.at, 27.9.2004
Leseprobe
Nun kann man natürlich so tun, als wäre da eine bruchlos durchgehaltene Traditionslinie zwischen einerseits hermetischer Poesie und fünfziger-Jahre-Naturdichtung und andererseits dem heutigen Stand der Dinge in der ,res publica poetica‘. Man kann in Requisiten schwelgen, so viel man lustig ist. Symbolismen der Preislage „Sand“ / „Asche“ / „Vergänglichkeit“ neu erfinden. Wenn man gut ist – und das ist Hans Raimund – hat das Ergebnis am Ende sogar Hand und Fuß: Bearbeitet glaubhaft Jetziges, Tatsächliches, statt der Posen vorgestriger Statuen. Was man aber nicht kann, ist dies: Im Leser die Assoziationen und Erwartungen löschen, die an so einen „klassizistischen“ Tonfall geknüpft sind, an Kunstsprache, die bei vollem Bewusstsein ihrer Kunstsprachlichkeit dieselbe nicht, aber schon gar nicht problematisiert.
Soweit mein erster Eindruck von Hans Raimunds Trauer träumen^. Man mag zugestehen, der Mann sei nicht irgendwer. Er zählt zu denen, die hierzulande noch wissen, dass es irgendwann für Lyrik Regel und nicht possierliche Ausnahme war, gereimt, stramm rhythmisiert und dergleichen zu sein; zu denen, die wissen, welchen Sinn das einmal hatte. Auch zu denen, die aus solchem Wissen schöpfen: Nicht bruchlos, aber doch irgendwie mit den fernen Gevattern verbunden, wo wir Jungspunde die private Literaturgeschichte bei Brinkmann und Konsorten eröffnen.
Dass in dem Band wesentlich mehr getan wird, als nur die alten Leiern wieder anzuschlagen, auf dass sie nicht verstauben, sei aber nicht verschwiegen. In sechs stringent verklammerten Kapiteln findet sich genug Auseinandersetzung mit folgenden Themen, um mich die nächsten paar Wochen zu beschäftigen: Trauer, der geschützte Raum der Trauer, der Traum vom Verlorenen, seine Untragbarkeit angesichts des Hier-und-Jetzt, Strategien des Erwachens, der Erinnerung, des Vergessens. Das Ganze wird einmal privat, einmal „öffentlich“ angerichtet und durchaus nicht, ohne Zeitbezug herzustellen.
Trauer träumen zu lesen, das ähnelt dem Durchschreiten des in Teil I beschworenen, beschriebenen Streckhofes in Hochstraß, Raum für Raum. Nicht restlos kontemplativ ist es hier, aber definitiv abgeschieden, nicht in sich widerspruchsfrei oder gar „heil“, aber dem Unterfangen des Bandes angemessen: Eine sehr spezielle Trauersituation zu überformen und auf das Ich zurückzuführen. Anders gesagt: Wir beobachten ein Ich, das sich – nicht zum ersten Mal – durch einen Trauerprozess peitscht, um ihn endlich ad acta legen zu können. In diesem „Hof der Trauer“ ist natürlich nicht alles sogleich auf das zugrundeliegende Motiv bezogen: Verästelungen in die eine, Erforschungen gemeinsamer Nenner in die andere Richtung finden statt.
Da wäre etwa die genaue Klärung, die dem Begriff des „Hofes“ widerfährt, eine Vorbedingung für das eigentliche Unterfangen, die sich als solche aber erst nach und nach erschließt. Ordentlich, man ist versucht zu sagen, didaktisch weit holt Raimund aus.
Ein anderes Beispiel für das Ausgreifen der Trauer in alle Richtungen ist in dem vorhin verwendeten Schlagwort „Zeitbezug“ festzumachen. Hier wäre es allerdings zu modifizieren in Richtung „Bewusstsein der Geschichtlichkeit“. Ein Textbündel, das von ganz woanders in dieses hermetische Bauernhaus von einem Gedichtebuch hineinragt; hineingewachsen scheint wie der Zweig einer Brombeerhecke beim offenen Fenster hereinwächst: Teil IV, „Höfe noch einmal“.
Denn hier sind „Höfe“ eben auch die Wiener Gemeinde- und Zinsbauten mitsamt ihren Bewohnern, und die werden gnadenlos aufgezählt, finden ihren Ort, jeder für sich, in der Galerie des Raimundschen Trauerarbeitsgehöfts. Was ich hier mit „Bewusstsein der Geschichtlichkeit“ meine, wo doch das Vorbeidefilieren von haufenweise Einzelschicksalen durchaus auch als ein alter Hut des heimeligen Hier-und-Jetzt unter den lyrischen Effekten gelten kann? – Dass „Bewohner“ eben auch bedeutet: Frühere Bewohner. Vergaste, oder unter Hitler zu Geld und Ansehen gekommene, zum Beispiel. Womit Raimund mir die Heimeligkeit aber austreibt. Ohne dabei den real existierenden Charme der Bundeshauptstadt gleich mit aus seinem Aufzählungsgedicht zu verbannen. Sehr wohl, sirra, ein Kunststück. Und nicht einmal dem Relativierungsverdacht ausgesetzt: Geht es doch um „Trauer“ und „Höfe“, mithin darum, wie unter dem Verlust einzelner Aspekte bzw. Leben eine Welt sich konstituiert, zur Heimstatt wird, right or wrong, my country.
Man könnte nun noch auf Teil VI, „Danses Gothiques“, zu sprechen kommen, den Abschluss von Trauer träumen, auf das hier inszenierte Auseinanderbrechen von Sprache selbst, auf das Sinnloswerden von Gedichtgrenzen angesichts der Form der Verklammerung (als eines „Festhaltens am Sinn“), auf die Meisterschaft Raimunds, die sich auch hier im Detail zeigt, und dann…
Ja, dann muss man wohl, der man zu Beginn dem Band recht kritisch gegenüberstand, Erich Hackls Zitat zustimmen, wie es auf dem Umschlag steht:
…von Österreichs missachteten Autoren einer der bedeutendsten.
literaturhaus.at, 8.5.2010
Das Mädchen ER
– Trauerarbeit des Lyrikers Hans Raimund. –
Längst hat sich der Lyriker Hans Raimund einen Namen gemacht als eine gewichtige poetische Stimme der österreichischen Literatur. Regelmäßig alle paar Jahre bringt er sich mit einem neuen Gedichtband in Erinnerung. Auch als Übersetzer und Vermittler italienischer Autoren wie Sandro Penna, Umberto Saba, Lucio Piccolo und Virgilio Giotti ist Raimund in Erscheinung getreten, denn der Dichter lebte dreizehn Jahre, von 1984 bis 1997, in Duino nahe Triest.
Inzwischen ist Hans Raimund im mittleren Burgenland ansässig geworden. In Hochstraß bei Lockenhaus lebt Raimund nach eigener Aussage „voll Euphorie“. Er fühle sich in Hochstraß zuhause. „Ich schätze die Offenheit der hier seit jeher Ansässigen, die manchmal linkische Freundlichkeit, die sich, immer wieder und doch überraschend, in einem Teller mit selbstgemachter Bäckerei zu den großen Festen manifestiert, in einem Korb selbstgebrockter Kirschen oder einer Limonadenflasche voll selbstgebranntem Vierundzwanzigkräuterschnaps, sechzigprozentig, eine Medizin, sagt der Nachbar“, wie Hans Raimund in dem autobiographischen Text Landnahme erzählt.
Sein neuer Gedichtband Trauer träumen trägt als Konsequenz der nunmehrigen Lebenssituation den Untertitel „Aus den Hochstraßer Heften“. Der eigene Streckhof, den Raimund mit seiner Frau bewohnt, wird zum Thema eines Gedichtes, die ländliche Gegend, jener Ort, wo er heimisch geworden ist. Mit dem Hausherren betreten Leser und Leserin dessen Wohnräume. „In sechs durch offene Türen / Zu einem Raum gestreckten Räumen / Voll Schellenklang und Uhrenschlag … Und Nässe / Die aus den Mauern schwitzt als matter Glanz“ bewegen sie sich behutsam und durchschreiten sie „von hint nach vorn“, „um ja nicht Fliege / Spinne oder Assel zu zertreten“.
Hans Raimund ist mit der Natur vertraut, beobachtet sie, registriert und notiert. Indem er einer Philosophie der Nähe gehorcht, schärft er seinen Blick für das Detail. Beinahe wie Aphorismen oder Haikus, lapidar und deshalb streng komponiert, sind die „operas-minutes“, Momentaufnahmen von Geräuschen und Bildern, von Tönen und Eindrücken.
Seit Tagen schon :
Der Stamm der Birke
blutet aus dem Stumpf
Des in den Weg gestandenen
zur Unzeit abgeschnittenen Asts.
Ebenso beachtet der Dichter eine überfahrene Kröte oder die Rinde eines Nussbaumes. Die Umwelt erweitert sich zum Universum. Die Welt liegt näher, als man vermeint zu glauben, und die Beobachtung der Natur erlangt eine metaphorische Dimension. Mit dem Hund an der Leine ergeht sich der Dichter mehrmals täglich seine nächste Umgebung.
Bis heute sind für mich die Erkundung, Entdeckung und Inbesitznahme eines Lebensbereichs mit dem Gehen verbunden. Ich muß mir das ,Land‘ ergehen, um es zu erfahren. Fahrend im Auto oder auch auf dem Rad, erfahre ich nicht genug.
Langsam und bedächtig geht Hans Raimund vor, seine Gedichte kennen keine Hast, keine Hektik. Die Zeitlupe erscheint als die gültige Zeiteinheit.
Das lange, geduldige Schnuppern der Hunde lehrte mich den „langen, geduldigen Blick“ des Lyrikers auf die Objekte.
(Bereits ein 1989 veröffentlichter Gedichtband trug den programmatischen Titel Der lange, geduldige Blick.) Dieser bedächtige Zugang überträgt sich auf Leser und Leserin. Erst langsam, nach genauem und mehrmaligem Lesen, erschließt sich die Schönheit der Gedichte. Ich habe den Eindruck, Hans Raimunds Sprache ist im Laufe der Jahre knapper und dichter, noch reduzierter geworden. Einige wenige Worte gestalten ein Gemälde.
Hügel
Felder
Mais und Wein
Stöcke wilder Rosen
an den Rändern
Pennas nackte
Pappeln
stumm verwundert
Ratlos über Dächern
schwankt im Sturm
Ein Kran, Mittagsläuten.
Mitunter wird ein wesentliches Wort beharrlich ausgespart. In dem Prosagedicht „anwesend abwesend“ wird der Marder, von dem das Gedicht handelt, nicht beim Namen genannt. Umso präsenter scheint das Tier durch diesen formalen Trick zu sein.
Bevorzugt arbeitet Hans Raimund zyklisch, ordnet oder unterordnet seine Gedichte einem Thema. Bereits im zweiten Gedicht des Bandes kündigt sich die zentrale Thematik des Gedichtbandes an: der Tod seiner ersten Frau im Jahre 1973. Das Gedicht „Poetik“ ist überaus raffiniert gebaut, spielt scheinbar mit den Möglichkeiten, wovon ein Gedicht handeln könne: „Um vieles könne es in dem Gedicht gehen / Um ein Amselnest in den Weigeliabüschen / Um die Enttäuschung über das Fehlen gesprenkelter / Eier… // Es könnte jemand auf einem Klavier spielen / Irgendwo in einem Stall mit niedriger Holzdecke“, bis nach und nach die Erinnerung einsetzt, sich schließlich durchsetzt und die Geschichte einer Tragödie mit ein paar Pinselstrichen skizziert.
Ein Mädchen ganz glücklich Französisch reden zu können
Das von einem zum anderen geht lächelnd sich in ihrem
Element wissend… Oder vom selben Mädchen das irgendwann
Beim Überqueren der Straßenbahngleise von einem Wagen
Erfaßt, durch die Luft geschleudert auf das Pflaster prallt
Mit gebrochenem Genick liegen bleibt sterbend, während
100 Meter weit weg in der Wohnung jemand wartet auf sie
Im Zyklus „Träume“ nimmt Hans Raimund das Thema direkter wieder auf.
Ich träume
Sie schreitet durch die Räume
In meinem Kopf
Die hallend leeren weiten
Von Trauer überschneiten
Räume
In den Prosagedichten des Traumzyklus bedient sich der Dichter einer konsequenten Kleinschreibung, zumal niemand Substantiva mit Majuskeln träumt. Das Unbewusste stellt sich gegen die Realität, verweigert Tatsachen.
Ich bin empört : ER ist nicht tot
ER lebt! Das sagt mir meine Mutter
an einer für ein Fest gedeckten
Tafel Ich renne weg, verstört :
Unmöglich meiner Frau etwas
Davon zu sagen
Sieben Träume – eine symbolische Zahl. Raimund verschlüsselt, doch gibt er dem Leser Gelegenheit, die Condices zu knacken.
Knapp 20 Seiten umfasst der „frightful release“ der Zyklus „ER“, in dem einige Gedichte enthalten sind, die ohne Zweifel zu den besten und dichtesten von Hans Raimund zählen. Die Beschreibung einer Begräbniszeremonie, eingeklemmt zwischen dem Bestreben, sich der Beschreibung zu entziehen und sich zugleich damit zu konfrontieren, sich damit auseinanderzusetzen, sich schmerzvoll der Erinnerung auszusetzen.
Wie Rauch, dann echolose Stille…
Verpasst zum xten Mal fehl
Geschlagen der Versuch zu nennen den Namen die Gestalt vor Augen
hinzustellen, als wäre sie noch da…
Oder der letzte Abend in Gemeinsamkeit und das Gefühl, nicht trauern zu können, hinter dem sich der Wunsch verbirgt, die Tote zum Leben zu erwecken, den bestimmten Moment in einem Stillstand der Zeit zu verwandeln, wenigstens temporär, wenigstens für ein paar Augenblicke.
Und doch ist sie gezogen unter
Dieses Dasein, so wie der vom Besen
Steifgeschlagene Schnee unter den Teig
Alles Abgestorbene ist unbestechlich Zeuge
Und ER ist sie. 1947–1973. Wie auf einem Grabstein geschrieben, sind von ER zwei Buchstaben erhalten geblieben, eine Erinnerung und eindrucksvolle, überaus eindringliche Gedichte.
Ich träume
Sie schreitet durch die Räume
In meinem Kopf
Von ihr bemalt, bebildert
Behängt mit Spiegeln
Ihr Schädel ist nur mehr Gesicht
Potjemkinsche Fassade
Vor ihr zerbricht das Licht („Traum 7“)
Mit Trauer träumen ist Hans Raimund ein Gedichtband gelungen, der gleichzeitig disparat und einheitlich, gleichzeitig einfach und eindringlich ist, wo Furchen und Spalten zum Stolpern einladen, wo Pathos anklingt und sogleich wieder zurückgenommen wird, wo Alltägliches den Claim absteckt, in dem sich ereignet, was oftmals unbeachtet bleibt, wo die Sprache spielt, ohne verspielt zu sein, wo Emotionen herausgeflüstert werden, um die Geschichte einer Tragödie zu thematisieren.
Manfred Chobot, Literatur + Kritik
Trauer träumen. Lyrische Texte. Hans Raimund
Um „die obligaten Trauervokabeln“ kommt Hans Raimund gut herum. Sein jüngster Lyrikband macht die Trauer nicht zu einer Obsession aus Sprache, sondern bändigt ein Gefühl, über das er keine Kontrolle hat, das ihn bis in seine Träume im Griff hält – in Worten, die den Ausnahmezustand zum Normalfall in einem aufgewühlten Leben machen. Die Gedichte und lyrischen Prosatexte halten eine Frau am Leben, die vor dreißig Jahren verstorben ist. Doch mehr noch ist dieser Band eine Selbsterforschungsexpedition ins verletzte Ich.
Anton Thuswaldner, Salzburger Nachrichten, 8.1.2005
TRAUER TRÄUMEN
Sprachgerinnsel
Die im Nu zerrinnen
Klangaufnahmen
Von Billard
Mit Wörterkugeln
…
Trauer ist es, die das neueste Werk mit lyrischen Texten von Hans Raimund durchzieht, Trauer um einen geliebten Menschen, Hans Raimunds erste Frau, die vor mehr als dreißig Jahren ums Leben gekommen ist.
Unscheinbare Dinge des Alltags erlangen in Trauer träumen aufgrund der Perspektive eines „Überlebenden“ eine veränderte, tiefere Bedeutung und bleiben doch dieselben; verstörende Träume durchziehen die Gedichte und lyrische Prosa Raimunds. Die Unfähigkeit zu träumen kollidiert mit der fortwährenden Präsenz der Erinnerung. Und dennoch gewinnt man als Lesende, als Lesender, nie den Eindruck, Hans Raimund ginge in Trauer träumen mit seinem Leid „hausieren“, ganz im Gegenteil: Auch ohne das Wissen um die Hintergründe versetzt die Verschiedenartigkeit der literarischen Töne die Leserin, den Leser, in einen Bannkreis beinahe körperlich spürbarer, zutiefst menschlicher Geografie, in welcher Raimunds eigener Hof, ein Streckhof im burgenländischen Hochstraß, kreativer Kulminationspunkt war.
Dreißig Male ist es
Immer Mai geworden
Durch die offene Halbtür
Richtet sich ein Blick hin
Auf die kindlich kargen
Abstraktionen zweier
Nie der Erde ganz ent
Wachsener Feigenbäume…
Auf die flatternde Kom
Paktheit schräger Ginster
Büsche
…
Auf 108 Seiten hat der Würdigungspreisträger des Landes Niederösterreich sowie Inhaber des Georg-Trakl-Preises für Lyrik, Hans Raimund, wieder einmal bewiesen, zu den wirklich großen lyrischen Begabungen zu zählen. Und dass ein solches Buch in „lyrikfeindlichen“ Zeiten wie diesen überhaupt möglich ist, kann dem Otto Müller Verlag gar nicht hoch genug angerechnet werden.
Trauer träumen ist ein Buch, an dem wohl kein an Lyrik – und am Leben selbst – ernsthaft Interessierter vorbeikommt.
Thomas Fröhlich, @CETERA Nr. 18.12.2004
Trauer Träumen
Nun kann man natürlich so tun, als wäre da eine bruchlos durchgehaltene Traditionslinie zwischen einerseits hermetischer Poesie und fünfziger-Jahre-Naturdichtung und andererseits dem heutigen Stand der Dinge in der ‚res publica poetica‘. Man kann in Requisiten schwelgen, soviel man lustig ist. Symbolismen der Preislage ‚Sand‘ / ,Asche‘ /,Vergänglichkeit‘ neu erfinden. Wenn man gut ist – und das ist Hans Raimund – hat das Ergebnis am Ende sogar Hand und Fuß: Bearbeitet glaubhaft Jetziges, Tatsächliches statt der Posen vorgestriger Statuen. Was man aber nicht kann, ist dies: Im Leser die Assozitionen/Erwartungen löschen, die an so einen ‚klassizistischen‘ Tonfall geknüpft sind; an Kunstsprache, die bei vollem Bewußtsein ihrer Kunstsprachlichkeit dieselbe nicht, aber schon gar nicht problematisiert.
Soweit mein erster Eindruck von Hans Raimunds Trauer Träumen. Lyrische Texte aus den Hochtrasser Heften. Man mag zugestehen, der Mann sei nicht irgendwer. Er zählt zu denen, die hierzulande noch wissen, daß es irgendwann für Lyrik Regel und nicht possierliche Ausnahme war, gereimt, stramm rhythmisiert und dergleichen zu sein; zu denen, die wissen, welchen Sinn das einmal hatte. Auch zu denen, die aus solchem Wissen schöpfen: Nicht bruchlos, aber doch ist er irgendwie mit den fernen Gevattern verbunden, wo wir Jungspunde die private Literaturgeschichte bei Brinkmann und Konsorten eröffnen.
Daß in dem Band wesentlich mehr getan wird als nur die alten Leiern wieder anzuschlagen, auf daß sie nicht verstauben, sei aber nicht verschwiegen. In sechs stringent verklammerten Kapiteln findet sich genug Auseinandersetzung mit folgenden Themen, um mich die nächsten paar Wochen zu beschäftigen: Trauer, der geschützte Raum der Trauer, der Traum vom Verlorenen, seine Untragbarkeit angesichts des Hier-und-Jetzt, Strategien des Erwachens, der Erinnerung, des Vergessens. Das Ganze wird einmal privat, einmal ‚öffentlich‘ angerichtet und durchaus nicht, ohne Zeitbezug herzustellen.
Trauer träumen zu lesen, das ähnelt dem Durchschreiten des in Teil I beschworenen, beschriebenen Streckhofes in Hochstrass, Raum für Raum. Nicht restlos kontemplativ ist es hier, aber definitiv abgeschieden, nicht in sich widerspruchsfrei oder gar ‚heil‘, aber dem Unterfangen des Bandes angemessen: Eine sehr spezielle Trauersituation zu überformen und auf das Ich zurückzuführen. Anders gesagt: Wir beobachten ein Ich, das sich – nicht zum ersten Mal – durch einen Trauerprozess peitscht, um ihn endlich ad acta legen zu können. In diesem ‚Hof der Trauer‘ ist natürlich nicht alles sogleich auf das zugrundeliegende Motiv bezogen: Verästelungen in die eine, Erforschungen gemeinsamer Nenner in die andere Richtung finden statt.
Da wäre etwa die genaue Klärung, die dem Begriff des ‚Hofes‘ widerfährt, eine Vorbedingung für das eigentliche Unterfangen, die sich als solche aber erst nach und nach erschließt. Ordentlich, man ist versucht zu sagen didaktisch weit holt Raimund aus.
Ein anderes Beispiel für das Ausgreifen der Trauer in alle Richtungen ist in dem vorhin verwendeten Schlagwort ‚Zeitbezug‘ festzumachen. Hier wäre es allerdings zu modifizieren in Richtung ‚Bewußsein der Geschichtlichkeit‘. Ein Textbündel, das von ganz wo anders in dieses hermetische Bauernhaus von einem Gedichtebuch hineinragt; hineingewachsen scheint wie der Zweig einer Brombeerhecke beim offenen Fenster hereinwächst: Teil IV, „Höfe noch einmal“.
Denn hier sind ‚Höfe‘ eben auch die Wiener Gemeinde- und Zinsbauten mitsamt ihren Bewohnern, und die werden gnadenlos aufgezählt, finden ihren Ort, jeder für sich, in der Galerie des Raimundschen Trauerarbeitsgehöfts. Was ich hier mit ‚Bewußtsein der Geschichtlichkeit‘ meine, wo doch das Vorbeidefilieren von haufenweise Einzelschicksalen durchaus auch als ein alter Hut des heimeligen Hier-und-Jetzt unter den lyrischen Effekten gelten kann? – Dass ‚Bewohner‘ eben auch bedeutet: Frühere Bewohner. Vergaste, oder unter Hitler zu Geld und Ansehen gekommene, zum Beispiel. Womit Raimund mir die Heimeligkeit aber austreibt. Ohne dabei den real existierenden Charme der Bundeshauptstadt gleich mit aus seinem Aufzählungsgedicht zu verbannen. Sehr wohl, sirra, ein Kunststück. Und nicht einmal dem Relativierungsverdacht ausgesetzt: Geht es doch um ‚Trauer‘ und ‚Höfe‘, mithin darum, wie unter dem Verlust einzelner Aspekte bzw. Leben eine Welt sich konstituiert, zur Heimstatt wird, right or wrong, my country.
Man könnte nun noch auf Teil VI, „Danses Gothiques“, zu sprechen kommen, den Abschluss von Trauer Träumen, auf das hier inszenierte Auseinanderbrechen von Sprache selbst, auf das Sinnloswerden von Gedichtgrenzen angesichts der Form der Verklammerung (als eines ‚Festhaltens am Sinn‘), auf die Meisterschaft Raimunds, die sich auch hier im Detail zeigt, und dann…
Ja, dann muß man wohl, der man zu Beginn dem Band recht kritisch gegenüberstand, Erich Hackls Zitat zustimmen, wie es auf dem Umschlag steht:
… von Österreichs mißachteten Autoren einer der bedeutendsten.
Elisabeth Hemelmayr, literaturhaus-wien.at
Was ich lese
Glücklicherweise gelingt es manchmal, die Befangenheit zu überwinden – sogar in einem so sperrigen Feld wie der Lyrik: Wer vermag noch – so meine engstirnige Frage – angesichts Trakls und Celans Gedichte zu schreiben? Hans Raimund belehrt mich eines Besseren: Seine „lyrischen Texte aus dem Hochstrasser Heften“, zusammengefasst unter dem Titel Trauer träumen (Otto Müller Verlag, Salzburg) eröffnen buchstäblich atemberaubende Schluchten der Sprache, Verführungen zu Abgründen der Existenz.
Rudolf Taschner, Die Presse, 24.9.2005
Zum 70. Geburtstag des Autors:
David Axmann: Wider-Klang der Welt-Betrachtung
Wiener Zeitung, 3.4.2015
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram +
ÖM + Kalliope
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Raimund im Interview mit Gerhard Winkler für die Literatur-Edition-Niederösterreich am 13.4.1999 in Hochstraß.



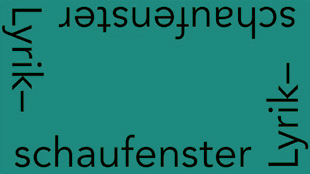
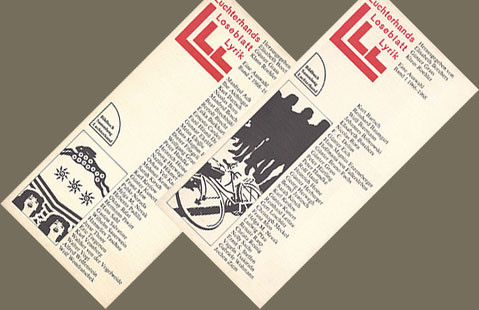



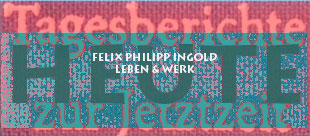
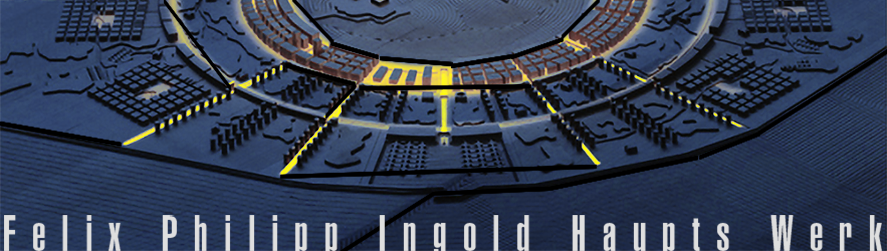
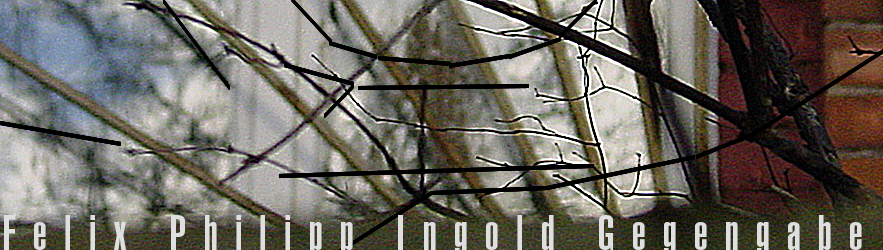
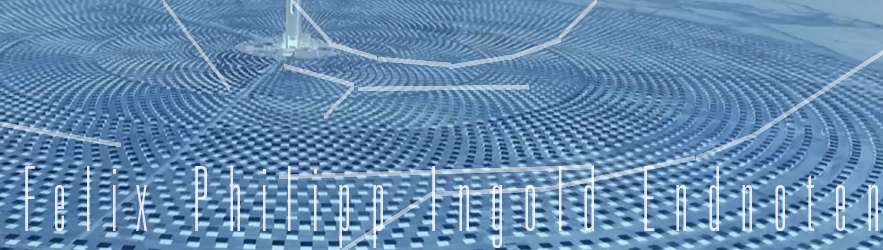

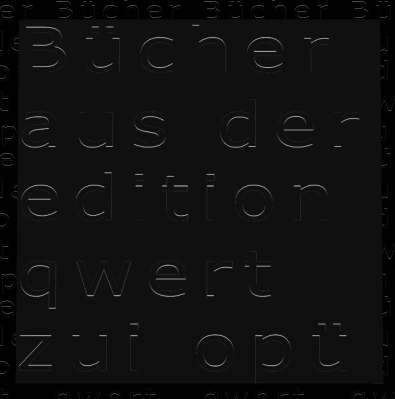
Schreibe einen Kommentar