Heiner Müller: Werke 1 – Die Gedichte
ZWEI STERNE
1
Ein Stern ward ausgefunden
in einer Dunkelheit.
Was war, schien überwunden.
Es schien die Früh nicht weit.
Der Stern hat nicht gehalten,
was da sein Schein versprach.
Es blieb die Welt beim alten,
und es kam nichts danach.
Er wärmte nicht die froren.
Der Wind hat kalt geweht.
Ein Stern, ach, ging verloren.
[W]er weiß noch, wo er steht?
2
Ein Stern ward ausgefunden
als es war an der Zeit.
Was ist, wird überwunden.
Es ist die Früh nicht weit.
Es hat der Stern gehalten,
was da sein Schein versprach.
Die Welt bleibt nicht beim alten.
Es kommt etwas danach.
Er wärmt die, die da froren.
Der Wind hat umgedreht..
Dem geht kein Stern verloren,
der auf der Erde steht.
„Meine Scham braucht mein Gedicht“
Wer mit dem Meißel schreibt
Hat keine Handschrift
Die Steine lügen nicht
Kein Verlaß auf die Literatur
– Lyrik also. Und endlich eine Werkausgabe. Postum, doch, im Müllerschen Duktus zu sprechen, für ein paar Überlebende vielleicht zu gebrauchen. Nun, nachdem die (Un)Person H. M. lang genug obskures Objekt medialer Begierden war, haben die Texte das Wort. – Daß Heiner Müller Gedichte schrieb, war bekannt, daß es mehr als die hier und da veröffentlichten sein mußten, ahnte, wer ein Ohr für die auf die Bühne gestellten Sprachrammen besaß – Hamletmaschine oder Medea-Material lassen sich auch als große Gedichte lesen. In welchem Ausmaß und mit welcher Intensität der Dichter solches betrieb, wird aber erst jetzt deutlich: Hier tritt ein Lyriker an die Öffentlichkeit, an dem keine der bald zu erwartenden Lyrikgeschichten des 20. Jahrhunderts vorbeigehen kann. Daß ein derart bekannter Autor in einer literarischen Gattung, die dieser zudem schon zehn Jahre vor dem Drama betrieb, quasi als Neuentdeckung gehandelt werden muß, ist ein Paradoxon. Über ein Drittel der hier versammelten Texte waren bisher unveröffentlicht, andere nur an entlegenem Orte zu finden, einiges in Auswahlbänden. –
Was mag Heiner Müller bewogen haben, sein lyrisches Œuvre derart auf kleiner Flamme zu fahren, geradezu versteckt zu halten? Die Einsicht, daß Die Lügen der Dichter aufgebraucht sind Vom Grauen des Jahrhunderts, teilt er schließlich mit anderen (man denke nur an Adornos Verdikt zum Thema Lyrik nach Auschwitz), auch war solches noch nie ein Hinderungsgrund für Dichtung.
Fürchtete Müller, der die Maskerade liebte, sich – die Gattung Lyrik hat eben erstaunliche Eigengesetzlichkeiten – doch zu sehr preiszugeben? Vielleicht lauerten ja Zeilen wie jene wenige Jahre vor seinem Tod geschriebenen schon lange und verhinderten mögliche Fluchtversuche der Verse:
Ungereimt
Kommen die Texte die Sprache verweigert den Blankvers
Vor dem Spiegel zerbrechen die Masken Kein
Schauspieler nimmt mir den Text ab
Ich bin das Drama
MÜLLER SIE SIND KEIN POETISCHER GEGENSTAND
SCHREIBEN SIE PROSA
Meine Scham braucht mein Gedicht.
Seine Gedichte seien eine Mischung aus Hölderlin und Brecht, so stand zu lesen, auch, daß die Masken- und Spiegelbilder fad, weil abgegessen. In Germania 3 finden Rotarmisten, einer davon gerade dem Gulag entronnen, in der Tasche eines soeben von ihnen erschossenen deutschen Soldaten Hölderlins Empedokles – und ein Foto von einer Exekution. Der jünglingshafte Tote ein strahlender Mörder, das aufkommende Mitleid verfliegt selbstredend; Müller aber legt sofort noch eins drauf: aus dem Gulag gibt es keine Bilder, keine Spiegel, die den Blick auf und hinter das Ich erlauben beziehungsweise erzwingen würden.
Dem Willen des Dichters entsprechend wurden die Texte nicht thematisch, sondern „brutal chronologisch“ geordnet. Ein unsicheres Unterfangen, so der Herausgeber Frank Hörnigk, angesichts der „über Jahrzehnte von ihm energisch betriebenen Praxis, jeden Versuch der genaueren Datierung seiner Arbeiten zu verhindern“. Einige Daten werden dennoch mitgeteilt, ansonsten muß der Leser mit der ab „1949…“ vorgenommenen Dekaden- und Kapiteleinteilung vorlieb nehmen.
Es sind wohl tatsächlich Die Gedichte (unter denen sich auch Kurzprosa befindet); die Sammlung verschont weder den Dichter noch den Leser mit sonst gern unterdrückten, da doch eher peinlichen Texten – die „üblichen Verdächtigen“ wurden nicht verhaftet.
Also hat auch Müller sie geschrieben, die Reimereien und gereimerten Übersetzungen, die hudelnden Hymnen zu Ehren Stalins, der Industrialisierung und der Traktoren. Ja, selbst ein Heiner Müller startete epigonal, (zu) oft wird Meister Brecht deutlich, auch und gerade hinter den chinesischen Masken, hinterm Katheder sowieso.
Daß er’s besser wußte, auch schon in den Fünfzigern, zeigen u.a. Texte wie die grotesken Verbesserungsvorschläge, aus dem Rahmen des Kanons jener Zeit fällt auch DER GLÜCKLOSE ENGEL; auf anderes wird noch zu kommen sein. Weshalb also solche Töne? Den Magen zu füllen, wird die Muse, die er selber ist, mal eben auf den Strich geschickt? Unter akutem Finanznotstand und versoffenem Gelächter sollen jene Texte entstanden sein, will ein Zeitzeuge wissen.
In welchem Maß Müller der Kinderkrankheit der DDR-Fünfziger – die reine Zukunft wird morgen sein und bloß kein Rundumblick – verhaftet war (und eben nicht wurde), wird sich wohl kaum feststellen lassen:
Der GROSSE OKTOBER DER ARBEITERKLASSE
besungen
Freiwillig
Mit Hoffnung
Oder mit doppeltem Würgergriff
Von zu vielen
Und noch mit durchschnittener Kehle.
Wann wurde der Ekel stärker als die Ekloge?
Verdächtig war Müller zunächst seiner schwer festlegbaren kommunistischen Neigungen wegen, und dies in Ost wie West, trotz der Preise. Zu einem nicht nur streitbaren, sondern auch strittigen und umstrittenen Autoren wurde er nicht zuletzt auf Grund seiner (End)Spielneigung zur Sentenz, die stets gleichermaßen faszinieren wie irritieren konnte. Besonders, als er in zunehmendem Maße die dramatische Gattung einer fiktional definierten Bühne um die Bretter des wohl nur scheinbar authentischen Gespräches erweiterte.
Kaum ein anderer konnte mit solch überzeugender Nuancierung Gegenteiliges nebeneinanderstellen, was den Gesprächspartner allerdings oft genug zum Sparringsdummy degradierte. Ein sicher fragwürdiges Verfahren, doch sollte solches beispielsweise in der Stasi-Debatte -Tabuverletzung hin, moralisches Schaudern her – zumindest bedacht werden.
Gedichte aber sind trotz ihres einladenden Gestuses monologischer Natur; wenn hier Sprüche (ab)geklopft werden, dann voll abgründiger Skepsis. Und da sie sich nicht als kokettes Bonmot kostümieren, sondern das lapidare Protokoll bevorzugen, treffen sie:
Die Welt ist beschrieben kein Platz für Literatur
Wen reißt ein gelungener Endreim vom Barhocker
[…]
Du wirst Knochen sein Staub kein Erinnern.
Oder jene bisher so noch nicht gelesene Penetrationsvariante von Eros und Thanatos, Der letzte Beischlaf ist das Standgericht. In diesem Ton eben. Mißklänge sind dabei erstaunlich wenig zu vernehmen, gerade die Dissonanzen, die Ungewohntes zusammenspannen, zwingen zum genaueren Hinhören, lassen nicht nur einmal den Atem stocken. Traten sie dennoch auf, so waren sie allerdings ärgerlich, schwarzer Humor sollte nicht kalauern:
Der Folterer Barbie
war der Erfinder der Barbiepuppe.
So mancher Bogen neigt denn auch zum Kurzschluß, vor allem dann, wenn hinter dem Endspieler eines Waswärewenn der Schatten des Zockers für historical games deutlich wird:
Als Hitler der Treibstoff ausging begann der Golfkrieg
Und welches Volk in Europa wäre nicht glücklich
Heute mit fröhlicher Mehrheit unter dem Hakenkreuz
Der letzten Utopie des Kapitals.
Da werden denn doch die Zutaten zum eintöpfigen Allerlei verkocht, das schnell gerinnt: freilich: Ekel, Grundmotiv für Müller wie für Hamlet, muß sich irgendwann einmal auch übergeben dürfen.
Doch nicht nur Hamlet irrlichtert durch die Zeilen – diesem einmal genauer nachzufragen, könnte wahrscheinlich einen spannenden Zugang zur Müllersehen Poetologie eröffnen –, immer wieder begegnet man den aus den Stücken bekannten Shakespearschen wie antiken Figuren, wobei die Gedichte die dramatischen Themen nicht nur ausprobieren, sondern oft auch weiterführen. Und stets mischt sich ins Verseskandieren der Marschrhythmus der Bestie Mensch.
„Wenn er schrieb“, so Kerstin Hensel, „bewegte er ein Weltbild im Kopf, unter dem war nichts zu machen“. Wird Horaz aufgerufen, so sind die Kohorten nicht fern, und Marx und Nietzsche vereinen sich im Bruderkuß, während unterm Messer die Kategorien zerfallen. Müllers Geschichtslehrer ist der Terror, die Historie die Blutwurst fürs Linsengericht. Immer nur „Ein Pyrrhussieg / Der Utopie“, und das noch im Privatesten, auch schon in den frühen Texten.
SELBSTBILDNIS ZWEI UHR NACHTS / AM 20. AUGUST 1959:
Nebenan träumt deine Frau von ihrer ersten Liebe.
Gestern hat sie versucht sich aufzuhängen. Morgen
Wird sie sich die Pulsadern aufschneiden oder wasweißich.
Wenigstens hat sie ein Ziel vor den Augen.
Das sie erreichen wird, so oder so.
Und das Herz ist ein geräumiger Friedhof
Wenig später ist Inge Müller angekommen, und Heiner, sind erst genügend Jahre ins Land gegangen, kann den Hamlet geben,
Ihren Schädel in der Hand zu halten
Und mir vorzustellen was ihr Gesicht war
Hinter den Masken die sie getragen hat.
„Du hast ja ein Ziel vor den Augen“, hieß eine Zeile der von jedem Schulkind zu lernenden Verheißungslieder.
Ein Zyniker? Vielleicht hörte Heiner Müller dieses weitverbreitete Urteil recht gern, eine feste Burg und er von Adel. Doch hinterm Grinsen der Groteske hockt das Grauen, das Kichern mutiert zur diaphragmatischen Kolik; Müllers Zynismus eine Emulsion aus Ekel und Ernsthaftigkeit. Wie anders sonst ein solcher Auschwitz-Text wie das BRUCHSTÜCK FÜR LUIGI NONO, so voll Entsetzen und ganz ohne Späßchen. „Er war“, schrieb Christoph Hein, „vielmehr – und das kostete ihn Kraft und Schreiblust und schließlich seine Lebenszeit – das Gegenteil eines Zynikers, also nicht bereit, über diese Welt hinwegzusehen.“
Oder jene Sorge über die im Namen der ZEN-Weisheit in eine Flasche geratene Ente, von der uns Katja Lange-Müller erzählt („Die Ente in der Flasche“),
Hm, sagte Reiner, gute Geschichte, wirklich. Trotzdem, wenn der Schüler beim letzten Mal, als er den Meister verlassen wollte, wenigstens die Flasche zerschlagen hätte, für die Ente, damit sie weggekonnt hätte von den beiden, wäre sie noch besser.
In den Augen meines Kindes las ich
Der zu viel gesehen hat die Frage
Ob die Welt die Mühe des Lebens noch aufwiegt
Einen Augenblick eine Schreckensnachricht
Einen Werbespot lang war ich im Zweifel
Soll ich ihm ein langes Leben wünschen
Oder aus Liebe einen frühen Tod.
Zwei Jahrhunderte zuvor schrieb ein anderer deutscher Dichter über den Verlust seines soeben geborenen Sohnes, Lessing, dem Müller einst „Ein Greuelmärchen“ widmete:
Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn! denn er hatte so viel Verstand! – Glauben Sie nicht, daß die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon so zu einem Affen von Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. – War es nicht Verstand, daß man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er so bald den Unrat merkte? – War es nicht Verstand, daß er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davonzumachen?
„Umsonst ist der Tod, aber er kostet Leute“, nein, dies ist nicht Heiner Müller, es entstammt der Rubrik Redensarten, gleichwohl der Tod stets im Angebot ist – „Kommt Zeit kommt Tod / und keine Gnade“ Anfang der Neunziger dann das Krankenbett, das „rendevouz mit dem tod hat stattgefunden“. Trotz alledem oder gerade deshalb grinst noch immer der Aberwitz, wenn auch eine Spur privater:
beinahe
war ich stolz auf meinen unbesiegten
Tumor
Einen Augenblick lang Fleisch
von meinem Fleisch.
Trost für diese letzte Wanderung gibt’s nur nach Müllers Lust, schließlich ist der „tod / das einfache sterben kann ein idiot, Sterben ist ein Nu / nimm es nicht ernst es ist ein Witz wie du“.
Wer ins Leere schreibt, heißt es in MOMMSENS BLOCK, einem der faszinierenden späten Großgedichte, „braucht keine Interpunktion“. – In Müllers Gedichten fehlen ab „1979…“ die Satzzeichen fast durchgängig.
Jürgen Krätzer, die horen, Heft 192, 4. Quartal 1998
Manöver Müller II
– Schauen wir voraus! Schauen wir auf 2029. Was wird sein? Müller 100! Kunert 100! Wolf 100! Enzensberger 100! Wem wird, wann die Briefmarke gedruckt, wie sie dem 100jährigen Brecht gedruckt wurde? Heiner Müller? Den dann, 2029, die Ministerpräsidentin des Landes Sachsen-Brandenburg-Mecklenburg die bedeutendste Hervorbringung der Literatur des Landes in den letzten hundert Jahren nennt? – Vermuten wir, vorausschauend, keine Marke für Müller 2029. Nicht, weil es keine Briefmarken mehr gibt. Nicht, weil die Geschichte sich abgeschafft hat. Die Literaturgeschichte hat den Dramatiker archiviert, der nicht vom preußisch-sozialistischen Ankerplatz Berlin ließ. Die Literaturhistorie hat den Dramatiker als größten Plünderer des Büchmann enttarnt. Die Literaturwissenschaft hat den Autor als schwer faßbaren Verlagsvagabunden festgeschrieben. Die Literaturkritik hat den theatralischen Lyriker als Bühnennomaden ausgemacht, dem es nicht gelang, eine feste Müllerbühne zu zimmern. Müller, 2029, ist wieder auf das Maß gekommen, das er zu Lebzeiten erreicht hatte. Heiner Müller ist wieder gut für akademische Manöver. –
Vermuten wir also nicht! Gehen wir von der Tatsache aus, daß die Europa-Universtität Viadrina, Frankfurt/Oder, zu einem Wochenend-Symposium einlädt. Das Thema der Veranstaltung lautet: „Die Metapher als dramatischer Ausdruck, das Drama als metaphorische Möglichkeit. Der Lyriker Heiner Müller.“ Eine Rezeption basierend auf Band I der einzigen und unvollendeten Müller-Werkausgabe.
Für Verunsicherung und Vergnügen unter den Versammelten sorgte bereits der Einführungsvortrag des bis dato völlig unbekannten Germanisten Philoktet Eppendorf. Der Basler Dozent, Jahrgang 2002, überraschte mit einer verblüffenden Recherche. Derzufolge gab es einen Vorläufer des zur Debatte stehenden ersten Bandes der Werkausgabe – Die Gedichte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998.
Der Jungwissenschaftler berichtete, daß der als „vorläufig“ deklarierte Gesamt-Gedichtband, besorgt von dem in Berlin tätigen Germanisten Frank Hörnigk, eine Nacharbeit der Ausgabe war; die von der in Frankfurt am Main lehrenden Germanistin Genia Schulz vorbereitet wurde. Weshalb ihre aufwendigen Editions-Bemühungen im vorliegenden Band unerwähnt blieben, konnte der Literaturarchäologe nicht herausfinden.
Die Aufregung war groß. Sie steigerte sich, als der Vortragende Müller einmal einen Kastraten-Lyriker, ein anderes Mal einen kastrierten Lyriker nannte. Das Nichtzustandekommen der Schulz’schen Herausgabe, die nicht verwirklichte komplette historisch-kritische Ausgabe der Gedichte deutet auf wesentliche Defizite der überkommenen und meist bedenkenlos übernommenen Ausgabe der Gedichte hin.
Erneut brachte Eppendorf eine alte Frage vors Auditorium: Wann trat der Lyriker Müller erstmals in Erscheinung? Sicherlich nicht erst im Gründungsjahr der zeitweiligen beiden deutschen Staaten. Das aber suggeriert seit Jahrzehnten der noch von Müller maßgeblich, wie es heißt, initiierte Band. War Heiner Müller ein Spätzünder? War er ein Anfänger mit Zwanzig? Dagegen spricht einiges.
Für die Kastration des Lyrikers sprechen nicht nur Auslassungen: Nazistisch infiltrierte Lyrik eines Hitlerjungen? Das nie Aufbereitete spricht dafür wie die Festlegungen des Dichters, in der Werkdarbietung einer „brutalen Chronologie“ zu folgen. Für Eppendorf der untaugliche Versuch, den Schein unbeeinträchtigter Potenz zu wahren. Demonstrierte Müller totale Männlichkeit? War er totalitär in seiner Männlichkeit? Protestierte er gegen die Totalität des Männlichen? Unbeantwortete Fragen, die auch Antwort auf Müllers Unbeholfenheit gegenüber seiner seelenkranken Frau, der Dichterin Inge Müller, geben könnten. Sowie über das Stummsein in der Stunde ihres Selbsttodes – „DU BIST GEGANGEN DIE UHREN, Schlagen mein Herz Wann kommst du.“ Sowie die späten Erschütterungen, die Müllers Gedanken zum unbeachteten, schließlich aufgelösten Grab der Toten drängen.
Ist im Falle Müller von Männlichkeit, von Totalität die Rede, muß vom Deutschtum Müllers gesprochen werden. So der Referent. Der Mühlstein des Dichters hieß Deutschland. Müller war ein deutscher Dichter und nichts als ein deutscher Dichter. Müller war ein Dichter in Deutschland. Müller lebte von Deutschland bis Deutschland. Von dem Deutschland Weimars bis zu dem der Bundesrepublik. In Deutschland geboren, in Deutschland gestorben, ist Heiner Müller nie in Deutschland angekommen.
Sein Heimat-Land war die deutsche Sprache. Einen historischen Moment war Heiner Müller ihr Ideologe. Als er sich im Widerstand zu jeglicher Ideologie wähnte. Der Widerstand garantierte ihm die Unabhängigkeit in der ideologischen Abhängigkeit. Müller, so die These Eppendorfs, war dem Absoluten nie abhold, in dem sich Ideologie gefällt. Die Devise des Dichters war, Dogmen Dogmen gegenüberzustellen. Damit rückte er seine Dichtung in die Nähe biblischer Dimensionen. Die Rhetorik der Bibel in der Dichtung Müllers rechtfertigt nicht, warnte Eppendorf, Müller zum biblischen Rhetor zu stempeln.
Müller sollte zuerst als der gesehen werden, als der er uns in dem Gedichtband zuerst begegnet. Als Deutscher auf Gedeih und Verderb. Als deutscher Dichter, der Person und Programm 1949 in den Zeilen addierte: „Der Terror von dem ich schreibe kommt aus Deutschland.“ Freimütig bekannte sich der Verfasser zur Umformung eines zitierten Satzes von Edgar Allen Poe, dem er eine geistig gravierend geänderte Richtung gab. Paul Zechs Titel „Deutschland, dein Tänzer ist der Tod“ muß Müller zu dieser Zeit noch nicht gekannt haben. Die deutsche Meisterschaft im Töten, der deutsche Todesterror waren die Kindheitsmuster des Kriegsgefangenen. Die Muster machten das Brandmal auf der Haut des Heiner Müller. Vertraut, verhaßt und Deutschland nie zu vergessen und nie zu verzeihen.
Der tötende Terror der Vergangenheit gestattete Müller keinen Vergleich mit dem gewöhnlichen Terror des ideologischen Terrorismus. Mit dem tötenden Terror konnte er in keinem Text „fertig“ werden. Fertig wurde er, und war er, mit dem real praktizierten ideologischen Terrorismus seiner Mannesjahre. Als Machthaber des poetischen Wortes glaubte sich Müller in der majestätischen Position. Sein königliches Wort war den Worten der Vasallen des ideologischen Wortes über. Heiner Müller war der Souverän. Der suchte sich seine Wahlverwandten. Der beutete sie aus. Der wechselte sie.
Der Mann des Wortes hatte es mit den Männern des Wortes. Müller stellte sich nicht an. Müller stellte sich in eine Linie mit Seneca, Horaz, mit Brecht, Benn. Manchem nahm er manches Wort aus dem Mund und käute es wieder, bis es ein Wort von Heiner Müller war. Von Anfang bis Schluß ist seine Dichtung deutlich in ihrem Abstand zum Gelebten. Müllers Lyrik ist Schrift von der Schrift für die Schrift. Gedanken hetzen Gedanken. Gehetzte Gedanken verhindern Handlungen.
Müllers Texte sind Trotz-Reaktionen eines unheilbar Verletzten. Der konnte sich nicht lösen von der Beschreibung der Folter. Seine Lebens-Lektion war: „Die Folter ist leichter zu lernen als die Beschreibung der Folter.“
Heiner Müllers Texte trotzen dem Tod. Denn: „Der Tod ist ein Irrtum.“ Doch: „Die Toten haben das letzte Wort.“ Das irrtümlichste aller irrtümlichen Worte? Das unsterblichste aller unsterblichen Worte? Maßte sich Müller die Rolle des Stellvertreters der Toten auf Erden an? Um, zunächst und wenigstens, das vorletzte Wort zu haben? Das einzige Wort, das Sterbliche unsterblich macht? Und den Irrtum aufhebt?
Den Fragen des Referenten folgten die Festlegungen. Heiner Müllers Verse sind Verse vom Vergehen. Seine Gedichte sind Gedichte, die den Tod vor das Leben stellen. Und deshalb kein Irrtum sind?
Heiner Müller glaubte, wie wir alle, der einzige Unsterbliche zu sein. Sterben tun die anderen. Als Müllers Sterben sich beschleunigte, schrieb er: „Ich sterbe zu langsam.“ Das, resümierte der Referent, ist der aufrecht gehaltene Gedanke, kein Opfer des Irrtums zu werden. Oder ist das die ewige Lebenseitelkeit, die der Lyriker in vitaleren Tagen formulierte: „Die Dichter ich weiß es lügen zuviel.“
Hat Heiner Müller zu lange irrtümlich vor dem Irrtum gelebt? Hat Heiner Müller zu zeitig vor dem Irrtum kapituliert? Langsam ist Müller zu schnell gestorben, stellte Eppendorf fest. Er beendete seinen Vortrag mit den Worten: Heiner Müller ist uns die Antwort auf die von ihm selbst gestellte Frage schuldig geblieben – Wie klatscht man Beifall zur eigenen Beerdigung?
Das ist das letzte Wort, das die Toten haben. Also auch Heiner Müller. Das Wort, das in die Ewigkeit reicht. Und noch nicht gesagt ist. Von niemand. Nirgends!
Bernd Heimberger, die horen, Heft 192, 4. Quartal 1998
Die Spanne zwischen Nichts und Wenig
– Heiner Müllers Gedichte in „brutaler Chronologie“. –
Der Suhrkamp-Verlag beginnt in diesem Jahr mit der Herausgabe der vollständigen Werkausgabe von Heiner Müllers Texten, und er eröffnet mit einem Paukenschlag: Die Gesamtausgabe der Gedichte von 1949 bis 1995 in der von Müller verfügten „brutalen Chronologie“ ist eine der wirklichen Sensationen im Literaturbetrieb.
Heiner Müller als Lyriker ist immer noch fast ein Geheimtip. Die zumal verstreut publizierten Gedichte erscheinen selbst vielen Kennern als zitables Streugut, den Stücken beigewerkt. Liegt es daran, daß die mal scharfkantigen, mal wuchtigen Blöcke seiner dramatischen Texte den Blick auf fragile Gebilde, wie es Gedichte sind, verstellen? Oder nicht doch eher daran, daß Lyrik das einst innige Bild vom selbstverdunkelnden Beschreiber der Weltkatastrophen durchstört haben würde, nähme man sie denn anders als Vorstufe, Kommentar, Kleingeröll im Werk-Steinbruch wahr? Der von Frank Hörnigk edierte Band Die Gedichte wird es zumindest erschweren, einen der großen deutschen Lyriker dieses Jahrhunderts fürderhin zu ignorieren. Das ist nicht zuletzt der Entdeckungs- und Abwägearbeit des Herausgebers und seines Teams zu danken: Stand doch der testamentarischen Forderung nach Chronologie Müllers Arbeitspraxis entgegen, die Datierung vieler Texte zu verschleiern, früher Geschriebenes oft Jahrzehnte später als Material neu zu verwerten. Oder die Gattungsgrenzen zwischen Dramatik, Prosa und Lyrik zu verwischen. So war ich zunächst überrascht, etwa Mommsens Block im Konvolut wiederzufinden. Hier stellen sich, gerade wegen der Entscheidung, die Einzelbände der Werkausgabe traditionell nach Gattungen zu ordnen, kniffelige literaturtheoretische Fragen. Schließlich: Ungefähr ein Drittel der Texte, 120 Gedichte, entstammen dem Nachlaß und werden somit zum ersten Mal den Lesern zugänglich gemacht. Auch wenn es sich nicht um eine historisch-kritische und kommentierte Werkausgabe handelt, lassen die bibliographischen Anmerkungen dennoch Wünsche offen. So sind nicht wenige Gedichte, die der 92er Ausgabe der Gedichte zugeschlagen worden sind, bereits früher veröffentlicht worden (z.B. „Fernsehen“ bereits 1990 bei Kiepenheuer & Witsch); eine sparsame Kommentierung gedichtexterner Verweise auf z.B. politische oder literaturgeschichtliche Hintergründe wäre für den Leser hilfreich gewesen.
Die ungefähre chronologische Ordnung der Texte hat den Vorzug, daß sie Aufschlüsse über die Gewichtung der Lyrik im Gesamtwerk erlaubt. Müller begann als Lyriker, und in seinen letzten fünf Lebensjahren sind mehr Gedichte entstanden, als in den zwei Dezennien zwischen 1969 und 1989. Hier spannt sich nicht nur in der Intensität des Gattungsbezugs der Bogen, sondern auch in Motivik, Gestus, Bauweise, thematischer Konzentration. Bereits in den Versen der frühen fünfziger Jahre spricht, noch brechtisch angeschattet, unverkennbar Heiner Müller: Zitat-Montage, Parabel und die – später für untauglich erachtete – Ballade als bevorzugte Bauformen, Gesprächssuche mit den Großen der Zunft – Horaz, Dante, Shakespeare –, der Seziergestus, mit dem Geschichte aufgeschnitten wird:
DER TERROR VON DEM ICH SCHREIBE KOMMT AUS DEUTSCHLAND.
Ein Satz aus „Germania Tod in Berlin“, der mich seit Mitte der siebziger Jahre begleitete. Was ich nicht wußte: Er stammt aus den frühen Fünfzigern. Ein Satz, erfahrungsgerändert durch das Kriegserlebnis, relativiert zunächst noch durch die Hoffnung, das blutige Kontinuum der Geschichte aufsprengen zu können, „das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge“ zu vernehmen.
Ihn interessierte vor allem die Versteinerung von Verhältnissen, und er ahnte, daß es nicht reicht, ihnen ihre eigene Melodie vorzuspielen, um sie zum Tanzen zu bringen. In der Ohnmacht des Schriftstellers zwischen den Mahlsteinen der Macht benötigte er weitgreifenden Rück-Bezug, um schmalen Halt – „Für uns ist die Spanne zwischen Nichts und Wenig“ – zu suchen und an der Haltbarkeit der eigenen Schriftspur zu arbeiten:
Was richtet ein Satz aus gegen die Strohköpfe
Fragst du. Nichts, sagen einige, andere: Wenig
Shakespeare hat Hamlet geschrieben, ein Trauerspiel
Geschichte eines Mannes, der sein Wissen wegwarf
Sich beugend unter einen dummen Brauch.
Dazwischen irrlichtern allerdings auch schauerliche Verse schlechter Dienstbarkeit wie einige Stalin-Hymnen oder ein im Neuen Deutschland am 15.3.1970 abgedrucktes „LENINLIED“. Müller hatte in Krieg ohne Schlacht über die taktischen Überlebens-Gründe dieser Reimereien berichtet, durchsichtiger Politkitsch bleibt das allemal. Es ist im übrigen gerade nicht jene Sorte von Texten, über die er 1989 schreiben wird:
3 SELBSTKRITIK
Meine Herausgeber wühlen in alten Texten
Manchmal wenn ich sie lese überläuft es mich kalt Das
Habe ich geschrieben IM BESITZ DER WAHRHEIT
Sechzig Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod
Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute
Mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit
Die vor vierzig Jahren mein Besitz war
Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend
Zwei Monate vor seinem Tod schreibt Müller in einer „NOTIZ 409“:
Die Welt ist beschrieben kein Platz mehr für Literatur
Wen reißt ein gelungener Endreim vom Barhocker
Das letzte Abenteuer ist der Tod.
Es ist der Blick in die Gräber – das „vorläufige Grab der Utopie“ und die Gewißheit „in den Augen der Ärzte“ –, der streng, gedrängt und verzweifelnd in den letzten Lebensjahren den Vers diktiert. Großgedichte wie „Mommsens Block“ oder „Ajax zum Beispiel“ sind in ihrer Zitierwut geschichtlichen Aberwitzes als lyrische Schlußrechnungen Müllers zu lesen.
Angekommen im „PARADIES DER BLINDHEIT“, besieht er den Zombiismus hinter der fröhlichen Unbekümmertheit wahrnehmungsamputierter – „Taub sind die Sieger die Besiegten stumm“ – Mittel- und Oberschichtenmasken:
… Bald schon
Werde ich keinen Bettler mehr sehn und kein Elend
Es gibt keine Bettler Es gibt kein Elend
Die mehr und mehr nietzscheanische Wandlung trostloser Resthoffnung in Hoffnungslosigkeit –
Denn Gott ist tot seine verwaisten Engel
Leihen ihre Flügel nicht mehr aus
läßt die Bilanzen bitter ausfallen:
Die Lügen der Dichter sind aufgebraucht
Vom Grauen des Jahrhunderts
An den Schaltern der Weltbank
Riecht das getrocknete Blut wie kalte Schminke
Das eigene Sprechenmüssen sieht sich zunehmend in einen „schalltoten Raum“ (Heinz Czechowski) gedrängt:
… Die Schwierigkeit
Den Vers zu behaupten gegen das Stakkato
Der Werbung das die Voyeure zu Tisch lädt
… Verfallen einem Traum der einsam macht
Im Kreisverkehr der Ware mit der Ware
… im aktuellen Gemisch aus Gewalt und Vergessen.
Und der Sprecher selbst ist endgültig auf sich allein verwiesen:
Vor dem Spiegel zerbrechen die Masken Kein
Schauspieler nimmt mir den Text ab Ich bin das Drama
Diese Stillegung von Geschichte, wie Müller sie verstand, erhellt, warum er sich in den neunziger Jahren mehr und mehr von der Dramatik ab- und der Lyrik zuwandte: „Ich bin das Drama“. Das großartige Sonett „Traumwald“ führt in kristalliner Dichtheit eine Selbstbegegnung der grauenhaften Art herauf, die im Ende des Lebens den Anfang berührt. Das Gedicht endet:
Hinter dem Traumwald der zum Sterben winkt
Und in dem Lidschlag zwischen Stoß und Stich
Sah mein Gesicht mich an: das Kind war ich.
Müller zitiert kunstreich, also unauffällig moderne lyrische Erlösungsmythen, Wagners Parsifal, Baudelaires „Correspondances“ und Georges „Ihr alten bilder schlummert mit den toten“, um sie am Ende gegen sich selbst zu richten. Welche Bitterkeit. Die fast unverhüllt auch eine innere Tragik bloßlegt, nämlich die lebenslangen Schrecken der Selbstdistanz und -aggression. Und doch entstehen ganz zuletzt auch jene Gedichte, die eine hautlose Verwundbarkeit bezeugen und in eine zärtliche Hommage an Frau und Tochter münden.
Heiner Müllers Welt-Befunde sind oft genug als die eines utopieverblendeten Zynikers denunziert worden. Christoph Hein hat in seinem Nachdenken über Heiner Müller einen treffenden Vergleich aus dem Liedgut der dreißiger/vierziger Jahre gefunden, der auf diesen Vorwurf antwortet:
Er war kein Zyniker. Er war vielmehr – und das kostete ihn Kraft und Schreiblust und schließlich seine Lebenszeit – das Gegenteil eines Zynikers, also nicht bereit, über diese Welt hinwegzusehen. Er beschrieb sie wahrheitsgemäß und wie er sie sah, als eine Schlacht und ein Totenhaus… Das galt, das gilt als zynisch. Eine alte Tradition, altdeutsches Brauchtum sozusagen, in der bombardierten Stadt singt man: „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“. Das gilt als menschlich, das greift ans Herz, das ist Kunst. „Es brennt, Brüder, es brennt“ ist dagegen verschrien als der Ruf eines Zynikers.
Peter Geist, neue deutsche literatur, Heft 520, Juli/August 1998
Was von der Herzkönigin blieb
Einer seiner Freunde, der alles, was Heiner Müller ihm erzählte, getreulich aufschrieb – war er doch nicht nur Dichter, sondern auch Stasispitzel –, schrieb auch auf, dass man, laut Heiner Müller, heute keine Gedichte mehr schreiben solle:
Das ist doch Quatsch und riesige Scheiße.
Bisher konnte man mutmaßen, die Gedichte, die von Heiner Müller da und dort zu lesen waren, seien Gelegenheitsgedichte gewesen, Neben- oder Abfallprodukte vom Schreibtisch des Dramatikers. Jetzt wissen wir, dass Heiner Müller zwischen 1949 und 1959 und zwischen 1985 und 1995 fast ausschließlich Gedichte geschrieben hat.
Der erste Band einer Müller-Werkausgabe, den der Suhrkamp Verlag soeben vorlegt, in erhabenem Schwarz-Rot (fehlt bloß noch das Gold zum Nationalmonument), präsentiert auf dreihundertsechzig Seiten nicht nur alle zu Müllers Lebzeiten in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen publizierten Gedichte, sondern auch hundertzwanzig unveröffentlichte aus dem Nachlass. Wer sich von diesen bisher unbekannten Gedichten die Entdeckung einer unbekannten Seite des Heiner Müller erwartet, wird ebenso enttäuscht werden wie der, der im gesamten Lyrikkonvolut jenen bekannten Heiner Müller wiederzufinden hofft, der als Schauspieler seiner selbst jahrzehntelang einen Dandy unter DDR-Bedingungen gab und in dieser Rolle auch noch nach dem Ableben der DDR in unseren Medien überaus lebendig war.
So wie Müller die Rolle des Dandys seinem Übervater Brecht abgeschaut hatte, schlüpfte er auch als Lyriker in dessen Kostüme, mit besonderer Vorliebe in jenes des belehrenden Brecht, dessen Einfachheitspose und Freundlichkeitsgetue Müller ebenso übernahm wie dessen kalkulierte Kälte. Dass die Brecht’sche Freundlichkeit die Kehrseite von Grausamkeit war – man denke nur an Die Maßnahme –, so wie seine Kälte die Kehrseite – nein, nicht der Wärme, sondern der Sentimentalität – war, das lässt sich am Epigonen viel leichter erkennen als am Original.
Dasselbe gilt für den archaisierenden Parabel- und Fibelton sowie den naiven Kinderliedton Brechts in der Müller-Kopie: Was bei Brecht mit Müh und Not noch – wie Reinhard Baumgart das einmal in seinem Essay „Schwacher Brecht“ vormachte – als Produkt einer eingestandenen und ebendarum gemeisterten Schwäche interpretiert werden kann, als Verzicht auf bürgerlichen Stilehrgeiz und „bewusst linkischer“ Altersstil, wirkt beim Epigonen meist nur albern, weil bei ihm von einem irgend gearteten Verzicht nicht einmal etwas zu ahnen ist, es gab da ja nie ein eigenes, unverwechselbares lyrisches Ich.
Was schon bei Brecht als Manier wirkt und den Eindruck des Vom-Kothurn-herunter-Sprechens verstärkt, nämlich die allzu freigebige Verwendung des Partizips Präsens, wird bei Müller, der uns unentwegt sagend, fragend, zeigend, deutend, lesend daherkommt, vollends manieriert. Und wenn Müller mit Würd’, Müh’, Kalt’, Lieb’ usw. operiert, übernimmt er Brechts Wortverkürzungsmanier, die bei ihm aber nicht durch seine süddeutsche Herkunft legitimiert ist. Die auch bei Brecht schon schwer erträgliche Dialektikmasche wird bei Müller zur puren Mogelpackung: „Wenn die Helle sagt, ich bin die Finsternis / Hat sie die Wahrheit gesagt. / Wenn die Finsternis sagt, ich bin / Die Helle, lügt sie nicht“, so raunt ein ausgerechnet „Brecht“ betiteltes Gedicht. Und ein Ekkehard Schall – dem „größten Schauspieler, den ich gesehen habe“ – gewidmetes, byzantinisch anmutendes Huldigungsgedicht fordert:
Die Wirklichkeit muss sichtbar gemacht werden
Damit sie verändert werden kann
Aber die Wirklichkeit muss verändert werden
Damit sie sichtbar gemacht werden kann.
Brechts Pathos, das auch bei ihm selbst oft schon wie die Kaschierung der Angst wirkt, die verkündeten Wahrheiten könnten vielleicht so wahr nicht sein, erscheint, auf Heiner Müller herabgekommen, besonders hohl, zumal Müllers Vokabular so eingeschränkt wie das keines anderen zeitgenössischen Dichters und dazuhin völlig unsinnlich und dem bloß Begrifflichen verhaftet ist. Tod – Leben, – Liebe – Hass, – Finsternis – Helle, Treue – Verrat, – Wahrheit – Lüge, – Kampf – Ziel, – Krieg – Frieden: All diese großen, viel zu großen Worte stehen in Heiner Müllers Gedichten herum wie riesige Pfeiler, die nichts zu tragen haben, weswegen sie wie Trümmer wirken. Bei Brecht war dieses Pathos, das oft im Rock des chinesischen Weisen einhergeht, noch abgeleitet von der „großen gemeinsamen Sache“. Bei Heiner Müller aber ist die Gemeinsamkeit, die seine Gedichte im Munde führen, eine rein rhetorische, keine geglaubte und im Grunde nicht einmal erhoffte. Das macht sein Pathos – „Das Blut in dem Gesicht des Fallenden / Macht die rote Fahne nur sichtbarer“ – so besonders peinlich.
Ich konnte nie sagen, ich bin Kommunist. Es war ein Rollenspiel. Es ging mich im Kern nie etwas an.
Auch wer von diesem Geständnis aus Heiner Müllers 1992 erschienener Autobiografie Krieg ohne Schlacht nichts wüsste, würde sich schwerlich von Müllers Agitationsgedichten aus den fünfziger und sechziger Jahren – auch noch in den Siebzigern liefert er dem Neuen Deutschland ein unsäglich plattes „Lenin-Lied“! – zum Kommunismus und noch weniger zum Liebhaber seiner Lyrik missionieren lassen.
Ich bin der Dreher Jakob Schmitt
Mit meiner Drehzahl hält kein andrer Dreher Schritt.
Auf diese Frequenz gestimmt geht es Seite um Seite, ob nun – ohne alle ökologischen Bedenken – ein chinesischer Staudamm und dessen Erbauer oder Väterchen Stalin gepriesen, Streikbrecher beschimpft oder die Zeiten beschworen werden, „wenn die Menschheit erkennt, die Partei ist die Menschheit / Die erkannte Natur der Parteidisziplin unterwirft und / Ihren Platz einnimmt am Steuer des Planeten“.
Solches Leder sprühen erst recht Gedichte, die gegen jene „revanchistische“ Bundesrepublik anstänkern, in der Heiner Müller sich seit je aber so viel lieber aufhielt als in seiner DDR, obwohl diese doch, glauben wir seinen Gedichten, „den Kapitalismus / Ins Museum verwiesen hat“ und in ihr „keiner der letzte ist / Sondern auf seinem Platz jeder der erste“! Noch 1964, also nach dem Mauerbau, reimt unser Rollenspieler:
Denn zum Fressen gern
Haben in Bonn die Herrn
Unsern nicht existierenden
Viel produzierenden
Arbeiter-Bauern-Staat
Und sie hätten gern parat
Atomares Besteck
Kommt Zeit, kommt Rat.
Und noch in den achtziger Jahren verklärt er die DDR – mit einer freilich verräterisch feudalistischen Metapher – zur „Herzkönigin“, was ihm bezeichnenderweise nur aus sicherer kapitalistischer Entfernung und dazuhin noch von hoch über den Wolken gelingt:
Manchmal wenn ich meine Privilegien genieße
Zum Beispiel im Flugzeug Whisky von Frankfurt nach (West) Berlin
Überfällt mich was die Idioten vom ,Spiegel‘ meine
Wütende Liebe zu meinem Land nennen
Wild wie die Umarmung einer totgeglaubten
Herzkönigin am Jüngsten Tag.
Jeder, der zu DDR-Zeiten einmal ein dortiges Restaurant frequentierte und impertinenten Kellnern ausgeliefert war, die ihre Gäste lieber schikanierten aIs bedienten, wird wissen, was er vom DDR-Kellner-Lob des Heiner Müller zu halten hat (das vermutlich in einer Westberliner Bar verfasst wurde):
O nicht genug zu preisende Langsamkeit
Der nicht mehr Getriebenen! Schöne Unfreundlichkeit
Der zum Lächeln nicht mehr Zwingbaren!
Wer meint, hier walte Ironie, irrt. Ironie hatte Müller für seine zahllosen Interviews reserviert, in denen er sie virtuos handhabte. In seinen Gedichten aber erscheint er als unfreiwilliger Parodist einer Wirklichkeit, die alles andere als zum Lachen war, oder als Opportunist, der dem Kaiser lieferte, was des Kaisers war. Für Gott aber blieb nichts, schon weil dort, wo Müller dichtete, Kaiser und Gott identisch waren als der Gott, der keiner war.
So geheimnislos Heiner Müllers Gedichte bis zur Wende waren, so geheimnislos bleiben sie auch danach, nur dass sie jetzt nicht mehr der „Diktatur des Proletariats“ Tribut entrichten, sondern der „Diktatur des Chaos“ (Carl Schmitt) – Müller liebäugelt jetzt offen mit rechtskonservativer1 Denkern vom Schlage Schmitts – und der Diktatur des Todes, mit der sich Müller gerade zu dem Zeitpunkt konfrontiert sieht, als er eine neue Liebesbeziehung eingegangen und Vater einer Tochter geworden ist. Aus „Tod den Faschisten“ wird nun „Tod den Enkeln“: Müller vermag nicht, wie der späte Brecht der Charité-Gedichte, sich „zu freuen / alles Amselgesangs nach mir auch“, und ist angesichts seines Kindes „im Zweifel / Soll ich ihm ein langes Leben wünschen / Oder aus Liebe einen frühen Tod“.
Was Heiner Müller, dem mit der DDR auch sein Dramenstoff abhandengekommen war, einmal in einem Interview äußerte – „es fallen einem keine Dialoge mehr ein, es gibt nur noch Zitate“ –, zeigt sich auch im Monologischen der Gedichte, die auch noch dort wie Zitate wirken, wo sie nicht aus Zitaten montiert sind. Das rührt auch daher, dass die eigene Person auch jetzt nicht als das auf reale Lebensgröße zusammengeschnurrte Ich erscheint, sondern immer noch mit Vorliebe im Spiegel historischer und mythischer Übergrößen reflektiert wird. Von Prometheus, Herakles, Homer, Tacitus, Seneca und Jesus bis zu Dante, Michelangelo, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Kafka und, selbstredend, Brecht lässt Heiner Müller alle, die gut und teuer sind, als Zeugen zu seiner Verteidigung aufmarschieren, wobei – wie es das Schlüsselgedicht „Mommsens Block“ verrät – doch nichts anderes als die eigene Schreibblockade und der „Ekel am Heute und Hier“, der mit dieser einhergeht, verteidigt werden sollen („der ungeschriebne Text ist eine Wunde / Aus der das Blut geht das kein Nachruhm stillt“).
Auf Pathos vermag Müller auch jetzt nicht zu verzichten, und im Gedicht „Mommsens Block“ liefert er eine Erklärung dafür:
Wer mit dem Meißel schreibt
Hat keine Handschrift.
Dass es im Gedicht ohne Meißel weit besser und glaubwürdiger geht, das wusste nicht nur Brecht, von dem die Maxime stammt: „Allem, was du empfindest, gib die kleinste Größe“, sondern das zeigt auch die einzigartige dichterische Handschrift der Inge Müller, die einmal Heiner Müllers Frau war und 1966 ihrem Leben ein Ende setzte. Von ihr ist in einem Gedicht Heiner Müllers von 1959 die Rede:
Gestern hat sie versucht sich aufzuhängen. Morgen
Wird sie sich die Pulsadern aufschneiden oder wasweißich.
Wenigstens hat sie ein Ziel vor den Augen,
Das sie erreichen wird, so oder so.
So zynisch diese Zeilen anmuten, wobei auch noch der Zynismus Müllers bei Brecht entlehnt war, so war vielleicht Müller nie der Wahrheit näher als in diesem „Selbstbildnis“ betitelten Gedicht, nämlich der Wahrheit, dass er selbst zutiefst ziellos war. Auch deshalb, weil seine Gedichte so lange das Gegenteil vorgaben, sind sie nie wirklich ganz die seinen – und auch dann nicht, wenn er mit sich so allein ist wie in den letzten Wochen vor seinem tragischen Tod. Einmal allerdings beschreibt er sich da im Gedicht als maskierten Vampir, der sich von Spiegeln umstellt sieht, und für einen Moment lang sieht man betroffen in das Gesicht des Menschen Heiner Müller, der nicht zu sich selbst kommen durfte.
Peter Hamm, Neue Zürcher Zeitung, 11./12.4.1998
Poesie in der Sprache der Männer
Dieser Gedichtband gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Ich habe ihn bereits vor einem Jahr gekauft/gelesen, lasse mir aber immer wieder einige Gedichte auf der Zunge zergehen, wenn ich Zeit habe. Geschrieben in einer sehr sparsamen und knappen Sprache sind viele der Gedichte doch voller Romantik und Gefühle, vor allem aus dem Erlebnisbereich von Männern. Andere sind mehr eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der „sozialistischen Realität“ in der DDR. Hier erlebe ich Heiner Müller zum Glück nicht als Kommunisten/Sozialisten, obwohl er häufig in einem Atemzug mit Bertold Brecht genannt wird.
Meine Empfehlung – einfach mal in einer guten Buchhandlung drin schnökern und sich anstecken lassen!
Rainer Ludwig, amazon.de, 21.1.2006
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Jürgen Verdofsky: Kunst braucht blutige Wurzeln
Badische Zeitung, 5. 6. 1999
Das Lyrische Quartett im Lyrik Kabinett München sprach am 30.11.2011 über dieses Buch und ist zu hören ab 1:05:50.
„Bring den Sturm zum Schweigen“
Keiner kommt nach Berlin, ohne eine Vision zu haben. Wer nach Berlin geht, sucht Komplizen und Belegstücke für seine Neigungen. So war es bei Joseph Roth und Robert Walser und so ist es geblieben. So war es bei Brecht und Heiner Müller, Uwe Johnson und Botho Strauß, bei Nicolas Born und Durs Grünbein. Literatur heißt Suche. Heißt Wahrnehmung und Entdeckung. Und inzwischen wird noch immer entdeckt, obwohl Welten zwischen damals und heute liegen, die Schreibkünstler wie Nomaden von einem Ort zum anderen ziehen. Wer schreibt oder liest, will in Bewegung bleiben. Und nichts eignet sich besser dafür, als durch die Stadt zu flanieren und seiner persönlichen Vision entgegenzugehen. Bücher sind eine Heimat für Gleichgesinnte, wie es auch Berlin ist, du kannst beides mit spähenden Augen durchstreifen, unermüdlich durchwandern, beliebig ergänzen und fortsetzen. Der bürgerliche Lebensstil hat keine Sendung mehr, keinen Auftrag, du mußt ihn dir selber suchen. Und so ist ein Berlin-Besuch für viele die notwendige Weiterbeschäftigung und gedankliche Fortsetzung der zuvor gelesenen Bücher.
Ein Sonntagmorgen wie jeder andere. Lentz am 13. Februar gegen zehn. Außer mir noch drei weitere Stammgäste, die verschlafen in ihrem Milchkaffee rühren. Und in dieser von keinem Handy gestörten Stille beginnt ein Monolog in dir. Jeder Kaffeetrinker ist ein Botschafter der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit, und keiner will sich blindlings hineinbegeben in den begonnenen Morgen. Draußen die Schwärze Berlins, ein dichter Nieselregen, große Wasserlachen, in denen sich das kahle Geäst der Bäume spiegelt. So erlebst du eine Stimmung, als hätten sich die leblosen Dinge miteinander verbunden und würden dir den Weg versperren. Das sind die Stunden, in denen du zu lesen beginnst: Oasen des Schweigens. Irgendwo die wirkliche Welt, ein Bühnenkäfig, und die Bewohner darin mit dem ständigen Wechsel ihrer Rollen beschäftigt. Und wenn du das Spiel dieser Masken wieder vor Augen hast, mußt du an Heiner Müller zurückdenken: Ein DDR-Autor, der sich in der Nachfolge Brechts zu einem der bedeutendsten Dramatiker des Zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte. Und wer nicht nur die Glaskuppel des Reichstags oder die Love-Parade sehen will, dem sei die Müller-Bildmonographie von Rowohlt empfohlen, ein schmales Taschenbuch, das der literaturinteressierte Reisende in jede Jackentasche stecken kann.
Wohin in Berlin? Fragt das Stadtmagazin Zitty und preist die Lieblingsrestaurants der Spitzenköche an. Aber ebensogut könnten die Stadtjournale eine Liste der wichtigsten Bücher herausgeben, die in Berlin geschrieben wurden, Stadtpläne hinzufügen mit den Adressen der Autoren und Handlungsorte, biographische Spuren legen, Erlebnispfade für Leser einrichten, auf denen sie Gedenktafeln, Wohn- und Arbeitsstätten „ihrer“ Autoren entdecken: Alle Worte haben ihre Orte! Ihre soziale und atmosphärische Verortung. Heute, wo der Unterschied zwischen Literatur und Nicht-Literatur angeblich nur noch philosophisch und nicht mehr durch den Leseakt zu ermitteln ist, wird die eigene persönliche Erkundung der atmosphärischen Voraussetzungen, unter denen Literatur entsteht, um so dringender. Also, mache dir ein Bild von der Welt. Visualisiere die Bücher auf deine Weise, mit deinen eigenen Erlebnissen vor Ort. Denn die schönsten Bibliotheken sind die einzelnen Stadtviertel von Berlin, ihre unüberschaubaren Häuser und Straßen, die Sprache, Mimik und Gestik ihrer Bewohner.
Wer sich in die Biographie von Heiner Müller begeben will, für den gibt es drei verschiedene Adressen in drei verschiedenen Vierteln: Pankow, Friedrichsfelde und Kreuzberg. Das sind in chronologischer Reihenfolge die Lebensstationen, die über das Berliner Verkehrssystem schnell zu erreichen sind. Als Reisebegleiter oder Stadtführer sind zwei Bücher nützlich: Krieg ohne Schlacht, eine Autobiographie, die 1992 bei Kiepenheuer & Witsch herauskam, und Die Gedichte von Müller, die 1998 bei Suhrkamp veröffentlicht wurden. Literarische Globetrotter wissen damit umzugehen: Wir fahren die Straße des 17. Juni entlang, umkreisen den vergoldeten Engel der Siegessäule, fahren am Hamburger Bahnhof vorbei, die Kastanienallee und die Schönhauser Allee hinauf bis zur Neumannstraße in Pankow, wo man den Kissingenplatz 12 findet: Ein dreieckiger Platz, von Bäumen und dreistöckigen, beigefarbenen Häusern umgeben, die aus den dreißiger Jahren stammen. Hier „hauste“ die Familie Müller von 1959 an: in einer „alten, engen Wohnung“ mit „verbrauchten Möbeln“. Nicht weit davon entfernt die Backsteinkirche St. Georg und ein Fußballstadion. Ein Bild, das kaum der Mühe wert ist: keine Läden, keine Gaststätten oder Kioske. Die typische trostlose Kleinbürgerwelt der ehemaligen DDR, inzwischen fast schon vergessen. Hier schrieb Müller viele seiner Texte. Er hatte inzwischen mit seiner Frau Inge den Heinrich-Mann-Preis der Akademie und den Anerkennungspreis des Kultusministeriums erhalten, das heißt die Akzeptanz der Partei erreicht.
„Glück heißt, das zu wollen, was man kriegt“, heißt es bei dem 1963 geborenen Peter Stamm in seinem neuen Buch Blitzeis. Und das Glück ist ein unstetes, bindungsloses und mißtrauisches Treibgut wie die Figuren in seinem Buch. Für mich eine Art Papageienmonster, das pausenlos spricht oder schreibt. Gemeint ist dieses „besinnungslose Weiterschreiben Tag um Tag, komme dabei zustande, was da wolle“, wie es Reinhard Baumgart in der ZEIT formuliert. Die Münder sind viel zu schnell und viel zu nah, doch die erwarteten Geschichten werden trotzdem verweigert. Aber einer, der sich noch für Geschichten interessierte, war Heiner Müller. Das Enfant terrible der ehemaligen DDR: Lyriker, Hörspielautor, Dramatiker und Essayist. Ein Aufarbeitungsspezialist ohnegleichen. Und die besten Geschichten hörte er in den Kneipen, erzählt er in seiner Autobiographie: zum Beispiel im Café Nord, Ecke Schönhauser/Wichertstraße. Eine frühere Nachtkneipe, in der auch getanzt wurde. Für ihn ein Ort der Stoffsammlung, eine nützliche Informationsquelle, in der er sich über die „Lage Deutschlands unterrichtete:
Kneipen sind das Gegenteil von Tourismus. Jedenfalls die Kneipen im Prenzlauer Berg, in Friedrichshain und in Lichtenberg.
Hier saß er und hörte zu. Ein Autor, der die Erzählung seines Gegenübers unmittelbar in Literatur umwandeln, zumindest in szenische, räumliche Bilder übersetzen konnte, ohne etwas dazuerfinden zu müssen.
Heiner Müller ließ seine Theater-Figuren das Leben spielen und spielte selbst dabei mit: Die Welt als Bühne und er der Arrangeur, der Finsternisexperte, der den ideologischen zivilisatorischen Schutt verarbeitete. Die eigene literarische Erfindung schien ihm damals nicht so wichtig wie der authentische Lebensbericht seiner Mitmenschen. Was ihn interessierte, waren die Schicksalsodysseen der einzelnen Gestalten, war die Entlarvung menschlicher oder ideologischer Verblendungen, die er vorläufig nur im Westen vermutete. Für ihn „war Brecht die Legitimation, warum man für die DDR sein konnte“, schreibt er in seiner Autobiographie:
Brecht war das Beispiel, daß man Kommunist und Künstler sein konnte.
Das waren die Jahre 1951 bis 1954, als er nach der Flucht seiner Eltern nach Berlin ging und dort quasi „ohne festen Wohnsitz und ohne festes Einkommen“ als „eine halb asoziale, nomadische Existenz lebte“, heißt es in der Monographie von Jan-Christoph Hausschild. Ein Autoren-Nomade, der seine Nächte in der Mitropa-Gaststätte am Bahnhof Friedrichstraße oder im Café Nord verbrachte: Literarische Assoziationsräume, die seinerzeit über eine große, trinkfeste Anhängerschaft verfügten und heute längst vergessen sind. Und hier begann die Suche nach Worten, die Arbeit an kurzen, gut verständlichen Sätzen, die häufig an Brecht erinnerten, bei dem er sich vergeblich als Meisterschüler beworben hatte. Was ihn beschäftigte, war die direkteste Form der Darstellung, die teilnahmslose, fast lieblose Vorführung des Konflikts, die funktionale Groteske. Müller war jemand, der intuitiv und rücksichtslos seinen eigenen Traumpfad suchte. Eine Existenz aus der Peripherie, die in das kulturelle Zentrum eindringen wollte. Und darin überlebt man nur mit zynischem Einfallsreichtum, woran es Heiner Müller, dem Dialektiker und Welterklärer, schon damals nicht mangelte.
Er war an der Herstellung von Harmonie nicht interessiert. Die Energien seiner Kunst schöpfte er aus der Entzweiung der Dinge.
Mit dieser Bewertung von Hausschild wird die schwarze Ironie, die zweifelnde Skepsis und der ganz persönliche Sarkasmus dieses Autors verständlich, der sich aus dem sozialen und literarischen Nichts zu einem der bedeutendsten Lyriker und Dramaturgen Deutschlands entwickelte. Denn wo war schon die Harmonie in diesen Jahren? Wo und von wem wurde sie gelebt? Als Nutznießer der beiden politischen Systeme sah er immer und zu allererst die Entzweiung, die Trennung und Bekämpfung entgegengesetzter Interessen. Müller war „immer ein Objekt von Geschichte“, das versuchte „ein Subjekt zu werden“. Und dies sei immer sein „Hauptinteresse als Schriftsteller“ gewesen, so beschreibt er sich selbst in seiner Autobiographie. Und weiter: „… die Kneipen sind die Paradiese, aus denen man die Zeit vertreiben kann“, heißt es dort auf Seite 91. Damals ein Lohnschreiber für die Klappentexte des Aufbau-Verlags, Mitarbeiter des Sonntag und vierundzwanzig Jahre alt. Sein erster, fester Wohnsitz in einem solide gemauerten Klinkerhaus, von den Häftlingen des Lagers Sachsenhausen für die SS-Offiziere gebaut. Ein 1929 geborener ehemaliger Hilfsbibliothekar, der seinen Weg gehen sollte.
Ein Weg, der nur in dieser Zeit und nur in dieser Stadt gegangen werden konnte: mitten im Nirgendwo. Mitten in dem Verschmelzungsprozeß von Ost und West. Ein Weg, der in die unmittelbar erlittene Geschichte dieser Stadt zurückführt. Und mitten in die Auseinandersetzungen der unterschiedlichsten literarischen Denk- und Darstellungsformen, die heute jeden Berlin-Befürworter zwingen, seine persönliche „Atlantische Mauer“ zu überwinden, die das Alte, Gewohnte vom Neuen trennt. So war das seinerzeit bei Heiner Müller und so ist es heute bei Reinhard Jirgl. „Die Figuren reden nicht. Sondern: Sie werden gleichsam gesprochen. Die Sprache spricht durch sie hindurch“, schreibt Martin Lüdke über Jirgl:
Jirgls Figuren werden kaum je in ihrer äußeren Erscheinung sichtbar gemacht, sie existieren allein in ihrem Sprachraum.
Eine Methode, die fast dem vorgegebenen Sprachgebrauch von Müller gleicht, seine Szenen reflektieren sich nicht selbst, sondern müssen dem lernenden Proletariat erst beigebracht werden! Und die Darsteller sprechen nur, was sie sprechen sollen oder dürfen. Das unterscheidet seine sprechenden Spielfiguren von den spontanen, hemmungslos redenden Mäulern Jirgls. Und trotzdem: Das Interessanteste in den Büchern oder Theaterstücken der DDR war häufig nicht das, was tatsächlich zu lesen oder zu hören war, sondern die kurzlebige Gratwanderung zwischen den Worten und den Bildern. Also jene Zwischenräume, die der Lesende oder Zuhörende selbstverständlich und unkontrolliert mit seiner Erfahrung ergänzen konnte.
Es ist 1957, als Müller sich in das Braunkohlegebiet Schwarze Pumpe begibt, um dort die realen Bedingungen der Arbeiterklasse zu studieren: Aus dieser Recherche entstand das politische Lehrstück Der Lohndrücker, das er zuerst als Hörspiel schrieb und danach für die Bühne dramatisierte. Ein für die Parteipropaganda nützliches Vorzeigestück, das Heiner Müller mit einem Schlag bekannt machte: Seine Kunst will Öffentlichkeit. Kollektive Willensbildung. Didaktisches Welttheater. Nach diesem Stück folgten die Dokumentarhörspiele Die Korrektur und Die Brücke. Ein Bericht aus Klettwitz. Sprechstücke, im Sinne des Arbeiter- und Bauernstaates dem sozialistischen Realismus verpflichtet: Ideologische Theorieentwürfe und Parteiheuchelei, die den damaligen Produktionskampf betrafen und mit den realen Konfliktbildern der Befürworter oder Gegner durchmischt waren. Das sind seine Anfänge: Das Theater als öffentlicher Raum der politischen Meinungsbildung. Und das Publikum immer als ein gedachtes Ganzes, dem sich der einzelne zu verantworten hatte. Das alles sind Konstellationen, die Brecht, aber nicht Jirgl gleichen. Das einzige, was übereinstimmt, ist das Fehlen von Lebendigkeit und daß die konstruierte Sprache gewissermaßen durch die „äußeren Erscheinungen“ hindurchspricht: Damals erzwungenermaßen parteikonform und heute dem Zeitgeist des literarischen Trends folgend.
Im Gegensatz zu dieser Zeit, als Heiner Müller eine positive Identifizierung seines Lesers, Hörers oder Zuschauers beabsichtigte, geht es bei dem Roman von Jirgl nur noch um die Wiedergabe der puren, unreflektierten „Unterhaltung“ der neuen Spaßgeneration. Damit ist nicht der kommunikative Wortwechsel verschiedener Menschen gemeint, sondern das unverbindliche Aneinander-vorbei-Reden, das Sprechen nur als Ausdruck des Da-seins. Das gleiche trifft auf das neue Buch der 1971 geborenen Kathrin Röggla Irres Wetter zu: „Das ICH wird heute nur verstanden als Angebot an den Leser, möglichst nah an der Wirklichkeit zu sein, in der man sich am besten bestätigt fühlt“, schreibt Röggla in der Zitty. Ähnliches passiert auch in dem neuen Roman Jetzt von Gabriel Josipovici, in dem nicht mehr beschrieben, sondern nur noch pausenlos gesprochen wird: „Man redet nicht miteinander, um sich interessante Dinge zu erzählen“, heißt es in diesem Buch, sondern nur noch zur gegenseitigen Ablenkung, um sich aus dem Moment der eigenen Gegenwart herauszudrängen. Heiner Müller dagegen benutzte das Sprechen „immer als Aufklärung, als Belehrung, als Entlarvung und Widerstand: als Schulung seiner Gesinnungsgenossen. Dort also die Förderung und Erziehung durch Sprache und heute ihr völliger Freilauf, damals die Autorität der Planung und heute die Ideologie der Unmittelbarkeit, damals der Überdruß an Verfahrensregeln und heute der hemmungslose Niederschlag der Beliebigkeit, die spontane Wiedergabe der ,wirklichen Wirklichkeit‘“.
Und Müller ging seinen Weg. Er agitierte als Lehrmeister und Weltverbesserer, obwohl er im Grunde weder etwas lehren noch verbessern konnte, was sich nicht ohnehin „von selbst“ veränderte. Statt auf Versöhnung setzte er auf Konflikt, statt auf Harmonie auf Konfrontation. Am 25. März 1959 erhielten er und seine Frau Inge für Lohndrücker und Korrektor den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste: Zwei Werke mit „gesellschaftskritischem Charakter, in denen ,die demokratische und sozialistische Erziehung‘ des DDR-Volkes gefördert wurde“, hieß es in der offiziellen Begründung. Aber wer geglaubt hatte, in Heiner Müller endgültig den braven Gegenwartsdramatiker der DDR gewonnen zu haben, irrte sich. Denn bei seinem nächsten Stück Die Umsiedlerin kam es 1961 zu erheblichen Distanzierungen und Parteistrafen: Müller wurde aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, das Manuskript vernichtet und das Stück wurde in den darauffolgenden fünfzehn Jahren nicht mehr aufgeführt. Als der „antifaschistische Schutzwall“ der DDR errichtet wird, ist Müller zweiunddreißig Jahre alt: Er hatte sich in die Höhe gearbeitet und war aus dieser Höhe wieder hinabgestürzt. „Aber dieser Widerspruch der Zeit… war Grundlage und Stachel seines Lebens“, vermerkte Christa Wolf. Für Müller ist alles Material, besonders die Niederlage, der Bruch einer Lebenslinie.
Der „einzige Stoff“, an dem Heiner Müller 1975 „arbeiten durfte“, aber der ihn „von Anfang an nicht interessierte“, war ein Stück über die Großbaustelle eines Chemiekombinats: Der Bau. Obwohl er davon sieben Fassungen herstellte, gab es auch diesmal wieder kritische Einschränkungen und am Ende das übliche Aufführungsverbot: Damit hatte Heiner Müller die Schlußetappe seiner bisherigen proletarischen Arbeiterstücke erreicht. Ein hochtalentierter und marxistischer Autor bekam bei den Kulturfunktionären des sozialistischen Realismus keine Chance mehr! Aber dieser Bruch, dieses Scheitern war vielleicht notwendig, damit Heiner Müller in den nachfolgenden Jahren auf die mythologischen Modelle der griechischen Antikenstücke zurückgriff. Mit diesen Dramen glückte ihm nicht nur ein Neuanfang in der DDR, sondern vor allem der große Erfolg in der Bundesrepublik.
Berlin also, und die neue Arbeitsphase der antiken Modelle. Nachvollzug und Nachempfindung archaischer Ereignisse, bei denen das einzelne Individuum gegen die Macht und Mächtigkeit gewalttätiger Systeme ankämpft und in denen sich die eigene Gegenwärtigkeit des Dramatikers Heiner Müller widerspiegelt. Er schrieb Prometheus, Ödipus und Philoktet, Macbeth und Der Horatier. Und inzwischen wohnte er seit 1979 in einer Sechs-Zimmer-Wohnung im 14. Stock eines neuerrichteten Plattenhochhauses in der Erich-Kurz-Str. 9 in Friedrichsfelde. „Manche Dinge kommen wieder und manche nicht / Das Herz ist ein geräumiger Friedhof / WER HAUST IN MEINER STIRN“, heißt es in einem Gedicht von Müller aus dem Jahre 1963. Das sind knappe, selbsterkennende und selbstbefragende Sätze, die in seinem 1998 von Suhrkamp herausgegebenen Lyrikband stehen. Und je weiter sich seine Texte von der Partei entfernten, um so näher rückten sie an den einzelnen Menschen heran, desto mehr bedrohten, beschimpften und verrieten sie ihn: Auch dann, wenn dieser Mensch in seiner eigenen Stirn hauste! Im Kleinen das Große suchen war seine Sache nicht – und das Große war ihm nicht groß genug.
Es ist Pfingstmontag, der 21. Juni, als ich, vom Lentz kommend, mit einer der gelb-roten S-Bahnzüge von Charlottenburg zum Alexanderplatz fahre. Neben mir russisch sprechende Fahrgäste mit großem Gepäck. In Berlin gibt es die Seßhaften und die Umzieher. „Kleinbürger ist, wer einen festen Wohnsitz hat und sich weigert, ihn zu verlassen“, schreibt Kerstin Decker in der taz über die Rückkehr der Nomaden. „Wir feiern unser Jubiläum im Zeichen des Nomadismus der Künstler“, vermerkt Christoph Tannert im Jubiläumstext des Künstlerhauses Bethanien. Da sitzen wir also, Fremde in der eigenen Stadt. Und fremd noch nach fünfunddreißig Jahren. Berlin ist ein Ort der Nähe und ein Ort der Trennungen. Und beides in extenso. Deshalb die Zeitraffer-Schritte der Straßenpassanten, ihr oppositioneller Blick. Erzählmaterial für viele Bücher: „Kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich / Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche“, heißt es im Horatier. So fährst du, von einer Denkfalle in die andere gleitend, durch Berlin. Am Zoo die feiertäglich gekleideten Ausflügler. Am Tiergarten der Flohmarkt. Das Schloß Bellevue ist menschenleer. Vor dem Lehrter Stadtbahnhof die hochragenden Kräne der Regierungsbauplätze. Irgendwo die winzige Reichstagskuppel dazwischen, die ehemalige Trennungslinie, wo die beiden verfeindeten Ideologien aufeinandertrafen. Und wenn die Literatur die Gegenwart zu transzendieren beansprucht, müßte sie hier beginnen. Danach kommt die Friedrichstraße, die Museumsinsel, der Hackesche Markt und der Alexanderplatz.
Es gibt keinen literaturinteressierten Stadtflaneur, der hier nicht an Alfred Döblin denkt. Und natürlich: an Heiner Müller, der von hier mit der jetzigen U5 nach Friedrichsfelde fuhr. Eine U-Bahnstrecke, die bis zum Tierpark zehn Stationen lang ist. Dem Freigehege der Braunbären gegenüber stehen die viereckigen Hochhäuser der Erich-Kurz-Straße. Darunter das besonders häßliche Haus Nr. 9, von dem Müller seinen „schwindelerregenden Balkonblick“ auf die brüllenden Bären hatte. In der untersten Etage eine Buchhandlung, eine Bibliothek, die Commerzbank und die Sparkasse. Alles total authentisch. Unbeschreiblich öd und leblos, aber für die damalige DDR-Zeit eines der modernsten Vorzeigeviertel. Doch die Form einer Stadt wandelt sich bekanntlich rascher als das Herz eines Sterblichen. Linker Hand des betonierten Platzes McDonalds und rechter Hand Kaisers Verbrauchermarkt, Telefonzellen, wasserlose Brunnen und vereinzelte, winzige Lindenbäume. Ein Terrain, das die Verweigerungshaltung seiner Bewohner geradezu herausfordern muß. Und der Autor Heiner Müller konnte sich nicht beklagen über den „Mangel an gutem Stoff“, an Intrigen und Hofklatsch. Ein Autor, der fast zehn Jahre lang ausschließlich Gedichte geschrieben hatte, bevor er Ende der fünfziger Jahre als Stückeschreiber hervortrat. Und zwar in einer rhythmischen, gereinigten Sprache, die sich von der Partei soweit entfernt hatte, daß sie von ihr nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnte.
Für Müller war „der Aufenthalt in der DDR in erster Linie ein Aufenthalt in einem Material“, sagte er später. Was er schätze, war das Produktive an jeder Situation, ihre Verwendbarkeit, ihre produktive Brauchbarkeit für seine Stücke: „Ich bin Schauspieler“, sagt Hamlet „kein Volk.“ Und das war auch Müller, der die Überwindung aller Ideologie versuchte und trotzdem an den Sieg des Sozialismus glaubte: ein Schauspieler nach allen Seiten hin. Jede Seite war für ihn eine Gegenseite, Werkstattstoff, mit dem er die Lebenstauglichkeit seiner Genossen überprüfte. Für Müller ist Schreiben ein unerbittlicher Krieg und notgedrungen ein Krieg gegen sich selbst. Er collagierte und montierte alles, was er sich aneignen konnte. Seine Identität ist obdachlos, destruktiv und fließend, von keinem eindeutig festzulegen, und seine Worte sind Behausungen, Zufluchtsgehäuse, in denen er sich vorübergehend einquartierte: Höhlenbewohner und Nomade zugleich. Fallensteller und Maulwurf in einem. Für ihn gab es „nur Aufenthaltsorte und Arbeitsplätze“.
Heiner Müller war kein Leibeigener des paranoiden DDR-Systems, das sich marxistisch nannte. Er nutzte, was ihm nützlich war. Und damit provozierte er nicht nur die Partei, sondern manchmal auch seine Freunde, wie Wolf Biermann und Wolfgang Harich, der ihm „literarisches Schmarotzertum“ und „Geschichtspessimismus“ vorwarf. Biermann, der von 1957 bis 1959 Regieassistent am Berliner Ensemble und seit der Wiedervereinigung mit Heiner Müller tief zerstritten war, bezeichnete diesen im Spiegel 2/1996 bösartig und nachtragend als einen „second-hand Dramatiker“, dessen bevorzugte Arbeitsweise „das Zerfetzen und Zerreißen“ großer apokalyptischer Stoffe sei. Und Urs Jenny nennt Müller in der gleichen Spiegel-Ausgabe einen „Katastrophenliebhaber“, einen Visionär der „deutschen Schlachtereien und Verhängnisse“. Wie auch immer, Müller war schon zu Lebzeiten eine ruhelose, rätselhafte Legende, die entweder Hingabe oder vehemente Ablehnung hervorrief. Eine heimatlose Identität, die sich zwischen den Grenzen seiner eigenen Stücke hin und her bewegte, die Abgründe als Stoff-Speicher nutzte.
Inzwischen war Heiner Müller 1970 als Dramaturg am Berliner Ensemble aufgenommen worden, wo er bis 1977 blieb. Danach arbeitete er bis 1982 als Dramaturg an der Volksbühne. 1987 bis 1991 war er Regisseur am Deutschen Theater und von 1990 bis 1993 Präsident der Akademie der Künste in Ost-Berlin. 1995 wurde Müller schließlich Künstlerischer Leiter des Berliner Ensembles. Ein Ziel, nach dem er immer gestrebt hatte. Ein Endpunkt, den er mit Hilfe der Weltgeschichte und mit Hilfe der ideologischen Auseinandersetzung zwischen dem östlichen und westlichen Teil dieser Welt erreicht hatte: Produktiv mißtrauisch, produktiv sich selbst suchend, während die Wirklichkeit tabu war. Seine Karriere ist eine wundersame Erlebnisgeschichte eines einzelnen, der gegen zwei Diktaturen kämpfte und am Ende mehr als dreißig Theaterstücke und über zweihundert Gedichte geschrieben hatte. Eine der herausragendsten Arbeiten ist das 1977 entstandene Neunseiten-Stück die Hamletmaschine, das bis zum Ende der DDR verboten war. Nach Müllers Selbstaussage:
Die Zerstörung des bürgerlichen Lebenszusammenhangs, der Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben und der Einstieg in die Illegalität.
Ein Stück, das er ohne seine Amerika-Reise überhaupt nicht hätte schreiben können und das 1978 in Brüssel seine Uraufführung erlebte. Müller erlaubt sich, was mißfällt. Und je mehr sich seine Popularität im Westen steigert, um so größer ist seine Wirkung im Osten.
So erhält er im Westen den Förderpreis, 1979 den Theaterpreis der Stadt Mülheim, 1985 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie in Darmstadt, 1994 den Europäischen Theaterpreis und 1996 den Hörspielpreis sowie den Prix Italia. Im Osten bekommt Müller 1975 den Lessing-Preis, 1976 den Kritikerpreis der Berliner Zeitung und 1986 den Nationalpreis 1. Klasse der DDR. So wurde Heiner Müller im real existierenden Sozialismus/Kommunismus und gleichzeitig im demokratischen/kapitalistischen Lager zu einem Medienstar „gemacht“, der sich zu einem der meistgespielten und meistfotografierten Autoren der Gegenwart entwickelte: Ein hageres, maskenhaftes Gesicht, an einer kubanischen Zigarre rauchend, das Whiskyglas in der Hand. Das Gesicht mit der leisen, hüstelnden Stimme, die uns das Leben erklärt, eine unversöhnliche, unerbittliche Sprache, die uns im Laufe der Jahre fast die Stimme Bertolt Brechts vergessen läßt. Heiner Müller war ein Dramaturg des Welttheaters. Er hat den Menschen enträtselt, entschlüsselt. Er hat aufbegehrt. Er hat das Offensichtliche, das Öffentliche mit dem Verborgenen und Privaten seiner eigenen Biografie zusammengeführt. Ein Grenzüberschreiter ohne Berührungsängste, an Leib, Leben und Seele gefährdet.
Die Weltgeschichte als Lehrpfad. Als biographische Lebensspur. Und nachdem am 10. November 1990 die Berliner Mauer fällt, überschreitet Heiner Müller vorläufig seine letzte Grenze: Er zieht vom östlichen Friedrichsfelde mit seiner neuen Frau, der Fotografin Brigitte Mayer, in das westliche Kreuzberg, wo er bis zu seinem Tod in der Muskauer Straße 24 wohnt. Die Konfrontation und der Widerspruch seiner Gegner existierten nicht mehr, die kommunistische Utopie war gescheitert. Es ist Samstag, der 27. Mai, und ich steige, vom Bahnhof Zoo kommend, am Wittenbergplatz in die U1, um damit zum Halleschen Tor zu fahren und dort die Muskauer Straße zu suchen. Die Fahrgäste überwiegend türkische Frauen und Männer. Seit Brecht, seit Heiner Müller und Botho Strauß ist Berlin eine bespielbare theatralische Landschaft geworden. Rollen und Masken in jedem U-Bahn Winkel. Der Ruf nach Bürgertugend ist vergeblich. Jeder ist sich selbst der Nächste: Lümmelnde Punker mit Hunden, Kahlköpfige mit Springerstiefeln, türkische Yuppies, Schwarze aus Ghana, Rentner aus Kreuzberg. Alles ist szenisches Leben. Alle sind Konkurrenten, Gegner, Big-Brother-Typen, Sediment und Überbleibsel.
Zur allerersten Kontaktaufnahme mit Heiner Müller – wie auch Berlin – reicht manchmal ein einziges Buch. Für mich waren es seine Gedichte: Autobiographische, physische Objekte, die ich mit mir herumschleppen konnte und die er in einem Zeitraum von mehr als vierzig Jahren schrieb. Der neue Suhrkamp-Band von 1998 umfaßt zweihundertfünfzig Gedichte, von denen einhunderteinundzwanzig hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. Das Buch als Zeugenschaft. Als Energiequelle. Ein individuelles Ich, das schonungslos und ohne Larmoyanz sich selbst diagnostizierte:
Meine Scham braucht mein Gedicht.
Und damit meinte er die Scham der fehlenden Wahrheit, die er in der Pflichtsprache seiner Theaterstücke vermeiden mußte. Und noch wenige Tage bevor er stirbt, schreibt Müller am 12. Dezember: „Beinahe rührte mich / Die Trauer der Experten und beinahe / War ich stolz auf meinen unbesiegten / Tumor / Einen Augenblick lang Fleisch / von meinem Fleisch“ zu sein: „Meine Herausgeber wühlen in alten Texten / Manchmal wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das / Habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit / Sechzig Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod“, heißt es auf Seite 252 der Suhrkamp-Ausgabe. 1994 erfährt er von seiner Krebskrankheit, die nicht mehr zu heilen ist. Auch nicht durch einen Erholungsaufenthalt in Feuchtwangers Villa Aurora im kalifornischen Santa Monica. „Ein sterbender Mann betritt das Hotelfoyer / Wo andere Sterbende ihre Zeit totschlagen“, heißt es in einem Gedicht von 1995.
Was blieb, ist die Erkundung der Welt mit seiner Sprache. Und auf der Suche nach der eigenen Biographie oder genauer: nach den eigenen Erinnerungen, sind auch die Erinnerungen eines anderen nützlich. So ergeht es mir mit Kreuzberg: Vom Halleschen Tor kommend, gehe ich die Oranienstraße entlang bis zum Heinrichplatz. Der Bierhimmel, Die Rote Harfe, Der Elephant, alles Kneipen, die meine Kneipen waren. Danach die Mariannenstraße entlang, die Naunynstraße von Aras Ören kreuzend, Richtung Bethanien. In Charlottenburg findest du die offensten Menschen, in Marzahn die verschlossensten, am Prenzlauer Berg die jüngsten und in Kreuzberg die fremdesten. Und es heißt, Identität wächst nicht nur an der geordneten Schönheit, sondern auch im Unbequemen, im Häßlichen und Chaotischen wie hier. Und ganz in der Ferne die Erinnerung an die beiden Dichterfürsten Günther Bruno Fuchs und Raoul Wolfgang Schnell, zwei ausladende, äußerst bizarre Persönlichkeiten der Kreuzberger Szene der sechziger Jahre. Aber kommen wir zu Bethanien, dem Künstlerhaus von Berlin, in dem ich so manche Ausstellung zeitgenössischer Künstler verwirklichen konnte. Links vor dem Hauptgebäude ein verdrecktes, mit Graffiti besprühtes Klinkergebäude, in dem Theodor Fontane 1848 als Apotheker wohnte und arbeitete. Von Bethanien geradewegs die Muskauer Straße entlang, findest du auf der linken Seite im zweiten Hinterhof des Hauses Nr. 24 das frisch renovierte Loft, in dem Heiner Müller mit seiner Familie wohnte. Auf einem der Briefkästen entdecke ich die Namen Meyer, Müller, von Kretschmann. Das sind die letzten Reste seiner Lebensspur.
Wer die Fähigkeit hat, sich die sichtbaren Dinge allein durch sinnliche Anschauung zu vermitteln, der kommt in Kreuzberg auf seine Kosten: Leben um des Lebens willen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Die Einverleibung und nicht die Aussonderung. Auf die Frage, ob Heiner Müller sich vorstellen könnte, im Ausland zu leben, antwortete er:
Ich bin auf dieses Material nicht mehr angewiesen, der Vorrat reicht für ein Leben.
Und mit „diesem Material“ meinte er Deutschland. Als letzter Widerstand verblieb ihm der eigene Körper. „Der Krebs als Sympton des Ekels“, wie es Volker Braun formulierte. Als ich von der Muskauer Straße zurück zur U-Bahn gehe, haben die Lesungen der „3. Langen Buchnacht in der Oranienstraße“ begonnen. Unter den Autoren der literarische Darstellungskünstler Alban Nicolai Herbst, der an sechs verschiedenen Stellen aus seinem neuen New York-Buch vorliest. Ein aus Papier gefertigtes Manhattan, während draußen das Leben vorbeiströmt: Die Fiktion wird als Erfindung ihrer selbst gefeiert, und das ist der neue Kult des Authentischen, der erträumte Aufbruch in ein neues Leben.
Die Welt macht müde. Literatur entsteht nicht allein beim Schreiben, sie muß auch gelebt werden. Und vor allem: sie muß auch gelesen werden. Und Lesen heißt Aufmerksamkeit, Konzentration und Bewegungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, sich über die Erdenschwere hinwegzusetzen. Bücher sind Empfindungsauslöser, eine Art „geistige Trödelei“, in der sich die Phantasie entwickeln kann. Ein Buch, das seinen Leser mehrere Wochen begleitet hat, wird schließlich ein Teil von ihm. So erging es mir mit den Gedichten von Heiner Müller. Der „Experte für Brüche“, wie ihn John Berger nannte, benutzte die Lyrik als „Ausstieg aus der Wirklichkeit“. Und Ausstieg heißt Distanz zur Realität schaffen – ein Bewegungsvorgang, den ich mit Freude nachvollziehe: Es ist Samstag, der 1. Juni, ich fahre mit der S-Bahn vom Bahnhof Zoo bis zu den Hackeschen Höfen und gehe von dort die Oranienburger Straße entlang bis zur Chausseestraße, um auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof nach dem Grab von Heiner Müller zu suchen. Die Oranienburger Straße ist heute eine der beliebtesten Touristenstrecken, auf der die jüngsten Aussteiger und Sinnsucher unter sich sind. Sie treffen sich im Goodwill, Silberstein, Oren, Mendelsohn, Obst & Gemüse oder Goa. Aber das „wildeste“ Lokal ist noch immer Zapata im Tacheles. Die Theke ein aus schwarzen Eisenteilen zusammengeschweißtes Monster, das manchmal echtes Feuer speit. Der dazugehörende Abenteuer-Garten ist inzwischen von Baggern niedergewalzt und eingezäunt: Der Zeitgeist der Punker ist längst geflüchtet.
„So kann eine neue Lektüre beginnen, nicht mehr in der Erwartung auf Erlösung, die aus den Texten selber kommt, sondern auf Hoffnung setzend in der Ermutigung zu einem selbstbestimmten Denken“, formulierte Frank Hörnigk, der Herausgeber der Müller-Gedichte. Jede Gegenwart hat ihre Geschichte. Aber für keinen Autor war die Geschichte ein so wichtiger Arbeitsstoff wie für ihn. Im kleinen Hof des Brecht-Hauses blühen zwei große Kastanienbäume. Ich gehe an den Gräbern von Brecht und der Weigel vorbei und stehe dann vor Müllers viereckiger, rostbrauner Grab-Stele. Darauf liegen winzige Steine, Ziegelstücke, Kastanien und Zigarren. „Wie fühlt man sich im Erdreich und allein / Im engen Sarg, nachdem die Trauergäste / Zurückgekehrt sind in ihr Leben / Wie fühlt man sich so jung im Tod?“ fragt Durs Grünbein in einem seiner Gedichte. Zwischen den weißen Birkenstämmen der Allee leuchten die letzten Sonnenstrahlen. Über der Tür der Leichenhalle steht:
Herr Gott du bist unsere Zuflucht.
Überall Worte aber nirgendwo Leben. Im Theater am Schiffbauerdamm wird Das Ende der Paarung gespielt. Vor der bronzenen Brecht-Figur sitzen die wartenden Theaterbesucher mit einer Bulette und einem Glas Rotwein in der Hand und warten auf den Anfang der Vorstellung. „Geh Ariel bring den Sturm zum Schweigen und wirf die Betäubten an den Strand“, heißt es in Müllers letztem Gedicht.
Walter Aue, aus Walter Aue: Auf eigene Faust. Spurensuche in Berlin, Anabas Verlag, 2001
DER LETZTE VERSUCH
in memoriam Heiner Müller
Undenkbar ist es.
Es hat Germania
Begraben einer der entkam. Die Haut
Und Fluß und Stadt und Berg drauf
Zwei mal mit Staub bestreut
Und wie sichs ziemt gefeiert.
Es ist kein Grabmal
Nur zarter Staub.
B.K. Tragelehn
ICH WILL GEDICHTE, DIE DAS LAND EINENGEN,
Die stur und lichterlos die Sprache nutzen,
Sich vor dem Ende nicht den Mund abputzen
Mit Heimatschwüren in den Satzanfängen.
Die Staaten regeln das, im Osten gab
Es Solidarität, Parteiausschlüsse,
Die Änderung von innen, Blutergüsse
Vom Meiden der Tribünen, bis ins Grab.
Ich will Ophelia um Getränke bitten,
Aus einem Wasserloch heraus, die losen
Verbrüderungen kommen jetzt zu spät.
Die Liebe geht mit unsichtbaren Titten.
Der Tod erinnert an Urin und Rosen:
Falls an der nächsten Ecke jemand steht.
(für Heiner Müller)
Thomas Kunst
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Heiner Müller
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christine Richard: 75 Jahre Heiner Müller: Dichtung & Drugs
Basler Zeitung, 8.1.2004
Gunnar Decker: Das Messer im Herz der vertrauten Lüge
Neues Deutschland, 9.1.2004
Ulrich Seidler: Im Besitz der Dichtung
Berliner Zeitung, 9.1.2004
Rüdiger Schaper: Die Explosion der Bilder
Der Tagesspiegel, Berlin, 9.1.2004
Michael Bienert: Manschetten sind keine Sprengsätze
Stuttgarter Zeitung, 12.1.2004
B.K. Tragelehn: Heiner Müller 75
neue deutsche literatur, Heft 553, Januar/Februar 2004
Zum 10. Todestag des Autors:
Jörg Sundermeier: Stumme Worte
die tageszeitung, 30.12.2005
Arno Widmann: Ein Freigänger beider Systeme
Berliner Zeitung, 31.12.2005/1.1.2006
Frauke Meyer-Gosau: Das Denkmal weiß nichts von Geschichte
Literaturen, Heft 1/2, 2006
Jörg-Michael Koerbl: Das Paradoxon vom Dichter
Abwärts!, Nr. 46/47, Januar 2023
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: Auf der Gegenschräge die Toten
Neues Deutschland, 8.1.2009
Jens Bisky: Deine Braut heißt Rom.
Süddeutsche Zeitung, 9.1.2009
Matthias Heine: Nicht so tot, wie viele glauben
Die Welt, 9.1.2009
Peter Laudenbach: Das Orakel spricht
Der Tagesspiegel, Berlin, 9.1.2009
Ronald Pohl: Bonmots und Schamottöfen
Der Standard, Wien, 9.1.2009
Stephan Schlak: Neue Gespenster am toten Mann
die tageszeitung, 9.1.2009
Zum 20. Todestag des Autor:
Peter von Becker: Das Licht der Finsternis
Der Tagesspiegel, 29.12.2015
Alexander Kluge: Was hätte er in dieser Zeit geschrieben
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.12.2015
Peter Jungblut: Heiner Müller zum 20. Todestag
Bayerischer Rundfunk, 30.12.2015
Heiner Müller – Weltautor mit DDR-Prägung
MDR, 30.12.2015
Wolfgang Müller: Wie aus Reimund Heiner wurde
Deutschlandradio Kultur, 30.12.2015
Tom Schulz: Dramatiker des Aufstands
Neue Zürcher Zeitung, 1.1.2016
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Thomas Hartmann: Heiner Müller – ein Getriebener des „Erfahrungsdrucks“
mdr.de, 9.1.2019
Hans-Dieter Schütt: Dunkel, das uns blendet
neues deutschland, 8.1.2019
Mathias Broeckers: Heiner Müller, die Zigarren und die taz
blog.taz.de, 8.1.2019
Ulf Heise: Stern im Sinkflug
Freie Presse, 8.1.2019
Ronald Pohl: Warum der Dramatiker Heiner Müller in der Epoche der Likes und Emojis fehlt
Der Standart, 9.1.2019
Günther Heeg, Kristin Schulz, Thomas Irmer, Stefan Kanis: „Ich glaube an Konflikt. Sonst glaube ich an nichts.“
mdr, 8.1.2019
Thomas Irmer: Wer war Heiner Müller und was bedeutet er heute?
mdr, 9.1.2019
Peter von Becker: Protagonist der Zukunft
Der Tagesspiegel, 21.2.2019
Alexander Kluge: Heiner Müller zum 90. Geburtstag
Volltext, Heft 4, 2018
Zum 25. Todestag des Autors:
Steffen Georgi: „Der Tod ist das einfache…“
mdr KULTUR, 30.12.2020
Carl Hegemann: Er hatte wohl leider recht, der Prophet Heiner Müller
Berliner Zeitung, 30.12.2020
Matthias Reichert: Heiner Müllers Eltern im Reutlinger Exil
Schwäbisches Tagblatt, 30.12.2020
Cornelia Ueding: Arbeiter im Steinbruch der Literatur
Deutschlandfunk, 30.12.2020
Ronald Pohl: Der rote Landschaftsplaner: Heiner Müllers ökologischer Auftrag
Der Standart, 30.12.2020
Joachim Göres: Andenken zum 25. Todestag von Heiner Müller ist umstritten
MOZ, 23.12.2020
Peter Mohr: Zwischen Rebellion und Tradition
titel-kulturmagazin.net, 30.12.2020
Achim Engelberg: Gestern & Heute: Der planetarische Klassiker Heiner Müller
piqd.de, 30.12.2020
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook 1 & 2 +
KLG + IMDb + Homepage + Archiv + Internet Archive + ÖM +
Baukasten + Kalliope +
Interviews 1 & 2 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Heiner Müller: Die Zeit 1 + 2 ✝ Der Spiegel 1 + 2 + 3 ✝
TdZ ✝
Trauerrede von Alexander Kluge am 16.1.1996 im Berliner Ensemble.
Jürgen Kuttners Müller-Sprechfunksendung vom 16.1.1996 in der richtigen Reihenfolge und eher ohne Lücken…
Thomas Assheuer: Der böse Engel
Frankfurter Rundschau, 2.1.1996
Lothar Schmidt-Mühlisch: Meine Gedanken sind Wunden in meinem Gehirn. Vom Irrglauben der Revolution zur sprachgewaltigen Weltverachtung: Zum Tode des Dramatikers und Theaterregisseurs Heiner Müller
Die Welt, 2.1.1996
Gerhard Stadelmeier: Orpheus an verkommenen Ufern. Unter deutschen Irrtrümmern. Zum Tode des Dramatikers Heiner Müller
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.1.1996
C. Bernd Sucher: Zur Weltliteratur gezwungen.
Süddeutsche Zeitung, 2.1.1996
Jürgen Busche: Mit ihm war kein Staat zu machen. Zum Tod von Heiner Müller
Wochenpost, 4.1.1996
Fritz-Jochen Kopka: Ein Kern, der unberührt blieb
Wochenpost, 4.1.1996
Hansgünther Heyme: Reflexe aus westlicher Ferne Eine Hommage an Heiner Müller
Süddeutsche Zeitung, 9.1.1996
Birgit Lahann: Nun weiß ich, wo mein Tod wohnt
Stern, 11.1.1996
Gisela Sonnenburg: Oberlehrer und Visionär. Heiner Müller verstarb
DLZ 11.1.1996
Martin Wuttke: In zerstörter Landschaft. Meine Erinnerungen an Heiner Müller
Süddeutsche Zeitung, 16.1.1996
Stephan Hermlin: Zum Abschied von Heiner Müller. Rede zur Totenfeier für Heiner Müller im Berliner Ensemble am 16. Januar 1996
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.1.1996
Friedrich Dieckmann: Trauersache Geheimes Deutschland. Wanderer über viele Bühnen im zerrissenen Zentrum: Totenfeier für Heiner Müller in Berlin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.1.1996
Hans Mayer: Der Hund, der mir ein Stück Brot hinwarf
SoirÈe, S2 Kultur, 27.4.1996
Uwe Wittstock: „Ich bin ein Neger“
Neue Rundschau, Heft 2, 1996
Frank Hörnigk u.a. (Hg.): Ich wer ist das/Im Regen aus Vogelkot Im/KALKFELL/für HEINER MÜLLER. Arbeitsbuch
Theater der Zeit, 1996
Michael Kluth:Apokalypse mit Zigarre. Der Dramatiker Heiner Müller
SFB/NDR/ORB/DW, 1996
Jürgen Flimm: Zwischen den Welten
Theater heute, Heft 2, 1996
Thomas Langhoff: Der rote Riese.
Theater heute, Heft 2, 1996
Günther Rühle: Am Abgrund des Jahrhunderts. Über Heiner Müller – sein Leben und Werk
Theater heute, Heft 2, 1996
Heiner Müller liest Texte und spricht über Inge Müller.
Heiner Müller – Gesichter hinter Masken – Gespräch & Werkzitate.


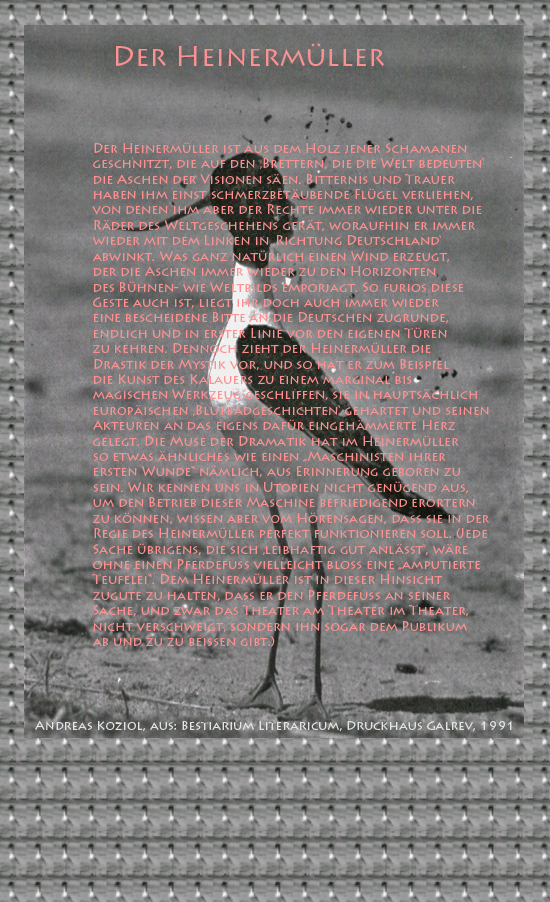
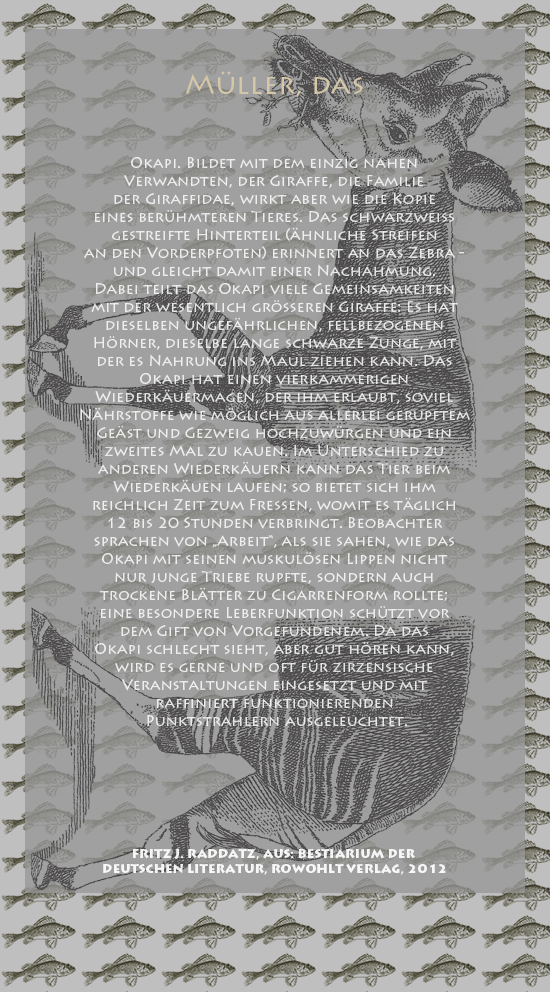












Schreibe einen Kommentar