Ilma Rakusa: les mots / morts
Die schwarzen weiss Redenden
die weissen schwarz Redenden
Elke Erb
Schwarz Weiss
oder im Wechsel.
Blökendes Schwarz
oder schreiendes Weiss
je nach dem Sonnenstand.
Nach dem Herzverstand.
Papier überblökt,
hiesse das weitergehen?
In die Weide der Weiden
in den Frieden, gestört?
In.
Immer in und immer weiter
Schwarz Weiss
oder im Wechsel.
Die Chance dauert,
kleine Geburt.
Murrt nicht.
Schwarz legt sich
Weiss zu, Weiss Schwarz.
Und weitergehen.
Und
Aus dem Mund der redenden
Zeichen dringt es
so schwarz so weiss
so Pulsschlag
stärker als Angst.
Beharrliche Arbeit am Universum der Texte
– Porträt der Übersetzerin und Autorin Ilma Rakusa. –
Es lohnt nicht. Was lohnt nicht? Zu schreiben in einer Zeit weltweiter Katastrophen, sagt Einer. Ich sage: Das eine kann ich nicht ändern, das andere nicht lassen. Auch Schneehasen sind ein Thema. Um Gottes willen, sagt Einer, welch himmelschreiende Borniertheit. Dann schreib doch mal Klartext, oder schweig.
So beginnt ein Kurztext, den Ilma Rakusa in Rowohlts Literaturmagazin 1987 veröffentlicht hat. Die wenigen Sätze enthalten eine Art Fahrplan jener Reise, die diese Autorin vor Jahren angetreten hat. Es ist eine Fahrt, von der sie sich wie dieses Ich nicht abbringen lässt, nicht von Katastrophen, nicht von Einwänden der Vernunft, nicht von fremden Programmen. Überblickt man das Schaffen dieser 1946 geborenen Schriftstellerin, so stellt man fest, wie sich ihre Arbeiten zu einer Einheit fügen, wie sich jenes „kleine Universum meiner Texte“ einstellt, von dem Ilma Rakusa spricht. Dieses Reich spannt sich aus zwischen Ost- und Westeuropa; es wird gespeist von jener Mitte, die heute Stoff für literarische Diskussionen liefert – Mitteleuropa.
In der Ostslowakei ist Ilma Rakusa als Tochter eines slowenischen Vaters und einer ungarischen Mutter geboren worden; in Budapest, Ljubljana und Triest hat sie die ersten Jahre verbracht, bevor der Vater Anfang der fünfziger Jahre Jugoslawien verlassen hat und in die Schweiz, nach Zürich, gezogen ist. Ungarisch ist Ilma Rakusas Muttersprache, ein weiches, zärtliches Idiom, das sie noch heute mit ihrem Kind spricht, Deutsch dagegen ist die Sprache, in der sie sich literarisch daheim fühlt. Mit ihrer Studienwahl hat sie die Pole ihrer späteren Beschäftigung angestrebt: In Zürich, Paris und Leningrad studiert sie Slawistik und Romanistik und lebt heute mit ihrem achtjährigen Sohn wieder in Zürich.
Ihre Tätigkeit umfasst drei Bereiche: Sie ist Übersetzerin russischer, serbokroatischer wie auch französischer Literatur; sie hat mehrere Anthologien und zahlreiche Essays zu Themen osteuropäischer Literatur veröffentlicht, und sie tritt seit einigen Jahren auch als Autorin hervor. Eine grössere Erzählung Die Insel (1982) und der Erzählband Miramar (1986) sind im Suhrkamp-Verlag erschienen.
In ihrer Übersetzertätigkeit, die aufgrund der zeitlichen Beanspruchung noch immer den Vorrang behaupten mag, ist Ilma Rakusa durch ihre Übertragungen einzelner Werke von Marguerite Duras (Der Liebhaber, Deutsch 1985, und die Chronik Sommer 1980, Deutsch 1984), von Marina Zwetajewa wie auch des Serben Danilo Kiš hervorgetreten. Ihre eigene Ausgangslage, nämlich die Mehrsprachigkeit als biografische Gegebenheit, mag sie hierin begünstigt haben, ist ihr als Geschenk, aber auch als Herausforderung mitgegeben worden, ja als Schicksal. Denn nur in den Sprachen ist Ilma Rakusa so wirklich zu Hause. Behend schlüpft sie von den einen in die andere, und besässe sie diese Sprachheimat nicht, so fühlte sie sich unbehaust. Ilma Rakusa ist eine „Nomadin des Geistes“, wie sie selbst sagt. Die Freude an der Sprache, diesem Tor zu einer Behausung, mag sich wie von selbst eingefunden haben, die Freude, mit ihr umzugehen, ihr immer wieder andere Farben zu entlocken.
Diese Lust springt dem Leser nicht nur aus Ilma Rakusas Übersetzungen entgegen, sondern vor allem auch aus ihren eigenen Texten in denen immer wieder eine Anmut am Werk ist, denn „auch Schneehasen sind ein Thema“. Nicht der Wille, eine Vorstellung in aller Breite zu entfalten, leitet sie, sondern der Wunsch, eine Imagination hinzutupfen, nur die Andeutung zu riskieren, dabei aber der Möglichkeit zu vertrauen, dass in der Skizze schon alles enthalten sein kann. Es ist die frühe Beschäftigung mit der Lyrik als einer Kunst der Verknappung, die Ilma Rakusa solches gelehrt hat.
Daneben wirkt etwas, das Ilma Rakusa in die Nähe von Gestalten wie Marina Zwetajewa oder Danilo Kiš rückt: ein wohl ausgeprägter Sinn für das Moment des Tragischen, wie es zum Beispiel in solchen Biografien aufscheint. Vielleicht mögen sich da manchmal für die einfühlsame Übersetzerin anscheinend fremder Texte entfernte Ähnlichkeiten eröffnen, leise Verwandtschaften, die sie wie Anmutungen streifen. In einer mir besonders lieben Erzählung, dem Text „Arsenal“ aus dem Prosaband Miramar, verschwistern sich früh Kinderangst und Kindereinsamkeit, und die Geschichte klingt schwermütig aus:
Kein Wort. Sie duschten. Sie assen. Und dann, um sich ihrer Niederlage zu vergewissern, Überliess die Frau das Kind dem toten Körper der Nacht.
Das ist frühe Erfahrung des Tragischen, gebündelt im Erlebnis der Einsamkeit. Das Thema der Einsamkeit, bei Ilma Rakusa ein nicht überhörbar angeschlagenes Motiv, haftet auch anderen Figuren ihres Erzählbandes an. Man kann diese Ausstattung ihrer Gestalten als Spiegelbild eigener Befindlichkeit verstehen, vor allem aber auch als Reflex jener Einsamkeit deuten, welche Marina Zwetajewa gequält hat – bis hin zu ihrem von den Lebensumständen erzwungenen Selbstmord im tatarischen Jelabuga (1941). Der Dichterin Marina Zwetajewa hat sich Ilma Rakusa seit 1972 anzunähern versucht, von ihr kommt sie nicht mehr los, sie lebt mit ihr in geheimer Auseinandersetzung.
Übersetzen – das ist nicht ein Aufgehen im fremden Text, sondern ein geduldiges Mitgehen, ein Begleiten im Medium „Sprache“. Dennoch möchte ich glauben, dass zwischen dem zu übersetzenden Text und dem eigenen sprachlichen Ausdruckswillen der Übersetzerin zwingende Verbindungen bestehen. Was Ilma Rakusa in ihrem klugen Nachwort zur autobiografischen Prosa Zwetajewas, Mutter und die Musik, schreibt, liest sich wie eine unbeabsichtigte Charakterisierung der eigenen Sprache. Marina Zwetajewas Prosa sei „eine Antiprosa“: assoziativ, lyrisch, paradox“… und „das Sperrige, Geballte“ gebe sich als „Ausdruck der Unmittelbarkeit“ zu erkennen.
Das heisst nicht, dass solche Affinitäten blosse Abhängigkeiten meinen; es ist vielmehr eine kaum zu benennende ähnliche innere Gestimmtheit, die dann die Übersetzerin wohl auch nicht zufällig an solche Texte heranführt. Mutter und die Musik, 1987 herausgekommen, ist ein wunderbarer Text, von einer glühenden Intensität durchpulst, die Ilma Rakusa kongenial in den deutschen Sprachrhythmus und Satzbau hereingeholt hat. Man erfährt hier vom Werden der eigenen Berufung einer Dichterin, die vorerst ganz unter dem Druck einer von der Mutter aufgezwungenen Passion, der Musik, gestanden hat. Früh spürte sie die Unerbittlichkeit, welche die Kunst vom Ausübenden fordert. Marina Zwetajewa musste jedoch „das Andere, das Aufgetragene“ verwirklichen, „das mit der Musik nicht zu vergleichen war und diese auf jenen Platz verwies, den sie in mir innehatte: den der normalen Musikalität…“. „Das Andere“ – das ist die Magie der Sprache, die sich früh im Kind festsaugt. Die Russin gibt hier eine denkwürdige Beobachtung mit:
Wenn die Mütter ihren Kindern häufiger unverständliche Dinge erzählten, würden diese Kinder als Erwachsene nicht nur mehr begreifen, sondern auch entschlossener handeln. Einem Kind soll man nichts erklären, ein Kind soll man beschwören.
Gleichsam ins fremde Sprachkleid hineingeschlüpft ist Ilma Rakusa während der Übertragung eines so hochkomplizierten Textes wie des Romans Sanduhr. Das Buch ist Teil einer Trilogie des 1935 in Subotica geborenen Serben Danilo Kiš, der heute in Paris lebt. Im Original ist der Roman bereits 1972 erschienen – als Geschichte einer Nacht, in der E. S., ein jüdischer Eisenbahninspektor, sein Leben einzuholen versucht. Er leistet dies in einer detailbesessenen Spurensicherung und wählt dabei immer wieder neue Perspektiven. So ist der Text ein verwirrendes Netz von Assoziationen, Erinnerungsfragmenten, Visionen, Träumen und imaginären Zeugenverhören, die mit einer hochentwickelten kriminalistischen Befragungstechnik brillieren. Schon die Einleitung zeugt von Genialität: Aus dem Wust formen sich gleichsam in einer Genesis für den Leser einzelne Gegenstände heraus, wie er auch die Geschichte nach und nach in Bruchstücken erfährt; die eigentliche Begebenheit wird aber erst am Schluss in einem authentischen Brief nachgetragen. Es gestaltet sich eine Leidensgeschichte der Verfolgungen durch die Nazis in Pannonien, dem Land zwischen Wojwodina und Westungarn, und als zentrales Ereignis schält sich der Pogrom in Novi Sad, 1942, heraus. Eine solche mit äusserster Sorgfalt betriebene Übersetzungsarbeit kostet viel Zeit und Kraft, wie Ilma Rakusa am Rand bemerkt. Hier müssen sich intuitive Intelligenz und analytischer Scharfsinn, aber auch Geduld und sprachliche Kompetenz engagieren. Es sei eine straffe Schulung „in sprachlicher Disziplin“, sagt die Übersetzerin, die mit dieser Arbeit auch die Vermittlung zwischen den Literaturen Ost- und Westeuropas ermöglicht hat.
Da mögen ihr die eigenen literarischen Arbeiten – die Essays, die kürzeren Skizzen und längeren Erzählungen – wie Oasen vorkommen, wo man sich in Zwischenpausen von einer anstrengenden Tätigkeit erholen und Atem für neue Unternehmen schöpfen kann. Dennoch verhält es sich nicht so, dass sich die beiden Bereiche – Übersetzungen und eigene schriftstellerische Tätigkeit – gegenseitig ausschliessen; eher durchzieht beide ein feines Geflecht. Mit ihrem bis anhin umfangreichsten Text, der Erzählung Die Insel, legt Ilma Rakusa die Geschichte einer Trennung aus der Perspektive des Mannes vor. In der von Frauen geschriebenen Literatur ist ein solcher Ausgangspunkt noch immer eher selten, und er wird von Ilma Rakusa verblüffend konsequent eingehalten. Innerhalb des Textes wird der Rollenwechsel auch einmal ausdrücklich reflektiert, indem die männliche Ichfigur nochmals einen Tausch vornimmt:
Die Maske ist Sinn, denn sie ist völlig rein. Anns Bestürzung, als ich mir in Venedig solch ein Ding (…) zulegte und im Hotelzimmer ,erprobte‘. Ich mimte mich als Frau und verfiel dabei, vielleicht ungewollt, in Anns Tonfall und Schritt (…) Ich wagte nicht einmal, ihr zu sagen, wie befreiend für mich der Rollenwechsel gewesen war.
Die Verständlichkeit dieses Textes stellt sich mühelos ein, ungleich rascher als jene der in Miramar enthaltenen Texte.
Dennoch eignet gerade diesen Prosastücken eine gewisse Schwerelosigkeit trotz aller feinnervigen Kompliziertheit. Ich glaube, dass Ilma Rakusas Prosa in diesem neuen Erzählband schon viel näher an ihre Eigenart herangerückt ist. Ein Blick auf weitere, zu gleicher Zeit oder später geschriebene und verstreut in Zeitschriften erschienene Beispiele der Kurzprosa bestätigen diesen Eindruck. Im Rückblick erscheint nun Die Insel vergleichsweise fast konventionell, als tastende Erprobung. Die neueren Texte dagegen stossen zu einer Kühnheit der Bilder, der Satzstruktur vor. Ich vermute, dass sich im sprachlichen Ausdruck dieser Niederschriften scharfe Gegensätzlichkeiten kreuzen, das diese Prosa überhaupt nicht so rasch zu durchdringen ist. Auf dem Vordergrund scheint eine moderne Sachlichkeit (oder Funktionalität) zu walten, die nach Zurückhaltung strebt, alles Überflüssige ausspart, aber eine intellektuell anmutende Präzision wahrt. Es ist der Mut zur Leere, der Gang in die Wüste gleichsam. Was sich aber vorerst mit Kühle wappnet, verdeckt einen vibrierenden Untergrund, eine erotisierte und erotisierende Unterschicht, deren Sinnlichkeit mit überraschender Kraft einschiesst. Sofort aber können auch wieder die Zügel wirksam werden, welche diese fessellose Dynamik mit dem Hang zur Lakonie und dem jederzeit verfügbaren spöttischen Ton eindämmen.
So gewinnen die einzelnen Texte Ilma Rakusas ganz verschiedene Sprachgesichter, schillernd in ihrer wechselnden Gestalt, faszinierend in ihrer herben Rätselhaftigkeit und dem Bestreben, eher zu beschwören als zu erklären. Nicht „Klartext“ will Ilma Rakusa schreiben. Und dazu wirkt wie ein Irrlicht eine unverkennbare Komik. Diese Prosa ist gerade wegen ihrer Fremdheit interessant. Auch die Figuren bewegen sich wie Fremde in einer literarischen Landschaft, die sich geografisch oft nicht festlegen lässt, sondern ein Irgendwo meint; deutlich werden jedoch gewisse östliche Signaturen, etwa in der Namengebung.
All dies vollzieht sich in der Stille einer Klausur, wo die Arbeit mit beharrlicher Disziplin und kreativer Schaffenskraft ausgeführt wird. Grosse Worte hegen den Texten Ilma Rakusas so wenig wie der Autorin selbst. Dafür atmet hier die Freude an der Auseinandersetzung mit der Sprache, Freude an der immer wieder neu zu errichtenden Architektur aus Worten, ihrer Magie und Verwandlungsfähigkeit. Nicht weniger aber leitet jener Ernst, der Einsamkeit für die Beschäftigung verlangt. Und es treibt jene zarte Besessenheit voran, die nicht zur Ruhe kommen lässt, sondern den Schaffenden ständig unterwegs sein lässt. Wie sagt es Ippolit in seiner Abhandlung „Meine notwendige Erklärung“ (Dostojewskij: Der Idiot)?
Kolumbus war glücklich, nicht als er Amerika entdeckt hatte, sondern als er es entdecken wollte…
Beatrice Eichmann-Leutenegger, Neue Zürcher Nachrichten, 9.7.1988
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihre Literatur und existentielle Schönheit.
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihr Werk und die europäische Geschichte und Gegenwart.
Literarische Selbstgespräche … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer – Von und mit Ilma Rakusa
Katja Scholz fragt und Ilma Rakusa antwortet: „Ich kann von Glück reden, wenn mir ein Gedicht an einem Tag gelingt.“
BLICK ÜBER DIE SCHLUCHT
für Ilma Rakusa
die sonne vertrocknete galle der himmel durchbranntes blau
weiß-greller glanz die kirschlorberei
plebs kleinzahnig die eichenblattei
in goldenen perücken wie Racine;
die albigenserfichten in fuchsroter asche glutend
die strohene front des ligurischen heers
fiel ein tabak kraus blutend am fuße des bergs
und die rosenfingrigkeit der Provence, süß wie das kerosin
alles das schillert in dem milchigen grau-blau und glas
der queren luftschicht, und wenn du fest auf den felsen schaust
kommen aus den fenstern im felsen heraus
schwalbenmenschen, die kriechen über das glas
nach rechts hinauf, nehmen zu
und die kleinen vogelbötchen täublein schwester nach schwester
fliegen mit raschem flügelgeschwirr zum ansatz des bergs
nach links, nehmen ab – in das rebenfurchen-dunkel.
der summende begleiter verstummt nun.
Oleg Jurjew
Übersetzung: Elke Erb
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Terézia Mora: Das Geschenk
Neue Zürcher Zeitung, 2.1.2016
Volker Breidecker: Die Fahrende
Süddeutsche Zeitung, 29.12.2015
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG +
Interview + DAS&D
Laudatio: 1, 2 & 3 + Lesung + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ilma Rakusa – Verleihung des Schweizer Buchpreises 2009.


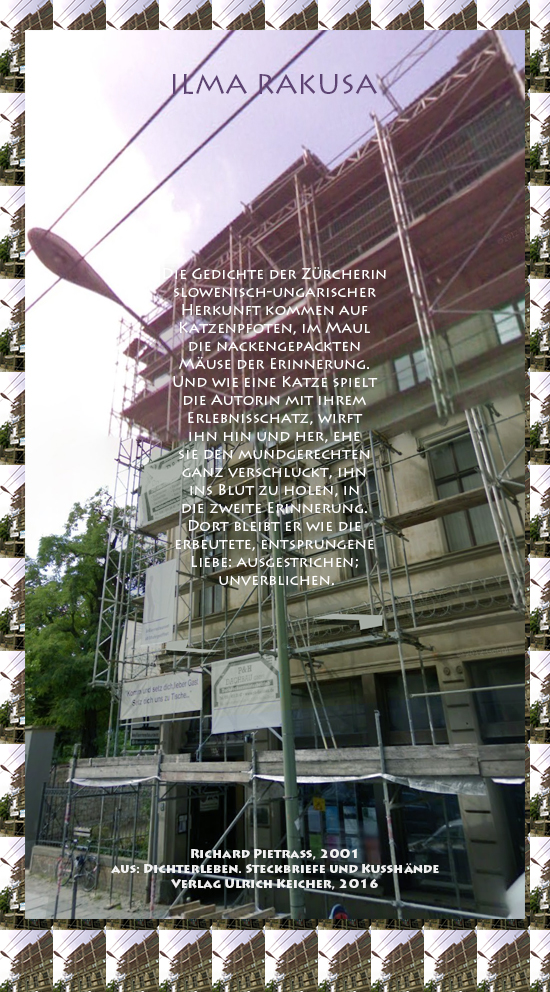












Schreibe einen Kommentar