Ilma Rakusa: Love after love
NEVERMORE
Jetzt ist die Angst der Hase und trägt mich fort
Jetzt oder nie die Wut. Wie Wunde wie Woodoo.
Kein Wie. No comparisons, please. Einfach Wut.
Und tut sich was an. Hat schon lang an der Substanz
gesägt, diese schräge Lust.
Hörige hurige Lust. Die sich ins Fleisch schneidet,
aber wie.
Und schreit und hurt. O, it hurts so badly.
Eins drauf. Eine olle Rolle Prügel. Rüde ins Herz.
Da wo die Häute zucken, ins klitzkleine Aug.
Du! Wie? Machst alles falsch. Schlaf drüber.
Doch der Hammer sitzt. Falsch.
Kalte Dusche und wie ich dich. Nein ja liebe.
Also verträgst du mehr. Hiebe. Sieb dich endlich durch.
Mehr Sport, move your ass. Trimm dich auf fun. Was
soll das russian drama.
Raus, ins Leben. Wer nur zusieht hat’s Nachsehen.
Ruck und bitte zuck und pariert.
Und durchgesiebt. Spreu vom Weizen. It’s so easy.
Ringe getauscht. Das Faktum hat einen Namen und
weiß nicht was es ist.
Weil wir uns beeilen. Warum? Selber dumm.
Weil. Gespeedet wie gegessen wie gekocht. Heiß.
Und alle Zungen Lungen verbrannt. It’s so easy.
Der Boß der Kavalier der Sensenmann.
Sofort! Mit dem Roß in die Schlacht. Und die Losung:
possession.
Ich will dich, aber wie. Mit Haut und. Gehäutet, my
lovely lovely girl.
So nackt wie Herz. Dieser schreiende Klumpen.
O God, nimm die Klammer von der Kammer. Laß ein
Rückzugsloch, o.
In den tauben Schmerz. Drainage.
Und was nicht reicht, reicht nicht. Denn du bist leck.
Brutaloboot mit gefräßigem Seelenleck. Was immer
man reinpumpt, endet nirgendwo.
Und was für Ströme, Konfessionen, big passion, Ova-
tionen.
Boy, you’re wrecked. Ich fließe aus, fortzu und wozu
Du? Hältst es nicht. Lausiger Tausch. Was mich höhlt,
geht ins Leck.
Rein, weg, o. und wo die Wale, bist du nicht
Nur fatal fordernd. Mehr, jetzt, alles!
(So hat die Callas sich verschachert und sang ins Meer.)
Alles
Die große Falle. Krawall der Ungeduld: Your circle is
full. You you you.
Ich bin der Kreis, ich bin das Schaf. Ich bin schuld, ich
bin bestraft.
So easy, das Disaster. Und die Rollen für immer ver-
teilt. Frust.
Wo die Lust so sommerlich gedeiht.
Ein Königreich. Eine Strampelwiese. Nimm und fuck.
Das Gesicht so kindlich frei. Der Körper heiter. Mehr.
Die Hand am Werg.
Wühl, und Raumzeit weg. Zwei Herzen glücksvereint.
Kein Du Ich dich Mich, die Rechnerei im Eimer.
Bonding, fondling.
Und Liebesschlaf, win-win der Leere. Atem geht. Für
heute Amen. …
Love after Love als Hörspiel inszeniert von Grace Yoon. Ein Lamento zu dritt, mit dem Cellisten Mathis Mayr, der Sängerin Lauren Newton und der Schauspielerin Corinna Harfouch
Love after love enthält acht längere Gedichte,
die alle um die verlorene Liebe kreisen – zärtlich, bitter, sanft, harsch, hadernd, klagend, im Kaddisch-Stil oder als manisch-monologisches Zwiegespräch. Die aufgewühlte, sich selbst immer wieder vergewissernde Sprache changiert zwischen Deutsch und Englisch, das den Anderen meint: Reibungsfläche, Gegenstimme, Widerpart. So scheint die Liebe hier als Abgesang auf, voll furioser Paradoxien, selbst am Schluß noch unschlüssig über das Ende, das währt.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2001
… In meinem jüngsten Gedichtband Love after love. Acht Abgesänge,
der über seine Mottos, abgewandelten Zitate (von Rilke bis Rosemarie Waldrop) und Allusionen einen ganzen Bezugsfächer entwirft, variiere ich das Genre der Litanei und des Kaddisch, freilich auf „säkulare“ Weise. Der siebte Abgesang, Lament genannt, beginnt mit einer langen Aufzählung südenglischer Ortsnamen, mit denen Abschied genommen wird. Im letzten Abgesang, And Venice, entrollt sich die gemeinsame Geschichte anhand einer venezianischen Topographie, die – namengetreu – zum Klagegesang wird. Was die Vielstimmigkeit angeht, trifft hier Deutsch – neben Englisch – auf Italienisch, und zwar so, dass die Übergänge fließend sind. Die andere Sprache, insbesondere Englisch, ist Gegenstimme, dramatischer oder zärtlicher Widerpart, Reibungselement … Der Umgang mit dem Englischen ist in Love after love inhaltlich und formal begründet, meiner Utopie eines vielsprachigen Textes nähert er sich nur zaghaft an.
…
Als ich über Monate meinen Zyklus Love after love schrieb, suchten gekappte Gefühle einer gekappten Story nach einem adäquaten Ausdruck. Eine Liebesgeschichte war zu Ende gegangen, die Erinnerung daran noch hellwach und schmerzlich; Hader und Klang stritten sich, der innere Dialog (mit dem andern) wollte nicht abbrechen. Ich verfiel in ein emotionales rhythmisches Parlando, das sich auch einer zweiten Sprache, des Englischen bediente. Zu meinem eigenen Erstaunen entstanden lange Gedichte mit einem (für meine Begriffe) langen Atem. Darin wird lamentiert und gesungen, narrative Elemente vermischen sich mit litaneihaften. Ich habe zahlreiche Realia eingearbeitet – Orte, Episoden, Namen, Zitate −, doch getragen wird das Ganze von einem Ton elegischen Zorns (oder zorniger Trauer), der einen bestimmten Rhythmus hat. Dieser staccato-, ja raphafte Rhythmus ist es, der die Abgesänge strukturiert bzw. zusammenschweißt, der ihnen zu einer Form verhilft, die den persönlich-intimen Inhalt gewissermaßen tranzendiert. Um diese Form habe ich bis zuletzt gerungen, sonst hätte ich es auch beim Tagebuchschreiben bewenden lassen können. Binnen- und Endreime, Assonanzen, Alliterationen u.ä. verstärken die formale Organisation, aber auch den Verdichtungsgrad der Texte. … Das Ende einer Liebe einzukreisen, abzusingen, zu beklagen und zu beschwören, scheint ein Unterfangen ohne Ende zu sein. Während Narration auf ein Ende drängt, entzieht sich das Ende selbst der Erzählbarkeit. Ich habe acht Anläufe gemacht, um das Ende zu Ende zu bringen. Daß es bei der Zahl acht schließlich geblieben ist, hatte damit zu tun, daß sich die Form erschöpfte. (Auch war die kathartische Wirkung erreicht: der Prozeß des Schreibens hatte Klärung gebracht.)
Love after love sei kein eigentlich narrativer Zyklus, habe ich gesagt. Narration setzt mehr Abstand voraus, Distanz zu einer Story, die ein Ganzes ergibt. In meinem Fall ist das lyrische Ich zutiefst involviert, ja aufgewühlt. Es fungiert nicht als Chronist einer Liebesgeschichte, sondern immer noch als ihr Teil. Es fungiert auch nicht als Chronist seiner Gefühle, sondern bestenfalls als deren Analytiker. Das Ende erscheint als stattgehabtes und gleichwohl präsentes – ein Ende in progress. Der Schlußsatz des Zyklus „So spült das Wasser / jeden Himmel weg“ setzt einen Punkt aus der Perspektive des Geht-nicht-mehr.
Es ist die Form, die in Love after love die subjektive Betroffenheit transzendiert und mit ihrer „Ordnung“ Welthaltigkeit schafft. Zur Form zähle ich auch das Spiel mit Referenzen: Referenzen intertextueller Art (Zitate, Motti) und gattungsmäßiger Art (Lamento, Litanei, Lied, Rap, Minidrama). Ferner den Dialog mit dem Englischen, das einen wesentlichen Teil der von mir angestrebten Polyphonie ausmacht. Welthaltigkeit definiert sich für mich nicht in erster Linie über das Sujet, sondern über dessen künstlerische Verarbeitung. Love after love ist zweifellos ein manisch-monologisches Zwiegespräch in acht Varianten, doch knüpft es vielerlei Fäden, und das entstandene Gewebe – der Text als Artefakt – ist hoffentlich so beschaffen, daß jeder Leser seine eigenen Assoziationen einflechten kann. Welthaltigkeit wäre ja auch dies: das um Leserassoziationen erweiterte Gedicht. …
Ilma Rakusa, Aus: Zur Sprache gehen, Thelem, 2006
Love after love
Manche halten deinen Gedichtzyklus Love after love für dein stärkstes Werk. Dabei ist er unter großem Leidensdruck entstanden.
Das kann man wohl sagen. Eine transatlantische Amour fou hat mich fünf Jahre lang fast um den Verstand gebracht. Als die Sache vorbei war, wusste ich nicht, ob ich vollkommen abstürze oder langsam wieder Tritt fasse. Es war schrecklich. Zum ersten Mal im Leben suchte ich therapeutische Hilfe. Der Psychologe – er starb wenige Monate später an einem Hirntumor – machte mir Mut. Ich sei stark, stark genug, das verzweifelte Kind in mir zu trösten. Ich gab mir Mühe. Schon als Kind hatte ich einmal an enttäuschter Liebe gelitten. Das Liebesdrama mit dem Angloamerikaner rührte an eine alte Wunde, vielleicht tat es darum so höllisch weh. Jedenfalls musste ich alle erwachsenen Kräfte zusammennehmen, um mich aus dieser existentiellen Krise zu befreien. Um Halt in mir selber zu finden. Traumabewältigung heißt das im Psychologenjargon. An Schreiben war zunächst nicht zu denken. Ich fühlte mich leer und stumm. Was ich ins Tagebuch notierte, glich einem zerzausten Seelenprotokoll, nicht der Rede wert. Doch eines Tages spürte ich, wie Wut in mir aufstieg. Aufs Geratewohl setzte ich mich hin und fing an. Ohne Konzept, dem Diktat des Moments folgend. Was dann geschah, war erstaunlich. Als hätten sich angestauter Schmerz und Zorn Bahn gebrochen, strömte es aus mir heraus. Ein Wortschwall in Deutsch, Englisch, anklagend, fragend, verzweifelt. Emotion pur, so hatte ich noch nie zuvor geschrieben. Ich gab einem immensen Druck nach, kämpfte ums Überleben, alles andere spielte keine Rolle. Rücksichten, Absichten, ausgeblendet. Man könnte es Raserei nennen, ich befand mich in einem Zustand höherer Raserei, jedenfalls war da eine Energie, die mich antrieb und immer weitertrieb, unbarmherzig vorantrieb. Und als ich nach Stunden aufsah, lag vor mir ein Gebilde, länger als alle meine bisherigen Gedichte. War es denn überhaupt ein Gedicht? Nicht vielmehr ein zorniges Gestammel? In das auch „er“ sich einmischte, in seinem Idiom? Ich ließ es liegen. Dann wusste ich: dies war ein Anfang. Auf das erste Gedicht folgten nach und nach sieben weitere. Keines mehr war so heftig und ausladend wie das erste. Mein Zorn ließ nach, Zärtlichkeit und Wehmut übernahmen die Register, ich dachte über Verfahren nach – Wiederholungen, litaneienhafte Aufzählungen, Reime –, das impulshafte Schreiben wich einem zunehmend kontrollierten. Und mich beruhigte, dass die Gefühle – bis zuletzt der Motor des Ganzen – sich bändigen ließen durch Form.
Entstanden sind acht Abgesänge, jeder trägt einen englischen Titel und hat ein Motto, in jedem reiben sich die Sprachen (Deutsch und Englisch) und stoßen Monologe auf Dialoge. Paradox und Ambivalenz sind Grundfiguren, Fremdzitate verdoppeln oder konterkarieren das biographische Setting.
Post festum lässt sich leicht über etwas reden, was alles andere als leicht war. Noch heute lese ich die Gedichte nicht ohne Emotion. Weil es für mich nach wie vor an ein kleines Wunder grenzt, dass Love after love existiert. Dass es mir gelungen ist, Liebesschmerz in Literatur zu verwandeln, die meine eigene Geschichte transzendiert. Darum geht es doch: um diese Verwandlung. Möge jeder Leser sich selbst und seine Story wiederfinden, wenn er den Band liest.
Übrigens konnte ich bei Lesungen beobachten, wie stark das Publikum mitging. Bis hin zu Tränen. Auch erreichten mich viele anrührende persönliche Briefe.
Das ist Trost. Das gibt mir die Gewissheit, dass meine Amour fou zu etwas gut war. Die Sache ist längst passé, wenngleich nicht vergessen. Love after love aber bleibt. Ein schmales blaues Buch, unverjährt.
Das Buch hat dich auch geheilt?
Ja, indem es entstanden und erschienen ist. Es war die bestmögliche Therapie. Und mehr als das. Denn es kann unter Umständen auch andere heilen. Dass es über mich hinausweist, macht mich am glücklichsten.
Unlängst las ich daraus im Berner Münster, ein Cellist spielte die fünfte Cello-Suite von Bach. Text und Musik erklangen alternierend, es passte wunderbar. Bach ist für mich der Lackmus-Test.
Eine Lieblingsstelle?
Die gibt es tatsächlich, sie findet sich in „Lament“, wehmütig und liedhaft:
Es war einmal ein Mund, der sagte: du
es war einmal eine Hand, die brachte Ruh
es war einmal ein Ohr, das hörte zu
es war einmal eine Stimme, die machte Mut
es war einmal ein Koffer, der hatte Zeit
es war einmal ein Mantel, der flog weit
es war einmal ein Traum, der hieß: zu zweit
es war einmal ein Lied: für immer vereint
es war einmal ein Wunsch, der wuchs riesengroß
es war einmal ein Kuss, der saß wie ein Stoß
es war einmal ein Tag, da zog ich das Los
and only death to get you out…
Schwer vorstellbar, dass du je wieder etwas Vergleichbares schreiben würdest.
Ganz unmöglich. Was ich damals erlebt habe, war einzigartig und unwiederholbar. Einzigartig in seiner Intensität und Abgründigkeit. Gott behüte, dass mir derlei ein zweites Mal passiert. Meine Lektion habe ich gelernt, sie reicht für ein Leben. Dass jene geballte Schreibenergie nicht isoliert zu haben ist, versteht sich von selbst. Ich vermisse sie nicht. Sowenig wie die überhitzten Gefühle. Seither geht es anders, temperierter zu. Was deutlich besser zu mir passt.
Ilma Rakusa, aus Ilma Rakusa: Mein Alphabet, Literaturverlag Droschl, 2019
Überall und nie mehr
Der Band ist schmal, gerade mal 56 Seiten lang, aber so schnell wird er nicht ausgelesen sein. In acht längeren Gedichten nimmt ein lyrisches Ich Abschied, mit elegischem Blick auf das Ende einer langen und intensiven Liebe.
Es wird nie mehr sein wie früher. „Das Leiden sprengt die Leidenschaft“, heisst es von dieser Liebe, die eine transatlantische und oft auch eine telefonische war. Im Gestrüpp der Gefühle, zwischen Hingabe und Abkehr, wurde sie zerrieben:
Wir ringen um das Ding
das sich entzieht
und ziehn die Schlinge
immer enger.
Die Gedichte halten auf meisterhafte Weise die heikle Balance zwischen nachzitternder Liebe und bleierner Enttäuschung.
Es könnten – und darin zeigt die Sprache ihr Doppelgesicht – fast die selben Wörter sein, die einst die Liebe beschworen und nun deren Ende beklagen. Zu nahe noch scheinen im Abgesang das Glück und dessen Verlust beieinander. Die Orte beispielsweise, wo sich die weit entfernt lebenden, durch Liebe nah Verbundenen trafen, gibt es alle noch. Aber sind sie mehr als Namen? Jedem Wort scheint die frühere Gelassenheit, das einst Tröstliche für immer ausgetrieben.
Die Begierde hat einen drastischen Temperatursturz erlitten und löst sich nun auf in einer dichten Folge von Bildern und Lautfolgen. Ortsnamen kommen noch einmal hoch, Wörter, die im Kosmos der beiden angereichert waren mit einem hohen Emotionskaliber, Worte des sehnlichen Wartens und der Verführung, englischsprachige Einsprengsel auch, sie sind nun alle das geworden, was die Litanei der Klagen antreibt.
Ilma Rakusas Gedichte erzählen von einem Aufruhr, der nach Ruhe sucht und diese nur in der aufgewühlten Rede über das Verlorene finden kann.
Martin Zingg, drehpunkt, Heft 112, April 2002
Ilma Rakusas neuester Gedichtband
ist keine bloße Sammlung von poetischen Texten, sondern ein kleiner Roman in acht Kapiteln, „in acht Abgesängen“, wie auch der Untertitel besagt.
Abgesungen wird die Liebe, der ewige Gestand der Lyrik. Aber selten wird die Liebe so methodisch und gleichermaßen stürmisch besungen wie hier:
bin ich? und bitte wo?
allein, getrennt
in limbo
zwischen dort und hier
zwischen damals und jetzt
im Reich der Irrläufer Wiedergänger
k.o.
Selten wird die Liebe so konsequent durch alle ihre Schauplätze, Umstände, Medien, Prädikate vertreten. In beinahe endlosen Listen wird sie abgesungen. 23 Partizipien – von „zerredet“ über „zerkaut“ bis „zerliebt“ („Limbo III“). An einer anderen Stelle werden 63 Toponyme aufgelistet.
Eine amerikanische Stadt entsteht daraus, bleibt in ihrer Silouette zwar ganz und heil, doch wird sie zu einer Wüste des vergangenen Glücks. Manchmal wächst durch die Zeile das Gefühl, als wäre die ganze Welt obdachlos geworden:
was mach ich mit den Straßen
Plätzen
Netzen unser Saat?
you hear me?
Die Dichterin Ilma Rakusa ist in vielen Kulturen zu Hause. In ihren früheren Büchern, auch in der Prosa, sind Spuren von vielen, insbesondere osteuropäischen Kulturen und Sprachen zu finden. In diesem neuen Gedichtband ist jedoch etwas anderes am Werke, das über das Bekannte Ilma Rakusas hinausweist.
Selten wird die Sprachvermischung innerhalb eines Textes (die bei den Literaturwissenschaftlern den seltsamen Namen „makkaronische Dichtung“ trägt und in der Moderne und Postmoderne überwiegend ein kühles semiotisches Spiel markiert) so für eine offene Gefühlsaussage benutzt wie hier die Vermischung des Deutschen mit dem Englischen – es entsteht eine fast inzestuöse Beziehung.
Alle rhythmischen und sprachlichen Wagnisse existieren in einer eisernen Konstruktion, die man als doppelte Sprachgitter bezeichnen könnte.
Dadurch ziehen sich acht große Gedichte zusammen, strammen sich, entwickeln „lyrische Muskeln“ und ein klares Sujet, bleiben in Erinnerung als eine Verserzählung, eine wütende und zugleich melancholische, die alle Phasen der Enttäuschung, Wut, Sehnsucht durchläuft, um in das harmonische, das dem Leser aus früheren lyrischen Büchern von Ilma Rakusa vertraute Element zu münden. Schauplatz für den Ausgang aus dem Schmerz ist für die in Triest aufgewachsene Rakusa Venedig.
Das letzte Gedicht des schmalen Bandes entfaltet das ewig geheimnisvolle Venedig. Das venezianische Wasser grenzt die Zeiten vor und nach der Liebe ab.
Ich gehe
so spült das Wasser
jeden Himmel weg.
Doch ist die vertraute Harmonie mit Schmerz und Wut angereichert, so, wie Erz angereichert wird, um ein härteres, klangvolleres Metall aus dem Ofen zu bekommen. Eine ganz neue Etappe auf dem Weg Ilma Rakusas.
Olga Martynova, Rheinischer Merkur, 11.4.2002
Den Schmerz auf der Zunge
„Einsamkeiten“ – mit dem schlichten, aber schillernden Plural im Titel edierte die Autorin und Übersetzerin Ilma Rakusa 1996 eine Sammlung von Texten aus dem 20. Jahrhundert, die diesem Grundgefühl der menschlichen Existenz mit Sprache zur Seite stehen. Der entleerte Himmel der Moderne habe zwar die „modischen Koketterien“ mit der Einsamkeit ad absurdum geführt, kommentierte Ilma Rakusa im Nachwort. Dennoch liess sie die Anthologie in die sprachliche Rehabilitation des Alleinseins münden, indem die letzten Textausschnitte von der positiv gewerteten Einsamkeit sprachen – derjenigen der solitär Denkenden und Schreibenden.
Nicht nur von der Einsamkeit, sondern vom noch viel Schmerzlicheren davor sprechen nun ihre eigenen, neusten Gedichte: von der Trennung, vom Verlust und vor allem vom Verlassenwerden. Love after love lautet der vermeintlich distanzierte Titel, hinter den sich acht „Abgesänge“ der ausdrucksstarken und –willigen Art reihen. Es sind Langgedichte, der Rhythmus frei, hier beschleunigt, da verlangsamend, hier nachdenklich, da furios anklagend. Vor allem aber sind es Abschiedstexte, vom Wechselspiel zwischen Deutsch und englisch, der Zweisprachigkeit jener verlorenen Liebe, unterspült:
Und mein Gesicht: blind.
Mein Haus: Verzicht.
Verzieh dich!
Leave me, lover. Belagerung beendet.
Die Festung freit sich selbst. Ruine. Aber frei.
Freit sich, lover. In frivoler Verzweiflung.
Don’t cry.
Don’t be shy.
Und das Pendel schwingt: Nein.
Achtmal hebt das weibliche lyrische Ich seine Stimme an, um den Schmerz und den Zorn neu zu gruppieren. So einzeln die Abgesänge auch angestimmt sind, so erkennbar wird über die acht Gedichte hinweg die Melodie des alltäglichen Melodrams vom Liebesverlust: ein Zusammenkommen, Zusammensein und ein Auseinandergehen – eine Lust, eine Liebe und ein Schmerz:
In unseren vertrackten Konjunktionen
gab es nur eins: den Schnee und
dein: Ich geh
so spült das Wasser
jeden Himmel weg.
Beeindruckend und irritierend zugleich ist die Insistenz, mit der Ilma Rakusa ihr lyrisches Ich zu Wort kommen lässt: Den Schmerz auf der Zunge buchstabiert es sich durch Begegnungen und die gemeinsam erlebte Geographie, im Auf und Ab der Erinnerungsmomente stets dem Pegelstand der Emotionalität ausgeliefert. An deren Oberfläche perlen Alliterationen und Assoziationen, Wortschöpfungen und Sprachspiele – masslos und zuweilen zornig, schmerzvoll und mitunter pathetisch, nachdrücklich und in eben dieser atemlosen Nachdrücklichkeit immer wieder überraschend. Vom eigenen Schmerz umfangen, scheut das lyrische Ich keine semantische Blösse:
du bist bullig gesund
willst mehr und mehr
ich flehe: weniger Verzehr
(…) du bist der Mann
Macher Macker Piesacker
ich die Frau
mausgrau zuweilen
und gar nicht schlau.
Wie stets in Ilma Rakusas Schreiben ist der Rhythmus auch in Love after love ein genaz wesentliches Sprachmoment. Das monologische, fast manische Zwiegespräch, vom lyrischen Ich in die einsame Leere gehalten, wird dabei immer wieder von der noch aufglimmenden, erinnerten Zweisprachigkeit akzentuiert. Der Rest ist vermeintlich kaskadenartige Syntax – hinter deren zorniger Beschleunigung und verlangsamender Ermattung die Orchestrierung aber immer wieder hörbar wird. Umso lyrischer ist die Bewegung, die sich über dem Ganzen der acht Gedichte abzeichnet: Spiralförmig bewegen sich Glück und Unglück, Lust und Schmerz durch die Texte, spiralförmig bewegen sie sich vom Liebesglück weg, auf die Trennung zu. Indem das weibliche lyrische Ich spricht, ordnet es in aller Wirrnis noch einmal seine verlorene Liebe und erstellt ein Inventar der Erinnerungen. Zwischen Weh und Zorn und Trotz blitzt dabei immer wieder messerscharf das Selbstbewusstsein einer Frau auf, die sich dem Schmerz nur ergibt, weil sie weiss, dass sie mit dem Leiden ebenso zu Rande kommt wie mit der Lust – Love after love: Der Schmerz ist ein Lebenszeichen, auch wenn der Liebesverlust die Existenz in den Grundfesten erschüttert. In der Einsamkeit danach entzündet sich hier lesbar der Sprachwille der Zurückgelassenen.
Sibylle Birrer, Neue Zürcher Zeitung, 23./24.3.2002
Schon das Buchcover
vermittelt eine Ahnung von Blues. Hier nimmt jemand Abschied. Vor den Augen des Lesers fightet Ilma Rakusa letzte Dialoge durch – das Ich nur mehr sich als Gegenpart. Was wird aus der Liebe, wenn sie sich selbst am Wegesrand zurücklassen muss?
God, I grieve.
Die Lettern eingraviert. In mir. Die Stimme.
Wort for Wort.
Dich auszumerzen. Ist mein Job.
Ein Pendeln hin und her zwischen Deutsch und Englisch, zwischen Festhalten-Wollen und Davonfliegen-Lassen. Als sagte es das Ich hinaus in die dunkelblaue Nacht. Mit fester Stimme zählt auf es, hält vor, klagt an – und verfängt sich dann und wann in einer Nebelschwade von Melancholie.
Remember, I care.
I caress you.
Das Karo ist leer.
Keiner.
Nur das Geschwader tobt.
Die Sprache als Spielball in einem gnadenlosen Verlustszenario, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, von everywhere to nowhere sich immer fremder werdend.
„Verzieh dich!
Leave me, lover. Belagerung beendet.
Die Festung freit sich selbst. Ruine. Aber frei.“
Acht Abgesänge, die jämmerliche Befindlichkeiten transportieren, und doch tönen sie wie Hymnen.
Cornelia Hülmbauer, readme.cc
Abgesungen wir die Liebe
Das neue Gedichtbuch von Ilma Rakusa ist keine bloße Sammlung von poetischen Texten, sondern ein kleiner Roman in acht Kapiteln, in acht größeren Gedichten, „in acht Abgesängen“, wie auch der Untertitel besagt. Abgesungen wird die Liebe – zugegeben, der ewige Gegenstand der Lyrik. Aber selten wird die Liebe so methodisch und gleichermaßen stürmisch abgesungen, wie hier:
bin ich? und bitte wo?
allein, getrennt
in limbo
zwischen dort und hier
zwischen damals und jetzt
im Reich der Irrläufer Wiedergänger
k.o.
Selten wird die Liebe so konsequent durch alle ihre Schauplätze, Umstände, Medien, Prädikate vertreten. In beinahe endlosen Listen wird sie abgesungen. – 23 Partizipien – von „zerredet“ über „zerkaut“ bis „zerliebt“ („Limbo III“). An einer anderen Stelle werden 63 Toponyme aufgelistet. Eine englische Stadt entsteht daraus, bleibt ganz und heil, doch wird sie zu einer Wüste des vergangenen Glücks. Manchmal wächst durch die Zeile das Gefühl, als wer die ganze Welt obdachlos geworden.
was mach ich mit den Straßen
Plätzen
Netzen unserer Saat?
you hear me?
Ilma Rakusa ist bekanntlich in vielen Kulturen zu Hause. In ihren früheren Büchern, auch in der Prosa, sind Spuren von vielen, insbesondere osteuropäischen Kulturen und Sprachen zu finden. Hier jedoch ist etwas anderes am Werke. Selten wird die Sprachvermischung innerhalb eines Textes (die bei den Literaturwissenschaftlern den seltsamen Namen „marokkanische Dichtung“ trägt und in der Moderne und Postmoderne überwiegend ein kühles semiotisches Spiel markiert) so für eine offene Gefühsaussage benutzt, wie hier die Vermischung des Deutschen mit dem Englischen – eine fast inzestuöse Beziehung. Alle rhythmischen und sprachlichen Wagnisse existieren in einer eisernen Konstruktion, in doppelten Sprachgittern sozusagen. Dadurch ziehen sich acht große Gedichte zusammen, strammen sich, entwickeln „lyrische Muskeln“ und ein klares Sujet, bleiben in Erinnerung als eine Verserzählung, eine wütende und zugleich melancholische, die alle Phasen der Enttäuschung, Wut, Sehnsucht durchläuft, um in das Harmonische, das dem Leser aus früheren lyrischen Büchern von Ilma Rakusa vertraute Element, zu münden. Schauplatz für den Ausgang aus dem Schmerz ist für die in Triest aufgewachsene Rakusa Venedig. Das letzte Gedicht des schmalen Bandes entfaltet das ewig geheime Venedig. Das venezianische Wasser grenzt die Zeiten vor und nach der Liebe ab:
Ich gehe
so spült das Wasser
jeden Himmel weg
Doch ist die vertraute Harmonie mit Schmerz und Wut angereichert, so, wie Erz angereichert wird, um ein härteres, ein klangvolleres Metall aus dem Ofen zu gewinnen. Eine ganz neue Etappe auf dem Weg der Dichterin Ilma Rakusa.
In: Olga Martynova: Wer schenkt was wem. Rimbaud Verlag, 2003
Der Titel verrät das Buch
Auch in love after love geht es um Liebe, Sehnsucht. Aber wie: In acht langen freirhythmischen, binnengereimten, vielgestaltig assoziativen, zwischen Städten, Ländern, Kontinenten und Sprachen (Deutsch und Englisch) springenden Katarakten wird demonstriert, was Sache ist. Das zerrt mich als Leser von Wort zu Wort, von Vers zu Vers, von Seite zu Seite. 54 Seiten bloß umfaßt dieses Büchlein, aber es strömt eine lyrische Potenz aus, die mich in Fesseln legt und taumeln läßt. Ilma Rakusas Gedichte sind Merkmalgedichte dieser Zeit der Wende von Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, in denen die Welt zum global village und die Liebe zum global event geworden ist, die, wenn überhaupt, oft nur in den zerbrochenen Köpfen stattfindet, vorstellbar nur in „broken images“.
Theo Breuer, aus: Theo Breuer: Aus dem Hinterland, Edition YE, 2005
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Christine Lötscher: Voyeurin mit geschlossenen Augen.
Tages-Anzeiger, 7.6.2002
Das Bedürfnis nach kristallinen Formen
− Gespräch mit Ilma Rakusa. −
Ich traf Ilma Rakusa am 22. April 2005 im Gästehaus der Technischen Universität Dresden, am Tag nach der letzten Vorlesung ihrer Chamisso-Poetikdozentur. Das Gespräch wurde auf ihrem Zimmer geführt. Wir waren absolut ungestört. Die Einrichtung – hell, kaum Farben im Raum – wie in einem Sanatorium. Zwischen uns lagen die Bücher von Ilma Rakusa. Ab und an griff sie nach einem, um daraus zu zitieren. Das Gespräch streifte ihr gesamtes Werk, ohne sich an einem der Bücher festzuhalten. Wichtig war mir vielmehr, das Denken und die Poetik Rakusas zu beleuchten, herauszufinden, welche Schreibhaltung zu den bemerkenswerten Texten der Bände Miramar und Steppe (1990) geführt hat, welche Umstände zu den teilweise eruptiven und offenen, dann wieder gezügelten Versen von Love after love (2001) geführt haben und warum Formen wie das Akrotrym oder der Neunzeiler solche Anziehung auf sie ausüben. Kennzeichnend für Ilma Rakusas Prosa ist das Vermeiden des Psychologischen. Und noch etwas anderes. Sowohl für die Lyrik als auch für die Prosa ist ihr Intertextualität als eine Art dialogisches Prinzip wichtig. Der im Band Steppe enthaltene Text „Liniatur“ etwa hat zwei sich ergänzende Stimmen. Eine – frei fließend und den unterschiedlichsten Assoziationen folgend – geht auf minimalistische Zeichnungen von Richard Tuttle zurück, eine andere – aphoristisch, sentenzhaft, kristallin – nimmt kontrapunktisch u.a. auf Malewitsch und Schopenhauer Bezug. Das alles weiß der Leser natürlich nicht, und muß es auch nicht wissen, um diese Texte genießen zu können. Beide Stimmen greifen seltsam ineinander und ergeben gemeinsam eine Partitur, die auch für Rakusa noch Geheimnisse offen läßt: „Ich kenne meinen Text selber nicht zur Genüge“, sagt sie. „Ich werde ihn immer neu lesen, lesen müssen, denn der Zustand, als ich ihn schrieb – und selber war −, ist vorbei. Und vorbei jener geringfügige Anlaß der ihn auslöste.“ Wie René Char weiß sie um die Notwendigkeit, die wesentlichen Schatten zu bewahren. Das macht für mich den besonderen Reiz ihrer Texte aus.
[…]
Alexander Helbig: In Ihrer Grazer Poetikvorlesung sagen Sie u.a. über die Entstehung Ihrer Gedichte: „Der Totalitätsanspruch nistet gerade in der Lyrik: alles zu sagen auf wenig Raum, unter Aufhebung der Zeit.“ Nahezu im gleichen Atemzug sagen Sie: Ziel war es, ein „sprachliches Schweben zu erreichen, ein fragiles Gleichgewicht zwischen Semantik, Syntax und lautlich-rhythmischen Valeurs.“ Steht dieses „Schweben“ nicht im Widerspruch zur Festlegung auf die strenge Form des Neunzeilers im Band Ein Strich durch alles oder der Form des Akronyms im Band Leben?
Ilma Rakusa: Nein, das sind zwei Dinge. Wenn ich vom fragilen Gleichgewicht spreche, vom Schweben usw., dann geht es um Verfahren, die ich anwende, weil mir das wichtig ist. Ich schreibe ja keine Sentenzen oder Aphorismen, sondern da spielen Reime, Halbreime und Assonanzen hinein. Solch ein lyrisches Gebilde soll für mich schweben, soll eben gerade nicht eine Eindeutigkeit wollen. Die Totalität, das ist wieder etwas anderes. Das hat mit einer sozusagen inneren Intention zu tun. Das wäre eher ein philosophisches Problem: Wie kann ich einen Moment fassen? Manchmal sind diese Gedichte auch wirklich Momentaufnahmen, Stimmungsbilder, wo ich überhaupt nicht den Anspruch habe, die ganze Welt zu erklären, oder mich zu unserer Zeit zu äußern. Es ist nicht mehr als ein Moment, aber in diesem Moment soll viel kristallisiert werden. Und ganz gleich, ob das eine Stimmung der Trauer, der Freude oder eine Naturempfindung ist. In diesem winzigen Tropfen soll sich ein Ganzes spiegeln. Das ist sozusagen eine philosophische Überlegung. Das mit dem Schweben ist ein poetologisches Problem. Es gibt da keinen Widerspruch. Das eine ist der Wunsch, etwas Kurzes, Intensives, fast Haikuhaftes zu sagen. Was nicht heißt, daß ich mich am Haiku orientiere. Aber eindrücklich ist das schon, diese extreme Kürze, mit der versucht wird, in feinsten Andeutungen einen Hauch einzufangen, der vielleicht für den Frühling steht, der aber zugleich ein Weltgefühl vermittelt. Auch Haikus haben dieses Schwebende, obwohl es strenge Formen sind. Da werden sogar die Silben gezählt, was ich in meinen Neunzeilern nicht tue. Mich hat diese Neunzahl interessiert, die man als drei und drei und drei verstehen kann oder als vier und eins und vier. Solche Formen sind Gefäße, die die Wahrnehmung schärfen, und die mich als Autor in einer positiven Weise disziplinieren. Die Form als Reibung ist für mich etwas sehr Positives. Auch die Uneindeutigkeit der Aussage. Totalität hat ja nichts mit Eindeutigkeit zu tun. Sie steckt im Wunsch, in einer winzigen Momentaufnahme mehr einzufangen als eben nur diese bestimmte Pflaumenblüte. Auch in den Akronymen kann das Schwebende entstehen, gerade weil Akronyme sich relativ schwer damit tun, wirkliche Sätze zu bilden. Die Syntax wird verändert. Jedoch kann man auch im Akronym seinen Personalstil realisieren und seine eigene Diktion bewahren. Da sind Zeilenbrüche, da ist Musik, da sind Binnenreime möglich, die die Struktur lockern. Ich empfinde diese Struktur nicht als Korsett.
[…]
Helbig: Das mag jetzt überraschen, aber, ich habe auch beim Lesen von Love after love an écriture courante denken müssen. Der Text ist ja von der Kritik äußerst unterschiedlich aufgenommen worden. Eine Rezensentin sprach von einem „kleinem Roman in acht Abgesängen“, ich hatte dagegen den Eindruck, das müßte man eigentlich auf die Bühne bringen. Sozusagen als ein Ein-Personen-Stück, das vom Dialogischen strukturiert wird. Ein Text auch, in dem mit unterschiedlichsten Formen gearbeitet wird.
Rakusa: Ja, ein Stück weit ist das wirklich so gewesen. Ich schreibe im übrigen nicht schnell. Aber, und da muß ich Duras Recht geben, man ist in einer quasi medialen Verfassung. Auch der Ausdruck Stimmentheater, den Duras gebraucht, ist sehr interessant. Ich höre diese Stimmen. In Love after love ist das sehr typisch, weil es dort die zweite Stimme gibt, die sich oft auf Englisch ausdrückt. Damit ist auch eine Art Polyphonie erreicht. Das ist eine Sache des Hörens, als hörte man diese Stimmen wirklich. Ich bin ja überhaupt der Meinung, daß man laut schreiben sollte. Ich selber tue es halblaut. Das Hören ist enorm wichtig. Ich könnte auch niemals mit einer musikalischen Berieselung im Hintergrund schreiben. Die Stille muß fast perfekt sein, damit ich diese inneren Stimmen höre. Marina Zwetajewa hat den Schreibvorgang einmal so beschrieben: Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es auch noch nicht, das ist es. Im Kopf spielt sich eine schnelle Abfolge von Selektionen ab, wobei man Wörter, Sätze verwirft. Bis sich plötzlich das Wort einstellt, das man gebrauchen kann, oder der Satz. Manchmal ist es so, daß mich beim Gehen oder im Halbschlaf ein Satz überkommt, und ich weiß in dem Moment, das ist die erste Zeile eines Gedichts oder einer Erzählung. Dann muß ich das aufschreiben. Der zweite Satz wird sich einstellen. Es braucht aber diesen Anfang. Und dann ist es wirklich eine Sache des Hinhörens. Über das Hinhören haben auch Anna Achmatowa und Joseph Brodsky gesprochen. Sie haben gesagt, daß es so etwas wie das Hinhören auf einen Rhythmus gebe. Manchmal sind es noch nicht einmal ganze Sätze, sondern es ist ein Rhythmus, der sich zuerst einstellt. Auch den Rhythmen muß man sich hingeben. Auch das gehört zu dieser écriture courante. Denn ohne Rhythmus gibt es kein Schreiben.
Helbig: Zur Entstehung Ihres in dem Band Steppe enthaltenen lyrischen Textes „Liniatur“ sagen Sie u.a.: „Der Grundimpuls war, der Bewegung einer Hand auf dem Papier zu folgen… Bevor ich eine klare Wahrnehmung hatte, spürte ich die Bewegung. Und überließ mich ihr. Alles resultiert aus dieser Bewegung, auch ihr Widerpart [d.i. eine zweite Textstruktur]… In diese Bewegung dann mischte sich Farbe, Anschauung, Reflexion, bis jene Komplexität entstand, ohne die ich mich nicht zufrieden geben kann… Ich kenne meinen Text selber nicht zur Genüge… Ich werde ihn immer neu lesen, lesen müssen, denn der Zustand, als ich ihn schrieb – und selber war −, ist vorbei. Und vorbei jener geringfügige Anlaß der ihn auslöste.“ Wie grenzt sich die hier beschriebene Arbeitsweise von der écriture courante und von der écriture automatique ab?
Rakusa: Écriture automatique würde ich für mich nicht reklamieren, das ist mir zu vage. Wichtig sind Ausdrücke wie: der erste Impuls. Ich will kurz die Entstehung des Textes „Liniatur“ rekapitulieren. Ich hatte in einem Buch minimalistische Zeichnungen von Richard Tuttle gesehen, einem amerikanischen Künstler, die mich in ihrer Sinnlichkeit fasziniert hatten im Grunde nur zwei, drei Linien jeweils. Plötzlich war der Gedanke da: Kann man überhaupt die Entstehung einer Linie auf dem Papier beschreiben. Damit beschreibe ich ja in gewissem Sinne auch die Entstehung des Schreibens. Das ist ja verwandt, die Hand auf dem Papier, das sind ähnliche Bewegungen. Dabei sind alle möglichen Assoziationen entstanden. Der Blick aus dem Fenster, eine Eidechse auf dem Balkon. Das fließt alles in den Text ein. Éctiture courante heißt ja fließendes Schreiben. So habe ich quasi diesen ersten Text geschrieben. Dann merkte ich plötzlich, daß dieser Text ein Gegenstück braucht, weil er mir zu fließend, zu assoziativ, zu weich und vielleicht auch zu unbestimmt erschienen ist. So hatte ich die Idee entwickelt, eine zweite Stimme zu komponieren. Eine ganz andere Stimme. Das finden Sie auch bei Bach – zwei vollkommen verschiedene Stimmen, die miteinander in Kontakt treten. Und so habe ich einen zweiten Text geschrieben, der sehr aphoristisch ist, sentenzhaft, kristallin. Dabei habe ich auch kunstphilosophische Begriffe benutzt und zum Beispiel Zitate von Kasimir Malewitsch, dem Begründer des russischen Suprematismus. Diese zweite Stimme ist überhaupt nicht fließend oder intuitiv, sondern sehr zerebral, sehr behauptend, sehr affirmativ. Ein richtiger Kontrapunkt. So erst wurde „Liniatur“ möglich und stimmig. Ich habe die zwei Stimmen reißverschlußartig verschränkt. Der zweite, kontrapunktische Text liest sich wie eine Abfolge von Geboten, er ist durchnumeriert. Auch das ist das Gegenteil von Fließen. Die zwei Stimmen sind übrigens typographisch interessant: sie ergeben eine Gewebestruktur oder, musikalisch gesprochen, eine Partitur.
[…]
Helbig: Inwieweit spielen Notizbücher und Tagebücher eine die Arbeit an den Texten vorbereitende Rolle?
Rakusa: Ich bin nicht jemand, der extrem viele Notizen für die Arbeiten macht. Ich führe seit meinem dreizehnten Lebensjahr ein Tagebuch. Da ist einiges zusammengekommen. Aber diese Tagebücher übernehmen nicht die Funktion von Notizbüchern. Da sind zwar Sätze drin, die ich gebrauchen könnte, wenn ich wollte. Aber interessanterweise greife ich auf diese Tagebücher kaum zurück. Da finden andere Dinge Platz. Ich notiere Träume und mehr spontan Reflexionen über bestimmte Dinge, nichts, was ich für das Schreiben dringend brauche. Auch sonst mache ich eher wenig Notizen. Manchmal sammle ich Material zu bestimmten Themen, das ich dann irgendwo ablege, und von dem ich weiß, ich könnte darauf gegebenenfalls zurückgreifen. Ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin und insofern eine Sammlerin und Archivarin. Für das Schreiben jedoch ist es gut, man verfügt über Material, aber vergißt es zugleich wieder ein bißchen. Denn dieses Material kann einem auch plötzlich zur Last werden.
Helbig: Inwieweit resultiert Ihr erster Schreibimpuls aus existentiellen Situationen?
Rakusa: Auch ein Glücksmoment kann den Anstoß geben. Es gibt die berühmte Tragische Literaturgeschichte von Walter Muschg, die in den angeführten Beispielen ziemlich schlüssig erscheint. In der Regel ist wohl die Not, der Mangel der bessere Motor beim Schreiben. Das schiere Glück ist in seiner Selbstgenügsamkeit gar nicht so inspirierend. Ich bestreite nicht, daß es immer wieder schwierige und auch existentielle Situationen waren, die mich quasi gezwungen haben: Jetzt mach was daraus! Daß das Schreiben auch Rettung ist, merkt man oft erst hinterher. Es ist ein Geschenk, daß man in solchen Situationen überhaupt wortfähig ist. Diese kathartische Wirkung des Schreibens ist ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt. Und am Schluß ist man weiter, als man vorher war, nur weiß man das, wenn man anfängt, nicht. Bei Love after love wußte ich nicht, ob es überhaupt geht, ob ich für diesen Liebesschmerz überhaupt Worte finden kann. Das war eine sehr extreme Situation, als ich anfing, diese Gedichte zu schreiben. Und daß es ein Gedichtzyklus geworden ist, das habe ich schon fast als ein Wunder gesehen. Als das Buch dann dalag und ich mir überlegte, daß es vielleicht anderen helfen könnte, hat mich das getröstet. Wenn eine Erfahrung erst einmal verbalisiert ist und eine künstlerische Form gefunden hat, kann man sich selber wieder davon trennen.
Die Literatur weiß mehr als der Autor. Was ich da manchmal geschrieben habe, war klüger als ich selbst. Ich habe Die Insel, eine Trennungsgeschichte, am Anfang meiner Ehe geschrieben, da war von Trennung keine Spur am Horizont. Später habe ich mich dann wirklich von meinem Mann getrennt. Die Literatur weiß mehr, sie ist antizipatorisch. Selber merkt man erst hinterher, welche Problematik in einem drin steckte.
Helbig: Sie schrieben einmal: „Mit jedem Satz werden die Möglichkeiten eingeschränkt, spitzt sich die Selektion zu.“ Ich gehe davon aus, daß man diesen Prozeß nicht herbeiführen kann. Gibt es dennoch Optimierungen? Gibt es Erfahrungswerte (oder gar „Tricks“), wie eine optimale Situation für die Entstehung eines Textes erreicht werden kann?
Rakusa: Nein, das würde ich schlichtweg bestreiten. Das kann sich irgendwie und irgendwann ergeben. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, es gibt aber auch einfach starke Momente. Ich hatte gestern ein paar sehr schöne Momente an der Elbe, und es ist durchaus möglich, daß daraus ein Gedicht wird, zwei Gedichte. Ich weiß es noch nicht, ich reagiere ja nicht nullkommaplötzlich auf etwas Erfahrenes. Aber die Art, wie ich gestern offen war für Erfahrungen, das Wetter, das Licht, läßt hoffen. Übrigens kann auch Nebensächliches inspirierend sein. Wie Anna Achmatowa so schön sagte: „Und wüßten Sie, wie ohne jede Scham / Gedichte wachsen, und aus welchem Müll!“ Man ahnt es oft gar nicht, das sind wirklich erstaunliche Dinge.
Helbig: Mitunter speist bei Ihnen das Meer eine Art Sehnsuchtsmetaphorik.
Rakusa: Als Sehnsuchtsmetapher ist es ganz wichtig. Wenn ich am Meer bin, ist meine Sehnsucht quasi erfüllt. In dieser Erfüllung ist die Sache dann auch schon passiert. Die Sehnsucht, das Manko, aus dieser Diskrepanz entstehen manchmal Texte. Aber ich muß nicht ans Meer, um schreiben zu können. Sondern es ist wahrscheinlich besser, ich sitze brav in Zürich und vermisse das Meer. Das ist produktiver.
Gerade für die Entstehung kurzer Gedichte kann es eine winzige Episode sein oder das Zusammentreffen von zwei ganz merkwürdig unvereinbaren Dingen, die plötzlich einen Impuls geben. Irgendeine Stimmung. Ich sitze am Schreibtisch und habe gar nicht vor zu schreiben, plötzlich sehe ich einen Lichteinfall oder einen Schatten und dann ist eine Verszeile da. Es ist nicht programmierbar und Tricks gibt es überhaupt nicht für mich. Ich muß auch keine faulen Äpfel essen, um in Fahrt zu kommen, oder eine bestimmte Teesorte trinken. Keine bestimmte Musik. Keine Stimuli. Ich brauche Stille. Wenn es keine Stille gibt, die es mir ermöglicht, in mich hinein zu hören, dann ist es schwierig. In Zeiten des Reisens, wo ich viel organisieren muß und sehr extravertiert lebe, entsteht kaum etwas. Ich kann in diesen Phasen etwas sammeln, aber wann das kreativ wird, weiß ich nicht.
[…]
Helbig: Die Entstehung des ersten Teils von Love after love kann ich mir jedoch nicht anders als zügig vorstellen. Der Text bricht geradezu hervor.
Rakusa: Solch einen Text hatte ich bis dahin noch nie geschrieben. Das war auch für mich eine überraschende Erfahrung. Das hatte etwas Eruptives. Dieser erste Text ist aus einem Gefühl entstanden, welches bei mir nicht so oft vorkommt, nämlich aus Zorn. Es ist nicht nur ein trauriger Text, es ist auch ein zorniger Text. Ich bin eher eine Elegikerin. Es gibt manchmal Ironie als Brechung, aber Zorn ganz selten. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich an dem Text gearbeitet habe, jedenfalls ist da so ein Stromstoß gekommen. Der Text ist wie aus einem Guß entstanden. Die Besinnung kam erst später. Es ist ein fast besinnungsloser Text. Doch ohne diese Eruptivität wäre es wahrscheinlich gar nicht losgegangen. Denn ich wollte ja nicht einen Kaddisch oder ein Totengebet schreiben, sondern meiner Wut freien Lauf lassen. Wut und Trauer in einem. Haß und Liebe in einem. Diese ganzen fürchterlichen Ambivalenzen. In diesem Text steckt eine Vitalität, die ich erst durch diese Liebesbeziehung in mir entdeckt habe. Meine Vitalität ist sonst nicht so an der Oberfläche. Es ist eher eine Vitalität der Neugier, der Ausdauer. Hier war etwas Überbordendes, fern von aller Berührungsangst. In der Beziehung zu diesem Mann hatte ich keine Berührungsangst, deshalb bin ich auch an gewisse Grenzen gestoßen – fast der Selbstaufgabe, der Selbstauflösung, sogar des Wahnsinns. Ich war zum ersten Mal im Leben in einer sehr gefährdeten Situation, weil ich jeden Selbstschutz aufgegeben hatte. Und davon spürt man etwas in diesen Texten. Da ist eine Maßlosigkeit drin, die an Verzweiflung grenzt.
Helbig: Das für dieses Buch gewählte Verfahren scheint mir im Gegensatz zu Ihrem sonstigen Schreiben zu stehen. Wurde bisher von Ihnen die Verknappung ins Hermetische bevorzugt, so findet hier Ausbreitung statt.
Rakusa: Nicht im ganzen Band. Es gibt Verknappungen, gerade dort, wo mit Signalen, Allusionen und Erinnerungsfragmenten operiert wird. Ich bin mir im Grunde durchaus treu geblieben. Ich habe nach Verfahren gesucht. Ich bin nicht einfach etwas losgeworden in Form einer unkontrollierten Suada. Das erste Gedicht, gut. Da mußte mal Luft raus, damit überhaupt etwas in Gang kommt. Dann wird es von Mal zu Mal schlanker und disziplinierter und lakonischer. Natürlich finden sich da und dort triviale Sätze, hingerotzte Sätze. Im Ganzen ist der Zyklus jedoch, insbesondere mit seiner Zweisprachigkeit, sehr gearbeitet. Ich würde nicht sagen, daß ich meiner Poetik untreu geworden bin. Es gibt viel Aussparung und Lakonie, viele Anspielungen und Zitate. Love after love ist über einundeinviertel Jahr hin entstanden. Am Ende war der Zorn verpufft und es hat sich ein elegischer Ton durchgesetzt. Das Ganze schließt mit einer Hommage an Venedig.
Helbig: Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ostragehege, Heft 40, 2005
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihre Literatur und existentielle Schönheit.
Silke Behl spricht mit Ilma Rakusa über ihr Werk und die europäische Geschichte und Gegenwart.
Literarische Selbstgespräche … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer – Von und mit Ilma Rakusa
Katja Scholz fragt und Ilma Rakusa antwortet: „Ich kann von Glück reden, wenn mir ein Gedicht an einem Tag gelingt.“
Ilma Rakusa zu Besuch bei Radio Neumarkt und im Gespräch mit Gabi Mezei
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Terézia Mora: Das Geschenk
Neue Zürcher Zeitung, 2.1.2016
Volker Breidecker: Die Fahrende
Süddeutsche Zeitung, 29.12.2015
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG +
Interview + DAS&D
Laudatio: 1, 2 & 3 + Lesung + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ilma Rakusa – Verleihung des Schweizer Buchpreises 2009.


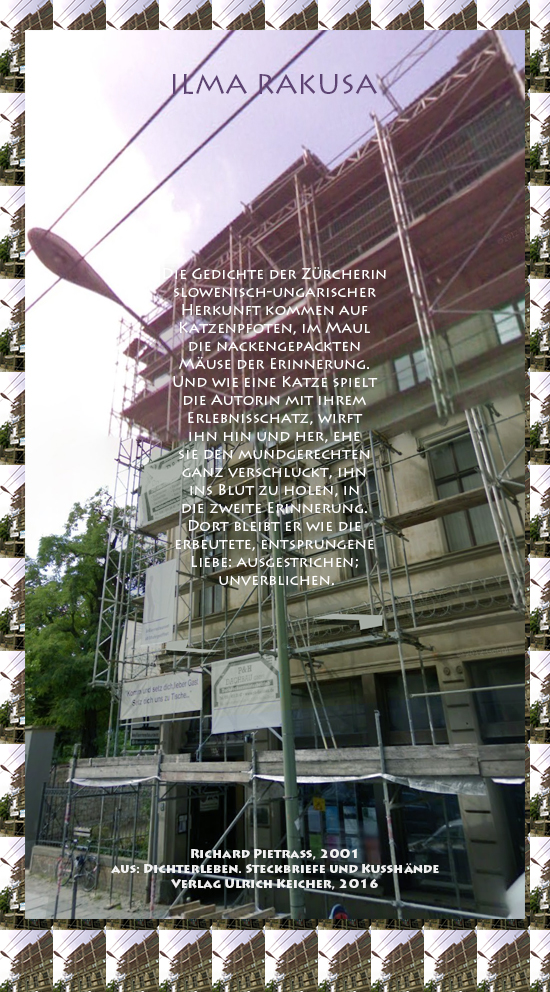












Schreibe einen Kommentar