Ingeborg Bachmann: Anrufung des Großen Bären
BLEIB
Die Fahrten gehn zu Ende,
der Fahrtenwind bleibt aus.
Es fällt dir in die Hände
ein leichtes Kartenhaus.
Die Karten sind bebildert
und zeigen jeden Ort.
Du hast die Welt geschildert
und mischst sie mit dem Wort.
Profundum der Partien,
die dann im Gange sind!
Bleib, um das Blatt zu ziehen,
mit dem man sie gewinnt.
Gegenbild der heillosen Zeit
Der Klappentext zu dem jetzt erschienenen zweiten Gedichtband Ingeborg Bachmanns sagt, daß schon in ihrem ersten Buch „die reine Stimme der Poesie selbst“ erklungen sei. Gerade das war nicht der Fall. Nicht die reine Stimme der Poesie selbst, – ein Schlagwort, das wohl nur an Äußerlichkeiten orientiert sein kann –, war es, die in den Gedichten Ingeborg Bachmanns zum Aufhorchen zwang, sondern die eigene, die ganz unverwechselbare Aussage eines Menschen, der erleidend, verzweifelt, anklagend und ohne Hoffnung in diese unsere Zeit und Welt verschlagen ist und versucht, im Wort, im Bild, im Gedicht sich Klarheit darüber zu verschaffen, was mit ihm geschehen ist. Es war die Stimme dessen, der den Schrecken überlebt hat, neuen, furchtbareren Schrecken drohen sieht und fragt, wo überhaupt es sich noch einrichten läßt. „Unsere Gottheit, die Geschichte, hat uns ein Grab bestellt, aus dem es keine Auferstehung gibt“, hieß es in der Gestundeten Zeit, und an anderer Stelle:
Das Unerhörte ist alltäglich geworden.
Eine Erfahrung wird benannt, die eigentlich erst die Generation gemacht hat, die den zweiten Weltkrieg überlebt hat, die Erfahrung nämlich, daß man auch im äußersten Schrecken noch vorhanden ist und niemals dies Bewußtsein vorhandenzusein, verlieren kann. Daß man den Schrecken erkennt und dennoch existiert. Woraus?
„Ziehn sie den Himmel fort?“ heißt es in dem neuen Gedichtband Ingeborg Bachmanns:
Trüg mich die Erde nicht, läg ich schon lange still.
Die Erde trägt noch. Ist es selbstverständlich? Wir sind nicht verstummt. Sind wir einfach noch einmal davongekommen? Und geht es weiter wie je und je? „Ich bin inmitten – was erwartest du?“ heißt es jetzt. Was besagt das? Besagt es, die Welt sei wieder heil geworden oder lasse sich wieder wie immer als eine heile erkennen? Oder nur, es sei mir gelungen, ein Refugium zu finden, in dem ich zu Haus sein kann?
Die Antwort darauf ist so einfach und so schwer wie der Vers, ein einzelner Vers, bestehend aus 5 Wörtern, der sie gibt:
Jeder, der fällt, hat Flügel.
Im Fall und aus dem Fall, heißt das, erwachsen die Kräfte, die den Untergang, die das Heillose zu bannen vermögen. Was vermag sie zu bannen? Der Flügel, der dem Fallenden erwächst, ist der aus der verzweifelten Sehnsucht geborene Entwurf eines Gegenbildes, die utopische Beschwörung der ganz anderen Welt, ist die Hoffnung, die sich nährt an der Berufung des besseren Daseins.
Utopischer Entwurf, abgezeichnet in der Verzweiflung an einer heillos, fremd und feindlich gewordenen Welt ist es, was den zweiten Gedichtband Ingeborg Bachmanns bestimmt. Gefärbt ist dieser Entwurf von den Bildern der Kindheit, von den Vorstellungen kindlicher Sagen- und Märchenwelt und von dem Erlebnis italienischer, mittelmeerischer Landschaft. In den Erinnerungsbildern der heilen, vergangenen Kinderwelt, im Zauberbereich der Sagen und Märchen, in der Verzauberung südlicher Landschaft hebt sich das Verstörende und das Verstörte auf. Wird es aufgenommen, ohne zu verschwinden. Löst es sich, ohne sich aufzulösen.
Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee
das Wort noch weiß, hat gewonnen.
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee
im Garten zerronnen.
Im Dunkel der Verstörung entfaltet sich der Zauber der Gegenlandschaft. Mitten im „Herbstmanöver der Zeit“ erwächst die Oase in der Imagination der lyrischen Sprache. Gibt Halt, gibt Trost nicht durch leere Beruhigung, sondern in der Realisation durch das Wort.
Einmal muß das Fest ja kommen!
Heiliger Antonius, weil du gelitten hast,
heiliger Leonhard, weil du gelitten hast,
heiliger Vitus, weil du gelitten hast.
Weil du gelitten hast: Das Ausharren des Erleidenden trägt Blüte in sich selbst. Die Kehrseite des Schreckens erweist sich als Entrückung. Die Kehrseite der Verzauberung bleibt der Schrecken.
Jetzt seid standhaft, törichte Heilige,
sagt dem Festland, daß die Krater nicht ruhn!
Heiliger Rochus, daß du gelitten hast,
o daß du gelitten hast, heiliger Franz.
In dem Zusammenhang der bitteren Welterfahrung mit der Erfahrung von der Benennbarkeit des Gegenbildes liegt der ganz besondere eigentümliche sprachliche Zauber dieser Gedichte. Sei es in der Anrufung des märchenhaft rächenden Bären selbst, sei es in der Mischung aus kindlichem Spiel und realer Bedrohung wie in „Das Spiel ist aus“, sei es im Anruf an „meinen Vogel“ („Was auch geschieht: die verheerte Welt sinkt in die Dämmrung zurück…“), sei es im Abglanz traumhaft verlorener mittelmeerischer Landschaft wie im „Schwarzen Walzer“ („Schuld ich dem Tag den Marktschrei und den blauen Ballon – Steinrumpf und Vogelschwinge suchen die Position zum Pas de deux ihrer Nächte, lautlos mir zugewandt…“), immer ist die Verzauberung bereit, den Verzweifelten aufzunehmen.
Dies ist nicht Flucht, nicht Transzendierung des bloß Gewünschten. Dies ist utopischer Entwurf im Wort, im, so könnte man sagen, naiv und mit aller Hingabe erfüllten Gedicht. Es bleibt Entwurf. Bleibt, als Entwurf, unvermeidbar gebunden an die Erfahrung der heillosen Welt. Bleibt als utopische Verzauberung Abbild des Leidens. Trost wird gewonnen aus der Substanz der Verzweiflung.
Löst sich das Gegenbild, versucht es, sich ins reine Positivum zu wenden, von der Erfahrung einer noch oder wieder heilen Welt zu reden, wird es ans bloß Äußere, Oberflächliche verraten. Der Vers: „Nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein“ wird durch die bedingungslose Positivität dieses „Nichts Schöneres“ zur bloßen Behauptung. In ähnlicher Weise erstarren Gedichte wie „Nord und Süd“, „Nach vielen Jahren“ oder „Harlem“ zur dekorativen Arabeske. Die Sprache läuft leer. Der reine Flug ist nicht möglich. Es sind Fehlgänge, die aus dem Versuch zu begreifen sind, das Äußerste zu leisten (und sind als solche der unvoreingenommenen Konsequenz Ingeborg Bachmanns zuzurechnen). Sie sind der Preis, der zu zahlen war für das, was als Gewinn der Sprache abgewonnen wurde. Das reine Positivum, – das eben ist der Tribut, den diese unsere Welt zu verlangen scheint, – es ließe sich nur fassen in der ausdrücklichen Benennung seiner dekorativen Leere. Der Weg dahin scheint in den letzten Prosastücken Ingeborg Bachmanns angebahnt zu sein.
Diese unsere Welt ist nicht heil. Leben in dieser heillosen Welt ist möglich, wenn ihr der Schild der utopischen Verzauberung entgegengehalten wird. Als Abbild des Leidens wird die Verzauberung zur Wahrheit, die das Heillose trifft.
Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten,
doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand.
Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten,
dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen,
die Zeit und die Zeit danach.
Wir haben keinen.
Der Klappentext spricht von der „überraschenden Einprägsamkeit und Schönheit“ der Verse. Wer war da überrascht? Der Verlag? Nicht „Einprägsamkeit und Schönheit“ kennzeichnen die Gedichte Ingeborg Bachmanns, sondern Verzweiflung und Hoffnung, beide, untrennbar, ineinander verwoben wie die Quer- und Längsfäden in einem einzigen Tuch, aufglänzend in ihrer verschiedenartigen Färbung, einzusehen nur, wenn man sie als unabwendbar Ganzes nimmt. Wahrheit nur, wenn man eins im andern erkennt.
Alles andere („die reine Stimme der Poesie selbst, Einprägsamkeit und Schönheit“) ist Mode und Mißverständnis.
Helmut Heißenbüttel, Texte und Zeichen, Heft 1, Januar 1957
Lyrik
Als im Herbst vorigen Jahres die Dichterin Ingeborg Bachmann gestorben war, da konnte man aus den Nachrufen neben dem Entsetzen über den schrecklichen Unfalltod auch eine gewisse Verlegenheit herausspüren. Ingeborg Bachmann, so hatte es den Anschein, passte nicht mehr so recht ins Bild der zeitgenössischen Literatur, ihr Roman Malina (1971) und ihre Erzählungen Simultan (1972) hatten einen Grossteil der Kritik befremdet; es mehrten sich die Stimmen der Skepsis gegenüber einer Autorin, die einst unbestritten auf dem Gipfel des literarischen Ruhms gestanden hatte.
Ingeborg Bachmann selbst hat sich gewiss keine Illusionen über die Launen des Publikums und der Kritik gemacht, die ihre Lieblinge von einst immer wieder so rüde vom Thron stösst. In ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen von 1959/60 hatte sie selbst von dem „inoffiziellen Terror“ gesprochen, „der ganze Teile der Literatur und jeder Kunst für eine Zeit in Acht und Bann tut“, und sie fuhr fort: Die wechselnden Erfolge der Werke oder ihre Misserfolge liessen weniger auf sich selber „als auf unsere eigene Konstitution und auf die Konstitution der Zeit schliessen“.
Heute ist eine allgemeine Unterschätzung der Lyrik festzustellen; auf die Blütezeit der Poesie in den fünfziger Jahren, die bis etwa in die Mitte der sechziger Jahre reichte, folgte zunächst eine Zeit, die Lyrik nur noch als politische Dichtung und Lehrgedicht gelten lassen wollte, bis schliesslich die ganze Gattung als privatistisch, innerlich und damit als angeblich gesellschaftlich irrelevant verketzert wurde. (Dass das Pendel sich inzwischen schon wieder in die andere Richtung zu bewegen scheint, bei der politischen Linken eine neue Sensibilisierung einzusetzen beginnt, sei nur am Rande vermerkt.)
Wenn wir heute die Gedichte der Ingeborg Bachmann lesen, dann sollten wir, um sie recht verstehen und beurteilen zu können, nicht vergessen, wann sie geschrieben und veröffentlicht wurden.
Gedichte haben, wie alle Literatur, ihre Zeit. Nicht als ob sie ausschliesslich als historische Texte betrachtet werden müssten und zeitgenössische Kritik ihnen gegenüber unangebracht wäre. Aber zunächst ist doch einmal der geschichtliche Ort zu erkennen. Es wäre höchst ungerecht, vor zwanzig Jahren entstandene Gedichte so zu beurteilen, als seien sie heute, 1974, geschrieben.
Anlass zu solchen Ueberlegungen gibt ein kürzlich im Verlag R. Piper (München) erschienener Band, der Ingeborg Bachmanns beide Gedichtbände Die gestundete Zeit und Anrufung des Grossen Bären zusammenfasst. Dies ist keine kritische Ausgabe, auch keine Gesamtausgabe – die Publizierung der gesamten Lyrik Ingeborg Bachmanns einschliesslich verstreuter und nachgelassener Gedichte bleibt einer späteren Edition vorbehalten –, sondern lediglich ein unkommentierter Nachdruck der beiden Bücher von 1953 und 1956. Allerdings hätte der Verlag darauf hinweisen sollen, dass bei Die gestundete Zeit nicht die Erstausgabe zugrundegelegt wurde, die Alfred Andersch 1953 in der Frankfurter Verlagsanstalt herausgegeben hatte, sondern die spätere Ausgabe aus dem Piper-Verlag, in der das Gedicht „Beweis zu nichts“ fehlt und die dafür um den Text „Im Gewitter der Rosen“ erweitert wurde.
Beim Lesen dieses Gedichtbuches beginnt man sich wieder zu erinnern an die Faszination, die einst von dieser Lyrik ausging, die in den fünfziger Jahren geradezu stürmisch gefeiert und allenthalben diskutiert und interpretiert wurde. Denn in der Tat brachte Ingeborg Bachmanns Dichtung seinerzeit einen neuen Ton in die deutschsprachige Lyrik, in der, neben dem alles überragenden Alterswerk Benns, eine zunehmend karger und ärmer gewordene Trümmerpoesie dominierte. In dieser Lage wirkte Ingeborg Bachmanns Dichtung befreiend, weil in ihr gedankliche Härte mit hoher Musikalität verbunden ist, lyrischer Intellekt und angespannte Subjektivität eine Verbindung von Gegenwart und Mythos erreichten.
Hier wurde mit einer bis dahin kaum bekannten Intensität des Denkens und Fühlens, des Intellekts und der Vitalität Gegenständlichkeit und Abstraktion ineinander verwoben, wurde Reflexion in einprägsame Bilder umgesetzt; mit raffinierter Artistik wurden die Elemente volkstümlicher Poesie, wurden Märchen, Sage und Mythos ins moderne Gedicht eingeschmolzen; mit souveräner Selbstverständlichkeit knüpfte die Dichterin an die formalen und thematischen Traditionen abendländischer Poesie an und schöpfte deren Arsenal aus. In diesen Gedichten wird eine existentielle Spannung ausgetragen zwischen Gefühl und Intellekt, Kalkül und Inspiration. Und wenn es uns heute so scheint, als ob sich in dieser Dichtung die Waage bisweilen doch allzu stark zur Seite des Gefühls hin geneigt habe und nicht alle Gedichte die Anspannung ausgehalten haben, der sie ausgesetzt sind, so wird das auch mit dem von der Dichterin selbst erwähnten Wechsel in der Konstitution des Betrachters und der Zeit zu tun haben. Im übrigen dürfte Ingeborg Bachmann selbst diese Gefährdung erkannt haben, als sie nach 1956, auf der Höhe des Ruhms, keinen Gedichtband mehr veröffentlichte und 1959/60 in Frankfurt eine Poesie forderte, die „scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht“ sein müsse.
Gottfried Benn hatte einst gesagt, auch bedeutenden Lyrikern gelängen allenfalls ein halbes Dutzend Gedichte, die überdauern. Es ist heute gewiss noch zu früh zu entscheiden, welche Gedichte Ingeborg Bachmanns die Zeit überdauern werden. Aber Texte wie „Die grosse Fracht“, „Die gestundete Zeit“, „Früher Mittag“ und „Alle Tage“ aus dem Buch von 1953, „Das Spiel ist aus“, „Anrufung des Grossen Bären“, „Erklär mir, Liebe“ und „An die Sonne“ aus der Sammlung von 1956 faszinieren noch immer, nach zwei Jahrzehnten – und das ist in der Literatur beinahe schon eine Ewigkeit.
Ein Erschrecken rührt den Leser an, wenn er jetzt, nach dem Tode Ingeborg Bachmanns, im letzten Gedicht „Lieder auf der Flucht“, ihres zweiten und zugleich letzten Gedichtbandes, die Zeile liest: „Wart meinen Tod ab, und dann hör mich wieder“, und die Schlussverse:
Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen,
die Zeit und die Zeit danach.
Wir haben keinen.
Nur Sinken um uns von Gestirnen. Abglanz und Schweigen.
Doch das Lied überm Staub danach
wird uns übersteigen.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 16.11.1974
Gedichte
Ingeborg Bachmann ist Österreicherin, Kind eines Landes, das der deutschen Sprache in den letzten Jahren mehrere begabte Dichterinnen geschenkt hat. Sie wurde vor wenigen Jahren schlagartig bekannt durch die gestundete Zeit. Das jetzt erscheinende neue Bändchen hat etwa den gleichen Umfang. Es enthält zwei größere Zyklen von Gedichten; der erste heißt „Von einem Land, einem Fluß und den Seen“ und umfaßt zehn Stücke, der zweite „Lieder auf der Flucht“, fünfzehn Stücke. Diese 25 Gedichte aus den beiden Zyklen haben – abgesehen von einzelnen Strophen und Zeilen – nicht den Rang der freien Gedichte des Bandes. Einige Titel heißen: „Mein Vogel“, „Nebelland“, „Tage in Weiß“, „Das erstgeborene Land“, „Die blaue Stunde“. Sie deuten auf die Welt Trakls und Hofmannsthals als poetische Vorfahren, doch auch George und Däubler gehören zu diesen.
Mit literarhistorischen Hinweisen ist ein Rahmen gegeben, in welchem das Eigene steht. Es hat eigene Lautgestalt und spielt mit Märchen, Mythe, Begriff und Bild. So heißt es im Titelgedicht:
Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolkenpelztier mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen…
Die Substrate gleiten fast assoziativ ineinander über, daher der unheimliche Ton, die sibyllinische Drohung. Hinter dem Ton steckt ein geheimnisvolles Mehr an Poesie. Grammatische Ueberraschungen gibt es kaum, eher syntaktische. Es gibt auch keine Bildbegriffe und Begriffsbilder („conceits“), sondern Metaphern. Das Bewußtsein, auf welches man heute gern als Dichter stolz ist, scheint ausgeschaltet. Die Dichterin ist Medium. Ihr gelingt die Bannung des Ohrs, denn ihre Verse haben Melos.
Der Ton besteht aus Trauer und Schwermut. Die symbolischen Orte dieser Gedichte sind verlassene Häfen, die geträumte Welt, die Vorwelt, das Märchen, die geträumte Welt, die Vorwelt, und wenn manche lokalisiert sind in Italien und Nordamerika, so handelt es sich nicht um die geographischen Punkte Rom und Boston, sondern um Verstecke einer spielenden Imagination. Ingeborg Bachmanns Gedichte inaugurieren eine neue Romantik, insofern als Romantik ein Seelenzustand ist – und doch sind sie mit den Leiden und Erfahrungen einer Jugend getränkt, die Krieg, Hunger, Flucht erlebte, die Heimat und die „Mitte“ verloren hat. Mit welch erstaunlichem Rhythmus aber wird das hier zum unheimlichen Bild:
Der Vampir im Rücken
übt den Kinderschritt
und ich hör ihn atmen
wenn er kreuzweis tritt.
Die Drohung des Vampirs kann aber auch anders formuliert werden, mit modernen Mitteln, und dann heißt es, man müsse die Länder wechseln „die Zirkelspitze“ im Herzen, zum Radius genommen die Nacht“. Aber etwas Ehrenhaftes, Großes, Herrliches – aber sie läßt sich lyrisch kaum ausdrücken, vielleicht weil sie zu groß ist. Wenn die Bachmann eine Sibylle ist, wird man ihr Moral zugestehen müssen, denn Sibyllen wollen warnen und weissagen, und zwar Unheil. Dann wird die durch Kunst so reizvoll verschlüsselte Welt zum Stoff der Eschatologie. Das Netz, das die Lyrikerin uns über den Kopf wirft, besteht aus dem festesten Garn der Erde, aus Schreckträumen. Sie betreffen die Zukunft:
wir werden Zeugen sein.
Curt Hohoff, Die Tat, 15.12.1956
Anrufung als Beschwörung
– Laudatio zum Bremer Literaturpreis 1957 gehalten am 26. Januar 1957. –
[…] Vor zwei Jahren hat auf ihrem [Ingeborg Bachmanns] Platz eine Landsmännin von ihr gesessen, in der Person der Frau Ilse Aichinger. Sie ist also die zweite Angehörige des Landes Österreich, der wir innerhalb vier Jahren hier in Bremen ex officio sagen und bezeugen dürfen, daß wir uns ihres dichterischen Wirkens und Daseins innerhalb der großen deutschen Sprachgemeinschaft freuen und ihr die mit solcher Freude verbundene Dankbarkeit und Ehrerbietung zollen. Ich darf vielleicht gleich hier einer Tatsache gedenken, die mir anläßlich unserer Feier besonders eindrücklich vor die Seele getreten ist. Es ist zum Erstaunen, wie viele Vertreterinnen hoher Dichtung das kleine deutschsprachige Österreich während der letzten Dezennien ins deutsche Geistesleben entsandt hat.
[…]
Sie, verehrte Frau Dr. Bachmann, werden es gewiß begreifen, wenn dem Doktor der Theologie in mir angesichts des Titels Ihres zweiten Gedichtbandes bedenklich zumute war. Die gestundete Zeit, das war ein Leitwort, das gemeinchristlichen Vorstellungen durchaus entsprach. Bei der anrufung des großen bären habe ich zwar keinen Augenblick an das aussterbende Völklein im äußersten Nordosten unserer Welt gedacht, das den Bären zugleich anruft und verspeist, aber mir fielen – schlechte Gewohnheit meinerseits – gleich Verse aus Faust II ein.
In der klassischen Walpurgisnacht singen die Sirenen:
Wir sind gewohnt, wo es auch thront, in Sonn’ und Mond, hinzubeten. Es lohnt.
Sie sehen: Ich stelle meine Torheit nackt zur Schau. Jeder Mensch hat seine Schusterdaumen. Ich habe dann aber doch gleich gesehen, daß Ihr großer Bär ein sehr reales, ein sehr bedrohliches Nachtwesen sei, und seine Anrufung den Charakter der Beschwörung trage.
Ihr Ausgang? Da darf ich die Dichterin selbst zitieren:
’s könnt’ sein, daß dieser Bär
sich losreißt, nicht mehr droht
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen
gefallen sind, den großen, den geflügelten,
die aus dem Paradiese stürzten.
Der Sturz aus dem Paradies, von dem diese Verse reden, ist meiner Meinung nach ein Politikum allererster Ordnung. Als ich von „politischer Linie“ sprach, habe ich ja nicht an den Stadtbürger – „zoon politikon“ des Aristoteles – gedacht; auch nicht an den Staatsbürger, der heute mehr denn je zum Rechenpfennig in der Trugbilanz fragwürdiger Mächte und zum Spielstein auf ihren taktischen und strategischen Schachbrettern geworden ist. Nicht an sie oder andere Politiker, Bürger oder Anti-Bürger habe ich gedacht, sondern an den Weltbürger Mensch. Er steht als „zoon politikon“ erster Ordnung hinter allen seinen einzelnen Spezies und Varietäten, deren Vielfalt uns Heutigen angesichts der allgemeinen Bedrohung in ihrer Buntheit so einförmig, in der Gespanntheit ihrer aktiven und passiven Gefährdung so wesenlos erscheinen will. Für diesen Weltbürger und seine Weltbürgerschaft ist und bleibt der seit alters bezeugte und seit alters immer von neuem wiederholte Sturz aus dem Paradies das weltpolitische Ereignis erster Ordnung. […]
Rudolf Alexander Schröder, aus Wolfgang Emmerich (Hrsg.): „Bewundert viel und viel gescholten…“. Der Bremer Literaturpreis 1954–1998. Reden der Preisträger und andere Text, edition die horen, 1999
Weitere Beiträge zu diesem Buch (Erstausgabe + Neuausgabe):
Siegfried Unseld: Ingeborg Bachmanns neue Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 10. 1956
Heinz Piontek: „Anrufung des Großen Bären“. Neue Gedichte von Ingeborg Bachmann
Stuttgarter Zeitung, 17. 11. 1956
Curt Hohoff: Ingeborg Bachmann „Anrufung des Großen Bären“
Die Tat, 15. 12. 1956
Helmut Heißenbüttel: Gegenbild der heillosen Zeit
Texte und Zeichen, Heft 1, 1957
Barbara Bondy: Verstoßen in das Frauenverlies…
Münchner Merkur, 13./14. 4. 1957
Günter Blöcker: Unter dem sapphischen Mond. Zum Thema Frauenlyrik
Der Tagesspiegel, 7. 7. 1957
Rainer Gruenter: Fülle aus Armut
Neue Deutsche Hefte, Heft 34, 1957
Günter Blöcker: Nur die Bilder bleiben
Merkur, Heft 163, September 1961
Günter Blöcker: Auf der Suche nach dem Vater
Merkur, Heft 276, April 1971
Karl Krolow: Nach zwei Jahrzehnten. Neuausgabe der Gedichte Ingeborg Bachmanns
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 3. 1974
Hilde Spiel: Das Neue droht, das Alte schützt nicht mehr
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. 8. 1974
Jürgen P. Wallmann: Ingeborg Bachmann: „Die gestundete Zeit“ – „Anrufung des Großen Bären“. Gedichte. Serie Piper No. 78
Literatur und Kritik, Heft 86/87, 1974
Kurt Oppens: Gesang und Magie im Zeitalter des Steins. Zur Dichtung Ingeborg Bachmanns und Paul Celans
Merkur, Heft 180, Februar 1963
„Haltet Abstand von mir, oder ich sterbe,
oder ich morde mich selbst“
Nimm das geängstigte Gewissen weg, so kannst du ihr Leben schließen. Ingeborg Bachmann und das Beschreiben einer Wahrheit, auf die sich so, wie sie es getan hat, kaum einer einlassen will. „Ja, Liebe führt in die tiefste Einsamkeit. Wenn sie ein ekstatischer Zustand ist, dann ist man in keinem Zustand mehr, in dem man sich durch die Welt bewegen kann. Man sieht die Welt nicht mehr mit den Augen der anderen“, hat sie gesagt. Ingeborg Bachmann und der Aufbruch ins Utopische, das ruhelose Wellenwesen, die Undine, die Frau, die in einem Riß in der Wand verschwindet. So hat sie sich gesehen, so hat sie sich in ihrer Literatur beschrieben – von ihren Gedichten bis hin zu dem Roman Malina. Ingeborg Bachmann und von Anfang an das Befragen aller Möglichkeiten zwischen Ich und Du:
Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann:
sollt ich die kurze schauerliche Zeit
nur mit Gedanken Umgang haben und allein
nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun?
Muß einer denken? Wird es nicht vermißt?
Da ist die alte bürgerliche Hoffnung von der Totalität des Individuums. Doch die Menschheitsgeschichte wies dem Mann den Verstand zu und der Frau das Gefühl. Ingeborg Bachmann ist eine emanzipierte Frau gewesen, lange bevor sich eine Frauenbewegung in den sechziger Jahren lautstark zu Wort meldete. In ihrer Prosa heißt es über die Männer:
Ihr mit euren Musen und euren Tragtieren und euren gelehrten, verständigen Gefährtinnen, die ihr zum Reden zulaßt.
In der Erzählung „Undine geht“ schreibt Ingeborg Bachmann:
Die heftigen Menschenfrauen schärfen ihre Zunge und blitzen mit den Augen, die sanften Menschenfrauen lassen ein paar Tränen laufen, die tun auch ihr Werk.
Sie, die sich den heftigen Menschenfrauen zurechnete, wußte von Anfang an:
Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.
Sie ahnte, daß sie für ihre Heftigkeit zu zahlen haben würde.
Es wuchs für sie „die Erfahrung“, wie sie schrieb, „daß die Menschen sich an einem vergingen, daß man selbst sich an ihnen verging“, daß „die Liebe zur Revanche wird für alles, was auf Erden erträglich ist“. Das Gefühl, „eine Art Aberglauben…, als wäre es jedem von uns zugedacht, genau das ertragen zu müssen, was man am wenigsten erträgt, sich mit dem Menschen ganz einlassen zu müssen, an dem man zuschanden wird mit seinem tiefsten Verlangen“. Ingeborg Bachmann und die Klage, nicht zu wissen, „wie man Platz nimmt in einem anderen Leben“. Die ekstatische Liebe, die allein Schutz böte gegen die „ungeheuerliche Kränkung, die das Leben ist“. Sie hat die Zeit gegen sich.
In ihrem Roman Malina schreibt Ingeborg Bachmann:
Ich bin die erste vollkommene Vergeudung, ekstatisch und unfähig, einen vernünftigen Gebrauch von der Welt zu machen.
Anrufung des Großen Bären heißt einer der beiden Gedichtbände von ihr. Sie beschwört darin einen imaginären Partner, ihre rettenden Gegenbilder inmitten des gefährdeten Lebens anzunehmen:
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel hinunter?
Mein lieber Bruder, bald ist die Furcht zu groß
und wir gehen unter.
Ingeborg Bachmanns Lyrik ist evokativ, aber die Lyrik hat noch eine Hoffnung. Die Prosa der Schriftstellerin hat diese Hoffnung nicht mehr. Im Roman Malina heißt es zwar noch:
Ein Tag wird kommen, an dem werden die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schönheit sehen, sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last.
Aber dann nimmt die Schriftstellerin diesen Glauben zurück:
Kein Tag wird kommen…
Die private Erfahrung ließ Ingeborg Bachmann zurück in einer heillosen Verwirrung der Gefühle. Daß die von ihr imaginierte Liebesvorstellung als Zustand nicht zu halten ist und immer eine Leidensgeschichte ist – darüber schreibt sie in ihrer Prosa. „Die Liebe hat einen Triumph, und der Tod hat einen, die Zeit und die Zeit danach. Wir haben keinen“, heißt es bei ihr. Ingeborg Bachmann wurde 47 Jahre alt. Die in Klagenfurt geborene Tochter eines Lehrers starb in Rom, wo sie mit Unterbrechungen seit 1953 gelebt hatte. Zuletzt arbeitete sie an ihrem Roman-Zyklus Todesarten, zu dem das erschienene Buch Malina gehört. Erschöpft vom Schreiben, aber unfähig einzuschlafen, nahm sie in der Nacht zum 26. September 1973 Beruhigungstabletten, legte sich ins Bett und rauchte eine Zigarette. Dabei schlief sie ein. Ihr Nachthemd fing Feuer. Sie stürzte unter die Dusche, löschte die brennenden Fetzen, ließ Wasser in die Badewanne laufen und kühlte die Brandwunden. Dann alarmierte sie per Telefon eine Bekannte.
Die Ärzte in der römischen Klinik Sant Eugenio konnten sie nicht retten. 40 Prozent ihrer Haut waren verbrannt. Die Schriftstellerin starb am 17. Oktober 1973 und wurde in Klagenfurt beerdigt. Ihr Sterben machte Schlagzeilen. Sie war eine international bekannte Dichterin. Sie hatte in der Bundesrepublik alle renommierten Literatur-Auszeichnungen bis hin zum Büchner-Preis erhalten. Schon zu Lebzeiten war diese Schriftstellerin ihre eigene Legende. Ihr Ruhm gründete auf zwei schmalen Gedichtbänden: dem Erstling Die gestundete Zeit, der 1953 erschienen war, und Anrufung des Großen Bären (1956). Danach hatte sie keine Gedichtbände mehr veröffentlicht.
Innerhalb der „Kahlschlagliteratur“ wurden ihre Gedichte damals von der Kritik als eine „Sensation“ empfunden. Das Lob war einmütig. Da hatte jemand das Empfinden einer Generation getroffen, die am Krieg selbst nicht mehr schuldig war und doch an der Schuld trug:
Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt,
sucht sein enthaupteter Engel ein Grab für den Haß
und reicht dir die Schüssel des Herzens.
Eine Handvoll Schmerz verliert sich über den Hügel.
Sieben Jahre später
fällt es dir wieder ein,
am Brunnen vor dem Tore,
blick nicht zu tief hinein,
die Augen gehen dir über.
Sieben Jahre später,
in einem Totenhaus,
trinken die Henker von gestern
den goldenen Becher aus.
Die Augen täten dir sinken.
In ihren Vorlesungen – Ingeborg Bachmann war im Wintersemester 1959/60 die erste Dozentin auf dem von der Frankfurter Universität eingerichteten Lehrstuhl für Poetik – sagte die Schriftstellerin:
Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht.
Und:
Die Fragwürdigkeit der dichterischen Existenz steht zum ersten Mal einer Unsicherheit der gesamten Verhältnisse gegenüber… daß Dichten außerhalb der geschichtlichen Situation stattfindet, wird heute niemand mehr glauben.
Doch sie beharrte darauf, daß die äußerste Subjektivität den Dichter ausmache und daß er von daher seine Existenzberechtigung erfahre:
Gelingen kann ihm, im glücklichsten Fall, zweierlei: zu repräsentieren, seine Zeit zu repräsentieren, und etwas zu repräsentieren, für das die Zeit noch nicht gekommen ist.
Ingeborg Bachmann war von Anfang an eine Schriftstellerin, die davon ausging, daß sie der Zeit nicht helfen kann, geschweige denn sie retten, sondern die nur ausdrückt, daß diese Zeit untergeht. Die rettende Bemühung aber galt ihr selbst, war ihre Bemühung für sich im privaten Leben. In diesem Widerspiel von Unmöglichem und Möglichem schrieb sie. Solange sie es im Bereich der Lyrik, die allzumal rational nie ganz auflösbar ist, tat, wurde sie gelobt. Lyrik war für sie zuerst einmal auch eine Verschanzung. Eine Verschanzung, die nachgibt in der Prosa und die Autorin dort wehrlos-menschlich zeigte. In der Prosa wurde ihr ihre subjektive Position als Ich-Monstrosität ausgelegt, als ein peinlicher Exhibitionismus.
Die Prosa der Ingeborg Bachmann rief die Zyniker auf den Plan, die jedes totale Gefühl madig machen, um nur in ihrer Sicherheit, in ihrem Distanzgehabe nicht gestört zu werden. Als Prosaistin wurde die Schriftstellerin, die die Erzählungsbände Das dreißigste Jahr (1961) und Simultan (1972) sowie den Roman Malina (1972) vorlegte, weitgehend von der Kritik abgelehnt. Für diese Kritik war Ingeborg Bachmann, als sie starb, schon längst eine „erledigte“ Schriftstellerin, eine Frau, die nur mit ihren Gedichten bestehen konnte. Doch dieselbe Kritik nutzte die Aura der Autorin, um sich unter ihrem Namen selbst zu produzieren und seit 1977 einen Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt zu vergeben.
Immer ist diese Frau ein Gegenstand der Neugier gewesen. Als sie 1953 bekannt wurde, gehörte sie mit Ilse Aichinger zu den jungen Frauen, die die männliche Szenerie der Gruppe 47 verschönerten. Sie war eine Frau, die es noch einmal wagte, den Anspruch der Frühromantik in der deutschen Literatur in Wirklichkeit umzusetzen: Leben und Werk in Einklang zu bringen. Eine Frau, die am Ende bitter vermerkte:
Mein Teil, es soll verloren gehen.
Ingeborg Bachmann – die ganz Andere, die Gezeichnete, die Zauberin, die darauf bestand, wie sie einmal formulierte, „bis zum Äußersten zu gehen, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind“:
Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten,
doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand.
Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten,
dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Immer liefen Geschichten über die Schriftstellerin um. Immer wußten Literatur-Insider etwas zu flüstern. Immer war Geheimes öffentlich. Sie war nicht jemand, der über die Liebe und die Geschlechterproblematik im Patriarchat schrieb, sie war eine Frau. Das erhöhte den Reiz. Sie war eine Frau, die zugleich publikumsscheu und publikumssüchtig war. Eine Schriftstellerin, die sehr wenig über ihre Biographie preisgab, geprägt von einem Weh-Mut und nicht von einer Wehmut. Den Freunden war sichtbar, daß sie eine von zahllosen Ängsten Gejagte war. Aber sie hat es nicht einmal in ihrem autobiographischen Roman Malina gewagt, diese Ängste offen darzulegen.
In traumhaften Visionen spricht sie von einem „Vater“ als der Inkarnation des Schreckens. Der „Vater“ erscheint als KZ-Scherge, der seine Tochter in einen Saal mit schwarzen Schläuchen einschließt, „die größte Gaskammer der Welt“. Sie beschreibt in Wahnsinnsphantasien, wie sie an den „Vater“ durch Hörigkeit und Inzest gebunden bleibt. Die grausame Vaterfigur könnte für alles stehen, was Glück und Entfaltung des fühlenden Menschen verhindert: für Krieg, Haß, Verfolgung und Gewalt, die von Menschen an Menschen verübt wird, für die Nachstellungen, denen man auf der Welt ausgesetzt ist. So könnte es sein, es könnte auch etwas anderes sein. Wir wissen es nicht.
Was die Freunde wissen, ist die Erfahrung, daß Ingeborg Bachmann von Ängsten besessen war. Und so erklärt sich ihr immer wieder geübter Sprung in die Öffentlichkeit hinein, in Parties und Veranstaltungen. Sie, die in ihrer Einsamkeit Verstörte, war darauf angewiesen, sich aller Dinge und aller Menschen zu versichern, um ihre Ängste wenigstens zeitweise loszuwerden. Sie mußte alle Menschen haben können. Ihre Hilflosigkeit wurde erkannt. Und sie hat dann gelernt, daß die Inszenierung von Hilflosigkeit ein ungeheures Machtmittel sein kann. Sie kreierte schließlich eine Schutzbedürftigkeit, da sie ihr mit Sicherheit Schutz einbrachte.
„Menschlichkeit: Den Abstand wahren können. Haltet Abstand von mir, oder ich sterbe, oder ich morde mich selber. Abstand, um Gottes Willen!“ schrieb sie zugleich. Der Schriftsteller Hans-Jürgen Fröhlich weiß von einer Begebenheit in Spoleto, wo Ingeborg Bachmann in einem Café an der Piazza saß und eine Frau mit den Worten zu ihr kam:
Ich liebe Ihre Gedichte. Sie wissen viel vom Leben. Helfen Sie mir.
Die Frau erzählte der Schriftstellerin ihre unglückliche Lebensgeschichte, und Ingeborg Bachmann reagierte mit den Worten:
Ich kann Ihnen nichts sagen. Wie soll ich Ihnen helfen?
Hans-Jürgen Fröhlich meint:
Ingeborg Bachmann hat für sich selbst keinen Rat gewußt und kein Rezept gehabt. Sie hat geschrieben und schreibend versucht, das Chaos nicht zu ordnen, sondern zu formulieren.
Ihr Tod durch Feuer schien folgerichtig, erschien so, als sei er herbeigeschrieben. Und das klingt zynisch. Dieser Flammentod steigerte noch das Legendenbild, das die Öffentlichkeit von Ingeborg Bachmann hatte. „Und zurückbleiben wird das Bett, an dessen einem Ende die Eisberge sich stoßen und an dessen unterem Rand jemand Feuer legt“, hatte sie geschrieben. Und:
Das Feuer, das plötzlich ausbricht,… ist die Rettung.
Und:
… wenn ich befeuert bleib, wie ich bin und vom Feuer geliebt.
Und:
Du wirst fallen zuletzt aber ins Feuer.
Und:
Wenn ich im Rauch behelmt wieder weiß, was geschieht.
Die Schriftstellerin Ursula Ziebarth zählt in ihrem Buch Hexenspeise (1976) an die hundert Steilen auf, in denen Ingeborg Bachmann in ihrem literarischen Werk das Feuer wie eine Erlösung herbeizuschreiben schien. Und Günter Grass schrieb der Bachmann als Nachruf dieses Gedicht:
Du hast sie gesammelt:
Schränke voll,
deine Aussteuer:
In leichteren Zeiten, als das noch anging
und die Metapher auf ihren Freipaß pochte,
wäre dir (rettend) ein Hörspiel gelungen,
in dem jener typisch doppelbödige Trödler,
durch dich vergöttert, alte Todesarten verliehen
neue aufgekauft hätte.
Bedrängt von.
Keine kam dir zu nah.
So scheu warst du nicht.
Wichsende Knaben hatten den Vorhang gelöchert:
jeder sah alles, Seide und chemische Faser
die jüngste Kollektion, bezügliche Zitate.
Todesarten: außer den windigen Kleidchen
diese probieren und diese;
die letzte paßt.
War es denn so, daß sich das literarische Werk der Ingeborg Bachmann im Sterben dieser Frau erfüllte? Nein und doch Ja in ganz anderer Beziehung, läßt man noch einmal ihre Gedichtzeile nachklingen:
Wart meinen Tod ab und dann hör mich wieder…
Als Ingeborg Bachmann von den Männern verlassen war, die sie liebte, wählte sie den Tod im Leben: Entbindung einer Produktion, rastloses Arbeiten an dem Roman-Zyklus Todesarten. In Malina, dem ersten Teil dieser Arbeit, gibt es Spuren verstummender Eindrücklichkeit, die an Erschütterungsfähigkeit die meisten Romane mit ihren abgegriffenen Ehebruchsgeschichten unendlich übertreffen. Wenn man den heutigen Menschen in seiner Lebensgier, seiner Betäubungssucht und seiner Verlorenheit begreifen will, muß man diesen Roman lesen. Ingeborg Bachmann steht dort nicht über den Menschen, sie steht mittendrin.
Es ist die Geschichte einer ausweglosen Liebe zum Nächsten. Die Ich-Erzählerin lebt in dem Roman mit dem Mann Malina zusammen und liebt einen anderen Mann namens Ivan. Doch Malina ist in Wirklichkeit der männliche Doppelgänger der Ich-Erzählerin, eine in die Realität projizierte Figur mit den Eigenschaften des Rationalen, Produktiven, die der Frau in ihrer alles verzehrenden Liebe zu Ivan abhanden gekommen sind:
Ich habe in Ivan gelebt, und ich sterbe in Malina.
Unerbittlich ausgebreitet ist hier ein Thema, das symbolhaft bereits dargestellt ist in ihrem 1958 gesendeten Hörspiel Der gute Gott von Manhattan. Da geht ein Bombenleger durch New York. Seine Opfer sind ausschließlich Liebespaare, die er in den Himmel „sprengt“.
Doch die Liebesgeschichte zwischen dem jungen Mann Jan zu dem Mädchen Jennifer, die wie Ruth in der Bibel spricht: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehn…“, bringt der Frau allein den Tod. Die Bombe, die in ihrem Hotelzimmer explodiert, zerreißt Jennifer. Jan hat sich für einen Augenblick vom Liebesrausch beurlaubt und sitzt in der Hotelbar. Die Liebe, so spricht der Bombenleger in dem Hörspiel, kann nicht geduldet werden, es sei denn in der gezähmten Form eines „Heilmittelunternehmens gegen die Einsamkeit, einer Kameradschaft oder wirtschaftlichen Interessengemeinschaft.“ Und:
Ich glaube, daß die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind.
In Ingeborg Bachmanns Hörspiel überlebt der Mann, weil er die Fähigkeit besitzt oder den Mangel, ein übermächtiges Gefühl zu unterbrechen und weil er in die Normalität einzutauchen versteht.
Die Verteidigung der Liebe aber ist für die Bachmann immer ein antigesellschaftlicher, gefährlicher Akt. Um sich zu: verwirklichen, muß die Liebe das Gesetz der Welt durchbrechen. Die Liebe ist deshalb, so wie sie von Ingeborg Bachmann dargestellt wird, ein Skandalon, Unordnung. Unordnung deshalb, weil die Gesellschaft auf der Beständigkeit einer Beziehung, der Ehe oder der Familie, beruht, die nichts anderes zum Ziel hat als die Reproduktion derselben Gesellschaft. Die Darstellung der Liebe durch Ingeborg Bachmann ist zwei Sternen vergleichbar, die das fatale Gesetz ihrer Bahn mißachten und sich im Raum begegnen. Die romantische Auffassung, zu der Bruch und Untergang gehören, ist die einzige, die wir kennen. Es ist auch die der österreichischen Schriftstellerin.
So war es denn auch nicht verwunderlich, daß der Kritiker Marcel Reich-Ranicki in der Zeit die Prosa Ingeborg Bachmanns als „ein trübes Gewässer“ denunzierte und ihr „backfischhafte Überspannung“ vorwarf. Daß die Kritikerin Sibylle Wirsing in der Frankfurter Allgemeinen über Malina meinte:
Obwohl das Romanthema die Selbstaufgabe ist, kennt das Ich nur einen Faszinationspunkt: den eigenen Nabel.
Daß der Kritiker Friedrich Wilhelm Korff persönlich wurde:
Zu verstehen ist es freilich, daß eine unglückliche Frau gelegentlich gezwungen ist, ihr weibliches Minus als ein Plus der Literatur zuzuschlagen, unverständlich bleibt aber, daß sie darin gleich so weit geht, ihr Unglück auch in Szene zu setzen, um es alsdann literarisch auszukosten…
Es ist eben das alte „Unglück“ der Bourgeoisie, die immer meint, als Publikum reagieren zu sollen. Ingeborg Bachmann setzte das Dichten absolut, und sie setzte die Liebe absolut. Dieser Zwiespalt war den „männlichen Schriftstellern“ zur Genüge bekannt. Der dänische Dichter und Philosoph Sören Kierkegaard hat ihn im vergangenen Jahrhundert in seinem Leben und in seinem Werk (Tagebuch eines Verführers) beklemmend ausgetragen. Kierkegaard setzte sich ab im Sprung in den christlichen Glauben. Weiter als er ging kaum jemand, der schrieb. Eher ein wenig zurück ins Selbstmitleid darüber, daß rechtzeitige Kapitulation vor der totalen Liebe notwendig ist. Die Liebe blieb für die „männlichen“ Schriftsteller weiter ein beliebtes Thema, aber sie wurde dargestellt als eine ständige Rechtfertigung für den ewigen Wechsel der Beziehungen. Das Thema gewann an Extensität, was es als Intensität verlor. Die Liebesthematik der „männlichen“ Schriftsteller wurde im Wesentlichen verständig, und die Leidenschaft – im wörtlichen Sinne – verflüchtigte sich. Die Frau blieb durchgehend in dieser Literatur Ausdruck männlicher Eitelkeit und Unruhe.
Ingeborg Bachmann erklärt ihren Roman Malina so:
Ich wollte zeigen, daß unsere Gesellschaft so krank ist, daß sie auch das Individuum krank macht. Man sagt, es stirbt. Doch das ist nicht wahr: Jeder von uns wird letzten Endes ermordet. Diese Wahrheit nebelt man in der Regel ein, und nur bei einer Bluttat sprechen die Zeitungen davon. Das weibliche Ich meines Buches wird fortwährend in vielen ,Todesarten‘ ermordet. Doch niemand fragt, wo dieses Töten beginnt. Auch die Kriege sind in meinen Augen nur die letzte Konsequenz dieser verborgenen Verbrechen.
Wo begann das Töten? In Malina erinnert sich die Ich-Erzählerin an das Erlebnis eines sechsjährigen Mädchens, an eine autobiographische Geschichte:
In einer Großaufnahme steht die kleine Glanbrücke da… diese mittägliche übersonnte Brücke mit den zwei kleinen Buben, die auch ihre Schultaschen auf dem Rücken hatten, und der Ältere, mindestens zwei Jahre älter als ich, rief: „Du, du da, komm her, ich geb dir etwas!“
Die Worte sind nicht vergessen, auch nicht das Bubengesicht, der wichtige erste Anruf… das Stehenbleiben, Zögern, und auf dieser Brücke der erste Schritt auf einen anderen zu, und gleich darauf das Klatschen einer harten Hand ins Gesicht: „Da, du, jetzt hast du es!“ Es war der erste Schlag in mein Gesicht und das erste Bewußtsein von der tiefen Befriedigung eines anderen, zu schlagen.
Erkanntwerden und Erkennen. Täuschung und Enttäuschung. Vertrauen und Betrug.
„Ich sage Glück“, so widersetzt sich die Ich-Erzählerin im Malina aller schlechten Erfahrung und sagt dann doch, daß alle Männer unheilbar krank seien:
Daß das Unglück der Frauen ein besonders unvermeidliches und ganz und gar unnützes ist.
Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann hat zwei Männer geliebt: den Komponisten Hans Werner Henze. Die Beziehung ging in die Brüche. Und den Schriftstellerkollegen Max Frisch. Die Beziehung ging in die Brüche. Für ihre Umgebung war Ingeborg Bachmann die bestaunte „neue Frau“ im Leben und auf der Literaturszene. Sie drehte den Begriff in der Erzählung „Drei Wege zum See“ um und ließ ihre literarische Figur Elisabeth, eine fünfzigjährige Liebende, resümieren:
… und solange es diesen neuen Mann gab, konnte man nur freundlich sein und gut zueinander, eine Weile. Mehr war daraus nicht zu machen, und es sollten die Frauen und Männer am besten Abstand halten, nichts zu tun haben miteinander, bis beide herausgefunden haben aus der Verwirrung und Verstörung, der Unstimmigkeit aller Beziehungen. Eines Tages konnte es dann anders kommen, aber nur dann, und es würde stark und mysteriös sein und wirkliche Größe haben, etwas, dem sich jeder unterwerfen könnte.
Hans Werner Henze: Ingeborg Bachmann lernte ihn in Niendorf an der Ostsee auf der Tagung der Gruppe 47 im Jahre 1952 kennen. Sie schrieb eine neue Textfassung für dessen Ballettpantomime Der Idiot. Sie wurde 1960 in Berlin aufgeführt. Der Monolog des Fürsten Myschkin aus diesem Libretto ist in Ingeborg Bachmanns Erstling Die gestundete Zeit enthalten. Nach einem Libretto von Ingeborg Bachmann entstanden Hans Werner Henzes Opern Der Prinz von Homburg (Uraufführung 1960 an der Hamburgischen Staatsoper) und Der junge Lord (Uraufführung 1965 an der Deutschen Oper Berlin).
In ihrer Erzählung „Undine geht“ schrieb Ingeborg Bachmann:
Ja, diese Logik habe ich gelernt, daß einer Hans heißen muß, daß ihr alle so heißt, einer wie der andere, aber doch nur einer. Immer einer nur ist es, der diesen Namen trägt, den ich nicht vergessen kann… Wie könnte ich je an die Wichtigkeit eurer Verstrickungen glauben? Wie euch glauben, solange ich euch wirklich glaube, ganz und gar glaube, daß Ihr mehr seid als eure schwachen, eitlen Äußerungen, eure schäbigen Handlungen, eure törichten Verdächtigungen. Ich habe immer geglaubt, daß ihr mehr seid, Ritter, Abgott, von einer Seele nicht weit, der allerköniglichsten Namen würdig. Wenn dir nichts mehr einfiel zu deinem Leben, dann hast du ganz wahr geredet, aber auch nur dann. Dann sind alle Wasser über die Ufer getreten, die Flüsse haben sich erhoben, die Seerosen sind gleich hundertfach erblüht…
„Undine geht“, das ist Anklage und Klage zugleich:
In euren schwerfälligen Körpern ist eure Zartheit zu loben. Etwas so besonders Zartes erscheint, wenn ihr einen Gefallen erweist, etwas Mildes tut. Viel zarter als alles Zartes von euren Frauen ist eure Zartheit, wenn ihr ein Wort gebt oder jemand anhört oder versteht.
Was die Autorin in den Männern attackiert, ist deren letztliche Flucht vor der höchsten Verwirklichung der Liebe: Zwei Einsamkeiten, die sich einander öffnen, die ihre eigene Welt schaffen und damit die gesellschaftliche Lüge zerstören, Zeit und Arbeit aufheben und sich für autonom halten.
Und so heißt es in „Undine geht“:
Verräter! Wenn euch nichts mehr half, dann half die Schmähung. Dann wußtet ihr plötzlich, was euch an mir verdächtig war, Wasser und Schleier und was sich nicht festlegen läßt. Dann war ich plötzlich eine Gefahr, die ihr noch rechtzeitig erkanntet, und verwünscht war ich… Ihr habt Altäre rasch aufgerichtet und mich zum Opfer gebracht. Hat mein Blut geschmeckt?… Mein Gedächtnis ist unmenschlich. An alles habe ich denken müssen, an jeden Verrat und jede Niedrigkeit.
Max Frisch: Er hat seine Beziehung zur Bachmann in der autobiographischen Erzählung „Montauk“ 1975 veröffentlicht. Vier Jahre lang, zwischen 1958 und 1962, waren sie beieinander. Abwechselnd in Rom und in Zürich. Max Frisch präsentiert sich in „Montauk“ als sympathischer Versager. Er spricht von Eifersucht, von Hörigkeit, öffnet Ingeborg Bachmanns Briefe, liest darin über einen anderen Mann, er spricht ein wenig von Qual, aber er stellt sie nicht dar, er berichtet von Kleinigkeiten:
Sie zu beschenken ist eine Freude; sie strahlt. Sie verlangt den Luxus nicht, wenn er da ist, so ist sie ihm gewachsen. Ihre Herkunft ist kleinbürgerlich wie die meine; nur ist sie frei davon. Wenn sie rechnet, dann rechnet sie mit Wundern… zu meinem fünfzigsten Geburtstag lädt sie mich nach Griechenland ein.
Und:
Das Ende haben wir beide nicht gut bestanden.
Ja, was ist denn nun passiert, daß diese Beziehung zerbricht? Was soll dieser Exhibitionismus, der sich nicht traut? Entweder man läßt sich auf einen Menschen ein oder nicht. Entweder man läßt sich auf ein Buch ein oder nicht. Montauk aber ist kein ehrliches Buch geworden. Hat er die Bachmann überhaupt geliebt? Liebt er eine Frau, kann er eine lieben? Hat die Bachmann ihn geliebt? Warum sind beide in diesen Kampf verwickelt? Ist das Buch Montauk eine seiner Rechtfertigungen, um nicht seine Angst vor dem Geschlecht besprechen zu müssen? Seine Liebe, wenn es denn eine war, ist eine Angst gewesen. Die Angst, er könnte die Bachmann in sich verleugnen. Und er verleugnete sie ja auch, so wie er über sie in diesem Buch schreibt.
Schreibend liebt dieser Max Frisch nur sich selbst. Schreibend entzündet er Liebe. Schreibend bestimmt er den Tod der Liebe. Im Leben hat er andern die Erfahrung des Todes zugefügt, indem er sie verließ. Verlassenwerden aber ist Tod erleben. Das ist das Brutale an Max Frisch und zugleich das Menschliche, weil es so alltäglich ist.
Erkannt hat Max Frisch dies als junger Mann, wenn er schreibt:
Angst vor dem Schmerz bringt uns zur Rücksicht, nie zum Leben, und so wie Du einmal erzogen bist und wie wir fast alle erzogen sind… Mit einem Gewissen, das die Ausmaße eines Geschwürs annimmt… versündigen wir uns in diesem Leben mehr durch Rücksicht als durch das Gegenteil, vorab durch Rücksicht gegen uns selber.
Doch dann ist Max Frisch der alten Moral gefolgt: Der Kunst, ohne Schmerzen durchzukommen. Max Frisch hat sich in seiner Erzählung „Montauk“ völlig im Griff. So kann er über Ingeborg Bachmann schreiben:
In ihrer Nähe gibt es nur sie, in ihrer Nähe beginnt der Wahn. Soviel habe ich schon gewußt. Noch meine ich, es sei zu entscheiden wie mit einer Münze, die man wirft: Kopf oder Schrift? Es ist aber schon entschieden. Zum Hohn bloß werfe ich tatsächlich eine Münze, 100 Lire, nehme sie vom Boden, ohne hinzusehen, ob Kopf oder Schrift; ich warte nur noch, bis es einen Kaffee gibt…
Diese männliche Haltung, die in der Liebe der Wahrheit aus dem Wege geht und in der Literatur der Wahrhaftigkeit, unterscheidet Max Frisch von der Ingeborg Bachmanns. In der Beurteilung der Literaturkritik war Max Frischs Montauk Kunst und Ingeborg Bachmanns Malina Kitsch. Auch der Kritik blieb der von Frisch benannte „MALE CHAUVINISM“ vertrauter und lieber. Er hat die Literaturgeschichte auf seiner Seite.
Und manche Kritikerin hat diese Haltung so verinnerlicht, daß sie ihr als die eigene vorkommt. So Lore Thoman in der Zürcher Zeitung Die Tat über Ingeborg Bachmann und Max Frisch:
Sie war eine geistige Potenz von Millionärsrang, mit der eigentlich kein Mann sich einzulassen wagte, keiner außer ihm; aber er war selbst zu sehr Star, um es durchzuhalten. Er brach ihr Herz… Vielleicht mußte er sie literarisch verfremden, um seine eigene Seele zu retten?
Lore Thoman spielt auf Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein an, der in verschlüsselter Form ebenfalls seine Beziehung zu Ingeborg Bachmann darstellt. Lore Thoman meint über Frisch:
Er hatte immer die Unterhaltung des Lesers dabei im Auge, er kann noch in Salamanca als Svoboda mit einer Münze ans Glas klopfen, um zu zahlen, während sie selbst als Prinzessin Kagran (in Malina) nur „plötzlich einen Schilling im Mund“ haben kann, „leicht, kalt, rund“, den Obolus für den Fährmann, der sie ins Totenreich führt. Er kann zu seinem eigenen Begräbnis gehen, und es wird unterhaltsam werden… während sie… nur noch aufpassen muß, daß sie „mit dem Gesicht nicht auf die Herdplatte falle, mich selber verstümmele, verbrenne“.
Ingeborg Bachmann: Geboren 1926 in Klagenfurt. In der Erfahrung des Faschismus aufgewachsen:
Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war so etwas Entsetzliches, daß mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt: Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke vielleicht überhaupt nicht mehr hatte… Diese ungeheuerliche Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren – das Aufkommen meiner ersten Todesangst.
1944 machte Ingeborg Bachmann ihre Matura. Sie studierte in Graz, Innsbruck und Wien, wo sie 1950 mit einer Arbeit über „Die kritische Aufnahme der Existenzphilosophie Martin Heideggers“ promovierte. Sie wurde Redakteurin am Sender Rot-Weiß-Rot. 1952 ging ihr erstes Hörspiel mit dem Titel Ein Geschäft mit Träumen durch den Äther. Ein Jahr später kam ihr erster Gedichtband heraus. Noch im selben Jahr erhielt sie den Preis der Gruppe 47.
In ihrer Literatur hat sie vom Hörigsein, vom Verstummen, vom Einanderdulden, vom Dursten und doch Nüchternbleiben, dem Bereuen und dem Rückzug in die Moral geschrieben und nichts davon akzeptiert. Es sind die klassischen Bedrückungen menschlicher Existenz, nicht ihre aktuellen Folgeerscheinungen. „Washington und Moskau und Berlin sind bloß vorlaute Orte, die versuchen, sich wichtig zu machen“, hat sie in ihrer Literatur geurteilt. Und sie hat ihr Einverständnis mit dem Land Österreich erklärt, das „aus der Geschichte ausgetreten ist“. Sie hat diesen Austritt als „ein Beispiel für die Welt“ genannt: … „weil hier keine verschonte Insel ist, sondern an jeder Stelle Untergang ist, ist alles Untergang, mit dem Untergang der heutigen und morgigen Imperien vor Augen“. Sie hat ihre Literatur dargestellt als eine Möglichkeit „zu neuer Wahrnehmung, neuem Gefühl, neuem Bewußtsein“. Sie hat verteidigt, was es in der Geschichte nicht gibt: die „Herzländer“. Sie meinte jeden einzelnen Menschen.
In ihrem Nachlaß fand man eine „Hommage à Maria Callas“, an eine große Künstlerin, die der Aufdringlichkeit der Öffentlichkeit ausgesetzt war und über die zuletzt niemand mehr etwas Positives sagen mochte. Was Ingeborg Bachmann über die Callas schrieb, könnte auch für sie gelten:
Sie wird nie vergessen machen, daß es Ich und Du gibt, daß es Schmerz gibt, Freude, sie ist groß im Haß, in der Liebe, in der Zartheit, in der Brutalität, sie ist groß in jedem Ausdruck, und wenn sie ihn verfehlt, was zweifellos nachprüfbar ist, ist sie noch immer gescheitert, aber nie klein gewesen. Sie kann einen Ausdruck verfehlen, weil sie weiß, was Ausdruck überhaupt ist.
Die Lyrik der Ingeborg Bachmann ist entdeckt. Sie wurde in dem Maße überschätzt, in dem ihre Prosa unterschätzt wurde. Eine Prosa, die mit ihren Fragen und Zweifeln tiefer geht als das Gedicht. Ihre Prosa ist die Herausforderung. Die Aufforderung, wie der Salamander durchs Feuer zu gehen. „Wohl euch, ihr werdet geliebt, und es wird euch viel verziehen“, schreibt Ingeborg Bachmann.
Doch vergeßt nicht, daß ihr mich gerufen habt in die Welt, daß euch geträumt hat von mir, der anderen, dem anderen, von eurem Geist und nicht von eurer Gestalt, der Unbekannten, die auf euren Hochzeiten den Klageruf anstimmt, auf nassen Füßen kommt und von deren Kuß ihr zu sterben fürchtet, so wie ihr zu sterben wünscht und nie mehr sterbt: ordnungslos, hingerissen und von höchster Vernunft.
Jürgen Serke, aus Jürgen Serke: Frauen schreiben, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982
Noch gibt es Lieder zu singen
Die Nachrichten, über die Tage hinweg, sie haben uns verstört. Gespräche mit Kollegen, Telefonanrufe bei gemeinsamen Freunden in Rom; Hoffnungen wie Irrlichter. Heym beim Schlittschuhlaufen ertrunken; Horváth von einem herabstürzenden Ast erschlagen; Ingeborg Bachmann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und in Brand geraten, Verletzungen, die tödlich waren.
Selten war ein Tod so schwer und so sinnlos.
Sie war das liebste Geschöpf der deutschen Kritik. Seit jenem Jahr (1953), da sie zum ersten Mal bei der Gruppe 47 vorlas und gleich den Preis der Gruppe erhielt, noch bevor ihr erster Gedichtband erschienen war, wurde sie mit Hymnen und Preisen überschüttet. Nach der Trümmerlyrik (wer erinnert sich noch daran?), eine junge Dichterin, die diesen Namen wirklich verdiente. Kein Weltschmerz, aber Weltangst, keine lyrische Schwärmerei, eher nüchternes Pathos, keine Aktualität, doch Zeiterfahrung – und in der Form so etwas wie Klassizität. Ein junges, schönes Mädchen mit großen, klugen Augen, scheu und immer etwas verwirrt, aus der „großen (geistigen) Landschaft bei Wien“ stammend, Trakl und Wittgenstein:
… dem vergänglichsten Augenblick geneigt
und der Schönheit verfallen,
sag ich mich los
von der Zeit,
ein Geist unter Geistern,
die kommen.
So wie sie, stelle ich mir vor, hat man den jungen Rilke begrüßt. Die besten kritischen Stimmen beschäftigten sich mit ihr und mit diesem Werk von im ganzen nur zwei schmalen Gedichtbänden, und kamen aus dem Staunen und Rühmen nicht heraus.
„Kämpfenden Sprachgeist“ nannte Holthusen ihre kühnen Versuche, der ins Schweigen versickernden Sprache noch einmal mächtige Bilder und Gesten abzugewinnen.
Ingeborg Bachmann war eine so originäre Stimme, neben der (ausgenommen der alte Benn) alles andere leiser wurde oder gar verstummte. Hier ist nicht der Platz, auf Einzelheiten einzugehen. Es sei nur darauf verwiesen, daß es hauptsächlich ihr Tonfall war, der alle, Kritiker wie auch Leser, weithin faszinierte, ein Tonfall, so bestimmend wie imperial, der die Autorin gleich in die obersten Ränge einwies. Sie thronte immer.
Das zweite Hörspiel brachte ihr gleich den Kriegsblindenpreis und mehr essayistische Auseinandersetzungen ein, als sie Eich für sein ganzes umfangreiches Hörspielwerk jemals bekam. Daß sie seitdem keine Gedichte mehr veröffentlichte, außer einer Handvoll im Kursbuch (im Kursbuch?! Was waren das noch für Zeiten!), wurde beflüstert wie sonst nur das Schweigen eines Koeppen. Um ihren ersten Roman, Malina, zehn Jahre nach den ersten Prosaversuchen, war so viel raunende Erwartung, daß er, noch bevor die Rezensionen erschienen, auf die Bestsellerliste kletterte.
Es war nicht nur ihr Werk, es war auch ihre Person, die an dieser ihrer Aura teilhatte. Jeder, der einmal dabei war, wenn sie vorlas, wird das nicht vergessen: dieses zögernde Hinaufgehen zum Pult, so als ob sie tausend Widerstände überwinden müßte, dann das Ausbreiten des Manuskripts, das Aufsetzen der Lesebrille, das Herumwühlen in den Blättern, und dann das Absetzen der Brille, der scheue, hilflose, ja verängstigte lange Blick ins Publikum, das nochmalige verzweifelte Suchen nach der ersten Seite, das Streichen der Haare aus der Stirn, dann erneut das Aufsetzen der Brille, immer mit endlos langen Pausen, die Erwartung, Erregung, Nervosität suggerierten, da oben wie auch im Publikum. Und dann das leise, monotone, fast tonlose Vorlesen mit zahllosen Versprechern, nein, kein Vorlesen, eher das Absolvieren eines Textes, mit dem sie der Öffentlichkeit ausgesetzt war.
Ich habe mich manchmal gefragt, ob das zur Show gehörte oder tatsächlich ihr Wesen war. Später, als ich sie näher kennenlernte, war mir klar: Anfangs mag es vielleicht Show gewesen sein, aber sicher ist, daß sie später ganz in dieser Rolle gelebt hat, ja, daß sie zu ihrer Existenz geworden ist. Vielleicht war es für sie die einzige Möglichkeit, der Betriebsamkeit der Literatur auszuweichen, die sie wirklich haßte. Doch je mehr sie sich verweigerte, desto stärker wurde ihre Person davon mystifiziert. Als sie sich von ihrem Verleger überreden ließ, zum Erscheinen des Dreißigsten Jahres eine Lesereise durch Deutschland zu machen, drängten sich die Zuhörer zu ihren Vorträgen wie bei keinem anderen literarischen Autor. Die Leute konnten ihre Gedichte auswendig sagen:
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel hinunter?
Oder hatte damals, Anfang der sechziger Jahre, unsere Literatur zum letzten Mal eine wirkliche Öffentlichkeit?
Die Bachmann hatte Maßstäbe gesetzt. Für andere; aber auch für sich. Auf ebenso radikale Weise wie Celan (und doch ganz anders) zeigte sie, daß es noch Lieder zu singen gibt, ja, auch „jenseits des Menschen“. Schreiben war für sie existieren, und die Grenzen des Schreibens aufzuzeigen bedeutete für sie, die Grenzen ihrer Existenz abzustecken.
Sie hörte auf mit Gedichten. In der Prosa wagte sie sich weit hinaus. Wahrhaft in extreme Bereiche. Und so wurden ihre Erzählungen auch zu extremen, bis an die äußerste Grenze gehenden, manchmal sie übertretenden Wahrheitsfindungen. Immer ging es ihr um das Ganze, das Absolute, das Alleinige, eben um ,Alles‘, wie kurz und vieldeutig ihre wohl beste Erzählung heißt. Es ging ihr niemals um eine Figur, eine Handlung, ein Ereignis, das wird nur benutzt, um in der Sprache von geisteshellen Bildern alles über die Liebe, alles über die Wahrheit, alles über die Schuld usf. zu sagen. Bei diesem Schritt zum Ganzen hin mußte sie wohl stolpern. Doch läßt sich sagen, daß sie in ihren besten Texten den Rang einer Djuna Barnes erreichte.
Ihre Fragen und Zweifel gingen tiefer als die Fragen und Zweifel der andern, und ihr gelang etwas, was seit der Langgässer in unserer Literatur vergessen war: das Gegenwärtige mit dem Mythischen zu verbinden, alltägliche Situationen in Bereiche des Dämonischen zu steigern. Theben in jedem Haus, Dublin in jeder Kleinstadt, Gomorrha in jedem Wohnzimmer.
Ich gebe zu, das ist bereits anfechtbar. Und der Literaturbetrieb, der sie einst gehätschelt, schüttete nicht nur wohlmeinende Kritik, sondern auch Spott über sie aus. Eine neue Generation fertigte das so ab:
Märchentante! (Wondratschek in Text + Kritik).
Es gab, man sollte es nicht leugnen, in den letzten Jahren so etwas wie eine Bachmann-Dämmerung.
Ich habe ihre jüngsten Prosaarbeiten nicht mehr gelesen. Vielleicht hielten sie nicht mehr den Rang, mit dem sie angefangen hat. Nun gut. Aber sollte man das nicht sehen als das Suchen und Tasten nach neuen Ausdrucksformen für jenen großen Romanzyklus, an dem sie seit Jahren mit fanatischer Besessenheit gearbeitet hat: Todesarten? Eine deutsche ,Recherche‘ sollte es werden. Eine Suche, und das ist das Kierkegaardsche in der Bachmann, nach dem Leben, nach dem Lieben, das doch nichts anderes ist als eine Krankheit zum Tode, eine allmähliche Vereisung.
Ich aber liege allein
im Eisverhau voller Wunden.
Es hat mir der Schnee
noch nicht die Augen verbunden.
Die Toten, an mich gepreßt,
schweigen in allen Zungen.
Niemand liebt mich und hat
für mich eine Lampe geschwungen.
Sie hätte aufhören können nach den Gedichten, nach den Hörspielen. Ihr Platz in der Literaturgeschichte war ihr sicher. Früh verstummt und makellos: so wie das die Deutschen lieben. Aber sie hat sich keinen Moment von der Kritik irritieren lassen und unbeirrt weitergeschrieben. Ihr Nachlaß wird einiges zutage fördern.
Ich glaube, sie hat nicht aufgehört, uns zu beunruhigen. Ingeborg Bachmann hat, überspitzt gesagt, schon zu Lebzeiten, ja in ziemlich jungen Jahren, eine Legende erzeugt. Ohne ihr Zutun. Vielleicht braucht die Literaturgeschichte von Zeit zu Zeit ihre Legenden. Hoffen wir, daß diese Legende und dieser sinnlose Flammentod nicht ihr Werk überdecken wird. Mit ihrem Tod spüren wir schmerzlich, daß jetzt schon, viel zu früh, eine Epoche deutscher Nachkriegsdichtung zu Ende gegangen ist. Celan, Eich und jetzt die Bachmann.
Horst Bienek, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.10.1973
José F. A. Oliver über Ingeborg Bachmann
– Ingeborg Bachmann gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren, wäre jetzt also 90 Jahre alt. Sie starb jung, bereits 1973. Ihr zu Ehren wird jedes Jahr seit 1977 der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt ausgerichtet. Was ihre Besonderheit ausmacht, kann am besten ein Dichterkollegen beurteilen, José F.A. Oliver sieht im Gespräch mit der Mittelbadischen Presse das „Geheimnisvolle“ um ihre Person in ihrem Nomadendrang, und dass die Literatur ihr Zufluchtsort war. –
Jutta Hagedorn: Ingeborg Bachmann scheint etwas Geheimnisvolles zu umgeben. Liegt es auch daran, dass ihre Geschwister so restriktiv mit ihrem Nachlass verfahren?
José F.A. Oliver: Das mag einer der gemachten Gründe sein. Das „Geheimnisvolle“ an ihr ist sicherlich auch der gehetzte, nicht zur Ruhe kommende Nomadendrang ihres Wesens und damit das Haltlose ihrer Texte. Ihre Gedichte schultern diese Unruhe, mehr noch, sie sind aus einer Getriebenheit vollendet. Ingeborg Bachmann floh ständig vor sich selber. Ihr Zufluchtsort hieß „Literatur“. Sie war Aufbrechende und Gestrandete in einem und das Meer. Aber wahrscheinlich ist das allen Dichterinnen und Dichtern eigen. Manchen wird es zum Verhängnis. So wie ihr.
Hagedorn: Sie hat etwas von einer tragischen Gestalt – tragisch ganz im Sinne des griechischen Dramas. „In mir ist die Hölle“, schreibt sie in einem Brief an Paul Celan.
Oliver: Ich denke, sie meinte die „Liebeshölle“ und damit auch die „Lebenshölle“. In ihrer Liebessehnsucht, der Sehnsucht, geliebt zu werden und das ungestillte Verlangen, jemanden bedingungslos zu lieben, war ein „Ja“ und ein „Nein“ verankert. Ein Nein, das immer Ja und ein Ja, das immer ein Nein kristallisierte. Im Grunde ein Todes-Wunsch. Die Sehnsucht, den „Unerreichbaren“ zu lieben, lieben zu dürfen, lieben zu können. Vielleicht hat sie in einer Liebe, die sich zu erfüllen drohte, den vorweggenommenen Tod erlebt. Ein sich ankündigendes Schwarz. Deshalb die Unerreichbaren. Celan, beispielsweise, oder denken Sie an Hans-Werner Henze. Auch die Liebe zu Letzterem war ein Drama für sich.
Hagedorn: Aufgabe von Kunst sei, den wahrgenommenen Schmerz darzustellen, damit uns „die Augen aufgehen“.
Oliver: Ja, das vermute ich auch. Ein Gedicht muss die Sicht entschleiern. Oder dort, wo die Augengehilfen die Lüge wie Komplizen aufsuchen, die Blicke ins Konturenhafte der Wahrheit entschieden offenbaren. Die Sicht auf uns und die Sicht auf die Wirklichkeiten der Verhältnisse, die immer auch uns als soziale Wesen meinen. Sie „emigrierte“ ja regelrecht aus den Jahren im Österreich der Nachkriegszeit, die sie einschnürten und schier erstickten.
Hagedorn: „Ich existiere nur, wenn ich schreibe, ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe“ – eine traurige Feststellung oder geht das jedem Schriftsteller so?
Oliver: Das ist nicht traurig. Es ist das Gegenteil von „Traurig-Sein“ oder Trauer. Diese Haltung bedeutet Trost, der kompromisslos stärkt. Der vernarbte Rückhalt in einem selber, anders sein zu dürfen, weil man muss. Ich bin davon überzeugt, dass das Dichter-Sein eine Seins-Form ist. Ein Literaturkritiker hat mir vor Jahren einen erhellenden Satz mit auf den Weg gegeben. Er sagte:
Die Würde eines Gedichtes hängt unmittelbar mit der Würde des Dichters zusammen.
Mein Gedicht ist „Ich“. Und Ich“ ist mein Gedicht. Insofern ist das Gedicht, solange ich schreiben darf und kann, die wahrhafte Ausdrucksform meines Mutes und meiner Geduld, meiner Verzweiflung und meiner Niederlage. Damit aber auch meiner Trauer und meiner Hoffnung.
Hagedorn: 1953 wurde sie von der Gruppe 47 ausgezeichnet für die „besten deutsch-sprachigen Gedichte ihrer Generation“. Ich bin über das „ihrer Generation“ gestolpert.
Oliver: Ach, das mit dem „besten“, „wichtigsten“ und „bedeutendsten“ ist ein so furchtbares Ding… Wer will das beurteilen. Die Universalität einiger Bachmann-Gedichte vergeht nicht. Das reicht doch, oder? Und dieses „Universum Bachmann“ ist nach wie vor geheimnisvoll und magisch… „Anrufung des Großen Bären“… Welch wunderschöner Titel…
Hagedorn: Haben Ihre Gedichte heute noch die Ausstrahlungskraft von damals?
Oliver: Ja, ihre Gedichte sind und werden bleiben. Wenn Sie an die politische Dimension ihrer Gedichte denken. Auch. Sie tragen eine ungebeugte Kraft des Widerstandes in sich. Die Zeitverbindungen sind heute zwar anders verlinkt, aber die Grundmotive der Widersprüche sind von zeitloser Natur. Eine meiner Lieblingszeilen Ingeborg Bachmanns lautet:
Das Unerhörte ist alltäglich geworden
Wenn das nicht für heute gilt, was dann?
Hagedorn: Wie lesen Sie als Lyriker mit einem ganz anderen Stil ihre Gedichte?
Oliver: Ich bin, wenn ich sie lese, in Bildern und Rhythmen und in ihrem Tonfall. Ihre Bildmotive schreiben in mir weiter, indem sie in meine eigene Stimme springen. Der Rhythmus schenkt mir Nähe. Auch in manches Bild, das ich nur aus der heutigen Zeit, aus meiner Zeit greifen kann. Das heißt noch nicht, dass ich alles, was ich von ihr lese, begreife. Aber ich darf erahnen, was sie meinte, indem ich ihre Trauer in meine Verlorenheit übersetze. Eine Verlorenheit, die nicht nur mir so offensichtlich und offenhörbar ist. Mir kam die Welt noch nie so ausfransend vor wie in diesen Tagen. Wir leben in einer „gestundeten Zeit“.
Hagedorn: Was zeichnet ihre Gedichte überhaupt aus? Oder kann man das pauschal nicht sagen? Sie hat ja ihren Stil immer mal geändert, unter anderem auch gereimt.
Oliver: Ihre Gedichte schauen. Sie meditieren und orientieren. Das überträgt sich. Ihre Sprache ist dabei schier mit der Hand zu greifen. Das hat Gründe. Ich glaube, sie konnte sich keinen Reim auf die Kulissen-Welt machen, auch wenn sie sich bisweilen ins Rettende gereimt hat und deren Scheinwelten (um die Dinge) ins Wort bannte. Ihre Lyrik ist ein einziger, großer Zweifel und trunken vor Liebessehnsucht. Das macht ihr lyrisches Werk so spürbar. Das Liebesgedicht ist immer Verlust. Mit Doppelpunkt.
Mittelbadische Presse, 21.6.2016
Ekkehart Rudolph im Gespräch mit Ingeborg Bachmann im Jahr 1971.
Bachmann Loops von Tim van Jul
Stimmen zu Ingeborg Bachmann
Hermann Burger: Abend mit Ingeborg Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Peter K. Wehrli: Unverbunden in Zürich
DU, Heft 9, 1994
Uwe Johnson: Good Morning, Mrs. Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Inge Feltrinelli, Fleur Jaeggy, Toni Kienlechner, Christine Koschel, Inge von Weidenbaum: Römische Begegnungen
DU, Heft 9, 1994
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Heinz Bachmann: „Die Ärzte wollten dringend wissen, ob es irgendwelche Medikamente gab“
Die Welt, 5.9.2023
Ria Endres: Es kommen härtere Tage
textor.online, 25.7.2024
Ria Endres: Die härteren Tage
textor.online, 21.8.2024
Ria Endres: Auf Widerruf (III)
textor.online, 27.8.2024
Ingeborg Bachmann erhält den Georg-Büchner-Preis 1964. Dankesrede und kurzer Fernsehbericht über sie inklusive Interview. Außerdem Rezitation des Gedichts „Die große Fracht“.
TOTER HUND
nach Ingeborg Bachmann
Drüben versinkt die Sonne im Sand der Alleen,
nirgend gewährt man, wie hier, vor den ersten Bissen
die letzten. Blaues Auge nun, blaue Zunge, wenig cantabile.
Hob das Bein am Römerstein, trunkenes Limesgefühl.
Verwarf ihn der Wind, löschte Lupinen aus, trieb ihn zurück
in die Marsch. Überrundete Zeit verdunkelt am Horizont.
Zieh den Fisch aus dem Netz, überwinde den Sprung,
wenn hinter dir die Meute stürzt und schreit.
Unter und neben den schwarzen Steinen Schatten Rosen Schatten.
Schöner als der beachtliche Hund sind die Weißdornaugen
deines Bruders, der kommt mit härteren Tagen.
Manfred Bieler
NACH DEM TOD VON INGEBORG BACHMANN
Nach-
rufen
dir
Große Bärin:
auf Umlauf
über Manhattan
dem Toten Wien
Oder Roma
die sich die Sonne
ins Haar kämmt
Aus Augen
auf uns:
so tief blickt
kein Pelztier
Nur die sich
ergeht
Undine
in Flammen
Und steigt
wie Vorwurf
steigt über
sie alle
Läßt rastlos
ratlos
zurück
die reißenden
Wölfe
Edwin Wolfram Dahl
Zum 10. Todestag der Autorin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Autorin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Autorin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + Forum + IMDb +
ÖM + KLG + Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK +
IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口


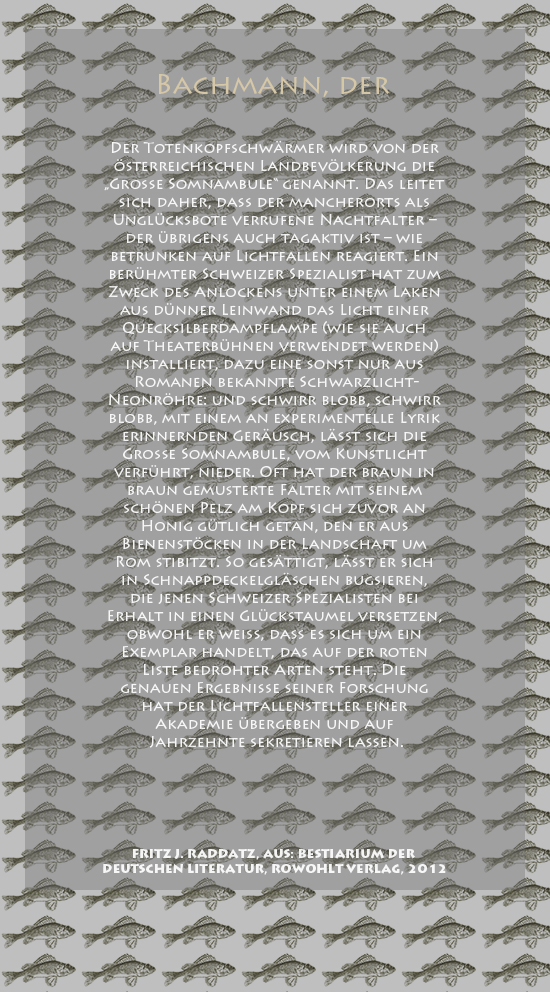












Schreibe einen Kommentar