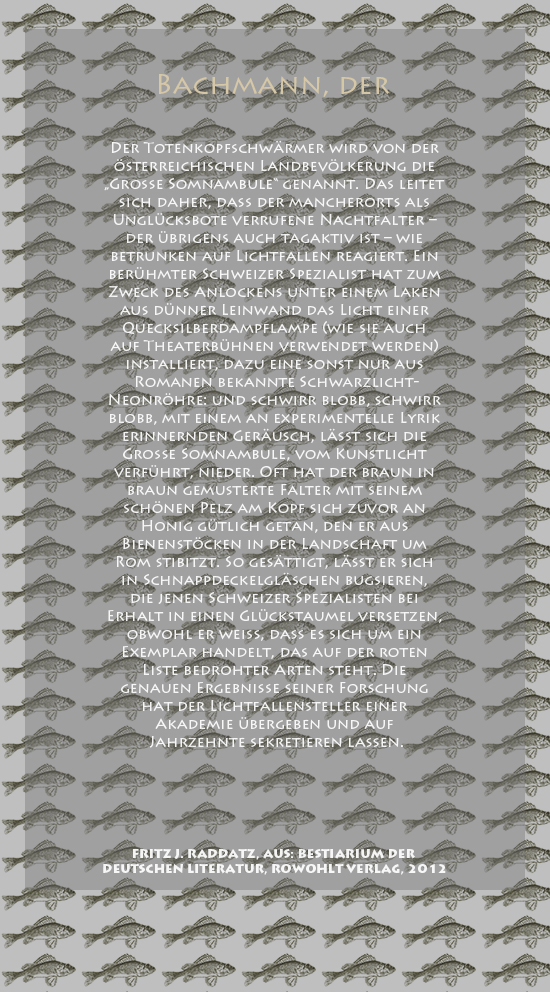Ingeborg Bachmann: Ingeborg Bachmann liest Gedichte 1948–1957 (CD)
Bachmann hören
– Lesungen von Ingeborg Bachman auf CD.
Zart und kränklich ist sie. Ihre Mitschülerinnen nennen sie „Elfchen“. Ungewöhnlich belesen und wissensdurstig zeigt sie sich im Unterricht. Was ihr den Spitznamen „Le‚ hibou“, die Eule, einträgt. Bereits während des Studiums veröffentlicht sie erste literarische Arbeiten in Zeitungen. Zur Wiener Kulturszene knüpft sie überraschend zielstrebig und entschlossen Kontakte. Unter anderem zum Hörfunk, wo sie Hans Werner Richter nach der zufälligen Lektüre einiger ihrer Gedichte spontan zur Tagung der Gruppe 47 einlädt. Ingeborg Bachmann. –
Mit ihrer ersten Lesung im Mai 1952 hinterlässt die 26-Jährige laut Richter „den stärksten Eindruck“.
Sie liest sehr leise, fast flüsternd. Einige sagten nachher: „Sie weinte ihre Gedichte“. Alle müssen näher rücken, um überhaupt ein Wort zu verstehen. Ingeborg Bachmann wird immer leiser, dann verstummt sie ganz.
Man bringt sie in ihr Zimmer, wo sie in Ohnmacht fällt. Mit ihrem angespannt-nervösen Debüt hat Ingeborg Bachmann auf Anhieb Erfolg bei den Kritikern. Schon wenige Tage später liest sie im Nordwestdeutschen Rundfunk. Mit einer brüchigen Stimme, in der ihre „Aufregung am Ersticken“, so Ingeborg Bachmanns eigene Worte, noch nachzuhallen scheint; unter anderen ihr Gedicht „Die Welt ist weit“.
DIE WELT IST WEIT
Die Welt ist weit und die Wege von Land zu Land,
und der Orte sind viele, ich habe alle gekannt,
ich habe von allen Türmen Städte gesehen,
die Menschen, die kommen werden und die schon gehen.
Weit waren die Felder von Sonne und Schnee,
zwischen Schienen und Straßen, zwischen Berg und See.
Und der Mund der Welt war weit und voll Stimmen an meinem Ohr
und schrieb, noch des Nachts, die Gesänge der Vielfalt vor.
Den Wein aus fünf Bechern trank ich in einem Zuge aus,
mein nasses Haar trocknen vier Winde in ihrem wechselnden Haus.
Die Fahrt ist zu Ende,
doch ich bin mit nichts zu Ende gekommen,
jeder Ort hat ein Stück von meinem Lieben genommen,
jedes Licht hat mir ein Aug verbrannt,
in jedem Schatten zerriß mein Gewand.
Die Fahrt ist zu Ende.
Noch bin ich mit jeder Ferne verkettet,
doch kein Vogel hat mich über die Grenzen gerettet,
kein Wasser, das in die Mündung zieht,
treibt mein Gesicht, das nach unten sieht,
treibt meinen Schlaf, der nicht wandern will…
Ich weiß die Welt näher und still.
Hinter der Welt wird ein Baum stehen
Mit Blättern aus Wolken und einer Krone aus Blau.
In seine Rinde aus rotem Sonnenband
Schneidet der Wind unser Herz
und kühlt es mit Tau.
Hinter der Welt wird ein Baum stehen,
eine Frucht in den Wipfeln,
mit einer Schale aus Gold,
Laß uns hinübersehen,
wenn sie im Herbst der Zeit
in Gottes Hände rollt!
Schüchtern und zögernd liest sie. Fast kontrapunktisch zur großen Bewegtheit der Gedichte befremdlich tonlos und monoton. Emotionen werden nur hörbar, wo die Stimme so fragil wird, das sie ihr zu versagen droht. Diese Vortragsweise festigt den Eindruck ihrer, so Hans Werner Henze, „elfenhafte[n]“ Erscheinung (…), von der eine Aura von Empfindsamkeit ausging, (…) ein Mensch (…), wie von der Nachtigall geboren.“ Ursache für den durchschlagenden Erfolg der jungen Bachmann ist aber nicht allein ihr auffälliges Auftreten. Nach Trümmer- und Kahlschlagliteratur stimmen ihre Gedichte eine neue Art lyrischen Urton an. Ihre mythischen Bildwelten und reich tönenden Klangmelodien treffen die Mentalität einer Nachkriegszeit und das Bedürfnis, von der jüngsten Vergangenheit loszukommen. Doch ihre von Todesverfallenheit und Schicksalhaftigkeit sprechenden existenziellen Verse knüpfen zwar an den Vorrat poetischer Tradition an, sind aber nur auf den ersten Blick romantisch zeitenthoben. In ihnen finden sich illusionslose zeitgeschichtliche Einsichten wie diese:
Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden.
Vielleicht erklärt das den befremdlichen Kontrast ihrer zurückgenommenen Sprechweise zur vermeintlich mythisch-überhöhten Poesie. Mit der flachen Dynamik, dem fehlenden Ausmessen der Sprechhöhen und -tiefen und der zurückhaltenden Betonung sprachlicher Gesten und Formen vermeidet sie alles Deklamatorische. Es scheint, als ob die Autorin beim Sprechen jedes Pathos zurücknähme. Sie schafft damit Distanz, erzwingt die genaue Rezeption und Reflexion der Texte und verhindert damit den unreflektierten Genuss ihrer Bildwelten voll poetischem Zauber.
Ist das schüchterne Sprechen also bewusst gewählt? Wie das hilflose und weltfremde Auftreten, das manche Zeitgenossen gleichfalls als Allüre und Attitüde deuten? Ihre steile literarische Karriere steht jedenfalls im auffälligen Kontrast zur scheinbaren Unbeholfenheit der Person. Ein Jahr nach ihrem Debüt erhält Bachmann den Preis der Gruppe 47 für Gedichte aus ihrer ersten Buchveröffentlichung, Die gestundete Zeit. Eins mit dem Titel „Fall ab, Herz“:
FALL AB, HERZ
Fall ab, Herz, vom Baum der Zeit,
fallet, ihr Blätter, aus den erkalteten Ästen,
die einst die Sonne umarmt’,
fallet, wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug!
Fliegt noch die Locke tagelang im Wind
um des Landgotts gebräunte Stirn,
unter dem Hemd preßt die Faust
sich schon um die klaffende Wunde.
Drum sei hart, wenn der zarte Rücken der Wolken
Sich noch einmal dir beugt,
sei hart, wenn der Hymettos die Waben
noch einmal dir füllt.
Denn wenig gilt dem Landmann ein Halm in der Dürre,
und wenig ein Sommer vor unserem großen Geschlecht.
Und was bezeugt schon dein Herz?
Zwischen gestern und morgen schwingt es,
lautlos und fremd,
und was es schlägt,
ist schon sein Fall aus der Zeit.
In dieser Sprechfassung ist die charakteristische Zartheit und Brüchigkeit der Stimme zwar weniger dominant. Dennoch fällt das in Tonhöhe und Betonung eigentümlich undifferenzierte Sprechen auf. Es bewegt sich zwischen Singsang, Litanei und vor sich hin sprechen. Die variationsarm vorgetragenen Verse werden gleichsam in der Schwebe gehalten. Jede hörbare innere Beteiligung beim Sprechen wird, wie es scheint, mit angestrengter Disziplin und beinahe erzwungener Nüchternheit zurückgehalten. Bachmanns Stimme klingt klar und eng und erzeugt den Höreindruck einer zurückgenommenen Resolutheit und Präzision, die wiederum so gar nicht zu dem Bild der verängstigten, hilflosen jungen Schriftstellerin passen will.
Einer Autorin, die sich längst endgültig im Kreis literarischer Prominenz etabliert hat. Im August 1954 erscheint ihr Porträt auf dem Cover des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Spätestens jetzt wird Ingeborg Bachmann zum Mythos. Sie lebt seit einiger Zeit als freie Schriftstellerin in Italien und steht dort in fruchtbarem Dialog mit dem Komponisten Hans Werner Henze, für den sie Libretti schreibt. Musik und Sprache sind für Bachmanns Poetologie von großer Bedeutung. Das Phänomen der Stimme nimmt dabei einen zentralen Platz ein. Nicht die professionelle Kunststimme, sondern gerade das Unvollkommene des Organs enthält für sie den „Vorzug des Lebendigen“. Denn, so die Autorin, „die Eigentümlichkeit dieser Stimme, die so und so beschaffen ist, wird kein Fortschritt aus der Welt schaffen“, diese „Stimme eines gefesselten Geschöpf, das nicht ganz zu sagen fähig ist, was es leidet, nicht ganz zu singen, was es an Höhen und Tiefen auszumessen gibt“. Eine musikalische Konzeption von Poesie, die sich in ihren Gedichten spiegelt. 1956 erscheint Bachmanns zweiter Gedichtband: Anrufung des Großen Bären. Ein Gedicht daraus: „Tage in Weiß“:
TAGE IN WEISS
In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken
Und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn
Vor einem Spiegel aus Eis.
Mit meinem Atem vermengt,
flockt die Milch.
So früh schäumt sie leicht
Und wo ich die Scheibe behauch,
erscheint, von einem kindlichen Finger gemalt,
wieder dein Name: Unschuld!
Nach so langer Zeit,
In diesen Tagen schmerzt mich nicht,
daß ich vergessen kann
und mich erinnern muß.
Ich liebe. Bis zur Weißglut
Lieb ich und danke mit englischen Grüßen.
Ich hab sie im Fluge erlernt.
In diesen Tagen denk ich des Albatros’,
mit dem ich auf-
und herüberschwang
in ein unbeschriebenes Land.
Am Horizont ahne ich,
glanzvoll im Untergang,
meinen fabelhaften Kontinent
dort drüben, der mich entließ
im Totenhemd.
Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang!
Mit dem zweiten Gedichtband hatte sich Bachmanns literarischer Ruhm gefestigt. Und auch persönlich öffnen sich Perspektiven: Im Sommer 1958 begegnet Ingeborg Bachmann Max Frisch. Der Beginn einer sechs Jahre dauernden schwierigen Beziehung. 1959 erhält sie für Der gute Gott von Manhattan den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und im Wintersemester 1959/60 liest sie als erste Dozentin des neueingerichteten Lehrstuhls im Rahmen der Frankfurter Poetik-Vorlesungen über Probleme zeitgenössischer Dichtung. Die Resonanz auf ihren exzentrischen Auftritt ist gespalten. Sie habe, so die Presse, „wortlos und bleich“ mit einer „modernen, dickrandigen Brille“ hinter dem Pult gestanden, wo sie sich durch „Brille, Haarsträhnen, Taschentuch und Manuskripttasche“ gegen ihre Umgebung abschirmte, um dann leise und „in fast gleicher Stimmlage“ zu sprechen. Von einer tiefen Skepsis gegenüber absoluten Wahrheiten getragen, vermeidet die etablierte Schriftstellerin bewusst jedes selbstsichere Sprechen. „Beiseite sprechen“ nennt sie es selbst einmal. Der programmatische Titel der ersten Vorlesung: „Fragen und Scheinfragen“. Selbst in der akademischen Veranstaltung einer Vorlesung, hört man Bachmanns unverwechselbare Stimme „kühn und klagend“, wie sie Christa Wolf beschrieben hat. Die Unsicherheit ihrer Stimme spiegelt dabei die Gefährdung eines Ich, dem die Sprache fragwürdig geworden ist und das sich der Welt entfremdet hat. Der Grundgedanke ihres poetologischen Denkens:
Der Fragwürdigkeit der dichterischen Existenz steht nun zum ersten Mal eine Unsicherheit der gesamten Verhältnisse gegenüber. Die Realitäten von Raum und Zeit sind aufgelöst, die Wirklichkeit harrt ständig einer neuen Definition, weil die Wissenschaft sie gänzlich verformelt hat. Das Vertrauensverhältnis zwischen Ich und Sprache und Ding ist schwer erschüttert.
Die für Bachmanns Poetologie zentrale Sprachproblematik ist eng verknüpft mit der Erschütterung des Vertrauensverhältnisses zwischen Subjekt, Objekt und Sprache. Dagegen setzt die Autorin die menschliche Stimme. Bachmann sieht in ihr das mögliche Gegenstück zum Sprachterror der missbrauchenden Zeit. Ihre Vision: die menschliche Stimme als Teilhabe an der Wahrheit, Universalität und Unschuld, als Retterin in der verurteilten Zeit. Ihre Hoffnung: Weil die Stimme immer weiter sprechen muss, wird auch das Ich überleben. In ihrer dritten Vorlesung „Das schreibende Ich“ zeigt Bachmann, wie auch das sich auflösende Roman-Ich „Mahood“ in Becketts letztem Roman Der Namenlose letztlich nicht vollständig verschwinden kann, solange es spricht:
[Mahoods letzte Worte sind.] … „ich werde also weitermachen, man muß Worte sagen, solange es welche gibt, man muss sie sagen, bis sie mich finden, bis sie mir sagen, seltsame Mühe, seltsame Sünde, man muß weitermachen, es ist vielleicht schon geschehen, sie haben es mir vielleicht schon gesagt, sie haben mich vielleicht bis an die Schwelle meiner Geschichte getragen, vor die Tür, die sich zu meiner Geschichte öffnet, es würde mich wundern, wenn sie sich öffnete, es wird ich sein, es wird das Schweigen sein, da wo ich bin, ich weiß nicht, ich werde es nie wissen, im Schweigen weiß man nicht, man muß weitermachen, ich werde weitermachen.“
Letztlich baut Bachmanns Leitgedanke der „Literatur als Utopie“ auf den Platzhalter der menschlichen Stimme:
Aber wird von der Dichtung nicht, trotz seiner unbestimmbaren Größe, seiner unbestimmbaren Lage immer wieder das Ich hervorgebracht werden, einer neuen Lage entsprechend, mit einem Halt an einem neuen Wort? Denn es gibt keine letzte Verlautbarung. Es ist das Wunder des Ich, daß es, wo immer es spricht, lebt; es kann nicht sterben – ob es geschlagen ist oder im Zweifel, ohne Glaubwürdigkeit und verstümmelt – dieses Ich ohne Gewähr! Und wenn keiner ihm glaubt, und wenn es sich selbst nicht glaubt, man muß ihm glauben, es muß sich glauben, sowie es einsetzt, sowie es zu Wort kommt, sich löst aus dem uniformen Chor, aus der schweigenden Versammlung, wer es auch sei, was es auch sei. Und es wird seinen Triumph haben, heute wie eh und je – als Platzhalter der menschlichen Stimme.
Nicht nur in den Frankfurter Vorlesungen fällt auf: Bachmann spricht Prosa wie Lyrik und liest ihre Gedichte wie Prosa. Deshalb ist es, entgegen der öffentlichen Reaktion, tatsächlich kein so einschneidender Bruch im literarischen Werk, als Ingeborg Bachmann 1961 mit Erscheinen ihres Erzählbandes Das dreißigste Jahr entscheidet, keine Gedichte mehr zu publizieren. Von Beginn an haben sich bei ihr verschiedene literarische Genres überlagert: Gedichte, Hörspiele, Libretti und Erzählungen stehen neben philosophischen und literaturkritischen Texten. Die lyrische Struktur und musikalische Komposition ihrer Prosa verwundert daher genauso wenig wie die Entscheidung, sich nun auf eine Gattung zu konzentrieren.
Eine Entscheidung, an die sie sich gehalten hat. Bis auf eine Ausnahme. Anlässlich einer Pragreise im Januar 1964 in einer der dunkelsten Zeit ihres Lebens entstehen eine Handvoll Gedichte. Darunter „Böhmen liegt am Meer“, dem Bachmann den Status eines „letzten Gedichts“ zuschreibt. Aber die Autorin nimmt die eigene Autorschaft gleichsam zurück, indem sie sagt, „wenn ich könnte, würde ich meinen Namen wegnehmen und darunter schreiben ‚Dichter unbekannt‘. Es ist für alle und es ist geschrieben von jemand, der nicht existiert.“ In seinem Roman Auslöschung wird es von Thomas Bernhard als das schönste Gedicht deutscher Sprache gerühmt. Bachmann selbst erschien es wie ein „Geschenk“, das sie „nur weiterzugeben“ habe „an alle anderen, die nicht aufgeben zu hoffen auf das Land ihrer Verheißung.“
BÖHMEN LIEGT AM MEER
Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus.
Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund.
Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern.
Bin ich’s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
Grenzt hier ein Wort an mich, so laß ich’s grenzen.
Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder.
Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.
Bin ich’s, so ist’s ein jeder, der ist soviel wie ich.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehen.
Zugrund – das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.
Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren
Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe
unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser,
und Venezianer alle. Spielt die Komödien, die lachen machen
Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
doch hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.
Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags
Zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.
Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr,
ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält,
begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.
Elementar klingt hier das utopische „und trotzdem“, das für die Bewegung ihres ganzen literarischen Werks bezeichnend ist. „Böhmen liegt am Meer“ ist, so Bachmann, „gerichtet an alle Menschen, weil es das Land ihrer Hoffnung ist, das sie nicht erreichen werden. (…) Deswegen hört für mich dort auch alles auf. Es ist deswegen auch das letzte Gedicht was ich geschrieben habe. Ich würde nie wieder eines schreiben, weil damit alles gesagt ist.“ Das Gedicht „Böhmen liegt am Meer“ ist der Kontrapunkt , Symbol für die „Literatur als Utopie“, so der Titel ihrer letzten Frankfurter Vorlesung. Es wird tatsächlich ihr letztes Gedicht bleiben.
Michaela Schmitz, Deutschlandfunk, 25.6.2006
Kein Heimweh
– Rede über Ingeborg Bachmann. Gehalten im Musil-Haus, Klagenfurt, am 19. Juni 2004. –
1 Man zitiert, und dann hat man den Satz selbst geschrieben.
Marina Zwetajewa schreibt an Anna Achmatova:
Ich schätze nichts und hebe nichts auf, doch Ihre Bücher nehme ich mit ins Grab – unters Kopfkissen!
Damit ich einem Schriftsteller seine Welt abnehme (im zweifachen Sinn, er übergibt sie mir durch die Sprache), muss er mich mit den Details seiner Sprache überfallen. Mich interessieren keine großen Entwürfe, wenn sie nicht durch die Sätze gedeckt sind. Mich interessieren in der Literatur nicht die großen Bedrohungen, wenn sie nicht spürbar werden in den Beziehungen der Wörter zueinander, die eng und unausweichlich sein müssen, so dass es den Atem zurückhält. Das unbewusste Ausatmen nimmt den Charakter eines verstohlenen Ausatmens an, als hätte ich Angst, das Gelesene könnte damit entfliehen. Und ich hole es mit einem tiefen Atemzug wieder zurück.
Wenn ich die Verführung begriffen habe, flüstere ich eine Zeile, ein paar Zeilen, eine Strophe, zuerst im Geist, bilde es dann mit Lippen und Zunge stumm nach, will es außerhalb meines Kopfes hören, es langsam hinausstellen, um zu prüfen, ob es wirklich so kräftig und traurig, so zart und ehrlich ist, wie mein hochgestimmter Kopf es mich glauben machen will. Ich habe es vom Mund des Dichters, der das geschrieben und sich aus dem Gedicht schon zurückgezogen hat, heruntergeholt.
Ich verfalle einem Gedicht, entdecke einen Dichter, und dann will ich nur noch seine (oder ihre) Sprache haben. Niemand anderer könnte etwas so ausdrücken wie dieser, ich bekäme schreckliches Heimweh, wenn ich zu einem anderen Autor gebracht würde. Vor ein paar Wochen las ich in England in dem neuen Band von John F. Deane.
Today I will lie down in sand, and if tomorrow
you come in search of me, I am no more.
„Heute werde ich mich in den Sand legen, und wenn du
mich morgen suchen kommst, bin ich nicht mehr.“ (m. Ü.)
Was passiert dabei mit dem Eigenen, das man noch schreiben will? Es verändert sich, ich will zu dem anderen Autor werden. Manchmal schäme ich mich dieser Bereitschaft zum Chamäleonhaften. Der andere ist imstande, mich binnen kürzester Zeit auszulöschen, weil er seine so viel stärkeren Wörter über meine legt. Immer wollte ich gleich danach so schreiben wie Harold Brodkey oder wie Musil oder wie Herta Müller. Oder wie ich, wenn ich mir ein Stück Text vorlas, das ich vor ewig langer Zeit, vor Wochen, geschrieben hatte und das immer noch Gültigkeit hatte. Um Zitieren geht es dabei nicht. Auch nicht um das „Retten“ eines Ausdrucks oder Satzes im Sinne von Ingeborg Bachmann:
… wenn mir etwas sehr gefällt, wenn ich meine, es müsse ,gerettet‘ werden, dann verwende oder variiere ich einen Ausdruck, gebe ihm einen neuen Stellenwert.
2 Füchsinnen
Max Frisch zitiert in Montauk aus seinem ersten Brief an „die junge Dichterin“, deren Hörspiel ihn begeistert hatte:
… wie gut es sei, wie wichtig, daß die andere Seite, die Frau, sich ausdrückt. Sie hörte Lob genug und großes Lob, das wußte ich, trotzdem drängte es mich zu dem Brief. Ich wollte sagen: Wir brauchen die Darstellung des Mannes durch die Frau, die Selbstdarstellung der Frau.
Diese Freigabe des Materials, diese patronisierende Lizenz, dieses zu einem Flaubert, einem Ibsen von innen Legitimierende hätte mir auch 1975 oder 76 schon, als ich Montauk las und selbst noch nicht schrieb, absurd vorkommen können, aber die Sätze kehrten wieder und waren einer der Anstöße für meine Erzählung Brandstetters Reise von 1985.
Mich reizte die Innensicht eines Mannes, der auf Grund von plötzlichen Geistesabsenzen zutiefst verunsichert wird, eine Frau kennenlernt und das Verlangen spürt, sein Innerstes einem anderen zur Deutung anzubieten. Ich wollte – wie in dem Meisten, was ich geschrieben habe – zeigen, dass Menschen durch eine außergewöhnliche Begegnung verändert werden können. Vor allem Männer. Ich hatte Mitleid, ich wollte die männliche Hauptfigur nicht desavouieren. Als Motto vor diese Erzählung stellte ich einen Satz aus „Undine geht“:
Wenn dir nichts mehr einfiel zu deinem Leben, dann hast du ganz wahr geredet, aber auch nur dann.
Ich denke, dass dies der einzige Satz von Ingeborg Bachmann war, den ich längere Zeit in mir herumtrug und aus dem ich etwas machen wollte. Zu dem Zeitpunkt, da ich Mitte der neunziger Jahre in den Frauenfiguren von Touché und Unsichtbare Frauen die Hingabe bis zur Selbstaufgabe als Wesenszug der weiblichen Liebe beschrieb, hatte ich Malina bereits mehrere Male nicht gelesen, d.h. die Lektüre nach kürzester Zeit abgebrochen. Mich störten die Konstruktion und das für mich leblos bleibende Ich.
Trotzdem könnte man einzelne Stellen aus Erzählung „Rilkes Lieblingsgedicht in Malina“ transplantieren, und vermutlich würde der Korpus sie nicht abstoßen, etwa jene über den täglichen Telefonanruf abwesenden Geliebten:
Und was hast du heute gemacht? – Er stellte ihr die Frage fast jedesmal. An schlechten Tagen musste sie sich zusammennehmen. Ihre Stimme durfte nichts verraten von der Sinnlosigkeit, die ihren Tätigkeiten hier, wo er sie nicht sehen konnte, allen Glanz entzog.
Gewiss hätte ich umgekehrt in einem Interview wie Bachmann über das Kleinmütige und Schmähliche Liebe mancher Männer sagen können:
Für mich stellt nicht die Frage nach der Rolle der Frau, sondern nach Phänomen der Liebe – wie geliebt wird. Diese Frau [(in Malina)] liebt so außerordentlich, daß dem auf der anderen Seite nichts entsprechen kann. Für ihn ist sie eine Episode in seinem Leben, für sie ist er der Transformator, der die Welt verändert, die Welt schön macht.
Noch ein Gedicht wie „Fischblut“ (aus meinem 1999 erschienenen Band Das Talent meiner Frau) scheint Ingeborg Bachmanns Hauptvorwurf an die Männer – sie seien Mörder, unfähig zur Hingabe, sie wüssten nicht zu lieben – bis in die Verletzung durch die Ausbeutung der Person im Gantenbein-Roman nachzugestalten:
Alle Flüsse hinauf wäre ich ihm
gefolgt wie es im Märchen heißt so
zog er mich in seinen Strom immer
genau die fünf Töne voraus die ich
mir in den Kopf gesetzt hatte und
kaum lag ich auf seinem nassen Brett
sagte eine Stimme wenn die Sonne
in den Räucherofen fällt glitzern
die Brassen wie Barren Golds
Verstreute Indizien, die einen Umgang beweisen, Affinitäten der Bildsprache – „Im Winter ist meine Geliebte / unter den Tieren des Waldes. / Daß ich vor Morgen zurückmuß, / weiß die Füchsin und lacht.“ („Nebelland“). Geschrieben aus der Sicht eines Mannes, wie die folgenden Zeilen:
Wie sollte ich wissen daß sie
als Füchsin über das Buch eines
Fremden schritt Nase hochgereckt in
den Dezembersturm.
(Beginn meines Gedichts „Das Talent meiner Frau“). Aber ihre Lyrik hatte ich nur sporadisch gelesen, mehr aus Pflicht, und nie mit Begeisterung.
Ein anderer Ansatzpunkt wäre die Einbeziehung der Sprachskepsis in die Auffassung von Liebe, die Erkenntnis, dass Liebe, sofern sie als Sprache zu kommunizieren versucht, den Unsicherheitsregeln der Sprache unterworfen ist. Die Liebesgedichte, die poetologische Gedichte sind:
Ich hol mir jedes Wort ganz tief
so sicher daß es keiner vorher
sah du kennst auch dies wirfst
zärtlich es zurück ziehst deine
Kreise mir im See ach du – es
täuscht uns wie das Ungesagte
ruhig nach außen sich verliert.
Das Gedicht ist Verlockung („Eine Handvoll Wörter immer nur mit / denen ich dich hungrighalten will / mein Raubtier Pranken größer als / mein Herz“) und bekommt Materialität – die imaginäre Materialität von Sprache und Liebe zugleich. Je weiter ich mich dabei in die Beschreibungen von Körperlichkeit begebe, desto mehr entferne ich mich von der Bachmann, wenn ich jemals bei ihr war. Das besessene Lesenwollen des Geliebten darzustellen, die Sehnsucht, nicht nur zu wissen, was er denkt und fühlt, sondern die Sprache seines Körpers mit dem eigenen Körper zu fühlen, führt bei mir zu einem völlig anderen Dialog, zu einem versöhnlicheren Mißverstehen als bei der Bachmann.
Ich zitiere zwei Stellen aus der Erzählung „Rilkes Lieblingsgedicht“, die klären sollen, wieso ich mich mit der Bachmann nach Erwachen aus der Narkose nicht vertragen würde, wieso wir unverträglich wären: Gudrun, meine weibliche Hauptfigur, liegt mit ihrem Geliebten in einem Hotelzimmer im Bett:
Sie setzte sich auf und bettete ihn richtig hin, dann begann sie mit weichen, irgendeinen Genuß tagträumenden Bewegungen ihrer Lippen nach seinem Glied zu schnappen – rund, fischmäulig, stumm. Ihre Lippen wölbten sich über die Zähne, sie wurde zu einem zahnlosen Wesen, das über ihn bestimmen konnte, über sein Glied in ihrem Mund. Es gab Morsezeichen an ihre Zunge weiter, die sie auf der Stelle zu dechiffrieren suchte – eine süße, nichts außer seine Existenz bezeugende Botschaft. Ihre Zunge umkreiste ihn, mit der Zeit, gegen die Zeit.
Der Körper erfüllt hier auch die Aufgabe einer sprachskeptischen Instanz. Der Liebesakt ist von einem Übersetzenwollen gekennzeichnet:
Er redete mit ihr in seiner tiefen Sprache. Er sprengte sie sanft, er holte ihre Aufmerksamkeit zurück. Er legte sein Gewicht in jede Silbe, die sie dachte, bis alles von ihm erfüllt war. Ihr Kopf lag zur Seite, dann zur anderen Seite, als müßte sie die richtige Stelle suchen, wo ihre Wange ruhighalten konnte, nicht dauernd das Laken liebkoste in nervösen Zügen.
3 Nachwelten
Für mich blieb Ingeborg Bachmann bis Anfang dieses Jahres die offenbar Unumgängliche, an der meine Wege mehr oder weniger vorbeigeführt hatten. Über die ich nicht schreiben oder reden wollte, weil ich mich angesichts meiner unzureichenden Lektüre nicht zuständig fühlte. Spätestens nach Veröffentlichung des Todesarten-Projekts gehörte sie außerdem so Vielen, die sie wütend verteidigten, dass mir die Zugänge versperrt schienen. Wenn ich mich doch einmal näherte, hatte ich das Gefühl, zu einem seit langem andauernden Fest dazuzustoßen, der Gast, dem immer die Details fehlen würden. Ich konnte nicht so tun, als sei ich intim mit ihr.
Dem entsprechend weigerte ich mich, an Diskussionen teilzunehmen, zu denen ich mich nicht im mindesten berechtigt fühlte. Sie war übererklärt, die Sekundärliteratur unübersehbar und unüberschaubar. Alle Argumente hatte schon jemand anderer vorgetragen, mit besserem Wissen. Ich könnte letzten Endes nur gegen dieses bessere Wissen, das nicht meines ist, über sie reden.
Bei Einwänden gegen sie begäbe man sich schnell in ungewollte Nachbarschaften. Was man vorbringen könnte, wäre schon analysiert und als Unfairness oder weibliches Konkurrenzgefühl entlarvt. Die Auseinandersetzung um ihr Werk und ihre Person kam mir immer emotionalisierter vor als bei anderen Autoren. Und wenn ich ihre eigene Stimme hörte im Strom der mythenseligen Deutungen, im Verhaften ihrer Worte an Plätzen, an denen sie vielleicht niemals waren, im weißen Rauschen einer feministischen Literaturwissenschaft, die mitunter nur noch über sich selbst zu schreiben scheint – dann mochte ich diese Stimme nicht.
„… bis zuletzt fast unfähig, einen Ansatzpunkt zu finden für diesen Versuch, der mir nicht geheuer ist“, schreibt Ingeborg Bachmann zu Beginn ihrer Frankfurter Vorlesungen, die unter dem Titel „Fragen der zeitgenössischen Dichtung“ stehen. Daraus spricht Vorsicht? Gespielte Vorsicht? Eine Inszenierung der Verunsicherung? Die gelben Zettelchen, die ich während der letzten sechs Monate in die Bücher klebte, die ablösbaren Pflaster über Stellen, die mir nicht geheuer schienen, wurden immer mehr.
4 „Anrufung des großen Bären“
Dass die Bachmann auch heute noch bei den Apologeten einer sogenannten experimentellen Literatur nicht gut wegkommt, verwundert nicht, hatte man sich doch schon 1958 die Hetz gemacht, in einer Veranstaltung des Literarischen Cabarets in einer Art polemischem Happening dem Publikum ein Bachmanngedicht Zeile für Zeile zum Fraß und zum Gelächter vorzuwerfen. „ich bemühte mich sehr,“ schreibt Oswald Wiener, „dieses schöne und moderne gedicht der großen österreicherin bachmann dem publikum zu vermitteln.“
Gedichte können, viel mehr noch als Prosa, durch das Vorlesen mit einer feindlichen Stimme sofort zerstört werden. Sie sind völlig hilflos, auch die besten. Jedes Wort, jede Zeile, durch den Tonfall in Anführungszeichen gesetzt, wird bloßgestellt. Es war und bleibt ein höchst problematisches Umgehen mit einem Text, der einem lächerlich vorkam und dessen unverdient erscheinender Erfolg einen aggressiv machen konnte. Wenn ein Publikum bei einer solchen Parade lacht, beweist das allerdings nichts über literarischen Geschmack und Urteilsfähigkeit.
Welche Verdienste hat dieses Gedicht? Ist es tatsächlich ein ernstzunehmender „Dialog mit der Macht“, eine große apokalyptische Vision, eine „originäre Mythenstiftung“? Oder findet letztere erst in der Germanistik statt, die dieses Gedicht zu einer Wendemarke stilisiert, einen Kraftakt darin erkennen will und sich doch nur ein langweiliges Märchen erzählen lässt? Zu folgsam ist der Text einer Allegorie des Schreckens verpflichtet, die nichts Erschreckendes an sich hat. Der zottelige Bär mit den Tatzen, die töten, ist eine Märchenfigur und verbreitet den Schrecken eines Kinderkostümballs. Die Erwiderung des Bären an die Hirten hat etwas Mundfaules, Verpisstes, Stotterhaftes, das dem Schrecken die Zähne zieht, die angeblich (scharf und halbentblößt) vom Himmel herunterdrohen. Die Szene selbst ist lächerlich, unangemessen dem, was sie meinen will.
Aber auch dort, wo der Schrecken in einem Gedicht stattfinden sollte, in der Sprache – ist nichts. Die einzige Zeile, die mich überzeugt, ist die erste – „Großer Bär, komm herab, zottige Nacht“ – weil sie im Rhythmus den Bären herunterholt, oder die Sterne herunterpflückt, die ihn ausmachen. Danach – nichts mehr. Von der schlichten Unverwendbarkeit eines Wortes wie „Zapfen“, das die Welt darstellen soll mit den Menschenleben als Schuppen dran, bis zur Ungenauigkeit eines „dass“ statt „damit“ (gebt dem blinden Mann ein gutes Wort / dass er den Bären an der Leine hält), von den störenden Adjektiven in der ersten Strophe zur Drohung des Bären in der letzten könnt sein, daß dieser Bär sich losreißt“) finde ich hier nichts, was mich tatsächlich ergreift. (An diesem halb-umgangssprachlichen „’s könnt sein“ bleibe ich unweigerlich hängen. In dem Gedicht „Rede und Nachrede“ verwendet sie „’s ist wahr“, was man mit einigem guten Willen als Entlehnung eines englischen „’Tis true“ lesen kann.)
Die Ironie, dass die Welt wie im Spiel eines alten Bären beiläufig zugrundegehen könnte, erreicht mich nicht. Sie bleibt als Interpretation behauptet. Ich habe in diesem Gedicht nichts anderes erlebt als den Willen, ein Gedicht zu schreiben über die große Bedrohung durch die Willkür einer größeren Macht – den Willen, ein Gedicht zu schreiben, dem nichts anderes zu Gebote steht als Bilder von einem zotteligen Bären und Hirten, die ihre Herde zusammenhalten. Hier wird ein Krampus gemietet, und er soll existentiellen Schrecken verbreiten. Ist das große, unverwechselbare Sprache, ein neuer mutiger Ton? Welcher Mut eigentlich? Wo riskiert dieses Gedicht etwas außer dem, was ihm seine Autorin passieren lässt?
5 „Erklär mir, Liebe“
Der Sprecher, ein Unerlöster, ein zur Liebesunfähigket verdammter Hirnmensch, fordert von der Liebe eine Erklärung dafür, warum er allein auf die Liebe verzichten und nur denken soll („Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann: / sollt ich die kurze schauerliche Zeit / nur mit Gedanken Umgang haben und allein / nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? / Muß einer denken? Wird er nicht vermißt?“) Diese beiden kurzen Fragen am Ende klingen, als habe sie die Autorin sich selbst laut gestellt oder jemandes schlechten Rat zurückgegeben. „Muß einer denken? Wird er nicht vermißt?“ Die zwei Fragen klaffen, überspringen einen Konnex. Sie faszinieren mich, weil hier reine, erfahrungsgesättigte Sprache arbeitet und eine Leerstelle lässt.
Eine Zeile wie „vom wilden Honig nimmt / das ganze Land“ überzeugt und begeistert mich, und es ist das „nimmt“, nicht der Honig, denn Honig ist ein Klischee von Süße und nicht zufällig klebrig, aber die Vorstellung der Anarchie, die im Lieben ausbricht, und dass der liebende Körper, der liebende Mensch oder alle Menschen, die sich verlieben, das Land plündern und sich plötzlich auf den wilden Honig besinnen, der immer schon da war – das stimmt. „Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund, / was soll dir noch geschehen“ ist große Lyrik.
Das Gedicht laviert aber ständig an der Grenze zum Putzigen. Sternblumen, ein Entrich, die Herrlichste (nämlich die Geliebte des Käfers), – es erinnert mich an die Illustrationen in den Kinderbüchern meiner Mutter, wo sich eine kleine Tierwelt „tummelt“, wie der Ausdruck dafür heißt, ein Manhattan der Grashalme, eine Geschäftigkeit, wo jeder seiner Aufgabe nachgeht und für das Gelingen eines Mikrokosmos sorgt. Bachmanns Gedicht stellt so etwas dar wie Ein Tag im Leben der verliebten Tiere, „so arglos tritt die Schnecke aus dem Haus“. Es behält seine Größe trotz dieses Käferlichen, und trotz des kindlichen Fragens „sollt ich die kurze schauerliche Zeit / nur mit Gedanken Umgang haben“.
6 Südliches
Manchmal kommen einem andere Gedichte zu Hilfe. Während ich für mich klären wollte, was mich an einigen Italiengedichten der Bachmann stört, las ich die Ischia-Gedichte von Wystan Hugh Auden wieder, „Ischia“, „Cattivo Tempo“, „Under Sirius,“ (entstanden 1948/49). „In den Umarmungen schöner Knaben / schlafen die Küsten“, heißt es bei der Bachmann, die in der Gesellschaft Hans Werner Henzes nach Ischia gekommen war. Auden schreibt:
My thanks are for you,
Ischia, to whom a fair wind has
brought me rejoicing with dear friends
from soiled productive cities.
(„Mein Dank gilt dir, / Ischia, wohin mich ein heiterer Wind gebracht hat, feiernd mit lieben Freunden // aus verschmutzten, produktiven Städten.“ (m. Ü.))
Bei Auden durchkreuzt der umgangssprachliche Tonfall gern und befreiend die Befrachtetheit mit Wissen, die Selbstironie untergräbt noch die große Pose in der Vorstellung des Weltendes:
How will you answer when from their qualming spring
The immortal nymphs fly shrieking,
And out of the open sky
The pantocratic riddle breaks –
„Who are you and why?“
[„Under Sirius“]
(„Wie wirst du antworten, wenn die unsterblichen Nymphen kreischend
Aus ihren dampfenden Quellen fliegen
Und aus dem offenen Himmel
Das pantokratische Rätsel herunterbricht:
,Wer bist du und warum?‘“)
(m.Ü.)
Hier ruft Auden keinen Inselheiligen an, sondern einen lateinischen Dichter des 6. Jahrhunderts, was ihm einen anderen Ton erlaubt: „Yes, these are the dog-days, Fortunatus“, während die Ironie bei der Bachmann ganz der Widergabe der Litanei verpflichtet bleibt:
Einmal muss das Fest ja kommen!
Heiliger Antonius, der du gelitten hast,
heiliger Leonhard, der du gelitten hast,
heiliger Vitus, der du gelitten hast
Audens Heilige von Ischia ist eine Santa Restituta mit einem allzu wachsamen Auge, die auch ihren Blutzoll fordert. Worauf der Dichter erwidert:
That, blessed and formidable
Lady, we hope is not true.
Bei Auden gibt es auch einen Esel, der wittgensteinisch in einen Klageschrei äußersten Protestes über das ausbricht, „was der Fall ist“ („what is the case“), und die Armen sind hier solche wie der Besitzer dieses Esels, der nach einem Brooklyn seufzt, wo die Hemden aus Seide sind und die Hosen neu.
Gedichte gegeneinander auszuspielen, macht keinen Sinn. Aber nachdem ich Wystan H. Audens Sprache für den Süden gelesen hatte, kam mir das Spiel mit der Tragik im Apuliengedicht der Bachmann erst richtig zu Bewusstsein. In diesem Gedicht über die verarmten Höhlenbewohner trifft das, was mich überzeugt, in einem Satz zusammen mit dem für mich schwer Erträglichen:
Endlich reichten die Geschenke:
Lammblut, Fisch und Schlangenei
Die Kargheit dieser Utopie der aufgehobenen Armut („endlich reichten die Geschenke“) wird gleich wieder erschlagen von theatralischer Aufzählung: Lammblut, Fisch und Schlangenei. Sie vertraut darauf, dass Signalwörter den Mezzogiorno flimmern lassen, Olivenbaum, Öl, Mohn, Esel, Madonna, Lammblut, Früchte, Krug. … Ich muss hinter diesem Katalog an Südlichem lesen, ich kann ihn nicht ignorieren.
Wenn man einem Kellner in Ischia glauben darf, dann war übrigens der Epomeo der einzige Vulkan, auf dem kein Galgen stand. Ich konnte das bislang weder verifizieren noch falsifizieren. Daher sage ich mit großem Vorbehalt, aber mit einem bleibenden Verdacht, dass es für mich „falsch“ ist, wie die Bachmann von den Richtstätten zu sprechen, die nun leer sind, und vom Henker, der am Tor hängt. (In „Lieder von einer Insel“). Es klingt mir nach einer der Insel aufgebürdeten Theatralik, vielleicht ungewollt und nicht hinterfragt, aber eben doch so typisch. Richtstätte, Henker: darunter tut sie’s nicht. Man kann streiten, ob die Wahrheit eines Gedichts diese Faktenwahrheit benötigt. Diese „wahren Worte“.
7 „Keine Delikatessen“
Um eine Sprache der Grundbedürfnisse und um die Absage an die hohe Kunstsprache geht es in diesem Gedicht, das mühsam von einer abgegriffenen Metapher zur nächsten turnt („Soll ich einen Gedanken gefangennehmen, / abführen in eine erleuchtete Satzzelle? / Aug und Ohr verköstigen / mit Worthappen erster Güte? / erforschen die Libido eines Vokals, / ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten?“) Es sind hilflos anmutende Versuche, der Benennung auf den Leib zu rücken. Es kann nicht funktionieren, weil „die Libido eines Vokals“ eine Abkürzung ist, sich etwas erspart, das in dem Wort Libido eben nicht zum Leben kommt, einem – gewiss auch Ende der 50er Jahre schon – billigen Wort. Die Bachmann will ja eine „billige“ Sprache propagieren, aber sie korrumpiert ihren hohen Anspruch dadurch, dass sie es sich zu leicht macht. Die Aufzählung ergibt nie das Ganze, weil jedes Teil für sich nicht lebt, es bleibt künstlich. „Eine Metapher ausstaffieren mit einer Mandelblüte“ – einfallslos auch das. „Die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt“ – heißt das die Syntax ans Kreuz schlagen, ein Kreuz, das einen Lichteffekt darstellt, auch das ergibt für mich kein zwingendes Bild. Meint es, die Syntax verrenken und mit Nägeln ans Kreuz schlagen, wie es die experimentellen Lyriker tun, um eines Lichteffekts willen? Meint es die vergewaltigte Wortfolge, zu der der Reim einen – schlechten – Lyriker zwingt?
Ein Gedicht, das sich abgrenzen will gegen eine von den Luxusartikeln des hohen lyrischen Tons verdorbene Sprache, das gegen ein nicht mehr mögliches „hohes“ Sprechen auftritt und dabei übersieht, dass solches Sprechen ohnedies nie möglich war unter ernstzunehmenden Dichtern. Mit der Art lyrischer Sprache, die es anklagt, haben sich Dichter, wie die Bachmann sie doch meinen muss, nie zufriedengegeben.
8 Schlimmste Momente
In den Frankfurter Vorlesungen sagt Ingeborg Bachmann:
Mit einer neuen Sprache wird der Wirklichkeit immer dort begegnet, wo ein moralischer, erkenntnishafter Ruck geschieht, und nicht, wo man versucht, die Sprache an sich neu zu machen, als könnte die Sprache selber die Erkenntnis eintreiben und die Erfahrung kundtun, die man nie erlebt hat.
Sie setzt diese Katharsis gegen ein dem Ästhetizismus verpflichtetes Kündertum, das Beispiel Günter Eichs gegen das Sendungsbewusstsein eines Stefan George. Der Ort, von dem Günter Eich aus spreche, sei „in eine fatale Einsamkeit verlegt […], nicht selbstgewählt, nicht hochmütig, sondern zudiktiert von einer Gesellschaft inmitten der Gesellschaft, ein Ort, an dem es nicht geheuer ist, und das Wachbleiben erschwert wird, dem, der wachen muß, kann, will.“
Und apropos Stefan George:
Von einem heiligen Gesang, von einer Sendung, einer auserwählten Gemeinschaft von Künstlern, kann nämlich heute überhaupt keine Rede mehr sein.
Kein Sendungsbewusstsein also, keine stolze Erhöhung des Dichters, kein Prophetentum. Mit dieser Absage an einen Dichterbegriff, den mehr noch als George der unselige Josef Weinheber vertreten hat, verträgt sich indes schlecht, was an die Stelle dieses Stolzes getreten ist: Denn zu den Grundtönen von Ingeborg Bachmanns Lyrik gehört für mich, dass sie verkündet, warnt, vorschreibt, befiehlt, den Leser anherrscht oder ihn zu einer bestimmter Aufgabe verdonnert, moralisiert – kurz, sie spricht erneut von einer erhöhten Position aus. Das Heroldhafte, das den vorauseilenden Gehorsam und die Vergessenswut der Restauration in Deutschland und Österreich überholen will, ist im historischen wie auch literarischen Kontext der späten Vierziger- und Fünfzigerjahre begründet und daraus erklärbar. Dennoch gehört das Einnehmen dieser Position, die Selbstverständlichkeit, mit der die Bachmann zu einem sehr groß imaginierten Publikum sprach, für mich zu den erstaunlichsten Merkmalen ihres Schreibens. Ich höre darin ein männliches Selbstbewusstsein, das annimmt, dass ihm zugehört wird. Es kennt nicht die Schwierigkeit der Frau, die sich die Autorität immer erst holen muss. Die Bachmann „hat“ sie. Und damit hat sie die Probleme einer Autorität.
Eine schwache Seite dieser harten, männlichen Stimme ist für mich die allzu weite Geste, die Armweite des großen Sprechers, der ganze Länder sagen muss, wenn er von einem Ort sprechen will, und große Zeiten beschwört, wenn er den Moment festhalten will. Solche Sprecher sind im Großen unterwegs. Sie gehen in Landschaften und entwickeln gewaltige Heimkehren. In ihren Schlachtengemälden mit namenlosen Helden sagen sich zwar die Füchse gute Nacht, aber Märchenpersonal muss die niederen Dienste verrichten, während der Sprecher den großen Gedanken wälzt.
Das Hohle, Gebärdenhafte, das solche Mahnungen an sich haben, eine Mischung aus Pädagogik und Poesie, die so selten (in der Gestundeten Zeit) durch etwas konkret Erfahrenes gedeckt scheint, wo sich nirgendwo eine Person zeigt, die etwas konkret erlitten hat, ist für mich schwer erträglich. In ihren schlimmsten Momenten (oder sind es meine schlimmsten Momente) erinnert sie mich an Weinheber. Es ist ein im Zentrum der Person leeres Sprechen. Ich höre auch in der Liebesdichterin selten eine intime Stimme. Sie trägt vor, sie spricht zu einer Menge hinunter.
Das Gedicht „Früher Mittag“ kann vielleicht zeigen, was ich meine. Es führt uns in eine mit allerlei Schaudervokabular und Schreckensbildern aufgeladene Landschaft, in der nichts, aber auch gar nichts, echt zu sein scheint, es sei denn, man nimmt der Dichterin wirklich ab, dass es schlimm ist, wenn „die Wolke nach Worten […]“ oder Deutschlands „enthaupteter Engel ein Grab für den Haß“ sucht. Dieses merkwürdige Umgetriebensein, das wie das outrierte Suchen einer Schauspielerin in einem Stummfilm wirkt, das Herbeizerren von allen Winkeln der Bühne überzeugt mich nicht. Das Eisen krümmt sich, die Hoffnung kauert, der Flügel des Märchenvogels ist geschunden, die Hand ist vom Steinwurf entstellt … Es ist eine Kulissensprache.
Allzu oft werden in solchen Gedichten die vielbeschworenen „Worte“ nicht ausgefüllt. Die Haltung, man könnte auch sagen, die Pose der Warnerin, der Erschrockenen, trägt für mich Züge einer Selbstgerechtigkeit, die in Widerspruch zu der behaupteten Skepsis steht. Der Kassandrastatus hat mich in zunehmendem Maße argwöhnisch gemacht. Ich misstraue dem Anspruch der moralischen Überlegenheit, mit denen mir viele dieser Gedichte entgegentreten. Und ich habe den Verdacht, dieser Anspruch könnte schon im Akt des Schreibens manchmal die ästhetische Selbstkritik beeinträchtigt haben. Die zahlreichen Entwürfe und Änderungen, die für Gedichte existieren, beweisen nicht notwendigerweise, dass man um das „wahre“ Wort gerungen hat.
Sobald man mit einem Anker einen Anker oder das metaphorische „vor Anker gehen“ meint, gelten die Gesetze von Physik, Mechanik, Schiffahrt ebenso wie die der Poesie. Die Gestalt eines Ankers, seine Gesten müssen ernstgenommen werden, sonst rächt er sich, indem er die Kausalität des poetischen Bildes untergräbt. Genau das passiert in den folgenden Zeilen aus den „Liedern auf der Flucht“:
Heimgesucht von meinen Lauten
diese Erde,
die schluchzend in meinen Zähnen
vor Anker ging
mit allen ihren Hochöfen, Türmen
und hochmütigen Gipfeln
Das funktioniert nicht, weil das Bild an eine brutale Zahnextraktion erinnert, die für das Bild in die Irre und ins Lächerliche führende Information liefert. Hier soll ja kein Übel aus dem Körper entfernt werden, mit brechzangenhaften Mitteln. Die Erde geht mit ihren Hochöfen, Türmen und hochmütigen Gipfeln in meinen Zähnen nicht vor Anker. Das Bild dieses Ankers würde auch nicht in einer Lyrik funktionieren, die nach einer viel assoziativeren, anarchischeren poetischen Logik arbeitet wie etwa die von Friederike Mayröcker.
Die wiederholte Absage der Bachmann an formale Experimente in der Lyrik, ihr Beharren auf dem Primat der Haltung und auf dem Aufheben der Grenze zwischen Moral und Ästhetik tragen deutlich ästhetikfeindliche Töne. Ihre Ambivalenz gegenüber der Lyrik äußert sich in den Interviews, wenn sie nach ihrem Verstummen als Lyrikerin gefragt wird. So sagt sie 1961:
Ich habe nichts gegen Gedichte, aber Sie müssen sich denken, daß man plötzlich alles dagegen haben kann, gegen jede Metapher, jeden Klang, jeden Zwang, Worte zusammenrücken zu lassen, gegen dieses absolute glückliche Auftretenlassen von Worten und Bildern.
Ist ihr der theatralische Aspekt ihrer Lyrik bewusst geworden? 1965 bekundet sie ihr Misstrauen gegen eine beliebig reproduzierbare Lyrik ohne Anlass aus der Wirklichkeit im Sinne der Goethe’schen Gelegenheit:
Ich habe darum auch viele Jahre keine Gedichte mehr geschrieben, weil ich eben nicht Gedichte schreiben kann, oder ich könnte es zwar, mag aber nicht, wenn da nichts ist außer verfügbaren selbstentwickelten Techniken und eben der Luft.
Im Erscheinungsjahr von Malina spielt sie, eher missverständlich, das Bühnenelement gegen die Notwendigkeit von Erfahrung aus:
Um ein wirkliches Gedicht schreiben zu können, braucht man keine langjährigen Erfahrungen, keine Fähigkeit zu beobachten. Ein sehr reiner Zustand ist das, in dem nur die Sprache eine Rolle spielt. Wortauftritte sind der Anstoß für Gedichte.
Wie man weiß, versuchte sie weiter Gedichte zu schreiben. Die im Jahr 2000 publizierten Unveröffentlichten Gedichte, die man in der Mehrzahl wohl als Entwürfe bezeichnen muss, sind getränkt von persönlichen Erfahrungen und verletzen nach meinem Dafürhalten mitnichten die Idee vom vollendeten Kunstwerk. Ich wünsche mir, dass das Texte bleiben, die von keinen Schauspielerinnen missbraucht werden, für keine akademischen Arbeiten den Stoff abgeben, dass kein Wort über diese Worte verloren wird.
9 Schreibbewegungen
In den Erzählungen in Das dreißigste Jahr seien noch viele Versuche, „den Satz so hochzutreiben, daß kein Erzählen mehr möglich ist. … Ich halte das noch nicht für erzählt, oder nur in ganz wenigen Partien, gegenüber dem, was ich heute unter ,erzählen‘ verstehe.“ Sie habe noch versucht, aus dem einzelnen Satz ein Kunstwerk zu machen. Ich verstehe das so, dass sie in diesen Prosatexten die Dichte von Gedichtzeilen erreichen wollte, und es fehlt nicht an Belegen, die diese Prosa als lyrische Prosa durchgehen lassen, vor allem im Rhythmus.
Am Rost, im Sand, gebraten, geflammt: das leicht verderbliche Fleisch des Menschen. Vor dem Meer, auf den Dünen: das Fleisch.
Eine etwas peinliche und peinlich hämmernde Passage, die jedem passieren kann. Wie überhaupt nichts gegen lyrische Prosa eingewendet werden könnte, wenn sie, als Erzählung immerhin intendiert und veröffentlicht, ihr Ziel mit lyrischen Mitteln verfehlt, oder elegant verfehlt, oder interessant verfehlt.
Sie tut das nur an wenigen Stellen. Sie repetiert über drei Seiten hinweg ein Strukturmuster, um den unseligen Jugendfreund Moll zu charakterisieren („Moll, den Wunderknaben… Moll, über den man sich lustig macht… Moll, noch immer der Jüngsten einer…“). Sie zählt auf und zählt auf und hört nicht auf. Wenn der Erzähler die Zeitung liest, liest er „die Schlagzeilen, Lokales, Kulturelles, Vermischtes, den Sportbericht.“ Wenn der Erzähler und sein Lieblingskellner vieles an sich vorbeigehen sehen haben, dann haben sie „Jahre, Menschen, Glücke, Unglücke“ an sich vorbeigehen sehen. Jahre, Menschen, Glücke, Unglücke machen nicht Jahre Menschen, Glücke, Unglücke in der Sprache lebendig.
Wird ein vages, ausweichendes Sprechen am besten durch vages Beschreiben charakterisiert:
Wahrscheinlich hatte er damals so mit ihr geredet, Zwischentöne gebraucht, Halbheiten geübt, Zweideutigkeiten, und nun konnte nichts mehr klar und gerade werden zwischen ihnen?
Das Aufzählen will sich legitimieren als poetische Litanei aber es bleibt nur die Litanei, wenn der Erzähler im Dreißigsten Jahr in schier endlosen Wenn-Sätzen räsonniert:
Wenn du nicht mehr wagen müßtest und verlieren oder gewinnen, sondern machtest Machst, den Handgriff in der größeren Ordnung, denkst der Ordnung, wenn du in der Ordnung wärst, in Rechnung, aufgingst in der hellen Ordnung.
Dann, wenn du nicht mehr meinst, daß es besser gehn müsse ,im Rahmen des Gegebenen‘, daß die Reichen nicht mehr reich und die Armen nicht mehr arm sein dürfen, die Unschuldigen nicht mehr verurteilt und die Schuldigen gerichtet werden sollten.
Ein erbarmungsloser Redestrom, der das Poetische im Kursorisch-Ungenauen zu finden meint und in einem Rhythmus, der alles mitschwemmt, was da liegt:
Er war von allem frei, aller Eigenschaften, Gedanken und Ziele beraubt in dieser Katastrophe, in der nichts gut und schlecht oder recht und unrecht war, und er war sicher, daß es keinen Weg weiter oder heraus gab, den man als Weg hätte bezeichnen können.
Der Gesang auf Wien, den der Erzähler hoch stemmt, wird ihm immer wieder zu schwer.
Und einer hatte eine Stirn, die blau und tragisch erglühte zwischen den Gezeiten aus Sprachlosigkeit.
Das wird in dieser Konstellation nicht Trakl, nur blaues Neon, das Bild stürzt in sich zusammen.
Die Unerträglichkeit des seitenfüllenden Aufzählens und der Tiraden setzt sich in Malina fort. Sie holt nach allen Seiten hin aus und hält die Wörter fest. Sie scheint zu glauben, dass man eine Sache dann treffend beschreibt, wenn man sie von allen Seiten her beschreibt, und erspart sich die Mühe des Auswählens. Sie ist überhaupt nicht wählerisch mit ihrer Sprache. Sie löscht die Suche nicht. Sie lässt dem Leser keine Leerstelle, die er selber ausfüllen könnte. Ich wollte nichts als streichen.
10 „I think I may well be a Jew“ (Sylvia Plath)
Die Schwäche der Malina-Konstruktion könnte ich vielleicht noch aushalten, wenn auch mit Mühe, aber nicht die Kraftlosigkeit der Sätze in einem Schwall nach dem anderen, die öden musikalischen Tempobezeichnungen in den Dialogen zwischen Malina und dem Ich, die halben Telefonsätze, die Briefe der Schriftstellerin, die ewigen Ungenauigkeiten in all den Einzelheiten („erfinde ich unglaubliche Bräuche und Geschichten aus dem Leben der Kriechtiere“ – welch ein unglaublicher Brauch? „… vor dem großen Vogelhaus erfinde ich alles über die Geier und die Adler“ – welches Konkrete in diesem Allem?
Im Laufe der Lektüre der letzten Monate habe ich mir eine Frage öfter als jede andere gestellt. Was ist es in mir, das mich so unnachsichtig sein lässt, so unverführbar und unempfänglich? Ich will ihr gerecht werden, und ich weiß, dass ich diese Texte längst weggelegt hätte, trügen sie nicht den großen Namen der Nachkriegsliteratur.
Ein Misstrauen, das ich nicht beruhigen konnte, begleitete meine Lektüre. Es hat in ihrer Lyrik mit dem zu tun, was ich ihr Moralisieren nannte (ich sehe insgesamt in ihrer Haltung nichts besonders Mutiges), und in der Prosa, vor allem in Malina, den Todesarten, mit etwas, das ich zögernd als eine Selbststilisierung als Opfer bezeichnen möchte. Man hat über Schmerzempfindungen anderer nicht zu urteilen. Ich kann auch nur mit begrenzter Gültigkeit über die Schmerzerfindung in einem Text urteilen. Dann komme ich allerdings zu dem Schluss, dass mir das Opfermonstrum namens Ich in Malina unerträglich ist.
Die Maßlosigkeit des Leidensanspruchs, die nicht davor zurückscheut, die Verletzungen der Frau durch das Wesen des Männlichen gleichzusetzen mit den Verbrechen des Faschismus, fügt allen Opfern Unrecht zu – den wirklichen Opfern des Faschismus, deren Leiden sie sich aneignet, ohnedies, aber auch den Frauen, weil aufgrund der Ungeheuerlichkeit dieses Verbrechensvergleichs nichts einfacher ist, als einer Frau den Opferstatus überhaupt abzusprechen. Mit ihren gigantischen Schuldzuweisungen macht sie es ihren Verächtern so leicht. Es geht um die Kränkung durch einen bestimmten Mann und durch alle Männer, und es wird das persönliche Leiden einer weiblichen Romanfigur aufgepeppt durch konkretes, fremdes Leiden. Die Gaskammerszene gehört – zusammen mit Sylvia Plaths „Daddy“-Gedicht – für mich zu einer Art von Texten, bei denen die Kategorie der Geschmacklosigkeit mir die Lust nimmt, mich mit dem literarischen Vermögen auseinanderzusetzen.
Die Versuche, Romanfiguren auf ihre sogenannten Vorbilder im wirklichen Leben zurückzuführen, sind gewiss immer eine Reduktion beider. Der Vater in einem Traum in Malina ist „ein riesiges Krokodil, mit müden herabhängenden Augen“. Und wenn tatsächlich Max Frischs physiognomisches Markenzeichen in Bachmanns Krokodil steckt, dann hat der schwyzerische Jack Nicholson in Montauk ein wenig larmoyant darauf reagiert:
Ein Zug von Trübsinn, den fast jedes Foto zeigt, mißfällt mir seit eh und je. Das kommt von einer Lähmung der Augenlider, was zudem, ich weiß, einen Ausdruck von Suffisance ergibt.
11 Indiskretionen
Im Juni 1972 teilte die amerikanische Dichterin Elizabeth Bishop ihrer Tante Grace mit, dass das Gedicht über Nova Scotia, das sie ihr zu widmen versprochen hatte, nun endlich fertig sei. „It is called ,The Moose‘“, der Elch. In Klammer beruhigte sie ihre Tante: „You are not the moose.“
Ein paar Monate davor hatte es zwischen Elizabeth Bishop und Robert Lowell eine tiefgehende Meinungsverschiedenheit gegeben. Die beiden verband eine lange Freundschaft, eine Art von Liebe, die es ermöglichte, völlig ehrlich im kritischen Urteil über die Arbeit des anderen zu sein. Lowell hatte Bishop das Manuskript seiner neuen Gedichtsammlung geschickt, Sonette, die das Ende seiner (zweiten) Ehe mit Elizabeth Hardwick und seine damalige dritte Ehe mit Caroline Blackwood nacherzählte. Er hatte aus zornigen und depressiven Briefen von Elizabeth Hardwick zitiert, in denen sie ihn um seine Rückkehr anfleht, ihr aber auch Sätze in den Mund gelegt, die erfunden waren.
In einem großartigen Brief (21.3.72) beschwört Elizabeth Bishop’ ihn, auf die Publikation einiger Sonette in dieser Form zu verzichten, da er damit großen Schaden auf sich ziehen würde. Sie warnt ihn vor allem vor der unverzeihlichen Vermischung von Fakt und Fiktion. An den Beginn ihrer Argumentation stellt sie ein Zitat von Thomas Hardy, der sich (1911) über einen zeitgenössischen Schlüsselroman empört hatte: Am schlimmsten sei bei solch unautorisierter Verwendung von Textstücken die Vermengung von fact und fiction in unbekanntem Verhältnis. Wenn etwas im Gewand der Fiktion heimlich als Fakt ausgegeben werde, dann müsse alles Fakten sein, und nur Fakten. Der Gedanke, dass Leser Unwahrheiten und Erfundenes für Fakten hielten, eben weil einige wenige Fakten hineingemischt worden waren, sei eine Horrorvorstellung.
Es sei ihr völlig egal, meint Elizabeth Bishop, was ein Norman Mailer über seine Ehen und Frauen schreibe, aber nicht ein großer Dichter wie Robert Lowell. Keine Kunst rechtfertige solche Verletzung. „It is not being ,gentle‘ to use personal, tragic, anguished letters that way – it’s cruel.“ Sie sorgte sich darum, was diese Art des Umgangs mit Briefmaterial aus dem Menschen Lowell machen und in welchem Licht er seinem Publikum erscheinen würde. Ihre literarische Detailkritik, die sich daran anschließt, muss Lowells Lektor eine Menge Arbeit erspart haben. Lowell bezeichnete Bishops Brief als ein Meisterstück literarischer Kritik, obwohl die Paranoia bezüglich Enthüllungen diesem Brief etwas Verrücktes gäbe. Dennoch befolgte er ihren Rat, verhüllte den Zitatcharakter, indem er Anführungszeichen entfernte und Gefühlsausbrüche der verlassenen Ehefrau abschwächte.
In seinen fünfzehn Jahren früher veröffentlichten Life Studies gibt es ein Gedicht mit einem Zitat aus Chaucer als Titel: „To Speak of Woe That Is in Marriage“, vom Leiden in der Ehe. Es ist – wie bei Chaucers „Wife of Bath“ – mit der Stimme einer Ehefrau geschrieben. Darin heißt es:
It’s the injustice … he is so unjust –
whiskey-blind, swaggering home at five.
My only thought is how to keep alive.
What makes him tick? Each night now I tie
ten dollar: and his car key to my thigh
Lowells Herausgeber Frank Bidart schreibt in der neuen Gesamtausgabe, er habe die Frage, warum sie jede Nacht einen Zehndollarschein und die Autoschlüssel an ihren Schenkel binde, schon oft seinen Studentinnen am Wellesley College gestellt. Die Hälfte der Studentinnen sage, die Frau bereite sich auf die Flucht vor, falls der Mann sie wieder betrunken attackiert, während die andere Hälfte glaubt, sie mache es, um Mann zu sexueller Intimität zu zwingen, ehe er flüchten kann. Lowell selbst erklärte Bidart einmal, die ganze Sache habe er von der Ehefrau von Delmore Schwartz, einem anderen Lyriker. Ein typischer Fall von „erfunde Fakten“ also.
Vielleicht lag die größte Kränkung durch den Gantenbein-Roman nicht in den „ausgehorchten“ und zitierten Sätz sondern in den erfundenen.
12 Kein Schluss
Was gestehen wir Dante zu? Welche Zugeständnisse machte Dante, als er Vergil las? Welche bin ich bereit zu machen, wenn ich einen vom Katholizismus gezeichneten Dichter wie John F. Deane lese? Sehr große, weil die Haltung immer eine poetische ist, die Sprache, auch wenn sie sich der Rituale einer Liturgie bedient, Unausweichlichkeit hat. Hinweise wie diese, auf einen anderen Autor, wirken meist extrem subjektiv und parteiisch, wo es gar keine Wahl gibt, denn man wählt nie zwischen zwei Dichtern. Man liest den einen und will, dass das nicht aufhört. Nach Ingeborg Bachmann, der ein paar Jahre jüngeren Kollegin, habe ich derzeit kein Heimweh.
Evelyn Schlag, manuskripte, Heft 165, 2004
Ferne Zeitgenossen (XIV)
Ja, ich bin alt genug, um Ingeborg Bachmann persönlich gekannt haben zu können.
Aber was heisst schon können und kennen!
Ich habe sie ein einziges Mal gesehen, gehört, kurz mit ihr geredet, als sie 1959 in meinem Gymnasium mit einer Lesung zu Gast war. Vor dem Auftritt musste sie von meinem Französischlehrer, der sie eingeladen hatte, gestützt werden, sie taumelte, schüttelte den Kopf, brachte ihr strähniges Haar zum Fliegen.
Von der Lesung ist mir nichts in Erinnerung geblieben, nichts jedenfalls von ihren Gedichten, nur der Eindruck, dass hier – damals! – eine schon leidlich berühmte Autorin eigene Texte vortrug, die sie eigentlich für sich behalten wollte. Fast musste sie zum Lesen gezwungen werden. Was dann folgte, war für mich höchst eindrücklich, dabei verwirrend und auch ein wenig provokant:
Die Bachmann schien die Texte eher in sich hineinzuwürgen, als dass sie sie für das Publikum freigegeben hätte; sie räusperte sich unentwegt, verschluckte sich, ihre Stimme verringerte sich zu einem Wimmern und wurde nur momentweise durch einen tiefen Atemzug wiederhergestellt und weiter vorangetrieben.
Die Zuhörer applaudierten zurückhaltend, wohl in der Ungewissheit, ob das Klatschen die Autorin noch mehr verunsichern, sie vielleicht sogar verletzen und vertreiben könnte.
Aber nein.
Nach der gespenstischen Veranstaltung ging es weiter in die Basler Kunsthalle. Zusammen mit einem knappen Dutzend neugieriger oder auch bloss mitleidiger Verehrer begleitete ich die Dichterin dorthin zu Fuss. Der nun sichtlich erleichterte Moderator ging mit ihr voran, sie hatte sich bei ihm locker untergehakt, schritt kräftig aus, sprach vor sich hin, lachte immer wieder laut auf, wippte das dichte Blondhaar über die Schulter.
Ich ging ein paar Schritte hinter ihr, sah mit postpubertärer Faszination, wie ihr enger strohgelber Schlitzrock sich um ihre Hüften spannte; wie darunter ihre Unterhose sich abzeichnete; wie der Reissverschluss überm Kreuz sich Zacke um Zacke öffnete … Konnte nur noch staunen, wie rasch sich die Märtyrerin, die sich eben noch schluchzend ans Lesepult geklammert hatte, draussen auf der Strasse in eine attraktive junge Frau mit zielstrebigem Auftritt und lebhaftem Mundwerk verwandelte.
In der Bar der Kunsthalle kam es bei herbem elsässischen Weisswein zu einem vielstimmigen Gespräch „über alles und noch viel mehr“. − Ein unvergesslicher Abend. − Ingeborg Bachmanns Verse waren spurlos verweht.
Felix Philipp Ingold aus Felix Philipp Ingold: Endnoten. Versprengte Lebens- und Lesespäne. Ritter Verlag, 2019
FÜR INGEBORG BACHMANN
die gestundete zeit auch hier
für einen augenblick erfühlt
die flammenhaut spannt tod mir ein
dein bett verwaist die betten
wie kinder die ermordet werden
ohne nachruf fernab tod
José F.A. Oliver
Bachmann Loops von Tim van Jul
Stimmen zu Ingeborg Bachmann
Hermann Burger: Abend mit Ingeborg Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Peter K. Wehrli: Unverbunden in Zürich
DU, Heft 9, 1994
Uwe Johnson: Good Morning, Mrs. Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Inge Feltrinelli, Fleur Jaeggy, Toni Kienlechner, Christine Koschel, Inge von Weidenbaum: Römische Begegnungen
DU, Heft 9, 1994
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Heinz Bachmann: „Die Ärzte wollten dringend wissen, ob es irgendwelche Medikamente gab“
Die Welt, 5.9.2023
Ria Endres: Es kommen härtere Tage
textor.online, 25.7.2024
Ria Endres: Die härteren Tage
textor.online, 21.8.2024
Ria Endres: Auf Widerruf (III)
textor.online, 27.8.2024
Ingeborg Bachmann erhält den Georg-Büchner-Preis 1964. Dankesrede und kurzer Fernsehbericht über sie inklusive Interview. Außerdem Rezitation des Gedichts „Die große Fracht“.
Zum 10. Todestag der Autorin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Autorin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Autorin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + Forum + IMDb +
ÖM + KLG + Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口