Inger Christensen: Das Schmetterlingstal ein Requiem
XV
Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten,
in der mittagsheißen Luft des Brajčinotals,
aus der unterirdisch bitteren Höhle herauf,
die das Berggebüsch mit seinem Duft verdeckt.
Als Bläuling, Admiral und Trauermantel,
als Pfauenauge flattern sie umher
und gaukeln dem Toren des Universums ein Leben
vor, das nicht wie nichts stirbt.
Wer ist es, der diese Begegnung verzaubert
mit Anflügen von Seelenfrieden und süßen Lügen
und Sommergesichten verschwundener Toter?
Mein Ohr antwortet mit seinem tauben Klingen:
Es ist der Tod, der dich mit eigenen Augen
vom Schmetterlingsflügel aus anblickt.
… Es gibt drei Gründe, Inger Christensen zu lesen:
Erstens ist sie unlesbar – jedes ihrer Bücher zieht die Grenze vom Lesbaren zum Umlesbaren neu; zweitens sieht sie in Ideologien geschliffene Perlen, die alle Lebens- und Denkformen in eine spannen wollen, die aber gerade in ihrer äußeren Gestalt ihre historische Signatur, deren Zwänge und Gewaltsamkeiten verraten; und drittens läßt sich in ihren Texten nicht genau auseinanderhalten, was uns die Wirklichkeit – aber welche Wirklichkeit? – auseinanderzuhalten gelehrt hat: Realität und Imagination, Faktum und Fiktion, Wachen und Traum, Chronik und Märchen.
Wer je Inger Christensen Sommerfugledalen oder eines ihrer anderen vielfach vertonten Gedichte hat vortragen hören, mit leiser, eindringlicher Stimme in einer Art Gesang, weiß, welche Suggestion davon ausgeht, eine unbezwingbare Gewißheit, ein Meisterwerk zu hören. Aber er sollte auch wissen, wieviel Systematik, Formstrenge und Anstrengung des Begriffs dem zugrunde liegt. Man muß das Lesbare und seine geschliffenen wie schiefen Perlen genau studieren, um das Unlesbare zu finden.
Das dänische Original von Inger Christensens Schmetterlingstal hält andere Möglichkeiten der Rhythmik, des Reims und der Assonanz bereit als das Deutsch der Übersetzung, Möglichkeiten, die sich vielleicht erst ganz erschließen, wenn die Dichterin ihren Text laut vorliest. Die schöne Homonymie im sechsten Sonett, daß sich der „Harlekin“ auf „måneskin“, dem Mondschein, reimt und so den Gaukler ins Licht seines Trugschließens setzt, geht ebenso verloren wie der Zusammenklang von „sørgekåbe“ mit „nektardråbe“, von „Trauermantel“ und „Nektartropfen“, die auf besondere Weise zusammengehören. Doch zu Recht hat Hanns Groessel in seiner Übersetzung darauf verzichtet, den Reim des Originals wiederzugeben – zugunsten der Bilderwelt und ihrer genauen Semantik, die das Reimschema des Originals verstärkt.
Sommerfugledalen, das 1991 auf dänisch erschien und hier auf dänisch und deutsch wiedergegeben wird, ist von einer strengen, historisch geprägten Form bestimmt: dem klassischen Sonettenkranz mit vierzehn Sonetten und dem abschließenden Meistersonett. Der letzte Vers eines Sonetts bildet die erste Zeile des folgenden, das Meistersonett setzt sich aus den Anfangsversen aller vierzehn Sonette zusammen.
Die Form ist lesbar, die Bilder prägen sich ein; will man aber das Thema dieses Textes, seinen Inhalt nur annähernd wiedergeben, greift man ins Leere. Der Text ist so nicht lesbar, wie wir zu lesen gewohnt sind, identifizierend, strukturierend, auf etwas eigentlich Gemeintes zielend. Dieses Requiem führt zurück in ein „Kindheitsland“, entfaltet in einem Spiel von kindlichen Verwandlungen in verschiedene Schmetterlingsarten eine „Symmetrie der Trauer“, es versucht, „die Schmetterlinge Seelen und / Sommergesichte verschwundener Toter zu nennen“.
Thomas Sparr, Aus dem Nachwort
Das Schmetterlingstal
ist ein Meisterwerk europäischer Poesie. Es enthält einen klassischen Sonettenkranz mit vierzehn Sonetten und dem abschließenden Meistersonett. Christensens Requiem führt zurück in ein „Kindheitsland“, entfaltet in einem Spiel von kindlichen Verwandlungen in verschiedenen Schmetterlingsarten eine ‚Symmetrie der Trauer‘, „die von meinem Leben überholte Trauer“, es versucht, „die Schmetterlinge Seelen und / Sommergesichte verschwundener Toter zu nennen“. Hier wie in all ihren Texten läßt sich nicht auseinanderhalten, was uns die Wirklichkeit – aber welche Wirklichkeit? – auseinanderzuhalten gelehrt hat: Realität und Imagination, Faktum und Fiktion, Wachen und Traum, Chronik und Märchen.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1998
Beitrag zu diesem Buch:
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Die Sonettenkranzmaschine
Das Sonett, dieser meistgespielte europäische Gedichtklassiker, bleibt in seiner Zumutung einer künstlichen Ordnung eine Provokation der Moderne. Ein Sonett besteht aus 14 Zeilen, basierend auf zumeist fünffüßigen Jamben, und ist nach einem strengen Reglement zu dichten, das hier nur kurz skizziert werden kann: Zwei vierzeilige Strophen (Quartette) mit ursprünglich nur zwei Reimen (Schema abba) bilden den „Aufgesang“, zwei dreizeilige Strophen (Terzette) mit variierenden Reimschemata den „Abgesang“.
Ein Sonettenkranz ist die Zumutung in Potenz. Es handelt sich dabei um einen Zyklus aus fünfzehn Sonetten, deren letztes, das sogenannte Meistersonett, im Kompositionsvorgang das erste ist, weil es die Anfangs- und Schlußzeilen der vierzehn übrigen und somit genaue Vorschriften über ihren Bau enthält: Sonett I beginnt mit der ersten Zeile von Sonett XV und endet mit dessen zweiter. Diese ist die erste Zeile von Sonett II, das wieder mit der dritten Zeile des Meistersonetts schließt usw., bis die Form ganz auskomponiert ist. Wegen der ungewöhnlich hohen formalen Anforderungen muß der Sonettenkranz in einer Zeit, die zur Formkunst ein bestenfalls ironisches, meist aber nur dilettantisches Verhältnis pflegt, als ungefähr so schwierig zu errichten gelten wie eine mittelalterliche Kathedrale.
Inger Christensens Sonettenkranz Sommerfugledalen. et requiem, 1991 in dänischer Sprache und 1995 mit der deutschen Übersetzung Hanns Grössels im Verlag Kleinheinrich in Münster erschienen, ist jedoch weit mehr als eine perfekte Befolgung traditioneller Vorschriften. Die schwere Statik der Verskunst (Christensens Quartette bevorzugen den Kreuzreim und folgen darin dem „englischen“ oder Shakespeare-Schema abab cdcd, während die Terzette nach dem Schema efe gfg die Regeln Petrarcas variieren) trifft darin auf das wohl Leichteste unter der Sonne, die „Schmetterlinge des Planeten“. Vielleicht liegt es an der faszinierenden Balance, die Christensens Gedichte halten, indem sie das Entschwebende mit dem Erdenschweren ins Einvernehmen setzen, daß dieser wunderbare Zyklus zu den raren sprachlichen Kunstwerken zählt, die wohl jeder Lyriker am liebsten selbst geschrieben hätte.
Die ganz sinngetreue und in dieser Hinsicht sicher nicht zu übertreffende Übersetzung Hanns Grössels verzichtete in konsequenter Bescheidung auf Reim, Versmaß und jene strenge lautliche Architektonik, die aus den Zeilen des einen Meistersonetts den Bauplan der vierzehn anderen zwingend herleitet: Sie ließ mithin den Raum für eine deutschsprachige Nachdichtung auf verführerische Weise vakant. Dennoch war ich mir keiner heimlichen Absichten bewußt, als ich Inger Christensen beim Freiburger Literaturgespräch im November 1997 auf diese Vakanz ansprach. Umso schockierender traf mich die saloppe Antwort der großen Dichterin: „Dann machen Sie’s doch.“ Meine Ausflüchte bezüglich mangelnder, schlichtweg nicht vorhandener Kenntnis des Dänischen schienen sie nicht weiter zu irritieren. Als Christensen nach wieder mal grandiosem Vortrag des Zyklus dann sogar öffentlich nach einem „frechen jungen Dichter“ rief, der sich an die fehlende Nachdichtung heranmachen solle, fühlte ich mich bereits unter Druck.
Meine Nachdichtung von Sonett XV im Dezember 1997 besagte noch nichts über ein mögliches Gelingen. Im Februar 1998 beschenkte mich ein Stipendienaufenthalt in Amsterdam mit einer Wohnung in Parklage und somit mit ein wenig Natur, was nach Benn eine nötige Voraussetzung für die Entstehung von Lyrik ist, für Schmetterlinge allemal. Jedenfalls war es auf einem meiner täglichen Gänge durch den winterlichen Vondelpark, als mir die Lösung für das schwierigste Problem in Sonett I zufiel: Für die beneidenswerte Möglichkeit des Dänischen, „Vernunft“ auf „Luft“ und auf „Duft“ zu reimen, mußte ein annehmbares Äquivalent gefunden werden. Danach lief alles wie von selbst. Die ungeheure Eigendynamik der Sonettenkranzmaschine und das Klima von Amsterdam taten ihre Wirkung. Draußen hörte ich holländisch und sprach englisch, drinnen las ich dänisch und schrieb deutsch, alles Sprachen, die um die Nordsee herum einen Kreis schlagen. Der Zyklus wurde in diesen Wochen fertig.
Eine Nachdichtung ist zuerst den Gesetzen der Form und der Sprachmusik verpflichtet. Ich habe versucht, den Klang des Dänischen im Deutschen zu imitieren, so gut es ging. Die relative Länge des Deutschen brachte es mit sich, daß ich gelegentlich zwölf- und dreizehnsilbige Verse bauen mußte, wo das Dänische mit zehn und elf Silben auskommt. An einer Stelle fehlt der Reim, dort, wo ihn auch Inger Christensen ausläßt, in Sonett VII (Zeilen 10 und 13). Ich hielt diese Aussparung für bedeutungsvoll, weil sie dem Unaussprechlichen des Liebesaktes geschuldet schien, den auch Hölderlin im Hyperion als Ellipse bestimmt:
Es ist hier eine Lücke in meinem Dasein.
Alle Einsicht in Sinn und Gehalt der Gedichte Inger Christensens, von denen ich mich nie ohne Not entfernte, verdanke ich den Übersetzungen Hanns Grössels, ohne die meine Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Mein Dank gilt auch dem Verlag Kleinheinrich, der diesen Abdruck genehmigte. Meine ganze Bewunderung gehört Inger Christensen. Entschuldigen muß ich mich beim Pappelvogel, dessen Erscheinen in Sonett I aus rhythmischen Gründen nicht wiedergegeben werden konnte.
Norbert Hummelt, Schreibheft, Heft 52, Mai 1999
„Verschmelze die Erscheinung mit dem Wort“
– Anmerkungen zu Inger Christensen. –
Man könnte meinen, Dichter hätten es immer nur mit Worten zu tun, die Welt der Zahlen sei ihnen fremd. Dazu mag passen, daß nicht wenige Lyriker im Fach Mathematik keine guten Schüler waren; zumindest muß ich das für mich bekennen. Lediglich in Kopfrechnen war ich gut, Dreisatzaufgaben löste ich intuitiv und ohne Fehler, nur war das später in den Klausuren nicht mehr gefragt. Merkwürdigerweise bin ich in der höheren Mathematik an der Sprache gescheitert. Da begannen dann die Aufgaben mit der Formel: „Es sei“, schon da kam ich ins Stocken, denn ich sah durchaus nicht ein, warum x auf einmal a2 – b2 oder c2 oder was auch immer sein sollte. Der Sprung in die abstrakte Gleichsetzung gelang mir nicht. Als ich einige Jahre später die Dichtung für mich entdeckte, kam mir ein Gedicht von Novalis entgegen, das beginnt: „Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen“ und mit den Worten endet:
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
Das sprach mir aus der Seele, denn als ich das Gedicht kennenlernte, um 1984, schwang in meiner Zustimmung zu diesen Versen nicht nur die Abneigung gegen Mathematik, sondern auch die Furcht vor der beginnenden Digitalisierung mit. Kreaturen sollten gar nicht aufgeschlüsselt werden, sondern ihr Geheimnis bewahren dürfen: So verstand ich das Gedicht, das mir sehr aktuell vorkam. Dabei war damals der genetische Code noch gar nicht geknackt, auch das Internet spielte kaum eine Rolle. Statt dessen sorgte man sich – es war das Orwell-Jahr – um Datenschutz und regte sich über die Volkszählung auf. Ich besaß damals eine Postkarte, auf der lauter Strichcodes abgebildet waren, und das war als Protest gegen die digitale Erfassung persönlicher Daten gemeint. Damals war es noch undenkbar, daß Millionen von Menschen völlig freiwillig ihre intimsten Geheimnisse weltweit für jeden einsehbar in Umlauf bringen würden. Gegen all das sollten die Verse von Novalis helfen, als Abwehrzauber. Ich übersah dabei, daß dieser Dichter der Frühromantik – den zitierten Versen zum Trotz – zu Zahlen und Formeln kein ablehnendes, sondern ein positives Verhältnis hatte. Er versuchte nicht nur seine kühnen theoretischen Ansichten über Literatur auf Formeln zu bringen, die mathematischen Gleichungen ähnelten („Poesie= Gemütserregungkunst“), er war zudem Bergbauingenieur und konnte den praktischen Nutzen exakter Berechnung schon deshalb gar nicht in den Wind schlagen. Was er im Sinn hatte, war nicht, Poesie gegen Mathematik auszuspielen, sondern eine höhere Synthese, eine Rückkehr zu einem mythischen Urzustand, in dem numerische und alphabetische Sprachen in eins fielen und die Zerklüftungen des Lebens und all das von ihnen ausgehende Unglück überwunden wären. Das klingt spekulativ; aber Novalis ist es gelungen, dieses abstrakte Nachdenken mit dem zu verbinden, was ihm als Mensch zustieß. So sucht er in den Hymnen an die Nacht nach dem Tod seiner Braut die Grenzen zwischen Leben und Tod aufzuheben, und immer wieder zielten seine Dichtungen und Fragmente darauf, die Grenzen zwischen dem menschlichen Bewußtein und der Dingwelt durchlässig zu machen.
Das Äußre ist in Geheimnißzustand erhobnes Innre. (Novalis)
Inger Christensen, die in ihren Äußerungen über Poesie immer wieder auf Novalis zu sprechen kam und bei ihm den Begriff „Geheimniszustand“ als Titel für einen Essayband entlehnte, konnte vermutlich ganz ohne antimathematische Ressentiments in dessen Gedankenwelt eintreten. Sie befaßte sich nicht zuletzt mit Novalis’ Reflexionen über den Zufall und der Frage, wie es möglich ist, sich den Zufall poetisch zunutze zu machen, indem man die Worte eines Gedichts nicht rein aus dem eigenen Denken oder der zufälligen subjektiven Eingebung, sondern unter Zuhilfenahme mathematischer Prinzipien findet.
Der Dichter betet den Zufall an. (Novalis)
Ich stelle mir vor, daß Inger Christensen in der Welt der Zahlen kaum weniger zu Hause war als in der Welt der Buchstaben. Immer wieder hat sie sich beim Schreiben ihrer Gedichte auf mathematische Regelsysteme eingelassen. Für den Gedichtband Alphabet verwendete sie eine Zahlenreihe, mit der der aus Pisa stammende Rechenmeister Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschrieb. In dieser Reihe bildet die Summe zweier aufeinander folgender Zahlen die jeweils nächste. Die ersten 14 Zahlen dieser Reihe, die rasch anwachsend ins Unendliche fortläuft, sind: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Ich darf einfügen, daß mir als altem Kopfrechner die Addition dieser Zahlen keine Probleme bereitet, gedichtet hätte ich auf diese Art jedoch nie. Genau das hat aber Inger Christensen getan, indem sie nach Art jener mir suspekten Mathe-Aufgaben festsetzte: es sei 1 = A, 2 = B, 3 = C, 5 = D. Sie verband also die Zahlenfolge Fibonaccis mit der uns allen bekannten Folge der Buchstaben im Alphabet und legte so fest, wieviele Zeilen jeder Abschnitt ihres Gedichts haben sollte und mit welchem Buchstaben die darin enthaltenen Dingwörter beginnen: „Die Aprikosebnäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es“ lautet in der Übersetzung von Hanns Grössel der dem Buchstaben A zugeordnete Einzeiler, dann geht es weiter mit zwei Zeilen zu B: „und farne gibt es; und brombeeren, brombeeren / und brom gibt es, und den wasserstoff, den wasserstoff“. Und so weiter bis zu den 610 Zeilen unter N, wonach der Band abbricht.
Sie merken schon an der zitierten Stelle, daß es auch zwischen den Wörtern verschiedener Sprachen Zuordnungsprobleme gibt, die das Gleichheitszeichen, das jede Übersetzung aus einer Sprache in eine andere zunächst einmal behauptet, fragwürdig machen. Während Brom und Brombeere in beiden Sprachen mit B beginnen, lauten die dänischen Wörter bregnerne für Farn und brinten für Wasserstoff ebenfalls auf B an, ihre deutschen Entsprechungen aber nicht. Man kann das nun auf zwei Arten übersetzen: Entweder man sucht andere Wörter mit B, oder man gibt die dänischen Wörter sinngemäß wieder, ohne Rücksicht auf ihren Anlaut. Da die lautliche Methode wohl zu weit weg von Sinn geführt hätte, hat sich der Übersetzer Hanns Grössel hier – wie auch später in seiner Übertragung des Schmetterlingstals – für den Verzicht auf das formale Gesetz entschieden, zugunsten der wörtlichen Bedeutungen.
Das Formgesetz, dem sie sich unterworfen hatte, brachte Inger Christensen dazu, ihr Gedicht als Fragment zu belassen. 987 Zeilen zum O zu finden unternahm sie nicht mehr, und daß schon zwei Buchstaben weiter 2584 Verse zum Q hätten gefunden werden müssen, ließ sie in kluger Selbstbescheidung auf sich beruhen. Es sei ihr in Alphabet nur um die Andeutung einer Ordnung gegangen, sagte sie in einem Gespräch ein halbes Jahr vor ihrem Tod. Liest man nun aber das so konstruierte Gedicht, dann bemerkt man, daß es darin um nicht weniger als um alles geht. Die Fülle aller Dinge scheint darin auf, fixiert in der insistierenden Formel „gibt es, gibt es“, dänisch „findes“, worin zufällig das deutsche Finden anklingt: Es gibt für uns nur das, was wir finden können. Das Gedicht versetzt in einen Rausch der Dinge. Es ist eine Inventur des Gegenwärtigen, aufgenommen 1981, als die Furcht vor einem Atomschlag allgemein war. Sie sei damals ratlos gewesen, wie es mit der Welt und mit ihrem Schreiben weitergehen solle, und habe zunächst alle Dinge, die ihr einfielen, auf einzelne Blätter notiert geordnet nach den Buchstaben des Alphabets, beschrieb die Autorin die Entstehung ihres Gedichts. Unter dem Gesetz der wachsenden Reihe (auch Kristalle bilden sich nach dem Muster der Fibonacci-Folge) ordnete sich der Zettelkasten zur endlosen, aber wohlgeformten Kette, läßt die Dinge, die es in der Welt gibt, vor uns auftauchen, bannt sie im Augenblick, da sie zu verschwinden drohen. Alphabet und Fibonacci-Reihe verbinden sich zur poetischen Weltformel, die das Universum der benannten Dinge erschließt. Die unendliche Wucherung, die in der Folge angelegt ist, verweist auf das Unabschließbare allen Ordnens und entspricht den offenen Horizonten, mit denen wir heute leben, ob wir wollen oder nicht. Das ist groß gedacht und brilliant gemacht. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich mit diesem Text ein Näheproblem. Zu sehr spüre ich beim Lesen das Konzeptuelle, Ausgeklügelte, ein Problem, das man mit experimentell erzeugter Literatur generell haben kann. Zahlen und Figuren sind nicht genug verhüllt, sie scheinen durch, sind als gefertigte Schlüssel erkennbar; fraglich, ob dies schon das Eine geheime Wort sein kann, vor dem das ganze verkehrte Wesen fortfliegt.
Was mich angeht, so hat die Dichterin dieses Wort zehn Jahre nach Alphabet gesprochen, mit dem Sonettenkranz Das Schmetterlingstal. Ein Requiem, der 1991 erschien und dem dann bis zu ihrem Tod kein neuer Gedichtband mehr folgen sollte. Auch das Sonett folgt einem ausgeklügelten Muster, bei dem Zahlen und ihre Verhältnisse eine Rolle spielen. Sie sind jedoch in ein musikalisches und architektonisches Ebenmaß gebracht und so, wie man beim Hören von Musik den Takt mitklopft, ohne ihn bewußt zu zählen, oder man den Bau einer Kathedrale betrachtet, ohne die Berechnungen des Architekten zu überprüfen, können Versmaß und Strophenbau uns beim Lesen tragen und sehend für die Bilder machen, die das Gedicht aufruft. Freilich nicht jedes Sonett, nicht jedes metrisch gebaute Gedicht kann das. Daß eine so konzeptuell arbeitende Dichterin wie Inger Christensen sich in diesem Werk auf eine so althergebrachte Form wie den Sonettenkranz einließ und ihr damit ganz neues Leben einhauchte, ist ein literarischer Glücksfall. Die meisten von Ihnen wissen aus der Schule, daß ein Sonett über 14 Zeilen verfügt, und daß es dabei bestimmte Strophenformen gibt. Die meist fünfhebigen Zeilen können unterschiedlichen Reimschemata folgen; Christensen wählt in den Quartetten den Kreuzreim, der bei Shakespeare vorherrscht, und reimt die Terzette nach den Mustern von Petrarca. Ein Sonettenkranz führt nun diese an sich schon stark reglementierte Form in einer strengen Folge von 15 Sonetten aus, bei denen das immer am Schluß stehende Meistersonett die 14 Zeilen liefert, die jeweils am Anfang und Schluß der übrigen 14 stehen. Sonett I also schließt mit der Zeile, die den Auftakt zu Sonett II bildet, dieses endet mit einem Vers, mit dem dann Sonett III beginnt usw. Hört man das Meistersonett am Schluß, sind alle darin vorkommenden Verse schon bekannt, doch erst im Wiederhören gehen sie ganz auf.
In der Übersetzung von Hanns Grössel wird dieses Formgesetz nicht wiedergegeben; seine Verse folgen dem Sinn, nicht dem Klang. Das ließ Raum, eine Nachdichtung zu versuchen, die die Sonette als Sonette wiedergibt und den Sonettenkranz aus dem Dänischen in einen deutschen Sonettenkranz überführt. Ich kann von Inger Christensens Schmetterlingstal daher nicht ganz unbefangen sprechen, weil es Teil meines eigenen Schreibens geworden ist. Als ich 1998 in Amsterdam meine Nachdichtung verfaßte, die bislang lediglich in Heft 52 der Zeitschrift Schreibheft nachlesbar ist, war ich auf Hanns Grössels Übersetzung angewiesen, da ich nicht nur keine Mathematik, sondern auch kein Dänisch kann. Ich stützte mich außerdem auf ein zweisprachiges Wörterbuch sowie auf den Vortrag des Gedichts durch die Dichterin, den ich mehrfach erleben durfte und der mir aus ihrem Mund auch in der ungereimten Fassung fast schon so gereimt klang, als könnte ich nun nach Diktat schreiben. Mittlerweile habe ich ehrlich gesagt etwas das Gefühl dafür verloren, was von wem ist, da ich nun vor allem meine Fassung kenne. Bitte hören Sie daraus Sonett I.
Da steigen sie, die Falter des Planeten
Wie Farbenstaub vom Leib der Erde warm
Zu Ocker-, Gold-, Zinnober-, Phosphorfêten
Erhebt ein Grundstoff, chemisch, ihren Schwarm.
Kann denn dies Flügelflimmern, diese Schar
Von Lichtpartikeln, nur Erscheinung sein?
Geträumte Sommerstunde, die die Kindheit war
Zersplittert zeitverschobner Blitze Schein?
Nein, es ist Luzifer, der malt sich ganz
In schwarz wie ein Apollo mnemosyne
Als Feuervogel oder Schwalbenschwanz.
Umschleiert seh ich sie, weil mein Verstand verpufft
Wie Federn leicht auf einer Wärmedüne
In des Brajĉinotales heißer Mittagluft.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen beim Hören so gegangen ist, wie ich mir wünsche, daß es Ihnen gegangen sein könnte. Nämlich so, daß Sie auf den Bau des Gedichts nur nebenher gehört, dafür aber eine Unzahl von Schmetterlingen vor sich gesehen haben. Ich wünsche mir, daß Sie Flügelflimmern und Lichtpartikel wahrgenommen haben und die Sommerstunden Ihrer eigenen Kindheit heraufsteigen sahen. Wenn auch nicht jeder unter Ihnen schon vorher wußte, was ein Sonettenkranz ist, so wissen Sie doch alle, was Schmetterlinge sind. Sie sehen sie vor sich, wenn Sie nur das Wort „Schmetterling“ hören, wobei jeder etwas andere Schmetterlinge vor sich sieht. Zitronenfalter oder Kohlweißlinge sind die verbreitetsten und diejenigen, die die meisten von uns am sichersten bestimmen können, wenn wir ihnen in der Natur begegnen. Dann könnten uns Pfauenaugen einfallen, vielleicht der Admiral oder wie sie alle heißen, aber da wird es schon schwierig: Nicht für jedes Bild, das wir von Schmetterlingen haben, fällt uns ein Wort ein, andererseits kennen wir viele Namen von Schmetterlingen wie auch von Vögeln oder von Pflanzen, ohne daß wir in der Lage wären, sie in der Natur zu erkennen. Wunderbare Bestimmbücher gibt es, in denen alle Arten von Tieren und Pflanzen abgebildet und beschrieben sind, aber die stehen meist zu Hause und werden an langen Winterabenden aufgeschlagen, wenn nirgendwo draußen ein Schmetterling flattert. Ist man dann aber wieder im Frühling und in der Natur und wird vom ersten Erscheinen der Falter neu überrascht, dann ist nie ein Buch zur Hand – bei mir ist das zumindest so. Damit wäre ich als Naturforscher ungeeignet, aber für jemanden, der Gedichte schreibt, ist es von nicht geringem Vorteil, denn so muß ich Bilder und Worte immer neu miteinander ins Spiel bringen. In Sonett XIII liefert Inger Christensen dafür die Formel:
Verschmelze die Erscheinung mit dem Wort.
Das ist eine treffende Beschreibung dessen, was beim Schreiben wie beim Lesen eines Gedichts idealerweise passiert, bezeichnet aber auch ganz allgemein die unablässige Tätigkeit des Bewußtseins, Sinn zu schaffen aus der Überfülle der Informationen, der wir ausgesetzt sind.
Wenn man die Bilder, die jeder von uns von Schmetterlingen im Kopf hat, fotografieren und per Mausklick weitersenden könnte, würden zu den bisher beschriebenen 180.000 Arten der Lepidoptera wahrscheinlich etliche neue hinzukommen. Aber bin ich froh, daß man das bisher noch nicht kann, denn wenn ein solcher bildlicher Gedankentransfer möglich wäre, dann hätte die Welt wohl endgültig einen Zustand erreicht, in dem ich ihr Einwohner nicht mehr sein möchte. Vorerst bleibt es dabei, daß unsere inneren Bilder sprachlich geformt sind und die Sprache – in den Worten Wilhelm von Humboldts – „das bildende Organ des Gedanken“ ist; es bleibt bei der erstaunlichen Leistung von Worten, die Dinge der Welt so zu bezeichnen, daß sie einerseits unseren privaten Vorstellungen, andererseits aber einem gemeinschaftlichen Begriff unterstehen; daß wir in Worten kommunizieren können, ohne unsere eigentümlichen Vorstellungen von der Welt einzuebnen. Bleiben wir noch kurz beim Wort Schmetterling. Schon seine Übersetzung in andere Sprachen zeigt, daß in den Ausdruck für diese uns allen vertraute Erscheinung Nebenbedeutungen eingeschmolzen sind, die aus der jeweiligen Sicht der Sprachgemeinschaft stammen. Kaum jemandem unter Ihnen wird bewußt sein, daß das Wort Schmetterling im Deutschen mit dem Schmand verwandt ist, dem Rahm, an den die Schmetterlinge gehen und von dem man sie fernhalten muß, wenn man den Rahm für ich behalten will (sie haben also gar nichts mit Schmettern zu tun, was auch seltsam wäre). Auch im englischen butterfly klingt diese Bedeutung noch an, während das dänische sommerfugle wörtlich Sommervogel bedeutet und damit rein auf das Beglückende dieser Naturerscheinung in der wärmsten Zeit des Jahres Bezug nimmt und den Kampf um die Süßspeise außen vor läßt. In meiner Nachdichtung habe ich sommerfugle jedoch oft gar nicht durch Schmetterling, sondern durch Falter wiedergegeben (was von Flattern kommt und mit dem Falten der Flügel nichts zu tun hat). Dies geschah um der Kürze willen, es spart eine Silbe, die man oft genug dringend braucht, um das Versmaß zu halten: „Da steigen sie, die Falter des Planeten“ ist ein ebenmäßiger Vers, mit Schmetterling kann man ihn nicht bauen. Während ich aber davon ausgehe, daß wir mehr oder weniger ähnliche Bilder vor uns sehen, ob wir nun Schmetterling, Falter, butterfly oder sommerfugle sagen, so ändert sich mit der Entscheidung für ein Wort das lautliche Gefüge im Gedicht. Durch das Wort Falter entsteht in meiner Nachdichtung von Sonett I ein Assonanzgefüge, das mit Farbenstaub, Phosphorfeten, Flügelflimmern fortgesetzt wird und für die von den Worten ausgehenden Gemütswirkungen nicht ohne Bedeutung ist.
Die Gleichung oder eher Ungleichung, die zwischen einem Gedicht und seiner Übersetzung besteht, ist bis ins Kleinste hinein kompliziert, und falls jemand dafür je eine mathematische Formel fände, wäre ich erstaunt. Andauernd muß man – wenn man sich denn zum Ziel gesetzt hat, die Schallform des Gedichts möglichst analog nachzubilden – Entscheidungen treffen, die kleine semantische Verschiebungen bedeuten. So fällt beim Vergleich von Hanns Grössels und meiner Übersetzung von Sonett I auf, daß es für mich Gründe gab, das dänische indbildt nicht mit Einbildung, sondern mit Erscheinung wiederzugeben. Wieder ist der Grund der Rhythmus: „Kann denn dies Flügelflimmern, diese Schar von Lichtpartikeln nur Einbildung sein?“ wäre nicht gegangen, da die Einbildung mit einer Hebung beginnt, die ich an dieser Stelle nicht gebrauchen kann. „Erscheinung“ ist zunächst etwas anderes als „Einbildung“, aber „nur Erscheinung“ drückt das Illusionistische ebenfalls aus. Während diese Ersetzung unproblematisch war, wäre ich an einem anderen Problem in Sonett I beinahe gescheitert. Das Dänische hat nämlich die charmante Eigenart, die Vernunft, die auf Dänisch vernuft heißt, auf Duft und Luft zu reimen. Einen solchen in der Sprache liegenden Effekt, der wie von selbst die romantische Synthese von Verstand und Gefühl ausdrückt, darf man nicht opfern – aber unrein reimen darf man in einem solchen Gedicht eben auch nicht. Meine Lösung fiel mir zu, als ich fast hingefallen war, nämlich als ich im Vondelpark in Amsterdam über eine Wurzel stolperte.
Umschleiert seh ich sie, weil mein Verstand verpufft
Wie Federn leicht auf einer Wärmedüne
In des Brajĉinotales heißer Mittagluft.
Gelegentlich aber muß der Nachdichter Opfer bringen und aus der Fülle der benannten Dinge eine Auswahl treffen. So fand sich für poppelfugl, den Pappelvogel, kein Platz mehr zwischen Feuervogel und Schwalbenschwanz. Seitdem habe ich mir Buße aufgetragen und mir vorgenommen, diesen Schmetterling einmal in einem Gedicht von mir zu verewigen. Gelungen ist mir das noch nicht. Seit der Arbeit am Schmetterlingstal sind zwar einige Gedichte entstanden, in denen es Kohlweißlinge gibt, Zitronenfalter, Pfauenaugen. Die Stunde des Pappelvogels aber ist noch nicht gekommen.
Daß ich durch die Vertiefung in Inger Christensens Schmetterlingstal gleichsam selbst auf den Falter gekommen bin, hat nichts damit zu tun, daß ich Interesse hätte, nun ein bestimmtes Wortfeld oder Motivgebiet zu kultivieren.
Es hat mit einer Erkenntnis zu tun, die nicht gleich bei der Arbeit an dieser Nachdichtung, sondern erst allmählich wirklich bis zu mir vordrang, obgleich sie in etlichen der Verse unmittelbar zu greifen ist. Schmetterlinge sind Seelenvögel, „Sommerahnung von verschwundnen Toten“, sind durch ihre Metamorphose, ihren Zyklus, der aus der Raupe eine sich selbst einspinnende Puppe und aus der Puppe den geschlüpften Schmetterling hervorgehen läßt, seit der Antike Sinnbilder für die Seelenwanderung und die Unsterblichkeit, freilich damit auch immer Erinnerer an den Tod. Das altgriechische Wort für Schmetterling ist psyche, ist gleichbedeutend mit Hauch, Atem, Seele. Das Schmetterlingstal: Ein Requiem. Inwieweit Inger Christensen für ihre Faltergedichte aus der Anschauung oder aus dem Bestimmbuch, aus dem Studium der Kulturgeschichte oder aus eigener Trauer die Meditationen über jene Erscheinungen schöpfte, die sie mit ihren Worten verschmolz, kann ich nicht wissen, in dem halben Dutzend unserer Begegnungen habe ich sie das nie gefragt und hätte darauf wohl auch keine Antwort erhalten. Seit ich mit ihren Gedichten diesen nahen Umgang hatte – und das Übersetzen ist ja die intensivste Form der Lektüre überhaupt –, kann ich jedoch keinem Schmetterling mehr begegnen, als sei er nur ein buntes flatterndes Insekt, das an den Rahm will. Sie bringen mir Nachricht von meinen Toten oder vom Tod überhaupt. Sie kennen mich von früher und sie wollen etwas von mir, und ich erkenne sie wieder, es sind immer dieselben, die vor mir herflattern, im letzten Sommer war es wieder so und eine noch unbestimmte, aber endliche Reihe von Sommern wird es noch so sein. Sie suchen mich in den Tälern heim, an Feldwegen, an Baustellen. Sie können mit einem gewissen Recht sagen, daß dies ein ziemlich unvernünftiges Gefühl sei, keine Erkenntnis. Sommerahnung, Einbildung, Erscheinung. Es gehört aber zu den Dingen, die Gedichte mit einem machen, wenn man sich auf sie einläßt und sie einen nicht mehr loslassen. Gemütserregungskunst. Wenn man sich den Sonetten Inger Christensens öffnet, wenn man ihren kunstvoll konstruierten Bau als etwas Tragendes, nicht aber als die Sache selbst nimmt, dann kann man bei aller Leichtigkeit und Helligkeit der darin aufscheinenden Bilder eine Trauer empfinden, die ganz persönlich und ganz allgemein ist und einen Trost, der diese Trauer nicht aufhebt, aber mildert, weil sie in den Gedichten so schwerelos ausgesprochen wird. „Was man spürt, wenn man ein Gedicht liest, sind die Bewegungen des Gemüts. Nicht nur das Gemüt des Dichters und nicht nur das eigene, sondern beide im Gedicht vermischt, als wäre das Gedicht das Neutrum des Gemüts“, schreibt Inger Christensen in dem Essay „Der Geheimniszustand“. In ferner Verwandtschaft zu Novalis’ den Tod durchleuchtenden Hymnen an die Nacht hat sie mit diesem Zyklus ein lichtes Gegengewicht geschafften. Hören Sie zum Schluß noch Sonett XV, das Meistersonett.
Da steigen sie, die Falter des Planeten
In des Brajĉinotales heißer Mittagluft
Aus ihrem bittern Erdloch hochgebeten
Hat sie das Berggebüsch, mit seinem Duft.
Als Bläuling, Trauermantel, Admiral
Als Pfauenauge flattern sie umher
Und taumelnd tun sie so, als ob im All
Ein Leben wäre und nichts stürbe mehr.
Was für ein Seelenzauber wird mir hier geboten
Mit Friedensanhauch, der mich süß betrügt
Und Sommerahnung von verschwundnen Toten?
Mir sagt mein Ohr mit seinem tauben Klingen:
Das ist der Tod, der dich mit Augen blickt
Im Flügelschlag von allen Schmetterlingen.
Norbert Hummelt, aus Michael Buselmeier (Hrsg.): „die aprikosenbäume gibt es“. Zum Gedenken an Inger Christensen, Verlag Das Wunderhorn, 2010
Das verlorene Paradies
– Die dänische Dichterin Inger Christensen. –
Das Paradies, so heißt es im zweiten Schöpfungsbericht des Alten Testaments, ist ein äußerst fruchtbarer Garten in Eden, ein irgendwo im Osten gelegener, mythischer Ort, an dem der Mensch und die Natur noch in organischer Verbundenheit lebten. Das Wort „Paradies“ ist aber eigentlich altpersischen Ursprungs, und es bezeichnet einen eingezäunten Garten, der von einer Sandwüste umgeben ist, wo das Leben keine Chance hat. Hin und wieder, so will es der altpersische Mythos, kam es vor, daß der Mensch in diesem Teil der Welt in die Wüste hinausging, um sich ins Gebet zu versenken. Gemeinsam ist aber dem biblischen Schöpfungsbericht und dem persischen Mythos das schockhafte Wissen um die Vertreibung des Menschen. Adam und Eva, die ersten Menschen, hatten von den verbotenen Früchten des Baumes der Erkenntnis gegessen und wurden aus dem Garten Eden, wo das Sein der Menschen noch ungestört in die Natur einging, in die unwirtliche Welt, in die Wüste vertrieben.
Sich an solchen biblischen Schöpfungsberichten faszinieren zu lassen, haben wir transzendental ausgenüchterten Zeitgenossen uns schon lange abgewöhnt. So bleiben die Erzählungen vom Ursprung, die mythischen Offenbarungen des Anfangs, die Berichte vom kosmischen Werden und die Ahnungen des planetarischen Endes weiterhin den Dichtern vorbehalten – sofern sie noch Dichter sein wollen. Zum Glück gibt es noch solch originäre Dichter, die auf die magische Wirkung ihrer poetischen Fügungen vertrauen; Dichter wie die dänische Lyrikerin Inger Christensen, deren poetisches Werk von den innersten Geheimnissen und tiefsten Rätseln der Schöpfung spricht.
Lange, sehr lange hat es gedauert, bis die einzigartige Dichtung der Inger Christensen den deutschsprachigen Raum erreicht hat. Bis vor wenigen Jahren war die mittlerweile 62jährige Autorin außerhalb Dänemarks nur einem kleinen Kreis von Skaninavisten bekannt; eine Folge vielleicht auch einer Befangenheit vor dem Dänischen, dem selbst ein Hans Magnus Enzensberger schon Unübersetzbarkeit attestiert hat. Um so höher ist die Übersetzungsleistung von Hanns Grössel zu bewerten, der schon seit dreißig Jahren das Œuvre Inger Christensen begleitet und für den Münsteraner Kleinheinrich Verlag ihre Hauptwerke in absolut verläßlichen Versionen übertragen hat.
Seit 1988 erschienen im Kleinheinrich Verlag sechs zentrale Werke Inger Christensens, vom Opus magnum alphabet bis hin zum jüngsten Buch der Autorin, dem Sonettenkranz Das Schmetterlingstal. Dank der vorbildlichen Editionspraxis des Kleinheinrich Verlags, und dank einiger kundiger Essays in der Literaturzeitschrift Schreibheft hat das Werk der Autorin den Weg aus den elitären Lyrik-Zirkeln heraus ins Freie einer zunehmend begeisterten Öffentlichkeit gefunden. Im Residenz Verlag hat der österreichische Dichter Peter Waterhouse eine sehr subjektive und fragmentarische, gleichwohl überzeugend montierte Auswahl aus den Gedichten, den Essays und der lyrischen Prosa Inger Christensens zusammengestellt, die in die ästhetischen Kernzonen dieses Werks hineinführt. In einem poetischen Essay, der in der Literaturzeitschrift manuskripte nachzulesen ist, hat Waterhouse seine Christensen-Lesart in einer sehr enthusiasmierten Charakteristik ihrer Poesie preisgegeben:
Sie spricht, … damit nicht Fortschritt komme, sondern Vereinigungen; die Wörter berühren einander, die Dinge berühren einander… Sie fabuliert, das heißt, erfindet, ermöglicht, erträumt; sie fabuliert, sie stellt nicht fest, sondern unterstützt die Schöpfung, sie erfrischt, sie hilft der Welt in ihrem Dasein.
Diese von Emphase überbordenden Sätze führen zurück zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung: Sie zeigen Inger Christensen als Paradiessucherin, als Erfinderin von Schöpfungsgeschichten. Tatsächlich hat sich die Autorin in ihren Vorlesungen und Essays immer wieder explizit auf den biblischen Ursprungsmythos rückbezogen. Die Erinnerung an das verlorene Paradies ist dabei für die Autorin keine zufällige Bildungsreminiszenz, sondern offenbart sich als Urszene ihrer poetischen Sehnsucht. Diese Sehnsucht nach dem ungeschiedenen Dasein, nach der Wiederherstellung der Einheit von Körper und Welt, Sprache und Natur ist die Antriebskraft ihres Schreibens, das sich in großen epischen Gedichten und mächtigen Sprachschöpfungen entfaltet hat.
„Worum ich kreise“, heißt es in dem poetischen Essay „Unsere Erzählungen von der Welt“, „sind Zusammenhänge und Unterschiede zwischen allen Geschöpfen auf der Erde“. Es ist dies ein im buchstäblichen Sinn romantischer Impuls: Wie der Romantiker Friedrich von Hardenberg alias Novalis, der für sie zur zentralen literarischen Bezugsfigur geworden ist, begibt sich Inger Christensen in ihren Gedichten auf die unabschließbare Suche nach dem goldenen Zeitalter, nach dem verlorenen paradiesischen Raum, der uns aus dem unwirtlichen Dasein erlöst.
Es ist einzig der Dichter, so sagt Inger Christensen in einer Vorlesung über „die ordnende Kraft des Zufalls“, der eine solche Suchbewegung ausführen kann; er versucht „zum paradiesischen Zustand der Sprache vorzudringen, wo Schriftsteller und Sprache verschmelzen, obwohl er am Ende immer wieder aus dem Paradies vertrieben wird, das er – so empfindet er es – ganz aus sich selbst geschaffen hat“.
Diese romantische Verschmelzungssehnsucht grundiert schon die Anfänge von Inger Christensens Poesie. 1935 in Vejle, einer Küstenstadt im Osten Jütlands, als Tochter eines Schneiders geboren, hat Inger Christensen Anfang der sechziger Jahre ihre ersten beiden Gedichtbände unter dem Titel Lys (Licht) und Graes (Gras) veröffentlicht. Schon in diesen frühen Gedichten spürt man den starken Wunsch nach einem inständigen Benennen der elementaren Phänomene der Natur. Die gleichförmigen Ebenen und horizontalen Weiten ihrer Heimat, deren Pflanzen- und Tierwelt, der Strand und das Meer, und nicht zuletzt die schneereichen Winter bestimmen die Topographie dieser frühen Gedichte. Aber der Weg zu den mit naturwissenschaftlicher Präzision konstruierten Großgedichten ist noch weit. In Århus absolvierte Inger Christensen zunächst ein Lehrerseminar, später studierte sie Medizin, nebenbei ein bißchen Chemie und Mathematik und arbeitete einige Jahre an einer Kunsthochschule. Mitte der sechziger Jahre kommt es dann zu jenem künstlerischen Erweckungserlebnis, dem wir die epochalen Großgedichte Es und Alphabet verdanken: Zu produktiven „Stolpersteinen“ werden für Inger Christensen die Thesen ihres schwedischen Lyrikerkollegen Lars Gustafsson über „das Problem des langen Gedichts“ und die Grammatik-Theorie des Linguisten Noam Chomsky.
Chomskys Idee von einer „angeborenen Sprachfähigkeit“ und seine Annahme universaler Regeln der Satzkonstruktion und unendlich generierbarer Sätze löste in Inger Christensen eine ästhetische Revolution aus:
Diese Sprachsicht Chomskys gab mir ein phantastisches Glücksgefühl. Eine unbeweisbare Gewißheit, daß die Sprache eine direkte Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe „Recht“ hatte, zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben. Wenn ich nur ganz still beginnen, mich in die ersten Sätze einschleichen könnte, mich dort wie in Wasser verstecken, fließend, davontreiben, bis die ersten kleinen Kräuselungen sich zeigten, fast Wörter, fast Sätze, immer mehr.
Ganz still beginnen, sich den organischen Zusammenhängen der Natur wie selbstverständlich anschmiegen, poetische Mimesis der Schöpfung betreiben: Das ist das poetische Organisationsprinzip der Großgedichte Es und alphabet, die in Dänemark als exemplarische Texte für moderne „Systemdichtung“ gelesen wurden. Es ist in der Christensen-Rezeption immer wieder auch darauf hingewiesen worden, daß diese Gedichte ganz strengen Kompositionsprinzipien folgen, die mathematischen Modellen entlehnt sind. Das Schöne und gänzlich Verblüffende dabei ist, daß diese wunderbar suggestiven Gedichte an keiner Stelle Gefahr laufen, als verkrampfte sprachexperimentelle Exerzitien mißverstanden zu werden.
Auch der Glaube an das symbiotische Verhältnis von Mathematik und Dichtung ist ja ursprünglich ein romantisches Motiv, das Inger Christensen bei Novalis entlehnt hat. „Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte“, schreibt Novalis in seinem „Monolog“ aus dem Jahr 1798,
daß es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei. – Sie machen eine Welt für sich aus – sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll – eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnisspiel der Dinge.
Als eine lyrische Litanei über „das seltsame Verhältnisspiel der Dinge“ kann auch das Großgedicht alphabet gelten, jene poetische Schöpfungsgeschichte der Welt, in der noch einmal die Natur und die Menschenwelt in all ihren wundersamen Einzelheiten aufgerufen werden – und in der auch die drohende Verwüstung dieser Welt evoziert wird. Der poetische Organismus dieses Textes scheint sich in geheimnisvoller ästhetischer Eigendynamik herzustellen, ohne daß es genauerer Kenntnisse darüber bedürfte, was denn zum Beispiel eine „Fibonacci-Folge“ ist.
Auf der Suche nach einer formalen Struktur, die ihr das Inventarisieren der Welt in einem poetischen alphabet ermöglicht, stieß Inger Christensen Mitte der siebziger Jahre auf jene „Fibonacci-Folge“, eine nach dem italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci benannte Zahlenreihe, bei der sich jedes Glied der Reihe aus der Summe der beiden vorangehenden Zahlen errechnet. Im alphahet bestimmt diese Fibonacci-Folge Versmaß und Strophenlänge. Was ist nun das Wunderbare, das dieses alphabet zu einem epochalen Werk zeitgenössischer Dichtung und außerdem zu einem großen Hörerlebnis macht? Es ist der leise, zarte eigentümlich singende Tonfall der Autorin, der uns in zuerst knappen, dann immer weiter ausgreifenden Sequenzen die Natur und die Dinge der Menschenwelt heraufruft. Der erste, sich in einer Art Beschwörung wiederholende Vers im alphabet – „die Aprikosenbäume gibt es / die Aprikosenbäume gibt es“ – zieht immer mehr welthaltige Wörter aus dem Ungesagten ins Gedicht, das eine immer stärkere Sogwirkung entfaltet:
1
Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es
2
Die Farne gibt es; und Brombeeren, Brombeeren
und Brom gibt es; und den Wasserstoff, den Wasserstoff
3
Die Zikaden gibt es; Wegwarte, Chrom
und Zitronenbäume gibt es; die Zikaden gibt es;
die Zikaden, Zeder, Zypresse, Cerebellum
4
Die Tauben gibt es; die Träumer, die Puppen
die Töter gibt es; die Tauben, die Tauben;
Dunst, Dioxin und die Tage; die Tage
gibt es; die Tage den Tod; und die Gedichte
gibt es; die Gedichte, die Tage, den Tod
So wächst allmählich das Gedicht, entfaltet sich nach Maßgabe des Alphabets und der Fibonacci-Folge in immer größeren Sequenzen; jeder Gedichtteil wiederholt das poetische Gewicht der beiden vorangegangenen Teile und gibt ihnen Dauer über sich hinaus. Die Fibonacci-Strukturierung bliebe rein abstrakt und willkürlich, wäre da nicht die Entdeckung, daß die Zahlen dieser Folge exakt bestimmten Wachstumsprozessen bei einigen Pflanzenarten entsprechen.
Fibonacci – Prozesse finden sich auch in Kristallbildungen, im Geäst der Bäume oder in Blumen. Sprache als direkte Verlängerung der Natur: diese Erfahrung teilt sich im alphabet der Inger Christensen unmittelbar mit. Die sprachmagische und pantheistische Weltsicht, die sich hier artikuliert, kehrt wieder in den Essays „Die Sieben des Würfels“ und „Unsere Erzählung von der Welt.“ Auch hier kreist der Diskurs um die autopoetische Selbsterzeugung von Welt und Dichtung, um die strukturgleichen Bewegungsgesetze von Natur und Kunst:
Ich muß mir vorstellen, daß die Erde die Macht besitzt. Ich muß mir vorstellen, daß sie ihre physische chemische Grundlage ins Gleichgewicht gebracht hat, ehe sie sich daran gemacht hat, das zu schaffen, was sie nach wie vor erschafft, nämlich Produkte, die das produzierende Prinzip reproduzieren, z.B. Kastanienbäume oder Menschen.
Ich muß mir vorstellen, daß die Menschheit auf eine gemeinsame Bildersprache zu tendiert, die diese Macht und ihre natürlichen Gleichgewichtszustände ausdrücken kann. Daß der einzelne Mensch, ungestört, ein Spiegel des irdischen Zustands ist und daß Menschen in Gemeinschaft ein chemisches Gedicht zu Ehren der Erde und ihrer Sonne sind.
Auch hier wird also das Loblied auf die Schöpfung gesungen, die Hymne auf das Biologische, das Lied auf „die Macht der Erde“. Gleichzeitig weiß die Dichterin um die massive Bedrohung aller biologischen Lebensgrundlagen, und daß „Menschen in Gemeinschaft“ nur idealiter „ein chemisches Gedicht zu Ehren der Erde“ darstellen, in der Praxis unserer Lebenswelten aber meist als gedankenlose Ressourcenvernichter und willige Gewalt-Vollstrecker auftreten.
So begegnen wir bei Inger Christensen auch unvermeidlich jener negativen Chiffre für unsere menschliche Existenz, die als Schlüsselwort unseres Zeitalters gelten kann: Wir lesen, z.B. in den Notaten des Essays „Reden, sehen, tun“, von der Angst, die alle Bereiche des Daseins durchdrungen hat. Inger Christensen beruft sich in ihrer Beschwörung der Angst auf den schwedischen Dichter Gunnar Ekelöf; sie hätte auch den großen englischen Dichter Wystan Hugh Auden zitieren können, der vom 20. Jahrhundert als dem „Zeitalter der Angst“ gesprochen hat.
Natürlich ist eine Poetik der Angst auch nicht zu denken ohne den Rekurs auf den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, der mit seiner Schrift „Der Begriff Angst“ am Anfang der europäischen Existenzphilosophie steht.
Als poetische Leitvokabel ist die Angst im „Epilogos“ des Gedichts Es allgegenwärtig; es ist eine Angst, die alles in ihren Bannkreis zieht, die alle Gefühle und Lebensregungen lähmt und auch die menschlichen Beziehungen zu torpedieren droht. Es gibt nur ein Gegenmittel, mit dem man sich dem eisernen Klammergriff der Angst zumindest für einige Augenblicke entwinden kann: Es ist die Poesie, die aus den Zwangszusammenhängen der Angst herausführt, die „Antistoffe“ zur „Heilung“ bereitstellt.
Inger Christensen findet hier in lyrischem Predigtton zum Begriff der „Gnade“:
Worte könnten es sein
die der Welt
Gnade brächten
die Angst formulierten
so daß jeder einzelne
in seiner Angst
wüßte daß er zwar
allein in der Welt ist
zwar allein ist
mit seiner Angst
aber nie allein
mit seinem eignen Bewußtsein
von der Angst
von der Welt
Worte könnten es sein
der Stoff den wir ohnehin
miteinander teilen
der Stoff der das Gemüt
und die Sinne
erweitern kann
könnten Worte sein.
In Anknüpfung an solche markanten Motive von Schöpfungsinnigkeit und Daseinsangst, von Gnade und Heil hat Peter Waterhouse im Nachwort zu seiner Auswahl auf die religiösen Wurzeln dieser Poesie hingewiesen: „Das ist eine Religion, eine Re-membrierung.“ Religion wäre hier im Sinn des lateinischen Wortes „religio“ zu verstehen: eine Bindung des Menschen, des Denkens und der Sprache an etwas, das größer ist als der Mensch: eine Bindung an die Kräfte der Erde, in denen das Göttliche anwesend ist. Die „Re-membrierung“ wiederum, von der Waterhouse in einem poetischen Neologismus spricht, meint die Rückerinnerung oder „Wiedererinnerung“ dieser Poesie an die ursprüngliche Einheit und Integrität der Natur, an das Ungeschiedensein.
Es macht die große Kunst von Inger Christensens Poesie aus, daß sie immer wieder das einfache und starke Pathos des Staunens vor den Phänomenen der Natur aufzurufen vermag: Das also gibt es! Die Aprikosenbäume gibt es, und wir haben es noch nie richtig bemerkt! Und erst der Vers über die Aprikosenbäume öffnet uns den Blick, und es gelingt uns – im Idealfall –, die Dinge anzuschauen, als wäre es das erste Mal. Und das Staunen darüber, daß es die Aprikosenbäume gibt, wird zum Sprechen über ein Wunder.
Auch Inger Christensens jüngstes Werk, der streng-klassische Sonettenkranz Das Schmetterlingstal, ist eine von Staunen und auratischer Erfahrung beseelte Schöpfungsgeschichte. Die Regel des Sonettenkranzes will es, daß die ersten vierzehn Sonette die Schlußzeile des vorangehenden Sonetts als Anfangszeile aufnehmen – so daß eine Ringkomposition entsteht. Das 15. und letzte Sonett, das sogenannte „Meistersonett“, zieht die lyrische Summa des ganzen Zyklus – und resümiert im vorliegenden Fall das Werden und Vergehen kreatürlichen Lebens.
In einem südlichen Tal, dem Brajcinotal, erscheinen die einzelnen Schmetterlingsarten, und werden in elegischer Beschwörung als Verkörperungen von Leben und Tod angerufen. Das Gedicht selbst wird zum Abwehrzauber gegen den Tod. Im poetischen Schmetterlingstal kommen die Phänomene der Natur und die Sprache noch einmal zusammen – in einem Requiem, einem Abschied.
Die Tore zum Paradies scheinen wieder offen – und die Sehnsucht, die Vertreibung aus dem Paradies rückgängig zu machen, scheint sich zu erfüllen. Aber das poetisch heraufgerufene Paradies ähnelt am Ende nicht mehr dem Garten Eden, sondern dem Garten eines Friedhofs:
Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten,
wie Farbenstaub vom warmen Körper der Erde,
Zinnober, Ocker, Gold und Phosphorgelb,
ein Schwarm von chemischem Grundstoff hochgehoben.
Dieses Flügelflimmern – ist es nur eine Schar
von Lichtteilchen in einem Gesicht der Einbildung?
Ist es die geträumte Sommerstunde meiner Kindheit,
zersplittert wie in zeitverschobenen Blitzen?
Nein, es ist der Engel des Lichts, der sich selbst
als schwarzen Apollo mnemosyne malen kann,
als Feuervogel, Pappelvogel und Schwalbenschwanz.
Mit meiner umschleierten Vernunft sehe ich sie
wie leichte Federn im Pfühl des Hitzedunstes
in der mittagsheißen Luft des Brajcinotals.
(…)
Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten,
in der mittagsheißen Luft des Brajcinotals,
aus der unterirdisch bitteren Höhle herauf,
die das Berggebüsch mit seinem Duft verdeckt.
Als Bläuling, Admiral und Trauermantel,
als Pfauenauge flattern sie umher
und gaukeln dem Toren des Universums ein Leben
vor, das nicht wie nichts stirbt.
Wer ist es, der diese Begegnung verzaubert
mit Anflügen von Seelenfrieden und süßen Lügen
und Sommergeschichten verschwundener Toter?
Mein Ohr antwortet mit seinem tauben Klingen:
Es ist der Tod, der dich mit eigenen Augen
vom Schmetterlingsflügel aus anblickt.
Michael Braun, die horen, Heft 189, 1. Quartal 1998
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + IMAGO
Nachrufe auf Hanns Grössel: Übersetzen ✝︎ FAZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


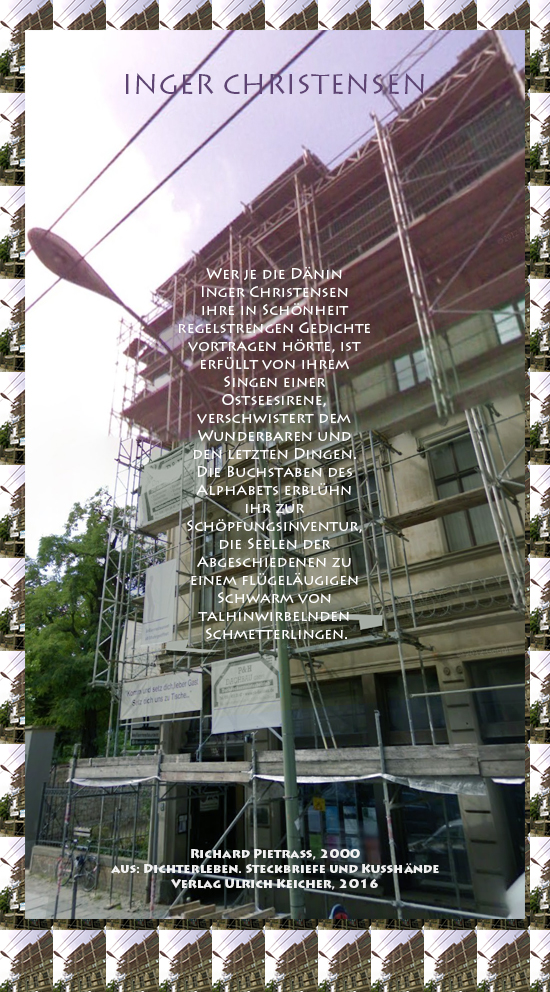












Schreibe einen Kommentar