Inger Christensen: det / das
DIE BÜHNE variabilitäten
5
Meine welt ist diskontinuierlich
aaaaaaaaaaim verhältnis zur welt im großen
aaaaaaaaaaund im verhältnis zu dir
aaaaaaaaaasie hat flügel
Meine welt ist eine sprache durch wasser
aaaaaaaaaamit den leuchtenden nerven verteilt
aaaaaaaaaawie wenn die sonne im wasser zufällig großzügig
aaaaaaaaaaDennoch hat sie flügel
aaaaaaaaaaFlügel aus Wasser
Und ich will dir sagen daß es eine gewisse wirkung hat
aaaaaes hat eine gewisse prickelnde wirkung
aaaaaein jubel über den mangel an ursache
aaaaaSpring sagt die welt und ich fliege
So ertränke ich meine welt in der welt
Herr Sade und das gefesselte
Einige Leute, die etwas von Poesie verstehen, halten Inger Christensen für eine veritable Nobelpreis-Kandidatin. Vielleicht steht sie ja auch schon in Stockholm auf der Liste. Daß sie die größte Poetin ist, die Dänisch schreibt, weiß man in ihrer Heimat seit über drei Jahrzehnten, spätestens seit ihrem Großgedicht det (das) von 1969. Endlich – gut drei Jahrzehnte später – liegt dieses Hauptwerk der europäischen Poesie auf Deutsch vor. Daß Inger Christensen bei uns überhaupt bekannt wurde, ist das Verdienst eines kleinen Verlages und eines engagierten Übersetzers.
Hanns Grössel hat für den Münsteraner Verlag Kleinheinrich sukzessive die wichtigsten Arbeiten der Christensen übersetzt. Den Bann dürfte 1988 Das gemalte Zimmer gebrochen haben, eine ingeniös-phantastische Erzählung, angeregt durch die Mantegna-Fresken im Palazzo Ducale in Mantua. Die größte Suggestion aber ging von alphabet (deutsch 1988) aus, einem Langgedicht, das mathematische und linguistische Bauprinzipien faszinierend kombinierte. Mit alphabet kam ein Impuls zur Vollendung, den Christensens Begegnung mit Chomskys Sprachtheorie ausgelöst hatte. Sie hatte den Charakter einer Initiation und gab der Poetin die „unbeweisbare Gewißheit, daß die Sprache die unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe Recht hatte zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.“ Dieses Glücksgefühl war der Antrieb zu ihren Großgedichten.
Gleich das erste dieser Poeme wurde ein außerordentlicher Erfolg. Die 15.000 Stück der Erstauflage von det wurden schnell verkauft. det gilt als ein Hauptwerk der dänischen „Systemdichtung“. Der Begriff allein könnte auf Kulinarik erpichten Leser abschrecken. Das dänische Publikum aber muß dieses Gedicht als bedeutend und unmittelbar aktuell empfunden haben. Kurz: hier war jenes lange Gedicht, um das damals die Wünsche und Reflexionen von Dichtern und Theoretikern kreisten. Lars Gustafsson suchte nach Kategorien, mit deren Hilfe das Gedicht den Kampf gegen die eigene Länge gewinnt. Walter Höllerer forderte das lange Gedicht, das die Republik erkennbar macht, die sich befreit. Man weiß, was aus dieser Hoffnung wurde. Als 1978 Enzensbergers Untergang der Titanic erschien, war das ein melancholischer Abgesang auf die politische Utopie.
Anders Inger Christensens det. Es ist vor allem strukturell ein großgedachter Entwurf, ein Weltgedicht mit Allusionen zu Dantes Divina Commedia. Auch die Dichterin empfindet sich „Nel mezzo del cammin“ und spielt mit Prologos, Logos und Epilogos auf Dantes Dreizahl an. Ihre heilig-magische Zahl ist die 8, die Zahl der Urzeichen im I Ging, im Buch der Wandlungen. 8 mal 8 Felder ergeben das Schachspiel. Nicht zu vergessen die liegende 8, der Begriff für unendlich. Das Gesetz der Zahlen gibt der Dichterin die Freiheit zu immer neuen EinfälIen, Assoziationen, Motiven. Die Form will Transgression. Das Zählen wird Aufzählen und Erzählen. „Ich habe versucht von einer Welt zu erzählen, die es nicht gibt, / damit es sie gebe“, heißt es im Kapitel „Die Bühne“.
Eine imaginierte Welt also, ein Kosmos aus Sprache. Aber diese Welt ist alles andere als zeitlos. Die Themen und Hoffnungen der sechziger Jahre sind unübersehbar anwesend. Angefangen von Popmusic und Flower-Power bis zum Vietnamkrieg und den damals florierenden theoretischen Diskursen. Wir sehen mit Christensen: „Sie tanzen auf den Straßen. Sie haben blumen im mund“ und sind „nackt wie John und Yoko Ono.“
Ja, die zumeist eher kühl analysierende Autorin war sich mit der aufsässigen Jugend einig in ihrem Vietnam-Engagement:
Aber niemand mag ein politisches beispiel sehen
das sich in die haut des jungen mädchens brennt
Denn napalm ist bloß der stempel Amerikas:
Du gehörst dem lande das Gott gehört.
Längst vergangen oder wieder erstaunlich aktuell? Doch geht Inger Christensens Vorstellung von Befreiung über das Politische hinaus. Sie hat damals – wie viele ihrer Zeitgenossen – mit R.D. Laings Vorstellung sympathisiert, wonach die Schizophrenie geeignet sei, die gesellschaftlichen Strukturen aufzubrechen. Einige Passagen zeigen die Bilder aus einem Hospital für Geisteskranke als Modell für das bürgerliche Klassensystem. Sie erinnern an den Marat / Sade von Peter Weiss.
Im innern der gesellschaft sitzt herr Sade mit dem gefesselten mädchen
er liebkost langsam eine schulter eine brust
er flüstert das ganze dürfe gerne der eher zerteilten
lust der teile weichen.
Wo so das Ganze lustvoll unterminiert wird, scheint auch die Axt an das Ganze des Gedichts gelegt. Inger Christensen ist keine ängstlich-enge Klassizistin. Sie liebt das Risiko. Sie teilt mit dem Marquis de Sade die Lust an der Subversion. Sie spielt mit der Dialektik von Chaos und Gestalt. Was sie vor der Ideologisierung bewahrt, ist das musikalisch-mathematische Prinzip ihres Schreibens. Unter ihren Motti findet sich der Satz des Novalis „Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem“. Umgekehrt vermag die Krankheit der Gesellschaft der Musik und also ihrer Poesie letztlich nichts anzuhaben.
Bleibt der Faktor Zeit. Er macht das Gedicht datierbar, macht es historisch. Die Dichterin selbst hat das in einem Interview betont:
det ist ein Produkt der sechziger Jahre, mit dem allmächtigen Autor, der det schreibt, weil es ein Wort ist, das stellvertretend steht für alles auf der Welt, das solche langen, seltsamen Mobiles in die Luft wirft und sich dann wieder in sich selbst kehrt.
Inger Christensen ist zu streng mit sich. Mobiles sind nicht gerade aktuelle Kunstformen. Der kunstvolle Bau von det aber hat etwas Solides, ja Monumentales. Er faßt eine enorme Fülle von Sprache, eine Fülle von Welt. Die Dichterin ist ihr eigener Vergil. Sie ist der verläßliche Begleiter des Lesers, auch wenn der Weg labyrinthisch und der Ausgang dunkel ist. Wenn auch manche Passage allzu komplett wirkt, so überzeugt uns ihr emphatisch gesetzter Impuls: „Meine leidenschaft: weiterzugehen.“ Inger Christensen ist ja weitergegangen, weiter gekommen – zu alphabet und darüber hinaus: bis in die Leichtigkeit der Sonette vom Schmetterlingstal (1991), wo sie den schönsten, den dunkelsten Falter evoziert, den schwarzen „Apollo mnemosyne“.
Harald Hartung, als: In die Haut gebrannt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.7.2003
Det / Das
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde wohl eher nicht. Die biblische Rede vom Anfang ist ebenso wie die von der Ewigkeit eine weltfromme Mythe aus verblichenen Zeiten, fast so bleich wie Frau Holles Bettfedern oder Newtons absoluter Raum und absolute Zeit und ihre Verknüpfung in einer in sich geschlossenen, durch Kausalzusammenhänge bestimmten Welt.
Unsere, die zeitgenössische Schöpfungsgeschichte lässt die physikalische Antike Newtons hinter sich und stellt auf der Schwelle zu einer neuen Neuzeit eine evolutive, aus einem Revolutionsprozess hervorgegangene Welt dar, in der die Entropie das Maß menschlichen Wirklichkeitswissens ist. Ihre Autorin ist die große dänische Schriftstellerin Inger Christensen, die zu den wenigen Vertretern der zeitgenössischen Avantgarde gehört. Der Prolog ihres Gedichts überspringt den Anfang, denn er ist menschenlos und ohne Sprache zu denken, eine abstrakte Gesamtheit aller noch ungeschiedenen Einzelheiten. Der Beginn ist ein Einzelungsvorgang, die Ausfilterung des Sprachmoleküls „Das“. Das Keimwort stellt Inger Christensen ihrem Weltgedicht als Titel voran. Die Schöpfungsgeschichte des wissenschaftlichen Zeitalters geht aus einer einzigen Sprachzelle hervor.
Das. Das war es. Jetzt hat es begonnen. Es ist. Es wahrt fort. Bewegt sich. Weiter. Wird. Wird zu dem und dem und dem. Geht weiter als das. Wird andres. Wird mehr. Kombiniert andres mit mehr und wird fortwährend andres und mehr. Geht weiter als das. Wird andres als andres und mehr. Wird etwas. Etwas neues. Etwas immer neueres. Wird im nächsten nur so neu wie es nur werden kann. Stellt sich dar. Flaniert. Berührt, wird berührt. Fängt loses Material ein, wächst größer und größer heran. Erhöht seine Sicherheit indem es als mehr existiert denn es selbst, kriegt Gewicht, kriegt Geschwindigkeit, kriegt in der Geschwindigkeit mehr mit, geht vor andres, über andres hinaus, das aufgesammelt, aufgeschluckt, schnell belastet wird mit dem was zuerst kam, so zufällig begann…
„… so zufällig begann“. Das ist mitten im Protokoll ein geistiger Funke: die begriffliche Bestimmung des Ursprungsereignisses. Mit der Natur ist der Geist auf dem Plan. Darum ähnelt das Gedicht Inger Christensens einem digitalen Programmcode, der sich selbst aufruft und steuert.
Die Autorin pflanzt ihren Erkenntnisbaum in eine Welt, die eine Manifestation des Spiels der Materie in Raum und Zeit ist. Die Darstellbarkeit der metaphysisch leeren, substantialistisch entsicherten Wirklichkeit garantiert das sprach- und naturwissenschaftlich begründete Axiom, dass Welt und Sprache einander bedingen, dass die beiden großen Evolutionsprozesse der Natur, die Entstehung aller Arten dos Lebens und die Evolution des Geistes, die Existenz einer Sprache voraussetzen. Die neuzeitliche Schöpfung beruht auf sich selbst, ist Schöpfung und Schöpfer, Prozess und System, Bewegung und Gestalt, Chaos und Ordnung, ein enormer Spannungszustand zwischen dynamischen Prozessen und reiner Zuständlichkeit, in der sich die Zeit verräumlicht. Die Einheit der Gegensätze spiegelt sich im dramatischen Dreischritt des Gedichts von Prologes, zu Logos und Epiloges, deren inhaltliche Einzelheiten gleichzeitig sind.
Das war es. So anders jetzt da es begonnen hat. So verändert… wird gewendet und gedreht. Und folgt einer Entwicklung. Sucht eine Form. Greift in der Zeit. … Kriegt Struktur in unaufhaltsamem suchen nach Struktur. Variationen innen wird Stoff von außen zugeführt. Wechselt Charakter. Lokalisiert bedarf…
„… in unaufhaltsamem Suchen nach der Struktur“: der Evolutionsprozess ist als feststehende Welt nicht erzählbar. Wie die Physik nicht die Natur beschreibt, nur Gesetzmäßigkeiten unter Ereignissen der Natur, so wird der bildmimetische Zusammenhang von Gegenständlichkeit, Spiegelung, Abbildung und Repräsentation ersetzt durch eine modellhafte Darstellung, die das organisierende Zusammenspiel der Dinge aufzeichnen, die Strukturen, die den Dingen zum Vorschein verhelfen. Sie steuern die Entwicklung des Sprachmoleküls zum Logos.
In dem gleichgültigen Zufallsgeschehen richtet sich ein menschliches Bewusstsein auf. Es entspringt dem illusorischen Wunsch nach Unsterblichkeit und ist bei bemessener Lebenszeit mit Weltzeitwissen ausstattet. Aus dem vorbewussten Paradiesleben wechselt das Bewusstsein in die Diaspora eines erwachsenen Lebens auf dem Zeitpfeil. Die Welt, in der es lebt, stirbt den langsamen Wärmetod, denn sie ist ein geschlossenes, von ihren Umweltbedingungen isoliertes System in einem beständig sich ausbreitenden Universum, dessen „Rand“ die Zeit ist.
Sie tun so als wäre es möglich einer des anderen zufälligen tod zu vergessen in einer welt wo anwesenheit, bewegung, illusion ihre eigene welt schaffen. – Sie tun so als wäre ihr zufälliges leben nicht eine funktion des todes, nicht etwas locker hingeworfenes, schon formloses, sondern eine andere weit. – Sie tun so als wäre das leben nicht ein immer tieferer chemischer schlaf…
Dumm bekämpft die menschliche Gesellschaft den Zufall und ordnet die Welt. Sie verhält sich epistemologisch richtig, produziert aber auf dem Feld der Sprache, die wie die evolutionäre Welt vorlogisch ist, nichts als Unsinn. Das Druckbild des Prologs meldet auf den ersten Blick die langsam fortschreitende Erstarrung des Lebens. Die zusehends uniformen Satzkolonnen steuern von einem Absatz zum nächsten immer auswegloser auf den Kollaps im letzten Prologsatz zu.
Irgendwer geht in ein haus hinein und betrachtet von seinem fenster aus die straße.
Irgendwer geht aus einem haus hinaus und betrachtet von der straße aus sein fenster…
Irgendwer ist gestorben und wird von denen betrachtet die trotzdem vorbeigehen.
Irgendwer ist gestorben und wird bei anbruch der dunkelheit aus seinem haus hinausgetragen.
Irgendwer ist gestorben und wird von andern betrachtet die endlich blind sind.
Irgendwer steht still und ist endlich alleine mit dem andern toten.
Auf die Kritik des Prologs am Verhältnis des Menschen zur Welt
Die plurale Welt, die jetzt im Schlepptau der Buchstaben und Zahlen jeweils im Nullpunkt der Schöpfung beginnt und immer aufs neue plaziert und entfernt wird, erschafft sich in den Wechselströmen zwischen Dingen, Worten und dem menschlichen Bewusstsein, stets aufs neue. Die Bewegungsgesetze, die im Prolog die Selbstorganisation der Wortdinge steuerten, gehen nun als Kraftparameter in das achtteilige Raster der Evolutionszyklen ein. In der Abfolge von erweiternden „Symmetrien“, „Kontinuitäten“, „Transitivitäten“, „Variabilitäten“ und „Extentionen“ zu konzentrierenden „Integritäten“ und umfassenden „Universalitäten“ spiegelt sich die ungeheure Dynamik des Zeichenuniversums. Das Spiel wechselt vom Schauplatz Welt, „Die Bühne“, in die Räume menschlichen Handelns, „Die Handlung“, und lässt im Bewusstseinsprodukt „Der Text“ Zeit und Raum hinter sich.
Nachdem die bühne, nachdem sie sorgfältig – übergossen worden war, – mit säure geätzt wurde, verschwand, entstand – der dunst, die übelkeit, der hohlraum, – der drang der worte nach kulissen: – „der spiegel“ wünschte einen spiegel, – „der rülpser“ wünschte einen rülpser, – selbst „die säure“ wünschte eine säure, „die kulisse“ eine kulisse, – die worte – schufen ihre eigenen Bedingungen, – machten eine welt aus „der welt“
Zunächst werden die Dinge in der Isoliertheit und Kurzlebigkeit ihres Naturzustands gezeigt, bevor sie ihre Schatten, die Wörter, herbeirufen und in sich binden. Die entstandene Gesellschaft der Dinge und die gegründeten Ortschaften der Wörter sind Bausteine zu einem stetig sich weitenden und verdichtenden Beziehungsnetz.
Die Wirklichkeit des Verhältnisses von Ding und Wort, die Machtspiele der Wörter, ihre Fälschungs- und Täuschungsmanöver, der Betrug an den Dingen, die Scheinobjektivität ihrer Aussagen rufen die Angst des Bewusstsein wach. Damit sind die dramatis personae des Mittelstücks versammelt: Welt, Sprache und Bewusstsein. Es entwickelt sich ein Spiel über die ganz neue existentielle Problematik sprachlich vermittelter Weltwahrnehmung, Erkenntnis, Information und Darstellung, dessen umstürzende Bedeutung für unsere Weltsicht in der Erweiterung der Vernunft zum Ausdruck kommt, den Grenzgänger der Semantik. Die Sprache balanciert zwischen Sinn und zunächst nur gelegentlich, dann mächtig hervorbrechenden Nichtsinn oder Unsinn. Zugleich erschließt sie dem Vers ästhetisches Neuland, die Eleganz und funktionale Redundanz von Programmiersprachen, das Stakkato von Telegrammen, das universelle, in seinem auffächernden Fassungsvermögen grenzenlose Spektrum der seriellen Sprache, ihre kraftvoll gliedernde Rhythmik und Musikalität.
Die stets fraglichen Beziehung zur Welt und der sich stetig weitende und verdichtende Spielraum des Lebens wecken das Bedürfnis des Bewußtseins nach Orientierung, nach Überblick:
Da ist die volle wirklichkeit – sie denken was sie mit ihren augen sehen – sie sehen mit ihren augen was sie denken – Da ist die volle wirklichkeit und die intrige – sie denken was ich mit meinen augen sehe – sie sehen mit ihren augen was ich denke – das bedürfniss loszukommen überblick zu kriegen – zu ordnen
Zufallstreffer der Evolution, entwickelt das Bewusstsein sein eigenes kognitives Programm. Damit stößt es ein Spiel im Spiel zunächst im individuellen, dann im gesellschaftlichen Bereich an, das den Launen des Zufalls, der Augenblicksgebundenheit und Flüchtigkeit des Einzellebens im Evolutionsgeschehen einen übergreifenden Plan entgegensetzt. Erste Funken utopischen, die Wirklichkeit überschreitenden Denkens heften sich an Begriffe wie Leidenschaft, Glück, Traum, Phantasie, die sich zu einem latenten, dann immer mächtigeren Leitmotiv verbinden.
Der zweite Zyklus „Die Handlung“ erneuert das Evolutionsgeschehen aus dem Nullpunkt. Die Probleme des Wahrnehmens, Erkennens und Darstellens werden jetzt auf den gesellschaftlichen Schauplatz, die Theorie und Praxis gesellschaftlichen Handelns übertrugen. Dabei werden einzelne Verse und Strophen, die ins Gedächtnis den Textes eingegangen sind, aufgegriffen, angereichert und in den dritten Zyklus mitgenommen.
Ein stein rollt herab von den bergen
Sisyphos schiebt ihn hinauf
Ein stein rollt herab von den bergen
Sisyphos schiebt ihn hinauf.
Ein stein rollt herab
von den bergen Sisyphos
schiebt ihn hinauf. Und Sisyphos singt:
Ein stein fliegt hinauf über die berge.
Die beiden Vierzeiler übersetzen den Sisyphosmythos in eine serielle Figur, die das sinnlose Wiederholungsgeschehen direkt abbildet. Das Wunschlied des Verdammten ist ein Zitat aus dem ersten Zyklus „die Bühne“. Dort warten die Requisiten des Mythos noch auf den Darsteller. Die Zitate sorgen entlang des feststehenden Bewegungsrasters der Zyklen für Zustände wachsender statistischer Wahrscheinlichkeit, so dass die Entropie, der Nachrichteninhalt, sich zunehmend verkleinert. Zugleich festigen sie den Eindruck einer durchgehenden Spielhandlung in einem sich verdichtenden und weitenden, immer verzweigteren Labyrinthsystem, das die drei „Logos“-fragmente überspannt. Gestützt wird die Zusammenhangbildung von dem immer stabileren Leitmotiv Utopie und von der Kontinuität der Bewusstseinshandlung, die nun, bei erweitertem Erkenntnisinteresse, auf dem gesellschaftlichen Schauplatz fortsetzt wird. Die gesellschaftlichen Zustände, die Herrschaft. des Großkapitals, der Militärs und Kirche, das staatliche Gewaltmonopol, das zu Kontrolle und Überwachung des einzelnen führt, reißen das Ich aus der Passivität seiner Weltwahrnehmung. Die Notwendigkeit, die Welt zu verändern, aktiv einzugreifen, mündet in das stellvertretende Bekenntnis der Autorin zu Verantwortung und Engagement.
Im dritten und letzten Zyklus „Der Text“ geht die enge Wissenswirklichkeit im poetischen Totalentwurf einer Schöpfung auf, die im Menschen um Bewusstsein ihrer selbst gelangt. Jetzt werden die Motive des Gedichts gebündelt. Die Bilder versteinerter Lebenssysteme und entfremdeter Existenz weichen einem aufständischen Lebens auf der Grenze zwischen Sinn und Wahnsinn.
Echoartig stützen Fragmente von Novalis den paradiesischen Gartenprospekt voller Liebender und Irrer. Merklich sind den Versen Foucaults Normenkritik eingeschrieben und die wissenschaftskritischen Thesen des in den sechziger Jahren heftig diskutierten englischen Psychiaters Ronald D. Laing.
Aus dem paradiesischen Innern der Liebe und des Wahnsinns dringt die Stimme der Autorin:
Man sieht dass der arzt selber LSD genommen hat Und deshalb den patienten entgegenkommt
Ihnen die richtige Prozedur erklärt
Im grunde sind wir alle tot
Auf der mitte unserer bahn durchs leben
Ist das leben bloß hässlich und dumm und öd
Habt deshalb keine angst Eindeutig ist es
Das beste wenn wir die Perspektive verlieren.
Die Zeile „Auf der mitte unserer bahn durchs leben“ ist. die Übersetzung von „Nel mezzo del cammin di nostra vita“, dem Eingangsvers von Dantes Göttlicher Komödie. Im Zeilenfall seiner Terzinen schließt sie sich mit ihm zusammen und verdoppelt damit seinen rückgreifenden Aufbruch in die Neuzeit, die Verklammerung von alter und neuer Zeit, indem er mit Vergil an der Seite den Epochenbruch vollzog. Die Zahlensymbolik der Comedia kehrt im Steuercode ihres poetischen Netzwerksystems wieder: die Ordnung der Zahl acht, im liegenden Zustand das Unendlichkeitszeichen und seit alters das Harmoniesymbol überhaupt. Es liegt den Chorbauten gotischer Kathedralen ebenso zugrunde wie dem ersten Figurengedicht der europäischen Literatur, dem Kreuzgedicht des Hrabanus Maurus.
In der Göttlichen Komödie unseres wissenschaftlichen Zeitalters organisiert die acht einen Evolutionsprozess der Zeichen, in dem sich dem Leser eine unübersehbare Zahl von Textrouten bieten, horizontale, vertikale, kreuz und quer durch Linie, Fläche und Raum und immer neue, den Text neuerlich öffnende und weitende Lesarten in einem unabschließbaren Verstehensprozess, mit dem Quadrat als Grundform und der Rückkoppelungsschleife als dynamischer Grundfigur weitet sich die Geometrie des achtgliedrigen Prologs in die Logos-Räumlichkeit dreier hintereinander geschalteter Quadrate zu je 8 x 8 Feldern und schließlich in das achtteilige rekursive Redeband des Epilogs.
Schauplatz der frei fließenden, wiederum in Rückkoppelungsschleifen ins Unendliche ausgreifenden Reflexion ist das Gehirn, das sich als Spiegel dem „Logos“-Universum zuwendet. Die fragmentarische menschliche Existenz ist endlich. Ihre Selbsttranszendenz jedoch, die der Epilog ganz konkret abbildet, vollzieht sich innerhalb der allgemeinen Geschichte der Menschheit. Die universalen Aufgaben, die sich nun jenseits evolutionärer Beliebigkeiten abzuzeichnen beginnen, richten sich auf das Ganze des Lebens und begründen auf ganz neue Weise den absoluten Rang und die humane Verpflichtung der menschlichen Existenz. Der poetische Bauplan zu einem human verfassten Neuen Leben wird kenntlich, der die Poesie als Königsweg zum Weltbild neben die Naturwissenschaften stellt und der Schöpfung das menschliche Bewusstsein als unentbehrlichen Zeugen zuordnet. In seiner stellvertretenden Funktion rückt der Mensch unter neuen Vorzeichen ins Zentrum einer einheitlichen Natur. Unüberhörbar ist das Gedicht Inger Christensens ein Werk des Engagements mit unüberhörbaren Wirkabsichten, als Modell einer Literatur zu verstehen, die künftig zu unserem literarischen Alltag gehören könnte: aus der Not erkenntniskritischer Zusammenbrüche und Weltbildstürze kognitive Sprengungen und Schleuderkonzentrate der Intelligenz, die Literatur als einheitgebender, immer vollkommenerer Spiegel der Gesamtheit des Lebens bei ihrem Weltdienst.
Über die Jahrtausende hinweggreifend, sorgt die Autorin nach einer halben Ewigkeit der Getrenntheit für die Wiedervereinigung von Poesie und Wissen.
Det / Das ist eines der Wunderwerke, die immer zu früh über die Welt hereinzubrechen scheinen, sie jedenfalls unvorbereitet treffen, eine weit in der Zeit vorgreifende Dichtung, die der Literatur eine ganz neue Begründung und Rechtfertigung zuweist. Die schöne Klarheit, die unübertreffliche Genauigkeit und Ökonomie der Übersetzung Hanns Grössels sichert dem Buch diesen Rang scheinbar ganz mühelos auch in unserer Sprache.
Sibylle Kramer, deutschlandfunk.de, 4.8.2002
Klartext aus Delphi
Dem Apollo, Licht- und Weissagungsgott der Griechen, war in Delphi das Heiligtum eingerichtet, hier saß die Pythia, seine Hohepriesterin, auf einem Dreifuß und formulierte, eingehüllt in Räucherwerk-Schwaden, Klartext – Klartext allerdings, der auf den Befrager des Orakels zurückgespiegelt wurde, mit dessen Bedeutungsspektrum er selber zurechtkommen mußte: Das ist Dichtung. Delphi – ein Kommunikationsort! Genau diesen Umstand – Dichtung, verabreicht als spirituelle Dienstleistung, die den Leser mitbefragt – hat um 1800 Novalis, der naturwissenschaftlich gebildete Frühromantiker, erkannt, als er feststellte:
Sprache ist Delphi.
Was schätzen und lieben wir an den Büchern der Inger Christensen, die eine genaue Novalis-Leserin ist? Am alfabet / alphabet vielleicht das unter Kontrolle gehaltene Wuchern der Weltdinge und Gemütszustände, dessen berühmt gewordene Aufzählungsformel „es gibt“ in det / das bereits in Erscheinung tritt. Im gar nicht so romantischen Schmetterlingstal könnte es die melancholische Feier von farbstarkem, bewegtem Leben sein, die geheimnisvolle Sprach-Verpuppung und die Hoffnung auf schillernde Wiederkehr, das kraftvolle Sich-gegen-den-Tod-Stemmen, wenn dieser seine gewohnt-feinen Herzstiche absendet.
Die Gedichtbücher haben sie hierzulande berühmt und beliebt gemacht wie kaum einen anderen Dichter fremdsprachiger Zunge. Und wenn sie von einer nicht geringen Zahl junger Lyriker verehrt wird, liegt dies vielleicht daran, daß sie uns unnachgiebig auf das Nichtfestgesetzte verpflichtet. Daß sie auf poetisches „Blendwerk“ verzichtet: Daß sie es schafft, schnörkellos „von einer Welt zu erzählen“. Daß dieses irisierende Ornament aus Leben, Sprache und Tod für sie kein Verbrechen ist. Im Gegenteil: Inger Christensen faßt Dichtung auf als flirrendes Vielmehr und gesteuerten Molekülesturm.
Wir schätzen und lieben sie, weil sie eine einfühlsame, zuzeiten ekstatische Beobachterin ist, die leicht übersehbaren Details Aufmerksamkeit zu verschaffen weiß, indem sie ihnen die Rolle von Schlüssel-Metaphern zuweist und sie als Refrain-Partikel an unerwarteten Plätzen einsetzt. Ein derartig trotzig wiederkehrender Kernsatz in det / das funktioniert – auch – als Naturbild: „Im mai werden die fliederbüsche wieder blühen, sie werden“; ein anderer Trotz-Refrain ist das Credo der Liebenden, der poetischen Wahrnehmungs-Forscherin:
Meine leidenschaft: weiterzugehen.
Wir verstehen. Weiterzugehen als das Gros derer, die da Gedichte schrieben und schreiben.
Bei det / das haben wir es mit einem Literatur-Denkmal aus den Sechzigern zu tun. Bröckelt es? Überhaupt nicht. det / das stellt sich mühelos in die Tausende Jahre alte Tradition der Kosmogonien-Dichtung; ein ebenso in sich ruhender wie beweglicher poetischer Kosmos. det / das ist flirrend-flanierende Sprach-Philosophie, bietet außergewöhnliche Liebeslyrik und auch mal pazifistische Attacken (Vietnamkrieg!). Vor allem fächert es sich auf und ist konstruiert als Schöpfungsbericht, der unaufdringlich-unverquält Fühlung aufnimmt mit Werken der antiken Weltliteratur von Hesiod und Vergil. Wobei es, heute gelesen (nach der lyrischen Antikenrezeption der neunziger Jahre), weniger verwundern mag, daß Inger Christensen die alttestamentliche Genesis aufruft und dem Wort-Anfang des Johannes-Evangeliums Echoraum verschafft.
In der experimentellen Dichtung der sechziger Jahre – zu der das Werk zu rechnen wäre und über die es entscheidende Schritte hinaustut – war der schöpferische Retroblick auf antike Traditionen, und dann gar der Rückgriff auf Formen und Motive des Buches der Bücher, keine Selbstverständlichkeit. Christensen, die Mathe-Spezialistin unter den Gegenwartsdichtern, erweitert die biblische Siebenzahl der Schöpfungstage allerdings um einen achten, umspielt dabei auch die Zahlenordnung, mit der Dantes Göttliche Komödie arbeitet.
Keine Sorge! Bei aller durch Sprach- und Zahlensystem gestützten Komplexität geschieht Wunderliches, ja Wunderbares – das zweisprachige, vom Christensen-Übersetzer Hanns Grössel stark übertragene 460-Seiten-Buch ist leicht zu lesen. Die Übersetzung zieht nur hier und da den gewählteren Ausdruck vor, wo das dänische Original den Schwebezustand zwischen high und low hat.
Man lernt bei der Dänin immer etwas dazu, über diesen zarten und gewalttätigen Widerborst, der sich Sprache nennt, der uns mitspielt bis zur Tyrannei und ohne den die Menschheit nicht wäre – was so pathetisch gesagt werden darf, aus zweierlei Gründen. Erstens: Nicht das geringste Verdienst liegt im Verzicht auf aufgeblasene Monumentalität und seifiges Pathos. Mit denen wird in Deutschland Lyrik gerne verwechselt. Zweitens: Ihre Klage ist nie Jammer und ihre Liebeserklärung nie Soap. Die Daseinsfreude nimmt man der Autorin ab, wie man auch nie auf den Gedanken käme, die Desillusionierung für aufgesetzt zu halten, die bei der Dreißigjährigen schon ausgeprägt ist.
Vor der fatalen Mischung aus Naivität und Didaktik, Konzeptlosigkeit und Selbstüberschätzung, mit der schon manches Werk vor die Wand gefahren worden ist, schützt sich Christensen, indem sie früh als kardinale Voraussetzung ihrer Dichtung anerkannt hat: Dichterische Sprache ist Wahrnehmungsinstrument. In ihrem labyrinthisch angelegten Opus magnum bewegt sich ihr Leser anstrengungslos, beherzigt er dies:
Ich spreche von den zwischenformen der mitteilung
den zwischenstadien des gedankens
spreche von den zwischenkulturen des gefühls
Warum sollte das nicht die einzige Welt sein
det / das, aufgeteilt in „Prologos“, den seinerseits in drei Hauptkapitel aufgespaltenen „Logos“-Mittelteil, dem abschließend der „Epilogos“ folgt, beginnt und wird großenteils durchgeführt als durchaus erdverbundene Alltagsrede. Die Demiurgin legt den Hauptschalter um, der Weltschöpfungsbericht kommt in die Gänge.
In bedächtig kurzen, dann schnell Fahrt gewinnenden, länger werdenden Sätzen. Entschiedenheit und Unterscheidungsfähigkeit sind vom ersten Wort-Moment an da, so auch Verdichtung der Sprachmaterie, und ohne Brimborium werden die Hauptthemen entwickelt. Das Gedicht entspringt, fließt und endet als elementarer Erzähl-Strom, eine poetische Strömungs- und Elementenlehre, die fein dosiert mit Metaphern spielt, die oft aus den Naturwissenschaften stammen (Geologie oder Chemie) – Antidot gegen klassizistische Gefühligkeit.
Schlagend einfach scheinen ihre poetologischen Erkenntnisse, eine abgespeckte, fast banale Poetik, der man auf das Knochengerüst ihres Schreibens zu blicken vermag:
Wie die ersten Menschen sprachen, so sprechen auch wir, und dieses Sprechen kann, ohne daß wir merken, wie es geschieht, umschlagen und rhythmisch werden, kann Gesang oder Gedicht werden…
Überprüfbar in ihrem Essayband Der Geheimniszustand und Gedicht vom Tod, der eine fantastische Blake-Durchdringung enthält.
Ein weiterer Vorzug: Christensen polstert nie ihre Bücher mit großmäuligen Zitaten auf, die, zumeist von kleineren Kirchenlichtern, dem Leser oft genug in den Weg bugsiert werden. Feilgeboten werden von der Kopenhagenerin keine angefaulten Lesefrüchte; Zierobst zieht sie nicht. Sie verfolgt in det / das eine subtile Zitat-und-Motto-Strategie. An keiner Stelle zufällig wirkende Präparate aus der älteren und neueren Literatur werden bei Unterzyklen jeweils den – immer auch einzeln funktionierenden – Gedichtpassagen vorangestellt, um ihrerseits als programmatische Türöffner dem Gesamt-Werk ihren Dienst zu erweisen. Jeweils in den Originalsprachen aufscheinende Motti sind wiederzuentdecken – englische Romantik (William Blake) und französische Literatur (Lautréamont und de Sade). Ein Leseprogramm, das grenzübergreifend von der Nachkriegsmoderne verschlungen wurde und auf deutschsprachiger Seite nachprüfbar ist in der zeitgleich zu det / das entstandenen verbesserung von mitteleuropa von Oswald Wiener. Ungleich wirkungsmächtiger als alle Exponate der deutschen Nachkriegsavantgarde war det / das jedoch für Dänemark – ein sensationeller Publikumserfolg.
Für die beiden Deutschlands: Fehlanzeige. Und Fehlanzeige für Österreich. Das mag daran gelegen haben, daß die von zynisch-witzelnden Gesten nicht freie Autoren-Mannschaft der Wiener Gruppe sich nie an der großen Gedicht-Form versucht hat. Nur aus der sprachphilosophisch beschlagenen Szene wäre ein Werk zu erwarten gewesen, das sich an die Seite von det / das hätte stellen können. Es bestand einfach kein Interesse für das lyrische Großformat, sieht man von einigen Arbeiten Konrad Bayers ab, der aber im Alter von 31 schon starb; mit seinem mathematisch konstruierten „der vogel singt“ aus den frühen Sechzigern, immerhin ein Liliput-Versuch zum langen Gedicht, das nicht schwafelt, hätte er immerhin als der kleine Bruder der großen dänischen Schwester durchgehen können.
Interesse fehlt. Und das Können. So bleibt det / das ein funkelnder Solitär, begonnen 1967 in Kopenhagen, nach längerer Pause in Rom zwei Jahre später beendet. Ein allchemisches Gedicht. Eines, das „schillert, changiert, wirbelt“. Ein Gedicht – Sprache ist Delphi –, das per Zufalls-Steuerung zur Welt-Anschauung gelangt ist. Etwa zu diesem Schluß:
Drehung um drehung bekommt eine andere drehung.
Thomas Kling, Die Zeit, 20.3.2003
Musterdichtung
– Bedeutungswachstum in Inger Christensens Lyrik. –
wassertreppen steinhimmel windhäuser
luftkeller regenherzen sandkörper
felsmünder flußbäuche eisgeschlechter
schneelungen kohlenhirne wolkenfinger
salznerven erdaugen herzeleid
Inger Christensen: das
„Das ganze Relationsnetz zwischen allen existierenden Phänomenen, die unsere Welt ausmachen, muß uns zu einem immer raffinierteren Verständnis dafür führen, daß unsere Kulturformen, all die menschengeschaffenen Ausdrucksformen, darunter die vielfältigen der Poesie, zwar als etwas in sich betrachtet werden können, vor allem aber die Formen der Natur sind.“ Die Worte sind Worte Inger Christensens, und sie enthalten die Essenz ihres umfassenden naturphilosophischen Denkens – eines Denkens, das untrennbar mit ihrer dichterischen Praxis zusammenhängt. Die Kultur und mit ihr die Sprache sind Inger Christensen zufolge vom Menschen nicht frei geschaffen, unabhängig und losgerissen von der Natur, vielmehr wiederholen sie mit Notwendigkeit die Strukturen und Prozesse der Natur. So ist einer der Grundpfeiler in ihrem Œuvre, daß die Dichtung in irgend einem Sinne die Natur „mimt“. Die Frage ist, wie diese Mimesis verstanden werden soll. In welchem Sinne kann Inger Christensen von einem Zusammenhang zwischen dem Wachstum von Pflanzen und den Sprachblüten des Gedichts, zwischen Zellen und Worten sprechen? Ich möchte behaupten, daß die poetische Konsequenz von Inger Christensens Sprachsicht viel weiter reicht als z.B. die Verwendung von Systemen, denen eine Zahlenreihe zugrunde liegt, die in der Natur vorkommt (alphabet), oder ein poetisches Universum, das wie eine Zellteilung aus einem einzelnen Wort hervorwächst (das). Inger Christensens Biopoetik durchwebt ihre Gedichte auf allen Ebenen, wo sie ihren Ausdruck findet in einem Beschäftigtsein mit Form- und Ordnungsbildung und einem ständigen Kreisen um das Verhältnis zwischen Form und Bedeutung.
Das Gedicht, das ich einleitungsweise zitiert habe, muß im Lichte dieses Kreisens gelesen werden. Für Inger Christensen charakteristisch ist das Gedicht durch seine Verwendung von sprachlicher Musterbildung und durch sein Spielen mit sprachlichen Bildern. Das Gedicht ruft eine Klarheit und zugleich eine Dunkelheit hervor, die das Leseerlebnis mit vielen von Inger Christensens Gedichten kennzeichnen – als ein beim Leser unmittelbares und fast intuitives Verstehen der Stimmung und der Gedanken, die das Gedicht vermittelt, gepaart mit einem eher undurchschaubaren Gefühl, daß dieses Verstehen nicht nur aus dem Wortlaut des Gedichtes stammt, sondern in mindestens ebenso hohem Maße in einer anderen, vielleicht sogar wortlosen Ebene im Gedicht wurzelt. Ein vorherrschender Zug an Inger Christensen ist, daß die Bedeutung, die das Gedicht generiert, in einem komplexen Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ebenen im Gedicht entsteht, aber in diesem Gedicht wird es besonders deutlich. Ich möchte eine Charakterisierung der komplexen Bedeutungsbildung des Gedichts anbieten, und ich möchte es mit Hilfe eines Begriffs tun, der aus einem naturwissenschaftlichen Kontext genommen ist, nämlich des Begriffs „Muster“. Es liegt auf der Hand, „System“ zu denken, wenn man in Zusammenhang mit Inger Christensen das Wort „Muster“ verwendet. Aber die Systeme sind bloß einer von mehreren Typen-Muster in Inger Christensens Gedichten. Der Musterbegriff, wie ich ihn anwende, ist damit umfassender als die Systeme in sich. Meine Verwendung des Musterbegriffs ist verankert in dem naturphilosophischen Denken, das Inger Christensens Œuvre von den Essays bis zu den Gedichten durchwebt und das Sprache und Welt zusammenhängen läßt wie eine Schnecke mit ihrem Haus. Ich werde also einen Begriff, der von Inger Christensens Naturphilosophie inspiriert ist, auf ihre dichterische Praxis anwenden. Doch bevor ich zu dem Gedicht komme, ein paar Worte über den Begriff und seinen Hintergrund.
Die Natürlichkeit der Sprache
Mit Muster meine ich eine Form von Ordnung oder Regelmäßigkeit in einem Stoff oder einer Menge. In literarischem Zusammenhang meine ich mit Muster eine Ordnung auf einer vorgegebenen Ebene im Text, sei es auf der grammatischen oder der semantischen Ebene des Textes. Bewegt man sich außerhalb der Literatur, kann das Kategorisieren und Sortieren der Welt durch die Erkenntnis auch als eine Musterbildung beschrieben werden. Mein Musterbegriff ist also sehr weit – so weit, daß er ein konkret von Wörtern gebildetes Muster auf einer Buchseite genauso umfassen kann wie einen mentalen Prozeß.
Ein zentraler Punkt in Inger Christensens Dichtung und Poetik ist, daß ein Zusammenhang in den Musterbildungen auf der Ebene der Biologie, der Erkenntnis und der Sprache besteht. Dieser Zusammenhang überbrückt die klassische Scheidung von Kultur und Natur, Sprache und Welt. In ihren Essays weist Inger Christensen ständig auf den Sachverhalt hin, daß, wenn der Mensch glaubt, er schaffe mit seiner Sprache Ordnung in einer chaotischen Welt, nicht sieht, daß in diesem Schaffensprozeß selbst eine vorher schon existierende Ordnung enthalten ist. Die Art und Weise, wie wir die Welt ordnen, ist in sich schon eine Ordnung, behauptet Inger Christensen. Das bedeutet, daß sie einerseits betont, die Welt, wie wir sie erleben, sei von unserer Sprache geformt, aber zugleich, dieser Filter der Sprache sei nicht willkürlich und frei vom menschlichen Bewußtsein generiert. Wir können die Welt nämlich nur in Verlängerung der formgebenden Prinzipien formen, die bereits in der Welt wirksam sind. Die Sprache und die Phänomene, die sie beschreibt, werden damit zu Manifestationen bereits existierender Muster für Bildung von Form oder Ordnung. Auf diese Weise ist die Welt in der Sprache zugegen in der Form eines morphologischen Zusammenfallens – einer Reihe gemeinsamer Muster von Sprache und Welt.
Für Inger Christensen ist die musterbildende Begegnung der Erkenntnis mit der Welt unlösbar mit Bedeutungsproduktion verbunden. Wir „lesen“ die Welt, wie sie es z.B. in dem Essay „Der naive Leser“ ausdrückt, auf dieselbe Weise, wie alle anderen lebenden Organismen die Welt, in die sie gesetzt sind, lesen müssen, um zu überleben. Pflanzen müssen Wetter und Wechsel von Jahreszeiten lesen können, um ihr Wachstum anzupassen, und eine Ameise muß z.B. die Bewegung der Blattläuse lesen können. Der Gedanke gehört nicht Inger Christensen alleine, z.B. findet man auch in der Biosemiotik Vorstellungen, wonach der Leseprozeß auf allen biologischen Ebenen vor sich geht. Selbst auf der geringsten lebenden Ebene, auf der Ebene der Zelle, handelt es sich einigen Biosemiotikern zufolge darum, daß die Zelle ihre Umwelt liest, d.h., daß sie den Kontext interpretiert, in dem sie sich befindet, um ihre weitere Entwicklung zu bestimmen. Mein Musterbegriff ist denn auch von der Biosemiotik inspiriert, genauer gesagt von Gregory Bateson, der in seinem Buch Mind and Nature (dt. Geist und Natur) von einem Muster spricht, das einen Krebs mit einem Hummer, eine Orchidee mit einer Primel verbindet und alle vier mit ihm selbst in eine und mit der Amöbe in eine andere Richtung. In Batesons Wortschatz wird das Wort „Muster“ in sehr weitem Sinne verwendet, in Zusammenhang mit Homologien zwischen Organismen ebenso wie in Zusammenhang mit wiederkehrenden Strukturen in kulturellen und mentalen Prozessen. In Batesons Welt handelt es sich nicht bloß um ein Muster, sondern um eine Musterhierarchie, mit einer langen Reihe von Mustern, die sich einander unterordnen. So kann man von Mustern dafür sprechen, wie andere Muster interagieren, von Mustern zwischen diesen neuen Mustern und von Mustern, die auf verschiedenen Ebenen wiederkehren. Über all diesen Mustern thront „das Muster, das verbindet“ – das Muster der Muster – ein Metamuster, das alle übrigen Muster in einer Einheit zusammenbindet. Bateson weist darauf hin, daß wir gewohnt sind, an Muster als an feste Größen zu denken, z.B. das Sechseckmuster der Bienenwaben und das Spiralmuster der Meeresschnecken, aber in Zusammenhang mit dem „Muster, das verbindet“ muß man notwendigerweise dynamischer denken. Das „Muster, das verbindet“ muß primär aufgefaßt werden als ein „Tanz ineinander greifender Teile (…) und erst sekundär als festgelegt durch verschiedenartige physikalische Grenzen und durch diejenigen Einschränkungen, die Organismen typischerweise durchsetzen“. Im Tanze selbst, im Verhältnis zwischen den Teilen muß das „Muster, das verbindet“ gefunden werden, nicht in den Teilen selbst.
Ähnlich wie lnger Christensen meint Bateson, allen Organismen sei gemeinsam, in Zusammenhängen aufzufassen, d.h. daß die Welt im Verhältnis zum Kontext des Organismus und zur Relevanz für den Organismus aufgefaßt wird – daß alles Leben in Bedeutung „denkt“. Batesons Theorie ist letztlich eine Kommunikationstheorie – lebende Organismen kommunizieren mit der Welt, in die sie gesetzt sind: Sie lesen sie, formen sich nach ihr und werden von anderen lebenden Organismen abgelesen, für die sie einen Teil des Kontexts ausmachen. Die Formen von Tieren und Pflanzen sind im Grunde transformierte Mitteilungen, wie Bateson überspitzt formuliert. In Batesons Theorie hängt das „Muster, das verbindet“ mit dieser Bedingung zusammen: Alles Lebende muß notwendigerweise die Welt durch den Filter sehen, den das eigene „Bewußtsein“ des Lebenden ausmacht, und wird sich deshalb immer in einer dialektischen Bewegung zwischen dem Gegebenen und dem Erfahrungsbedingten befinden, zwischen dem Genetischen und dem Somatischen, zwischen Form und Prozeß. Das Muster, das alles Leben verbindet, ist bei Bateson das Muster für eben jene Zickzackbewegung. Batesons Muster-Theorie mündet in eine These, wonach das Muster dafür, wie das Leben sich entfaltet und entwickelt, dem mentalen Muster des Menschen analog ist, d.h. dem Muster dafür, wie wir die Welt erkennen. Das innere Universum des Menschen und die Evolution und Ökologie, von denen der Mensch ein Teil ist, haben also ein gemeinsames Muster. Das „Muster, das verbindet“ kettet so Mensch und Natur zusammen auf eine Weise, die ganz in den innersten Kern der Natur und des Geistes hineinreicht.
Batesons Gedanken von einem allesumfassenden Zusammenhang mit Wurzel in gemeinsamen Mustern stehen auf weiten Strecken mit dem weltanschaulichen Teil von Inger Christensens Musterdenken in Einklang. Doch woran ich primär in einer textanalytischen Perspektive festhalten will, ist das Musterverständnis bei Bateson als solches. Wie ich meine, ist es fruchtbar, wie Bateson in Musterhierarchien zu denken, so daß Muster auf mehreren verschiedenen Niveaus interagieren und neue Muster auf anderen Niveaus schaffen können. Außerdem ist es wichtig, drauf zu achten, daß Muster, wie Bateson behauptet, einen prozessualen Charakter haben können – daß auch im Verhältnis zwischen Elementen als solchem Muster sein können. Muster als ihrem Wesen nach prozessual zu sehen, ist auch bei Inger Christensen ein durchgehender Zug. Sie spricht z.B. in Die Seide, der Raum, die Sprache, das Herz davon, wie Formen in der Gestalt des Baumes und der Geschichte des Menschengeschlechts wiederkehren, und das wohlgemerkt nicht als ein Vergleich, sondern als „eine Form, die dieselbe ist. (…) Und hier sollen Formen nicht als statische betrachtet werden, sondern als fortlaufende Prozesse, die ab und zu verdeutlicht werden, auch in einem Zusammenspiel mit unserem Sinnesapparat.“ Diese Beispiele für „Form, die dieselbe ist“ in den Verzweigungen des Baums und des Stammbaums nähern sich eng dem Musterverständnis an, das diejenigen Typen von Mustern einschließt, die es im Verhältnis zwischen Elementen gibt (in diesem Fall, daß ein Zweig sich in mehrere Zweige teilt, der sich wiederum teilt usw.), mehr als in den Elementen selbst.
Kann das Auge seine eigene Netzhaut sehen?
Inger Christensens Musterdenken macht es unmöglich, die Sprache von der Welt zu trennen. Die Frage aber ist, was man tut, wenn man als Dichter nicht damit zufrieden ist zu wissen, daß die Sprache, deren man sich bedient – wie frei man sich zu ihr auch verhält –, immer über isomorphe Prozesse mit der Welt verbunden sein wird. Wenn man den Ehrgeiz hat, über die Sprache hinausreichen und diese Prinzipien in ihrer reinen Form vielleicht geradezu „fangen“ zu können, sozusagen die Notwendigkeit der Sprache zu versprachlichen. Die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, solche Prinzipien an sich zu versprachlichen, unabhängig und isoliert von der Form, die sie schaffen. Der einzige Zugang, den man zu solchen Prinzipien hat, führt ja gerade über ihre konkreten Realisierungen in der Welt. Ist es möglich, sich solche formschaffenden Prinzipien vorzustellen, ohne daß etwas geformt wird? Ist man mit diesen Fragen nicht, trotz des „Musters, das verbindet“, im Paradox der Sprache gefangen: daß wir nie um die Sprache herumkommen können – selbst wenn wir versuchen, das innerste Wesen der Sprache zu erforschen, können wir es nur über die Sprache selbst tun. Die Sprache um die Sprache herum betrachten zu wollen, die Erkenntnis um die Erkenntnis herum verstehen zu wollen, ist genauso unmöglich wie für das Auge, seine eigene Netzhaut zu sehen, um denn Inger Christensen selbst zu zitieren. Wird in diesem Falle das Streben des Dichters danach, die formgebenden Prinzipien, das „Muster der Muster“ auszudrücken, nicht zu einem Streben ähnlich dem Streben der Romantiker nach dem „Absoluten“, das im Aufblitzen erahnt, aber nie erreicht werden kann? Ja, wenn man wirklich wünschte, die Prinzipien rein darzustellen – um die Sprache herum, aber dennoch in der Sprache –, wäre erforderlich, daß man eine Form von sprachlichem Möbiusband unbekannter Dimension schaffen könnte. Es ist aber auch nicht Inger Christensens Ehrgeiz, die Prinzipien zu isolieren – eher handelt es sich um ein Sichtbarmachen der Prinzipien in Sprache und Welt, so daß die Prinzipien, die im verborgenen in der Sprache fungieren, im Gedicht sichtbar werden.
In Der Geheimniszustand beschreibt Inger Christensen einen besonderen Zustand, den sie mit Novalis eben den „Geheimniszustand“ nennt – einen Zustand, wo die Dinge sich selbst sagen, wo die Sprache übernimmt und wo die Verbundenheit der Sprache mit der Welt hervortritt. Wenn der Dichter Zugang zu diesem Zustand erhält, dann entsteht das Gedicht. Sie beschreibt den Geheimniszustand als eine Form des Sich-der-Unordnung-Überlassens – einer Unordnung, in die der Dichter sich hinausbegeben muß, um aufs neue Verbindungen herzustellen, neue Muster zu machen? Der Prozeß, wie Inger Christensen ihn beschreibt, erinnert an einen Wachstumsprozeß: Ein zufälliges Wort erhält seine eigene Notwendigkeit, und aus der Verankerung dieses Wortes in der Notwendigkeit wachsen die anderen Worte im Gedicht hervor – wie eine Zellteilung, oder wie das einzelne Staubkorn in einer gesättigten Lösung, das eine Kettenreaktion von Kristallbildung auslöst. Der Dichter, so könnte man sagen, übergibt sich den eigenen Wachstumsprinzipien der Sprache und wiederholt damit die Wachstumsprinzipien der Welt – der Dichter läßt die Welt durch eben die Sprache sprechen. Daß das Wort seine eigene Notwendigkeit erhält, bedeutet, daß ein Zusammenfallen von Wort und Phänomen stattfindet, ein Zusammenfallen, das nur im Geheimniszustand stattfinden kann. Zugang zu dem Geheimniszustand bekommen zu können, ist nicht Dichtern vorbehalten; vielmehr läßt er sich z.B. auch innerhalb der Wissenschaft erleben, wenn ein Problem plötzlich „sich selbst löst“ – die Stellung der Poesie zum Geheimniszustand unterscheidet sich von anderen dadurch, daß sie sich auf spezifische Weise der Sprache und deren Verbundenheit mit der Wirklichkeit verknüpft.
Mit dem Begriff „der Geheimniszustand“ werden die Dinge etwas dunkler, obwohl nicht schwer ist zu spüren, was Inger Christensen damit meint, daß die Dinge oder die Sprache übernehmen und am ehesten sich selbst sagen können. Dennoch ist es schwer, einen solchen Zustand als anderes zu beschreiben denn als einen Inspirationsschimmer, eine Vision oder geradezu eine Offenbarung. Es ist ein Zustand von Selbstvergessenheit – eine „Entrealisierung“, wie Inger Christensen es an anderer Stelle nennt –, wo der Dichter als Subjekt zurücktritt und etwas anderes zu Wort kommen läßt. Die Frage ist, ob es für Inger Christensen andere Lösungen für das Paradox der Sprache gibt als gerade den Glauben daran, daß das Gefühl des Dichters, das Gedicht habe seine eigene Notwendigkeit – es schreibe sich selbst –, ein genuiner Ausdruck dafür ist, daß die formgebenden Prinzipien übernehmen. Und das wohlgemerkt nicht im verborgenen, als etwas, das der Dichterin und ihrer Sprache schon immer unterlegt ist, sondern als ein Schaffensprozeß, der sich vor den staunenden Augen des Dichters entfaltet – als etwas Inneres, das zu etwas Äußerem erhoben wird, wie Inger Christensen mit Novalis sagt.
Ich habe nicht den Ehrgeiz, eine Bestandsaufnahme von Inger Christensens poetischer Genese zu machen, und will deshalb auch darauf verzichten, näher auf diesen Teil ihres Denkens einzugehen. In Klammern bemerkt, läge es nahe, gerade diesen Teil ihres Denkens mit dem naturphilosophischen Aspekt zu verknüpfen, wenn man Inger Christensens Verhältnis zur Romantik nachgehen wollte. Doch ist mein Anliegen hier mehr an der Lektüre des Gedichts und an den Bedeutungsbildungen der Muster im Gedicht orientiert. Die Vorstellung von wiederkehrenden Mustern verbindet bei Inger Christensen nicht bloß Sprache und Welt. Sie vereint, wie sich sagen läßt, auch Inger Christensens Denken mit ihrer dichterischen Praxis; die Muster und wiederkehrenden Formen in Natur, Kultur und Gemüt, welche die Gedichte thematisieren, werden beim Lesen der Gedichte mit den kognitiven Mustern verkettet, welche die Lektüre beim Leser hervorruft. Es geschieht wohlgemerkt aber auf eben eine solche Weise, daß die Muster aus einer mehr unbewußten Sphäre hervortreten und im Prozeß selbst dem Leser sichtbar werden. Die Bedeutungsbildung – oder das „Bedeutungswachstum“, um ein von Inger Christensen inspiriertes Wort zu gebrauchen – kann damit auch in der Musterperspektive gesehen werden. Gerade das Gedicht aus das mit seinen wortlosen Bedeutungsbildungen ist ein Beispiel dafür.
Muster im „herzeleid“-Gedicht
Das Gedicht besteht aus einer Reihe zusammengesetzter Wörter, die bis auf eines, nämlich das letzte Wort „herzeleid“, alle Neologismen sind. Andere Wörter, z.B. Verben, welche die Wörter zusammenbänden, gibt es nicht, und diese Ausformung verleiht dem Gedicht fast den Charakter einer Wortliste. Aber das Gedicht ist nicht bloß eine zufällige Anhäufung sonderbarer Wörter; das System, nach dem die Liste zusammengestellt ist, bildet ebenso wie der semantische Zusammenstoß zwischen den einzelnen Wörtern einen Zusammenhang zwischen den Wörtern und einer Bedeutung, die über die Semantik der einzelnen Wörter weit hinausreicht. Der bedeutungsmäßige Joker im Gedicht ist das Wort „herzeleid“ – ein Wort mit metaphorischen Wurzeln –, das mit seiner Wiedererkennbarkeit und unmittelbaren Verständlichkeit teils im Verhältnis zu den anderen Wörtern sich unterscheidet und teils auf das Verständnis der anderen Wörter im Gedicht einwirkt.
Das Gedicht enthält Muster auf mehreren Niveaus. Teils handelt es sich um ein grammatisches und ein lexikalisches Muster, das in dem System liegt, nach dem die Wörter aufgestellt und zusammengesetzt sind. Dieses Muster zeitigt eine Reihe semantischer Muster, die miteinander interagieren. Ins Auge springt das grammatische Muster: Jeder Vers besteht aus drei zusammengesetzten Wörtern, die alle aus zwei Substantiven zusammengesetzt sind. Über diese grundlegende Regelmäßigkeit hinaus besteht auch eine Regelmäßigkeit in der Zusammensetzung selbst. Bis auf „herzeleid“, das sich in mehrerlei Hinsicht unterscheidet, ist ihnen allen gemeinsam, daß das erste Glied der Zusammensetzung mit der Natur verknüpft ist (wasser, stein, wind, luft, regen, sand, fels, fluß, eis, schnee, kohle, wolke, salz, erde). Das zweite Glied der Zusammensetzung steht zu Beginn des Gedichts (Verse 1 und 2) mit Bauten in Zusammenhang (Treppen, Häuser, Keller), bewegt sich danach aber zu Wörtern hin, die mit dem Körper verknüpft sind (herzen, körper, münder, bäuche, geschlechter, lungen, hirne, finger, nerven, augen). Eine einzelne Ausnahme außer „herzeleid“ ist das zweite Wort im ersten Vers, dessen zweites Glied, wie auch das erste, mit der Natur (himmel) verknüpft ist. Das System bewirkt, wie ich weiter unten zeigen werde, daß die Wörter als miteinander in irgendeinem Zusammenhang stehend empfunden werden – daß die Wörter als Gruppen von Wörtern empfunden werden. Der Übersichtlichkeit halber will ich die Wörter im ersten Glied der Zusammensetzungen Gruppe 1 und die Wörter im zweiten Glied der Zusammensetzungen Gruppe 2 nennen. Als Schema sieht die Gruppierung so aus:
Gruppe 1 Gruppe 2
wasser treppen
stein himmel
wind häuser
luft keller
regen herzen
sand körper
fels münder
fluß bäuche
eis geschlechter
schnee lungen
kohlen hirne
wolken finger
salz nerven
erd augen
herze leid
Die Gruppe 1, die Naturelemente, sind größtenteils Variationen über dieselben Grundelemente – Wasser, Stein und Luft –, die in verschiedenen Formen auftreten. Das Wasser tritt als Regen, Fluß, Eis, Schnee und Wolke auf, und die Luft gibt es auch in Form von Wind – zutreffender ist es vielleicht zu sagen, daß es verschiedene Formen gibt, in denen die Elemente auftreten: eine feste Form (Stein, Sand, Fels, Eis, Schnee, Kohle, Salz, Erde – einige Dinge treten in Form von Partikeln, andere in solider Form auf) und eine fliegende Form (Wasser, Regen, Fluß) und Luftform (Luft, Wolke) – die Grenzen zwischen den Formen sind nicht absolut: der Regen und der Schnee sind teilweise luftgetragen, der Sand wirkt fließend im Verhältnis zum Felsen usw. Auf diese Weise besteht Zusammenhang zwischen den Naturelementen in Form einer Art Metamorphose der Elemente. Im ersten Teil des Gedichts sind die Elemente unorganisch, aber in den beiden letzten Versen des Gedichts kommen auch organische Elemente hinzu: Kohle; ein organisches Element, das zwar z.B. Stein ähneln kann, das aber aus dem besteht, was man komprimiertes Leben nennen könnte. Salz; ein Element, das unorganisch, aber stark mit dem Körper verknüpft ist. Erde; ein Element, das sowohl organisch als auch unorganisch ist. Und zum Schluß das Herz, das zwar organisch ist, sich aber von den übrigen Wörtern der Gruppe radikal unterscheidet – ich werde darauf zurückkommen. In der Gruppe 1 des Gedichts vollzieht sich also eine Bewegung vom Unorganischen hin zum Organischen.
Innerhalb der Wörter in der Gruppe 2, der Bauten- und Körperelemente gibt es ein Changieren zwischen Teil und Ganzem; so können „häuser“ als eine übergeordnete Kategorie für „treppen“ und „keller“ betrachtet werden, so wie „herzen“, „münder“, „bäume“, „geschlechter“, „lungen“, „hirne“, „finger“, „nerven“ und „augen“ alle unter die Kategorie „körper“ fallen. Doch scheint das Gedicht diese Niveauunterschiede aufzuheben und die Elemente einander nebengeordnet auftreten zu lassen. Diese Aufhebung von Niveaus setzt den Begriff gleich mit den Gegenständen, die unter den Begriff fallen, und hebt den Sprung zwischen Teil und Ganzem auf – diese Bewegung ist, so wie die Vorstellung von einer Art kosmologischer Metamorphose, ein durchgehender Zug in Inger Christensens Œuvre.
Die Bedeutungsbildung des Musters
Der zusammenhangschaffende Prozeß im System des „herzeleid“-Gedichts ist somit ein bedeutungschaffender Prozeß. Die Tatsache, daß die Wörter als eine Gruppe betrachtet werden, erweitert die ursprüngliche Bedeutung der Wörter; zwischen den Wörtern entsteht eine Form von gemeinsamem Raum, der in sich selbst bedeutungshaltig ist – das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Damit liegt in den Wortgruppen des Gedichts und dem Muster, das sie bilden, eine Bedeutung, die über die Bedeutung hinausreicht, die das einzelne Wort enthält. Oder anders gesagt: das System des Gedichts auf grammatischem und lexikalischem Niveau schafft beim Lesen semantische Muster, welche die Bedeutung erweitern.
Die Bedeutungserweiterung wird im „herzeleid“-Gedicht zusätzlich dadurch beschleunigt, daß das Muster gebrochen wird; einige Wörter passen nicht unmittelbar in das Muster, das man im ersten Durchgang gefunden zu haben meint. Diese Abweichungen bringen im ersten Durchgang mit sich, daß das abweichende Wort exponiert wird. Weil das Wort herausfällt, tritt es mit größerer Deutlichkeit hervor. Es wird eine Anomalie, ein Bruch jener Ordnung, welche die anderen Wörter bilden. In diesem Gedicht ist das Wort „herzeleid“ das deutlichste Beispiel für diese Exponierung. Das „unpassende“ Wort kann zwei verschiedene Reaktionen hervorrufen: Das Wort wird als zu der betreffenden Gruppe gehörig abgelehnt, oder das Wort wird versuchsweise der Gruppe einverleibt. Der erste Fall tritt z.B. bei einem Typus von Übungen ein, mit denen u.a. die Begriffsbildung und das Sprachbewußtsein von Schulkindern trainiert werden. Die Übung sieht vor, daß man in einer Gruppe von Bildern oder Wörtern ausmacht, welches Bild oder Wort nicht in den Zusammenhang paßt, z.B. „Schuh, Hemd, Auto, Hut, Hose, Jacke“. In einem solchen Fall wird der Begriff – in diesem Beispiel „Kleidung“ – durch Anomalien gestärkt; eben jener Aspekt der Wörter, daß sie alle Bezeichnungen von Kleidungsstücken sind, wird durch das Wort hervorgehoben, das keine ist. Oder anders gesagt: daß die Wörter zu einer Gruppe zusammengesetzt sind, hebt einen bestimmten Teil der Konnotationen zu den Wörtern hervor, nämlich jenen Teil der Konnotationsmenge, der den Wörtern gemeinsam ist. Die Anomalie tritt dann als das Wort hervor, dessen Konnotationen in der gemeinsamen Menge nicht vertreten sind.
Wenn das Wort versuchsweise der Menge einverleibt wird, geschieht das Gegenteil. Hinter den Begriff wird ein Fragezeichen gesetzt. Das geschieht dort, wo man erwartet, einen Zusammenhang zu finden. In diesem Gedicht wird eine Erwartung von Zusammenhang und Ordnung in den zwei Gruppen von Wörtern aufgebaut, die das erste und das zweite Glied in den Zusammensetzungen ausmachen (da die Wörter weit hinten unter bekannte Begriffe fallen: Natur, Bau und Körper) – ein Zusammenhang, der dann auf verschiedene Weise gebrochen wird, am stärksten mit dem Wort „herz“ unter den Naturelementen und dem Wort „leid“ unter den Bau- und Körperelementen. Wenn die abweichenden Wörter passen sollen, müssen die Begriffe, welche die gemeinsame Menge oder den gemeinsamen Raum abgrenzen, justiert oder vielleicht sogar ausgetauscht werden. Man sucht sozusagen einen Begriff zu finden, der alle Elemente umfassen kann.
Wenn die Bewegung vom Unorganischen hin zum Organischen in der Gruppe 1 mit dem Herzen schließt, wird auf die Bedeutung sowohl durch „herz“ als auch durch die Wortgruppe als solche eingewirkt; in diesem Kontext fungiert das Herz nicht als der bildliche Ausdruck der Liebe und des Zentrums der Gefühle, auch nicht als ein Teil im geschlossenen System des Körpers, sondern als ein Grundelement in irgendeiner Form größerer kosmologischer Zusammenhänge, von denen auch der lebendige Körper ein Teil ist. Dadurch ist das, was anfangs die „Grundelemente der Natur“ in Form von Wasser, Stein und Luft waren und was später „kohle“, „salz“, „erde“ und nicht zuletzt „herz“ umfassen konnte, erweitert und wird eine Art von „kosmologischen Elementen“ – eine Formulierung, die hier eine Auffassung eines größeren allesumfassenden Zusammenhangs abdeckt. Diese Kosmologie wird zusätzlich dadurch verstärkt, daß „herz“ sowohl in der Gruppe 1 als auch in der Gruppe 2 erscheint („herzeleid“ und „regenherzen“) und damit eine Brücke schlägt zwischen den zwei Gruppen, als erstes bzw. zweites Glied in den Zusammensetzungen.
Wie „herz“ unter den Naturelementen erscheint, so erscheint ein Naturelement, „himmel“, unter den Bau- und Körperelementen. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen sind somit fließend. So wie das Zusammensetzungsmuster des Gedichts eine Verbindung zwischen den Wörtern der Gruppe 1 herstellt und somit „herz“ unter die Naturelemente stellt, wird zwischen den Bau- und Körperelementen und dem letzten Wort des Gedichts ein Zusammenhang hergestellt: „leid“ in der Gruppe 2. „Leid“ unterscheidet sich von sämtlichen anderen Wörtern im Gedicht dadurch, daß es kein konkretes Ding, sondern ein Gefühl benennt. Aber in diesem Kontext wird auch das Leid in Einklang mit den übrigen Elementen des Gedichts materialisiert.
Die einverleibende Bewegung mag an die Variante der Übung erinnern, von der ich oben gesprochen habe. Statt einer Gruppe von Elementen gegenübergestellt zu werden, aus denen ein Element herausfällt, wird man in dieser Übung einer Reihe von Elementen, z.B. Zahlen, gegenübergestellt und soll dann berechnen, welches das nächste Element in der Reihe sein wird. Ein Beispiel ist die Zahlenreihe: 1, 2, 3, 5, 8, wo die nächste Zahl 13 sein wird (diese Zahlenreihe bildet den Hintergrund des Systems in alphabet) – wenn man die nächste Zahl ausrechnen können soll, muß man das System hinter den übrigen Zahlen durchschaut haben. In diesem Fall wird man durch die Zahl 5 überrascht, wo man hätte erwarten können, die Zahl 4 zu finden. Man muß danach seine Auffassung der Ordnung revidieren, die hinter den Zahlen Iiegt; nicht mehr zu der vorangegangenen Zahl 1 dazulegen, sondern die zwei vorangegangenen Zahlen addieren. Auf dieselbe Art und Weise wird man im Gedicht gezwungen, seine Auffassung des Musters zu revidieren, das in den Wörtern liegt, wenn man die abweichenden Elemente einverleiben und am Zusammenhang im Gedicht festhalten können will. Beide diese Bewegungen, die Ablehnung und die Einverleibung, sind im Gedicht zugegen, wie ich meine – ja, die Bewegung zwischen ihnen ist meiner Meinung nach ganz zentral für die Bedeutungsbildung im Gedicht.
Die Bedeutungsbildung des Musters als metaphorischer Prozeß
Die Bedeutungsbildung des Musters kann also auf diesem Niveau im Gedicht als eine Bewegung zwischen Ablehnung und Einverleibung beschrieben werden. Eine Bewegung, die man an vielleicht unerwarteter Stelle wiederfindet, nämlich in der metaphertheoretischen Beschreibung der Bewegung des metaphorischen Prozesses zwischen einer buchstäblichen und einer übertragenen Bedeutung. Der französische Hermeneutiker Paul Ricœur hat in seinem Buch über das, was er „die lebende Metapher“ nennt, die Bedeutungsbildung der Metapher eingehend beschrieben, und er hebt das Dynamische und Spannungsgeladene im metaphorischen Prozeß hervor. Ricœur zufolge kann man den metaphorischen Prozeß nicht nur als einen Übergang von einer buchstäblichen zu einer übertragenen Bedeutung beschreiben, so verstanden, daß sich von dem metaphorischen Prozeß mir sagen läßt, er vollziehe sich im Übergang selbst – daß, wenn die übertragene Bedeutung einmal etabliert ist, wieder Ruhe im Lager und Stabilität in der Bedeutung herrscht. Vielmehr ist in der Metapher eine anhaltende Spannung zwischen der semantischen Nicht-Übereinstimmung in der buchstäblichen Bedeutung der Metapher und der neuen semantischen Übereinstimmung in der übertragenen Bedeutung der Metapher. Entscheidend für die Schaffung der neuen Übereinstimmung auf dem semantischen Niveau ist gerade, daß die Nicht-Übereinstimmung auf dem buchstäblichen Niveau festgehalten wird und eine aktive Rolle bei der Bedeutungskonstruktion der Metapher spielt. Die Spannungen zwischen Unterschieden und Ähnlichkeiten bleiben somit weiterhin ein wesentlicher Teil der Dynamik im metaphorischen Prozeß.
Daß man im metaphorischen Prozeß die Unterschiede in ein spannungsgeladenes Ganzes integriert, bewirkt, daß man in der Metapher Einblick gewinnen kann in den Prozeß, der sich vollzieht, wenn wir Begriffe bilden. Die Begriffsbildung ist ein Klassifikationsprozeß, der sich sozusagen über die Unterschiede hinweg vollzieht – wo von den Unterschieden zugunsten der Ähnlichkeiten abgesehen wird. Der „Friede“ und die „Ruhe“, die Ricœur zufolge im Begriff liegen, werden nicht in der Metapher erreicht, wo der Widerstand der Unterschiede die endgültige Klassifikation bremst und wo stattdessen die Klassifikationsbewegung in der rhetorischen Figur eingefangen und festgehalten wird. Die Metapher ist mit anderen Worten ein Fenster in der Sprache, ein Fenster auf das fundamentale Prinzip oder Muster der Erkenntnis. Ricœur sagt es so:
Die Metapher als Redefigur stellt den Prozeß, der verdeckt durch Verschmelzung der Differenzen in der Identität die semantischen Felder hervorbringt, offen durch einen Konflikt zwischen Identität und Differenz dar.
Ein entsprechender Prozeß wird über das System des Gedichts im „herzeleid“-Gedicht sichtbar. Die ständige Bewegung zwischen Ablehnung und Einverleibung, die das System zeitigt, läßt sich am besten als ein metaphorischer Prozeß beschreiben. Auch in der Gruppierung der Wörter durch das System liegt eine spannungsgeladene Doppelbewegung, wenn der Leser versucht, die scheinbar unvereinbaren Wörter unter einen Begriff fallen zu lassen, der sie alle umschließen kann. Auch nicht durch das System des „herzeleid“-Gedichts werden „Friede und Ruhe“ des Begriffs erreicht. Die Bedeutung des Musters, seine neue semantische Übereinstimmung wird nur in einem ständigen Spielen mit der „ursprünglichen“ Kategorisierung der Wörter erreicht. So besteht im Bedeurungsbildungsprozeß in Einklang mit dem metaphorischen Prozeß eine Spannung zwischen einer Nicht-Übereinstimmung auf dem lexikalischen Niveau des Musters und einer neuen Übereinstimmung auf dem semantischen Niveau des Musters.
„Herzeleid“: System, Zusammensetzung und Bild
Bis jetzt habe ich mich auf die Muster konzentriert, die im ersten beziehungsweise im zweiten Glied der Wortzusammensetzungen des Gedichts lagen – dem, was ich die Gruppe 1 und die Gruppe 2 genannt habe. Genauso wichtig aber ist, wie ich einleitungsweise erwähnt habe, das Verhältnis zwischen den unbekannten und im ersten Durchgang unverständlichen zusammengesetzten Wörtern, die den größten Teil des Gedichts ausmachen, und dem einen bekannten Wort, „herzeleid“, welches das Gedicht abschließt. Vieles von dem, was ich oben über Bedeutungsbildung in Gruppen von Wörtern gesagt habe, macht sich auch hier geltend. Wie es früher schon der Fall war, handelt es sich um ein Spiel zwischen einer Gruppe von Wörtern, die zusammenzugehören scheinen (auf diesem Niveau: die unverständlichen Zusammensetzungen), und einem Wort, das von der Gruppe abweicht (das verständliche Wort, „herzeleid“). Doch fügt hier die Tatsache, daß die Wörter aus zwei Wörtern zusammengesetzt sind, dem Spiel eine weitere Dimension hinzu: Auf der einen Seite bindet „herzeleid“ die übrigen ungleichen Wörter im Gedicht dadurch zusammen, daß es einen Zusammenhang zwischen „wasser“ (und „treppen“ andeutet, gleichwertig dem Zusammenhang zwischen „herz“ und „leid“. Auf der anderen Seite machen die übrigen Zusammensetzungen im Gedicht den Leser darauf aufmerksam, daß auch „herzeleid“ ein zusammengesetztes Wort ist. Das heißt, „herzeleid“ lädt dazu ein, die übrigen Wörter als zusammenhängend zu lesen, während zugleich die übrigen Wörter dazu einladen, „herzeleid“ als zwei Wörter zu lesen.
Wie aber fungieren zusammengesetzte Wörter, semantisch gesehen? In Ulla Albecks Dänischer Stilistik ist den zusammengesetzten Wörtern ein eigenes Kapitel gewidmet. Albeck unterscheidet zwischen den zusammengesetzten Wörtern, die zur gewöhnlichen Sprache gehören (im „herzeleid“-Gedicht ist es das Wort „herzeleid“), und den zusammengesetzten Wörtern, die dichterische Neuschöpfungen, sogenannte Neologismen sind (im „herzeleid“-Gedicht sind es die vierzehn übrigen Wörter). Auf verschiedenerlei Weise fungiert ein zusammengesetztes Wort wie eine Metapher; Albeck hebt hervor, daß das zusammengesetzte Wort einen konzentrierenden Effekt hat, weil es vermag, in ein und demselben Wort zusammenzudrängen, was normalerweise mehrere Wörter erfordert – ein Vermögen, das auch der Metapher zugesprochen wird. Wie in der Metapher ist der Abstand zwischen den beiden Gliedern entscheidend für die stilistische Wirkung: je größer der semantische Abstand zwischen den beiden Wörtern in der Zusammensetzung ist, desto stärker wirkt die Zusammensetzung. Die Abgrenzung zwischen zusammengesetzten Wörtern und Metaphern ist denn auch fließend. Einige zusammengesetzte Wörter haben metaphorischen Charakter (Albeck nennt „Sünden-wände“ und „Trauer-wolke“ als Beispiele), während andere zusammengesetzte Wörter ganz einfach Metaphern sind (z.B. das oft angeführte Beispiel für eine tote Metapher: „Tisch-bein“). Albeck faßt die Metaphern, die aus einem zusammengesetzten Wort bestehen, als eine besondere Untergruppe jener Gruppe von Metaphern auf, wo „die Ersatzvorstellung neben der eigentlichen Vorstellung steht“, wo sowohl Bildglied als auch Sachglied im Satz zugegen sind – z.B. „Sündenfetzen“, „Sehnsuchtsfluß“, „Sterndiamanten“.
Im „herzeleid“-Gedicht ist der semantische Abstand zwischen den Wörtern in den vierzehn Neologismen groß – so groß, daß die Wörter im ersten Durchgang, wie gesagt, unverständlich wirken. Wenn sie einen Sinn ergeben sollen, liegt es deshalb nahe, sie als Metaphern zu lesen, so daß ihre unverständliche buchstäbliche Bedeutung durch eine übertragene Bedeutung ersetzt werden kann. Z.B. kann das erste Wort, „wassertreppen“, als eine Metapher gelesen werden, die einen Wasserfall beschreibt, wo das Wasser in Kaskaden herabfällt – oder als eine Metapher, welche die Kaskaden in Springbrunnen beschreibt (im späteren Œuvre Inger Christensens erscheint diese Metapher in dem Text „Wassertreppen“, der eben mit Springbrunnen als Ausgangspunkt geschrieben ist). In beiden Fällen ist das Wort „treppen“ das Bildglied, während „Wasserfall“ oder „Springbrunnen“ das Sachglied ist. Doch könnte man sich auch leicht vorstellen, daß „wasser“ das Bildglied wäre – vereinfacht gesagt; daß es die Treppen wären, die Wassercharakter hätten, und nicht das Wasser, das Treppencharakter hätte. Normalerweise wird aus dem Kontext hervorgehen, welches Wort als das Bildglied betrachtet werden soll, aber die Wörter im Gedicht haben keinen unmittelbar stabilisierenden Kontext – der Kontext besteht nur aus den anderen unverständlichen Wörtern in der Reihe. Die Zusammensetzungen erhalten denn im ersten Durchgang am ehesten den Charakter von Fixierbildern, wo im einen Augenblick das erste und im nächsten Augenblick das zweite Wort in der Zusammensetzung Bildglied ist.
Eines der Wörter aber, „herzeleid“, fällt, wie gesagt, durch seine unmittelbare Verständlichkeit heraus und wird, wie sich zeigt, eben auf Grund der Verständlichkeit zu dem Kontext, der eine gewisse Stabilität in der Bedeutung geben kann. „Herzeleid“ wird damit der Kontext, der, semantisch betrachtet, den Weg zum Lesen der übrigen Wörter weist. „Herzeleid“ in der Bedeutung „unglückliche Liebe“ bildet somit den Resonanzboden für die übrigen Wörter des Gedichts, die damit meistenteils als Bilder des Gefühls von Hoffnungslosigkeit und Unmöglichkeit gelesen werden können, die das Herzeleid hervorrufen kann. Auf Treppen aus Wasser kann man nicht gehen, Himmel aus Stein fallen herab, Häuser aus Wind schenken keine Geborgenheit, so wie Keller aus Luft keinen Schutz bieten – und später; Körper aus Sand zerbröseln und verschwinden, ein Mund aus Fels kann weder sprechen noch küssen, ein Geschlecht aus Eis nicht lieben, Finger aus Wolken können nicht berühren, Augen aus Erde nicht sehen. Innerhalb desselben Konnotationsfeldes können Regenherzen als Metaphern für ein weinendes Herz gelesen werden, Kohlenhirne als Hirne, die in Schwarz übergegangen sind, und Salznerven als ein Hinweis auf den Ausdruck „Salz in eine Wunde streuen“.
Durch diese Optik betrachtet, wird die Reihe von Neologismen des Gedichts zu einem Versuch, ein Gefühl über verschiedene Bilder einzufangen – und dieses Gefühl wird dann der Zusammenhang, der die Wörter untereinander verbindet. Lenkend für eine solche Lesart ist das Wort „herzeleid“ – wohlgemerkt in der gängigen Bedeutung des Ausdrucks: unglückliche Liebe. Aber wie ich früher gesagt habe, bringt das System des Gedichts mit sich, daß die Einwirkung zwischen „herzeleid“ und den übrigen Wörtern auch in die andere Richtung geht: daß die Plazierung von „herzeleid“ unter die übrigen Wörter den Leser darauf aufmerksam macht, daß auch „herzeleid“ aus zwei Wörtern zusammengesetzt ist. Das System löst sozusagen „herzeleid“ in seine lexikalischen Grundelemente auf, „herz“ und „leid“, und enthüllt damit eine semantische Tiefe, für die der automatisierte Gebrauch des Wortes den Leser normalerweise blind macht; die Zusammensetzung von „herz“ und „leid“ zielt nämlich auf eine übertragene Bedeutung des Wortes „herz“ ab. Nicht das konkrete physiologische Herz ist gemeint, sondern das Herz als Bild der Liebe. „Herzeleid“ ist also nicht nur eine Beschreibung dessen, wo im Körper das Gefühl von Leid sich befindet (Herzeleid und andere mit der Liebe verbundene Gefühle werden ja rein faktisch als „im Herzen wohnend“ erlebt – was wohl auch einer der Gründe dafür ist, daß das Herz die bildhafte Bedeutung bekommen hat, die es besitzt), es ist ein Name für einen bestimmten Typus von Leid, nämlich Liebesleid. Die Auflösung von „herzeleid“ durch das System enthüllt auf diese Weise den Grund der Zusammensetzung in der Bildsprache.
Somit handelt es sich um eine semantische Doppelbewegung im Verhältnis zu „herzeleid“: Auf der einen Seite stabilisiert „herzeleid“, wie gezeigt, die Bedeutung in den übrigen zusammengesetzten Wörtern, und zwar dadurch, daß es die Grundlage liefert, auf der eine übertragene Bedeutung etabliert werden kann – und auf der anderen Seite enthüllen die übrigen Wörter die zusammengesetzte Natur von „herzeleid“ und dadurch die bildsprachliche Bedeutung eben dieser Grundlage.
Musterdichtung
Einer meiner Gründe dafür, Gregory Bateson einzuführen, war, wie gesagt, sein Denken in Muster-Zusammenhängen und Muster-Hierarchie dies, daß Muster, als Prozesse begriffen, quer zu dem wiederkehren können, wofür sie Muster sind – und daß Muster auf einem Niveau interagieren und neue Muster auf einem anderen Niveau bilden können. Die Lektüre des „herzeleid“-Gedichts zeigt die Wichtigkeit dieser beiden Aspekte in Zusammenhang mit der Bedeutungsbildung des Gedichts Die Muster-Hierarchie ist eine Art und Weise, die Interaktion zu beschreiben, die zwischen den Mustern auf verschiedenen Niveaus im Gedicht vor sich geht, wo die Bedeutungsbildung in einem Muster sozusagen auf den Schultern der Bedeutungsbildung in einem anderen Muster steht: das Muster, das „herzeleid“ mit den übrigen Wörtern im Gedicht verbindet, ist hinsichtlich der Bedeutung von den Mustern abhängig, welche die Wörter im ersten und im zweiten Glied der Zusammensetzungen (Gruppe 1 und Gruppe 2) verbinden – die wiederum an einem anderen Muster bauen, dem Muster nämlich, welches das System auf dem grammatischen Niveau des Gedichts schafft. Von Musterzusammenhängen kann man in dem Umfang sprechen, wie das Grundmuster auf mehreren Niveaus im Gedicht wiederkehrt, und wie dabei in dem bedeutungbildenden Prozeß gemeinsame Züge sind – gemeinsame Züge in der Gruppierung der Wörter beziehungsweise der übertragenen Bedeutung, die den Wörtern zugeschrieben wird. In beiden Fällen handelt es sich um eine Form von Bedeutungskonstruktion, die in ihrer Grundstruktur als ein metaphorischer Prozeß beschrieben werden kann. Würde man von einem Metamuster für „herzeleid“ sprechen, müßte es deshalb der metaphorische Prozeß werden, der das Unvereinbare in einem spannungsgeladenen Ganzen vereint.
Das „herzeleid“-Gedicht zeigt, daß System und Metapher nur in mancher Hinsicht Gegensätze zueinander sind. Oft begegnet man der Auffassung die Metapher sei ans Gefühl und an das Subjektive gebunden, während die straffe Form des Systems als Ausdruck objektiven Intellekts gilt. Aber aus der Musterperspektive gesehen, haben System und Metapher in ihren Bedeutungsbildungen eine Reihe struktureller und verlaufsmäßiger Züge gemein, so wie die semantischen Muster, die sie bilden, beim Lesen des Gedichts miteinander interagieren. Wenn es zu Bedeutungsbildung kommt, folgen sie somit beide einem Muster, das in metaphertheoretischen Termini als ein metaphorischer Prozeß beschrieben werden kann – als ein Prozeß nämlich, wo der Leser Ähnlichkeiten auf dem Grunde des Unterschieds herstellt. Dagegen läßt sich einwenden: wenn die Metapher, wie die moderne Metapherforschung behauptet, das Sichtbarmachen eben dessen ist, wie die Sprache fungiert – wenn die Metapher bloß eine sprachliche Ableitung dessen ist, wie unsere Erkenntnis arbeitet, und das Denken somit grundlegend metaphorisch ist, dann kann es schwerlich die große Überraschung sein, daß auch das Lesen des Systems in Struktur und Verlauf an einen metaphorischen Prozeß gemahnt. Doch ist es hier wichtig, zu unterscheiden zwischen der grundlegenden metaphorischen Fähigkeit der Erkenntnis, Ähnlichkeiten zu sehen, und dem Sichtbarmachen dieses Prozesses durch die sprachliche Metapher. Ricœur zufolge liegt die heuristische Stärke der Metapher gerade in ihrer Sichtbarkeit: weil die Metapher eine unabgeschlossene Spannung zwischen Ähnlichkeit und Unterschied enthält, gewinnt der Leser Einblick in den sonst verborgenen Begriffsbildungsprozeß. Gerade das Sichtbarmachen verbindet das System im „herzeleid“-Gedicht mit der Metapher. Wenn die Bedeutungsbildung im System des „herzeleid“-Gedichts an einen metaphorischen Prozeß gemahnt, dann deshalb, weil ins System des Gedichts eine Anomalie eingebaut ist – ein Bruch mit dem erwarteten Muster, der bewirkt, daß der ähnlichkeitschaffende Prozeß sichtbar wird. Mit anderen Worten, wäre das System nicht durchbrochen worden, wäre man als Leser nicht im selben Maße darauf aufmerksam geworden. Deshalb läßt sich behaupten, daß die Bedeutungsbildung im System des „herzeleid“-Gedichts metaphorisch in dem Sinne ist, daß ins System eine Abweichung eingebaut ist, die den bedeutung-bildenden Prozeß erst sichtbar macht.
Die Verwendung des Musterbegriffs öffnet die Augen für die Interaktion, die zwischen den verschiedenen Niveaus des Gedichts vor sich geht, von seiner Thematik und seinen Systemen bis zur Bedeutungsbildung seiner Metaphern (den verschiedenen Richtungen der modernen Metaphertheorie ist gemeinsam, daß die Theoretiker vergleichsweise eng an die einzelne Metapher gebunden sind und nicht eben großes Interesse bekunden für die Strukturen oder Muster, die zwischen den Metaphern in einem Text entstehen oder zwischen dem Muster der Metapher und den übrigen Mustern wie Systemen des Textes, Reim und Rhythmus u.a.m.). Darüber hinaus kann man mit dem Musterbegriff die Lektüre von Inger Christensens Gedichten befreien von einem in meinen Augen reduktionistischen Begriff von Systemdichtung und stattdessen ihre Verwendung von Systemen als Teil eines weitaus umfassenderen Gebrauch von Mustern in der Dichtung sehen.
Systemdichtung als literarischer Begriff hat einen Klang von extremer Sprachbewußtheit, wohlgemerkt einer Sprachbewußtheit, die bewirkt, daß die Sprache sich um sich selbst in einem Bewußtsein ihrer eigenen Begrenzung zusammenkrümmt. Im Literaturhandbuch heißt es über die Systemdichtung u.a.: „In der Systemdichtung (…) wird der Leser aus allen Illusionen gerissen. Alles ist Sprache, und es wird auf nichts ,Wirkliches‘ außerhalb der Sprache verwiesen.“ Demgemäß läßt Steffen Hejlskov Larsen in seinem Buch über Systemdichtung seine Definition eines Systemdichters ausgehen von einer Erkenntnis des Dichters, wonach unser Weltbild sprachlich determiniert ist – daß unsere Auffassung von der Welt durch den Filter der Sprache geht und die Sprache auf diese Weise dazu beiträgt, die Welt zu schaffen, in der wir leben. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis wird Hejlskov Larsen zufolge, daß die Dichter über die Systeme versuchen, eine alternative Sicht der Welt zu schaffen, um damit letzten Endes – da ja die Sprache die Welt „erschafft“ – das Bild der Welt zu verändern. Der Systemdichter versucht mit anderen Worten, dem Leser den wirklichkeitschaffenden Charakter der Sprache bewußt zu machen, indem er ihn mit alternativen Strukturierungsprinzipien konfrontiert. In diesem Sinne wird das System zu einer Markierung der Kluft zwischen Sprache und Welt.
Nichts könnte Inger Christensens Verwendung von Systemen ferner liegen. In ihrer Dichtung werden die Systeme gerade zu einer Art und Weise, eine Form von Zusammenhang und Kongruenz zwischen Sprache und Welt einzufangen. Mit der gängigen Betrachtung des Systems verliert man den Blick für die Doppelheit von Zufall und Notwendigkeit, die es in Inger Christensens Sprachauffassung gibt und die den Hintergrund für ihre Verwendung von Systemen bildet – und man übersieht, daß die sprachlichen Muster des Systems bei Inger Christensen ihre Verankerung und ihre Äquivalenz in nichtsprachlichen Mustern haben. Denn Inger Christensens Verwendung von Systemen umschließt ein Nach-außen-gerichtet-sein, ein Sich-der-Welt-draußen-zuwenden, das mindestens ebenso wesentlich ist wie das sprachliche Nach-innen-gerichtet-sein. Ihre Gedichte werden zu einer Wiederholung der Muster der Welt und zugleich zu einer Reflexion darüber – das Gedicht spiegelt die Welt und ist zugleich eine Welt in sich, worin die bedeutungbildenden Prozesse in unendlichen Variationen durchgespielt werden können, begrenzt nur durch die Kreativität des Dichters. In Inger Christensens eigener Formulierung zusammengefaßt:
Die Welt, die ihre natürliche Verlängerung in der Sprache hat, kommt zum Bewußtsein ihrer selbst, und die Sprache, die ihren Hintergrund in der Welt hat, wird zu einer Welt in sich selbst, zu einer ständig mehr entfalteten Welt.
Anne Gry Haugland, Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 1, Januar 2005. Aus dem Dänischen von Hanns Grössel
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Robert Habeck: Was wir Schrecken nennen
literaturkritik.de, Mai 2003
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
VON WO WORÜBER, NICHT WARUM, AM MEER
(Für Inger)
von der Welt sprechen, gemeint Natur, ein
sommerlicher Anfang, der weit über die See
hinausreichte. Eine zögerliche Zaghaftigkeit
des Gesprächs und zaghaft bis ins Ende, das
Zögerliche war immer greifbar, war aber
den Zeichen gewichen (Natur als solche war
gemeint), der stillen Systematik des
Gesprochenen. Sprache als solche
blieb abseits, verborgen unter Vergangenem
und seinem Gewicht: Sprache ist Delphi
(Novalis), das Gesprochene, das
den Ort füllt, war immer schon
gemeint. Von der Welt sprechen, die sich
selbst aufschreibt, uns mit –
welch Zwischen-Raum! –, während
wir sprechen und der Adler aus dem
Reservat drüben herübersteigt
in den Himmel über Skagen, das Eis
in der Ostsee, 1981, die Sandzunge
Skanens Gren unter sich, die leckt
nach links, die wirft sich
nach rechts, er fliegt seinem Schrei
nach, dem einfachen hochgezogenen
Ton, hinaus auf die Ostsee, ans
Ende vom Eis:
(Eine lautlose Erzählung; die hohen Töne
tragen die beleuchtete Stille, in der – unten – ein
beweglicher Schatten sich in seinem Auge
abbildet da oben, festgemacht bis zum
schnellen Ende der Beweglichkeit unten.)
aaaaadraußen, draußen: der Schatten
der Schiffe überm Horizont, wo das Dunkle
ins Helle umschlägt. Der Horizont war –
immer schon – wieder das Band, der Horizont
war diese Bindung, Verbindung, Bündnis
mit dem Gesprochenen, das seine Stille
behält. Von der Welt reden wie den Stein, diesen,
in die Hand nehmen, ortsvergessen, seine
Stille redet, dicht, eine bis zum Äußersten auf-
gespannte Fremde Nähe; die bewerfen wir
zeilenweise mit Kugeln aus Schnee und Feuer:
Figuren, leuchtend aus ihren Schatten, die
stolpern in ihre Verwandlung, in die Schönheit
des ersten Rhythmus zurück: durchs Meer
wandernde Reisende, die Ohren verbunden
gegen die Verführung. Von der Welt, Natur ist
gemeint, wie übers Wohnen reden, die alten
Holztreppen hoch unters Dach, wo der Wunsch
da ist, noch einmal in eine andere Stadt, noch
einmal die nahe und fremde Zeichensetzung
aus nächster Nähe wie zur Erinnerung
an das blaue Echo der Jammerbugt, den
angerufenen Horizont zwischen den Körpern
im Sand: aber –
Gregor Laschen
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie
Nachrufe auf Hanns Grössel: Übersetzen ✝︎ FAZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


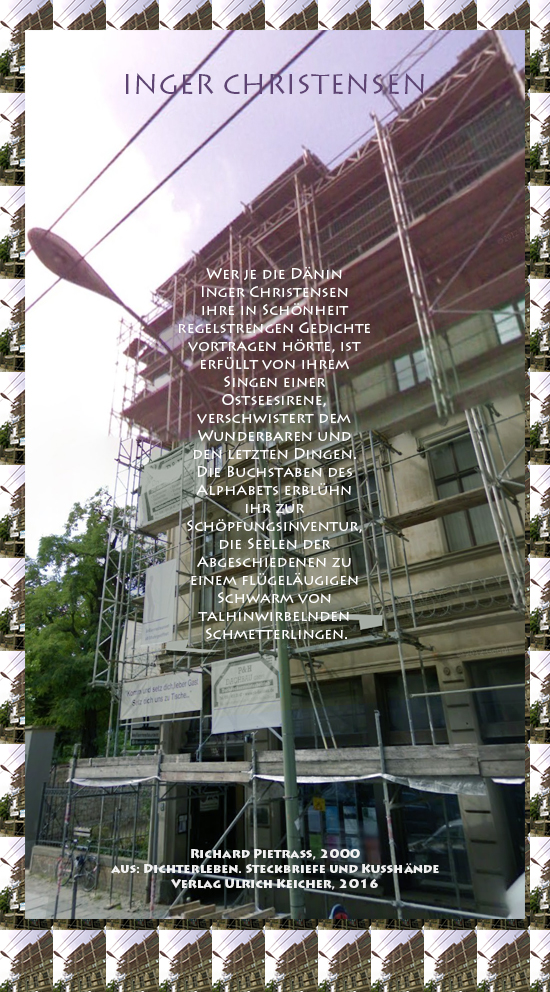












Schreibe einen Kommentar