Inger Christensen, Hanns Grössel: Preis für Europäische Poesie 1995
den herbst gibt es; den nachgeschmack und das
aaaaanachdenken
gibt es; und das insichgehn gibt es; die engel,
die witwen und den elch gibt es; die einzelheiten
gibt es, die erinnerung, das licht der erinnerung;
und das nachleuchten gibt es, die eiche und die ulme
gibt es, und den wacholderbusch, die gleichheit, die
aaaaaeinsamkeit
gibt es, und die eiderente und die spinne gibt es,
und den essig gibt es, und die nachwelt, die nachwelt
(Auszug aus alphabet)
Begründung der Jury
Inger Christensen und ihr Übersetzer Hanns Grössel erhalten den Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie 1995.
Die 1935 in Vejle/Dänemark geborene Inger Christensen schreibt Lyrik, Romane, Essays, Bühnenstücke und Hörspiele. Im Zentrum ihres Werkes steht die Lyrik, die Sprachexperiment und Erfahrung von Welt verbindet.
Viele ihrer Großgedichte – wie alphabet und es – folgen zahlenkombinatorischen Prinzipien und erzeugen poetische, der Ordnung der Natur verwandte Organismen.
Die Ideen des Linguisten Noam Chomsky über eine angeborene Sprach-Fähigkeit und über allgemeingültige formale Regeln für den Satzbau haben ihr, wie sie selbst bezeugt, „ein phantastisches Schwindelgefühl“ gegeben: „Eine nicht beweisbare Gewißheit, daß die Sprache eine unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe ,Recht‘ hatte, zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.“ So gelingt es Inger Christensen, Wortsituationen zu schaffen, in denen die Dinge und die Wörter verraten, wer wir sind.
Hanns Grössel, 1932 in Leipzig geboren und in Kopenhagen aufgewachsen, hat zahlreiche Autoren aus dem Französischen, Schwedischen und Dänischen übersetzt.
Sein besonderes Engagement gilt seit den frühen 70er Jahren dem Werk Inger Christensens. Mit großem Einfühlungsvermögen für Textur und mit absolutem Gehör für den Ton ihrer Stimme hat er überzeugende Analogien für die offenen Sprachprozesse der Lyrik Inger Christensens gefunden.
Renate Birkenhauer, Michael Braun, Harald Hartung, Joachim Sartorius, Norbert Wehr
Laudatio
Liebe Inger Christensen,
lieber Hanns Grössel,
sehr verehrte Damen und Herren!
IN INGER CHRISTENSENS REGISTERN reicht eine chinesin ihre hirse-terrine ins reisgericht, eine geste. in ihrer strengen geste ist gerste geschichtet, in ihrer gerste gries – eine geschichte
nicht seit gestern erst
sicher ist; es geschieht in stiegen
renitente striche erregen ihren geister-sinn
escher, ein trichter sticht in see, es regnet, seiner reise schritt riecht schnee
in nestern regieren schein-einheiten, steineichen niesen ringe, es ginstert
sechs echsen reinigen sich
inger christensens register errichten schneisen
ihr interner steg richtet sich gegen schienen, sie entrinnen sie entrinnen nicht, einstein, richtiges sternengetier, echte stirnen
eines nicht geringen tisches reiche genießen chitinschicht – ihr einstieg rechnet sich eher genetisch, negiert eiserne thesen: sichtlich ein teich
(gestern hingen sie in nischen, ein geschirr-test ihres schieren seins – triestiner gneis hingegen regeneriert sich)
ich sehe, hier ist strittiges erreicht, ein innenhirn-gesicht, sicher, sie singen es in eins: sehr riesig, sehr in teig gestrichen – trichinen! rettich! stets ein geschrei in engen resten, hinein, herein, es ist nicht ihres, nicht seins −
richtig, ein geister-schnitt, ein scheren-riß, ein geniestreich-gitter „estrich“ – nein, ein reigen gesichter, gesichte, hie steingeschichte, hie trennstrich, hie einsicht: ich sehe sensen, hirse, reis, gries, gerste, rieche gerne ihren gischt-regen in trichtern hinter registern gesintert −
hier ist er, hier ist er nicht, hier geschieht’s
INGERCHST AUS IHREM VORKOMMEN GEKLAUBT: und ziemlich einfach darin zu bauen, denke ich, so in „variablen Homophonien“ aus dem 9-Buchstaben-Raster gelautet, der Inger Christensen heißt und bedeutet – denke ich freiwillig, wenn das Tentakelwerk sich dann freilich wie selbsttätig in Gang und etwas in Sprache setzt, das an die Hexenprobe des Mittelalters gemahnt: Beweise mir, „Stechring“, daß du bist was du nicht bist, Spielregel Sprache, die du du bist, die du ich bin – ob du schwimmst, ob du geschwemmt wirst, ob du dich anfühlst oder es dich anfühlt, Bild das du dir und mir machst von der Welt die sich ausmacht wenn sie dich über sich hinaus liest, selber eingeschränkt, wie es (wie Sie hören konnten) im Raster der Fuge der 9 Lautbuchstaben geschieht −
ziemlich einfach auch noch zu bewerkstelligen, wenn man denkt selbst im 26-Buchstaben-Raster, mit welchem, über welchem und in welchem in unseren Breiten die Welt aufgeht −
und geradezu läppisch einfach, wenn ich mir vorstelle (und wir alle können es ja mit unseren 9 oder 26 Milchzähnen!), wie komplex ein Denkgebilde etwa aussähe, wenn, sagen wir, die ganze Haufendispersion der Milchstraße bloß ein Dialekt unter vielen anderen einer sich denkenden Milchsäure wäre! Oder wer im Tuten einer Güterwagenlokomotive eine historisch unbekannte Zahl von Sonnenauf- und Untergängen in den Schlund eines einzigen Buchstabens stürzte, von dem die Zwischenstufe zum Klang sich auf halber Strecke zwischen der alten Seidenstraße und einem Pfauenschrei im Innenohr des ausgemalten Himmels über der Zwergin Nana von Mantua eben erst anbahnen täte −
aber, und diese Einsicht verdanke ich all den Texten genannt Inger Christensen: auch solche Alphabete in statu nascendi müßten sich ganz einfach anfühlen – eine textorganische Empfindung genannt Erkenntnis. Könnte ich „staunen“ sagen, ohne „staunen“ sagen zu müssen, wäre somit und hierin „sich anzufühlen“ möglich wie etwas in dem und indem gerade erst wird, was es wahrnimmt, den Schritt der er war im Schritt der es wird. Wüßte sich ja fast so einfach anzufühlen wie Inger es dänisch buchstabiert, denkt mein Deutsch, irgendwo im Spektrum der transitorischen Milchsäure, die sich organisiert.
Wir sind hier übrigens auch mitten in der Gattungsproblematik einer „Laudatio“. Rühmen, von diesem hier zu jenem dort, das ist’s, konnte einer sagen, als Konnexitäten einmal klar wie ein Glaubenssatz schienen – hier Newton, da der Apfel.
Welche Sprachwelten haben seit wann sich global gewandelt. Auch Physik ist eine Sprachwelt. Doch ich ist seit jeher ein anderes, Mantegnas ausgemaltes Weltzimmer hat’s gewußt. Ingers Brunnen von Rom wissen es, und die Arterien im permutativen Wirbel des hellroten Cabrios loben die Baumeister nicht, sie sind sie. Erschrocken wie beglückt.
Laben, leben, loben, die Ijub-Lupe Chlebnikovs wie die Lippenblütler aller Liebesbrüter – vom Lorbeer des Lobs fällt aber – Obacht! – in unserem Ohrbereich des hautnahen Spiels im Nu das Ob ab: Stoßbote Staunen: ob’s – verdammt und bitte, die optative Optik – möglich sei, daß Materie sich liest, sich lesen möge, ja sie tut’s doch, noch, Ontologie wird Poiesis, sozusagen indeterminiert bedingt, ihr Ob vom Lob des skandalösen Anfangs, quasi ein Hiobs-Apfel-Abfall aus dem Oberbegriff. Ich ist weil es wird, permanentes Fallobst, mal als Ichthyosaurus, mal als Bin-Birne, jedenfalls ein Obsassa (manche sagen dazu Quantensprung, manche sagen Übersetzung) eines sich verstört wahrnehmenden, also mit einer gewissen Wirkung selber generierenden „Lebens“. Traumwandlerische Entscheidungsfreiheit dann die Entzweiflung des Apfelmännchens in der Bifurkation. Chaobst aus der Baumschule eines Inger-Textes von der flüssigen Algebra ihrer Alchemie.
Und kleine Lobotomie eines Lobsters in Ingers Laudation. Die ist natürlich ihr Text. Das sind die Teile und die Kräfte zwischen ihnen. Ob das genüge.
BLOSS NEULICH WAR’S, am 16. Januar dieses Jahres. Sechzehnter Erster Fünfundneunzig. Oder Eins Sechs Eins Neun Fünf. Oder, andere Lesart, Sechzehntausendeinhundertfünfundneunzig.
Wir lernen Sprachen wie ein Datum da aus Inger Christensens Sechzigstem Geburtstag bereits im Augenblick des Abhebens vom ABC: Wieso bist du oder warum ist mir Sechs Null Sechzig, Oder eben, aus der übergreifenden Grammatik einer solchen Flugbahn, in der unsere Sprachen („Dänisch“, „Französisch“, „Neuhochdeutsch“, „Spanisch“, „Englisch“, „Polnisch“ und so fort) im Flickenteppich einer Cumulusdecke auf dem Augapfel zusammenschwimmen, für sie notiert:
sechzehntausendeinhundertfünfundneunzig
inger zum sechzigsten
teilbar durch fünf
das datum wie die jahre
ganz ernsthaft
was war zum beispiel („ballspiel“)
am dritten februar neununddreißig
oder wie man sich mit zwölf erinnern könnte
einmal vier (und ein wenig drumherum)
womöglich gewesen zu sein
eher den tag
als den abstand
eher einen allgemeinen zustand
als den tag
teilbar durch fünf
datum wie jahre
gibt es primzahlen
wie denkt sich das wort primzahl
wer stellt sich wolkenlos darunter
und darunter irgendetwas vor
warum denkt sich das wort
teilbar wie unteilbar
zwischen 16195 und 3239
kommt möglicherweise etwas ins spiel
das kein spiel ist
nämlich dies und das und
zwischen dem und dem und
ortung und willkommenszeit
verpuppt sich dann ach die koordination
aaaaber leicht-
gläubig in knochenarbeit – „wie“ ein heu-
schreck „wie“ ein differenzialgebläse „wie“
eine sanduhr für metaphern −
tritt konjunktion ein („möglicherweise“)
und entpuppt sich als primzahl und
wir staunen: dominoklötze: teilbar durch
aaaaafünf näch-
te fünf pfauen fünf augen
wenig domestiziert doch in die eigenschaften
aaaaavon na-
men und namenslisten genommen sagen wir
aaaaawir und und
und das hündchen wirbelt aus der
aaaaamilchstraße her-
aus in eine primzahl die keine verneinung
aaaaader an-
deren fünf augen ist in dieser syntax die keine ei-
genschaft der anderen fünf milchstraßen ist
aaaaain die-
sem zustand zwischen 16195 und 3239 der
aaaaaeher staunt
als daß er teilbar ist an einem solchen tag
aaaaader kein
abstand ist von jahren & texturen die teilbar wä-
ren (heute) durch fünf
und willkommen und
zum ballspiel und
warum ein datum sich denkt
DEM NETZ IN DIE NATUR GEGANGEN – der Netzhaut Sprache; und der Iris, ihrem Stiefvater oder Störfaktor, das ist nämlich der Briefträger des Störs an die verflossenen Adressen und Absenzen gestriger und kommender Verknüpfung – sage ich mal, gestelzt, in schiefen Metaphern, eingedenk der Sprache, die ja selber, um überhaupt zu reden, ständig verblümt und unverblümt auch „danebenhaut“ – während Ingers Texte sich doch so einfach und ohne Metapherngepränge oder gründelndes Nominalornament eben einfach wie der Seidenfaden in seinem Kokon der Konnexitäten traumwandlerisch zu entrollen scheint. Man kann das nur holprig umschreiben, was in ihren Texten wie mit leichtester Hand passiert.
Und gleichzeitig wahnsinnig beglückend künstlich ist. Und das Wahnsinnige daran, daß man es nicht merkt. Wenn ich etwa an den als „symmetrische Permutation aus 5 Elementen“ gebauten Gedichtband brief im april denke, Oder an das trotz seiner nur 70 Seiten ins Unermeßliche geworfene alphabet: Stichwort Fibonacci-Reihe, eine ganz bestimmte Art ausschreitender Zahlenprogression, bemessen hier in Verszeilen, nach der die Grammatik der 14 Abschnitte des Buchs, die also vom a bis ins symbolische n reichen, ihren Schneeball bilden.
„Proteus & Mandelbrot, oder Das Nüchterne Entzücken“ heißt dann vielleicht meine barocke Lesart ihrer leichtfüßig strengen Brüderlichkeit, wenn man so sagen kann angesichts der Textgenese aus dem mathematischen Verfahren – ich will das gar nicht kontrollieren müssen.
Ich muß es ja gar nicht kontrollieren, wo es ist, das Verfahren. Es sagt sich, und du sagst es ja und hast mich Lesenden ja erst hergestellt, Teil seines keiner Kontrolle bedürftigen gegen Kontrolle sich regelrecht stemmenden Erschreckens, da zu sein im Satzbau „avant la lettre“ – hat mir der Faden gesagt, Bewußtsein, die komfortable Unleserlichkeit.
WEISSER KONTRAST −
wie die Fadenheftung dieser schönen weißen Bände von Kleinheinrich hier in Münster, auch so ein „Ob“ aus dem Lob, wenn sie da sind, und wie Hanns Grössel ja im Spiel ist darin, auch wenn niemand sich fragt, oder gerade weil niemand beim Lesen sich fragt, wer ist die Autorin und wer ist ihr Übersetzer? Denn was Hanns Grössel da seit Jahren unternimmt (intim, dezent, kundig, so absolut verläßlich), ist, und der Text weiß das, und Inger weiß das beim Schreiben auf ihre Art, und Hanns Grössel bei seiner Tätigkeit auf seine Art, eben wieder nichts anderes als die bewußte Hexenprobe, der sich jede wirkliche Übersetzung stellt: Beweis mir, daß du bist was du nicht bist Übersetzung, Original.
So wie Inger Christensen seit Jahren das Gleiche unternimmt, was wirklich Schreibende in allen Sprachen tun: rerum natura und vitae natura gleichsam gleichzeitig zu sein und werdend zu bedeuten –
weißer Kontrast.
Nichteingestandenes inklusive. Wenn Ingers Texte einen lesen während man sie liest, gibt es, Überfluß und Abfall, ja immer ein kosmisches Teflon der Gefühle „im Moment des Umschlags“, wo ihr Zustandekommen kein Epitheton verträgt, immer punktuell einen Stich, doch ständig unterfüttert vom besagten Staunen und Schlucken darüber ob überhaupt etwas sein und heißen kann und darf und möchte – universell schon im solidarischen Kleinmaßstab der Spinne, der Sinne.
Proteus eben, das selbst sich Wandelnde, und nicht Prometheus das Transportvehikel mit dem mimetischen Touch von Vorbestimmung und Verheißung („promettre“!), scheint mir, ist der Spinnwebfaden ihres Gehirns wie dessen Granatapfel, den Inger Christensen in die Hand nimmt und schneidet; so wie in Säften aus filigraner Süße eine kleine Über-Säure zu kosten ist.
Wo das Pfauenauge mich auftut, sich liest – herrlich asymmetrisch (schon wegen der Zeitschlaufe von Flügel zu Flügel), bestürzend unvorhergesehen (schon wegen der Musterung im Wiedererkennen), ruhig bis jähzornig, wie tanzend
die langen Pinselstriche
als ihr Alphabet mich in die Hand nahm
von Sprachraum zu Sprachraum, Hörsaal zu Hörsaal die Welt und ihre Lesbarkeit gegen den Standard im Standort „Niels bohrende Frage mit den Wildgänsen“ – der Traum vom Original:
Ingers Geheimnis
− das ich nicht berühren kann. In seinem Unterschied fühlt es dich etwas anders an als du es anfühlst. Dort bin ich anders vorgedacht und nachgebracht, verneige mich unruhig. Und danke.
Oskar Pastior
Von O bis Z
Inger Christensen wohnt in der Dag Hammarskjölds Allé, im vierten Stock des Hauses Nummer 5. Als ich das erstemal aus ihrem Fenster guckte, da wurde mir klar: Ich muß schon als Zehnjähriger hier vorbeigekommen sein, als die Straße noch Østerbrogade hieß. Mein Blick war auf die Mønstedsche Villa in der Kristianiagade gefallen (lange Sitz der sowjetischen Botschaft), und ich erzählte Inger, daß ich während der Besatzungszeit in der Uniform des „Deutschen Jungvolks“ im Hinterhof der Villa und im Hofgebäude Dienst getan hätte – immer mittwochs, (Um die Ecke, in der Bergensgade 11, lag das „Haus der deutschen Jugend“.)
Im September 1940 hatte die „Nordische Gesellschaft“ die Mønstedsche Villa gekauft und darin ihr „Dänemark-Kontor“ untergebracht. Die „Nordische Gesellschaft“ war diejenige Organisation der nationalsozialistischen Kulturpropaganda, die in den skandinavischen Ländern für die Sache des Dritten Reichs werben sollte; Schirmherr der Gesellschaft war Alfred Rosenberg. Vor dem Kriege schon hatte sie in Lübeck-Travemünde das „Deutsch-Nordische Schriftstellerhaus“ eingerichtet, und in ihrer Monatszeitschrift Der Norden läßt sich nachlesen, wie man damals in Deutschland über skandinavische – somit auch über dänische – Literatur urteilte und schrieb.
Dänisch lernte ich buchstäblich spielend: beim Spielen mit Nachbarskindern am Peblingesee. Außerdem besuchte ich eine zweisprachige Schule, die Sankt-Petri-Schule, an der erst mein Vater, später meine Mutter unterrichtete. Als sie berufstätig geworden war, verbrachte ich große Teile des Tages bei unseren dänischen Nachbarn, sprach also sicherlich mehr dänisch als deutsch; ein Tagebuch, das ich mit zwölf Jahren begonnen habe, ist auf dänisch geführt.
Mich in zwei Sprachen bewegen, ohne Mühe aus der einen in die andere wechseln zu können, war bis in die späten sechziger Jahre ein selbstverständlicher Bestandteil meines Lebensgefühls. Auch meine ersten literarischen Übersetzungen aus dem Dänischen habe ich im Gefühl ungeschmälerten Sprachbesitzes gemacht. Doch „besitzen“ oder „beherrschen“ sind falsche Wörter für die Art und Weise, wie wir in Sprachen leben und wie Sprachen in uns leben. Sie führen ein unberechenbares Eigenleben, können sich wie Schmarotzer in uns einnisten und uns einzelne Wörter aufdrängen, die dann tagelang als Ohrwurm und Hirnwurm unseren Schädel beherrschen.
Zeitweise also sind sie übermächtig, zeitweise aber sinken sie ab. Wir glauben schon, sie verloren zu haben, doch sie haben sich nur in ein geheimnisvolles Anderswo verzogen – nach schwer ergründbaren Lebensrhythmen, die eine Anekdote über den französisch-deutschen Schriftsteller Adelbert von Chamisso (1781 bis 1838) andeutet: von ihm wird erzählt, er habe im Koma fremde Sprachen gesprochen, und zwar meistens Hawaiisch, das er bei einer Weltumseglung gelernt hatte.
Die Schwankungen meiner Vertrautheit mit dem Dänischen fallen auch in den Zeitraum, wo ich Texte von Inger Christensen übersetzt habe, angefangen mit ihrem Hörspiel Klædt på til at overleve (1967). Nachdem 1972 Azorno erstmals auf deutsch erschienen war, trat eine Pause ein – eine Pause von fünfzehn Jahren, in der ich auch sonst kaum aus dem Dänischen übersetzt habe. Die Sprache war in mir abgesunken, ich wagte kaum noch, sie zu sprechen.
Aber ich wollte das Dänische nicht aufgeben. 1985 erfüllte ich mir einen alten Wunsch und schaffte mir Verner Dahlerups Ordbog over det danske Sprog an, später auch Christian Molbechs Dansk Ordbog in der zweiten Auflage aus dem Jahre 1859 (wie handschriftliche Eintragungen zeigen, hat mein Exemplar davor dem Pfarrer Ole Jørgen Sadolin, danach seinem Sohn, dem Arzt Frode Sadolin gehört): Hinweise darauf, daß meine Sprachkenntnis sich nicht mehr von selbst verstand, daß sie einer neuen Fundierung, einer tieferen Verwurzelung bedurfte.
1987 fragte mich dann Josef Kleinheinrich, ob ich für seinen Verlag alfabet ins Deutsche übersetzen wolle. Damit konnte ich nicht nur die Zusammenarbeit mit Inger wiederaufnehmen – ich verdanke ihr auch meine Re-alphabetisierung im Dänischen, denn in wortwörtlichem Sinne mußte ich diesen Text durch buchstabieren, wenn auch nur bis zu dem Buchstaben n. – Über meinen Wunsch brauche ich deshalb nicht lange nachzudenken: ich bin mit Inger von a bis n gegangen, jetzt möchte ich mit ihr auch von o bis z gehen!
Hanns Grössel, aus: Til Inger Christensen pa tresarsdagen den 16. Januar 1995, redigeret af Christian Bundegaard, Pia Juul, Pia Tafdrup og Soren Ulrik Thomsen, Kobenhavn 1995, Festschrift zum 60. Geburtstag Inger Christensens.
Landschaft mit Tiefenschärfe. Eine Vorbemerkung
– Inger Christensen, Sarah Kirsch „Die flach ausgedehnte Landschaft des Bewusstseins“. Briefwechsel 1986–2001. –
„Hoffe sehr, daß es Dir in W. doch gefällt. Daß die Ortsgeister Dich lieblich umschweben und Du Gefallen an der Streusandbüchse doch findest“, schreibt Sarah Kirsch am 3. Februar 1995 an die dänische Schriftstellerin Inger Christensen. Hinter der Initiale W. verbirgt sich der Ort Wiepersdorf mit seinem von Künstlern genutzten Schloß, in dem sich Christensen zu dieser Zeit als Stipendiatin aufhält. Der Brief ist Teil eines Konvoluts von Schriftstücken, das sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach sowie in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen befindet. Die Briefe und Postkarten dokumentieren eine Korrespondenz ab Mitte der achtziger Jahre bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts.
Für Kirsch ist das Refugium nahe Jüterbog eine „Lieblingslandschaft“, an die sie in der Frankfurter Poetikvorlesung Geschenk des Himmels erinnert:
Es muß im Jahre 73 gewesen sein als ich mit meinem vierjährigen Knaben etwas verrütteter Herzensverhältnisse wegen um die Pfingstzeit nach Wiepersdorf kam in einen fürchterlich blasenschlagenden Regen. Ich arbeitete täglich am elegischen Stücke oder lief mit dem Kinde langsam erfreut meilenweit durch die Arnimsche Landmark oder wir sprachen zu den italjänischen Gnomen den kopflos gewordenen steinernen Göttern im Park.
In der damaligen „Erholungs- und Arbeitsstätte für Kulturschaffende“, dem heutigen Künstlerhaus, entsteht – bevor sie 1977 mit Sohn Moritz die DDR verläßt – ihr Zyklus von elf „Wiepersdorf“-Gedichten, der 1976 in Rückenwind erscheint. Der Auftakt:
Hier ist das Versmaß elegisch
Das Tempus Praeteritum
Eine hübsche blaßrosa Melancholia
Durch die geschorenen Hecken gewebt
Auch Christensen fühlt sich hier wohl. Neben der ihr zugeteilten „supermodernen 2-Zimmer-Wohnung“ erscheint ihr jedoch die Gaststätte Donath in der Dorfstraße als die „einzige richtige Attraktion in Wiepersdorf“, der sie regelmäßig einen Besuch abstattet. Während sie im Schloß, dem ehemaligen Wohnsitz der Arnims, von einer auserwählten Schar künstlerisch arbeitender Menschen umgeben ist, begegnet sie in der Dorfkneipe den Ortskundigen, die über „ihr neu-altes Leben“ berichten, „als ob die Wende nur so eine Kräuselung auf der Oberfläche wäre“. Dabei erlebt sie einen „Kulturzusammenstoß “ in einer für sie „unbestimmbaren Landschaft“.
Zeugen Kirschs Wiepersdorfer Gedichte von einer enormen Produktivität, fragt sich Christensen zwei Jahrzehnte später:
Ob es also hier zum Schreiben kommt, weiss ich nicht.
Im ländlichen Abseits, dessen Erkundung sie mit Spannung entgegensieht, fühlt sie sich an die „übriggebliebene Frühheit“ der Kindheit erinnert, eine „wochenlange Sonntagsstille“, die der rastlosen Kosmopolitin kostbare Zeit schenkt. Søren Ulrik Thomsen erinnert sich 2009 in seinem Nachruf auf die Dichterfreundin in der dänischen Zeitung Politiken, sie habe auch in ihrer Kopenhagener Wohnung in der Dag Hammarskjölds Allé auf Østerbro den Paß stets in ihrer Handtasche gehabt:
Manchmal wirkte sie auf einem Kaffeehausstuhl in Wien oder in einer römischen Hotellobby mehr zu Hause.
Reisend ganz bei sich, fühlte Christensen mitunter eine schalkhafte Genugtuung, nicht immer nur schreiben zu müssen.
Einen gemeinsamen Aufenthalt in Wiepersdorf hat es leider nicht gegeben. Weitaus intensiver als die persönlichen Treffen scheinen ohnehin die zahlreichen Wort-Begegnungen gewesen zu sein. In einem Briefentwurf vom Oktober 1992 sagt Christensen, auch wenn ein Wiedersehen auf sich warten lasse, sei man doch in der „Schrift fysisch zusammengebracht“. So gibt es eine abwesende Anwesenheit bei der Lektüre der Publikationen, die zwischen Kopenhagen und Tielenhemme ausgetauscht werden. Und es kommt vor, daß sich während einer Zugreise die Buchstaben mit der vorbeiziehenden Landschaft und den eigenen Erinnerungen zu einem magischen Raum verbinden.
Zur ersten persönlichen Begegnung kam es wohl 1985, wie Christensen auf einer Postkarte vom 15. Mai 1990 erwähnt. Ein Foto in der Publikation 50 Jahre Goethe-Institut Kopenhagen 1961–2011 bestätigt diesen Hinweis auf ein Treffen in Dänemark. Es heißt dort, daß Sarah Kirsch bei der Lesung im Kopenhagener Goethe-Institut von der Dänin Inger Christensen „eingeführt wurde“.
Auch in einem Brief an Christa Wolf vom 2. Juli 1985 kündigt Kirsch diese Lesungen – „4 Stück in Dänemark“ – an. Die Herausgeberin Sabine Wolf merkt dazu an:
Vom 16. bis 19.9.1985 liest Kirsch in Aalborg, Århus, Odense und Kopenhagen.
Schließlich resümiert Kirsch in der 2010 erschienenen Prosaminiatur Krähengeschwätz unter dem Datum 22. September 1985:
Nach der Lesung ein kleenes Fest mit denen Übersetzern meiner Gedichte, 3 rothaarigen Engeln, wo wir auch Inger Christensen trafen.
Zwölf Jahre später, in ihrer Laudatio zur Verleihung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Preises an Kirsch, bedauert Christensen allerdings, daß die Preisträgerin es leider noch nicht in ihre Kopenhagener Küche geschafft hat, „dann wäre diese Szenerie für immer in ihrem Bewusstsein gespeichert und damit nicht nur Teil der sprachlichen Landschaft, die sie geschaffen hat, sondern auf paradoxe Weise auch ein Teil der physischen Landschaft, in der sie gelebt hat, so als könnte Kopenhagen ein Teil der Marschlandschaft sein“.
Christensens Differenzierung zwischen sprachlicher und physischer Landschaft verweist auf ein Spezifikum ihres Dialogs mit Kirsch, der immer wieder um Regionen kreist, in denen sie sich „physisch“ aufhalten. In der literarischen Reflexion scheinen sich diese auszuweiten. Das tröstet über die Tatsache verlorengegangener Schriftstücke in der Korrespondenz hinweg, die im Werk als sprachliche Landschaften weiterexistieren.
So vermag Christensen in ihrer Laudatio eine „Landschaft Kirsch“ zu kartographieren, in der ein Meridian zwischen der Urbanität Kopenhagens und der rauhen Marschlandschaft von Tielenhemme verläuft. Demzufolge könnte Kirsch auch eine Dänin sein, da sie auf friedliche poetische Weise ein Gebiet „wiedererobert“, das zwischen 1559 und 1864 dänisch war:
aus der Marsch zieht sie nach Jütland hinauf und holt das Ganze mit nach Hause zu dem, was ich von jetzt an die ,Landschaft Kirsch‘ nennen werde.
Christensen verweist damit auf die besagte Reise ins nördliche Dänemark (Aalborg, Århus, Skagen), die Kirsch drei Jahre später in ihrer Chronik Allerlei-Rauh ebenfalls in eine magische Sprachlandschaft verwandelt. Alles ist wohl eine Frage der Perspektive. Denn wieder in Tielenhemme muß sie feststellen, sich „recht eigentlich doch auf Jylland“ zu befinden, „wo sich die beiden verschiedenen Meere bis zur Bewußtlosigkeit des Betrachters umarmen“. Zudem sieht sie in dem „gläsernen Licht“ auf der „Spitze eines im Flugsand versunkenen Kirchturms“ ihre Sehnsucht ins Offene gespiegelt, die sie zu der Wortschöpfung „Salzlicht“ inspiriert.
In Kirschs Krähengeschwätz-Prosa, die die Zeit zwischen März 1985 und Dezember 1987 reflektiert, erscheint ihre „Missionsreise durch Danmark“ als eine wundersame räumliche Verlängerung:
Die Landschaften unterwegs waren einfach ne Fortsetzung unserer Breiten, Wikingersteine und Schafe. Wir wohnen ja selber auf Jylland. Erst ging es ins nördliche Ålborg wo wir herrliche Häuser erblickten, unter anderem das erste fünfstöckige Steinhaus Europas, Jens Bangs Steenhus. Über den Limfjord nach Nørresundby: eine gewellte fast baumlose Landschaft, Wikingergräber und Schnuckenschafe zwischen den alten Steinen.
Im Prozeß intensiver poetischer Erkundung werden reale Regionen zu magischen Landschaften, in denen sich das schreibende Ich, getragen von der tröstlichen Gewißheit, selbst ein „Stückchen Natur in dem Ganzen“ zu sein, heimisch fühlt.
Wie zur Bestätigung findet sich im Archiv ein Brief mit einem Foto – datiert mit „Tee 12. Jaguar 2000“ –, das Kirsch in robuster, wetterfester Kleidung zeigt. „Tee“ steht für Tielenhemme, jene Gemeinde im Dithmarschen, in der sie mit Moritz ab 1983 in einer alten Dorfschule, der „Moor-Schule“, mit Deichgrundstück ansässig ist. Der Brief wurde mit einem Faxgerät gesendet, dessen stolze Besitzerin Kirsch seit kurzem ist. Wobei das Foto die Erinnerung an das frühe Gedicht „Winter“ aus dem lyrischen Debüt Landaufenthalt von 1967 hervorruft, das Christensen als „Selbstporträt“ bezeichnet. Es beginnt mit den Worten: „Ich lerne mich kennen“ und endet mit den Versen:
Ich liebe meinen Bauernpelz meine Stiefel
Und mein trauriges Gesicht
Während die von skeptischer Melancholie grundierten Zeilen wie ein frühes poetisches Credo klingen, visualisiert das Foto drei Jahrzehnte später jene Momente, die Christensen in ihrer Rede „Die Landschaft Kirsch“ analysiert: eine „charakteristische Mischung des Gesamtwerkes aus Robustem und Rätselhaftem, aus sichtbaren Tatsachen und einem Ich“, das „ganz einfach diese Tatsachen selbst ,ist‘ in dem Sinne, daß alles ,Ich‘ sein kann“. Dieser Gedanke schließt wiederum an eine Episode an, die sich ebenso in der Chronik Allerlei-Rauh findet und die Kirsch in ihrer Frankfurter Poetikvorlesung Das Siebengestirn von 1996/97 nochmals zitiert – womit sich die Zeiten mehrfach überblenden.
Ende des Sommers habe ich einen ganzen Tag mit dem Schäfer Moorschnucken in den Binsenwiesen gehütet. Er gab mir seinen langen Schäferstock, mich darauf zu stützen wie auf den alten Gemälden, und ich stand zwischen den Sumpflöchern in originaler Haltung, die Füße weit ausgefahren, die Hände übereinandergelegt auf dem Stockknauf, das Kinn darauf gestützt, der Leib völlig entspannt, von Bienengetön, dem leichten fächelnden Wind umgeben, während der Kuwacs die eigentliche Arbeit wohl übernahm, ich nur auf das Blöken der Lämmer achthaben mußte, nachdem der Schäfer zu einer anderen Weide ging. Als ich so stand und allmählich wie ein Stück Natur in diesem Flachland war, der brütenden Sonne ausgesetzt wie ein x-beliebiger modernder Baumstamm, und mir jedes Zeitgefühl abhanden kam und mein Körper so porös wurde, daß die Lerchen durch ihn gerieten, fand ich Gefallen daran, für den Blauen Planeten eine archaische und eine augenblickliche Natur zu unterscheiden. Die eine, sagte ich mir und sank fußbreit ins Moor, lappt mancherorts noch in die andere über, und ich war es in diesem Augenblick sehr zufrieden, an solcher Stelle mich aufzuhalten, weil eine Existenz in reiner archaischer Natur, wenn ich sie noch gefunden hätte, mir meiner Bedürfnisse wegen und der meinem Alter angemessenen körperlichen Fähigkeiten nicht mehr möglich schien, die zeitgenössische Natur jedoch, wie sie eine Stadt vielleicht abgibt, für mich nur noch ein gelangweiltes Entsetzen brachte vor Leere und Fülle, blitzendem Tand. Es kam bei meiner Moorphilosophie letztlich darauf an, wofür die Menschen ich ansah.
Inger Christensens und Sarah Kirschs Korrespondenz findet in wechselnder Landschaft statt, die reisend, schreibend, lesend wahrgenommen wird.
(…)
Carola Opitz-Wiemers, Sinn und Form, Heft 5, 2021
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
WAS ICH EIGENTLICH HOLEN WOLLTE
Für Hanns Grössel
Was ich eigentlich holen wollte,
weiß ich immer noch nicht; ich kam
mit Gelatine nach Haus. Wie lange hab ich
wohl am Fenster gestanden? Über den Dachfirsten
bauen die Wolken sich auf; die Firste sind der Horizont
von meinem dritten Stock aus. Die Wolken wahren die Form,
oder richtiger: ihre Verwandlung geschieht so langsam,
daß sie kaum wahrnehmbar ist. Vielleicht weil ich
an etwas andres denken muß.
Etwas zwischen zwei Tagen und zwei Jahren.
Noch. Zu leben. Du kannst eine Welt aufbaun,
sie wieder einreißen, du kannst loslassen,
die Verwandlung geschehen lassen, dich als Wolke
vom Wind führen lassen, über die Firste, den Horizont.
An dem Fenster im Dritten vorbei.
Ulrikka S. Gernes
Übersetzung Peter Urban-Halle
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + IMAGO
Nachrufe auf Hanns Grössel: FAZ ✝︎ Übersetzen ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


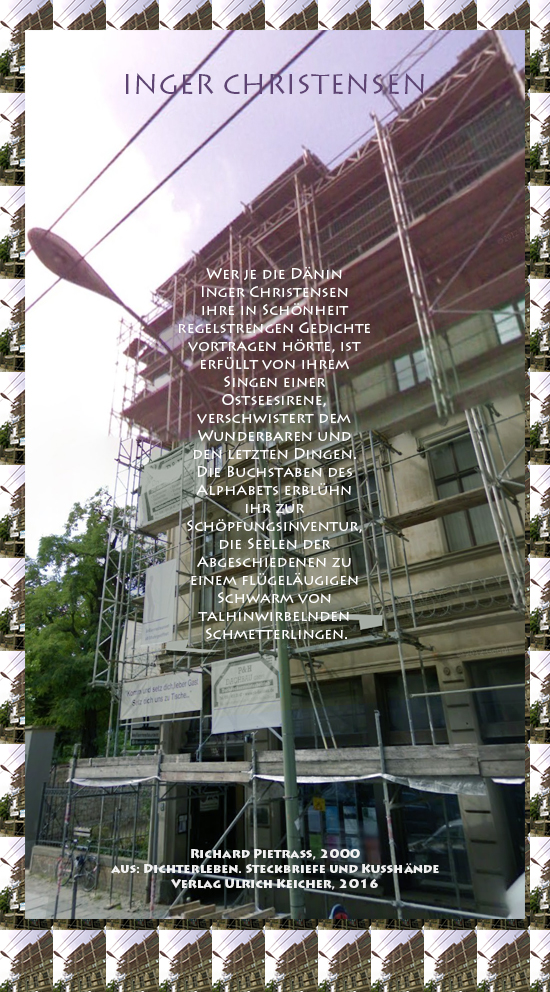












Schreibe einen Kommentar