Ingrid Pergande, Ulrich Kaufmann (Hrsg.): „Gegen das GROSSE UMSONST“
FORTGESETZTER WIDERSTAND
An einem Spätsommertag des Jahres 1939, Volker Braun dürfte in seiner damals noch unzerstörten Heimatstadt Dresden in der Wiege gelegen haben, heulten in der Hauptstadt Großdeutschlands zum ersten Mal die Sirenen, die die Bevölkerung auf Luftangriffe vorbereiten sollten. Noch fielen keine Bomben, aber jedermann wußte, daß damit der Zweite Weltkrieg begonnen hatte. Ich tröstete mich damit, daß ich erst dreizehn war und folglich dem Schlachten entgehen würde. Ein kindischer Trugschluß – doch überlebte ich immerhin. Und in der Mitte der sechziger Jahre traf ich bei Freunden den jungen Dichter, dessen Name sich rasch herumzusprechen begann.
Braun las Gedichte, und in einer Pause des Nachdenkens merkte ich an, wie ärgerlich es sei, beim Zuhören immer schon daran denken zu müssen, ob dieser oder jener Text Chancen hatte, gedruckt zu werden. Braun entgegnete prompt, das Ohr, das auf solche Weise mithöre, müsse man abschrauben. Da gab der Vorturner beim Training des aufrechten Ganges bereits seine Visitenkarte ab. Er schrieb im Auftrag, doch schon damals nur in seinem eigenen.
Braun war sehr höflich, konnte zuhören und äußerte sich mit Respekt, doch fand sich in seiner Konzilianz keine Spur von Opportunismus. Wo es ihm darauf ankam, trug er seine Ansichten mit einer freundlichen Bestimmtheit vor, die einladend wirkte und von der Kraft ausging. Es kostete übrigens auch Kraft, den eingeschlagenen Weg durchzuhalten gegen Mißtrauen, bösartige politische Unterstellungen, bürokratische Kleinlichkeit und Verbote – und auch gegen nagende Selbstzweifel.
Je näher ich seinem Werk kam, desto deutlicher nahm ich (nicht ohne Erstaunen) wahr, daß dieser junge Bursche – für mich blieb er das in gewissem Sinne immer – mich dahin drängte, meine eigene Aufgabe kritischer zu bedenken. Talente hätten, meinte Goethe, „immer etwas Verwegenes“, und wenn das stimmte, so mochte es wichtiger sein, die Spezifik eines Talentes zu begreifen und begreiflich zu machen, statt es schulmäßig zu belehren. In der Besprechung früher Gedichte Brauns im Forum hatte ich 1968, lang ist’s her, gemeint, Braun vor einer Neigung zu sensationellen Paradoxien im Sprachgebrauch warnen zu sollen,1 und hatte eben damit an etwas vorbeigeredet, was zu seinem Eigensten gehörte.
Braun befaßte sich stets mit Politik, und sein jüngst erschienener Band mit „Äußerungen“2 bezeugt, daß er das auch weiterhin tut. Und da seine Weise, sich zu äußern, das Wort ist, hat er etwas von einem Tribun – in dem Sinn, daß der Gedanke zur Verwirklichung, das Wort zur Tat drängt. Aber er ist auch kritischer Kopf, analytischer Denker, ein echter Abkömmling von Marx, und kann deshalb nie bloßer Nachredner sein („Der Widerspruch von Disziplin und eigenem Denken […] war mein eigenes Trauma“, sagt er im Rückblick). Der Tribun und der Analytiker stehen permanent in einem Widerspruch zueinander, der fruchtbar ist, aber einen aufmerksamen Leser verlangt, jedenfalls einen, der bereit ist, sich aus geistiger Bequemlichkeit aufstören zu lassen. Das aufgerufene Wortmaterial, vom Sprichwort bis zum Goethe-Zitat einerseits, zum Jargon andererseits, vor allem aber die abgenutzte, allzu achtlos hingesprochene Phrase, hinterfragt der Poet mit oft sarkastischem Humor, stellt Satzteile überraschend gegeneinander und schafft so neue Bedeutungen oder stellt alte wieder her. In solcherart Verfremdung wird die Sprache gleichsam gewaschen, falsches Bewußtsein ausgetrieben. Indem wir als Leser diesen Prozeß mitvollziehen, werden wir in einen kollektiven Prozeß hineingezogen. Das Sprachgebilde ist Ort der Begegnung.
„Begegnung“ scheint mir ein zentraler Begriff des Braunschen Denkens und Fühlens zu sein. Er bildet die Antithese zur „Entfremdung“. Zwar sind die Momente seltener geworden, in denen der in Kämpfe Verwickelte, der „Ent-Täuschte“, der selbst so viel zur Liquidierung von Täuschungen beigetragen hat, das Miteinander befreundeter Menschen, das „laute Gespräch“ oder die Liebesbeziehung als besonders intensive Form der Begegnung feiert; doch gehört der Gedanke, daß die von Ämtern und Institutionen aufgebauten oder aufrecht erhaltenen Schranken zwischen den Menschen zerbrochen werden könnten und müßten, zum Kern seines Menschenbildes, ist Utopie und Triebkraft. Sein Verständnis von Demokratie schließt eng daran an. In den Tagen der „Wende“ meldete er sich wieder als Tribun zu Wort, suchte die kurzen und bescheidenen Momente des „lauten Gesprächs“, des noch unreglementierten Demokratismus (Meetings, Runde Tische) zu ermutigen, fragte aber vor allem sogleich, welche geschichtliche Dimension diese „Wende“ hat.
Der Band, der solche „Äußerungen“ sammelt, mischt in seinem Doppeltitel beinahe tückisch Banales mit Hintergründigem: Volker Braun: Wir befinden uns soweit wohl und Wir sind erst einmal am Ende. Das scheinen abgegriffene Worte zu sein, doch ist leicht herauszuhören, daß sie Brauns Übersetzung des (Verlegenheits-)Wortes „Wende“ bilden und auf das Nicht-Endgültige zielen. Ich blättere in den Verlautbarungen der letzten Jahre, lese mich hinein und sehe mich Seite für Seite bestärkt in der Gewißheit, daß Braun nicht am Ende ist. Seine Bilanz bleibt „vorläufig“, seine Kritik und Selbstkritik – in dem Wort „wir“ wächst beides zusammen – ist rücksichtslos, aber nicht fatalistisch oder selbstzerstörerisch. Peter Weiss’ Ästhetik des Widerstands hat ihn stark berührt, und er macht aus diesem Titel eine Leitlinie für sein weiteres Schreiben und unser aller Handeln: Widerstand wird auch weiterhin nötig sein. Er sagt uns nicht, was kommen wird, doch ist für ihn gewiß, daß die Absage an Fehlentwicklungen und falsche Hoffnungen nicht in Anpassung an eine Welt verewigten Konkurrenzkampfes, die sich als „Spaßgesellschaft“ drapiert, einzumünden habe. Man kann nur staunen, wie er dies bereits im Jahr des Um- und Zusammenbruchs in einem zwölfzeiligen Gedicht auf den Punkt bringt, das mit „Das Eigentum“ überschrieben ist.3
Es beginnt damit, daß der Dichter (nach seiner Art) zwei lapidare Kurzsätze aneinanderstoßen läßt:
Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.
Mir ist, als meine das zentrale Wort „mein Land“ mehr als eine geographische oder auch politische Ortsbestimmung. Bei der Wiederentdeckung der deutschen Romantik fiel der Blick einiger Schriftsteller auch auf Mörikes Dichtung „Der letzte König von Orplid“ (aus Maler Nolten), dessen Anfang lautet:
Du bist Orplid, mein Land,
Das ferne leuchtet
Bei Braun wird in dem gleichsam erschrocken konstatierten Bruch zwischen „Ich“ und „mein Land“ Utopie von gestern aufgerufen und unsentimental verabschiedet. Und was als Hintergrund mitzudenken ist, artikuliert Braun auf doppelt überraschende Weise. War es der sich anbietende Reim auf „Westen“, der ihn inspirierte, das von Büchner aus der Französischen Revolution nach Deutschland importierte „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ in Initialen herbeizuzitieren, jedoch auf den Kopf gestellt? Wo „Friede“ stand, steht jetzt „Krieg“, wo es „Hütten“ hieß, heißt es jetzt „Palästen“. Steht die Welt Kopf – oder nur unsere bisherige Vorstellung von ihr?
Am Anfang des Gedichtes heißt es „ich“, an seinem Ende „alle“ – was aber „wir alle“ bedeutet. Wenn Braun im Gedicht, im Essay oder auch in lyrisch-dramatisch-prosaischen Mischformen „ich“ sagt, so spricht er als einer von uns. Sein Wort ist an Menschen adressiert, die der Einsicht fähig, nicht weniger aber von Leidenschaften und Leiden, von Freuden und Hoffnungen, den Möglichkeiten und Zwängen des profanen irdischen Lebens bewegt sind – wie er selbst. Einer von uns wird er dadurch, daß er sich sozusagen ungeschützt preisgibt. Der kritische Kopf schreibt immer auch mit Herzblut. Was ihm durch den Kopf gegangen ist, ist ihm auch durch Mark und Bein gegangen (oder erzeugt jedenfalls den Schein, als sei es so). Dabei ist die Authentizität seiner Selbstdarstellung weniger davon abhängig, ob alles, was er ausspricht, sich faktisch so verhalten hat, wie es da auf dem Papier steht. Entscheidend ist die Evidenz, mit der aus dem Miteinander von gedanklicher Durchdringung und emotionalem Berührtsein die Vorstellung von einem ganzen Menschen entsteht. Der da „ich“ sagt, ist, wie jeder, sowohl „das Ensemble seiner Verhältnisse“ – als ein unverwechselbarer, soziologisch nicht auszudeterminierender „Dieser“. Im ideellen Austausch mit ihm meint man, er sei, frei nach Hölderlin zitiert, „wie Unsereiner“, und man hat es dabei mit einem auf Dauer wichtigen Dichter unserer Zeit zu tun.
Salut, Volker.
Hans Kaufmann, 1999
WIE IST DIE LAGE?
– Kritische Bemerkungen zu Brauns „Lagebericht“. –
Der Dichter des Lageberichts4 erscheint mir als einer, der viel gelernt hat seit der Zeit, da wir zuerst Gedichte von ihm lasen. Als ein anderer und doch derselbe tritt er uns heute entgegen. Derselbe: ein aktiver und auf Aktivität drängender, streitbar gegen Kontemplation und bequeme Harmonisierung auftretender Sprecher, der sich mit den vorwärtstreibenden Kräften der sozialistischen Gesellschaft verbunden fühlt, ein Rufer, jedoch nicht in der Wüste, sondern zwischen Bauplätzen und Fabriken, die seinen Worten einen kräftigen Widerhall verleihen. Ein anderer: dessen Blick sich, wie mir scheint, geweitet und geklärt hat. Sowohl im einzelnen Gedicht als auch vor allem in ihrer Zusammenordnung zum kleinen Zyklus sind das Bild, die situationsbestimmte Reflexion, die Polemik strenger als früher einem ideellen Ganzen zugeordnet. Einern gemeinsamen programmatischen Titel subsumiert und in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, sollen die einzelnen Stücke des Lageberichts auch in ihrem Bezug auf die anderen gelesen werden. Braun geht zielstrebig auf ein allerdings gewaltiges Thema los. Sein neues Werk zielt als Ganzes auf das Ganze der sozialistischen Entwicklung in der DDR und sucht namentlich sein Verhältnis zur Dialektik von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bestimmen.
Ein Merkmal dieser Lyrik besteht darin, daß sie ins Zentrum der Beziehung zwischen Ich und sozialistischer Welt energisch die materielle Produktion in ihrer persönlichkeitsbildenden Bedeutung rückt. Ich lese das Eingangsgedicht als eine Bestimmung der Position des Dichters in diesem Sinn. In schroffer Abgrenzung gegen ihm hinderlich erscheinende Haltungen („Zufriedne“, „Heilskünstler“) sagt er, wovon man ausgehen muß, um die „Lage“ zu erkennen: von den produzierenden und über ihre Arbeit nachdenkenden Brigaden, den lernenden Kindern, den die Zukunft planenden Forschern, den zur Armee sich formierenden Menschen, die Geschichte machen. Die folgenden zwei Gedichte und noch einige andere beschäftigen sich denn auch mit Arbeitsvorgängen. Doch geht es nicht um die Produktionssphäre als Stoff lyrischer Gestaltung, sondern um sehr viel mehr, nämlich um den angemessenen künstlerischen Ausdruck der Beziehung von Ich und Umwelt in der wissenschaftlich-technischen Revolution unter sozialistischen Bedingungen.
Vor fast einhundertzwanzig Jahren verspotteten Marx und Engels einen Herrn Daumer, der sich vor der „geschichtlichen Tragödie“ der modernen Klassenkämpfe „in die angebliche Natur, das heißt die blöde Bauernidylle“ flüchtet und „schließlich seinen Kindern mit heiligen Schauern Klopstocks Frühlingsode vordeklamiert“. „Von der modernen Naturwissenschaft“, heißt es weiter, „die in Verbindung mit der modernen Industrie die ganze Natur revolutioniert und neben anderen Kindereien auch dem kindischen Verhalten der Menschen zur Natur ein Ende macht, ist natürlich [bei Daumer – H. K.] keine Rede.“ Eine kühne Voraussage, die die Dichter angeht – aber wo wird sie in der Poesie bestätigt? Unter kapitalistischen Bedingungen erscheint immer wieder als das Poetische, als Sphäre, in der sich das Individuum bejaht und bestätigt, in der es Zuflucht sucht, eine Natur, die vom gesellschaftlichen Getriebe unberührt, unbeschmutzt, die heil und ganz ist. Ihr wird zugeschrieben, was der Mensch sein möchte und nicht sein kann. Das Vordringen der Industrie in Wald und Tal wird folglich als schreckenerregender Vorgang, als Tod der Poesie aufgefaßt. Und für den mit der Arbeiterklasse verbundenen Dichter ist die wichtigste Sphäre menschlicher Bejahung die des politischen Kampfes, nicht die der Produktion. Denn da die Entfremdung noch nicht verschwindet, wenn man sich ihrer bewußt wird, sondern erst, wenn man ihre Voraussetzung, die kapitalistische Basis, beseitigt, bildet der politische Kampf den entscheidenden Hebel zur Wiedergewinnung der Menschenwürde und folglich den wesentlichen poetischen Gehalt für den sozialistischen Poeten. (Nicht zufällig steht der Hymnus auf die Arbeit, der die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen verschweigt, oft unter religiös mythisierenden und politisch reaktionären Vorzeichen.) Hier wie in der Produktionslyrik, die bald nach 1945 bei uns entstand und das Lob der befreiten Arbeit sang, kam die Natur, genauer: die Gesamtheit der Umweltbeziehungen des Menschen, oft zu kurz. In einem Gedicht, das „Schlechte Zeit für Lyrik“ heißt, schreibt Brecht:
Der verkrüppelte Baum im Hof
Zeigt auf den schlechten Boden, aber
Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen
Krüppel
Doch mit Recht.
In keiner „schlechten Zeit für Lyrik“ mehr lebend, sucht nun Volker Braun ein reiches Naturverhältnis des Menschen poetisch zu vergegenwärtigen und läßt zugleich von dem kindischen, sentimentalen Verhalten zur Natur keine Spur übrig. Tätigkeit (nützliche, auch harte Arbeit) und Genuß (Selbstbestätigung im Anschauen der Umwelt) erscheinen nicht mehr getrennt.
Zweierlei zeichnet den Lagebericht in dieser Hinsicht aus. Einmal stellt sich die Natur ganz überwiegend als die vom Menschen geschaffene Umwelt dar, als sein „unorganischer Leib“, das „aufgeschlagene Buch seiner Wesenskräfte“, wie Marx sie nannte. Das gilt nicht nur für die technische Landschaft der Zukunft, die sich dem Dichter beim Gang durch die Leipziger Messe eröffnet, sondern auch für das Stückchen Vogtland, das die Arbeiter morgens auf dem Weg zur Schicht durchmessen:
Auf schmalen Teerstraßen Arbeiter, täglich, neben
Den Pfützen hangzu auf das Geräum und hinab
In Sturzdörfer, eilig, unser Schritt
Schleudert Industrie hinterm Hügel vor, unter uns
Die Wasser rot von den Färbern, Wälder umstellt
Von Motoren […]
(„Das Vogtland“)
Sogar die Begegnung mit der Geliebten, die zwar, wie naheliegend, etwas abseits vom Getriebe stattfindet, schließt eine positive Bezugnahme auf die tätige Umwelt und von Menschen geschaffene Landschaft nicht aus, sondern ausdrücklich ein. Der traditionelle Gegensatz zwischen Natursphäre und Menschensphäre entfällt. Die Einheit des Menschen mit seiner Tätigkeit und mit deren Ergebnissen, der erschaffenen Umwelt, wird von Braun kaum als These vorgetragen, sie ist vielmehr wesentliches Element seiner Denk- und Sehweise und durchtränkt die Gedicht; die Natur dieser Dichtung ist davon bestimmt. Zum anderen entsteht aus dem tätigen Verhältnis zur Natur das Bild des Menschen: sein Antlitz, sein Lebensanspruch und seine Lebensfülle. Das Gedicht „Gegenwart“ stellt die kleinen Menschen und die große Maschine gegenüber, um dann dieses Erscheinungsbild, das sich bei einer statischen, photographischen Betrachtung ergibt, durch die Schilderung der Dynamik in der Beziehung zwischen Mensch, Maschine und bearbeitetem Naturstoff umzukehren. Wer ist klein, wer groß? Wer ist Herr, wer Knecht? – Am Schluß ist es der riesige Bagger, der „schlapp macht“, während die„ winzige Schar“ ihrem Triumphgefühl über die freigelegten Energien in „kindischer Brüllerei“ Luft macht.
Besonders bemerkenswert erscheint mir das nächste Gedicht: „Von Martschuks Leuten“. Nicht nur sein Titel erinnert an Brechts „Von des Cortez Leuten“. Braun schafft vielmehr, gestützt auf Berichte über sibirische Großbauten, bewußt ein Gegenstück zu diesem frühen Werk Brechts. Bei diesem dringen die Abenteurer oder Eroberer in die Wildnis ein und werden von ihr aufgehalten, besiegt, erdrückt, wobei sie sich unter dem wuchernden Gehölz auch untereinander aus den Augen verlieren. Die außermenschliche Natur besiegt, schweigend und unnahbar, die Menschen, deren Handeln keinen sichtbaren menschlichen Zweck hat. In Brauns Gedicht korrespondiert der Sieg über die Natur genau mit dem Wachstum der Menschen und dem Reicherwerden der Beziehungen zwischen ihnen. Die ersten Ankömmlinge sitzen in der noch kaum besiegten Wildnis „einzeln, redend mit den Wellen“ herum. In direkter Umkehrung der bürgerlichen Auffassung, wonach das Anwachsen der Masse die individuelle Beziehung auslöscht, erkennen sich die Arbeiter in Brauns Darstellung bei wachsender Zahl – und das heißt auch: mit dem rascher sich vollendenden Werk – besser. Sie rufen sich an, individuelle Besonderheiten („Seine Stimme, einzelnes, Zähne gebleckt verbissen“) treten hervor und die Einsicht:
Je mehr wir werden,
Desto genauer, scheint uns, kennen wir jeden.
Die Verwandlung der Wildnis in Zivilisation durch kollektive Arbeit auf moderner technischer Grundlage begreift Braun als einen Akt gesellschaftlicher Menschwerdung. Die Leistung besteht darin, daß die großen kollektiven und technischen Prozesse als menschlich integrierbar aufgefaßt werden und darum poetisch integriert sind. Und da dies eine Entscheidungsfrage gegenwärtiger und künftiger sozialistischer Dichtung ist, verdient das Gedicht besondere Aufmerksamkeit. Vergleichbares findet sich nicht häufig in unserer Literatur.
Die zweite inhaltliche Hauptkomponente des Lageberichts – man könnte sie als gedankliche Konkretisierung, als Historisierung der ersten auffassen – sehe ich in der Fixierung und künstlerischen Wertung des heutigen Tages als Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Als es nicht mehr genügte, den zum Alltag werdenden Sozialismus aus seinem Gegensatz zur kapitalistischen Vergangenheit zu bestimmen, verfielen einige Schriftsteller bei uns darauf, ihn aus einem Gegensatz zur kommunistischen Zukunft zu definieren. Daraus entstand eine im Schillerschen Sinn sentimentalische Betrachtungsweise: Im Licht des Ideals erschien die Gegenwart als Mangel; erträumter künftiger Fülle stand heutige Dürftigkeit gegenüber. Der Lagebericht hat die falschen Antinomien hinter sich gelassen und durch Dialektik ersetzt. Aber Braun entsinnt sich jener Debatten und nimmt sie in Gestalt einer Auseinandersetzung mit sich selbst ins Schlußgedicht des Zyklus so hinein, daß jede Seite des Gegensatzes erscheint und im Gesamttext aufgehoben wird:
Wir sagen: die Zeit ist da! wir sagen: sie beginnt erst.
Wir versprechen uns nicht goldne Berge. Wir versprechen uns goldne Berge […]
Wir sagen: so bleibe es. Wir sagen: nichts bleibt.
Dazwischen zwei kühne Bilder:
Wir richten uns häuslich ein, auf dem Sprungbrett, das federnd bebt
Und kauern im Startloch, jubelnd wie hinter dem Ziel.
(„Bleibendes“)
Gleichweit entfernt von kontemplativem Feiern wie von kontemplativem Nörgeln, bejaht das Subjekt der Dichtung sich und seine Welt, also die gegenwärtige Realität des Sozialismus, dadurch, daß es um sich einen weiten Spielraum zu freier und schöpferischer Tätigkeit erblickt. Das historisch Errungene ist ihm wert als Ausgangspunkt („Sprungbrett“, „Startloch“, “freie Strecke“, „zerbrochene Schranke“ usw.) zu neuer Bewährung. Das Schöne liegt nicht im Zustand, sondern in der Bewegung, die zu ihm hin- und über ihn hinausführt. Man beachte etwa das Verhältnis von Einzelbildern und Gesamtlage in dem Gedicht „Das weite Feld“. Nicht im Glanz polierter Details spiegelt sich das bejahte Neue; sie sind in ihrer Rauhigkeit und Sprödigkeit, wohl sogar in betonter Abwehr jeder Verschönerung gesehen:
[…] die Schädel gegeneinander
Über dem Tisch, verbohrt […]
[…] die Kaschemme dröhnt
(„Das weite Feld“)
Aber daraus entsteht das Gesamtbild jener Gemeinschaft von Tätigen, die auch Denkende und darum des Dichters Hoffnung sind. Ähnlich das Gedicht „Vogtland“, das übrigens eine bestimmte historische Situation präziser erfaßt als „Das weite Feld“. In derben, wegwerfenden Wendungen bezeichnet Braun die rückständigen Produktionsbedingungen, unter denen – heute noch unvermeidlich – ein Teil der Arbeiter schafft, und seine Phantasie vervollständigt den neben der Blechbude sich abzeichnenden Großbau zu einer modernen Industrielandschaft. Möglich, daß mancher Leser aus Sorge, Braun wolle der DDR einen Makel anhängen, mit ihm ob solcher Formulierungen ins Gericht geht. Wie denn: Sind wir vielleicht ein Land, „das seine Socken verhökert“? – Aber diese Bissigkeiten stehen in einem Kontext, der mit wünschenswerter Eindeutigkeit die DDR als Heimat charakterisiert, in der zu leben, für die zu mühen sich lohnt. Was ihn an unserer Gegenwart stört und belästigt, bezeichnet Braun derb satirisch (und nicht immer genau), aber es türmt sich nicht zur Barriere, die dem Fuß und dem Auge den Weg von der Gegenwart in die Zukunft verstellt. Und Braun weiß auch, daß die Möglichkeit, zu neuen Ufern aufzubrechen – keine abstrakte Möglichkeit für ihn, kein „Prinzip Hoffnung“, sondern mit Händen zu greifen, mit jeder nützlichen Tat in Wirklichkeit zu verwandeln –, selbst eine historische Errungenschaft ist. Darauf gründet sich sein Urteil in dem Deutschlandgedicht des Zyklus („Wir und ihr“). Braun konfrontiert nicht zwei Zustände, sondern charakterisiert das „Drüben“ durch Bilder der Zuständlichkeit, das „Hüben“ durch solche der Bewegung und Entwicklung. Naturbilder, mit satirischen Schlaglichtern versetzt, sollen die Schwierigkeiten unseres Weges verdeutlichen; am Anfang steht „Diese Durststrecke gegen den Hang / Voll Eigenheimen und -nutzen“, am Ende die unbegrenzte Möglichkeit, die zu gebrauchen in unserer Hand liegt. Sie wird zum Kriterium für unsere historische Überlegenheit über den westdeutschen Staat.
Sowenig das lyrische Subjekt der Braunschen Dichtung die gegenständliche Welt, von der es umgeben ist, als eine Anhäufung fremder, starrer Dinge auffaßt, so wenig erkennt es die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen an, die Verhältnisse als fremde, äußerliche, ungreifbare Macht. Beiden gegenüber tritt es als Herr, als Schöpfer auf. Anders ausgedrückt: Der Lagebericht ist ein Gegenentwurf zur Universalisierung und Vergottung der Entfremdung. Die Seh- und Sprechweise Brauns ist jeder Verdinglichung direkt entgegengesetzt. In allen Gedichten ist stets der Sprecher anwesend und mischt sich reflektierend in die Beschreibung von Vorgängen, Landschaften usw. ein. (Oder umgekehrt: In „Regierungserlaß“ und „Wir und ihr“ ist die primär als zusammenhängender Gedanke angelegte Rede mit Gegenständlichem reich durchsetzt.) Die erstrebte Einheit von Denken und Tun setzt sich in der Diktion Brauns in der Weise durch, daß das Bild (die sprachliche Vergegenwärtigung von Sichtbarem) fortwährend von einer Fülle gedanklicher Assoziationen umgeben ist. Er schafft den Dingen Raum, um mit den Gedanken dazwischenzukommen. Bisweilen treibt er dabei zusammengehörige Satzglieder so weit auseinander, daß es einiger Anstrengung bedarf, damit man des vollen Sinnes habhaft wird. Besonders liebt es Braun, den im umgangssprachlichen Gebrauch unbeachteten metaphorischen Nebensinn von Wörtern und Redewendungen bewußtzumachen und zu nutzen, um im Sinnlichen das Übersinnlich-Abstrakte durchschimmern zu lassen. Eine Aussicht ist bei ihm sowohl ein Blick vom Berg ins Tal als zugleich eine historische Perspektive („Das Vogtland“); die Genossenschaftsbauern „bestimmen selbst, was ihnen blüht“, nämlich was auf ihren Feldern wächst und was ihre Zukunft ist („Das freie Feld“); die Redensart „mit Hängen und Würgen“ gebrauchen wir stellvertretend für „mit Mühe“, „knapp“ oder ähnliches. Wenn aber Braun sagt:
Wie kommen wir über den Hang
Hinweg, ohne Hängen und Würgen […]
(„Wir und ihr“)
so entdecken wir, daß die banal gewordene Redensart eigentlich vom Aufhängen und Erwürgen spricht, und das Handgreifliche weitet sich sogleich zum historisch Bedeutenden: Gefahren blutigen Völkermords, die es künftig zu vermeiden gilt, werden erinnert. Auch manche Titel gehen darauf aus, Bekanntem eine neue und überraschende Bedeutung zu verleihen: Einem Gedicht, in dem der Mensch sich in der Begegnung mit der großen Natur schon aller Fesseln enthoben sieht („nicht vorstellbar ist das Leid“), gibt er die Überschrift An alle, die uns aus ganz anderem Zusammenhang geläufig ist. Was hat der heitere Hymnus auf den freien Menschen, dem die Erde gehört wie sein Leib, mit dem Leninschen Dekret vom 8. November 1917 zu tun? Einiges. – Braun lädt uns ein, darüber nachzudenken. Solcher Sprachbehandlung hat der Dichter vielfach seine Stellungnahmen und Emotionen anvertraut, seine Zu- und Abneigungen, Humor, Ironie, Sarkasmus, Zorn, Liebe und Haß. Wenn Heines Ansicht richtig ist, daß beim Dichter Gedanke und Ausdruck gleichzeitig und aus der gleichen Quelle fließen, dann ist Brauns Sprache entschieden poetisch.
Und doch will ich nicht länger einen Einwand verschweigen, der zunächst vom Formalen ausgeht, aber auf Prinzipielles zurückführt. Diese Lyrik ist (ich vereinfache etwas, man mag mir das nicht verübeln) durchgehend auf einen leicht erhöhten Redeton gestimmt – und sie haftet nicht im Ohr und Gedächtnis. (Ich weiß wohl, daß ich ganze Kompendien, mit Lyrikdebatten mehrerer Jahrzehnte gefüllt, überspringe mit dem, was ich sagen will, und vielleicht geht es an den Absichten und spezifischen Möglichkeiten Volker Brauns ganz vorbei. Es sei trotzdem gesagt.) Nach Inhalt und Ausdruck sind die Verse Brauns an die breite Öffentlichkeit adressiert, sie ahnen Meetingluft. Zugleich aber sucht er in Gedichten, deren Einheit – hier gibt es freilich Unterschiede zwischen den einzelnen Stücken – mehr im Gedanken als in der Anschauung begründet ist, Distanz zu halten gegenüber herkömmlicher Agitation in bildgeschmückten Versen. Das führt dazu, daß er seine Sprache ständig mit Sensationen füttern muß. Von den Überraschungen und Entdeckungen, der weltanschaulichen Weite in der wechselseitigen Spiegelung von Gegenständlichem und Abstraktem, die Braun bietet, war gerade die Rede. Es entstehen jedoch Fragen: Stehen sich Anschauung und Reflexion in Brauns Denken und Sprache nicht manchmal im Wege; hindern sie sich nicht gegenseitig an der Entfaltung? Das Bildliche bleibt bisweilen zu vorübergehend, zu flüchtig, der Gedanke verschwommen. Könnte nicht in einigen Gedichten, deren Gegenstand dies erlaubt oder verlangt, die Scheidung der Elemente dazu führen, daß sich verschiedene Arten von Gedichten herauskristallisieren, daß z.B. ein schlichtes und leiseres lyrisches Sagen den Ton der erhöhten Rede ablöst, der dann dort, wo er speziell am Platze ist, als etwas Besonderes, nicht mehr als das einförmig Dominierende seine Wirkung tut? Nachblätternd finde ich, daß Braun schon vor Jahren in dem Band Provokation für mich eine Antwort auf meine Frage gegeben hat:
IchkanndasJahrhundertwieeineDrehorgelrausleiern:
FÜR DIE LIEBHABER PUCCINIS
(„Gebrauchsanweisung zu einem Protokoll“)
Die Äußerung stärkt meinen Verdacht, daß die lyrische Sprache Brauns von geheimer Polemik mitgeprägt ist. Nun kann die Polemik den Dichter gewiß inspirieren, sie kann ihn aber, zur Gewohnheit, zur Manier werdend, auch hemmen. Damit seinem Wort nichts Puccinihaft-Gefühlsseliges und Drehorgelmäßig-Monotones anhaften möge, rauht er den Rhythmus auf, kämmt er die Sprache gegen den Strich. Noch den gereimten Vierzeilern der Kriegs-Erklärung Brauns ist hier und da – ich meine, zu ihrem Nachteil – anzumerken, wie sich die Feder des Dichters gegen den gleichmäßigen Silbenfall sträubt. Nun hat ja Marx in seinem berühmten Brief an Lassalle über dessen Drama Franz von Sickingen sehr respektlos über die nachmärzliche poetische „Epigonenbrut“ gesprochen, die „nichts als formelle Glätte übrig behalten hat“, so daß ihn einige holprige Verse Lassalles geradezu angenehm berührten. Heute kann man leicht nachweisen, daß die Vertracktheit, die Verweigerung eines an gewohnte Vorstellungen anknüpfenden lyrischen Sprechens ebensogut modisch, manieriert, epigonenhaft werden können wie die Balladen und Terzinen der Neuklassiker. Wenn Brecht schreibt:
Anmut sparet nicht noch Mühe,
Leidenschaft nicht noch Verstand,
Daß ein gutes Deutschland blühe,
Wie ein andres gutes Land,
so kann ich mich nicht entschließen, das altmodisch zu finden. Wenn Brecht in der „Kinderhymne“, ebenso wie Becher in der Nationalhymne der DDR, das Metrum des „Deutschlandliedes“ verwendet (Brecht knüpft auch, selbstverständlich polemisch, an dessen Inhalt an), so tat er das, um in einer angemessenen Weise vom Bekannten ins Unbekannte und Neue hinüberzuleiten. Die Herstellung einer richtigen Beziehung zwischen Erwartetem und Überraschendem, zwischen Überliefertem und Neuem, Fremdem und Eigenem ist nicht nur schlechthin eines der Geheimnisse großer Kunst, sondern speziell ein Problem des demokratischen und sozialistischen Künstlers, der die Einheit zwischen sich und den fortschrittlichen Kräften nicht nur postulieren, sondern die Einheit und den Fortschritt poetisch-praktisch hervorbringen will. Den individuellen Weg, den der Dichter dabei einschlägt, kann der Theoretiker nicht vorzeichnen. Ich könnte mir aber vorstellen, daß beispielsweise die „Glückliche Verschwörung“ gültiger, dauerhafter, mehr zu unserem festen Besitz werden könnte, wenn sie liedartig gestaltet, ebenso der „Regierungserlaß“, wenn er zum unvergeßlichen Spruch gehämmert würde. Andere Gedichte würden, so wie sie sind, in ihrer Eigenart dagegen noch kräftiger hervortreten. Der Pfuscher verhunzt die Sprache, wenn er sie dem Zwang von Rhythmus und Reim unterwirft; der Dichter entschlackt sie, prüft die Notwendigkeit jedes Wortes, wird zu neuen Ideen inspiriert. Braun ist kein Pfuscher.
Braun sagt „wir“, wenn er von den Arbeitern spricht, die die Werkhalle betreten. Und mit Recht. Aber wichtiger als die Frage, ob einer „wir“ sagt oder „ich“ oder ein redendes Subjekt ganz ausspart, ist, ob jene, die von dem „Wir“ verbal umschlossen werden, wirklich die Möglichkeit erhalten, sich in Einklang mit der Aussage des Dichters zu setzen. Und da können, jedenfalls für die Dauer und in der jetzt noch bemerkbaren Dominanz, die Sprödigkeit, die Verweigerung einer zutraulichen Ausdrucksweise sowie der Traditionsbruch den Dichter an der Verwirklichung seiner eigenen guten Absicht hindern.
Der Lagebericht ist eine Dichtung, die meiner Meinung nach in die beginnende neue Phase sozialistischen Aufbaus gut hineinpaßt. Wie in Brauns Aussage keine unübersteigbaren Hindernisse den heutigen Tag von der Vollendung unseres gesellschaftlichen Systems trennen, so stehen auch keine unüberwindlichen Barrieren zwischen ihm und den Erbauern des Sozialismus, denen der Zyklus zugedacht ist. Unsere Einwände sind die Kehrseite des Lobes. Braun, hieß es eingangs, sei ein Dichter, der viel gelernt hat. Er ist auch einer, von dem wir viel erwarten dürfen.
Hans Kaufmann, 1968
DIE DIMENSION DES KRITIKERS5
– Volker Braun fragt Hans Kaufmann (1986). –
Volker Braun: Lieber Hans Kaufmann, es ist üblich, daß der Literaturwissenschaftler die Fragen stellt und der Dichter zu antworten hat – wieso eigentlich? Ist es nicht sinnvoller umgekehrt?
Hans Kaufmann: Was du sinnvoller nennst, stellt die Welt auf den Kopf. In den zahlreichen gedruckten Gesprächen, in denen Kritiker fragen und Autoren antworten, kommt die tatsächliche gesellschaftliche Stellung und Rolle des Autors wie des Kritikers zum Ausdruck. Das Publikum ist in erster Linie am Autor interessiert, und der Kritiker sieht seine Aufgabe darin, Mittler zwischen Autor und Leser zu sein. Im Gespräch fordert er dem Schriftsteller zusätzliches Material ab, das für den Leser interessant ist, das ihm zum besseren Verständnis der Werke des Schriftstellers verhilft. Das ist die normale gesellschaftliche Rollenverteilung, und dagegen habe ich auch gar nichts einzuwenden.
Schon, indem du die Frage stellst, schon, indem du dich mit mir auf so ein Gespräch einläßt, kommt bei dir ein bestimmtes Verhältnis zur Wissenschaft zum Ausdruck, ein Verhältnis, das durchaus nicht die Mehrheit deiner Kollegen teilt. Nimmt man die Frage ganz ernst, also gar nicht eulenspiegelhaft, dann bedeutet sie ja eigentlich, daß du dir von der Kritik, von der Wissenschaft, auch von der Literaturwissenschaft etwas erwartest, was bei weitem nicht alle erwarten: eine produktive Anregung für die eigene Arbeit. Und ich vermute, in diesem Gespräch werden wir dieses Problem nicht wieder loswerden.
Braun: Du bist von Haus aus Literarhistoriker und bearbeitest nicht ausschließlich das Feld der DDR-Literatur. Weshalb du wohl unbeschwerter, unamtlicher ans Werk gehst als mancher eingewiesene Kollege. Wie hilfreich oder hinderlich ist bei dem Einsatz im Neuland das Rüstzeug aus dem anderen Grabfeld?
Kaufmann: Das ist schwer beschreibbar. Was ich von der Literatur anderer Epochen weiß, was ich aus der Beschäftigung damit gelernt habe, ist wohl zu selbstverständlich anwesend, wenn ich mich mit Gegenwartsliteratur beschäftige, als daß ich es systematisch kenntlich machen könnte.
Der Begriff des Literaturkritikers ist für mich deshalb auch dem Ganzen des wissenschaftlichen Umgangs mit Literatur zu- und untergeordnet. Umgangssprachlich redet man oft vom Kritiker, wenn man den Rezensenten meint. Ich sehe den Begriff des Kritikers etwas anders. Ob ich in einer Tageszeitung eine Neuerscheinung knapp rezensiere, ob ich sie in einer Fachzeitschrift etwas eingehender interpretiere, ob ich eine Beschreibung und Analyse literarischer Tendenzen versuche – immer handelt es sich um verschiedene Anwendungsfälle der gleichen Wissenschaft. Wenn ich über Literatur der Vergangenheit schreibe, sind die Umstände, das zur Verfügung stehende Material und das Instrumentarium andere als bei der Beschäftigung mit Gegenwartsliteratur. Dem Wesen nach ist jedoch die wissenschaftliche Arbeit, die Bemühung um das denkende Begreifen, immer dieselbe. („Bist du Poet, so bin ich Kritiker“, schrieb Marx an Freiligrath.) Wer sich der schönen Literatur mit den Methoden des diskursiven Denkens nähert und dabei auf offene, unabgeschlossene Prozesse, sei es der Produktion, sei es der Rezeption zielt, ist für meine Begriffe ein Literaturkritiker.
Übrigens habe ich erst verhältnismäßig spät angefangen, mich häufiger und eingehender zur Gegenwartsliteratur zu äußern. In den fünfziger Jahren geschah das kaum (und ich bin dafür kritisiert worden), in den sechziger Jahren vereinzelt, in den siebziger Jahren systematischer (soweit meine Situation es gestattete). Zum Teil liegt das daran, daß ich anderweitig in Anspruch genommen war. Eine Rolle spielt aber auch, daß mir das Eingreifen in Gegenwartsprozesse besonders schwierig und verantwortlich zu sein schien. Und das ist es wohl auch.
Braun: Es fällt auf, daß du seit Jahren nicht mehr in der Tagespresse publiziert hast. Woran liegt das?
Kaufmann: Nicht an mir.
Braun: Was war deiner Meinung nach dein produktivster Ansatz, der folgenreichste für dein Denken?
Kaufmann: Ich nenne mal drei Schwerpunkte meiner bisherigen Arbeit: 1. den Umgang mit dem literarischen Text, 2. die Arbeit an literarischen Prozessen, 3. theoretische Aspekte von 1. und 2. Sie ergaben sich primär aus den Aufgaben, die mir durch die Lehr- und Forschungsprogramme der Universität und der Akademie der Wissenschaften vorgegeben waren, aber auch aus persönlichen Neigungen. Trotz dieser Bedingtheit durch äußere Faktoren und Individualität wage ich zu behaupten, daß in dem Miteinander der drei genannten Aspekte auch eine gewisse Logik liegt.
Den gesellschaftlichen Sinn literaturwissenschaftlicher Arbeit sehe ich darin, möglichst vielen Menschen beim Zugang zur Literatur und beim Umgang mit ihr hilfreich zu sein. Die Kunst des Lesens zu erlernen, zu vervollkommnen und sodann zu lehren steht folglich am Anfang und am Ende literaturwissenschaftlicher Bemühung. Literaturgeschichtliche, -soziologische, -psychologische Arbeit, Poetik, Literaturtheorie, alles relativ selbständige Betätigungsfelder, erhalten dadurch ihren Bezugspunkt. Ich habe mich seit langem viel mit der Interpretation von Texten befaßt, schriftlich und mündlich, teils ausführlich, teils in gedrängter Form. Der Reiz dieser Art von Arbeit liegt darin, daß man gehalten ist, sozusagen den Puls literarisch-künstlerischer Arbeit zu fühlen. Aber unvermeidlich stößt man auch an die Grenzen dessen, was Werkinterpretation zu leisten vermag. Man kann ihr den Schein von Rundheit, Abgeschlossenheit und Ausgewogenheit verleihen – man verdeckt damit nur, daß es unmöglich ist, in diesem Rahmen alle Voraussetzungen aufzuhellen, auf denen das gegebene Werk beruht: die biographischen, geschichtlichen, kommunikativen, weltanschaulichen und ideengeschichtlichen, poetologischen und sprachlichen. Folglich bedarf es der entsprechenden Genres literaturwissenschaftlicher Arbeit, deren Ergebnisse ebenfalls dem Verständnis literarischer Texte dienen, ohne jedoch – das ist hier wieder der Nachteil – dem Kunstwerk in seiner Einmaligkeit ganz gerecht werden zu können.
Bei der Arbeit an literaturgeschichtlichen Überblicken, die mich über eine Reihe von Jahren in Atem hielt, lernt man natürlich vieles, was dem Umgang mit dem einzelnen Text nützt. Und Literaturgeschichten sind unstreitig notwendig. Aber die Arbeit daran ist besonders mühselig und in bestimmter Hinsicht besonders undankbar. Denn von ihr wird in selbstverständlichster Weise eigentlich Unmögliches verlangt. Sie soll Auskünfte über die allgemeinen geschichtlichen Voraussetzungen des literarischen Prozesses, aber auch über spezielle geschichtliche Aspekte, die Buchproduktion, die kommunikative Situation, die Soziologie der Autoren und Leser geben, die geistigen Strömungen der Zeit darstellen sowie zahlreichen Künstlerindividualitäten gerecht werden, ein feines Gespür für literarische Qualität beweisen, aber auch die literarische Massenproduktion nicht vergessen, weltliterarische Bezüge herstellen, den anderen Künsten Beachtung schenken usw. Sie muß nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Methoden, die Denkstrukturen der verschiedenen Genres der Literaturwissenschaft in sich vereinigen. Das heißt, es gilt einen Kompromiß zu finden, und der befriedigt nie alle Wünsche. Je weniger man die Voraussetzungen einer Literaturgeschichte bedenkt, desto leichter ist es, sie zu kritisieren.
Es mag an den mir zugefallenen Aufgaben oder an meiner Veranlagung liegen, daß mein vom Marxismus inspiriertes theoretisches Interesse sich meist nicht nur am einzelnen literarischen Text oder an bestimmten literarhistorischen Sachverhalten äußerte. Wenn ich es mit Heine oder mit Brecht zu tun habe, dann reizt es mich, auch allgemeiner über das Komische, über Gattungsfragen von Lyrik, Drama und Prosa, über das Wirklichkeitsverhältnis von Literatur nachzudenken. Dabei habe ich großen Respekt vor literaturtheoretischen Arbeiten – freilich nur, soweit sie das historische oder aktuelle Material wirklich aufschließen.
Ich könnte die Frage nach den produktivsten Ausgangspunkten meiner Arbeit auch summarisch und stofflich knapp so beantworten: Es waren erstens der Marxismus, zweitens drei große Dichter, die auch bedeutende theoretische Köpfe waren, nämlich Goethe, Heine und Brecht, und drittens die Bemühung um die DDR-Literatur.
Braun: Du hast es mit den Resultaten der dichterischen Arbeit zu tun, du bist elend auf sie angewiesen, das könnte dich ungeduldig und reizbar machen. Ich profitiere von der Wissenschaft und mache meinen Vers darauf. Wir sind Stiefzwillinge, und natürlich kennen wir mitunter die Verwandtschaft nicht. Was scheint dir fruchtbarer: der Streit zwischen uns (in Endlers oder Kunerts Manier) oder die „Vorverständigung“?
Kaufmann: Der Dichter und sein Werk bilden den Gegenstand der Arbeit des Literaturwissenschaftlers, aber der Literaturwissenschaftler bildet nicht den Gegenstand der Arbeit des Dichters – es sei denn, dieser benötigt ein Sujet für eine risikoarme Satire, einen Sack, auf den er schlägt, wenn er den Esel meint.
Aber Spaß beiseite. Der günstige Fall ist der, daß der Streit zwischen Kunst und Kunstwissenschaften auf einem Vorverständnis beruht, von ihm umschlossen ist und seine Dimension und Richtung erhält. Die Kunst bringt doch im Aneignungsprozeß, im Falle der Literatur also beim Leser, nicht Kunst hervor, sondern Einstellungen zum Leben. Auf diese Einstellung zielt auch die Kritik, sie hilft dem Leser entweder, durch die Lektüre die Einstellung zu finden, oder sie meint, das gegebene Buch bewirke nicht wünschenswerte Einstellungen – dann nimmt sie den Leser gegen das literarische Werk ein. Diese durch Kunst bewirkte, aber „außerkünstlerische“ (außerhalb des Werkes sich abspielende) gemeinsame „dritte Sache“ nenne ich mal die Ebene der Vorverständigung.
Ist sie nicht vorhanden, wird man über Einstellungen zum Leben zu streiten haben. Ist sie vorhanden, so kann sich der Streit zwischen Schriftsteller und Kritiker auf spezifisch künstlerische Fragen beziehen, z.B. darauf, ob eine Parabel geeignet ist, die Verhältnisse, auf die sie zielt, wirklich zu treffen, ob kathartische Wirkungen heute denkbar sind, ob und unter welchen Umständen ein Pechvogel mitleidlos verspottet oder besser einfühlend gestaltet wird – usw. usf. Mir scheint, daß sich in den siebziger und frühen achtziger Jahren sowohl von den allgemeinen Voraussetzungen her als durch Leistungen der Kunstwissenschaften und Ästhetik und schließlich durch den literarischen Prozeß selbst alles in allem die Tendenz zum produktiven Streit auf der Basis der Vorverständigung verstärkt hat – wieviel auch noch zu wünschen bleibt.
Wo die gemeinsame „dritte Sache“ außer Sicht gerät, wo – besonders von der Seite der Schriftsteller – Mißtrauen, Verhärtung, Sprachlosigkeit zwischen Literatur und Kritik eintreten, ist das gewöhnlich darauf zurückzuführen, daß Autoren, mit Recht oder Unrecht, jedenfalls aufgrund von Erfahrungen, die manchmal lange nachwirken, meinen, aus der Stimme des Kritikers eine fremde Stimme herauszuhören, nicht die Überzeugung einer Person, sondern etwas der Kunst Abholdes.
Braun: Walfried Hartinger bemerkte neulich, selbstkritisch für seine Gilde, die Literatur werde immer einmal wieder auf das Modell der Wissenschaft verpflichtet („[…] der Philosoph redet in Begriffen, der Dichter in Gestalten und Bildern, beide reden über dasselbe“). Das meint, der Kunst werden Zwecke zugeschoben, die nicht ihre eigenen sind, ihre Autonomie wird verdächtigt, ihre eigenen Entdeckungen sind wenig gefragt. Dabei weiß man doch seit den Höhlenbewohnern von der Erkenntniskraft des Bildes; in der generellen Metaphorik des poetischen Textes scheint ein Wissen auf, das die Wissenschaft noch nicht oder nie zu formulieren vermag (denken wir nur an die Kapitalismusanalyse in Goethes Faust), die künstlerische Struktur ordnet im Sinnlich-Konkreten Erscheinung und Wesen zur Helle der Poesie, die uns durchstürzt als Gewißheit, Hoffnung, Schmerz, die unsere Sinne mobilisiert. Die eigentümliche Leistung der Kunst, die sich nicht gleichbleibt – mit welchen neuen Worten, nach Hegel, nach Goethe, läßt sie sich heute fassen? Ich frage das dich, der du Heines Attacke gegen die Tendenzpoesie mit Behagen referiert hast, durchaus gegen den banausischen Geist der Zeit.
Kaufmann: Der Autonomiebegriff ist umstritten, und ich bin nicht sicher, ob er genau das zum Ausdruck bringt, was man damit meint. Teils wird er mit der „eigentümlichen Leistung der Kunst“ etwa gleichgesetzt und positiv akzentuiert (so auch von dir), teils sieht man darin die Gefahr einer vom materiellen und ideellen Geschichtsprozeß abgelösten, sich selbst genügenden Handhabung und Betrachtung der Kunst und weist ihn deshalb zurück.
Sinnvoll handhabbar scheint mir der Begriff allenfalls im Zusammenhang mit den historischen Schicksalen der Kunst und Kunstbetrachtung zu sein. Im Deutschland der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erheben die Schriftsteller den Anspruch, nicht mehr entsprechend den Vorgaben aus anderen Bereichen des ideologischen Oberbaus, vor allem von seiten der den Feudalabsolutismus stützenden Kirche, zu schreiben. Die schöne Literatur versteht sich als eigenständiger Bereich im geistigen Leben, der auf seine Weise, also nicht im Nachvollzug von Theologie, auch nicht von aufklärerischer Philosophie, am Menschenleben teilnimmt und geschichtlich wirkt. Die Konflikte zwischen den Lehren der Aufklärung und der frühklassischen Literatur und Poetik hängen damit zusammen. Die Kunst wird in diesem Sinn „frei“, aber nicht „freischwebend“, sie spielt ihre eigene Rolle im geschichtlichen Umwälzungsprozeß.
Sieht man dies, so ist Heines Spott über die „Tendenzpoesie“ des Vormärz leicht zu verstehen. Heine ist entschieden politischer Dichter, er nennt sogar einige seiner Werke „Parteischriften“. Aber es widerstrebt ihm, einfach die begrenzten politischen Vorstellungen liberaler oder kleinbürgerlicher Gruppen zu versifizieren. Die produktive, widersprüchliche Einheit von „Autonomie“ und „Engagement“ kann an ihm studiert werden.
Wenn Brecht von Autonomie spricht (die er von Autarkie ausdrücklich unterscheidet), sollte man fragen, ob bei ihm nicht ähnliche Motivationen zugrunde liegen.
Diese nur angedeuteten literaturgeschichtlichen Erfahrungen können dienlich sein, wenn es darum geht, sich klarzumachen, was es mit der weithin anerkannten Formel von der „Unersetzbarkeit der Kunst“ in unserer Gesellschaft auf sich hat. Der von Hartinger – ich stimme ihm da zu – kritisch apostrophierte Satz, wonach Kunst und Wissenschaft den gleichen Gegenstand („die Wirklichkeit“ schlechthin) haben und sich nur in jeweils „anderer Form“ ausdrücken, erklärt die Kunst für ihrer Substanz nach durch das begriffliche Denken ersetzbar, weist ihr faktisch die Rolle zu, das auf anderem Wege schon Erkannte, das Bekannte, auf ihre Weise lediglich zu reproduzieren. Die Kunst wird so anderen Formen des Bewußtseins untergeordnet, wird wie bei manchen Aufklärern Nachhilfe für Leute, die das abstrakte Denken nicht verstehen. Etwas entdecken, etwas der Sache nach Originelles, Eigenes artikulieren und vermitteln kann die Kunst nur in einem eigenen Gegenstandsbereich, der von dem der wissenschaftlichen Erkenntnis verschieden ist.
Über den Gegenstand der Kunst, insbesondere der Literatur, und über ihren Wahrheitsanspruch hat es in den letzten Jahren interessante Bücher und Debatten gegeben, die ich hier nicht ausbreiten will, von denen ich aber wünschte, sie gingen weiter. Es ist dabei wichtig, mitzudenken, daß ein solcher heutiger Begriff von Kunst wie die Kunst selbst, der er entspricht, historisches Produkt ist, d.h., daß dessen Zusammenhang mit dem gesamten praktischen und geistigen Leben einer Gesellschaft, mit den Haltungen des Kunstproduzenten zu und in ihr nicht außer acht gelassen werden kann.
Braun: Du ziehst es oft vor, gleich zu reden bzw. zu schreiben, nicht unbedingt zu warten, bis ein Buch durchgesetzt ist oder eine Ansicht spruchreif. Das heißt, sich in gesellschaftliche Prozesse einzumischen. Was fällt dir ein?
Kaufmann: Das frage ich mich auch öfter. Aber – in der anderen Bedeutung des Wortes fällt mir ein, daß es dem Kritiker vielleicht ähnlich gehen mag wie dem Schriftsteller, wenn er in gesellschaftliche Prozesse eingreift. Man kriegt Herzklopfen – und das ist ein verniedlichender Ausdruck.
Jeder Entschluß zu einer entschiedenen Aussage birgt in sich das Risiko des Irrtums. Es erhöht sich jedoch beträchtlich, wenn man es mit neuen Erscheinungen zu tun hat, an denen von anderer Seite noch nichts vorgeklärt ist und deren Bild sich rasch ändern kann. Ist einer gescheit, so kann er heute über die Romantik etwas schreiben, was in zehn oder auch in fünfzig Jahren noch bestehen kann. Beim Versuch, noch in Fluß befindliche literarische Tendenzen zu erörtern, ist die Gefahr, wichtige Tatsachen außer acht zu lassen, die eine zu über-, die andere zu unterschätzen, sehr groß. Ein oder zwei wichtige neue Werke, die erscheinen, während man schreibt, verändern bereits den Gegenstand, mit dem man es zu tun hat. Der Einfall, den ein Schriftsteller hat, neue Züge seiner Individualität, die er einbringt, sind nicht mit literaturwissenschaftlichen Methoden kalkulierbar und lassen sich erst aus der Distanz allgemeineren Tendenzen zuordnen.
Spricht man über einzelne Werke, gibt es ähnliche Probleme. Hat man es z.B. mit Erstlingsarbeiten zu tun, so entsteht die bange Frage nach dem Talent. Gibt es aber ein wissenschaftliches Instrumentarium, um Talent zu erkennen? Erfahrung und Kunstsinn sind da eher gefragt, zwei unentbehrliche, aber schwer festzumachende Attribute des Kritikers. Lassen sie sich auf die Höhe wissenschaftlicher Einsicht bringen? – Da gibt es viele ungelöste Fragen, und ich denke mir, daß die Skrupel wegen der vielen Unwägbarkeiten einer der Gründe dafür sind, daß manche fähigen Leute sich nicht gern auf Aussagen über unabgeschlossene Literaturprozesse festlegen.
Neben dem Risiko des Irrtums gibt es aber auch das Risiko der Wahrheit. Man kann recht haben, aber nicht recht bekommen – oder erst spät.
Braun: Es ist eine liebe Gewohnheit, neuen Werken durch gelindes Zumessen des Tadels auf den Weg zu helfen. Wir bewundern aber heuer eine andere Zurückhaltung; während die Literatur schamlos wird, wagt die Kritik gar nicht mehr zu eröffnen, womit man es bei einem bestimmten radikaleren Buche zu tun hat, was sein tiefer Gehalt ist, die Kritik spricht mit verstellter Stimme: wie über vertraute, wie über mögliche Dinge. Diese Eulenspiegelei war durchaus vergnüglich (und der Dichter durfte einmal die Frage zurückgeben: „Wie machen Sie diese verflixte Naivität, verehrter Meister?“) – bis die Kluft bemerklich wurde, in der die neue soziale Qualität der Literatur vor den öffentlichen Augen verschwand. Die Literaturkritik geriet in eine Krise, und sie mußte/muß sich entscheiden, zu verstummen oder zur Sache zu kommen. Es genügt nicht die halbe Wahrheit (sagtest du eben, als das Band gewechselt wurde).
Kaufmann: Für das, was andere Kritiker schreiben, kann ich nicht einstehen. Man muß vielleicht sehen, daß die Kritik, wenn sie ein Buch bespricht, nicht nur auf den Text reagiert, den sie vor sich hat, sondern auch auf das Medium, durch das sie sich an den Leser wendet, und daß ihre Haltung und ihre Schreibweise dadurch mitbedingt ist. Natürlich ist es schlecht, wenn auf diese Weise Leistungen der Literatur verkleinert und eingeebnet, wenn sie immer auf das schon Dagewesene reduziert werden.
Noch ein anderes Moment ist zu bedenken. Eine literarische Aussage über Menschen und Verhältnisse hat den Charakter eines Angebots, eines Vorschlags, einer Einladung, die Dinge so zu sehen, wie sie im Werk dargestellt und gewertet werden. „Übersetzt“ in die Sprache der Wissenschaft, erhält dieses Dargestellte eine allgemeine Form, die Form des Allgemeinen, damit auch einen höheren Grad allgemeiner Verbindlichkeit als das am Einzelnen orientierte, schwebende Angebot des literarischen Werkes. Der Inhalt ist in beiden Fällen nicht ganz derselbe. Wenn ein Erzähler einen betrunkenen Eisenbahner schildert: „Was will er uns damit sagen?“ – Etwa, daß Eisenbahner Trunkenbolde seien? Es kommt vor, daß tatsächlich so plump argumentiert wird. Aber auch wenn das nicht geschieht, wenn man sorgsamer das Allgemeine im Besonderen aufweist, bleibt doch immer ein Differenzpunkt. Die wissenschaftliche Aussage nähert sich dem Inhalt der künstlerischen an, ohne ihr je ganz zu gleichen.
Braun: Der Literaturwissenschaft eignet heute oft mehr Realismus als mancher anderen Gesellschaftswissenschaft; es liegt natürlich daran, daß ihr Gegenstand ihr die Wirklichkeit relativ unverklärt nahebringt, in den arbeitenden Widersprüchen, welche Kraft und Schönheit des künstlerischen Textes konstituieren. Was den Philosophen, Kulturtheoretikern usw. fehlt, mögen sie selbst empfinden, sie sind offensichtlich zu weit weg vom Fenster. Ich will nicht sagen, daß die Literaturwissenschaft mit ihrem Pfund wuchert, der Zentnerlast der Wahrheit, aber sie handelt immerhin – mit nicht gängiger Münze. Wird sie ihr abgenommen?
Kaufmann: Literatur bezieht sich aufs gesellschaftliche Leben und wertet es. Die verantwortliche Literaturkritik geht diesem Bezug nach, sie wertet die Wertungen. Das heißt aber, daß sie ihrerseits in die gleichen gesellschaftlichen Probleme verwickelt wird, die in dem literarischen Werk eine Rolle spielen bzw. ihm zugrunde liegen. Sie kann sich nicht aussuchen, welche Probleme heutigen Lebens sie erörtert, welche sie umgeht. Und sie kann nicht warten, bis von anderer Seite Antworten kommen. Es ist daher schon öfter davon gesprochen worden, daß die Literaturwissenschaft so etwas wie eine „universelle Gesellschaftswissenschaft“ zu sein habe. Und damit hängt zusammen, daß die Literaturwissenschaft, die sich als Gesellschaftswissenschaft begreift, auch immer in einer manchmal sehr unbequemen Weise in Streit verwickelt wird. Das ist unvermeidlich. Und man kann sich dem entweder stellen oder darauf verzichten, sich über aktuelle Literaturprozesse zu äußern. Ein Drittes gibt es nicht. Das Körnchen, das der Kritiker von der Zentnerlast der Wahrheit herausbekommt, das ist dann die Wahrheit für alle, und wenn es nicht stimmt, so muß er den Irrtum auf sich selbst nehmen.
Braun: Ist der Literaturwissenschaft im Sozialismus ein besseres Feld eröffnet als in der bürgerlichen Gesellschaft? Dort sehe ich mehr Onanie, hier oft Vergewaltigung, aber jedenfalls Verkehr. In welcher Stellung, frage ich diskret, siehst du dich?
Kaufmann: Gestattest du, daß ich deine überaus plastische Metapher fallenlasse? – In den kapitalistischen Demokratien unterliegt der praktische Gebrauch, der von den bürgerlichen Freiheiten gemacht werden kann, auch auf literarischem Gebiet in erster Linie den Gesetzen des Marktes bzw. den Gesetzen, die dem Markt zugrunde liegen. Die Gesellschaft zeigt den Beziehungen zwischen Autor und Leser ein steinernes Gesicht. „Der Schriftsteller schreibt, wie’s kommt, der Leser liest, wie’s kommt“, sagte Lenin. Bei uns werden Literatur und Kritik sehr viel ernster genommen. Nicht zufällig geht wiederholt die Rede von der Literatur als einem Organ gesellschaftlicher Verständigung, von einem „Vorgang zwischen Leuten“ – und das stammt doch wohl von dir? Diese Formulierungen bezeichnen teils eine Realität, teils ein Ziel.
Der „Kritik“, der Wissenschaft also, soweit sie sich mit den gegenwärtigen Vorgängen in der Literatur befaßt, ist damit zunächst ihre Stellung zugewiesen. Sie ist ein Teil des „Organs“, nimmt Einfluß auf den Umgang und die Art des Umgangs der Leute mit Literatur. Ihre Besonderheit besteht darin, daß ihr einziges Mittel die Überzeugungskraft des Arguments ist. Vorausgesetzt, sie habe eine gewisse Wirkung, ist sie eine gesellschaftliche Instanz, aber, für sich genommen, keine Institution. Institutionen des literarischen Prozesses wirken auch durch materielle Mittel (Erteilung von Druckgenehmigungen, Zuteilung von Papierkontingenten, Stipendien und dergleichen mehr).
Die Funktion der Kritik, Mittler zwischen der Kunst des Schreibens und der Kunst des Lesens zu sein, veranschlage ich nicht gering. Den Begriff des Mittlers kann man im Prinzip aber auch so verstehen, daß Adressat der Kritik sowohl der Leser als auch der Schriftsteller sein kann. Zwar läßt sich sagen – und es ist wiederholt, bisweilen mit Spott, gesagt worden –, daß die Rezension eines Werkes den Autor erst erreicht, wenn er es schon lange Zeit abgeschlossen hat und mit seinen Gedanken und seiner Praxis schon ganz woanders ist. Dagegen läßt sich schwer etwas einwenden. Oder doch: Im Prinzip – ich wiederhole „im Prinzip“, weil ich gleichzeitig sagen will, daß dies bei uns nicht in herausragender Weise der Fall ist – sollte und könnte die Kritik einzelner Werke oder literarischer Tendenzen mindestens Ansätze zu Verallgemeinerungen enthalten, die zwar nicht Regeln zur Verfertigung von Kunstwerken (wie zur Zeit der Gelehrtenliteratur), auch nicht Verbesserungsvorschläge für das einzelne Werk (damit muß man vorsichtig sein) hergeben, aber doch Erfahrungen in der Weise aufbereiten, daß das zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem Sujet, in einem Genre, in einem Kommunikations- und Wirkungszusammenhang Erforderliche und Mögliche aufscheint. Ob ein Autor sich daraus etwas nimmt, was in seine Produktion eingeht, bleibt ihm überlassen (die Schriftsteller denken darüber verschieden), die Kritik sollte aber danach streben, dem Schriftsteller ein solches produktives Überdenken lohnend erscheinen zu lassen.
Man wird mir widersprechen, ich bin jedoch überzeugt, daß ein gewisses Maß an Prognosefähigkeit zu dem Anspruch gehört, den Wissenschaft an sich stellen muß.
Braun: Du bist einer der wenigen Kritiker, die noch etwas auf die Zukunft halten, indem sie die Gesellschaft „in ihrer Offenheit zum Kommunismus hin“ sehen. Beliebter ist ja Ernst Fischers Meinung: Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie war. Wie, wenn aber deine phantastische Prämisse, die „dynamische Gesellschaft“, die siebziger Jahre nicht überdauert hätte? Und die „einzelne Erscheinung“ nicht mehr leicht „vom Standpunkt sozialistischer Ziele“ aus „geschichtlich relativiert und dadurch in ihrer Überwindbarkeit kenntlich“ wird? Der Status quo als Grunderlebnis der blindgeborenen Generation – wie hat er das Realismuskonzept verändert? Haben sich unsere raschen Ideen nicht vor der zähen Wirklichkeit blamiert, und gleicht unser Messen an der „notwendigen“ Zukunft nicht – wie du es dem Messen an der faschistischen Vergangenheit vorwirfst – geistesgeschichtlicher Betrachtung? Die Vergangenheit ist aber wirklich, die Zukunft ist aber wirklich nicht.
Kaufmann: Du willst von der Wissenschaft, auch von der mit Literatur befaßten, etwas wissen, aber, wie ich sehe, in erster Linie etwas übers Leben und dann erst übers Schreiben.
Deine Frage bezieht sich heute, 1984, auf einen Text, den ich 1974 geschrieben habe („Literatur in einer dynamischen Gesellschaft“). Was du zitierst, erinnert mich an eine Auseinandersetzung Heines mit Campe. Heine beklagt sich wieder einmal über die Knausrigkeit seines Verlegers und wünscht sich, dieser hätte „mehr Christentum“, würde aus christlicher Nächstenliebe mehr zahlen. Jedoch sei Campe durch beständiges Lesen der Schriften Heines reinweg Atheist geworden, der nur ans Materielle denkt, also knausert. Im vergleichbaren Sinne könnte ich sagen, daß ich durch fleißiges Lesen deiner frühen Gedichte und Stücke auf die Formulierungen verfallen bin, die du anführst.
Es waren die Neuansätze nach dem VIII. Parteitag der SED, in der praktischen Politik und in der theoretischen Analyse, die mich damals zu einem solchen Versuch ermutigten. Vielleicht habe ich heute weniger Mut, eigenhändig Zukunftslinien zu zeichnen, in den Grundzügen möchte ich jedoch das damals Gesagte nicht preisgeben. Aber in einem fünf Jahre später geschriebenen Versuch („Veränderte Literaturlandschaft“) setze ich die Akzente anders. Gestützt auf einige Neuerscheinungen von 1979 spreche ich dort von der Notwendigkeit und Möglichkeit, sozialistisch-humanistische Positionen dauerhaft durchzuhalten – auch beim Ausbleiben eines raschen Progresses und qualitativen Umschwungs in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Entwicklung in der dazwischenliegenden Zeit hatte mich belehrt, jedoch nicht so, daß die eine Äußerung zur anderen in ausschließlichem Gegensatz steht. Der reale Prozeß verlief nicht geradlinig, und das spiegelt sich in dem Zickzack meiner Bemühung wider, ihn zu erfassen.
Eine „blindgeborene“ Generation muß nicht blind bleiben. Vergessen wir nicht, daß meine Generation absolut blindgeboren war, daß wir als schon Erwachsene beim Zertrümmern und beim Enttrümmern ernsthaft geschichtlich zu lernen anfingen. Verstehen wir unter Status quo die Unterordnung aller Bemühungen unter die Anstrengung, den Frieden zu erhalten, so mag er geschichtlich auf andere Weise ebenso lehrreich sein wie der Umwälzungsprozeß nach 1945. – Was die Zukunft angeht, hast du nicht in deinen „Berichten von Hinze und Kunze“ die Frage, wann der Kommunismus komme, dahingehend beantwortet: „Der kommt nie. Vielleicht, daß wir gehen.“?
Braun: Du hast seinerzeit ein Wort, das zu benutzen sich nicht gehört, in den Mund genommen: Desillusionierung; Hans Koch hat dich dafür gerügt6 – weil er wohl weiß, daß auch Illusionen materielle Gewalt sind, das ist keine Frage. Sondern das: Wie steht es um die politische und/oder menschliche Emanzipation im notwendigen Korsett, oder sage ich im wärmenden Leibchen des ökonomischen Leistungsprinzips, und was hat zur Klärung dieses Verhältnisses die Ernüchterungsarbeit der Literatur beigetragen?
Kaufmann: Den Vorreiter einer Literatur, der es Selbstzweck ist, einfach alles mies zu machen, wird man mich kaum nennen können. Mehr denn je brauchen wir heute eine ermutigende Literatur. Zwischen einem solchen Zweck und der „Desillusionierung“ bestand jedoch für Marx – in seiner für eine Poetik so fruchtbaren Schrift Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung – kein Gegensatz. Er meinte ein paar Jahre vor der Revolution von 1848, man müsse dem Volk Courage machen, indem man es vor seiner Lage erschrecken lehrt. Projiziert in die heutige Weltlage mit ihren fürchterlichen Bedrohungen, ergibt das schon den Umriß eines zeitgenössischen poetischen Programms.
Für mein Verständnis von materialistischer Dialektik bedeutet Desillusionierung Ent-Täuschung, das Beseitigen von Täuschungen, das den Menschen hilft, bei sich selbst, bei ihren wirklichen Problemen anzukommen.
Über „menschliche Emanzipation“ in dem großen und weitreichenden Sinn, den Marx diesem Begriff gab, hast du selbst geschrieben und vermittelst in deiner Poesie etwas davon. Sagen wir knapp so: Emanzipation, sei es die der Frau, der Geschlechter oder „des Menschen“, setzt sich als etwas Massenhaftes, das den Alltag, die Sitten und Gewohnheiten durchdringt, nur so weit durch, wie es dem Stand der gesellschaftlichen Produktion und der Verkehrsformen entspricht. Auch in dieser Hinsicht sollte man keinen Illusionen nachhängen, wohl aber eine Perspektive sehen und sichtbar machen. Literatur kann an realer Emanzipation teilhaben, indem sie – das kann auf verschiedene Weise geschehen – den Menschen ihre Lage in der Art bewußt macht, daß sie, die Leser, Zuhörer, Zuschauer sich ihre Lage auch noch anders vorstellen können.
Wir sprachen schon davon, daß der Literaturwissenschaftler, wenn er zu gegenwärtigen Prozessen Stellung nimmt, auch Gesellschaftstheoretiker sein muß. Das bedeutet aber nicht, daß ich darauf ausgehe, eine aparte, privat-eigentümlich-„originelle“ Zeitgeschichtsinterpretation vorzutragen. Ich nehme am Prozeß der Meinungsbildung über diese Fragen teil – das ist alles. Auf meinem Felde habe ich versucht, an der Präzisierung der gesellschaftlichen Selbsterkenntnis mitzuarbeiten. Und der Leser wird auch gebeten, die Beiträge als aus einer bestimmten Situation heraus geschrieben zu verstehen.
Braun: Ein Schriftsteller, den ich schmerzlich verehre – dies sind wohl die Vokabeln für Liebe –, dieser alte Peter Weiss, nannte seinen letzten Roman eine „Ästhetik“ und zog so Literatur und Wissenschaft in ein unerhörtes Buch zusammen, Die Ästhetik des Widerstands: und das ist eine kämpferische Ästhetik, die, mit Weissens Worten, „nicht nur künstlerische Kategorien umfassen will, sondern versucht, die geistigen Erkenntnisprozesse mit sozialen und politischen Einsichten zu verbinden“. Das versuchen wir auch – aber was sind wir für schüchterne Geister vor diesem entschlossenen Riesentext, diesem unbestochenen Kommunismus, diesem Konzept der freien Assoziation der Gleichgesinnten! Literarische Kleinhändler, Provinzsozialisten. Ein Buch freilich, sagt Hans Mayer, „mit keinem anderen zu vergleichen, das heute in unserer Sprache geschrieben wurde. Literaturkritik im Alltagssinn muß davor versagen“. Wie war dir bei dem Buch zumute? Hat Mayer recht? Aber nicht nur die Kritik ist ja gefordert, der ganze Mensch – mit welchem Gefühl legtest du es aus der Hand?
Kaufmann: Ich bin ganz deiner Meinung über den außerordentlichen Charakter der Ästhetik des Widerstands und die tief erregende Wirkung, die von diesem Buch ausgeht. Ich würde nur dort nicht einstimmen wollen, wo du dich und deinesgleichen daneben kleinmachst. In der Kunst gibt es niemals nur eine Art, auf die großen Probleme der Zeit angemessen zu reagieren.
Wie mir bei dem Buch zumute war, möchte ich mit Zitaten aus einem Aufsatz Tschingis Aitmatows belegen. Er führt dort Briefäußerungen eines Zeitgenossen Dostojewskis über Die Brüder Karamasow an: „Nach den Karamasows (und noch während der Lektüre) habe ich einige Male mit Schrecken um mich geblickt und mit Erstaunen festgestellt, daß alles seinen alten Gang geht, daß sich die Erde nach wie vor um ihre Achse dreht […] mit einem Wort, das ist etwas derart Prophetisches, Flammendes, Apokalyptisches, daß es unmöglich ist, auf dem Platz zu verharren, auf dem wir gesessen sind […].“ Eine derartige Wirkung, einen so starken Leseeindruck, daß man von dem Gefühl beherrscht wird, alles könne, dürfe nicht so bleiben wie bisher, fordert Aitmatow von heutiger Literatur. In der Ästhetik des Widerstands ist dies, für mein Empfinden, erreicht. (Aitmatow darf übrigens mit besonderem Recht dergleichen fordern, denn sein Roman Der Tag zieht den Jahrhundertweg ist auf ganz andere Weise ebenso aufwühlend.)
Ist es für den Kritiker angebracht, solche vielleicht maximalistisch zu nennenden Forderungen aufzustellen? Ja und nein. Mir liegt es fern, alles kleinzumachen, was eine solche Tiefendimension der Wirkung wie die Ästhetik des Widerstands nicht erreicht. Aber man soll auch wissen und darüber sprechen, was an Kunstleistung auch in unserer Zeit und in unserer Sprache möglich ist.
Braun: Die Verwaltung des geschriebenen Wortes (zu der auch die Literaturkritik gehört) mag repressive Attitüden entwickeln – die Literatur schafft neue Tatsachen, die die Landschaft verändern und die Debatte auf eine andere Ebene bringen. Dies ermöglicht, im allgemeinen Erschrecken, die Sternstunden der Literaturwissenschaft. Deiner Unerschrockenheit danken wir einige der besten Arbeiten der DDR-Literatur. An der Schwelle der achtziger Jahre hast du einen bedeutenden Aufsatz geschrieben: „Veränderte Literaturlandschaft“. Ich lese ihn so: – Große Breite der Sujets – aber verengter Zugriff auf die Gegenwart;
– viele neue Stimmen, das Bedürfnis zu sprechen, dringlicher Anspruch auf sinnerfülltes Leben
– aber nicht mit Durchreißertypen, den großen Helden, die die Gesellschaft sichtbar ändern (Balla, Ole Bienkopp), sondern der Autor als die leidenschaftliche Figur, als der Held des Textes, der die radikale Analyse und den Vorgriff leistet;
– Zurücknahme des Pathos – aber neue Beziehungen zwischen Autor und Leser, der Leser als zuständig begriffen.
Was du nicht artikulierst: die verbreitete Destruktivität in der Literatur, die Unlust, der Gesellschaft noch Vorschläge zu machen. – Die Schwelle der achtziger Jahre ist überschritten. Siehst du die Landschaft heute mit noch anderen Augen?
Kaufmann: Es trifft zu, daß ich auf einige literarische Erscheinungen und Tendenzen wenig oder nicht eingehe. Und da ich sie nicht näher untersucht habe, vermeide ich auch, sie mit einer Formel wie „Destruktivität“ zu bezeichnen. Man müßte dann schon genau sagen, welche Literatur und welche ihrer Eigenschaften so zu bewerten sind.
Die von dir benannte Vernachlässigung der von dir gemeinten Probleme bleibt ein Mangel. Ich möchte aber Gründe dafür anführen. Vom Standpunkt einer idealen Wissenschaftlichkeit müßte ein Kritiker nicht nur alles kennen, sondern auch jede Art von Literatur mit der gleichen unbestechlichen Gerechtigkeit bewerten. In Wirklichkeit arbeitet er aber als ein auch emotional auf Literatur reagierendes Individuum, er entwickelt Zu- und Abneigungen gegenüber bestimmten Schreibweisen, Schreibhaltungen und Autoren und vermag an den Gegenständen, die ihn reizen, mehr zu entdecken als an anderen, die ihm fremd bleiben. Will man ein vielfach gegliedertes Feld der Literatur überblicken, so muß man dieser Tendenz zum Subjektivismus Zügel anlegen; ganz ausschalten kann man sie kaum. Wenn ich zu einer Literatur schwer Zugang finde, so halte ich es für besser, über sie zu schweigen, als ihr aus einem Vorurteil heraus nicht gerecht zu werden.
Was die literarische Landschaft der jüngsten Zeit angeht, so scheint mir einerseits, daß sich einige der für das vergangene Jahrzehnt, besonders für seine zweite Hälfte, konstatierte Tendenzen bis heute fortsetzen. Die Erkundung des Alltags, die Beschreibung des Lebens werktätiger Menschen, die Selbstdarstellung sind und bleiben wichtige Angelegenheiten. Doch sind andererseits in den Jahren, die seit dem Schreiben jenes Versuches vergangen sind, auch einige neue Momente hervorgetreten, die der Tendenzbeschreibung vielleicht andere Akzente verleihen müßten. Was mir wichtig erscheint, das ist besonders in den letzten Jahren eine starke Erschütterung durch die gewachsene Kriegsdrohung. Es scheint dahinter zu stehen, daß durch diese zugespitzte Weltsituation für manche der Sinn und die Möglichkeit literarischen Schaffens überhaupt in Frage gestellt worden ist, daß mindestens insgeheim die Frage auftaucht, ob nicht die Musen am besten überhaupt zu schweigen hätten. Aber – und das halte ich für einen glücklichen Umstand – die Antwort ist dann doch die, daß die Musen nicht schweigen, sondern daß durch diese Erschütterung, durch das In-Frage-Stellen eines Sinnes von literarischem Schaffen überhaupt dann doch wieder neue Ausgangspunkte gewonnen wurden und werden, und zwar Ausgangspunkte von einigem Gewicht, die dazu geführt haben, daß man aus dem gewohnten Gleis heraustritt – stärker, als ich das vor ein paar Jahren noch sehen konnte. Zum Beispiel hat das dazu geführt, daß in einer Reihe von literarischen Werken große geschichtliche, menschheitsgeschichtliche Gesichtspunkte eingeführt worden sind. Ich nenne mal Irmtraud Morgners Amanda und Christa Wolfs Kassandra. Es handelt sich dabei wohl nicht darum, daß man sich aus irgendwelchen äußeren Rücksichten scheut, die Gegenwart zum Gegenstand der Literatur zu machen, sondern man glaubt, eine Einsicht in die Gegenwart erst wieder gewinnen zu können auf dem Wege über die Betrachtung bestimmter Grundprobleme der Menschheitsgeschichte. Und aus dieser Haltung heraus werden dann durchaus auch wieder Vorschläge gemacht, in dem Sinne, wie das Brecht mal von der Literatur erwartete.
Und um vom Allgemeinen aufs Besondere zu kommen, so denke ich daran, daß du dich darangemacht hast, den Nibelungenstoff dramatisch zu bearbeiten und hier in einer Verwandtschaft zu dem, was auch andere Autoren etwa gleichzeitig unternommen haben, an diesem Stoff auf einige Grundfragen wie Krieg und Frieden im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft, mit dem Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat und die widerspruchsvollen Zusammenhänge dieser verschiedenen großen geschichtlichen Komponenten dramatisch zur Anschauung gebracht hast. Du hast dieses angedeutete Verhältnis ja sogar als Regieanweisung oder Leseanweisung ausdrücklich formuliert, indem du sagst, alle Handlungen seien in ihrem Alter und in ihrer Gegenwärtigkeit zu zeigen. Das ist wissenschaftlich gar nicht leicht beschreibbar, macht aber die Besonderheit dieser Dramatisierung der Nibelungengeschichte mit aus.
Braun: Das will zunächst weiter nichts sagen, als daß man den Stoff als einen historischen nimmt, der auskommt ohne Anachronismen, weil er in sich anzüglich ist und viel unerledigte Geschichte transportiert. Es scheint mir, wir leben in einem Augenblick, in den alle produktiven Möglichkeiten und alle Schrecken der Geschichte geballt sind. Die Stationierung von Raketen auf deutschem Boden hat die Situation schlagartig verändert. Christa Wolf hat recht; wenn es so weit gekommen ist, muß sich auch die Literatur etwas herausnehmen. Wir beobachten (oder Hartinger beobachtete) ein Auseinandergleiten der Schreibweisen: das Fortschreiben der Literatur der siebziger Jahre; die Suche nach positiven Werten, nach lebbarem Leben; die Erziehung durch Erschrecken, ein Mittel, zu dem ich in den letzten Jahren geneigt habe. Angesichts der Zuspitzung der irdischen Probleme muß man aber das Erschrecken nicht mehr lehren, die Schockmethode wird stumpf, und man ist verwiesen darauf, die Konfliktfähigkeit zu trainieren durch Literatur, die Widersprüche auszuhalten und nicht unbedingt nach Lösungen zu fischen: Haltungen zu ermöglichen, die in dieser ungeheuren Welt noch realistisch sind. Die Helden des Nibelungenlieds, die bis zuletzt von den Verfassern als Helden behandelt werden, ungeachtet sie furchtbare Taten begehen und sich Mann für Mann abschlachten, können nach einem Jahrtausend wieder Gewährsleute unserer Erfahrung sein. Was dieses Epos heraushebt aus allen anderen Heldengedichten, ist die schonungslose Darstellung des gräßlichen Geschehens, das durch nichts mehr entschuldigt wird, durch keine christliche oder sonstige Ideologisierung. Wie auch die heute mögliche endgültige Not durch keinerlei Weltanschauung oder Glauben beschönigt werden könnte. Es ist die bewußte Selbstvernichtung, die am Horizont steht. Die Vorgänge des Lieds, wenn man sie aus dem Familienkalkül heraushebt in ein geschichtliches Feld, wenn man den „Helden“ also verständliche Seelen erfindet, werden eine zwar ferne, aber große Geschichte früherer Menschheit, zu der wir uns in Beziehung setzen. Das ist, als würden wir die Gesellschaft, in der wir leben, oder das Jahrhundert, als die möglicherweise letzte oder das letzte betrachten und sie deshalb, mit großem Abstand, messen an anderer, längst vergangener Geschichte, Troia oder Burgund, die eine Geschichte des Verschwindens war.
Dieser Abstand mag entsetzen, diese auferlegte Distanz zur eigenen Zeit, die Gelassenheit, mit der man sich anderen freilich vergleichlichen Gegenständen zuwendet. Aber es ist nicht nur das; es geht uns ja nahe. Es ist ein Warnen vor alten Mustern von Abläufen, die ins Nichts führten, und aus denen doch schlagend sichtbar wird, daß Geschichte nicht unausweichlich so laufen mußte. Sie lief aus Gründen so. Verhängnisse, selbst genäht, und ahnbar die Rettung, die immer vorhandene Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Die wahnwitzige Vorführung der fatalen Verläufe ist ja ein intimes Klammern an die heutige Welt, die wir nicht verloren geben.
Kaufmann: Du sagtest, daß deine Bearbeitung ohne Anachronismen auskomme. Sind es nicht, formal gesehen, sehr bewußte Anachronismen, wenn du z.B. zeitgenössische politische Aussprüche einarbeitest? Das Nichtanachronistische wäre wohl in einem weitergehenden Sinn zu fassen, nämlich so, daß eigentlich die Gesamtheit der großen Geschichtsprozesse als unabgeschlossen und in gewissem Sinne als noch dieselben gezeigt werden, daß der dominante Gesichtspunkt Krieg und Frieden die archaischen Züge der heutigen Weltlage besonders hervortreten läßt. Soll ich das so verstehen?
Braun: Es gib eine ganze Szene, die einen heutigen pikanten Text bemüht, weil, was dort im Jahr 436 zu sagen ist, treffender, wüster und altertümlicher gar nicht gesagt werden könnte als mit diesen in der Zeitung gefundenen Sätzen. Wenn ich jene historische Situation simulieren wollte, könnte ich keine besseren alten Worte finden als diese heutigen. Das liegt am Anachronismus der heutigen Zeit, nicht an dem Anachronismus des Mittelalters. Denn du hast recht: Die Gegenwart schleppt soviel Altes mit, alte Verlaufsformen, Strukturen, Denkweisen, daß die alten Vorgänge als Modell für heutige dienen können. Ein Umstand, der zu bedauern ist, der aber Geschichte für die Kunst darstellbar macht. Nur wenn Linien vom Gestern ins Heute als brennende spürbar sind, wird ein Stoff kunstwürdig. Hegel sah im Nibelungenlied nichts, was im 19. Jahrhundert interessiere, „das Schicksal des gesamten untergehenden Geschlechts“ habe „mit unserem häuslichen, bürgerlichen, rechtlichen Leben, unseren Institutionen und Verfassungen in nichts mehr irgendeinen lebendigen Zusammenhang“, es war ihm eine aschgraue, stumpfe, erledigte Geschichte. Daß da Frauen merkwürdige Szenen mit Männern haben, daß Brünhild Gunther in der Brautnacht an die Wand hängt, daß sie mit Hinterlist unterworfen wird – das mochte im preußischen Staat ein Kaspertheater sein, heute sind das virulente Vorgänge, weil ein Gegenprozeß stattfindet, weil sich die Frau aus der Unterwerfung durch Staatsverhältnisse herausrekelt. Und der Untergang eines Volkes, das mit offenen Augen in ein Messer rennt, das es nicht töten will – eine Gefahr, die noch nicht ausgestanden ist auf deutschem Boden, sie macht das Lied für uns zu einem aktuellen und aufregenden Text. Man muß ihn nicht verheutigen durch äußerliche Aktualisierung. Aufregend an den alten großen Stoffen ist das Unerledigte, sind die bis heute kämpfenden Widersprüche, die vielleicht Jahrhunderte scheinbar beruhigt waren oder zu Kompromissen geführt wurden, die plötzlich mit Wucht aufbrechen und Weltbedeutung erlangen. Wir greifen zu diesen Stoffen, weil sie den Untergang in sich haben. Die Nicht-Zukunft, die jetzt vor uns liegt wie die Zukunft, ist dort das Schicksal, das Kassandra zum Reden bringt, und zu einem unausweichlichen Nachdenken über die Alternative, und im Theater, so ist meine Rechnung, den Zuschauer.
Kaufmann: Du berührst hier wichtige Fragen unserer Literatur- und Gesellschaftsentwicklung, zu denen ich eigentlich ganz gern noch mehr von dir hören würde.
Braun: Aber die Fragen stelle nun wieder ich. – Du hast einen demokratischen Begriff von der Literaturwissenschaft: du nennst sie „diskutierend“. Du entziehst ihr damit, aus Erfahrung, schätze ich, das besserwisserische Prä und lädst sie an den runden Tisch, wo schon die Autoren Platz genommen haben, die sich auch nicht mehr als Präzeptoren und Schulungsleiter verstehen, und die Leser, die als Koproduzenten begrüßt zu werden wünschen. Du bist ein Verfechter solcher Partnerschaft, in der die Gesellschaft lernt, mit ihren Widersprüchen zu leben. Und ich bitte dich jetzt einfach, der Runde die Tagesordnung zu nennen.
Kaufmann: Vor zehn Jahren habe ich mal einen Versuch gemacht. Ich habe einen Überblick über Tendenzen der neuesten Literaturentwicklung, bevor ich ihn zum Druck gab, einigen Autoren gegeben und mit ihnen durchdiskutiert. Und ich denke daran eigentlich gerne zurück. Unter anderem bin ich dadurch mit Franz Fühmann ins Gespräch gekommen. Man hat sich auf diese Weise plötzlich als Diskussionspartner gesehen, was ja nicht bedeutet, daß man zu allen Fragen das gleiche denkt. Man konnte mit Fühmann sogar ganz kontrovers diskutieren, aber man lernte dabei, indem man seine Intentionen besser verstand. Einige Jahre später gab es bei einer Konferenz über Romantik wiederum mit Fühmann ein sehr streitbares, aber ganz produktives Gespräch. Zu einem demokratischen Begriff von Literaturwissenschaft gehört die Herstellung eines solchen partnerschaftlichen Verhältnisses; man wird sich dessen bewußt, daß man an den gleichen Zielen arbeitet.
Zur gleichen Zeit wurden auch andere solcher Versuche unternommen. Wir haben an der Akademie mehrfach Jahreskolloquien (z.B. über die Welt im sozialistischen Gedicht) und Gespräche veranstaltet, zu denen wir Autoren eingeladen haben. Du warst auch einmal da. Und das waren immerhin einige Ansätze dazu, jene Situation des Aneinandervorbeiredens zu überwinden, wie wir sie in den sechziger Jahren in beträchtlichem Maße hatten und wie sie seinerzeit Adolf Endler in einer scharfen polemischen Stellungnahme ausgedrückt hat. Nach meiner Meinung ist zur Herstellung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Literatur und Kritik noch lange nicht genug getan worden.
Der Begriff „diskutierende Literaturwissenschaft“ hat aber noch eine spezielle Bedeutung für eine Wissenschaft, die es mit unabgeschlossenen Literaturprozessen zu tun hat. Es bedeutet keine Rückversicherung, keine Vorsichtsmaßnahme, wenn man die Literaturwissenschaft in diesem Zusammenhang besonders als eine diskutierende vorstellt. Der Wissenschaftler muß sich zu seiner Aussage schon bekennen – sie ist falsch oder richtig oder teilweise falsch und teilweise richtig – und kann sich da auf nichts herausreden. Es geht jedoch darum, daß bei den neuen Prozessen, deren Material die Zeit noch nicht gefiltert hat, das von jedem einzelnen nur teilweise überblickt wird, wo andere, ebenfalls wichtige Gesichtspunkte in der einzelnen Studie unberücksichtigt bleiben und wo jede Stellungnahme des einzelnen notwendigerweise den Charakter der Vorläufigkeit hat, die Diskussion, d.h. das Einholen der Meinung des anderen, unbedingt notwendig ist.
Wenn ich jetzt die Anmaßung, die du mir nahelegst, der Runde die Tagesordnung zu nennen, aus Spaß ernst nehme, so würde ich zunächst sagen, daß ich in diese fiktive Runde auch diejenigen einladen würde, die für die literarische Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind. Und ich würde versuchsweise mal ein paar Punkte der Tagesordnung benennen:
1. Literatur als „Friedensforschung“.
2. Wie wir dahin gelangen (welche Hebel wir in Bewegung setzen müssen), um a) der Literatur, die Ansprüche an den Leser stellt und ihm eine gewisse Anstrengung abfordert, eine größere Verbreitung zu sichern, b) die Literatur der einfachen Unterhaltung in ihrem Niveau zu erhöhen.
3. Wie die Ergebnisse der Literaturwissenschaft und Ästhetik wirksamer für das literarische Leben gemacht werden können.
4. Literatur ist aus Sprache gemacht. Wie gelangen wir dahin, daß dies von der Kritik nicht mehr als Nebensache behandelt wird?
5. Verschiedenes.
Braun: Schreiben als Möglichkeit, intensiver in der Welt zu sein, sagt Christa Wolf. Höchste Subjektivität; bereit sein, „sich seinem Stoff rückhaltlos […] zu stellen“, bereit für die Verwandlung, „die Stoff und Autor dann erfahren“: in die gesellschaftlichen Beziehungen. Objektive Poesie nennt es Rimbaud paradox und genau, und die Suche nach der Methode dieses Schreibens nennt Christa Wolf „subjektive Authentizität“ oder: die Dimension des Autors. Das ist die Lebensweise der (wenigsten) Dichter (formuliert in einem Gespräch, in dem du die Fragen stelltest – jetzt frage ich dich:) Läßt sich ein ähnlich radikaler subjektiver Anspruch des Literaturwissenschaftlers behaupten? Bei seinem Bemühen um Objektivität… Wie vergegenständlicht er „als ein besonderer Mensch ein persönliches Weltverhältnis“ (deine Worte über den Autor), ein intensiveres Dasein im wissenschaftlichen Werk? Was ist die Dimension des Kritikers?
Kaufmann: Wenn der Autor schreibt, so empfindet er nicht nur die Möglichkeit, intensiver in der Welt zu sein, er teilt sie zugleich mit. Das Innerliche wird wirklich, indem es äußerlich, indem es Sprache und Form, damit Gegenstand der Kommunikation wird. Dadurch kann der Leser, also auch der Kritiker, an jenem intensivierten Dasein teilhaben. Besteht nun die Tätigkeit des Kritikers darin, lediglich das gehabte Leseerlebnis in Worte zu fassen? – Ich glaube nicht. Zur Zeit ist viel von der „Subjektivität“ des Kritikers die Rede. Ich halte es nicht für richtig, sie mit der Subjektivität der künstlerischen Weltaneignung einfach zu parallelisieren oder gleichzusetzen und aus dem Kritiker einen Auch-Künstler zu machen, der das, was der Poet geschrieben hat, in Form von Begriffen gleichsam nachdichtet. Das wäre der Unkritiker. Alle Aneignung der Welt, auch die geistige Aneignung einer geistigen Welt, ist subjektiv. Mit dem Gebrauch des Wortes subjektiv ist für den besonderen Fall noch nicht viel gesagt.
Ich sprach schon davon, daß Literaturkritik für mich ein Anwendungsfall von Wissenschaft ist; sie bedient sich des diskursiven Denkens. Der Kritiker muß nach Übereinstimmung seiner persönlichen Sicht auf ein Buch mit den gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Kunst und Wirklichkeit streben, um deren Kenntnis er sich zu bemühen hat. Zunächst ist er, wie gesagt, ein Leser, der durch die Lektüre in seinem Denken und seinen Emotionen in dieser oder jener Weise angerührt wird. Und er kommt zu einem Geschmacksurteil: es gefällt mir, es gefällt mir nicht, es läßt mich gleichgültig – usw. Und dieses spontane Gefallen oder Mißfallen soll er auch äußern. Bleibt er aber dabei stehen, so ist er noch kein Kritiker; von ihm muß mehr als eine spontane Lesermeinung erwartet werden. Er muß nämlich für sein Geschmacksurteil Gründe angeben, und sein Urteil muß mit den Maßstäben, die er aus der Geschichte und Gegenwart der Kunst gewinnt, übereinstimmen. Ein Kritikerurteil, das etwa lautete: „Dieses Buch ist schön, bedeutend und gesellschaftlich wertvoll, aber es gefällt mir persönlich nicht“, ein Urteil also, in dem Subjektives und Objektives einander äußerlich bleiben, kann allenfalls wegen seiner Ehrlichkeit, aber nicht in seinem Gehalt akzeptiert werden.
Der Kritiker, der zu einer solchen Schlußfolgerung käme, müßte seinen Geschmack überprüfen und verändern. Seine individuellen ästhetischen Wertvorstellungen müssen einen „substantiellen Gehalt“, wie Hegel sagen würde, eine gesellschaftliche Relevanz besitzen und so orientierend wirken. Es ist nicht leicht, dies in der Sofortreaktion auf eine Neuerscheinung zu erreichen, die Neuerungswert besitzt, also in den auf Überlieferung sich gründenden Maßstäben nicht aufgeht. Den Wert von Neuerungen einzuschätzen, ist wohl das schwierigste. Doch das Streben nach überindividueller Geltung, nach Objektivität, muß den Urteilen und Argumenten des Kritikers ablesbar sein.
Wenn Schriftsteller auf der Subjektivität des Kritikerurteils bestehen, so geschieht das gewöhnlich aus verständlichen praktischen Gründen, die mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Literatur zu tun haben. Sie verwahren sich dagegen, daß das negative Urteil eines einzelnen zum Anlaß genommen wird, um einem literarischen Werk seine Existenzberechtigung abzusprechen. Das ist, wie gesagt, verständlich, aber kein Grund, um daraus Theorien zu machen, die darauf hinauslaufen, daß das Subjektive, weil subjektiv (gemeint ist eigentlich mehr das Individuelle), keinen objektiven Geltungs- und Wahrheitsanspruch erheben könne.
Braun: Bei einem neuen Buch eines lebenden Autors, schreibst du, berühre man „so oder so seine Interessen“. So oder so heißt wohl: indem man ihm nachschreibt oder vorschreibt. Ich gestehe dir, das Vorschreiben, das Vorausschreiben ist, was mich an der Kritik interessiert. Ich will, daß sie mich auf andere Gedanken bringt, auf einen anderen Text. Und nicht nur an den alten, sondern an den neuen Büchern mitarbeitet, den ungeschriebenen, die uns fehlen. Wenn sich die Autoren beklagen, daß sich der Kritiker einen Kopf darum macht – um das andere Buch, das der Autor nicht zustande brachte –, so ist das eitle Blödelei. Denn um eben das Buch wird es gehen, und ich wünsche dir, daß du daran bleibst. Was für eine Literatur erhoffst du dir?
Kaufmann: Schreibt man über lebende Autoren, so entstehen auch persönliche Probleme. Man macht Leute, denen man in der Realität begegnet, die man persönlich kennt oder die man gelegentlich auf Sitzungen und Beratungen sieht, zu Objekten wissenschaftlicher Überlegungen. Da kann es natürlich passieren, daß die wissenschaftliche Aussage, zu der man sich verpflichtet fühlt, mit zwischenmenschlichen Beziehungen in Kollision gerät. Mir ist das einmal passiert, als ich in einer skizzenhaften Darstellung, die ein Eingehen auf Details gar nicht erlaubte, ein umfangreiches Buch eines bekannten Autors en passant lediglich mit einer kritischen Anmerkung erwähnt habe. Das war offensichtlich für diesen Schriftsteller eine beträchtliche Kränkung. Mir ist es nicht angenehm, den Autor gekränkt zu haben, aber auf der anderen Seite kann ich in dem gegebenen Zusammenhang – der ja eben von der Sache her diktiert ist – auch nichts anderes tun, als meine Überzeugung zu äußern. Und dadurch entstehen Spannungen. Allgemeiner gesagt: Es existiert ein bestimmtes Feld von Beziehungen, in dem das Schreiben über lebende Autoren nun einmal steht und das dem Kritiker gewisse Verhaltensnormen auferlegt. Schlecht ist es aber, wenn diese Normen der Wahrheitsfindung zu starke Schranken auferlegen.
Die Frage, was ich mir für eine Literatur erhoffe, ist nur nach einer Seite hin zu beantworten. Im Rahmen wissenschaftlicher Überlegungen wäre es müßig, sich eine Literatur zu erhoffen, die man nicht auch für real möglich hält – bzw. umgekehrt: Man müßte auf die realen Erfordernisse einer erhofften Literatur hinweisen. Ich möchte hier auf den Versuch verweisen, den ich in dem Aufsatz „Veränderte Literaturlandschaft“ gemacht habe. Ich habe dort nicht einfach beschreibend einen großen Kreis von Büchern Revue passieren lassen. Vielmehr habe ich gleich am Anfang mit einer bestimmten exemplarischen Auswahl von drei sehr verschiedenartigen literarischen Werken angefangen und habe den Versuch gemacht, ihnen, die ich alle drei für wertvoll, sogar für bedeutend halte und die auch etwa zur gleichen Zeit entstanden sind, etwas Gemeinsames abzugewinnen, einen gemeinsamen Nenner zu formulieren. (Man kann das in diesem Aufsatz nachlesen.) Ich versuche dort, über das Beschreiben eines Zustandes hinauszugelangen und etwas darüber auszusagen, wie eine bedeutende Literatur in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation aussehen könnte, welche Merkmale sie aufweisen müßte. Das, was sein könnte, kann nicht dem, was ist, gegenübergestellt werden, sondern es muß aus dem, was existiert, gewonnen werden. Nur an den besten Leistungen, die die Literatur wirklich hervorgebracht hat, läßt sich etwas Tendenzielles beschreiben. Nicht aus Büchern, die man sich wünscht, sondern aus den besten vorhandenen Leistungen kann man das ableiten, was in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation möglich ist. So weit kann Prognose allenfalls zu gehen versuchen, mit allen Einschränkungen, die dabei zu machen sind. Sie beziehen sich insbesondere natürlich darauf, daß die Individualität des Autors – das habe ich wohl schon mal gesagt – nicht ein mit den Mitteln der Literaturwissenschaft berechenbarer Faktor ist. Und da alle Literatur eben von einzelnen Autoren gemacht wird, bleibt ein starkes Element von Unsicherheit immer vorhanden. Es käme aber darauf an, nach meinem Dafürhalten, solche methodologischen Ansätze, wie sie dort in noch essayistischer Form und provisorisch versucht worden sind, fortzusetzen und zu systematisieren, um die Irrtums- und Fehlerquote zu verringern.
Dann sollte es gelingen, daß die Literaturwissenschaft an der entstehenden Literatur „dran“, daß sie ihr Partner ist, ohne sie unkritisch bloß in Gedanken zu reproduzieren, daß die Kritik sowohl auf die Ansichten über unsere Literatur als auf diese selbst Einfluß nimmt.
Braun: Du hast Einfluß darauf genommen. Es gibt ja andere Wünsche, denen eine brave Schreiberei gern gerecht wird.
Die Literatur trägt ihren Kampf unter sich aus durch die indirekte, amüsierte Polemik, die sie endlos durchwebt. Direktheit kann nur der Sonderfall sein, die Gunst peripherer Genres. Der Literaturwissenschaft aber ist Schärfe zu wünschen im Gemetzel der kritischen Strömungen; die Kritikkritik – das härteste Turnier. Ihr solltet euch zwingen, Farbe zu zeigen. Damit wir unsere Freude daran haben, nicht wahr?
Geleitwort
Es steht uns zu, mit Härte und mit Heiterkeit mitleidlos auf das Eigne zu schauen. Die Wahrnehmung, daß wir nichts im Ganzen, doch etwas über uns selbst vermögen, ist der utopische Fund, der zu machen ist.
So Volker Braun am Vorabend seines 60. Geburtstages in einem Gespräch mit Silvia und Dieter Schlenstedt. Der Dichter, radikal im Denken, von außerordentlicher Sprachmächtigkeit, hat ein Werk geschaffen, „das sich der Zeit ausgesetzt hat wie kaum eines“, sagt Christa Wolf.
Die Sammlung von Aufsätzen, Rezensionen und Gesprächen dreier miteinander in vieler Hinsicht verwandter Literaturwissenschaftler begleitet Brauns Schaffen seit 40 Jahren. Immer wieder wird deutlich, dass Volker Braun, unbequem und zu allen Zeiten mit einem hohen Maß an Zivilcourage, die Frage nach den Möglichkeiten geschichtlichen Handelns stellt. Die Besinnung auf die Altvorderen, Büchner vor allem, Goethe, Lenz, Rimbaud oder Peter Weiss, gehört dabei zu den Eigenarten seiner Poetik.
Es spricht für die Autoren dieses Bandes, dass sie die Beiträge bis 1989 im Nachhinein nicht klüger gemacht oder geglättet haben und sie in ihrem sprachlichen ,DDR-Gestus‘ beließen. Offensichtlich werden so auch die Literaturverhältnisse des verflossenen Landes. Man hat den Eindruck, die Literaturvermittler sind nicht nur mit Braun und dem Leser im Gespräch, sondern mit einem ,dritten Mann‘ einer oberen Behörde, die man von der Wichtigkeit und Qualität eines Buches überzeugen muss. Zensur, Druckverzögerungen und Verbote begleiten das Werk von Volker Braun. Es wäre ein eigenes Kapitel wert. Man lese nur in diesem Band das Gutachten zum Hinze-Kunze-Roman oder die unzensierte Fassung des Gesprächs „Volker Braun fragt Hans Kaufmann“. Hier haben die Herausgeber jene Stellen kenntlich gemacht, die der Zensur zum Opfer fielen.
Schließlich sei auf Volker Brauns bittere Replik am Ende des Interviews mit Ulrich Kaufmann und Frank Quilitzsch verwiesen.
Schön wäre es, wenn dieser Band Anstoß zu einer Gesamtdarstellung des bisherigen Braun’schen Werkes im Kontext der deutschsprachigen Literatur gäbe. Sie steht aus, wie auch eine wirklich vollständige Werkausgabe. Man bedenke allein das Schaffen der letzten 20 Jahre von „Bodenloser Satz“ bis hin zu „Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchammer“ mit diesem globalen Blick auf einen begrenzten Landstrich. Nicht zu vergessen die Lyrikbände. Als Theaterdichter ist Volker Braun in den letzten Jahren zurückgetreten. Und es wäre darüber zu sprechen, wie sein Vermögen als Dramatiker die Prosa prägt.
Der Lese-Zeichen e.V. unterstützt gern die Drucklegung dieses Bandes. Verdanken wir Volker Braun ja nicht allein die Bücher, sondern auch Lesungen, an die wir immer wieder zurückdenken. So an die auf der Literatur- und Kunstburg Ranis an einem milden Sommerabend im Juni 1999 zu den jährlich stattfindenden Thüringer Literatur- und Autorentagen. Braun las, wie immer konzentriert, Lyrik und Prosa. Sein sächsischer Diphthong wehte leise durch die Vokale und gab dem Ganzen einen eigenen Sound. Vom Bergfried starteten die jungen Falken ihre ersten Flugversuche.
Martin Straub, April 2009, Vorwort
Inhalt
– Vierzig Jahre mit dem Dichter Volker Braun – Vorwort
– Hans Kaufmann (1999): Fortgesetzter Widerstand
– Hans Kaufmann (1968): Wie ist die Lage? Kritische Bemerkungen zu Brauns „Lagebericht“
– Hans Kaufmann (1968): Wie „faustisch“ ist Hans Faust? „Hans Faust“-Aufführung in Weimar
– Hans Kaufmann (1974): „Was bleibt zu tun?“ Fragen eines Arbeiters während der Revolution
– Hans Kaufmann (1976): Volker Brauns „Tinka“
– Hans Kaufmann (1982): Arbeitsgutachten zu Brauns „Hinze-Kunze-Roman“
– Volker Braun fragt Hans Kaufmann (1986): Die Dimension des Kritikers
– Hans Kaufmann (1986): Der Gestus der Unehrerbietigkeit in Brauns „Hinze-Kunze-Roman“. Diskussionsbeitrag zu einer Kontroverse
– Ulrich Kaufmann (1987): Peter-Weiss-Lektüre bei Braun und anderen
– Ingrid Pergande (1987): Politische Poesie als Vorgang zwischen Menschen. Zur Rezeption des Gedichtbandes „Gegen die symmetrische Welt“
– Ulrich Kaufmann (1990): Umgang mit Peter Weiss: „Trotzki im Exil“ – „Lenins Tod“
– Ingrid Pergande (1990): „Doch die eigenen armen Entwürfe gelten jetzt nichts“. Alltag, Politik und Literatur bei Volker Braun
– Ingrid Pergande (1991): „Volker Braun? – Da kann ich nur sagen, der Junge quält sich.“ Neue Stimmen in der DDR-Lyrik der achtziger Jahre
– Ulrich Kaufmann (1992): „… Poesie aus der unvollendeten, aus der arbeitenden Geschichte…“. Im Dialog mit Georg Büchner
– Frank Quilitzsch, Ulrich Kaufmann im Gespräch mit Volker Braun (1998): Nach wie vor dem Umbruch – Das Nichtgelebte ist das, wovon man nicht loskommt
– Ulrich Kaufmann (1999): „Das liebe Zimmer der Utopien“. Thüringen als Arbeitsort des Dichters Braun
– Ulrich Kaufmann (2001): Doppelter „Abschied von Kochberg“. Lyrisches Zwiegespräch mit Jakob Lenz
– Ulrich Kaufmann (2002): Eine Endzeit grüßt die andere. Uraufführung von „Limes. Mark Aurel“ in Kassel
– Ulrich Kaufmann (2005): „Ein Freudenelend ist das Leben“. Der Gedichtband „Auf die schönen Possen“
– Ulrich Kaufmann (2007) Ein anderer Woyzeck“. Der Dichter im erneuten Gespräch mit Büchner
– Ulrich Kaufmann (2007): „Ich war kaum geboren, da war Krieg“. Braun porträtiert die Portalfiguren seines Lebens
– Ulrich Kaufmann (2007): „… die schönste Geschichte der Welt“. Braun liest Hebel
– Ulrich Kaufmann (2008): Der Bergmann als Ritter. Bitterböse Schwänke in der Tradition von Cervantes
Anhang
– „Abschied von Kochberg“ – Faksimile
– Volker Braun in dem Film „Lieb Georg“ (Tonmitschnitt)
– Volker Braun. Fotos von Lothar Deus
– Volker-Braun-Ausstellung 2009 im Holzland-Gymnasium Hermsdorf/Thüringen. Fotos von Rudolf Pörs
– Bibliografie der Erstdrucke und Uraufführungen der Werke Volker Brauns
Drucknachweise
Über die Autoren des Bandes
Personenregister
Vierzig Jahre mit dem Dichter Volker Braun
Du hast es mit den Resultaten der dichterischen Arbeit zu tun, du bist elend auf sie angewiesen, das könnte dich ungeduldig und reizbar machen. Ich profitiere von der Wissenschaft und mache meinen Vers darauf. Wir sind Stiefzwillinge, und natürlich kennen wir mitunter die Verwandtschaft nicht.7
(Volker Braun zu Hans Kaufmann, 1985)
Das Verhältnis des Dichters Volker Braun zur Literaturwissenschaft unterscheidet sich von dem vieler anderer Autoren – das gilt sowohl für seine Schaffenszeit in der DDR als auch für seine Arbeiten und öffentlichen Auftritte nach der „Wende“. Die Gründe für eine jahrzehntelange „bekennende“ Nähe8 sind vielschichtig und es lohnt, ihnen nachzugehen.
Zunächst ist Braun natürlich selbst ein theoretischer Kopf und hat ein gesellschaftswissenschaftliches Studium belegt. Nach dem Abitur bekam der 1939 Geborene keinen Studienplatz und arbeitete deshalb unter anderem einige Jahre im Tiefbau und im Bergbau; jene Zeit förderte sein Interesse und sein Gespür für die ,einfachen Leute‘ im Produktionsprozess, die fortan die künstlerische Blickrichtung bestimmen. Sein historisches und philosophisches Interesse führte ihn endlich doch zum Studium der Philosophie in Leipzig, das er von 1960 bis 1965 absolvierte. Im Jahr des Studienabschlusses erschien sein erster Gedichtband Provokation für mich und zeigte eine einzigartige Verbindung von jugendlich-kraftvoller Sprechweise und poetischer Sicht auf den Alltag der ihn umgebenden Welt.
Volker Braun verstand sich von Anfang an als politischer Schriftsteller, mischte sich mit seinen Texten in die Auseinandersetzungen seiner Zeit ein und wurde 2008 gar als der „wohl […] politischste aller deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte“ bezeichnet und mit Peter Weiss verglichen.9 Politik und Poesie waren für den Lyriker, Dramatiker, Prosaisten und Essayisten nie ein Gegensatz, im Gegenteil:
Eben weil, was die Poesie ausspricht, die empfundenen Beziehungen des Menschen, das Leid und die Lust, nicht durch sie ausgeräumt oder produziert werden kann, muß sie ,nach draußen‘ wirken, aus sich heraus, daß die vielen das praktisch bewältigen. Das ist das politische Wesen der Poesie. Dafür wird sie gefürchtet und verfolgt, und gelesen und verbreitet.10
Literatur hatte in der DDR einen geradezu ,wunderbaren‘ und zugleich schweren Stand: Sie wurde ernst genommen. Und sie wurde sehr schwer genommen, geradezu überlastet mit Aufgaben. Lebenshilfe sollte sie sein, politische Orientierung geben, den Staat DDR festigen, an der Ausbildung sozialistischer Persönlichkeiten mitwirken, den bzw. die sozialistischen Menschen – vornehmlich in der Produktion – darstellen. Man bürdete ihr viel auf seitens der Kulturpolitik, und die Leser suchten in kritischer Literatur das zu finden, was ihnen z.B. in den Medien vorenthalten wurde. Heute ist manches einfacher, aber oft auch beliebiger geworden.
In diesem Konfliktfeld von Literatur, kulturpolitischer Überfrachtung und Reglementierung und einer ungeduldigen und selbstbewussten Leserschaft agierte auch die Literaturwissenschaft in der DDR. Besonders jene Wissenschaftler, zu deren Lehr-, Forschungs- und Interessengebiet der aktuelle Literaturprozess gehörte und die Publikationen über Neuerscheinungen veröffentlichten, hatten mitunter einen nicht leichten Stand. Von kulturpolitischer Seite aus wurden sie gleichsam zu ,Wächtern‘ über den aktuellen Literaturprozess erhoben, die Autoren erwarteten von ihnen (wenn sie denn überhaupt etwas von der Literaturwissenschaft erwarteten) Beistand gegenüber politischer Zensur und die Leser Orientierungshilfe in einer immer disparater werdenden literarischen Landschaft.
Wenn Volker Braun anlässlich eines Gesprächs mit dem Literaturwissenschaftler Hans Kaufmann, in dem – recht ungewöhnlich – der Dichter dem Wissenschaftler die Fragen stellte, das sprechende Bild der „Stiefzwillinge“ verwendet, so meint er dieses gemeinsame und durchaus ähnliche Agieren von Autor und Wissenschaftler in jenem hier charakterisierten politischen und kulturpolitischen Umfeld. Braun stellt in dem Gespräch diesem Teil der Geisteswissenschaft ein positives Zeugnis aus:
Der Literaturwissenschaft eignet heute oft mehr Realismus als mancher anderen Gesellschaftswissenschaft; es liegt natürlich daran, daß ihr Gegenstand ihr die Wirklichkeit relativ unverklärt nahebringt, in den arbeitenden Widersprüchen, welche Kraft und Schönheit des künstlerischen Textes konstituieren […]. Ich will nicht sagen, daß die Literaturwissenschaft mit ihrem Pfund wuchert, der Zentnerlast der Wahrheit, aber sie handelt immerhin – mit nicht gängiger Münze.11
Um die „Zentnerlast der Wahrheit“ ging es sowohl dem Autor Braun als auch den literaturwissenschaftlichen Mitstreitern. Dass sie „gnadenlos“ aufeinander angewiesen waren, gründet nicht nur in vergleichbaren Denkweisen und Interessen, sondern gleichermaßen in jenem politischen und kulturpolitischen Klima der DDR, in dem es Brauns Werke von Anfang an nicht leicht hatten, in dem er aber auch stets Verbündete in der Zunft der Literaturwissenschaft an seiner Seite wusste.
Schon mit seinen ersten Gedichten aus dem Band Provokation für mich (1965) geriet Braun in die Kritik. In einem gesellschaftlichen Klima, in dem die Propaganda täglich sozialistische Fortschritte im Kampf gegen alle Hemmnisse in der sozialistischen Produktion, gegen den „Klassenfeind“ vermeldete und vornehmlich Erfolge gefeiert wurden, nahmen sich Ausrufe wie „Kommt uns nicht mit Fertigem! Wir brauchen Halbfabrikate!“12 bereits gefährlich provokant aus. Braun wurde allzeit kritisch beäugt; er war unbequem, weil er sich in seinem Denken und Dichten nicht anpasste. Dass er gleichwohl den Sozialismus verändern und voranbringen wollte und bis fast zum Schluss an dessen Verbesserbarkeit glaubte, wurde oftmals übersehen oder in Frage gestellt – was mit der generellen Unfähigkeit der DDR-Funktionäre zu tun hatte, mit Kritik umzugehen, sie anzunehmen und produktiv zu nutzen.
Die vorliegende Sammlung vereint 23 literaturwissenschaftliche und -kritische Texte über den Dichter Volker Braun aus der Feder dreier Autoren: des Literaturwissenschaftlers Hans Kaufmann (1926–2000), der Berliner Germanistin und Publizistin Ingrid Pergande sowie des Jenaer Publizisten und Gymnasiallehrers Ulrich Kaufmann. Die Beiträge (entstanden zwischen 1968 und 2008), von denen einige hier erstmals veröffentlicht werden, beleuchten das Werk Volker Brauns jeweils nur punktuell. Dennoch entsteht ein Mosaik, das die Entwicklungslinien und die Vielschichtigkeit eines Autors veranschaulicht, der die DDR-Literatur in ihrer Einmaligkeit und Besonderheit maßgeblich mitgeprägt hat, und der sich nach der „Wende“ als Schriftsteller in der BRD neu positionieren musste. Kritisch-gegenwartsbezogen und politisch sind seine Texte nach wie vor, von ihrer Sprachkraft und dem stilistischen Hinter- und Widersinn haben sie nichts eingebüßt. Als er 1996 den Kritikerpreis erhielt, bescheinigte man ihm, dass der „Kritiker der alten Realitäten“, der „Widergänger des realen Sozialismus“ zu einem Kritiker „der neuen Illusionen“ geworden sei. „Literatur ist ihm“, so hieß es, „eine Verschwörung des Subjekts gegen das nichtgelebte Leben in einer bewußtlosen Gesellschaft“.13 Sein Roman Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer (2008), mit dem sich ein Beitrag von Ulrich Kaufmann in diesem Band beschäftigt, ist ein philosophisch-politisches Meisterstück über heutige Verhältnisse und soziale Betrübnisse, ein satirisches Sprachkunstwerk, das dem Hinze-Kunze-Roman in nichts nachsteht. Wenn einige Kritiker bereits von einem „Volksbuch“ sprachen, so keineswegs, weil es eine leicht zu verdauende Lektüre ist. Im Gegenteil: Die dialektische Sprachform, eine tiefsinnige, komplizierte Struktur, das stilistische Hin- und Herwenden von Widersprüchen, eine scharfe Ironie, Sprachverdrehung und Hintersinn zeigen das Sprachvermögen des Autors auf neuer Stufe. „Volksbuch“14 mag man das Buch nennen, weil es in seinem Anspruch universell und volksnah ist:
Er [der Verfasser, der sich gelegentlich in den Roman einschaltet – Hg.] hat das Meer vielleicht überfischt, aber den Gegenstand nicht ausgeschöpft. […] Vielleicht muß sich die Menschheit noch einmal buchstabieren, und der neue Anfang der Geschichte heißt: für den Letzten soll die Welt gemacht sein.15
Die Verfasser blicken nicht von heute aus auf Brauns umfangreiches Werk zurück, sondern sie haben dieses als work in progress über Jahrzehnte mit dem Blick der Zeitzeugen, eingebunden in wissenschaftliche Projekte und dem Autor immer freundschaftlich verbunden, begleitet. Um die wissenschaftlichen und literaturkritischen Beiträge in ihrer Historizität zu belassen, sind keinerlei inhaltliche Änderungen an den Texten vorgenommen worden. An einzelnen Stellen wurden Anmerkungen der Herausgeber beigegeben, jedoch ausdrücklich gekennzeichnet. Die Texte wurden lediglich formal bearbeitet, um innerhalb des Bandes einen leserfreundlichen einheitlichen Zitierstandard anzuwenden.
Das Buch möchte helfen, Brauns Texte im jeweiligen Kontext kenntlich zu machen. Neben umfangreicheren wissenschaftlichen Abhandlungen (über Brauns Dialog mit Georg Büchner, die Rezeption des Gedichtbandes Gegen die symmetrische Welt, über das Verhältnis junger Autoren der achtziger Jahre zu Braun) und Werkanalysen (Tinka) stehen kleinere publizistische Arbeiten für die Tagespresse (Uraufführung 2002 von Limes. Marc Aurel in Kassel, Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer) bzw. für Zeitschriften. Interviews finden sich neben Texten, die vor 1989 nicht für die Veröffentlichung geschrieben waren, sondern innerhalb des kulturpolitischen „Apparats“ ihre interne Funktion hatten (Verlagsgutachten zum Hinze-Kunze-Roman).
Anhand der Entstehungs-, Druck- und Rezeptionsgeschichten von Werken Volker Brauns gehen die Verfasser auch auf das Problem der Zensur in der DDR ein. Nach verschiedenen Eingriffen kulturpolitischer Funktionäre in noch ungedruckte/nicht gespielte Texte arbeitete Braun an diesen weiter, ging im Interesse der Veröffentlichung Kompromisse ein, versuchte sich auch zu arrangieren bzw. die Eingriffe der Zensur schrittweise zu unterwandern, jedoch ohne opportunistisch den eigenen Ansatz aufzugeben. Der Hinze-Kunze-Roman (1985), eine bitterböse Satire auf die stagnierenden Verhältnisse in der DDR und einen sie widerspiegelnden Funktionärsjargon, lag vier Jahre ungedruckt bei den Behörden. York-Gothart Mix hat 1993 eine eindrucksvolle Dokumentation zusammengestellt mit Zeitdokumenten über die leidvolle Geschichte, die vor sich ging, ehe Brauns Hinze-Kunze-Roman erscheinen konnte – ein unglaublicher Vorgang.16 Hans Kaufmanns „Arbeitsgutachten“, das bei Mix fehlt, in dem vorliegenden Sammelband jedoch enthalten ist, trug – neben den Bemühungen und Texten von Dieter Schlenstedt – auch dazu bei, dass der Roman überhaupt in der DDR erscheinen konnte. Braun wusste die Unterstützung Hans Kaufmanns nicht nur bei diesem schwierigen Druckprozess zu schätzen – eine jahrzehntelange Freundschaft verband den Schriftsteller mit dem Wissenschaftler.
Für den Sammelband Werke und Wirkungen (1987) schrieb Ingrid Pergande eine Abhandlung über die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von Brauns Gedichtband Gegen die symmetrische Welt. Der von einem Forscherteam der Akademie der Wissenschaften der DDR erarbeitete Band lag lange auf Eis. Die zuständigen Funktionäre meinten, er sei von der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Konzeption und Literaturauffassung her zu „elitär“ und würde einseitig und tendenziös lediglich „Literaturskandale“ (um Werke von Volker Braun, Heiner Müller, Ulrich Plenzdorf, Erwin Strittmatter, Christa Wolf u.a.) und nicht die positiven Wirkungsmöglichkeiten von Literatur im sozialistischen System darstellen. Erst als die Literaturwissenschaftler Aufsätze zu Bruno Apitz und Hermann Kant nachlieferten, durfte das Werk im Reclam-Verlag erscheinen.
Über Jahre interessierte sich Ulrich Kaufmann dafür, in welch produktiven Dialog Schriftsteller der DDR mit Georg Büchner traten. Im Falle Brauns war dies besonders interessant: Der Essay „Büchners Briefe“ (1978) war verboten und nur in Frankreich und der BRD erschienen, d.h. für den Wissenschaftler in der DDR mit einiger Anstrengung zwar zugänglich, aber nicht zitierbar. Die frühen Geschichtsdramen Lenins Tod und T. (gemeint war die „Unperson“ Trotzki) durften erst im letzten Jahr der DDR in Buchform gedruckt werden. „Spiegelgasse“, jenes Gedicht, in dem sich Braun mit Büchners Zeit im Züricher Exil beschäftigt, lag in der DDR nur in einer zensierten Fassung vor usw.
Für den Band haben die Herausgeber eine Bibliografie der Erstdrucke und Uraufführungen Braun’scher Werke erarbeitet. Dieses Unterfangen erwies sich als nicht ganz einfach, da der Dichter häufig an bereits publizierten Texten weiterarbeitet und sie späterhin in einer überarbeiteten Version veröffentlicht oder sich ganz von ihnen verabschiedet hat, wie im Fall des Stücks Hans Faust. Angesprochen auf diese „Neigung des Verwerfens“, antwortete Braun 1999:
Ja, natürlich. Man hat sich selber wegbewegt.17
Diese Bibliografie gibt in der Parallelität von Publikationen in der DDR und in der BRD bzw. im Ausland weiteren Aufschluss über die Druckgeschichte Braun’scher Werke. Was sie jedoch nicht erfasst, ist die häufig erhebliche Differenz zwischen der Entstehung der Werke18 und ihrer Veröffentlichung – jene Zeit, in der sich die nervenaufreibenden kulturpolitischen Debatten und Versuche des Eingriffs in die Werke abspielten, die in den Führungsetagen blasphemisch als „kollektive Meinungsbildungsprozesse“ bezeichnet wurden.
Eine historisierende Lesart voraussetzend, sind die Beiträge des Bandes chronologisch angeordnet – bis auf die Druckfassung der letzten öffentlichen Rede Hans Kaufmanns im Mai 1999 mit dem Titel „Fortgesetzter Widerstand“, gehalten auf einer Veranstaltung des Berliner Literaturforums im Brecht-Haus anlässlich des 60. Geburtstags von Volker Braun. In dem anrührenden Text auf den Jubilar zeichnet der Literaturwissenschaftler miniaturartig ein Porträt des Autors von dessen ersten Gedichten in den sechziger Jahren über das „Wende“-Gedicht „Das Eigentum“ bis hin zu dem 1998 erschienenen Essay-Band Wir befinden uns soweit wohl. Wir sind erst einmal am Ende, das den Herausgebern im Sinne eines Auftakts für die nachfolgenden Beiträge geradezu als Glücksfall erscheint. Neben der auch autobiografisch angelegten Würdigung des Dichters reflektiert Hans Kaufmann zugleich seine erste eigene Veröffentlichung im Jahre 1968 zu Brauns Gedichten „Lagebericht“ und setzt sich kritisch mit dort vorgenommenen Wertungen auseinander. Dieser Beitrag gibt den Herausgebern zugleich Gelegenheit, knapp und freundschaftlich den damaligen Gruß Hans Kaufmanns an Volker Braun – ,,Salut Volker.“ – zum diesjährigen 70. Geburtstag wieder aufzunehmen und ihm im nächsten Jahrzehnt viel Gesundheit und Energie für den notwendig ,fortzusetzenden Widerstand‘ zu wünschen.
Wir danken dem Jenaer Lese-Zeichen e.V. für die Unterstützung unseres Projekts; Dr. Frank Quilitzsch für die Abdruckerlaubnis des zusammen mit Ulrich Kaufmann 1993 geführten Gesprächs mit Volker Braun; Gerd Adloff für die sachkundige Mitarbeit an der Bibliografie, Hannes Berghof für die Gestaltung des Buchumschlags und die Unterstützung bei den Layout-Arbeiten, Yvonne Okunewa für das Korrektorat der Beiträge und Dr. Brigitte Peters für die kritische Begleitung des Projekts. Der Berliner Fotograf Lothar Deus hat Volker Braun über Jahre hinweg mit der Kamera begleitet und den Dichter in seiner Diskussionsfreudigkeit, Bedachtsamkeit und Verschmitztheit eingefangen. Ihm danken wir für die Fotos, die er uns großzügig für den Band überlassen hat. Der Leistungskurs Deutsch 11.2 (Leitung Ulrich Kaumann) am Holzland-Gymnasium in Hermsdorf/Thüringen hat 2009 eine Volker-Braun-Ausstellung unter dem Titel Fortgesetzter Widerstand veranstaltet,19 aus der wir einige Fotos veröffentlichen. Sie stammen von Rudolf Pörs, dem wir herzlich danken.
Ingrid Pergande und Ulrich Kaufmann, Frühjahr 2009, Vorwort
„Stiefzwilling“
nennt der politisch-philosophische, sprachgewitzte Lyriker, Dramatiker und Prosaist Volker Braun 1985 den Literaturwissenschaftler Hans Kaufmann, der seit den frühen sechziger Jahren die Arbeit des Dichters begleitet hat. Brauns ungeduldige gesellschaftskritische Poesie hatte es unter der DDR-Zensur schwer, überhaupt gedruckt oder aufgeführt zu werden. Namhafte Literaturwissenschaftler halfen katalysatorisch mit, seine Werke über die kulturpolitischen Hürden zu bringen. Gemeinsam lebten sie die Utopie einer möglichen Veränderung der DDR. Aufsätze von Hans Kaufmann und zwei Fachkollegen der nächsten Generation, Ingrid Pergande und Ulrich Kaufmann, aus den Jahren 1968 bis 2008 zeigen eine Symbiose zwischen Wissenschaftler und Dichter, die so häufig nicht ist.
Klappentext, 2009
Beitrag zu diesem Buch:
Margrid Bircken: Ingrid Pergande, Ulrich Kaufmann (Hg.): „Gegen das große Umsonst“
Argonautenschiff : Jahrbuch der Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + Facebook
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope
In der Reihe Klassiker der Gegenwartslyrik sprach Volker Braun am 9.12.2013 in der Literaturwerkstatt Berlin mit Thomas Rosenlöcher.
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Die Geschichte macht keinen Stopp von Peter Neumann. Ein Besuch beim Büchnerpreisträger Volker Braun, der den Weltgeist immer noch rumoren hört.
Zum 80. Geburtstag von Volker Braun:
Katrin Hillgruber: Der ewige Dialektiker
Der Tagesspiegel, 5.5.2019
Rainer Kasselt: Ein kritischer Geist aus Dresden
Sächsische Zeitung, 7.5.2019
Hans-Dieter Schütt: Die Wunde die bleibt
neues deutschland, 6.5.2019
Cornelia Geißler: „Der Osten war für den Westen offen“
Frankfurter Rundschau, 6.5.2019
Helmut Böttiger: Harte Fügung
Süddeutsche Zeitung, 6.5.2019
Erik Zielke: Immer noch Vorläufiges
junge Welt, 7.5.2019
Ulf Heise: Volker Braun – Inspiriert von der Widersprüchlichkeit der Welt
mdr.de, 7.5.2019
Oliver Kranz: Der Schriftsteller Volker Braun wird 80
ndr.de, 7.5.2019
Andreas Berger: Interview zum 80. Geburtstag des Dresdner Schriftstellers Volker Braun
mdr.de, 7.5.2019
Fakten und Vermutungen zu Volker Braun + Instagram + Linkliste +
KLG + PIA + DAS&D + Archiv 1 & 2 + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Anmerkung zum GBP
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + Dirk Skibas Autorenporträts +
Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Volker Braun – 50 Jahre Autor im Suhrkamp Verlag.


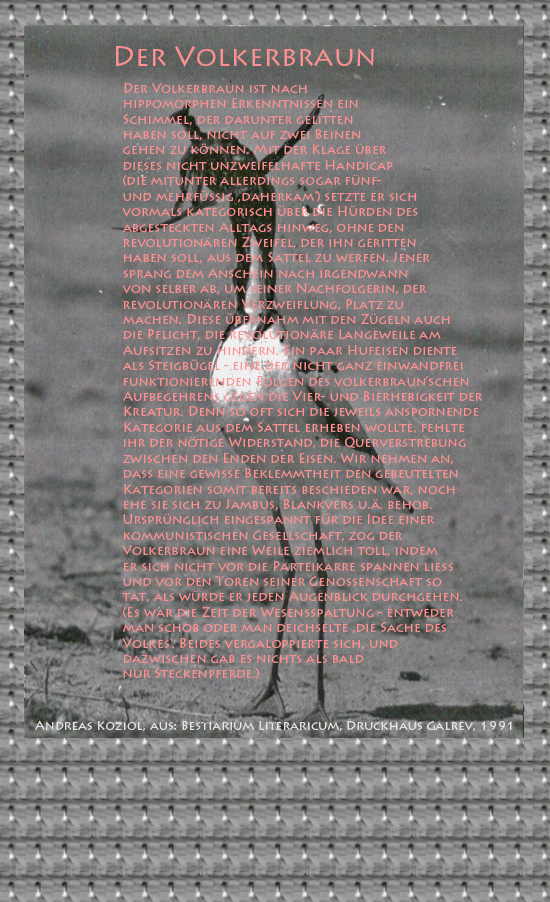
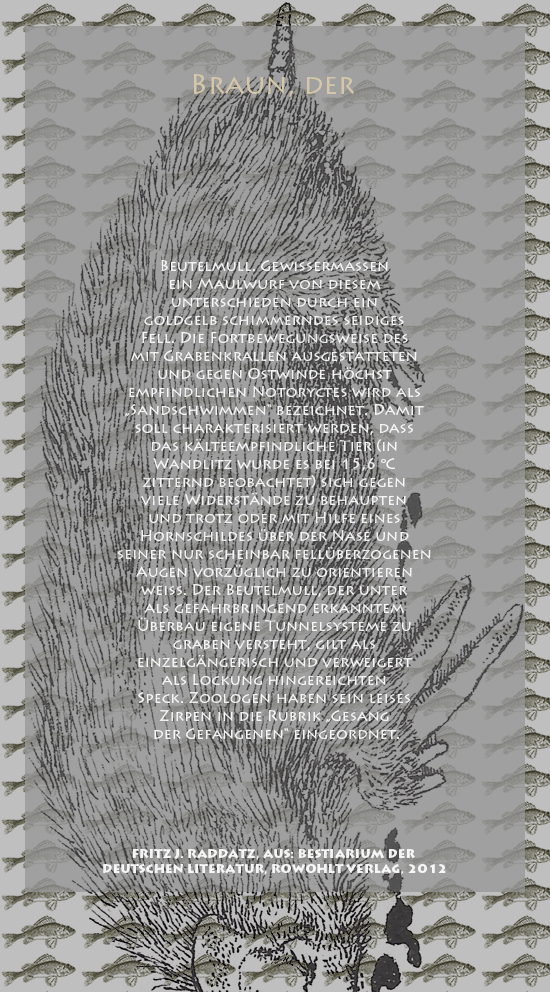
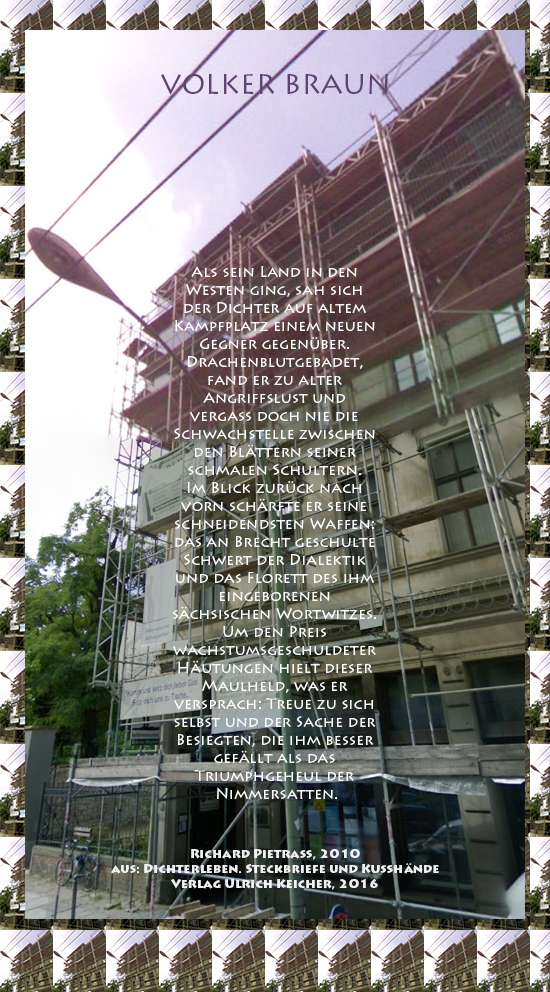

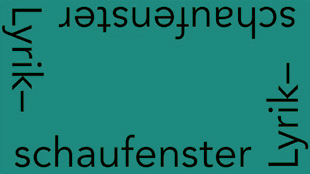
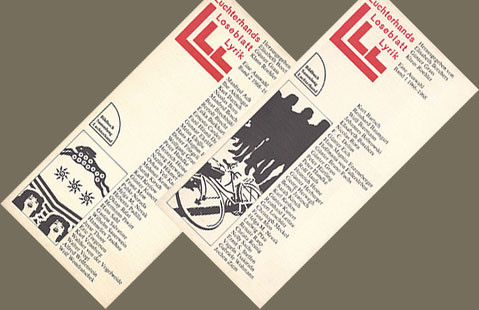



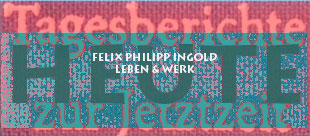
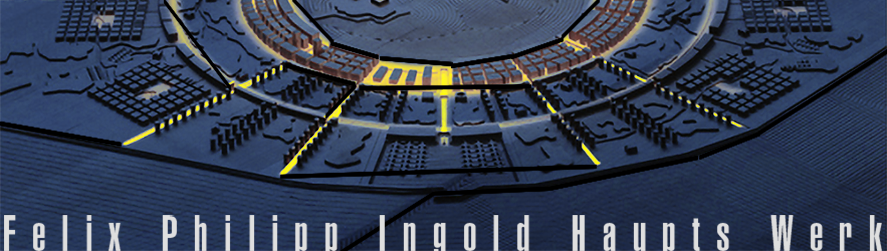
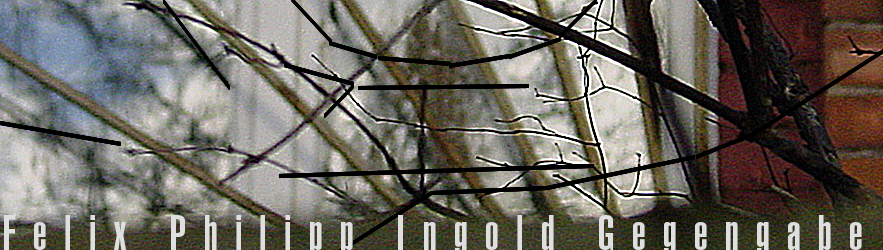
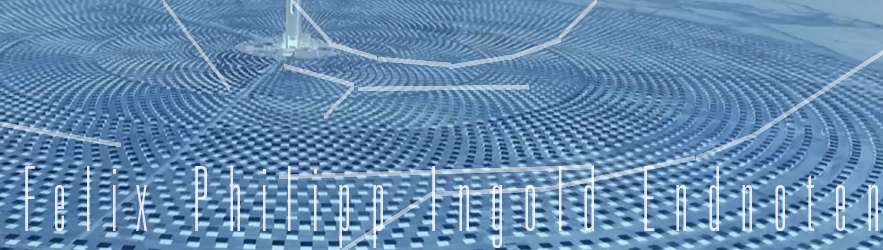

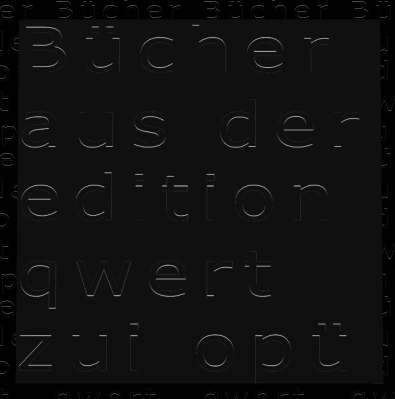
Schreibe einen Kommentar