Jan-Heiner Tück: Zu Paul Celans Gedicht „In eins“
– Zu Paul Celans Gedicht „In eins“ aus Paul Celan: Die Niemandsrose. –
PAUL CELAN
In eins
Dreizehnter Feber. Im Herzmund
erwachtes Schibboleth. Mit dir,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Schäfchen zur Linken: er, Abadias,
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden
über das Feld, im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels, er sprach
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten, es war
Hirten-Spanisch, darin,
im Eislicht des Kreuzers „Aurora“:
die Bruderhand, winkend mit der
von den wortgroßen Augen
genommenen Binde – Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt lag
auch dir toskanisch zu Herzen.
Friede den Hütten!
Eine poetische Synopse von Daten, Orten und Losungsworten
Setz deine Fahne auf Halbmast,
Erinnerung.
Auf Halbmast
für heute und immer.
Paul Celan1
Eine Geschichtsschreibung, nach der die Verlierer
immer im Recht gewesen wären.
Elias Canetti2
Das Werk Paul Celans kann – ohne es einlinig darauf festlegen zu wollen – als poetische Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit gelesen werden, die nicht vergeht. Celans Dichtung ist in allen ihren Stadien angereichert von Spuren, die das jüdische Leiden bezeugen, dessen Inkommensurabilität man sich angewöhnt hat, mit dem Begriff der Shoah zu bezeichnen. Über die anamnetische Solidarität mit den Toten hinaus kann es dem Gedicht aber auch darum gehen, Ereignisse der Vergangenheit in die Gegenwart hinüberzuretten, die ein uneingelöstes Versprechen mit sich führen oder unabgegoltene Ansprüche enthalten. Gerade in diesem Anliegen nimmt Celan einen Grundimpuls auf, der bereits in den geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins artikuliert wird. Die Nähe zu Benjamins Thesen zeigt sich paradigmatisch in dem Gedicht „In eins“, das unterschiedliche Daten, Orte und Losungsworte in einer poetischen Geschichtskomposition vereinigt und damit ein Verfahren dichterisch zur Anwendung bringt, das Benjamin in der XIV. seiner Thesen Zum Begriff der Geschichte theoretisch entfaltet.
Um Celans Gedicht „In eins“ näher zu kommen, möchte ich zunächst an den Grundimpuls der Geschichtsphilosophie Benjamins erinnern. Dann versuche ich eine Interpretation des Gedichts vorzulegen, welche die poetische Komposition von Daten der politischen Unterdrückungs- und Widerstandsgeschichte aufschlüsselt. Den Abschluss bilden Reflexionen zu den unabgegoltenen Möglichkeiten der Vergangenheit, die eine andere Geschichte hätte freisetzen können. Die Idee rettenden Eingedenkens, in der das Verlorene aufbewahrt wäre, bliebe unvollständig expliziert, wenn sie nicht auf den Horizont der memoria Dei bezogen würde.
Die Berücksichtigung der zeitgeschichtlichen Situation, in der Walter Benjamin seine Thesen zur Geschichtsphilosophie verfasste, ist für ihr Verständnis aufschlussreich:3 Als deutschjüdischer Emigrant in Paris, bedroht durch die expandierende Macht des Nationalsozialismus, als marxistisch orientierter Denker fundamental irritiert durch den Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939, konzipiert Benjamin ein Geschichtsverständnis, das sich – angeregt durch die Frage nach der Rettung der Bedrohten – über den Historischen Materialismus hinaus an theologische Kategorien verwiesen sieht. Der Begriff ,Klassenkampf‘ wird zumindest äußerlich mit der Semantik der Erlösung verbunden. Die Abfassung der Thesen fällt in das Todesjahr Benjamins, der sich auf der Flucht vor den Nazis, die im Juni 1940 Paris besetzt hatten, beim Passieren der Pyrenäengrenze in Port Bou das Leben genommen hat. Gershom Scholem schreibt:
Im Februar und März 1940 schrieb Benjamin nach seiner Entlassung aus dem Lager, in dem er wie fast alle Refugies aus Hitler-Deutschland nach Kriegsausbruch interniert war, jene Thesen Über den Begriff der Geschichte, in denen sein Erwachen aus dem Schock des Hitler-Stalin-Paktes sich vollzog.4
Diese Thesen können daher als testamentarisches Dokument und als ein wichtiges Zeugnis der jüdischen Leidensgeschichte des 20. Jahrhunderts gelesen werden.
Eine Schneise in das Dickicht der komplexen Benjamin-Rezeption zu schlagen, ist schwierig und soll hier gar nicht erst unternommen werden. Es gibt typologisch betrachtet – eine theologische, auf Spuren der jüdischen Tradition abhebende Deutungslinie, die durch Gershom Scholem repräsentiert wird; einen die ästhetisch-erkenntniskritischen Motive aufnehmenden Interpretationsstrang, der durch Theodor W. Adorno vertreten wird, sowie eine den Einfluss des Historischen Materialismus auf Benjamins Denken betonende Rezeptionslinie, die auf die Kommunistin Asja Lascis und den Schriftsteller Bertold Brecht zurückgeht.5 Hier soll lediglich das zentrale Motiv seiner Geschichtsphilosophie herausgestellt werden, das auch für Celan ausschlaggebend gewesen sein dürfte: die Konzeption des Eingedenkens und das damit verbundene Motiv der Rettung des Verlorenen.
In der Privatbibliothek des Dichters finden sich die beiden Essay-Bände Illuminationen und Angelus Novus, die Adorno 1955 im Frankfurter Suhrkamp Verlag postum herausgegeben hatte.
Benjamins Konzept rettenden Eingedenkens lässt sich am besten in Absetzung vom Historismus und der Fortschrittsideologie darstellen. Der Historismus, so wie Benjamin ihn in den Thesen V–VII beschreibt,6 ist bestimmt vom Ideal der Objektivität: nachzuzeichnen, wie es denn eigentlich gewesen ist. In diesem berühmten Wort Leopold von Rankes ist das erkenntnisleitende Interesse des positivistischen Historismus präzise ausgesprochen. Um der Objektivität der Fakten ansichtig zu werden, wird methodisch vom Standpunkt des Historikers abgesehen. Neutral soll er sich durch ein Verfahren der Einfühlung in die vergangene Epoche versenken7 und aus den angesammelten Fakten – nach dem Modell von Ursache und Wirkung – allgemeine Gesetze ableiten.8 Hinter dieser Geschichtskonzeption steht nach Stéphane Moses ein Zeitmodell, das an der Newtonschen Mechanik orientiert ist: Historische Zeit wird verstanden als „ein zugleich kontinuierliches und lineares Medium, indem die unendliche Kette von Ursachen und Wirkungen bruchlos ablaufen kann. Die genaue Übertragung des Kausalitätsprinzips auf den Ablauf der historischen Zeit führte zwangsläufig zu dem Glauben an eine mögliche Verlängerung der historischen Erkenntnis auf die Zukunft hin.“9
Das Proprium der herrschenden Fortschrittsideologie hat Benjamin in der XIII. These10 durch drei Momente gekennzeichnet: Hier werde vorausgesetzt, dass (1) mit dem technischen Fortschritt zugleich ein gesellschaftlicher Fortschritt einhergehe, der einen Humanisierungseffekt mit sich bringt; dass (2) dieser Fortschritt unabschließbar sei und der unendlichen Perfektibilität des Menschen entspreche; und dass (3) dieser Fortschritt sich unaufhaltsam und gewissermaßen selbsttätig vollziehe. Hinter allen drei Voraussetzungen stehe letztlich das Verständnis einer leeren und homogenen Zeit, an dem sich Benjamins geschichtsphilosophische Kritik entzündet.
Das erste Motiv für diese Kritik an Historismus und Fortschrittsideologie ist ideologiekritischer Natur und betrifft den Standort des Historikers. Die vorgebliche Neutralität des Historismus erweist sich faktisch als wenig neutral, wenn man die perspektivische Einschränkung beachtet, mit der das Verfahren der Einfühlung angewandt wird. Die kritische Rückfrage, in wen sich der Historiker eigentlich einfühle, legt offen, dass sich seine Geschichtsschreibung an den großen Namen und Ereignissen orientiert und an deren Würdigung interessiert ist. Damit läuft Geschichte auf die Rekonstruktion einer Siegergeschichte hinaus. Die Engführung der Geschichte auf eine Geschichte der Herrschenden aber komme den gegenwärtig Herrschenden zugute. Dieser politische Konformismus unter dem Vorzeichen vermeintlicher Neutralität hat Benjamin zu der Bemerkung veranlasst, der Historismus sei „das stärkste Narkotikum des [19.] Jahrhunderts“11 gewesen. Nicht weniger kritisch beurteilt er den Standpunkt der herrschenden Fortschrittsideologie. Ihre unerschütterliche Fortschrittsgewissheit verschleiere den Blick auf die soziale Realität und schwäche den politischen Widerstand gegen gesellschaftliches Unrecht. Die Vorstellung, dass die Entwicklung unendlich, unaufhaltsam und unumkehrbar zum Besseren voranschreitet, führe zu einer moralisch indifferenten Geschichtsbetrachtung, die unkritisch hinnimmt, was faktisch geschieht. Letztlich lässt das Grundvertrauen in eine automatische Verbesserung der Verhältnisse, für das Darwins Evolutionslehre die Analogie abgibt,12 eine moralische Beurteilung der geschichtlichen Handlungssubjekte in den Hintergrund treten. Es führt zu einer politischen Haltung passiver Ergebenheit. Demgegenüber unterstreicht Benjamin den politischen Standort des Historikers. Dem Neutralitätsideal des Historismus stellt er die Parteilichkeit des am Historischen Materialismus geschulten Geschichtsschreibers entgegen. An der Tradition der Unterdrückten orientiert, versucht diese Geschichtskonzeption, die unterdrückten Traditionen subversiv zur Geltung zu bringen.
Diese Beurteilung der Stellung des Historikers wird erst ganz verständlich, wenn ein weiteres Motiv von Benjamins Historismus- und Fortschrittskritik bedacht wird: die Frage nach dem jeweils vorausgesetzten Zeitverständnis. Beide Geschichtskonzeptionen gehen von einem Kontinuum der Zeit aus, in der das Gegenwärtige im Licht des Vergangenen und das Vergangene im Lichte des Gegenwärtigen betrachtet werden kann. Der Augenblick des Historikers ist für die historische Erkenntnis unerheblich, da die Rekonstruktion dessen, wie es gewesen ist, unabhängig ist vom Jetzt des Geschichtsschreibers. Additiv wird das Ensemble der Fakten aufgeboten, um die leere und homogene Zeit auszufüllen. Demgegenüber ist bei Benjamin die Jetztzeit des Historikers zentral. Diese Jetztzeit aktualisiert das Bild der Vergangenheit, wie es einzig in der geschichtlichen Konstellation des Historikers aufscheint. Sie ist unvereinbar mit einer Geschichtssicht, die in Gottfried Kellers Satz „Die Wahrheit wird uns nicht davonlaufen“ ihren prägnantesten Ausdruck gefunden hat. Dieser evolutiv entfristeten Zeitvorstellung stellt Benjamin den Begriff einer messianischen Stillstellung der Zeit entgegen, der Affinitäten zur jüdischen Apokalyptik aufweist. Der Begriff der Katastrophe, der im Spätwerk eine immer entscheidendere Rolle spielt, bezeichnet dabei weniger das definitive Ende des Geschichtsverlaufs als vielmehr das Katastrophische des Fortschritts selbst.13
Damit ist das dritte und wohl gravierendste Motiv der Fortschrittskritik Benjamins bezeichnet, wonach die eigentliche Katastrophe das Stattfinden eines Fortschritts ist, der von den Katastrophen, die er fortlaufend hervorbringt, absieht und sie dadurch zur Bedeutungslosigkeit herabstuft. Dieser abstrakten Zeitauffassung stellt Benjamin eine anti-evolutionistische Geschichtssicht entgegen. Sie folgt der ideologiekritischen Einsicht, dass die historistische Einfühlung in den Sieger den jeweils Herrschenden zugutekommt, und sieht es als ihre vorrangige Aufgabe an, „die Geschichte gegen den Strich zu bürsten“.14 Insofern liegt der Maßstab für die Kritik am Fortschritt letztlich in der Erinnerung an die marginalisierte Leidensgeschichte der Welt. Deshalb versucht Benjamin, einen Begriff der Geschichte zu entwickeln, der der Tradition der Unterdrückten entspricht, und gegenüber einer am Leitfaden der Sieger entwickelten Geschichtskonzeption die Perspektive der Geschlagenen und Besiegten zur Geltung bringt.
Die Herausstellung der katastrophischen Seite der Geschichte impliziert das Interesse an einer Befristung der Zeit. Die zunehmende Präsenz der Kategorien des Innehaltens, der Unterbrechung, der Stillstellung und des „Chocs“ dokumentiert, dass Benjamin einer linearen und kontinuierlichen Sicht der historischen Zeit gegenüber die Diskontinuität der Geschichte betont. Die Fokussierung des historischen Blicks auf die Brüche der Geschichte schließt zugleich die Abkehr von der historistischen Methode ein, Ereignisse in Analogie zur mechanischen Kausalität zu rekonstruieren. Stattdessen soll der Horizont unerfüllter Erwartungen in der Vergangenheit in die Gegenwart eingebracht werden – und zwar durch dialektische Bilder, in denen das Gewesene mit dem Gegenwärtigen zu einer Konstellation zusammentritt. Um dieses Verfahren zu exemplifizieren, hat Benjamin an das Selbstverständnis der Französischen Revolution erinnert:
Sie zitierte das vergangene Rom genauso, wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt.15
Und wie für Robbespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit war, so soll der Historiker die Konstellation erfassen, „in die seine eigene Epoche mit einer ganz bestimmten früheren getreten ist. Er begründet so einen Begriff der Gegenwart als der Jetztzeit, in welcher Splitter der messianischen eingesprengt sind.“16 Durch diesen posthistoristischen Umgang mit Geschichte soll das latente Potential subversiver Momente des Vergangenen reaktualisiert werden.17 Die intendierte Politisierung des historischen Standorts steht insofern konträr zum Neutralitätspostulat des Historismus.
Die Erinnerung an das Leid vergangener Generationen führt Benjamin an die Grenzen des Historischen Materialismus in seiner orthodoxen Gestalt; dieser begreift den geschichtlichen Prozess als Klassenkampf zwischen Herrschenden und Beherrschten, der letztlich der Subjektwerdung einer ganz bestimmten Klasse dient: dem Proletariat. Das erfahrene Leid derer, die um eine Verbesserung der Produktionsverhältnisse gekämpft haben, wird für die Durchsetzung des gesellschaftlichen Fortschritts in Kauf genommen. So heißt es bei Marx:
Die Revolution des 19. Jahrhunderts muss die Toten ihre Toten begraben lassen, um bei ihrem eigenen Inhalt anzukommen.18
Mit dieser Geschichtssicht, die das Geschick der Toten noch einmal bestätigt, bricht Benjamin, der nichts, was sich einmal ereignet hat, für die Geschichte verloren geben will, „bis die ganze Vergangenheit in einer historischen Apokatastasis in die Gegenwart eingebracht ist“.19
An dieser Stelle wird deutlich, warum Benjamin über den orthodoxen Marxismus hinausgeht und auf theologische Kategorien zurückgreift. Die Solidarität nach rückwärts mit den Geschlagenen der Geschichte birgt nicht nur subversives Potential, das zur Überwindung leidverursachender Strukturen eingesetzt werden könnte. Sie wirft auch die Frage auf, ob die Toten definitiv tot sind und ihr Schicksal endgültig besiegelt ist oder ob doch Hoffnung auf Rettung der Verlorenen besteht. Die Thematisierung dieser Frage motiviert den Rückgriff auf theologische Kategorien; so heißt es bei Benjamin:
Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit sich, durch den sie auf Erlösung verwiesen wird.20
Wie allerdings der Begriff der Erlösung näher zu verstehen ist, ob sein Gehalt eher im Kontext revolutionären Denkens zu explizieren wäre oder in den Bereich messianischer Hoffnung verweist, ist schwer zu klären. Immerhin gibt ein Kommentar zu einer brieflichen Äußerung Max Horkheimers21 Aufschluss über die theologische Tiefendimension der Geschichte; hier expliziert Benjamin seinen Begriff von Geschichte als „Form des Eingedenkens“:
Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie; aber im Eingedenken machen wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich atheologisch zu begreifen, so wenig wir sie in unmittelbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen.22
Eine Erinnerung, die mit den Leidenden und Toten solidarisch sein will, kann das Vergangene nicht für vergangen erklären, ohne noch einmal das historische Unrecht zu bestätigen, das den ungerecht Leidenden widerfahren ist. Das Anliegen, eine erlösungsbedürftige Vergangenheit zu retten, erfordert insofern theologische Kategorien. Die Präsenz der Kategorien Erlösung und Rettung im Denken Benjamins ist ein Indiz dafür, dass das Erbe des jüdischen Messianismus im Kontext seiner geschichtsphilosophischen Überlegungen zunehmend durchschlägt.23 Doch ist der Gebrauch theologischer Terminologie noch kein Hinweis dafür, dass es sich um genuin theologische Überlegungen handelt.24 Allerdings bliebe eine Erinnerungssolidarität mit den Toten, die nicht theologisch fundiert würde, letztlich ohne Hoffnung; sie könnte zwar von systemverändernder Wirkung sein, insofern die gefährliche Erinnerung an vergangene Unterdrückung den Einsatz für eine bessere Zukunft motivieren kann. Die beste innergeschichtliche Zukunft aber könnte das begangene Unrecht an den Opfern nicht wiedergutmachen. Brechen wir die Benjamin-Lektüre hier ab. Seine Intention, die Tradition der Unterdrückten wachzuhalten, die Geschichte um der Opfer willen gegen den Strich zu bürsten, reicht dort ins Theologische hinüber, wo das Motiv der anamnetischen Solidarität mit den Toten verknüpft wird mit der Frage nach deren Rettung. Würde die Geschichte als abgeschlossen gedacht, dann hätte der Henker über seine Opfer definitiv triumphiert. Es ist dieses verletzte Gerechtigkeitspathos, das Benjamin für theologische Fragestellungen empfindlich werden lässt, auch wenn er Denkfiguren theologischer Hoffnung nicht ausdrücklich ausbuchstabiert hat.
Paul Celans Gedicht „In eins“, das unterschiedliche Daten und Orte der Leidens- und Widerstandsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zusammenträgt,25 kann als poetisches Zeugnis gelesen werden, das die Benjaminschen Thesen fortschreibt. Das konstruktive Prinzip, das in der synoptischen Montage von Daten, Orten und unterschiedlichen Losungsworten deutlich wird, dürfte direkt inspiriert sein durch die XIV. geschichtsphilosophische These:
Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von ,Jetztzeit‘ erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die Französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das Alte Rom genau so, wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat.
Die Kritik an der Vorstellung von der Zeit als einer leeren und homogenen ist in Celans Gedicht „In eins“ aufgenommen. Es handelt sich um eine poetische Montage von Orten, Daten und Losungsworten, die – in unterschiedlichen Sprachen – an bestimmte zeitgeschichtliche und politische Vorgänge erinnern, die Unabgegoltenes enthalten, das in die Jetztzeit einzubringen ist.26 Die Überschrift legt – geradezu programmatisch – das Kompositionsprinzip offen; es geht darum, Disparates zusammenschauen, in eins zu lesen. Zunächst treten im Gedicht, als solle die babylonische Sprachverwirrung widerrufen werden, unterschiedliche Sprachen zusammen: eine idiomatische Wendung aus Österreich („Feber“) findet sich ebenso wie Hebräisch („Schibboleth“, „Abadias“), Französisch („Peuple de Paris“), Spanisch („No pasaran“), Latein („Aurora“), Griechisch („Petropolis“) und Deutsch („Friede den Hütten!“).27 Das Gedicht lautet:
IN EINS
Dreizehnter Feber. Im Herzmund
erwachtes Schibboleth. Mit dir,
Peuple
de Paris. No pasarán.
Schäfchen zur Linken: er, Abadias,
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden
über das Feld, im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels, er sprach
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten, es war
Hirten-Spanisch, darin,
im Eislicht des Kreuzers „Aurora“:
die Bruderhand, winkend mit der
von den wortgroßen Augen
genommenen Binde – Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt lag
auch dir toskanisch zu Herzen.
Friede den Hütten!
Neben Wendungen aus unterschiedlichen Sprachen, die das Gedicht aufführt, werden bestimmte Orte, Daten und Losungsworte synoptisch zusammengelesen.28 Das Gedicht nimmt gleichsam eine Kollokation vor, wenn es Städte wie „Paris“, „Huesca“ und „Petropolis“ vernetzt sowie Länder und Landschaften – „spanisch“ und „toskanisch“ – aufruft. Es entsteht so eine eigene poetische Topographie, die durch die Erinnerung an bestimmte Daten und die Rezitation bestimmter Losungsworte angereichert wird. Diese gilt es Schritt für Schritt zu entschlüsseln. Denn das Gedicht „In eins“ ist – einer Bemerkung Jacques Derridas zufolge – „offenbar verschlüsselt“.29
Das Gedicht setzt ein mit einer geradezu protokollarischen Notiz: „Dreizehnter Feber“. Dieses Datum ist unvollständig, es fehlt die Angabe der Jahreszahl. Dies macht es möglich, das Datum auf unterschiedliche erinnerungswürdige Ereignisse zu beziehen.30 Gleichwohl will die sprachliche Verkürzung der Monatsbezeichnung ,Februar‘ auf ,Feber‘ beachtet sein. Sie verweist idiomatisch nach Österreich – und könnte durch die Assonanz mit ,Fieber‘ auch den Zustand einer Erschütterung, einer Krise indizieren. Mit dem Datum des 13. Februar 1934 ist – wie der Blick auf das Gedicht „Schibboleth“31 offenlegt – der Wiener Arbeiteraufstand wachgerufen: „Flöte / Doppelflöte der Nacht: / denke der dunklen / Zwillingsröte / in Wien und Madrid“ (GW Bd. I, S. 131). Die Arbeiter revoltierten gegen die autoritäre Regierung unter Engelbert Dollfuß (1892–1934), der brutal gegen sozialdemokratisch oder marxistisch gesinnte Arbeiterverbände vorging. Im Zentrum der Stadt Wien hat man – wie der Schriftsteller Stefan Zweig in seinen Memoiren Die Welt von gestern festgehalten hat – von den Unruhen in den Randbezirken nichts mitbekommen.32
Allerdings – so zeigt eine Vorstufe des Gedichts aus dem Umkreis der „Walliser Elegie“33 – hat Celan über den Wiener Arbeiteraufstand hinaus wohl auch den 13. Februar 1962 im Blick gehabt. An diesem Tag – möglicherweise dem Entstehungstag des Gedichts – wurden in Paris die Opfer einer gewaltsamen Demonstrationsauflösung zu Grabe getragen; die Demonstration hatte sich gegen die nationalistische Organisation der Algerienfranzosen gewandt und war von der Polizei brutal niedergeschlagen worden. Das peuple de Paris hat sich mit den Opfern des Massakers solidarisiert. Hunderttausende haben den Grabeszug begleitet und den Toten die letzte Ehre gegeben.34 Idiomatisch gefärbte Wendungen begegnen bei Celan öfter, so im Gedicht „Tübingen, Jänner“35 sowie in der Meridian-Rede, in der vom 20. Jänner die Rede ist, an dem Lenz durchs Gebirg ging, an dem aber auch auf der Wannsee-Konferenz 1942 die Deportation und Vernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas beschlossen wurde. „Vielleicht darf man sagen, dass jedem Gedicht sein ,20. Jänner‘ eingeschrieben bleibt?“, notiert Celan in der Meridian-Rede, ohne es bei einem bloß rememorativen Rückbezug zu belassen:
Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns zu?36
Erinnerung hat immer auch einen Aktualitätsindex, der „Gravis des Historischen“ und der „Akut des Heutigen“ treten zu einer Konstellation zusammen, um das Bewusstsein zu schärfen, um sich des eigenen Standorts zu vergewissern, um notfalls auch Widerstand zu leisten.
Das Gedicht geht weiter:
Im Herzmund
erwachtes Schibboleth
Ein hebräisches Wort schiebt sich wie ein Fremdkörper in das deutschsprachige Gedicht. Auffällig aber ist zunächst die Ineinssetzung von Herz und Mund. Nicht jede Äußerung ist Ausdruck des Inneren, die Sprache der Lippen kann vielmehr die Sprache des Herzens unkenntlich machen und verschleiern. Einer strategischen Instrumentalisierung der Sprache entgegen scheint durch das Wort „Herzmund“ eine bruchlose Übereinstimmung zwischen innerem Empfinden und äußerer Artikulation angezielt zu sein.37 Im „Herzmund“ erwacht nun ein Pass- oder Losungswort: „Schibboleth“, mit dem Celan intertextuell auf das gleichnamige Gedicht aus dem Band Von Schwelle zu Schwelle anspielt.38 Es gibt Losungswörter, die man braucht, um eine Grenze zu passieren. Wer sie nicht kennt und dennoch die Grenze überqueren will, kann im wahrsten Sinn des Wortes auf der Strecke bleiben. Schibboleth „hat eine Vielzahl von Bedeutungen durchlaufen: Strom, Fluß, Kornähre, Ölzweige. Doch jenseits dieser Bedeutungen hat es die Bedeutung eines Losungsworts angenommen. Man gebrauchte es während des Krieges oder danach zum Passieren eines bewachten Grenzübergangs. Die Wichtigkeit dieses Wortes lag weniger in seiner Bedeutung als in der Art, wie man es aussprach.“39 Die Ephraimiter waren durch Jiftach und seine Soldaten in einer Schlacht geschlagen worden. Das Losungswort ermöglichte nun den Anhängern des Jiftach, feindliche Soldaten aus Ephraim, die an den Jordan geflohen waren, um diesen zu überqueren, zu enttarnen. Die Unfähigkeit der Ephraimiter, das Losungswort Schibboleth korrekt auszusprechen – sie sprachen das ,Sch‘ wie ein ,S‘ –, verriet sie als Feinde und kostete sie das Leben (vgl. Ri 12,6). Die regional begründete phonetische Differenz zwischen Schibboleth (Gilead) und Sibboleth (Ephraim) wird so zum Passwort, das über Leben und Tod entscheidet.40
„Mit dir, / Peuple / de Paris.“ – „Mit dir“ ist eine Solidarisierungsgeste. Sie gilt dem Volk, und nicht – wie man vielleicht ergänzen darf – denen, die das Volk regieren oder auf Kosten des Volkes leben. Sie gilt darüber hinaus konkret dem Volk von Paris. „Peuple de Paris“ ist eine historisch aufgeladene Parole. Mit ihr waren die an die Bevölkerung adressierten Aufrufe während der Pariser Kommune 1871 überschrieben. Der Aufstand der Arbeiter und Kleinbürger hatte sich gegen die gemäßigte Nationalversammlung unter Adolphe Thiers gerichtet. Diese war nach der auszehrenden Belagerung von Paris durch das Heer des norddeutschen Bundes mit seinen Verbündeten als Folge der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen bereit gewesen, den von Bismarck diktierten Friedensvertrag zu akzeptieren, obwohl dieser neben hohen Reparationszahlungen auch die Abtretung von Elsass-Lothringen an das Deutsche Reich vorsah. Zudem hatte die republikanische Regierung unter Thiers einige unpopuläre Maßnahmen getroffen, welche die Lebensbedingungen der einfachen Pariser Bevölkerung weiter verschlechterten.41 Allerdings dekomponiert Celan die Parole ,Peuple / de Paris‘ durch das Verfahren des Zeilenbruchs, als solle das Scheitern der Kommune in die Sprachgestalt des Gedichts eingeschrieben werden. Mit Genehmigung der deutschen Besatzungsmacht eroberten nämlich schon bald die Regierungstruppen Thiers nach blutigen Kämpfen die Stadt zurück. Die Solidarität gilt dem Volk überhaupt, dann erst näher dem Volk von Paris, wobei hier nicht vergessen werden darf, dass Paris die Stadt ist, in welcher der deutsch schreibende, der Bukowina entstammende jüdische Dichter Paul Celan – wie im selbst gewählten Exil – gelebt, gearbeitet und geschrieben hat, vergleichbar (und doch unvergleichbar) der Situation Heinrich Heines und Walter Benjamins.
Das Gedicht zitiert nach der französischen sogleich eine weitere Parole, die ausdrücklich als Zitat42 gekennzeichnet ist: No pasarán – „Sie werden nicht durchkommen.“43 Es ist der Schlachtruf der internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg (1936–1939). Die franquistische Falange, die durch Hitlers Legion Condor, aber auch durch das faschistische Italien Mussolinis militärisch unterstützt wurde, sollte zurückgedrängt und vor allem am Einmarsch in die Hauptstadt Madrid, dem Sitz der republikanischen Regierung, gehindert werden. Der antifaschistische Kampf der Internationalen Brigaden, dem sich viele Intellektuelle und Schriftsteller aus aller Welt44 freiwillig angeschlossen hatten, endete im März 1939 bekanntlich mit einer Niederlage, die zur endgültigen Etablierung der Franco-Diktatur führte. Nachdem er Madrid eingenommen hatte, setzte Franco dem Schlachtruf der Republikaner nicht ohne triumphalen Unterton das Wort entgegen: Hemos pasado, zu deutsch:
Wir sind durchgekommen.
Die antifaschistische Parole No pasarán ist am 18. Juli 1936 durch die Kommunistenführerin Dolores Ibárruri (1895–1989) in einer flammenden Rede geprägt worden.45 Ibárruri, die aus einem baskischen Bergarbeiterdorf stammte und Mutter von sechs Kindern war, ist unter dem Pseudonym La Pasionaria (dt.: Passionsblume) zu einer Ikone des kommunistischen Widerstandes geworden. Im August 1936 versuchte sie bei einer öffentlichen Rede in Paris, die Nichteinmischungspolitik der Franzosen zu ändern und deren Unterstützung gegen Franco zu gewinnen. Bei dieser Gelegenheit prägte sie den Slogan:
Lieber aufrecht sterben als auf Knien leben!
Celan zitiert den antifaschistischen Kampfruf No pasarán bereits in seinem Gedicht „Schibboleth“, das ebenfalls den Wiener Arbeiteraufstand und den Spanischen Bürgerkrieg als schattenhafte Präfigurationen des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung ruft:
Ruf’s, das Schibboleth, hinaus
in die Fremde der Heimat:
Februar. No pasarán (GW Bd. I, S. 131).46
Die Geschichte würde nur unvollständig wahrgenommen, wenn nicht auch ihre Folgen in konkreten biographischen Schicksalen gesehen würden. Das Gedicht schaut darum die historischen Daten zusammen mit der biographischen Prägung, die diese in einem konkreten Schicksal hinterlassen haben. Die allgemeine Perspektive wird mit der allerpersönlichsten in eins gesetzt. Das zeigt die zweite Strophe:
Schäfchen zur Linken: er, Abadias,
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden
über das Feld, im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels, er sprach
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten, es war
Hirten-Spanisch, darin,
Zunächst ist von „Schäfchen zur Linken“ die Rede. Man könnte mutmaßen, dass es wichtig ist, dass diese sich nicht „zur Rechten“ befinden. Man könnte das so lesen, dass gerade im Blick auf die poetisch wachgerufenen, historischen Daten des Wiener Arbeiteraufstands und des Spanischen Bürgerkriegs eine politische Semantik anvisiert ist, die eine Absage an rechte Ideologien anzeigt. Gleichzeitig ist es aber auch – wie Gisèle Celan-Lestrange mitgeteilt hat – eine private Idiosynkrasie des Dichters gewesen, Schafherden auf die richtige Weise zu passieren, was für ihn stets bedeutete, nur dann vorbeizugehen, wenn diese sich zur Linken befanden. Man kann sich durch die räumliche Opposition – zur Linken oder zur Rechten – schließlich an die berühmte Gerichtsparabel im Matthäus-Evangelium erinnert fühlen, in der der Menschensohn die Schafe von den Böcken scheidet, wobei erstere auf der rechten und letztere auf der linken Seite versammelt werden (vgl. Mt 25,31–46). Die eschatologische Topographie des Evangeliums würde im Gedicht durch die Rede von den „Schäfchen zur Linken“ dann geradezu umgekehrt – und man könnte fragen, was diese poetische Inversion bedeutet, wenn das Gedicht selbst Anlass gäbe, diese Fragerichtung weiter zu verfolgen.
Stattdessen fährt es fort: „Er, Abadias“. Ein Name wird genannt, in dem sich ein Schicksal verdichtet. „Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Lied! / Das namensgeschmückte Lied / lebt länger inmitten der andern“ – heißt es in Celans Übertragung von Ossip Mandelstams Gedicht „Der Hufeisen-Finder“.47 Der Name ist – vom biblisch-hebräischen Ursprung her – nie rein zufällig, er bringt das Wesen seines Trägers verdichtet zum Ausdruck. Wenn man den Namen „Abadias“ aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzen will – doch vielleicht wirft man beim Passieren der Sprachgrenze ebenfalls semantisches Gepäck ab –, dann ist Abadias der „Knecht Gottes“. Der Name spielt auf den Propheten Obadja an, der das Gericht über Edom ankündigt, weil dieser sich an Jakob vergangen hat. Die Gerichtsansage macht deutlich, dass die Feinde Israels am Ende nicht triumphieren, sondern zur Rechenschaft gezogen werden. Neben dem Motiv der noch unabgegoltenen Gerechtigkeit, das durch den Propheten Obadja zur Geltung gebracht wird, könnte der Name Abadias nicht minder als Reminiszenz an Adalbert Stifters Erzählung „Abdias“ gelesen werden, in der Segen und Fluch eines jüdischen Schicksals so festgehalten werden, dass letzte Fragen sich unabweisbar aufdrängen.48 Aber es ist – wie es nun im Gedicht weiter heißt – ein „Greis aus Huesca“, ein Hirte, der „mit den Hunden / über das Feld“ kommt. Wiederum durch eine private Information ist inzwischen bekannt, dass Abadias „ein alter, ehemals spanischer Revolutionär“ war, der gegen die Franquisten gekämpft hatte und später im französischen Exil lebte.
Als Hirte, der in der Nähe ihres Ferienhauses in der Normandie seine Herde hütete, war er mit der Familie Celans persönlich bekannt.49
Der Name des Ortes – Huesca – gibt die Herkunft des Abadias an, seine verloren gegangene Heimat, eine nordspanische Stadt im Ebrobecken, um die 1936 im spanischen Bürgerkrieg eine entscheidende Schlacht geschlagen wurde.
Im Exil
stand weiß eine Wolke
menschlichen Adels.
Diese Wendung kann auf den Greis aus Huesca bezogen werden. Sie lässt zugleich an den Auszug des Volkes Israels aus dem Sklavenhaus Ägypten denken, das bei Tag von einer Wolke, bei Nacht von einer Feuersäule geführt wurde (vgl. Ex 13,21f.). Abadias, der „Knecht Gottes“, würde bei aller Heimatlosigkeit etwas von der Orientierung verkörpern, die im Zeichen der Wolke ansichtig wird. Allerdings ist es der „menschliche Adel“, auf den besonders abgehoben wird – eine Humanität, die sich im Widerstand gegen das Unmenschliche des Franko-Regimes bewährt hat.
Die „Wolke / menschlichen Adels“ lässt darüber hinaus an andere Fügungen in Celans Niemandsrose denken, die an die Vernichtung der Juden, an ihre in den Krematorien verbrannten Leiber erinnern: „Alle die Namen, alle die mit- / verbrannten / Namen. Soviel / zu segnende Asche. Soviel […]“ – heißt es in dem Gedicht „Chymisch“ (GW Bd. I, S. 227); oder: „die Schwebenden, die / Menschen-und-Juden, / das Volk-vom-Gewölk“ – in „Hüttenfenster“ (GW Bd. I, S. 278); oder: „Die / Geschlechterkette, / die hier bestattet liegt und / die hier noch hängt, im Äther, / Abgründe säumend“ in „Les Globes“ (GW Bd. I, S. 274); oder: „(All das / Gewölk um sie her – es war lesbar.) […] am Anhalter / Bahnhof / floß deinen Blicken ein Rauch zu, / der war schon von morgen“ in La „Contrescarpe“ (GW Bd. I, S. 283). Es gibt eine Deutungsrichtung, die Celans Gedichte als poetische Kenotaphe zu lesen empfiehlt, als schriftgewordene Orte, an denen der unbestattet gebliebenen Toten gedacht wird: „Der hier liegen sollte, liegt / nirgends“ – heißt es lakonisch in dem Gedicht „Kenotaph“ (GW Bd. I, S. 134).50
Der Greis aus Huesca aber „sprach uns das Wort in die Hand, das wir brauchten“.51 Anders als die unpersönlichen Parolen, die das Gedicht aus unterschiedlichen historischen Konfliktzusammenhängen zu einer poetischen Collage vereinigt, handelt es sich hier offenbar um ein von Person zu Person gesprochenes Wort, das Atem und Schicksal mit sich führt, ein Wort, das in die Hand gesprochen wird, die als Organ der Schrift die Feder führt: „es war Hirten-Spanisch darin“ – die Herkunft des Exilierten wird nicht vergessen oder verleugnet, vielmehr wird sie im Wort mitgegeben, es ist ein schicksalbeschwertes, von historischen Erfahrungen angereichertes Wort. Der es spricht, ist ein Vertriebener; was er spricht oder gesprochen hat, bleibt gleichwohl ungesagt – und dieses Verschweigen des Wortes (des Losungswortes?) gibt dem Gedicht eine enigmatische Aura.
Das Gedicht kommt nach dieser eher persönlich gefärbten Strophe zurück auf die makrohistorische Ebene, wenn es in der dritten Strophe fortfährt:
im Eislicht des Kreuzers „Aurora“:
die Bruderhand, winkend mit der
von den wortgroßen Augen
genommenen Binde – Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt lag
auch dir toskanisch zu Herzen.
Mit dem Kreuzer Aurora wird abrupt eine weitere revolutionäre Situation in Erinnerung gerufen, nämlich die Schüsse, die am Abend des 7. November 1917 vom Kreuzer Aurora auf das kaiserliche Palais in Petersburg abgefeuert wurden und die russische Oktoberrevolution eröffneten. Der Name des Schiffes Aurora (dt.: Morgendämmerung) trägt die Verheißung in sich, die mit dem Umsturz des zaristischen Regimes zunächst verbunden war. „Alle Macht den Sowjets!“, lautete seinerzeit die bolschewistische Parole. „Heda! Wer da? Losungswort // Fahnenschwenken, rot – ein Zeichen?“, heißt es in Alexander Blocks „Die Zwölf“, die man das De profundis der Oktoberrevolution genannt hat.52 Was Lenin, Stalin und ihre Diadochen in der Sowjetunion aus dieser Macht faktisch gemacht haben, ist Celan nicht verborgen geblieben. Bei aller Sympathie für den Sozialismus hat er sich früh und entschieden von den Verdrängungs- und Vertuschungspraktiken jener politischen Linken distanziert, die die Gewalt der Sowjet-Diktatur verharmlosten. Über den „Tod des Schnauzbarts“53 [sc. Stalins] hat er sich ausdrücklich gefreut. Schon die Treue zu Ossip Mandelstam gebot dies, der 1934 von Stalins Schergen inhaftiert wurde und Ende 1938 in einem sibirischen Arbeitslager den Tod fand.54
„Die Bruderhand, winkend mit der / von den wortgroßen Augen / genommenen Binde“ – In diesem Vers werden das Kriegsschiff Aurora und der Panzerkreuzer Potemkin zusammengeführt. Denn Celan erinnert – anders als Lion Feuchtwanger, der in seiner Erzählung Panzerkreuzer Potemkin die ungeheure Wirkung des gleichnamigen Films von Sergej Eisenstein im Berlin der 1920er Jahre festgehalten hat55 – durch die Rede von der Binde, die von den Augen genommen wird, konkret an eine Szene auf dem Achterdeck des Panzerkreuzers. Hier spielt – kaum zufällig – ein Losungswort die entscheidende Rolle.56 Nachdem die Matrosen sich in der ersten Szene geweigert haben, faules, von weißen Maden durchsetztes Fleisch zu essen, werden sie in der zweiten auf dem Achterdeck der Potemkin zusammengerufen und vom Kapitän scharf ins Visier genommen: Wem die Fleischsuppe schmecke, der solle zwei Schritte vortreten. Alle Matrosen bleiben wie versteinert stehen. Der Kapitän gerät in Rage und droht, alle erschießen zu lassen. Da wird unter den Matrosen die Parole in Umlauf gebracht: Zum Turm! Alle – bis auf ein paar Unentschlossene – begeben sich zum Geschützturm auf der Mitte des Decks. Das Häuflein der Zurückgebliebenen aber wird vom Kapitän, der ein abschreckendes Exempel statuieren will, zur Exekution bestimmt. Er befiehlt eine Zeltplane herbeizutragen, die Meuterer damit zu bedecken und umgehend zu liquidieren.57 In dem Moment, wo die Spannung ihren Höhenpunkt erreicht und das Kommando „Feuer!“ erschallt, brüllt ein Matrose dazwischen: „Brüder! Auf wen schießt ihr?!“ – und ein Gewehr nach dem anderen sinkt – weitere Erschießungsbefehle des Kapitäns verpuffen im Wind, und der tumultuarische Aufstand der Matrosen gegen die Offiziere beginnt, der von Eisenstein als revolutionärer Akt (1905) vor der eigentlichen Revolution (1917) dargestellt wird. Nachdem ein erschossener Matrose von den Einwohnern Odessas mit großer Anteilnahme zu Grabe getragen wird, findet sich im Drehbuch zum vierten Akt die summarische Angabe:
In jenen denkwürdigen Tagen lebte die Stadt ein gemeinsames Leben mit dem aufständischen Panzerkreuzer.58
Der Triumph des Panzerkreuzers Potemkin ist nicht von langer Dauer gewesen – und es dürfte kein Zufall sein, dass das Gedicht eine subversive Wende memoriert, die dann doch am Widerstand des Althergebrachten scheitert.
Petropolis, der
Unvergessenen Wanderstadt
Lag auch dir toskanisch zu Herzen.
Auffällig ist hier zunächst der Name. Das Gedicht spricht weder von „St. Petersburg“ noch von „Petrograd“ oder „Leningrad“, sondern wählt die klassizistische Form „Petropolis“, auf die – nach einem Hinweis von Thomas Sparr – vornehmlich Dichter des Akmeismus zurückgegriffen haben. Auch Ossip Mandelstam, dessen Andenken der Gedichtband Die Niemandsrose gewidmet ist, hat sie verwendet.59 Von Mandelstam stammt der Vers:
PETROPOLIS, DIAPHAN: hier gehen wir zugrunde.60
Es gibt darüber hinaus eine fragmentarische, aber aufschlussreiche Notiz, die sich in einem nachgelassenen Konvolut mit verschiedenen Entwürfen zur Niemandsrose findet:
Ossip Mandelstam
demjenigen, der mit dem russischen Wort toska in Sibirien toskanische Verse [schrieb]61
Celan spielt damit an auf ein Gedicht, in dem das russische Wort für Sehnsucht mit der Toskana in eins gesetzt wird:
Und helle Sehnsucht (russ.: toska) geht mir nicht mehr aus dem Sinn
Von den noch jungen Woronescher Hügeln
Zu den toskanischen, die Habe aller Menschen sind.62
Das Gedicht endet mit einer Parole, die – nach einem kurzen Vorbericht – Georg Büchners Pamphlet Der Hessische Landbote eröffnet:
Friede den Hütten!
Die andere Hälfte des berühmten Schlachtrufs „Krieg den Palästen“ wird bei Celan weggelassen. Büchner, der in seiner Flugschrift mit agitatorischer Zugkraft die sozialen Missstände der 1830er Jahre im Großherzogtum Hessen anprangert und dazu nicht nur auf eine amtliche Steuer-Statistik zurückgreift, sondern zugleich eine herrschaftskritische Bibelhermeneutik betreibt,63 rekurriert auf einen in der Französischen Revolution häufig gebrauchten Ruf, den der französische Schriftsteller Nicolas Chamfort (1741–1794) den Soldaten der Revolutionsheere als Wahlspruch vorgeschlagen haben soll:
Guerre aux châteaux! Paix aux chaumières!64
Nach dem Durchgang durch die offenbar verschlüsselten Stellen des Gedichts „In eins“ seien einige Beobachtungen festgehalten. Das Kompositionsprinzip des Gedichts besteht darin, unterschiedliche Daten wie die Pariser Kommune 1871, den Wiener Arbeiteraufstand 1934, den spanischen Bürgerkrieg 1936–39, die Wannsee-Konferenz 1942, den Aufstand des Panzerkreuzers Potemkin 1905, die Oktoberrevolution 1917 in Erinnerung zu rufen. Das Gedicht tut dies so, dass signifikante Losungsworte in die poetische Diktion eingeflochten werden – Losungsworte, die politische Zugehörigkeiten definieren und im Ernstfall – Schibboleth – über Leben und Tod entscheiden. Die Vorgänge, die erinnert werden, sind nicht beliebige, sondern historisch bestimmte Vorgänge, in denen es um die revolutionäre Überwindung von ungerechten Herrschaftsverhältnissen oder die Abwehr rechter Ideologien geht. Der Einsatz für humanere Verhältnisse aber ist faktisch immer wieder zum Scheitern verurteilt, sei es, dass Aufstände blutig niedergeschlagen werden, sei es, dass die humanen Anliegen im Fortgang der Geschichte korrumpiert und wie im Fall der Oktoberrevolution im real existierenden Kommunismus durch eine kleine Elite von Parteifunktionären verraten werden. Das Gedicht „In eins“ reiht allerdings die Daten nicht nur additiv aneinander, es fügt auch nicht nach Art einer Collage zufällig ausgewählte, heterogene historische Ereignisse zusammen. Es entwirft vielmehr eine historische Topographie, der es zugleich um die Aktualisierung von unabgegoltenen Ansprüchen, von abgeschnittenen Lebensmöglichkeiten, von vernichteten Hoffnungen geht. Man kann die Faktizität der Geschichte nicht widerrufen, auch ein Gedicht kann dies nicht. Man kann sich aber die verlorengegangenen Möglichkeiten aus der Perspektive eines historischen Irrealis klar zu machen versuchen: was wäre gewesen, wenn der Wiener Arbeiteraufstand das austrofaschistische Regime in die Knie gezwungen hätte, wenn Frankreich und England nicht dem Prinzip der Nichteinmischung gefolgt wären, sondern der bedrängten republikanischen Regierung militärisch unter die Arme gegriffen hätten, wenn die Internationalen Brigaden gegen die franquistische Phalanx gesiegt und damit den aufkeimenden Faschismus im Keim erstickt hätten – wäre dann möglicherweise auch das Widerstandspotential gegen das Dritte Reich größer gewesen? Was wäre geschehen, wenn die Sowjetunion sich einem Sozialismus mit humanem Antlitz verschrieben hätte – anstatt – wie Stalin – zu machtpolitischen Allianzen mit Hitler bereit zu sein? Hätte dann möglicherweise auch die Judenvernichtungspolitik Hitlers von Anfang an wirksam bekämpft werden können? Das Gedicht stellt diese Fragen nicht ausdrücklich, aber die Komposition der Daten und Losungsworte gibt Anlass, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten und der verloren gegangenen Möglichkeiten zu gedenken.
Jan-Heiner Tück, aus Jan-Heiner Tück: Gelobt seist du, Niemand. Paul Celans Dichtung – eine theologische Provokation, Herder Verlag, 2020



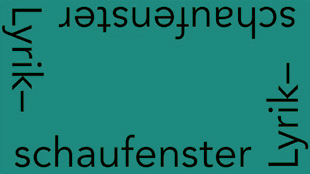
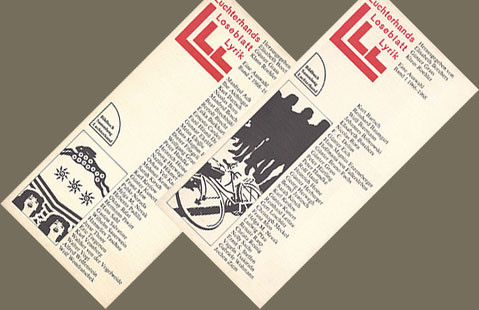



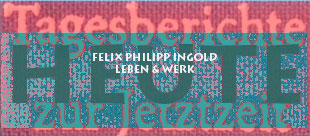
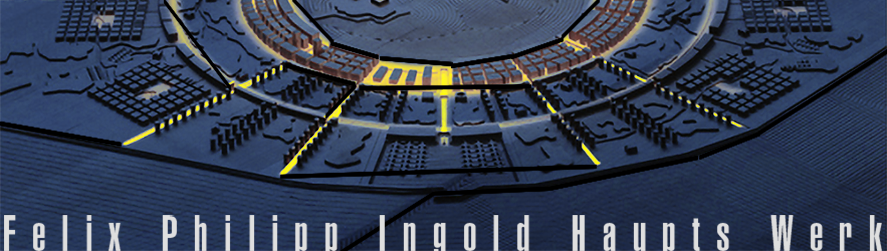
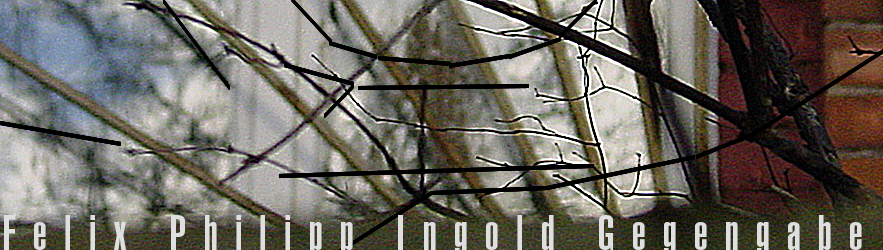
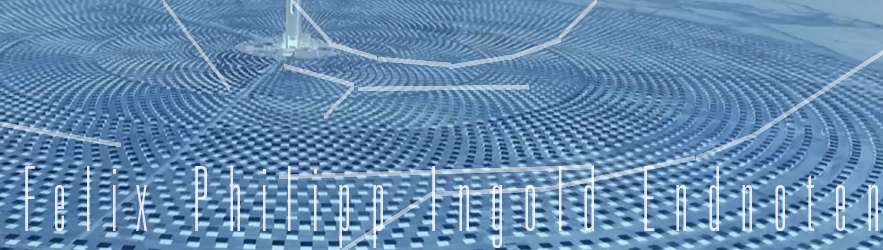

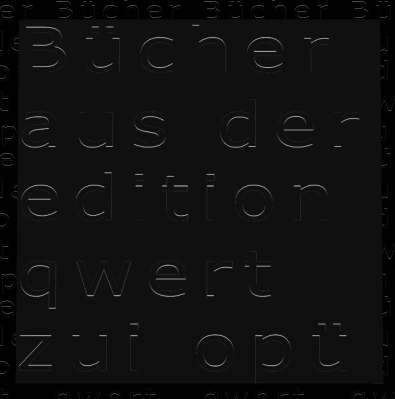
Schreibe einen Kommentar