Jan Wagner: Guerickes Sperling
STÖRTEBEKER
„Ich bin der neunte, ein schlechter Platz.
Aber noch läuft er.“
– Günter Eich –
noch läuft er, sieht der kopf dem körper zu
bei seinem vorwärtstaumel. aber wo
ist er, er selbst? in diesen letzten blicken
vom korb her oder in den blinden schritten?
ich bin der neunte und es ist oktober;
die kälte und das hanfseil schneiden tiefer
ins fleisch. wir knien, aufgereiht, in tupfern
von weiß die wolken über uns, als rupfe
man federvieh dort oben – wie vor festen
die frauen. vater, der mit bleichen fäusten
den stiel umfaßt hielt, und das blanke beil,
das zwinkerte im licht. das huhn derweil
lief blutig, flatternd, seinen weg zu finden
zwischen zwei welten, vorbei an uns johlenden kindern.
Er übersetzt uns die Welt.
Wie schon in seinem preisgekrönten Debüt Probebohrung im Himmel schickt Jan Wagner den Leser mit seinen neuen Gedichten auf eine Expedition der Wahrnehmung. Oft auf Reisen, ob im Ausland oder in der deutschen Provinz, überall findet er Geschichten und Geheimnisse des Alltäglichen. Kein Detail ist belanglos, kein Thema zu groß. Wie nebenbei, etwa durch eine unerwartete Wendung im letzten Vers, klingen in den präzisen Miniaturen umfassendere Fragen an. Mit der gelassenen Weitsicht eines Wanderers spannt Wagner den Bogen zwischen mythologischen Urszenen und trivialen Requisiten der Gegenwart. Dabei schließen seine subjektiven Entdeckungen den Leser nie aus, und er bleibt, mit augenzwinkernder Selbstironie, vor allem eins: ein Geschichtenerzähler.
Der Duft eines Weihnachtsbratens, der Name eines Stadtviertels – Neukölln –, ein einsamer Koffer am Flughafen – alles weckt hier Erinnerungen und Assoziationen. In dem Gedicht „guerickes sperling“ gerät ein vermeintlich kühles, wissenschaftliches Experiment unvermittelt zur poetischen Apotheose, und die dezente Kraft einer Berührung vermag in Dolmen im wahrsten Sinne Berge zu versetzen: „als sie mich, wortlos, wie von ungefähr / am arm berührte. jener augenblick, / in dem die stütze fiel, der monolith / zu schweben begann.“
Berlin Verlag, Klappentext, 2004
In Georges Garten
– Der Lyriker Jan Wagner flirtet mit dem Ästhetizismus. –
Was ist das für eine erstarrte Kunstwelt, in die uns Jan Wagner in seinem neuen Buch Guerickes Sperling locken will? Man kann den Eindruck gewinnen, hier huldige ein junger Lyriker einer ornamentalen, durch keine profane Realität erschütterbaren Idyllik. Der „Botanische Garten“, den das lyrische Ich durchquert, ist ein längst vermessenes Gelände, die Ähnlichkeit zu dem „totgesagten park“ Stefan Georges frappierend.
Der Kostbarkeitskult und die Exklusivitäts-Metaphorik der Fin-de-siècle-Poesie werden jedenfalls in diesem Gedicht geradezu ostentativ aufgerufen. Ein Vers wie „das licht aristokratisch fahl wie wachs“ bekräftigt die Künstlichkeit der Szenerie. Wagner neigt häufig zu solch erlesenen Bildern von eher dekorativem Wert. Naturphänomene werden in künstlerisch oder kunsthandwerklich vorgeprägte Objekte verwandelt. Gänse schwimmen hier „friedlich“ in Seen „aus weißem porzellan“, die Ansammlungen von Fischlaich erscheinen als „die winzigen perlen eines geplatzten kolliers“.
„Alles liegt nah und findet seinen maßstab / im auge des betrachters“: Diese schöne Maxime interpretiert Wagner mitunter so, als wolle er dem zufällig gefundenen Detail durch exquisite Metaphern eine besondere Leuchtkraft verleihen. Die Melancholie, heißt es einmal von Spaziergängern, „ist tief / in ihnen verstaut wie altes tafelsilber“. Hat hier jemand in den Truhen des 19. Jahrhunderts gewühlt?
Bei aller Koketterie mit dem Repertoire des Ästhetizismus zeigt sich Jan Wagner in seinem zweiten Gedichtbuch als formbewusster Autor. Wie schon in seinem Erstling Probebohrung im Himmel reaktiviert er entlegene Gedichtformen wie die Sestine, den Sonettenkranz oder das Haiku. Zu den intensivsten Texten gehören freilich nicht diese Demonstrationen von Formdisziplin, sondern die doppelbödigen historischen Urszenen, in die Wagner seine Helden verwickelt: etwa den Erfinder der Vakuumpumpe Otto von Guericke oder den Revolutionär Saint-Just. Die Balance von Schönheit und Schrecken gelingt im Gedicht „Störtebeker“, das einen Zweizeiler von Günter Eich fortschreibt. An den in einer Reihe aufgestellten Gefährten des berühmten Freibeuters taumelt hier der Körper des soeben Enthaupteten vorbei. Es bleibt offen, wann und ob der Körper fällt. Das Entzünden dieses Schicksalsaugenblicks ist Poesie.
Michael Braun, Der Tagesspiegel, 24.3.2004
Das Blatt, die Welt und ich
Auch der strenge Pauker Gottfried Benn machte Ausnahmen. In seinem Vortrag über Probleme der Lyrik von 1951, zu dessen reinigendem Fegefeuer immer noch alle angehenden Dichter verurteilt sein sollten, schlug er Gebote in eherne Tafeln und versah sie gleich mit Öffnungsklauseln: 1. Keine Andichtung unbelebter Gegenstände! Ausnahme: Eichendorff. 2. Keine Wie-Vergleiche! Ausnahme: Rilke. 3. Keine Farben! Ausnahme: Blau. 4. Keine Esoterik! Ausnahme: auf realistischer Basis. Heute, nachdem die Literatur das postmoderne Einkaufsparadies und die Ironiehölle durchschritten hat, gilt 5.: Keine ernstgemeinte Verwendung klassischer Formen! Ausnahme: der späte Heiner Müller – dem konnte man nichts mehr übelnehmen. Aber wenn in den letzten Jahren das Antike auch wieder in Mode kam, dann wirkte das mitunter wie ein von den Gästen allzu ernst genommenes Kostümfest, eine Toga-Fete im Musenaltershain.
Und nun ein Lyriker wie Jan Wagner, Jahrgang 1971, dessen zweiter Band noch deutlicher als sein Debüt vor drei Jahren wie ein Musterbuch der Verskunst daherkommt. Lyrische Spielformen wie die Villanelle oder die Sestine, deren Prinzip zu erklären hier schon zuviel Platz wegnehmen würde, finden sich hier ebenso wie Sonette (nach italienischer Manier!), Vierzeiler und Couplets; selbst ein Zyklus von Haikus ist dabei. Die Krönung dieser beeindruckenden Handwerksmesse ist ein mit allen Schikanen ausgestatteter Sonettenkranz über – Görlitz:
die feuchte krötenhaut der kopfsteingassen
sprang durch die sohlen an die eigene haut
hoch über den plakaten, wo die haute
couture zu frieren anfing, zu verblassen,
spann sich das weite netz der regenrinnen
Der unreine Reim haut/haute ist dabei keine Panne, die einem Virtuosen auch niemals aus Nachlässigkeit unterlaufen würde, kein Fleck in einem ansonsten makellosen Gemälde. Wagner ist ein Meister des Unreinen, der winzigen Abweichung. Schönheit verdankt sich auch dem Nebeneinander von Worten und Dingen, die sich beißen. Gleich im ersten, Georges und Rilkes Parks beschwörenden Gedicht „Botanischer Garten“ müssen „fin de siècle“ und “walskelette” gezwungenermaßen im Takt spazieren. „Totgesagt und nicht gestorben / geistern wir durch neue Formen“, hat das Jochen Distelmeyer ähnlich schief gereimt auf den Punkt gebracht.
Seine Themen findet Wagner, nicht anders als ein Rilke, auf Reisen, gern auch in Italien, aber auch auf Coney Island oder in Neukölln. Neben solchen eher konventionellen Stimmungsbildern, in denen „die stumme sprache der dinge“ hörbar gemacht werden soll und in denen Wagner nicht immer das erste Gebot Benns einhält, gelingen ihm aber auch stupende Brechungen der Idylle. Etwa in seiner „kleinstadtelegie“:
die schattenkarawane, jeden morgen
ihr aufbruch, und die waschanlage,
die stets aus einem reinen schlaf erwachte
und in den lieferwagen pendelten
die schweinehälften zwischen ja und nein,
den linden wuchsen herzen. und es paßte
nicht mehr als ein blatt papier zwischen mich und die welt.
und in den gärten, hinter allen hecken
verkündeten die rasenmäher den mai.
Erst hier in der Alltäglichkeit des Jahreszeitengedichts, nicht im exotischen Stoff erweist sich die Tragfähigkeit dieser poetischen short cuts. Allerdings schließt Wagners Empirie auch das Historische ein. Das Titelgedicht bezieht sich auf ein berühmtes Experiment des Magdeburger Naturforschers Otto von Guericke, der zum Beweis des Vakuums einen Sperling ersticken ließ, in der „luft, die immer enger wird“. Ganz konkret wird hier das Medium zum Material. In einer Hütte, im Winterurlaub, verfestigt sich der Abstand zwischen Ich und Du zur Naturgewalt:
von deinen lippen aber
fuhr eine lawine durch den raum.
Wagner, im vergangenen Jahr gemeinsam mit Björn Kuhligk Herausgeber der wichtigen, aber ästhetisch-programmatisch zu unentschiedenen Anthologie Lyrik von jetzt (F.A.Z. vom 19. Juli 2003), ist wohl der reifeste Vertreter einer Richtung junger Poesie, die den überkommenen Formenkanon als Herausforderung annimmt; Nikolai Kobus oder Alexander Nitzberg könnte man noch nennen. Das ist ein schmaler Grat: Auf der einen Seite klafft die Gefahr einer im Leerlauf surrenden Artistik, auf der anderen Seite die einer bloß oberflächlichen Gängelung herkömmlicher Stimmungs- und Gedankenlyrik am Band der Tradition – ohne daß der Rückgriff aus dem Material heraus eigentlich legitimierbar wäre. Diesem Abgrund entgeht auch Wagner nicht immer: Sosehr man auch den Görlitz-Zyklus bewundern mag, die Notwendigkeit dieser rigiden Selbstfesselung ist nicht einzusehen.
Den stärksten Eindruck hinterlassen so die auf den ersten Blick weniger strengen, dafür inhaltlich um so dichter gefügten Schlaglichter auf historische Figuren: Die in dieser Zeitung vorabgedruckten Gedichte über „Störtebeker“, „Kolumbus“ oder „Saint-Just“ etwa, wo die Sprache sich am Gegenstand wie an einem Wetzstein buchstäblich schärft und alle Schlacken des Impressionistischen verliert:
die nationalversammlung und das pult,
das seiner redner harrt: ein falsches wort,
ein laut zuviel nur, und der beifall rauscht
als fallbeil herab.
Auch dem Verstummen des psychisch kranken Dichters Jakob van Hoddis in Tübingen gewinnt Wagner eine eindringliche poetische Anamnese ab.
Na bitte, geht doch, mag der Massengeschmack da all jenen um Ausdruck ringenden und an Sprachskrupeln laborierenden Zauderern zurufen – frei nach dem Motto „Meine Mitte ist intakt“ (Benn). Also endlich wieder ein Dichter, der sich auf die Welt seinen Reim macht? So einfach wischt man die Moderne nicht vom Tisch, der in diesem Fall eine tabula rasa ist. Wagner weiß, daß die Sprachwelt seiner Gedichte von der Wirklichkeit durch eine hauchdünne, aber undurchlässige Papierschicht getrennt ist: eine Atmosphäre aus Zeichen, in der der Unterschied zwischen Äther und Vakuum nur im Klang liegt und in der allein der krepierte Sperling „durch den leeren Himmel“ fliegt.
Am Ende des Bandes steht eine weitere, eine letzte Phantasie. Das Packeis um die gescheiterte Shackleton-Expedition von 1915 wird zum Gleichnis des einsamen Autor-Ichs vor der endlosen, unbeschriebenen Fläche:
es frißt sich von den rändern bis zum herzen
der scholle stetig vor. dort kauern wir,
vom ruß verklebt, wie lettern nach dem schwärzen.
die blanke fläche. dieses blatt papier.
Wo Kolumbus als unaufmerksamer Schüler vor der leeren Tafel von der terra incognita träumt, muß der wahnsinnige van Hoddis das „bohrende Weiß“ der Wand „mit Zeitungsfetzen zum Schweigen“ bringen. In der zerfließenden Welt, so lehren diese Gedichte, können Formen eine Sache auf Leben und Tod sein.
Richard Kämmerlings: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.3.2004
Die Welt, wie sie einmal war
– Renaissance der Vormoderne: Jan Wagner dichtet im Retrostil. –
dabei, die worte an dich abzuwägen –
die paare schweigend auf geharkten wegen,
die beete laubbedeckt, die bäume kahl,
der zäune blüten schmiedeeisern kühl,
das licht aristokratisch fahl wie wachs –
(„Botanischer Garten“).
Mit diesen leicht manierierten Sonettversen, jedoch mühelos gereimt und stilsicher, eröffnet Jan Wagner seinen zweiten Gedichtband Guerickes Sperling. Und wir betreten quasi vom ersten Gedicht an die Welt des Autors: eine scheinbar vergangene Zeit, die uns ihrer Stilleben versichert. Bereits mit seinem ersten Gedichtband Probebohrung im Himmel hatte der Berlin-Hamburger Lyriker sein poetisches Prinzip deutlich gemacht, aus kleinen Dingen eine für den Leser „gesicherte Welt“ zu entwerfen, die sich der realen Gegenwart auf kindliche Weise weitestgehend entzieht. Derart sind auch eine Vielzahl von Wagners neuen Gedichten, die u.a. an den Orten der Kindheit nach Impressionen suchen wie in dem Gedicht „Regenwürmer“:
jahre später
seh ich am himmel ihre schatten ziehen, riesig,
in dunklen wolken präsentiert sich mir die welt
vorm fenster als kaltes quadrat.
Über den Band verstreut finden sich eine Reihe solcher leichten Phantasien im Stile kleiner Musikstücke, sei es in Naturgedichten sowie Reiseimpressionen, in denen Jan Wagners stilistische Fähigkeiten zum Vorschein kommen. Hier schreibt einer, der sein Handwerk beherrscht. Wenn Wagner dann aber wie im Titelgedicht „Guerickes Sperling“ die Frage aufwirft: „was ist das, unsichtbar und doch so mächtig, / daß keine kraft ihm widersteht?“ wird die Tonlage unüberhörbar, die uns noch einmal in das Raunen aus dem Stimmenwald deutscher Dichtung des 19. Jahrhunderts versetzt, in die Zeit hingetupfter Sonnenuntergänge, wie sie wohl Rilke und Hofmannsthal beim Tee vom Balkon einer Villa am Wörthersee gesehen haben mögen.
Wagners Gedichte behaupten die Welt als Summe vieler freundlich ins Bild gesetzter Nuancen. So ist es nicht verwunderlich, daß die Wahrnehmungsstrategien des Lyrikers Jan Wagner verglichen werden können mit der Erfindung der Fotografie 100 Jahre später im Zeitalter des Bildverlustes bzw. seiner Auslöschung. Insofern zeigen die Texte motivisch wie formal eine deutliche Rückwärtsbewegung an, eine Renaissance der Vormoderne:
blaue abende, in die wir stiegen
wie in keller voller alter weine.
der mond, das helle artischokkenherz
der jahresmitte…
(„Caprice im Hochsommer“)
Dem Autor deshalb gleich einen „Biedermeierstil“ unterstellen zu wollen, greift wohl zu kurz oder zum Teil daneben: Wagners Gedichte sind der mit allen Mitteln konservative Versuch, eine heile oder zumindest noch zu rettende Welt in den Momenten der Glückseligkeit zu saturieren. Wenn Wagner, und das ist selten, diese Momente, allenfalls sehr subtil, zu brechen versucht, beginnt das eigentlich Interessante seiner Gedichte:
der himmel abends mit den farben von
gesangbuch und von schlehenschnaps. die hügel
sanft und wie von meisterhand radiert.
fachwerkhäuser, die im schatten grasen.
gestärkte weiße hemden in den schränken
warten auf den toten, der ihnen paßt.
das bellen eines hundes läßt
die stille wachsen. und die stille wächst.
(„Eberhardzeller Ekloge“).
Derlei zumindest im Ansatz aufbrechende Textstrukturen finden sich jedoch zu wenige bei Jan Wagner, dem man sogar eine gewisse Beliebigkeit vorwerfen könnte, sieht man sich sein Porträtgedicht „Kolumbus“ an, in dem der junge Kolumbus am Hafen steht: „wo die matrosen / mit scharfem atem von atilia schwafeln“, „sich die taue an der mole / im schlaf zusammenrollen und die schrift / des tangs verwischt…“ Das ist sehr hübsch gemacht, nur man fragt sich, warum Jan Wagner mit keiner einzigen Zeile über die harmlose Sicht auf das zu sprechen kommt, wofür die historische Figur Kolumbus signifikant wurde: das Zeitalter der größten Völkermorde. Muß ein solches Gedicht heutzutage nicht zwangsweise wenigstens vom Denkansatz her ein zivilisationskritischer Text sein und nicht wie bei Wagner bloß eine nette lyrische Anekdote?
Zudem: In Jan Wagners Gedichten ist jedwede soziale Realität schlichtweg ausgespart. Nicht einmal in der Beschreibung Neuköllner Ghettoisierung: „ein firmament von glückspielautomaten, / die kleine nachtmusik der ambulanzen…“ („Neukölln I“) taucht sie auf. Noch in den Sirenen der Krankenwagen findet Wagner etwas Anheimelndes wie Mozarts süßliche Komposition.
Wenn Dichtung ein Spiegel ist, der der Wirklichkeit vorauszugehen vermag, dann vermißt man bei Jan Wagner die sprach- und gegenwartskritischen Findungen, den Versuch, die eigene – womöglich im guten Willen harmonisierte – Welt wenigstens gelegentlich in Frage zu stellen. Zumindest einmal versucht Wagner eine kritische Durchleuchtung: „die veteranen wachsen aus dem gras / empor in ihren ehren-uniformen“, „sie wachsen aus dem gras wie in den mythen / das heer der ausgesäten drachenzähne.“ („Veteranengarten“)
Jan Wagner, so möchte man meinen, ist mit großer Kunstfertigkeit bei einer Handwerklichkeit angekommen, die einen kaum mehr für möglich gehaltenen Retrostil anklingen läßt, ein Summen und Rauschen beinah aus der guten alten Zeit.
Tom Schulz, scheinschlag, Ausgabe 4, 2004
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Lars Reyer: Betäubung und Rausch
titel-kulturmagazin.net, 3.7.2004
Michaela Schmitz: schmetterlinge, die in die wiesen fallen
michaela-schmitz.de
Markus Fauser: Naturwissenschaft aus dem Ausstellungskatalog
jstor.org, 2009
Beate Tröger: Hell und originell – Jan Wagners Gedichte sind Einladungen in die Welt der Lyrik
literaturblatt.de, März/April 2015
Jürgen Egyptien: Artistik und Evokation
literaturkritik.de, Juli 2004
Brigitte Kronauer: Störtebecker
Brigitte Kronauer (Hg.): Die Augen sanft und wilde, Balladen, 2014
Idylle und Schrecken
– Einige Fußnoten zu dem Dichter Jan Wagner. –
Im Oktober 2005 wurde der Dichter Jan Wagner das Opfer einer polemischen Aufwallung. Das war in zweifacher Hinsicht eine faustdicke Überraschung. Denn zum einen sind Auseinandersetzungen um ästhetische Grundsatzfragen sehr selten geworden; öffentliche Kontroversen unter Lyrikern gar muss man mit der Lupe suchen. Zum andern scheint sich eine formsichere Dichtung wie die Jan Wagners kaum für beckmesserische Vorwürfe zu eignen. Nur ab und an führt der branchenübliche Futterneid dazu, dass einem Autor der Kragen platzt, wenn wieder mal der Kollege von nebenan den fünften Literaturpreis oder das siebte Stipendium eingestrichen hat. Jan Wagner war im Oktober 2005 der Ernst-Meister-Preis zugesprochen worden, eine der höchstdotierten Lyrik-Auszeichnungen in Deutschland. Und urplötzlich loderte in einem jener mitteilungsfreudigen Netzwerke im Internet, in denen junge Lyriker ihre Selbstvergewisserungen und Gedichte austauschen (www.forum-der-13.de), ein gewisser Zorn auf. Eine allseits respektierte Dichterkollegin, die für ihre Provokationslust bekannt ist, streute einige boshafte Invektiven gegen Jan Wagner. Seiner Lyrik, so die Polemikerin, hafte etwas „Kleingartenhaftes“ an, in ihr wehe der Geist der fünfziger Jahre. Und weiter:
ich hätte es gerne so lakonisch schön, in rhythmisch rund gefügten versen wie bei wagner, aber sie verhängen mir die gucklöcher in die welt, ziehen die gardinen zu, zünden die kerzen an…
Diese boshafte Stichelei ist aufschlussreich. Als vermeintliches ästhetisches Defizit wird nämlich etwas benannt, was wir noch immer für ein Qualitätsmerkmal eines Gedichts halten wollen: Tatsächlich schreibt Jan Wagner ja „rhythmisch rund gefügte Verse“, tatsächlich sind seine Gedichte durch eine „lakonische Schönheit“ charakterisiert. Niemand wird bestreiten wollen, dass dieser Autor eine gewisse poetische Sympathie für Gartenanlagen entwickelt hat. Und auch ein lyrisches Interesse an Quittenpasteten, Champignons oder Melonen. Aber nur eine oberflächliche Lektüre wird zu der Schlussfolgerung verleiten, dass in der Dichtung des 1971 geborenen Autors die Kerzen des Biedermeier brennen. Gewiss darf man sagen: Jan Wagner ist der Klassiker unter den jungen Dichtern, denn er beherrscht die Königsdisziplinen der Lyrik, er arbeitet mit ihren kunstvollsten und schwierigsten Formen: mit dem Sonett und dem Sonettenkranz, mit der Sestine oder der sogenannten Villanelle – alles ebenso ehrwürdige wie komplizierte Formen, die in der Gegenwartslyrik vom Aussterben bedroht schienen. (Der Sonettenkranz feiert derzeit ein erstaunliches Comeback, etwa bei Ulrike Draesner, Christian Lehnert oder Nicolai Kobus.)
Schauen wir doch etwas genauer hin, und inspizieren den „Botanischen Garten“, den das lyrische Ich in Wagners zweitem Gedichtband Guerickes Sperling (2004) durchquert. Die Ähnlichkeit dieses Gartens zu dem berühmten „totgesagten park“ Stefan Georges ist frappierend. Der Kostbarkeitskult der „fin-de-siècle“-Poesie wird jedenfalls in diesem Gedicht geradezu ostentativ aufgerufen. Ein Vers wie „das licht aristokratisch fahl wie wachs“ bekräftigt die Künstlichkeit der Szenerie. Wagner neigt mitunter zu erlesenen Bildern, wobei Naturphänomene in kunsthandwerklich vorgeprägte Objekte verwandelt werden. Gänse schwimmen hier „friedlich“ in Seen „aus weißem porzellan“, die Ansammlungen von Fischlaich erscheinen als „die winzigen perlen eines geplatzten kolliers“.
Wer sich mit diesen Gedichten aber näher beschäftigt, wird bald entdecken, dass die scheinbar weich gezeichneten Szenen überall Risse bekommen, dass die Idyllen mit Bildern der Unruhe und des Schreckens aufgebrochen werden. Im Gedicht „Botanischer Garten“ wird die Dekadenz-Szene konterkariert durch eine verstörende Assoziation: das Ich vergegenwärtigt sich den Erstickungstod eines Wals. Im Fortgang dieses Textes mehren sich die Zeichen des Unheimlichen: Die Wale landen im Naturkundemuseum, sie werden aufgehängt „an unsichtbaren drähten“. Was soeben noch im Gedicht hübsch ausgepinselt schien als hübsche, ornamentale Miniatur, kippt um in den ästhetischen Schrecken.
Auch in anderen Gedichten finden wir diese kunstfertig hergestellte Balance zwischen dem Idyllischen und dem Unheimlichen, den Schwebezustand zwischen Schönheit und Schrecken. Das Titelgedicht seines zweiten Gedichtbands Guerickes Sperling zitiert beispielsweise ein berühmtes Experiment der Wissenschaftsgeschichte. Durchgeführt wurde es von dem Naturwissenschaftler Otto von Guericke, der 1657 in einem spektakulären Versuch die Wirkung des Vakuums demonstrierte. Zwei metallische Halbkugeln wurden dabei zu einer Kugel zusammengepresst, danach die Luft herausgepumpt. 16 Pferde vermochten es nicht, die Kugel in ihre beiden Hälften auseinander zu reißen.
In dieser kulturhistorischen Schlüsselszene gilt die Aufmerksamkeit Jan Wagners einem Sperling, der sich in die Vakuumpumpe verirrt hat und dort unrettbar erstickt. Das Gedicht endet mit einer metaphysischen Pointe: „Dieser tote sperling“, heißt es, „wird noch durch einen leeren himmel fliegen.“ Der leere Himmel – das ist die aller Geheimnisse und Transzendenzen beraubte Landschaft der Aufklärung.
Ein weiteres Gedicht, das einen epochalen Augenblick neu interpretiert, ist „Störtebeker“, ein Gedicht, das von der Enthauptung des legendären mittelalterlichen Freibeuters handelt und sich dabei in die Rolle eines Störtebeker-Weggefährten versetzt. Die Fama behauptet ja, dass dem Delinquenten Störtebeker kurz vor der Hinrichtung noch ein letzter Wunsch gewährt worden sei. Man werde, so der Richterspruch, alle Piraten begnadigen, an denen der Geköpfte noch ohne Kopf vorbeilaufen könne.
Jan Wagners Ich spricht aus der Perspektive eines Piraten, der sich an neunter Position in der Reihe befindet. Markiert wird das im Gedicht durch ein Günter Eich-Zitat:
Ich bin der neunte, ein schlechter Platz.
Aber noch läuft er.
Unverkennbar ist also die Passion Jan Wagners für historische Szenen, für Schicksalsaugenblicke aus der Wissenschaftsgeschichte und für Urszenen der Moderne. In einem poetologischen Zehn-Punkte-Programm hat dieser Autor einmal festgestellt, dass das Gedicht „an der Schnittstelle zwischen den sogenannten Trivialen und dem sogenannten Erhabenen“ entsteht. Die Momentaufnahme eines Kreuzungspunkts zwischen Trivialität, Hochstapelei und Erhabenheit trifft ein noch druckfrischer Text Wagners, der in Heft 25 der Zeitschrift Zwischen den Zeilen zu finden ist. Es ist das Gedicht „Der Mann aus dem Meer“, das ein reales Ereignis aus dem Frühjahr 2005 aufgreift, das vier Monate lang die einschlägigen Spekulationen um den Zusammenhang von Genie und Wahnsinn speiste. Ein unbekannter junger Mann wurde auf der englischen Insel Sheppey nahe der Küste von Kent aufgegriffen. Er war verwirrt, trug elegante Kleidung, sprach kein Wort, wirkte schwermütig und schien besondere Fähigkeiten im Klavierspiel zu besitzen. Nach seiner Einweisung in die Psychiatrie begann er, so hieß es, auf einem Piano bizarre Stücke zu spielen, improvisierte Endlosschleifen aus Klassik-Versatzstücken. Genug Stoff für eine moderne Kaspar Hauser-Geschichte also. Vier Monate später wurde der junge Mann als gewöhnlicher Simulant und Hochstapler entlarvt. Jan Wagner evoziert diesen Vorfall zunächst als Tragödie eines heillos Verlorenen:
man findet ihn in einem frack aus salz
und sand. ein paß aus algen, ein ensemble
von heringsmöwen hinter ihm. der nebel.
Aber, es werden, unmerklich zunächst, sogleich auch feine Kontrapunkte gesetzt, die das Fiktionale dieser Genie-Geschichte signalisieren. Die Schlussverse verweisen auf den süßen Schwindel, ohne die Verführungskraft der Inszenierung zu verleugnen:
… aus dem alten schuppen,
an dem der efeu steigt, gedämpftes klingen
eines klaviers. man hält es für chopin.
Auch hier sucht der Dichter Jan Wagner einen ästhetischen Schwebezustand, der den poetischen Stoff nicht an die sogenannten Fakten verraten will.
„Fortschritt“, hat Jan Wagner einmal gesagt, „ist das, was man aus dem Rückgriff macht. Die vordergründige Regeltreue bei der Verwendung alter Formen lässt übersehen, dass die poetischen Grundtugenden der Originalität, der Überraschung, des Widerspruchs und des Regelbruchs auch hier möglich sind und das ganz sicher auch nicht weniger effektiv…“ In diesem Sinne sind noch viele Rückgriffe, noch viele metaphorischen Überraschungen, Widersprüche und Regelbrüche von Jan Wagner zu erwarten. Freilich jenseits von „Kleingärten“.
Michael Braun, Ostragehege, Heft 46, 2007
Schwarze Schafe. Über Ernst Meister
– Dankesrede anläßlich der Verleihung des Ernst-Meister-Preises der Stadt Hagen. –
Wo in Berlin die Oranienstraße auf die kleinere, aber kaum weniger belebte Adalbertstraße trifft, gleich gegenüber von einem prallen, bis auf den Gehweg blühenden und wuchernden Blumenladen und unweit der Geburtsstätte des Döner Kebab, findet man das gut sortierte Antiquariat Kalligramm, benannt nach Guillaume Apollinaires berühmten Figurengedichten. Ohne Übertreibung läßt sich sagen, daß ich in dieser Buchhandlung, seit ich vor zehn Jahren erstmals in den Stadtteil Kreuzberg zog, fast ein Drittel meines derzeitigen Regalbestandes erworben habe. Dazu gehört zweifellos auch jener schmale Band aus dem Luchterhand Verlag, der noch in der längst verblaßten Währung des letzten Jahrhunderts ausgezeichnet ist und ausgewählte Gedichte Ernst Meisters mit einem Nachwort von Beda Allemann enthält.
Wer ein Antiquariat nach dem Stöbern mit einem Buch unterm Arm verläßt, hat ja nicht nur einen Autor und sein Werk erworben, sondern auch einen oder gleich mehrere Leser samt ihrer Lesart des Buches – eine ganze Vorgeschichte, die sich in Kaffeeflecken und Eselsohren, aber auch in Kommentaren und Unterstreichungen äußert. Mit einem Wort: Die Zahl der Botschaften, die von diesem einen Buch ausgeht, hat sich vervielfacht. „Das Salz der See / kann nicht dumm werden“, lese ich also jetzt in den Ausgewählten Gedichten und weiß nicht, ob die Zeilen von meinem Bleistift so dünn akzentuiert wurden – oder ob es sich um einen Hinweis des Vorbesitzers handelt. Eine ganze Reihe solcher Markierungen gibt es, mal diskret, mal vehementer. Ich blättere weiter, stoße auf Meisters Zeilen über „den Tod, der jedem / Gegend ist, / in die er eingeborn / (niemand, der nicht von hier)“, bin mir fast sicher, damals selbst die Linien unter den Worten gezogen zu haben, und finde schließlich, wenige Seiten später, ein Gedicht, das fast vollständig mit einem feinen Rahmen versehen, gleichsam höher gehängt ist. „Ein Kind“ heißt es und stammt ursprünglich aus dem Band Lichtes Labyrinth, den Meister 1960 veröffentlichte:
EIN KIND
Blickt auf die Schale
voll Zeit,
sieht nippen
den grauen großmächtigen
Schmetterling,
ein Kind,
und geht,
schwarze Schafe zu hüten
im Finstern.
Bilder sind das, in denen man einen Traum wiederzuerkennen glaubt. Dabei entspricht das Zurückgenommene in der Schilderung des Tableaus, die Sparsamkeit der Zeilen, dem ruhigen Ablauf der Dinge. Alles geht en passant und mit großer Folgerichtigkeit vor sich. Und vielleicht ist es ja gerade die Tatsache, daß alles in diesen Zeilen die Beunruhigung des Lesers zu ignorieren scheint, die ihre Wirkung ausmacht. Daß der graue Schmetterling ohne alle Eile nippt, macht ihn schier riesenhaft, wenn auch über seine tatsächliche Größe nichts gesagt wird, und das Idyll wirkt nur um so verstörender – denn es kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Inhalt der Schale, die auch uns gehört, zur Neige gehen wird. Ein Kind aber – vielleicht ist es das Kind – geht Schafe hüten, und wir, die wir durch das Kind anwesend sind, gehen mit.
Kind, Hirte, Herde: Das sind natürlich Motive – mit starkem religiösen Beiklang noch dazu –, denen man in den Gedichten Meisters immer wieder begegnen kann. Die „Hirtin“ des gleichnamigen Gedichts aus dem Band Pythiusa ruft in einer rührenden Groteske nicht nur die lebenden Tiere zu sich – man sieht „in dem Strahlen / einer Liliensonne“ auch die Lammskelette der geschlachteten neben den warmen Leibern herziehen. In der darauffolgenden Sammlung Zahlen und Figuren heißt es: „Ich war eine Herde / und rupfte Erfahrung“, und ein anderes Gedicht geht noch weiter. Unter dem Titel „Das Ich“ lesen wir:
Das Ich dünkte sich
Hirte und Hund und
wandernde Herde zugleich
Man wird diese Passagen in dem später entstandenen Gedicht „Ein Kind“ mitlesen können wie auf einem mehrmals beschriebenen Pergamentstück, einem Palimpsest nicht zu vergessen den Titel von Meisters erstem Buch nach Krieg und langem Schweigen, der sehr schmalen Sammlung Unterm schwarzen Schafspelz, die 1953 in der Eremitenpresse erschien.
Zugleich sind all diese Motive durch und durch klassisch und öffnen einen weiten Echoraum in der Literaturgeschichte. Man kommt kaum umhin, an die alte Schäferdichtung zu denken, wenn sich auch der sehnsüchtige bukolische Seufzer nicht einstellen will – denn die sich leerende Schale, der traumgraue Schmetterling oder auch die possierlich mahnenden Lammskelette machen Meisters Hirtenlyrik vor allem zu einer Variation auf das „Et in arcadia ego“ in seiner ursprünglichen Bedeutung. Derzufolge ist es kein Schäfer, der die Worte äußert, sondern der Tod, um zu sagen: Selbst hier in Arkadien bin ich, auch hier führt kein Weg an mir vorbei.
Erstaunlicherweise sind es gerade die scheinbar willkürlichen Unterstreichungen in den Ausgewählten Gedichten, die beim Blättern den passenden Kommentar liefern, ebenjene Verse, die als letzte vor dem Gedicht „Ein Kind“ markiert und dem „Tod, der jedem / Gegend ist“ gewidmet sind. Dies ist ja die Landschaft, das Panorama, vor dem das Kind Schafe hüten geht, schwarze Schafe im Finstern, wie es so sonderbar und widersprüchlich heißt – denn was könnte aussichtsloser sein, als eine solche Herde unter diesen Umständen beieinanderhalten zu wollen? Vergeblichkeit, sogar eine existentielle Absurdität scheinen markant auf eine Formel gebracht – und doch muß man sich das Kind als glückliches vorstellen. „Schwarze Schafe zu hüten / im Finstern“ – das ist ja vor allem ein großes Dennoch angesichts der sich leerenden Schale. Es ist der schöne Trotz, mit dem man beschließt, das Vergebliche zu wagen, vielleicht gar das Unvermeidliche als sinnstiftend zu begreifen. Das Hüten der Schafe schließt demnach viele, es schließt alle Handlungen ein.
Wenn der dünne Bleistiftrahmen allerdings von mir stammt, dann deshalb, so vermute ich, weil ich die wunderbaren Schlußzeilen poetologisch lesen zu können glaubte und ihren Stellenwert auf diese Weise hervorzuheben wünschte. Schwarze Schafe im Finstern hüten – das schien mir immer auch ein Bild zu sein, in dem das Schreiben von Gedichten erfaßt ist: Die Worte, die nicht sichtbar, aber doch da sind, nach und nach zu ertasten, mit einem gewissen Quantum an Naivität und dennoch eine Herde zu formen, die zunächst bloß in der Vorstellung existiert und deshalb dem einen oder anderen weder zähl- noch eßbar und deshalb sinnlos erscheint. Aber mit etwas Geduld hört man es eben doch dann und wann, wie eine Antwort, unerwartet vielleicht und beglückend, dieses leise Blöken im Dunkel.
Jan Wagner, Lose Blätter, Heft 36, 2006
Jan Wagner: Avernische Vögel. Von den Fakten der Poesie. Dankesrede zum Arno-Reinfrank-Literaturpreis 2006
Denis Scheck trifft Jan Wagner in Druckfrisch.
Jan Wagner liest bei faustkultur.
Poetry Crossings: Jan Wagner, Monika Rinck, Alistair Noon und Adrian Nichols lesen im Studio Niculescu am 15.4.2011 ausgewählte Gedichte und übersetzen sich gegenseitig.
Salon Holofernes – mit Jan Wagner. Judith Holofernes spricht mit Künstlern über das Kunstmachen.
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Homepage + Instagram +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.


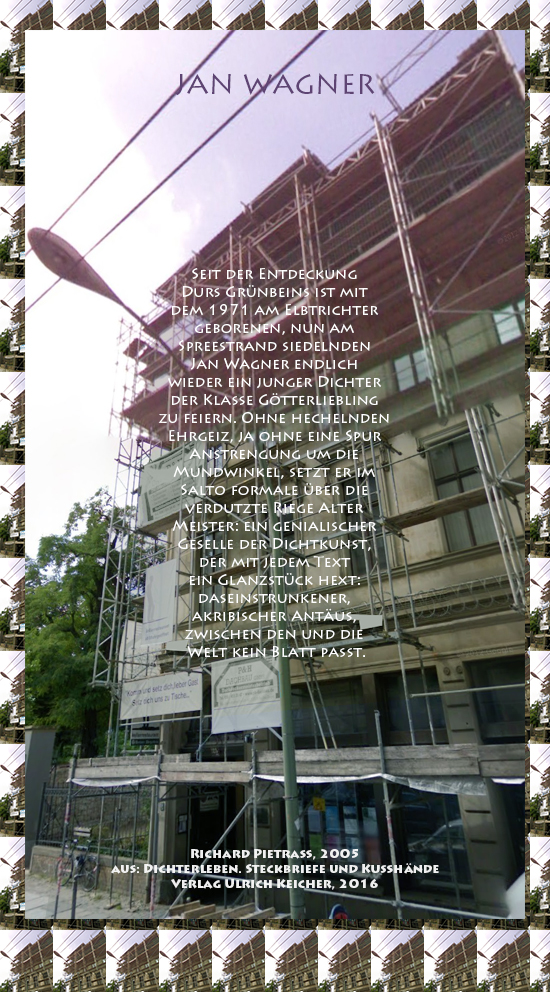












Schreibe einen Kommentar