Johann Georg Lughofer (Hrsg.): Ernst Jandl
JANDL RELOADED
„Da kommen sie gelaufen“ ist ein sehr frühes und eher unbekanntes Gedicht Jandls. Es ist im Jahr 1952 in der Zeitschrift publikationen erschienen und eignet sich insofern besonders gut für eine Neukontextualisierung bzw. für eine poetische Antwort 58 Jahre später, als es mit der Frage „aber wer sind die Leute?“ endet.
Doch zuerst zurück zum Anfang und den Fragen wer und wann wer gelaufen kommt?
Wenn ein Hund verreckt auf der Straße,
So ein Hund, der nur ein Haufen Dreck ist,
Da kommen sie gelaufen:
Da will jeder etwas wissen
Da will jeder etwas besser wissen:
aaaaaWas man hätte tun sollen.
aaaaaWas man jetzt noch tun kann.
aaaaaWas man tun soll mit den Leuten,
aaaaaDie ihn hier verrecken lassen
aaaaaMitten auf der Straße armes Tier.
Da kommen die Prediger
aaaaaDie überall sein müssen.
aaaaaDie überall dabei sein müssen,
Die überall mitreden müssen.
Da kommen die alten Weiber
aaaaaDie immer beten müssen,
aaaaaDie immer Rosenkranz beten müssen,
aaaaaDie immer Tränen drücken müssen,
aaaaaAus Zitronengesichtern.
Ganz langsam verreckt der Haufen Hund
Und der Rauch steigt blaß auf
Wie von warmem Mist
Auf gefrorenem Pflaster.
Da stirbt also ein Hund und die Prediger, die Weiber, nein, mehr noch, jeder will etwas besser wissen. Überall, immer, jeder, alles, besser: ein ziemlicher Absolutheitsanspruch! Überall will immer jeder alles besser wissen, wenn es um nichts Wesentliches geht. So weit die erste Strophe. In der zweiten wird dagegen gehalten.
Wenn ein Mensch auf der Bank liegt,
Plattgedrückt, und der Kopf hängt über den Rand,
Und die Augen sind halb offen und schwarz
Von Fliegen, und die Haut ist ihm zu groß,
Sein Gesicht hat keine Wangen, sein Rock
Eine Uniform, die keiner mehr anhat,
Nur einer auf der Bank, der den Atem
Lang anhält:
aaaaaWenn einer auf der Bank so
aaaaaDen Atem lang anhält,
Kommen sie nicht gelaufen.
Da will keiner etwas wissen,
Da will keiner etwas besser wissen:
aaaaaWas man hätte tun sollen – aber was nützt das?
aaaaaWas man jetzt noch – aber jetzt kann man nicht.
aaaaaWas man tun soll mit den Leuten –
aaaaaaber wer sind die Leute?
Nun rückt also ein Mensch ins Zentrum der Aufmerksamkeit und die, die vorher noch konnten, wollten, wussten, mussten und eben gelaufen kamen, bleiben aus. Wer sind nun diese Leute?
Auf dieser Frage basiert der Antworttext. Auch der Vergleich mit der Behandlung des Hundes konnte beibehalten werden. Die Moral bleibt also die gleiche. Die Realisierung ist formal und inhaltlich der Zeit (2010, 58 Jahre nach Jandls Text) angepasst. „Na Hund?“ ist ein Vortragstext in Spoken Word Manier versehen mit drastischen Beispielen gleichermaßen wie mit humoristischen Pointen. Aber sehen Sie selbst (bzw. versuchen Sie den Text zu hören).
Na Hund?
oder: Hund, Mensch, Leute
Was sind das für Leute,
die ihrem Kind als Jausenbrotergänzung eine Notfalldosis Ritalin in den
Schulranzen packen?
Was sind das für Leute, die sagen:
Ach, Kinder… Kinder gibt’s keine, es gibt nur Kunden!
Was sind das für Leute, die sagen:
Qualität ist, was die Kunden zufrieden stellt!
Was sind das für Leute?
Die Leute sind immer die anderen
Die anderen sie nie wir
Wir können da ja nichts machen
Machen wir doch nicht immer nichts
NICHTS
Nichts, nichts, nichts
Das macht nichts
Das hat nichts
Das ist nichts
Nichts – ist einfacher, als etwas tun
Aber etwas tun ist einfach notwendig
Not macht wendig und findig, lebendig und sinnig
SINN
Sinn, Sinn, Sinn
Drei Sinne: Sehen, Hören, Sprechen
Sinn, Sinn, Sinn
It’s a sin diese nicht zu nutzen
Das macht Sinn
Das hat Sinn
Das ist Sinn
Das ist der Sinn
Das ist der Sinn
Das ist der Sinn der Sache, sag ich
Ich sag: Nichts ist schlimmer, als den dreifachen Affen machen
Nichts ist schlimmer, als wegschauen, weghören und totschweigen
Oh doch: Schlimmer noch ist wegschauen, weghören und trotzdem das
Maul aufreißen
Eine große Klappe aber keine Ahnung haben
Eine unheilvolle aber vor allem auch in Politikerkreisen weit verbreitete
Sitte
Sozusagen seine Dummheit äußern, Gaga-Gassi gehen, Stumpfsinns-
dünnschiss verbreiten
Und weit und breit kein Sackerl fürs Meinungsgackerl, nur Leute, die für
jeden Scheiß zu haben sind
Was sind das für Leute,
die 1000 Euro für ein mit Swarovski-Steinen besetztes Hundehalsband
ausgeben?
Was sind das für Leute,
die Bilanzen frisieren und fremdes Vermögen verschachern?
Was sind das für Leute,
die Natascha-Kampusch-zurück-in-den-Keller-facebook-groups bilden?
Was sind das für Leute?
Die Leute sind immer die anderen
Die anderen sie nie wir
Wir können da ja nichts machen
Machen wir doch nicht immer nichts
Apropos „machen“
Mit Tieren lässt sich zunehmend mehr Geschäft machen
Der Heimtierbedarf Discounter Nummer eins macht rund eine Milliarde
Euro Umsatz im Jahr, Tendenz steigend
„Hunde sind gut fürs Betriebsklima“, sagt der Fressnapf-Chef
Seit kurzem gibt es den ersten österreichischen Hundeflüsterer
Einen staatlich anerkannten Tierenergetiker, der den Tieren über den
Blasenmeridian streichelt, ihnen seine heilenden Hände auflegt und da-
für natürlich ordentlich abkassiert
Unlängst eröffnete auch Wiens erste Hundebäckerei
Es gibt dort Geburtstagstorten für jeden Hund
Und es werden selbstverständlich auch Welpen-Partys ausgerichtet
Reconcile das Antidepressivum für den Hund, ist längst auf dem Markt
Der Hundeseelentröster schmeckt nach Fleischwurst und hilft dem trie-
sten Tier in Notlagen
Apropos Notlagen
Obdachlose wissen zu berichten: Mit Hund bettelt’s sich besser
Jaja, wir haben alle ein großes, großes Herz für Tiere
Jaja, die meisten Halterinnen und Halter lieben ihre Putzerl, Waukerl
und Schnuggerl
5 % der Halterinnen und Halter haben überdies Sex mit ihrem Haustier
Jaja, dein Haustier mag dich so, wie du bist!
Was sind das für Leute, die sagen:
Ein Hund, ein Hund ist auch nur ein Mensch!
Was sind das für Leute, die sagen:
Naja, also ich schau mir diese Tierpornos ja nur an, aber wer so etwas
wirklich braucht, also der, der muss schon echt krank sein
Was sind das für Leute,
die ihr Tier Franz Ferdinand Gustav den XII. nennen?
Was sind das für Leute,
die ihren Bello Knurrtöle, Fauchwuchtei, Schnaubsauger, Schlabber-
schlöte,
Lefzenlusche, Fletschfresse, Wuwuwuzi, Krawallwachtel, Schlieren-
schnauze oder Dreckskläffbeule nennen?
Was sind das für Leute,
die Auftragsvortragstexte schreiben, um nicht vor die Hunde zu gehen?
Was sind das für Leute?
Die Leute sind immer die anderen
Die anderen sie nie wir
Wir können da ja nichts machen
Oh doch!
Machen wir einfach die Augen, Ohren und gelegentlich den Mund auf
Aber machen wir vor allem nicht jeden Schwachsinn mit
Das würde eigentlich genügen
Markus Köhle
Vorwort des Herausgebers
Kaum sonst jemand könnte geeigneter sein, um mit ihr oder ihm unsere Publikations- und Veranstaltungsreihe zu eröffnen, als Ernst Jandl (1.08.1925 – 9.06.2000), dessen vielfältiges und langjähriges Schaffen unterschiedlichste Anschlussmöglichkeiten für Literaturwissenschaftler, Linguisten und Didaktiker bietet. Überhaupt kann seine einzigartige Bedeutung in der deutschsprachigen Literatur nicht genug betont werden, wovon ein neuerdings wiederbelegtes öffentliches Interesse an Jandl zeugt, das etwa in der publikumswirksamen Wiener – und bald Berliner – Ausstellung Die Ernst Jandl Show zum Ausdruck kommt. Nicht zuletzt koinzidiert dieses Interesse mit der Tatsache, dass der große Dichter vor genau zehn Jahren verstorben ist, ein Verlust, welcher in der österreichischen Literaturszene schmerzhaft zu spüren ist. Welch großartige poetische Stimme damit verloren gegangen ist – darauf will dieses Büchlein unter anderem hinweisen.
Jandl forderte und fordert auf ganz besondere Weise die verschiedenen Disziplinen der Philologie zu essentiellen Stellungsnahmen heraus. Sein Werk verlangt nicht nur nach literatur- und kulturwissenschaftlichen Interpretationen, sondern genauso nach sprachwissenschaftlichen Kommentaren. Doch auch für den didaktischen Bereich stellt das Werk Jandls eine reiche Fundgrube dar. Der fast sein ganzes Berufsleben lang als Lehrer tätige Schriftsteller blieb auch selbst immer an didaktischen und pädagogischen Fragen interessiert, ja beantwortete mitunter schriftlich Schülerfragen zu Gedichten. Mit Freuden stellte er fest, dass seine Sprachspiele das literarische Interesse von Schülern deutlich steigerte. Er äußerte sich selbst theoretisch zum Literaturunterricht, wobei er zu größtmöglicher Freiheit aufrief. Sein Interesse galt genauso dem Bereich Deutsch als Fremdsprache, wovon sein Vorwort für die lexikonartige Sammlung Blume ist ein Kind von Wiese von Helga Glantschnig zeugt.
Die Reihe Ljurik dokumentiert die Beiträge der Internationalen Lyriktage der Germanistik Ljubljana, eine Verbindung von akademischem Symposion, Lyrik- und Musikvortrag sowie intellektuellem Austausch. Die Idee dazu entstand aus dem Wunsch, der automatischen und automatisierten Geschlossenheit wissenschaftlicher Tagungen entgegenzutreten und ein offeneres Format zu finden: Lyrik eignet sich dafür hervorragend, denn Gedichte finden einen direkten, sofortigen Zugang zum Publikum. Leider erhält gerade an den Universitäten Lyrik oft zu wenig Raum. Es scheint so, als werde Gedichtinterpretation vor allem an Schulen praktiziert, während sich angehende Philologen an den Hochschulen vor allem auf Prosa und vielleicht noch Drama konzentrieren. Auch zu einer Korrektur dieser Tendenz soll diese Veranstaltung und dieses Büchlein beitragen.
Gerade die (hinsichtlich der bloßen Textmenge) „kleinste“ Literaturgattung verlangt jedoch den InterpretInnen eine besonders präzise Handhabung ihrer analytischen Fertigkeiten und eine ständige Reflexion ihrer Deutungsbemühungen ab, sind doch die Ergebnisse meist unmittelbar nachprüfbar und auf ihre Plausibilität leichter befragbar. Die professionelle Lektüre von Gedichten ist somit vielleicht sogar als eine Art Königsdisziplin der Philologie zu erachten und verdient daher umso mehr Aufmerksamkeit.
Ljubljana dürfte dafür der perfekte Ort sein, ein Ort nämlich, an dem die zentralen Plätze nicht mit Reiterstatuen von Kriegshelden geschmückt sind, sondern mit den Standbildern von Dichtern und Philologen. Dies spiegelt wieder, dass die Identität der Republik Slowenien weniger auf Erfolge in Schlachten oder Sportstadien basiert, sondern auf der Sprache und Kultur. Lyriktage, die in lockerer Reihenfolge mindestens einmal im Jahr stattfinden werden, in der Germanistikabteilung einzuführen, lag somit mehr als nahe.
Für das Zustandekommen des Lyriktages zu Ernst Jandl am 28.10.2010 sei herzlich dem Österreichischen Kulturforum Ljubljana unter der Direktion von Frau Gesandte Dr. Christa Sauer gedankt. Genauso gebührt all den KollegInnen der Germanistikabteilung der Universität Ljubljana Dank sowie allen Beiträgerinnen zur Tagung und zu diesem Bändchen, das den an Jandl interessierten Lesern neue Perspektiven auf sein Werk eröffnet und beweist, wie lebendig die Auseinandersetzung mit diesem Autor auch zehn Jahre nach seinem Ableben geblieben ist.
Johann Georg Lughofer, Vorwort, Dezember 2010
Inhalt
– Geleitwort
– Vorwort des Herausgebers
– Michael Hammerschmid: Existenzgrammatiker, Lautforscher und Künstler der Reduktion. Ernst Jandls Dichtung im Porträt
– Imelda Rohrbacher: „die rache der sprache ist das gedicht“. Kleine Einführung in Ernst Jandls Zufallsmethodik
– Kristian Donko: ,Abschied ohne Willkommen‘. Ernst Jandls frühe Reisegedichte zwischen literarischer Tradition und Nachkriegserfahrung
– Michael Hammerschmid: Produktive Krisen. Reflexionen zu einem vitalen Paradox im Werk Ernst Jandls
– Špela Virant: „da gehören zwei dazu“. Zu Jandls Theater-Stücken
– Milka Car: Ernst Jandl. (Einmal) Kulturwissenschaftlich
– Johann Georg Lughofer: Jandls stanzen im Kontext der österreichischen VolXmusik
– Stojan Bračič: „liebervaterbittebiegmichlieber“. Wortbildungsprodukte als Kohäsionsmittel in Gedichten von Ernst Jandl
– Tanja Škerlavaj: nacheinander, concrete und frfrfrfrauauauau: Zur Mehrdeutigkeit in Jandls Gedichten – aus linguistischer Sicht. Stilistische Analysen ausgewählter Gedichte von Ernst Jandl unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten der Mehrdeutigkeit
– Neva Šlibar: Ernst Jandl, BA MA – Ernst Jandl im DaF-Unterricht
– Markus Köhle: Jandl reloaded
– Zeittafel zu Ernst Jandl
– Verzeichnis der Werke Ernst Jandls: Zu Lebzeiten veröffentlichte Bücher, Theaterstücke, Hörspiele, Tonträger und Film
Weit mehr Pathetiker als Clown
– Laudatio auf Ernst Jandl zur Verleihung des Hölderlin-Preises 1995. –
Ausweislich einer kleinen handschriftlichen datierten Eintragung in das betreffende Buch habe ich im Sommer 1965 zum ersten Mal etwas von Ernst Jandl erworben, nämlich den Band 11 der Reihe Writers Forum Poets mit dem Titel mai hart lieb zapfen eibe hold. Ich habe den Band in London erstanden in einem der kleinen Lädchen in der Charing Cross Road, für 10/6, weil ich, als der Groschen gefallen war, die „Oberflächenübersetzung“ Jandls von William Wordsworths berühmtem „My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky“ so überraschend, so barbarisch und so verzweifelt komisch fand, daß ich das blaue Heftchen unbedingt besitzen wollte. So kam es, daß im Sommer 1965 zwei große Poeten in mein Gesichtsfeld traten, nämlich Ernst Jandl und John Lennon, denn in diesem Sommer hatte Help von den Beatles Premiere im Pavillion Theatre am Picadilly Circus. Ich hatte nie das Vergnügen, auf den geliebten John Lennon eine Laudation zu halten, aber ich habe das eminente Vergnügen, mich öffentlich freuen zu dürfen darüber, daß Ernst Jandl fünfzig, vierzig oder dreißig Jahre, je nachdem, wie man’s rechnet, durchgehalten hat und nun endlich nach und nach in seinem wahren poetischen Rang akzeptiert ist. Dem Sarkasten, Spötter und Bruder im metaphysisch grundierten Wortspiel John Lennon wurde bekanntlich das Leben verkürzt; mit Ernst Jandl aber, und ganz gewiß damit auch mit uns, hat es das Schicksal – oder wie immer Sie diese Instanz nennen wollen – gut gemeint, indem es dem Dichter Ernst Jandl die Chance gab, ein Werk von enormem Reichtum zu schaffen, ein lyrisches Werk und ein Hörspiel-Œuvre, eine ganze Palette von Möglichkeiten und Fähigkeiten als performing artist und Stimme seiner selbst zu realisieren.
Das war nicht selbstverständlich und das war nicht einfach und erforderte große Kraft des Durchhaltens gerade in jenen Jahren, die den Ereignissen 1965 und 1966 vorausgingen, der Publikation von mai hart lieb zapfen eibe hold also und dann, 1966, des Gedichtbandes Laut und Luise. Wer’s zu was bringen will, muß bereit sein, sich zu ruinieren, sagte Peter Rühmkorf einmal, und Ernst Jandl hatte diesem Ruin fast ein Jahrzehnt lang in Gestalt von Isolation und verstellter Lebensperspektive ins Auge zu sehen, von 1956, als er seinen Band Andere Augen mit frühen Gedichten veröffentlichen konnte, bis – und nun korrigiere ich mich selbst, denn wenn man genau bibliographiert, dann war’s gar nicht der Band Laut und Luise, womit im deutschen Sprachraum die Publikationspause Ernst Jandls endete, sondern der kleine Band Hosi-Anna, erschienen 1966 in der Gulliver Presse in Bad Homburg. So scheint sich dann alles doch in einem höheren Sinne zu fügen, aber das sieht nur hinterher so aus; er mußte in einer Einsamkeit durchhalten, die zunächst nur von Friederike Mayröcker geteilt wurde und die noch länger hätte dauern können, wären da nicht noch zwei gewesen: der Lektor Otto F. Walter nämlich und der Verleger Klaus Wagenbach, die Laut und Luise und dann 1968 die Sprechplatte mit 21 Gedichten aus Laut und Luise publiziert haben. Damit begann der Siegeszug von Ernst Jandls Dichtung, zunächst bei meiner Generation und im Zusammenhang mit einer enormen Liberalisierung, einer befreienden, beglückenden Horizonterweiterung nicht nur, aber eben ganz besonders auch auf dem Gebiet der Literatur. Diesem Anfangspublikum ist inzwischen eine Leser- und Hörerschaft und auch Zuschauerschaft des Dichters und Performance-Künstlers Jandl gefolgt, die bis zu den Grundschul-Kids altersmäßig hinabreicht – Ernst Jandl zur Freude, hoffe ich, und manchen seiner Freunde doch auch ein bißchen zu händereibender Genugtuung: wir haben’s doch gesagt, wir sind doch nicht blöde gewesen! Das Vergnügen war allerdings bald auch ein wenig versetzt mit einem unangenehmen Ingrediens, nämlich der häufig anzutreffenden etwas herablassenden und schulterklopfenden Qualifizierung von Ernst Jandls Dichtung als „Sprachspiel“, „Sprachclownerie“, „Wortspielerei, wenn auch brillanter“ usw. Sätze wie „Seine Gedichte sind allemal ein Jux“ (entnommen einer Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung von 1979) begannen einen zu nerven, denn was da bei Jandls Gedichten übers Amüsement hinausging und -geht, ist doch eine Zutat von durchaus Verstörendem und Beunruhigendem, wenn da Kritiker zu Jandls Leidwesen nur den „Witz im Sinne von Humor“ in seinen Gedichten sahen, so übersahen sie doch offenbar, daß da häufig mit Entsetzen Scherz getrieben wurde und daß die Texte über jene Verdichtung hinaus, die ein Kennzeichen des Witzes ist, eine ganz außergewöhnliche Dichte zeigten und zeigen, eine Vielfachdeterminierung ungefähr aller ihrer Elemente vom Wort bis zum einzelnen Buchstaben, die nur nach und nach aufzulösen bzw. einzuholen war. Es muß ja niemand zum Kummer gereichen – und vielleicht noch nicht einmal Ernst Jandl selbst –, aber es gibt eigentlich erstaunlich wenige literaturwissenschaftliche Untersuchungen zu den Texten Ernst Jandls, bis heute, und ich denke, dies hängt mit ihrer Dichte und zugleich Vertracktheit zusammen, die sich im übrigen ganz gut verträgt mit schlagender Komik auf einer gewissen Ebene. Es gibt einen durchaus finsteren und schroffen Zug an Ernst Jandls Gedichten zusammen mit einer Komik, die einem aber zwischen der Neigung zum Gelächter und dem Entsetzen steckenbleibt:
falamaleikum
falamaleitum
falnamaleutum
fallnamalsooovielleutum
wennabereinmalderkrieglanggenugausist
sindallewiederda.
oderfehlteiner?
Hier ist jeder Buchstabe funktional, und das Unheimliche am Tonfall des Gedichts ist, daß es im militärischen Tonfall äfft und mit einer barschen Frage endet, auf die man nur ganz jämmerlich antworten kann: Ja, es fehlt einer, und zwar nicht nur einer, sondern eben 55 Millionen! Ähnlich bei „ernst jandls weihnachtslied“, das muß man kaum noch zitieren, es kennt’s ja fast jeder, wir lächeln einverständig, denn das Adventsliedchen spielt natürlich mit einem Weihnachtslied, doch bei näherem Zusehen steckt das Stückchen voller Rätsel und Tricks: die Wiederholungen der Zeilen und der Rhythmus sind bis heute nicht erklärt, was der Hund im Gedicht tut, kriegt man nur durch Rekurs auf Ernst Jandls Selbstbildnisse sowie auf einen Prosatext Thomas Manns und ein Gedicht Goethes heraus, und dann erscheint mehr als nur gerührt meckerndes Gelächter die adäquate Antwort auf das Gedicht. Jandls Lyrik schien anfangs gewissermaßen mit einer neutönerisch-barbarischen Voraussetzungslosigkeit einzusetzen, schien zum Teil mit einem recht groben Pardauz auf der Szene anzugelangen, doch nachdem wir uns langsam von dem Schock, den Genialität bekanntlich versetzt, erholt haben, erkennen wir mehr und mehr, daß Jandl zart und dicht anknüpft an die Geschichte der deutschen Literatur, so daß z.B. das Gedicht „amsterdam“ gewissermaßen über die Bande gespielt werden muß, und die heißt: Johann Peter Hebel, und die „etüde in f“, die aus dem „falfischbauch“ heraus ertönt, hat als lyrisches Ich natürlich Jonas, der aus dem Walfischbauch spricht, und die Gedichtfrage „bist eulen“ – Antwort: „ja / bin eulen“ soll nicht nur den Einzelgänger Eule heraufrufen, sondern auch die Brilleneule als Spottbezeichnung für den Intellektuellen und Bücherwurm, das Adjektiv „allein“, das Adjektiv „elend“ und das Verb „heulen“, und so wird langsam aus dem grotesken, verstörenden, gar nicht melodiös-lieblichen Gedicht eine Elegie von Graden.
Wir lachen bei Ernst Jandl auf keinen Fall unter unserm Niveau, wir werden nicht billig abgespeist, und das scheint mir das tiefere Geheimnis der Popularität vieler Texte Jandls: Er hat sich nicht einem momentan herrschenden Geschmack angepaßt, er schielte nicht von vornherein auf Massen-Leserschaft und Popularität, sondern Popularität wurde das Ergebnis seiner kompromißlosen Strenge.
So gelang ihm die Quadratur des Kreises, nämlich als sogenannter Experimenteller populär zu werden. Auf eine atemberaubende Weise hat er zumindest einige seiner Texte in der im besten Sinne Massenkultur unterbringen können, oder man müßte vielleicht besser sagen: die Massenkultur hat sie resorbiert, hat sie ganz glücklich in sich aufgenommen. Diesen populär gewordenen Texten Jandls half dabei natürlich ihre spezifische Komik, aber es ist doch bemerkenswert, daß dies keine verbilligte, ja sogar eine eher unheimliche Komik ist, zudem in einer Sprache, der alles Einschmeichelnde – gängigerweise die notwendige Voraussetzung für breite Erfolge mit Lyrik – fehlt. Ernst Jandls Lyrik ist übrigens insgesamt und jenseits der Popularität gewisser Teile seiner Lyrik eine demokratische Kunst in dem oben schon angedeuteten Sinn einer Lyrik aus nicht-hierarchischer, enthierarchisierter Sprache; wenn der bekannte höchst spekulative und problematische Benjaminsche Begriff wenigstens dazu taugt, eine bestimmte Richtung der Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert andeutungsweise zu bezeichnen, so müßte man Ernst Jandls Lyrik zur „nicht-auratischen“ Kunst rechnen; sie scheint mir einer der vornehmsten zeitgenössischen Belege hierfür.
Wie aber kann eine solche Lyrik, die alle sich selbst heiligende Distanz zum Betrachter und Hörer eingezogen hat, dennoch die Ausdrucksmöglichkeit des „Pathos“ in sich bewahrt haben und sie sogar auf eine in der Nachkriegsliteratur ganz einmalige Weise realisieren? Ich denke, die Möglichkeit von „Pathos“ in Jandls Lyrik kommt genau da her, daß er in einer strengen, kahlen und abgründigen Weise aufgeklärt ist, und das heißt: er hat sich zur Beseitigung allen Priestertrugs in bester aufklärerischer Tradition entschlossen, er ist auf Illusionslosigkeit verpflichtet und muß doch vor Schmerz jaulen und vor Trostbedürfnis heulen: und diese Spannung schlägt sich als unauflösbares, nicht zu entspannendes Pathos im wahrsten Sinne in seinen Texten nieder. Er hat „Magie von seinem Pfad verbannt“ und das heißt auch den Trost durch die alte lyrische Magie, und so muß er ohne Magie, ohne verklärenden Hokuspokus leben und möchte doch knieweich werden und darf es nicht: es wäre sinnlos, keiner von oben schaute ihm dabei gefällig zu, jedenfalls der EINE nicht mehr, von dem früher alle Sinnstiftung und aller Trost ausgingen:
Die Dichter, die nur spielen,
Die wissen nicht, wer sie und wer die Leser sind,
Der rechte Leser ist kein Kind,
Er will sein männlich Herz viellieber fühlen,
Als spielen.
heißt es in einem Stammbuchvers Hölderlins, dem Sie das Adjektiv „männlich“ als ein zeitgebundenes nachsehen werden; synonym zu „männlich“ wäre hier und heute ganz generell „ernsthaft“ und „unbedingt“; das Gegenteil wäre „tändelnd“ und eben nur (wort-)„spielerisch“.
Es hat der Kritik bisweilen gefallen, Ernst Jandls Dichtung gerade in ihren eminenten Qualitäten, ihrer Härte, ihrer Unbedingtheit, ihrer Kompromißlosigkeit im Zusammenhang mit Adornos berühmtem Satz von der Problematik bzw. der Unmöglichkeit des Gedichtschreibens nach Auschwitz als Beleg dafür anzuführen, daß Adornos Dictum eben doch nur eine „akademische abgehobene Formel“ (Klaus Siblewski) sei: Ernst Jandls Gedichte existieren doch schließlich… Die Wahrheit ist, daß Adorno im fraglichen Zusammenhang darüber nachdenkt, wie Gedichte nach Auschwitz aussehen müßten, wenn sie nicht auf feinsinnige Weise inhuman und substanzlos sein sollen, auf unverantwortliche Weise unberührt von dem, was da in Mitteleuropa passiert war, und Jandls Gedichte sind höchstens deshalb partiell gegen Adornos Dictum ins Feld zu führen, weil Jandl die Folgerung aus der Lage gezogen hat: Seine Gedichte sind häßlich, hart, laut und unrein, genau deshalb, weil sie der Realität nach 1945 gewachsen und nicht weltflüchtig sein wollen. Jandl kann als Person ja sehr höflich sein, aber in seiner Kunst kennt er keine Verbindlichkeit im Sinne von Unverbindlichkeit: da ist er barsch, schroff, ungeduldig und verbietet sich und anderen Geschwätzigkeit, baut er seine Gedichte lieber auf durch ungemilderte Wildheit, Rabiatheit und Verzweiflung. Wenn Sie mir als dem Anglisten zu dem Anglisten Jandl hin die englische Formulierung erlauben: He is very much down to earth, oder, wie er es ganz trocken formuliert:
Den überhöhten Weg, also Dichtung, die über dem Boden und über den Bergen schwebt, habe ich kaum je geschrieben. Wäre es mir passiert, hätte ich das Gedicht abgeändert oder auf eine andere Weise eliminiert.
lch halte es für eine großartige menschliche und sehr genaue ästhetische Entscheidung Ernst Jandls, daß er existentielle Erfahrung bis zum Groben und Elementaren, daß er Pathos, die Tatsache der Spannung und Fallhöhe unserer Existenz ungemildert an entscheidender Stelle in seine Literatur hineingenommen und sich grundsätzlich dieser Ausdrucksaufgabe gestellt hat. Als kleines Modell diene der Titel des einen seiner beiden großen Hörspiele: Das Röcheln der Mona Lisa spricht verdeckt von einem Schönheitsbegriff, zu dem unabdingbar und aus Gründen der Wahrhaftigkeit die Störung klischierter Schönheits-Erfahrung gehört: das „Lächeln“ wird zum „Röcheln“ aufgerauht, die Kreatürlichkeit des Menschen und die Verstörtheit des Zeitalters werden vorbehaltlos in ihr Recht auf Ausdruck eingesetzt. Es ist wohl seine erstaunlichste Leistung überhaupt, Sprache kalkuliert so zu demolieren, daß sie Europas demoliertem Antlitz, demoliert in zwei Anläufen, vor 1918 und vor 1945, entspricht, also Sprache so zu verhäßlichen, ihr Melos, Schmelz und Schmalz zu nehmen, und sie poetisch so zu restituieren, daß eine neue, gehärtete Schönheit entstand. Martin Buber hat 1964 in einem Gespräch mit Werner Kraft die Überlegung angestellt, daß pure Schönheit, völlige Vergeistigung eines Dichters heute vielleicht geradezu verdächtig wäre; er meinte etwas „Unreines“ sei geradezu notwendig:
Wenn es heute irgendwo einen Dichter gibt, dem dieses Unreine fehlt, dann ist er zum Untergang vorbestimmt.
Ich denke, Ernst Jandls Literatur hat bis heute gezeigt, daß er von der Gefahr ganz entsubstantiiert ätherischer Schönheit als einer verlogenen Schönheit gewußt hat und uns in vielfältiger Hinsicht eben nicht durch Kulinarik bei der Stange hält, sondern durch vielfältige Strategien der Irritation durch Sarkasmus, durch heilige Nüchternheit, durch Ungetröstetheit, durch nur sehr gebrochenen Gebrauch und Anruf großer Worte:
DU
hast es verschuldet
der großen Brille
klüften
die sonne hatte
schon die halme
froh
dunklen lichtes voll
geht
nach der erde
deine stille
Fast erscheint es vermessen, den in diesem Gedicht Angeredeten umstandslos mit Gott gleichzusetzen; er erscheint nur wie verschleiert in diesem Gedicht, das eines der wenigen von Jandl ist, in denen auf Hölderlin angespielt ist bzw. in dem er zitiert wird. Die Entfernung zwischen Hölderlin und Jandl ist weiß Gott nicht zu übersehen: Die beiden leben entschieden in einer jeweils anderen Zeit, Hölderlin in Erwartung eines neuen Äons, in der Hoffnung auf die Transsubstantiation des Griechentums ins Deutschtum, das den Gegenstand von Hölderlins letzten Hymnen bildet. Und nicht nur diese Hoffnung, dieses dichterische und religiöse Konzept, an dessen Weitgespanntheit Hölderlin zerbrach, unterscheidet die beiden Dichter, den Namenspatron und den Geehrten. Sie erfahren Pathos, die Fallhöhe, den Höhenunterschied zwischen Ersehntem und Realitäten jeweils ganz anders, obwohl sie doch beide Pathetiker sind. Friedrich Hölderlin erlaubt sich ein letztes Mal, persönliches Leid auszusprechen in dem Gedicht „Hälfte des Lebens“, das er, wie Peter Szondi gezeigt hat, gewissermaßen abzweigt und ausscheidet aus der Arbeit an einer Hymne, in der er nur noch rein Mund des Göttlichen sein will und den hohen Ton nicht mehr verunreinigen darf durch schlecht Persönliches. Das Pathos entstammt dem Ausschluß des Persönlichen zugunsten des Göttlichen, das allein er singen darf. Jandl aber hat nichts anderes als das Persönliche; er ist geschlagen damit, das Leben und sich selbst obendrein als kosmischen Fehlschlag wahrzunehmen, als ,beyond repair‘, als kläglich. Und deshalb ist er in allem Ernst hauptsächlich damit beschäftigt, Späße darüber zu machen, daß es nichts zu lachen gibt, Faxen darüber zu machen, daß es keinen Grund gibt, Faxen zu machen. Ernst Jandl betrachtet unser Leben als per se pathetisch, er braucht gar keine sonderliche Fallhöhe, es genügt schon das schmerzhafte Dauergefühl, daß auch er Größeres gewollt habe und das Leben verdammt noch mal ihn niederzwingt und daß wir ein Witz sind, und zwar ein ziemlich schlechter, ein Kalauer, und daß die Idee doch eher herzig ist, daß da mit Humor was zu machen sei… Aber mit Komik ist dann doch was zu machen, die kann Jandl jedenfalls nicht unterdrücken; sie ist fast synonym, mit seiner Vitalität. Er hat ja gar keinen Humor, aber er hat ein ununterdrückbares Sensorium dafür, daß es komisch ist, daß wir uns dauernd gerne beklagen möchten darüber, daß es uns so schlecht geht, daß wir wahrhaft transzendental obdachlos sind, und dabei gibt es keine Instanz, die sich dafür interessiert, außer uns selbst und einige Leser. Ernst Jandl weiß als Dichter, daß es kein Prädikat der Wahrheit ist, angenehm zu sein, sondern: wahr zu sein, und daher sind manche Einblicke, die er in die condition humaine getan hat und von denen er mit rücksichtslosem Ingrimm in seinen Gedichten spricht, auch nicht bei jeder Gelegenheit erbaulich und die Stimmung hebend zu zitieren. Er befindet sich damit in gar nicht so übler Gesellschaft, hat doch sogar Goethe das vielgepriesene Leben ein „höchst zweifelhaftes Geschenk“ genannt und es als – ironischerweise am Ende des „Römischen Carneval“ – „im Ganzen unübersehlich, ungenießbar, ja bedenklich“ apostrophiert. Ernst Jandl ist dazu verdammt, in keinem Moment dies „Zweideutige“ unserer Existenz vergessen zu können, und dennoch scheut er feinsinnige Formulierungen hierfür. Seine Trockenheit macht ihn groß; er konstatiert respektvoll, daß etwas für Friederike Mayröcker so ist und für ihn nicht:
Friederike Mayröcker nennt den, oder einen heiligen geist die quelle ihrer inspiration; es gibt, für sie, in ihrer kunst etwas, das von außen kommt, und zwar von oben, während ich nicht sicher bin, wo oben ist.
Ein solcher Mensch wird natürlich – einmal vom verschiedenen Epochengeist abgesehen – nie sagen können: „… und wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen“; der sagt vielmehr barsch:
Wenn ich schon dazu verdammt bin, hier als Mensch zu vegetieren, dann möchte ich mich aktiv mit Kunst beschäftigen.
Das tut er nun seit fast 50 Jahren, und er hat dabei systematisch und programmatisch auch das Unauffälligste, das Banalste, das Unedle, die verachtete Kleinigkeit vom nebensächlichen Gegenstand über das Gebrechen bis zum einzelnen Buchstaben ästetisch geadelt, zum Träger von Bedeutung gemacht, wie Joyce ein weggeworfenes Papier und eine verschrumpelte Kartoffel in Blooms Hosentasche; in diesem Punkt sind der Ire und unser Wiener ganz unhierarchisch, ganz diesseitig und menschennah und emphatisch profan. Treffend für Prinzipiell seines gesamten Werkes ist ein Satz, den er bedächtig für das Hörspiel Das Röcheln der Mona Lisa formuliert hat: „Es sollen Dinge eintreten, die nicht erwartet wurden, und womöglich in ununterbrochener Folge.“ Ja, und das passierte quer durch sein Werk: Er hat sich nicht auf Gekonntem und Errungenem ausgeruht, hat aus keinem Verfahren eine Masche werden lassen, hat aus keinem Verfahren einen ganzen Band ausgewalzt und uns vor drei Jahren noch einmal etwas serviert, dessen wir uns nicht gewärtig waren: „Stanzen“ nämlich. Einen Moment dachte ich, jetzt greift er doch auf klassisch edle Ottaverime zurück, jetzt kommen vielleicht feierliche Achtzeiler, aber dann atmete der Münchner in mir erleichtert auf: Ach so, Schnaderhüpferln hat er gedichtet, laut Wilperts Sachwörterbuch der Literatur „bei den Alpenbewohnern (Österreich, Bayern, Schweiz) verbreiteter, lustig-derber Vierzeiler oft fordernden, neckenden oder erotisch-satirischen Inhalts, epigrammartiges, übermütiges Stegreifliedchen.“ So, wie Ernst Jandl dies Genre „erotisch-satirischen Inhalts“ handhabt, kann man wohl von der Inbeschlagnahme des Gschtanzels für die dichterische Altersradikalität sprechen: Leisetreterei gibt es hier nicht, lieber eine Grobheit mehr als ein weniger in diesen vierzeiligen Ohrfeigen für den guten Geschmack, angesiedelt zwischen Stanzen, Nestroyschen Couplets und Rap-Texten. Das kommt davon wenn ein Dichter sich stur und ungezähmt an seine Maxime hält, die da lautet „Ich bin überzeugt, daß die Entwicklung, Entdeckung oder Erfindung neuer Arten zu dichten heute notwendig ist.“ Wenn wir als Liebhaber der Literatur daran nicht festhielten, erst dann wären wir verloren. Und daher also:
My heart leaps up when I behold:
Jandl in the sky with Hölderlin.
Jörg Drews, neue deutsche literatur, Heft 503, September/Oktober 1995
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Zum 70. Geburtstag von Ernst Jandl
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag von Ernst Jandl:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag von Ernst Jandl:
Zum 20. Todestag von Ernst Jandl:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


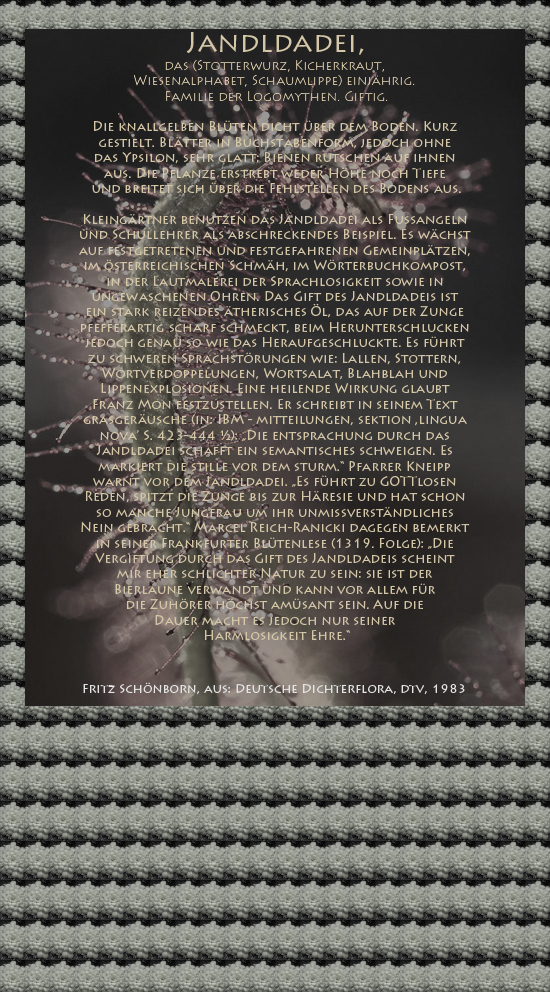












Schreibe einen Kommentar