Jürgen Becker: Scheunen im Gelände
INFORMATIONSSTAND
Man weiß es noch nicht. Sonst könnte man
anfangen. Die kleinen Bilder hängen, die größeren
lehnen an der Wand. Fahren kann die Straßenbahn,
die Hauptstraßen sind geräumt. Es gibt
eine Mehrheit, auch wenn noch einige Stimmen fehlen.
Körbe voller Geschirr. Obschon sie verlängert worden sind,
die Pässe will keiner mehr sehen. Schneereste oben
im Bergland; dort blüht es immer zwei Wochen
später. Kranichzüge sind unterwegs. Der Taxifahrer
weiß auch nicht, was los ist. Das Augenmaß stimmt;
das haben bestätigt Wasserwaage und Zollstock. Also,
was sagen wir den Reportern? Die Unterlagen liegen
auf dem Tisch. Kaugummi für die Kinder.
Die Mannschaftswagen halten sich zurück. Einige
frühstücken noch. Sag es, wenn du Bescheid weißt.
Nachwort
„Der eigene Ton“, heißt es in Hugo von Hofmannsthals Vortrag „Poesie und Leben“, „ist alles; wer den nicht hält, begibt sich der inneren Freiheit, die erst das Werk möglich machen kann. Der Mutigste und der Stärkste ist der, der seine Worte am freiesten zu stellen vermag; denn es ist nichts so schwer, als sie aus ihren festen, falschen Verbindungen zu reißen. Eine neue und kühne Verbindung von Worten ist das wundervollste Geschenk für die Seele…“
Man mag den Ton dieser emphatischen Feststellung von 1896 für veraltet halten, an der Sache – dafür ist Jürgen Beckers Werk ein herausragendes Beispiel – hat sich nichts geändert. Seit vierzig Jahren veröffentlicht er in erstaunlicher Regelmäßigkeit Gedichtbände, die sich, zusammengenommen, zu einer poetischen Lebensmelodie fügen, wie sie klarer und eindrucksvoller kein anderer deutscher Dichter seiner Generation entwickelt hat.
Auch wenn der Radius seiner Beobachtungen kleiner geworden ist, sie selber haben nichts von ihrer dringlichen Genauigkeit verloren. Wo er früher mühelos die Grenzen übersprang, konzentriert er sich heute auf das Naheliegende, als wollte er es in seiner Flüchtigkeit festhalten. Der rasanten Veränderung der Welt hält er trotzig sein stilles Bild der Welt entgegen. Wenn seine Gedichte sich dennoch nicht zu einem System fügen, zu einer bündigen Aussage über die Welt zwischen Vorkrieg und Nachkrieg, zwischen faschistischem Terror und republikanischer Friedfertigkeit, zwischen Festigkeit und Auflösung, so ist ihnen das hoch anzurechnen und gutzuschreiben. Sie bleiben über die Jahre hinweg offen. Die Suche nach dem eigenen Ton, der ganz eigenen dichterischen Stimme, die fester und verläßlicher ist als die Dinge der Realität, die bald wieder im Strudel der Zeit verschwinden, ist allen dichterischen Werken Jürgen Beckers eingeschrieben. Seine Zeilen triumphieren nicht; sie machen einen weiten Bogen um die großen Worte, wie es sich für eine Suchenden geziemt. Jürgen Beckers leiser Stimme zuzuhören, ist tatsächlich ein „Geschenk für die Seele“.
Der Stil, den Jürgen Becker gefunden hat, hilft ihm, die prinzipielle Unlesbarkeit der Welt, ihre Paradoxien und Brüche, aufzuhellen. Daß sein Ton eine melancholische Grundierung hat, kann nur den erstaunen, der mit geschlossenen Augen oder mit einem Sehfehler durch die Welt geht. Die heitere Grille, die auf alles einen Reim findet und darauf noch stolz ist, kann bei ihm nicht gefunden werden. Um die Welt, in die man hineingeboren wird, überhaupt verständlich zu machen, um das Detail mit dem Ganzen, das eigene Leben mit dem Leben der anderen in eine halbwegs tragfähige Beziehung zu setzen, braucht es eine hohe Kunst. Jürgen Becker hat eine parataktische Methode entwickelt, die es ihm erlaubt, auf den ersten Blick weit auseinanderliegende Beobachtungen auf kleinstem Raum zu versammeln. So entstehen die zwischen geschichtlicher Erfahrung und gegenwärtiger Zumutung angesiedelten Texte, die zunächst nichts beweisen, sondern auf etwas hinweisen:
Die Pappeln flirren im schwindenden Licht, und man
spürt den Abschied von etwas, das noch nicht da ist.
Mit solchen in sich verkapselten Ahnungen ist kein geschichtsphilosophischer Blumentopf zu gewinnen; man muß tiefer graben, um an die Wurzeln dieses poetischen Denkens zu kommen.
Jürgen Becker hat stets der Versuchung widerstanden, brillieren zu wollen. Die große, Beifall heischende Geste ist ihm so fremd wie falsche Geheimnistuerei. „Man weiß nicht, wie das Mögliche aussieht“, heißt es einmal in diesem Buch. Oder:
… nie weiß man,
was die nächste Minute vorhat und was, wenn sie vorüber ist, man sagen wird.
Oder:
Du weißt nur, irgend etwas fehlt.
Was ist es, das verloren gegangen ist, was fehlt? Der unprätentiöse, nie belehrende Ton, die Abwesenheit aller seherischen Attitüden machen auf beklemmende Weise deutlich, welche Verluste wir hingenommen haben, hinnehmen mußten, um sogar das Mögliche zu verfehlen.
Man sollte diese melancholischen Gedichte (mit den Bildern seiner Frau Rango Bohne) getrost wie ein berührendes Geschenk annehmen, das uns Jürgen Becker zu seinem 80. Geburtstag gemacht hat.
Danke, lieber Jürgen!
Michael Krüger, Nachwort
Beiträge zu diesem Buch:
Tobias Roth: Gleich welche Jahreszeit
fixpoetry.com, 23.8.2012
Scheunen im Gelände – Vorstellung eines neuen ‚Blauen Buches‘ des Lyrik Kabinetts: Jürgen Becker liest aus Anlass seines 80. Geburtstags am 25.7.2012 im Lyrik Kabinett mit Michael Krüger und Joachim Sartorius.
Zeitzeuge im Schnee
– Randnotizen zu Jürgen Beckers Lyrik. –
Jürgen Becker ist besessen von Schnee. Seine Lyrik kann wie ein Wörterbuch des Schnees gelesen werden. Die Gedichte sind, um eine winzige Auswahl zu bieten, durchzogen von Schneefall, Schneeregen, Schneegestöber, Schneeästen, Schneehemden, von wildem Schnee und stillem Schnee, von Schnee, der geschaufelt, und Schnee, der von der Sonne weggeschmolzen wird, von Schneemännern und Schneeresten, von Augustschnee, von Schnee, der bis nach Japan fällt, Schnee, der kommt, der tanzt und der verschwindet. Wenn die Motivik auch schon in den frühen Experimenten der Gattungsentgrenzungen und -verschränkungen zu finden ist, etwa in Felder (1964) und Ränder (1968), für seine Lyrik spricht Becker ihr die Bedeutung einer programmatischen Chiffre zu indem er seinen ersten Gedichtband, der 1971 in der LCB-Edition erschien Schnee betitelt. Beckers Lyrik, so kann man den Befund deuten, entstammt dem Schnee, er schreibt Schneegedichte. Das gilt nicht nur in dem augenfälligen Sinn, daß immer wieder „weiße Inseln“ in der lyrischen Bildwelt Beckers, bis in die jüngsten Bände Dorfrand mit Tankstelle (2007) und Scheunen im Gelände (2012), auftauchen und sie strukturieren. Wenn Becker von Schnee spricht, verweist das auch auf die Entdeckungen, Erkundungen und Verknüpfungen, die seinen Gedichten als poetologisches Bewegungsmuster unterlegt sind.
Schnee verhüllt und zeigt. Schnee verbirgt bis zur Verfinsterung und kann so gleißend blenden, daß das Auge nicht mehr sieht. Sind das Extreme, denen der alltägliche Blick kaum ausgesetzt ist, so zeigen sie das Wechselspiel, das unsere Wahrnehmung mit Schnee verbindet: Schneefall verbirgt, Schneeschmelze enthüllt. Das bildet das Doppelgesicht eines epiphanischen Umschlags, der beides, das Verbergen und das Offenbaren, in sich einbegreift. Wer Schnee beobachtet, kann sich von dem schieren Weiß anziehen lassen, er kann das Auge aber auch auf die Ränder des Schnees richten und wird genauer und mehr sehen an der Nahtstelle wo der Schnee sich zurückzieht und anderes freigibt. Im Frühjahr überziehen schmelzende Schneereste, ein langsam schwindendes Raster, den unbearbeiteten, aufgeweichten Acker. Durch das weiße Schlierennetz glänzt die nackte Erde hervor. Das Sonnenlicht ist hart und hell, als sei es noch kalt, es blendet. Das ist die Zeit der dunklen Farben. Was im Sommer nur braun sein mag, entfaltet sich jetzt im Schnee, der sich zurückzieht, als Farbpalette, die von Fastschwarz über Rostbraun und Olivgrün bis ins Saphirblaue schillert. Was unter dem Schnee verborgen war, setzt ebenso unscheinbare wie dramatische Akzente. Der Schnee, der sich zurückzieht, löst optische Spektakel aus.
Hier nimmt Beckers Lyrik ihren Anfang. „Was geschieht, wenn/ der Schneerest freigibt die Wiese – / Die Krokusse zögern; die gelben zögern / am längsten (…)“, heißt es im „Gruß nach Frankfurt“ aus dem Band Odenthals Küste (1986). Der genaue Blick auf das Phänomen des Schnees, das Widerspiel von Verbergen und Enthüllen, löst die Benennung aus, bringt das Gedicht langsam, „zögernd“, verbal in Gang. Beckers Lyrik geht aus vom Sichtbaren, das sich zeigt, weil es „freigegeben“ wird. Das wird ins Wort, ins Bild gesetzt und mit anderen Partialaufnahmen verbunden. Beckers Gedichte, seien es die kurzen Moments musicaux oder die weiträumigen Erzähltableaus, bilden sich, indem sie Wahrnehmungsmomente verknüpfen und in vieldeutige Beziehungen setzen. Was weiß bleibt, spricht aber mit. Beckers Gedichte sind Bilder mit „fehlenden Resten“ – das, was gesehen und gesagt wird, bleibt überzogen von einem Netzmuster des verbergenden Weiß. Beckers Lyrik erweckt daher, wie oft bemerkt wurde, den Eindruck von Gemälden oder Zeichnungen, bei denen das Weiße der Leinwand, des Papiers an vielen Stellen sichtbar bleibt oder durchscheint. Sie verweist durch ihre freien Flächen auf den Grund, dem sie sich verdankt und der Möglichkeiten für Bilder bietet, wie ein Gedicht Beckers aus dem Band Erzähl mir nichts vom Krieg (1977) heißt. Im Gedicht „Eine Zeit ohne Skrupel“ aus dem Band Scheunen im Gelände hebt Becker die Hintergrunderfahrung des Weißen in die vordergründige Szenerie eines Vierzeilers:
Der Waldrand steht still.
Still liegen die Felder,
So sieht es aus.
So könnte man es sagen.
„Der Anblick / eines leer gelassenen Felds“, wie ein paar Zeilen aus dem Gedicht „Mielenforster Wiesen“ lauten, „und das Wiederfinden / des leer geräumten Schrott-Modells“ sind Komplemente; erst vor dem Weiß, in der Leere, im stillen Feld zeigt sich, was das sprechende Ich entdeckt.
Die ersten Worte von Beckers Gedichten sind polymorph, Kapseln, Codes für Unbekanntes. Sie enthalten den Beginn von etwas, von dem der Leser noch nicht wissen kann, wohin es sich bewegt, ausstülpt, weiterschreibt. Die Sprachbewegung könnte verschiedene, ja widerstrebende Richtungen nehmen, weil das Unbestimmte des weißen Hintergrunds mitgenommen wird in die erste Benennung. Daß Beckers Gedichte unvorhersehbar sind, ist nicht trivial. Auch wenn das Gedicht das Medium des Überraschenden par excellence ist, in Beckers Lyrik wendet sich die Kategorie ins generierend Grundsätzliche, weil die Relationspotentiale unbegrenzt sind, jedes mit jedem in Beziehung gesetzt werden könnte. Ihr Gestus ist die Überraschung. Seine Lyrik verbindet, was auf den ersten Blick weit auseinander liegt, was getrennt scheint durch die weißen Inseln. Sie bringt mit jedem Muster, das durch die Erzählung geknüpft wird, etwas Unerwartetes in den Blick. Ihre Konstante liegt nicht in einem Metrum, einem Motiv, einer Szene oder im rhetorischen Räsonnement sondern in den Wendungen der Wahrnehmung, die sich zur Erzählung des Gedichts summieren. Im Gedicht „Solonummer“ aus dem Band Scheunen im Gelände hat Becker seinem lyrischen Verfahren eine ironische, selbstreferentielle Hommage gewidmet:
… der Anruf
kommt, wenn er kommt, unerwartet; dann
stehst du gerade unter der Dusche oder verfolgst
das Elfmeterschießen; nie weiß man,
was die nächste Minute vorhat und was,
wenn sie vorüber ist, man sagen wird.
Eine typische Becker-Volte: durch die unauffällige Konjunktion wird selbst das Duschen zu einem prekären Akt, von dem man nicht wissen kann, wie er ausgeht.
Beckers lyrische Kombinatorik kann alles zum Gegenstand werden lassen, wenn es in die Erzählung des Gedichts gerät. Seine Lyrik ist gegenständliche Poesie. Die Gedichte gehen nicht nur von dem aus, was als Detail, Gestalt, Objekt wahrgenommen wird, sie ziehen auch alle Wörter und Konstellationen, die auf die Innenwelt, auf memoria, voluntas und intellectus eines Subjekts verweisen könnten, in die Äußerlichkeit des Gegenständlichen. Was gesagt werden kann, bedeutet gleich viel, weil es im Gedicht als oder wie Gegenständliches gesehen und behandelt wird. Blaue Wiesen, Frost, ein Gedanke, längeres Leben, Anwälte, Telefone, der Himmel, härtester Frieden, Winter, der Horizont – die Nomina beziehen sich nicht auf verschiedene „Welten“, lassen sich nicht in eine Objekt- und eine Subjektzone dividieren, sondern bilden gemeinsam den einen Gegenstandsraum des Gedichts:
Blaue Wiesen hinterläßt der Frost Schon
mittags ist zersprungen der Gedanke an
längeres Leben Die Telefone sind heiß und
die Anwälte keuchen Gläserne Kuppeln
ersetzen produktionsbedingt den Himmel
Im Winter im härtesten Frieden
wird es hinterm Horizont nicht still
so lautet ein Gläsernes Gebäude aus Odenthals Küste. Wollte man den Befund philosophisch deuten, könnte man sagen, Beckers Gedichte verzichten darauf der Innerlichkeit des Subjekts einen besonderen Status zuzubilligen: Innenwelt und Außenwelt bilden eine einzige, gegenständlich gesehene Welt. Wollte man die Diagnose soziologisch werten, könnte man versucht sein, seine Nominaparataxe als egalitär zu bezeichnen: Als Wort wird alles gleich. Daß beide Pointen nicht abwegig sind, wird in einem Vergleich deutlich, der zunächst nicht naheliegt, der aber im Kontrast Beckers Verfahren erhellt. Rainer Maria Rilke hat in seinem kleinen Gedicht „Ach, nicht getrennt sein“ für das lyrische Subjekt an den Sternen Maßgenommen und das „Innre“ zum „gesteigerten Himmel“ aufgeladen, „durchworfen mit Vögeln und tief / von Winden der Heimkehr“. Die Innenwelt eines Subjekts wird hier lyrisch so potenziert, daß sie die gegenständliche Außenwelt asymmetrisch überbieten und gleichsam in sich aufsaugen kann. In Beckers Lyrik werden beide Bewegungen umgekehrt. Entwirft Rilke einen „Weltinnenraum“, so kartographiert Becker mit seiner Lyrik einen „Weltaußenraum“. Indem seine Gedichte Referenzen auf Innerlichkeit sprachlich genauso behandeln wie Details und Dinge der gegenständlichen Welt, ziehen sie die Äußerungen von Erinnerung und Phantasie, Wille und Vernunft in den einen Raum des Gedichts, in dem alles in gleicher Weise gültig ist. Segmentierungen und Systemabgrenzungen, Hirarchien und gesonderte Gebiete gibt es in Beckers Lyrik nicht. In der Erzählung des Gedichts herrscht Gleichheit vor dem Wort: „das Herz“, „das überleben des Todes“, „die Wünsche“, das zählt nicht mehr und nicht weniger als der „erste Zungenkuß“, „Mutmaßungen im Nebel“, „Rübenkrautzeit“. Denn es gilt:
man sieht nicht den Unterschied zwischen
Schutzengel, Attentäter, Kontrolle. („Vorbereitungen im Herbst“).
Daß Beckers poetischer Kombinationskunst des Gegenständlichen in all seinen Gedichten Figuren der Selbstbezüglichkeit eingeschrieben sind, steht dazu nicht in Widerspruch. Seine Lyrik erfährt ihren Initialimpuls dadurch, daß in der Sprache Realia auf ein lyrisches Ich treffen, das Züge eines realen Subjekts hat. Auch diese Eigenart seiner Poesie hat Becker im Gedicht formuliert. Das Thema seiner Lyrik sind, wie es im „Gedicht für einen Satz im Konjunktiv“ heißt, „Dinge in der Phantasie“. Beckers Gedichte setzen ein bei dem, was sich in der Welt zeigt, und sie verbleiben in den Grenzen, die die Erfahrung der Welt zieht. Auch wenn das ästhetisch unmöglich ist, weil sie ohne Fiktion keine Kunstwerke wären – Beckers Gedichte wirken immer imaginär, aber nie fiktiv. Das gibt ihnen den Anschein, alltäglich zu klingen, von vertrauten Bewußtseinszuständen zu sprechen. Beckers Lyrik ist alles fremd, was irreal oder surreal, hermetisch oder absurd genannt werden könnte. Eine erfundene Landschaft wie Sarmatien, Metaphern wie „Niemandsrosen“ oder „Fadensonnen“, ein Einhorn, das fortgeht und im „Gedächtnis der Wälder“ ruht, oder ein Graureiher, der ein sprachliches Eigenleben beginnt, sind in Beckers Gedichten kaum vorstellbar. Wie jede realistische Kunst ist seine Lyrik hungrig nach Stoff, gefräßig, unersättlich. Sie kann sich, im Medium des Erzählens, alles einverleiben, was in den Umkreis der Wahrnehmung gerät. Sie verwendet, ohne zu verwandeln, ihr Konsum ist Reproduktion. Ihr Furor speist sich aus dem Benennen und Verknüpfen – als erwache fortlaufend jemand in einem Paradies, vor lauter Epiphanien gestellt, „daß er sähe, wie er sie nennte“ (Genesis 2,19). Ihre formative Kraft als Kunstwerke aber beziehen die Gedichte, wie es Marcel Beyer nachgezeichnet hat, daraus, daß an die Stelle der Grenze der realen Welt die nicht überschritten wird, ein hellwaches, selbstbezügliches lyrisches Ich tritt. Es spricht als Bewußtsein, das weiß, daß es poetisch rezeptiv und produktiv tätig ist. Es bringt sich ins Spiel, indem es sich selbst und seine poetischen Vollzüge im Verlauf des Gedichts thematisch macht. Jürgen Becker schreibt Bewußtseinslyrik – in dem Sinn, daß die Gedichte ein reales Bewußtsein abbilden, das sich sprachlich in der Welt orientiert und vergewissert.
Das zeigt sich daran, wie Becker seine lyrischen Bildwelten entfaltet und aufbaut. Wenn sich in seinen Gedichten auch vereinzelt klassische Genitivmetaphern finden, kennzeichnend ist ein anderer Bildgebrauch. Wie Becker Bilder aufnimmt, assoziiert und zur leitenden Struktur seines Gedichtes macht und wie er in diesem Akt und seinem Ergebnis das lyrische Bewußtsein sprechen läßt, ist an einem Gedicht ablesbar wie „Mittags-Geräusch“ aus dem Band Das Ende der Landschaftsmalerei (1974):
MITTAGS-GERÄUSCH
Riesig die Fliegen; eine Art Offensive
im Sommer
aaaaaaaaaaaa(einmal,
Stille und Hitze,
im Gasthof im Dorf im August,
erinnerte mich
das schwere Gesumm an das schwere Gesumm
in einer Küche im Dorf im August,
und es war,
in der Stille und Hitze,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauf einmal
das Summen der Bomber
aus dem Raum Hannover-Braunschweig)
und ich lobe
aaaaaaaaaaajetzt
den Panzer des Kühlschranks.
Das Summen riesiger Fliegen weckt eine erste Erinnerung „an das schwere Gesumm“ in einem „Gasthof im Dorf im August“, das damals seinerseits „an das schwere Gesumm / in einer Küche im Dorf im August“ erinnerte: und wie sich in beiden Erinnerungen „das Summen der Bomber“ assoziativ einstellt, so wird es in der Erinnerung an die Erinnerung auch „jetzt“, in der Gegenwart des Sprechers präsent. Der Effekt der zeitlichen Durchlässigkeit des Bildes, das aus der Wahrnehmung des Fliegensummens entsteht, ist eine für Beckers Lyrik typische Form der reflektiven Mehrstelligkeit. Durch das auffallende, zweideutige Geräusch wird das Bewußtsein des lyrischen Ich geweckt. Indem es ausspricht, daß es in die Erinnerung an eine Erinnerung gerät, verbindet es verschiedene Räume und Zeiten zum Gedicht. Was in „Mittags-Geräusch“ in seiner lyrischen Scharnierfunktion erkennbar ist, die Verbindung einer Bildtransposition mit der Selbstreflexivität des Sprechers, erhellt, wie Beckers Lyrik durch Subjektivität grundiert ist. Seine Gedichte können, durchgehend, als der poetische Vollzug eines Verhältnisses gelesen werden, das sich im Medium der sprachlichen Wahrnehmung zu sich selbst verhält. Auch wenn man, Dieter Henrich folgend, annimmt, daß Kunst in all ihren Gattungen und deren Ausprägungen unentrinnbar die Distanzverläufe von Subjektivität abbildet, zum unverwechselbaren Gesicht von Beckers Lyrik gehört, wie er in seinen Gedichten den konkreten Vollzug von Subjektivität durchscheinen läßt. Das erklärt den Eindruck, daß Becker an einem einzigen großen Gedicht schreibt, daß seine Lyrik ein zusammenhängender Prozeß, ein unablässiger Strom ist. Flüssig und in Bewegung gehalten wird sein poetisches work in progress dadurch, daß es seine Energie aus Variablen zieht.
In Beckers Gedichten fungieren die Dinge und Details nicht als Metapher oder Symbol für anderes. „Zwiebelmuster-Tassen / in der schrägen Sonne“ verweisen nicht auf Drittes, sie mögen zwar einen epiphanischen Charakter haben – sieh, wie überraschend, wie eigen, wie schön sich das darstellt! –, sind aber auch im Gedicht nichts anderes als Tassen in der Sonne. Was das lyrische Subjekt wahrnimmt und in seine Bilderzählungen integriert, bekommt keinen neuen, überschüssigen Sinn. Beckers Gedichte wirken daher, als sei die Welt grundsätzlich lesbar, sie sind bei der ersten Lektüre auf freundlich unkomplizierte Weise zugänglich. Keine Form spielt sich als Selbstzweck in den Vordergrund. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die visuelle Eindeutigkeit nur das Material für die beziehungsreiche Bildwelt bereitstellt, die Beckers Lyrik ihre prägnante Signatur gibt. Denn in seinen Gedichten geraten die Wahrnehmungen, die Wörter, die Bilder in eine Erzählung mit eigenem Ton, in Kraftfelder des Fluiden, in die Vieldeutigkeit von Variationen.
Was fest gefügt, klar umrissen, eindeutig scheint, bleibt es nicht. „Das Wolkenbild ist nur augenblicklich. Hinschauen / wegschauen“, heißt es in dem wunderbaren Erzählgedicht „Was man uns sagte“ aus dem Band Scheunen im Gelände. Beim erneuten Hinsehen hat sich das Bild gewandelt, es „gleicht jetzt einer Herde, die sich / langsam über den Horizont bewegt.“ Der Sprecher weiß, daß auch das nur eine vorübergehende Gestalt ist:
Das Wolkenbild, eine wellige Fläche, die sich
fortwährend variiert.
Beckers Gedichte sind durchzogen von solchen Bildvariationen – was wahrgenommen wird, verweist auf nichts anderes, aber es zeigt sich immer anders. Becker sagt es so:
Sicher, Hügel sind
Hügel. Die Schatten der Wolken entwerfen eine Topographie
die sich, bis abends, fortwährend ändert.
Daß die Wahrnehmungen, Wörter und Bilder nur im Modus der Variation zur Sprache kommen können, im Bewußtsein, daß sie flüchtig und veränderbar sind, findet seine Entsprechung darin, daß Beckers Gedichte sich als Folgen situativer Wechsel darstellen. Nicht nur was wahrgenommen wird, auch die Perspektive des Betrachters verändert sich fortlaufend. Das lyrische Bewußtsein findet sich in einem Strom von Situationen, aus verschiedenen Zeiten, die sich ständig verändern und ablösen, mal in weichem Übergang, mal durch einen harten Schnitt. Eine Situation kann wenige Worte währen oder ganze Strophenblöcke umfassen, immer aber treibt das lyrische Ich weiter durch verschiedene Perspektiven und Formationen, neue oder alte, die in der Wiederholung neu werden. Der Strom der Bilder, Wörter, Situationen ist sein Element. Das Gedicht hält alles in Kopräsenz, wie das Bewußtsein selbst. Ist im Bewußtsein die Intention immer auf etwas Bestimmtes fokussiert hinter dem das andere in Felder des Vagen zurücktritt und an den Rändern ausfranst, so bildet Beckers Gedicht dieses Wechselspiel von Latenz und zielgerichteter Aufmerksamkeit ab – der Leser gerät buchstäblich in eine Bewußtseinswelt, in der seine Konzentration auf einen bestimmten Satz eine Strophe gerichtet ist, vor der sich die anderen Teile des Gedichts wie im Bewußtsein, zurückziehen, ohne zu verschwinden.
Wer in Beckers Gedichten spricht, kann deshalb nicht anders, als seine Worte und Sätze fortlaufend relativieren. Alles Assertorische ist ihm suspekt. Beckers lyrisches Ich ahnt, wartet, mutmaßt, zweifelt, zögert, ist in seinen Wahrnehmungen und Erkundungen Verben unterworfen wie „vermuten, tasten, entdecken, verlieren“ („Gedicht für einen Satz im Konjunktiv“). Wer spricht im Fluß der Phänomene, im Wechsel der Situationen, der weiß mit heiterer Resignation:
So war es, wie du erzählst, aber dann
sagtest du: alles war anders. Was
macht es aus… („Die Spuren des wiedergefundenen Heimwegs“).
Durch den Gestus des anerkannten Nichtwissens, der basalen Wahrnehmungsskepsis macht Becker im Gedicht deutlich, daß es sich dem grundierenden Weiß und seinen unverfügbaren Epiphanien verdankt:
weiße Flächen berühren den Waldrand
dahinter beginnt wovon man nichts weiß.
Seine Lyrik kennt die Spielräume der Möglichkeiten, sie lotet aus, was der Fall hätte sein können, aber ihr Grundzug ist deliberativ. Sie setzt das, was sie sagt, einem ständigen Rückfragen und Nachfragen, Abwägen und Bedenken aus, ohne zu einem Abschluß zu kommen:
Wer nicht
glaubt, daß er einen Schutzengel hat, fährt besser mit
der Straßenbahn; sie fährt hin und her
zwischen zwei Endstationen („Was man uns sagte“).
Man kann nicht von seinem Bewußtsein, seiner Subjektivität sprechen, ohne sich in der eigenen Geschichte wiederzufinden. Beckers lyrisches Ich erzählt von sich, indem es seine Geschichte erforscht und entwirft, die private, persönliche wie die große Historie. Beides verbindet sich zu dem, was man Zeitgeschichte nennen kann. Ungeachtet der aktuellen, kaum überschaubaren Debatten, die in der Geschichtswissenschaft zu diesem Begriff geführt werden, ist es für das Verständnis von Beckers Lyrik hilfreich, an eine Programmschrift der deutschen Diskussion zu erinnern. 1953, im Jahr, als Becker Abitur machte, erschien in der ersten Nummer der neu gegründeten Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte zum Auftakt der Essay „Zeitgeschichte als Aufgabe“ von Hans Rothfels (1891–1976). Nach einer grundsätzlichen Problematisierung des Begriffs schlägt Rothfels vor, unter Zeitgeschichte „die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung“ zu verstehen. Wer Zeitgeschichte erforsche und schreibe, stehe unter dem Eindruck eines „spezifischen Betroffensein(s) durch die Geschichte“. Das „eigene Betroffensein“, „die Situation des Mitlebens“ sei das entscheidende Spezifikum von Zeitgeschichte, das sie abgrenze von der Erforschung anderer Epochen. Zeitgeschichte hat also einen moving wall, der sich daran bemißt, ob es noch Zeitzeugen gibt, die die historiographische Aufgabe des „Sichhineinversetzens in die Lage der Handelnden wie der Leidenden“ erleichtern. Rothfels’ Beschreibung trifft präzise auf die Perspektive zu, aus der Becker sein lyrisches Ich sprechen läßt, wenn es neben und mit seiner eigenen Geschichte die Ereignisse, Personen, Konstellationen der verschiedenen Erzählungen thematisiert, die die Historie bilden. Im Gedicht benannt und erwogen wird nur, was im Radius eines möglichen historischen Erlebens liegt, was sich als konkrete Geschichte in der Situation des zeitgenössischen Sprechers spiegelt oder spiegeln könnte. Der historische Autor Jürgen Becker und das lyrische Ich in seinen Gedichten sind in dem Maß kongruent, wie das Gedicht sich auf Zeitgeschichte bezieht. Er läßt sein lyrisches Alter Ego im Gedicht aussprechen, was er, der Autor, durch „die Situation des Mitlebens“, das „eigene Betroffensein“ bezeugen könnte. Becker, so sieht es aus, hat kein Interesse daran, sein lyrisches Ich auf Distanz zu halten. Daß er in seiner Lyrik zeitgeschichtlich spricht, kassiert den Unterschied von Autor und Sprecher.
Daß die Zeitzeugenschaft des historischen Autors das lyrische Ich imprägniert, gibt den Gedichten die Aura des Realen. Sie lesen sich wie ein Tagebuch, eine fortlaufende Inventur, die Bestandsaufnahme eines ebenso privaten wie politischen Lebens. Darum spielt die Figur des Zeitzeugen eine so wichtige Rolle in Beckers Lyrik. Denn im „Zeitzeugen“ treffen sich der Autor und sein poetisches Alter Ego.
Straßenszenen zum Nacherzählen. Zeitzeugen treten auf,
sie sind dabeigewesen einige als Kinder. Sie sprechen
erst jetzt, jahrzehntelang sind sie stumm geblieben.
Becker erfindet nicht ein lyrisches Ich, das, außerhalb der Reichweite seiner eigenen Geschichte, historisch bedeutungsvoll plaziert wird – römische Kaiserzeit, italienische Renaissance, Erster Weltkrieg –, sondern er läßt ein lyrisches Bewußtsein sprechen, dessen Geschichte und Verflochtensein in die erzählte Historie durch die Zeitzeugenschaft des Autors verbürgt ist. Wenn man seine Gedichte, von Schnee bis zum jüngsten Band Scheunen im Gelände liest, kann man nachverfolgen, wie sich ein lyrisches Ich entwickelt und entwirft, das in die Zeitgeschichte involviert ist und bleibt. Der in Beckers Gedichten erzählt, kann gar nicht anders, als in der eigenen Geschichte auf andere Geschichten, die Historie zu treffen. In „Takes“ aus dem ersten Band Schnee heißt es, als habe hier einer seine poetologische Absichtserklärung formuliert:
so blieb nicht lange
unabhängig unsere Biographie
von der Biographie der Gesetze Umstände, Massen
und Bewegungen
und auch im Gedicht
bleibt die Vereinzelung
nicht Sache des einzelnen Sprechers
– die Sprache
der Umgebung dringt weiter und sickert
in jedes Gedächtnis
Liest man Beckers Gedichte als poetische Stationen der Zeitgeschichte wird der epiphanische Charakter des Schnees aus einem Schock erklärlich. Durch das Weiß zeigt sich der Schrecken. Denn der Schnee in den letzten Wintern des Zweiten Weltkrieges, in den ersten Wintern der Nachkriegszeit gibt für Becker den Blick frei auf Tote, Trümmer, Verheerungen, auf – so der Titel des Buches von Friedrich Meinecke – Die deutsche Katastrophe:
… im Schnee, nackt und gefesselt, lag
morgens, erfroren, der Junge; er hatte sich noch
vom Baum befreit, an den er gefesselt war, und
er kam bis zur Straße nach Much, wo
er winkte und schrie: es hielt keiner –
und wie denn, sagt jetzt einer, der nicht hielt,
hätten Sie’s denn gemacht allein
in der Kälte,
im Wald,
in der Nacht? („Takes“).
Beim Lesen von Beckers Gedichten habe ich oft den Gedanken gehabt, daß es am besten wäre, sie abzuschreiben oder zu kopieren, sie mit Nadeln auf Tafeln zu befestigen, die das Format von Bilderrahmen haben, und die auf einer großen weißen Wand aufzuhängen. Galeriephantasie. Man könnte die Tafeln nach Themen, Orten und Zeiten ordnen, unter Rubriken wie Erfurt 1939–1947, Küstenbilder, Amselvariationen, Kölner Bucht, Autobahnversuche, Berlingedichte. Auf manchen Tafeln hinge ein Gedicht, auf anderen mehrere. Die Tafeln könnte man umhängen, zu neuen Mustern arrangieren. Was man beim Lesen im Buch nur diachron wahrnehmen kann, würde auf der Wand mit den Tafeln wenigstens den Anschein des Synchronen erwecken. Ein frühes Erzählgedicht wie „Takes“, lang wie eine antike Papyrusrolle, ist von kleinen Snapshots aus dem späten Band Dorfrand mit Tankstelle umgeben; viele kurze Gedichte aus den Bänden von Schnee bis Scheunen im Gelände können auf einer Tafel zu einem neuen Erzähltableau collagiert werden, dessen Teile in verschiedene Richtungen, nach oben, nach unten, zur Seite gelesen werden; das Auge springt von rechts oben, wo auf einer Tafel ein Gläsernes Gebäude aus Odenthals Küste steht, über viele andere Gedichte nach unten, zu verschiedenen Passagen vom „Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft“ (1988), das sich am unteren Rand einer anderen Tafel in der Horizontalen erstreckt. Die weiße Wand, die Tafeln, die Zeilen, Strophen, Gedichtformationen – und die Möglichkeit unbegrenzter Muster von Bildwelten. Wie Gerhard Richter, sein Jahrgangsgenosse, arbeitet auch Jürgen Becker an seinem persönlichen „Atlas“, dem Atlas einer Biographie und der „Biographie einer Zeit“ („Das Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft IV“).
Henning Ziebritzki, Akzente, Heft 4, August 2014
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Heinrich Vormweg: Ein Poet in seinen Umgebungen
NRW literarisch, Heft 5, 1992
Walter Hinck: Vielleicht das letzte Glänzen: Sinfonien, Radiostimmen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.7.1992
Sabine Küchler: Die Entdeckung des „multiplen“ Ich
Der Tagesspiegel, 10.7.1992
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Wolfgang Schirmacher: Geräusche, Gerüche und Signale
Rheinische Post, 8.7.1997
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Armin Ayren: Die Wirklichkeit als Sprache
Stuttgarter Zeitung, 10.7.2002
Nico Bleutge: Erinnerungsreise
Süddeutsche Zeitung, 10.7.2002
Hannes Hintermeier: Der Landschaftsmaler
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.7.2002
Beatrix Langner: Selbstporträts mit dem Rücken zum Betrachter
Neue Zürcher Zeitung, 10.7.2002
Jochen Schimmang: Ockerfarben in Deutschland
Frankfurter Rundschau, 10.7.2002
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Mit dem Rücken sieht man schlecht
Frankfurter Rundschau, 10.7.2012
Norbert Hummelt: Leise landen die Abendmaschinen
Neue Zürcher Zeitung, 10.7.2012
Lothar Schröder: Autor Jürgen Becker wird 80
Rheinische Post, 10.7.2012
Gisela Schwarz: Jürgen Becker wird 80 Jahre alt
Kölner Stadt-Anzeiger, 10.7.2012
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Olbert: In diesen neuen alten Gegenden
Kölner Stadt-Anzeiger, 10.7.2017
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Prosa als fehlender Rest
literaturkritik.de, Juli 2022
Martin Oehlen: Jürgen Becker – zwei Bücher zum 90. Geburtstag: „Fast täglich hört eine Epoche auf“
Frankfurter Rundschau, 7.7.2022
Jens Kirsten: „eine Landschaft aus Erinnerungen und Imaginationen“
Palmbaum, Heft 75, 2022
„eine Landschaft aus Erinnerungen und Imaginationen“ – Der Dichter Jürgen Becker im Gespräch mit Wolfgang Haak und Jens Kirsten
Radio Lotte, 5.7.2022
Nico Bleutge: Der riesige Rest
Süddeutsche Zeitung, 8.7.2022
Michael Hametner: Jürgen Becker: „Ich habe nicht viel Phantasie“
der Freitag, 9.7.2022
Hans-Dieter Schütt: Das siehst du nie wieder!
nd, 8.7.2022
Michael Braun: Der große Lyriker Jürgen Becker wird 90 Jahre alt
Die Rheinpfalz, 8.7.2022
Gregor Dotzauer: Die Schatten des früher Gesagten
Der Tagesspiegel, 9.7.2022
Joachim Dicks: Jürgen Becker zum 90. Geburtstag
NDR, 10.7.2022
Thomas Geiger: Zeitmitschriften in Lyrik und manchmal auch Prosa
Berliner Zeitung, 8.7.2022
Herbert Wiesner: Von Altlasten und künftigen Katastrophen
Die Welt, 10.7.2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Jürgen Becker: „Da wagt einer, mich zu verreißen? Das muss ich aber genauer wissen.“


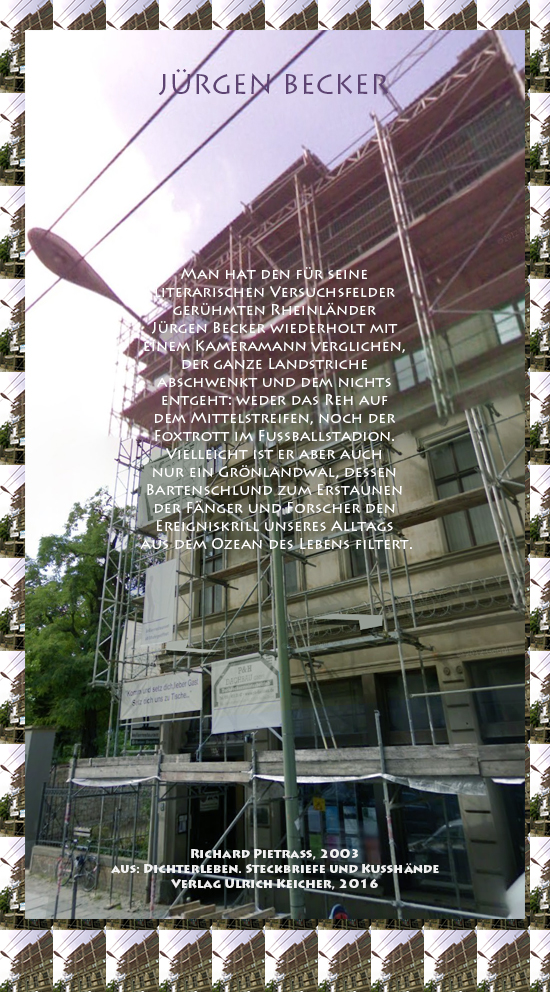












Schreibe einen Kommentar