Jürgen P. Wallmann (Hrsg.): Reiner Kunze – Materialien und Dokumente
OFFENSIVE VERTEIDIGUNG DER POESIE
Der 1933 in Oelsnitz geborene Reiner Kunze ist längst kein erzgebirgischer Lokalfall mehr. Spätestens nach seinen Übersetzungen aus dem Tschechischen, für die er 1968 einen Preis des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbands erhielt, gewann er internationale Anerkennung. Auch für seine eigenen Arbeiten bedeutete die Freundschaft mit Autoren aus Böhmen und Mähren sehr viel. Ohne Milan Kundera oder Jan Skácel hätte er es sicher noch schwerer gehabt, einen Weg aus seinen politischen und persönlichen Krisen zu finden. Der Sohn eines Bergmannes und einer Kettlerin, die sich mit Heimarbeit durchschlug, brachte die sozialen und psychologischen Voraussetzungen mit, ein Lieblingskind der offiziellen Kulturpolitik zu werden. Die Deutsche Demokratische Republik ermöglichte ihm den Besuch der Oberschule, und der achtzehnjährige Abiturient war bereit, diesem Staat naiv und enthusiastisch in ewiger Dankbarkeit zu dienen. Er schwankte, ob er an der Dresdner Kunstakademie oder am Leipziger Institut für Publizistik studieren sollte, sein Interesse am Journalismus setzte sich durch. Nach dem Staatsexamen war Kunze dann auch zeitweilig Assistent an der inzwischen zu einer Fakultät für Journalistik aufgeblasenen Ausbildungsstätte der Leipziger Karl-Marx-Universität. Von dem, was er in den fünfziger Jahren geschrieben und gesagt hat, läßt Kunze heute kaum noch etwas gelten. Seinerzeit wurde Kunze verhätschelt und für dumme Reimereien hochgepriesen. Ein Kinderlied hielt er 1962 noch für geeignet, ein Bändchen mit heiteren Texten zu zieren. Der vollständige Text geht so:
Der Soldat braucht einen Helm.
Wozu braucht ihn der Soldat?
Der Helm schützt seinen Kopf,
und der Kopf ersinnt die Tat,
die den Kindern der Welt
alle Blumen erhält
und das Glück, und das Glück
urnsrer Republik.
Der Soldat ist unser Freund.
Warum ist es der Soldat?
Weil er klug und tapfer kämpft
und mit Mut vollbringt die Tat,
die den Kindern der Welt
alle Blumen erhält
und das Glück, und das Glück
unsrer Republik.
Diese Zeilen werden hier nicht zitiert, um dem Autor Vergangenes um die Ohren zu schlagen. Peinlich kann die Erinnerung auch ans Peinliche nur dem sein, der sein Leben nachträglich in die Einlinigkeit pressen will und die eigene Biographie zu einer Form „mit Konsequenz“ stilisiert. Ein großer Teil der Verantwortung für derlei gelehrige Fleißarbeiten fällt auf die Lehrer und Vorbeter zurück, die familiär-anhängliche Wendungen („sprach die Partei wie eine Mutter“) als emotional bewältigte Parteilichkeit rühmten.
Ein Enthusiast wie Kunze hatte schließlich nur die Wahl zwischen opportunistischer Anpassung ans jeweils Verlangte und der Preisgabe errungener sozialer Positionen. Nach heftigen politischen Angriffen brach er die akademische Laufbahn ab, verzichtete auf die Promotion, zu der man ihn wahrscheinlich nicht mehr zugelassen hätte, hielt sich aus der journalistischen Tagespraxis heraus. Kunze arbeitete als Hilfsschlosser in einem Leipziger Betrieb, der Verlade- und Transportanlagen herstellt. Nach mehreren Aufenthalten in der Tschechoslowakei siedelte er ins thüringische Städtchen Greiz über, in seine „grüne Zuflucht“, wie er es in dem Gedicht „Dreiblick“ bezeichnet. Dort nämlich konnte seine Frau, eine tschechische Zahnärztin, Arbeit finden.
Ohne das Beispiel Kunze überstrapazieren zu wollen, scheint es mir zu beweisen, daß die überfällige Brechung des alten Bildungsprivilegs in den kommunistischen Ländern Veränderungen bringt, die über den kurzfristigen Zweck, dankbare machtkonforme Kader heranzuzüchten und das bestehende Gesellschaftsgefüge zu stabilisieren, weit hinaus führen.
Die Verteidigung der Poesie durchdringt die Arbeiten Kunzes bis in die letzte Zeile. Pragmatische Technokraten und auf Politik im beschränktesten Sinne fixierte Sektierer sehen in der Dichtung kein schutzbedürftiges Gut. Der Dichter, der nicht hauptsächlich mit Hilfe der Poesie für Zwecke aller Art, sondern für sie selber kämpft, muß sich nicht erst Gegner suchen. Ob man ihn des bürgerlichen Luxus im Geiste bezichtigt oder ihn des volksfremden Formalismus zu überführen sucht, ob man ihn nach dem quantitativen Nutzen (bitte möglichst in Tonnen angeben!) für die rasche Entwicklung der Volkswirtschaft oder nach der Anzahl der Kämpfer befragt, die durch seine agitatorische Kraft für die auf der jeweiligen historischen Tagesordnung stehende Sache gewonnen wurden – immer wird der Dichter in die Situation eines Außenseiters gedrängt, der sich bitte schön um plausible Rechtfertigungsgründe für seine Existenz bemühen möge. „Entschuldigung“ heißt ein Gedicht Kunzes:
Ding ist ding
sich selbst genug
Überflüssig
das zeichen
Überflüssig
das wort
(Überflüssig
ich)
Das Stichwort „Verteidigung der Poesie“ stammt von Johannes R. Becher, der in mehreren Bänden tagebuchartiger Betrachtungen über literarische und kulturpolitische Probleme neben mancherlei Füllstoff viele „anstößige“ Reflexionen mit Langzeitwirkung in die öffentliche Diskussion eingebracht hat. Die Bedeutung dieser Bücher, von denen das im Jahr 1952 erstmals erschienene Verteidigung der Poesie heißt, wird im Westen unterschätzt, wo man ein Becher-Bild gemalt hat, in dem beinahe ausschließlich die literarischen Schwächen und persönliche Eitelkeiten des Dichters und Kulturministers anekdotisch aufgeputzt wurden. In der DDR ermöglichten aber gerade diese Schriften subjektive Fragestellungen unter Berufung auf Bechers „klassische“ Autorität auch in schwierigen Perioden durchzuhalten oder wiederaufzugreifen.
Das gilt auch für Reiner Kunze, der bei Becher erste Ermutigungen für die Emanzipation von der standardisierten, veräußerlichten Auftragsliteratur im Sinne nirgends faßbarer Volksmassen fand. In einem Vortrag aus dem Jahre 1959 zitiert Kunze mehrfach aus Bechers Verteidigung der Poesie. Wichtig ist vor allem die Stelle:
„Für wen schreibst du?“ Nicht die Frage ist es, die an den Dichter gerichtet wird, wie einige in der Dichtung unerfahrene Leute nach wie vor annehmen […]. „Wer bist du, der du schreibst?“ Diese Fragestellung geht tiefer und ist die eigentliche Lebensfrage jedes Dichters. Man schreibt für diejenigen, deren Wesen so tief in das eigene eingegangen ist, daß man gar nicht anders kann, als für sie schreiben.
Wie auch immer Becher am Schluß durch den Hinweis auf die Verinnerlichung der „Träume des Volks“ in dessen Repräsentanten, den Dichtern, mit der einen Hand wieder zurücknimmt, was er mit der anderen gerade gegeben hat – die Bemerkungen ermutigen zum Nachdenken über sich selbst, sie werten die Persönlichkeit des Dichters auf. Bechers Hauptmotiv war es, darauf hinzuwirken, daß der Autor sich wieder „frei im Stoff“ bewegen kann, ohne durch ein inneres Kontrollämpchen gelähmt zu werden, das bei jedem Wort in Form eines Fragezeichens aufleuchtet: „Ist das, was ich schreibe, auch verständlich genug?“ Denn dies steckt ja genaugenommen hinter der fordernden Frage, für wen einer eigentlich schreibe.
Ein tschechischer Übersetzer, Luboš Přihoda, hat, ohne Becher zu erwähnen, geschrieben, Kunze sei aufgrund musikalischer Vorbilder, vor allem durch Beethoven, statt zu der Frage „Für wen schreibst du?“ zu der „Wer bist du?“ geführt worden. Mir scheint aber gerade in diesem Punkt die direkte Ableitung aus kulturpolitischen Diskussionen im Zusammenhang mit der Becher-Rezeption möglich. Wie das auch sein mag – Přihoda hat mit seinen Schlußfolgerungen ohne Zweifel recht:
In den Intentionen dieser Konzeption wird das Schreiben zum eigenen Klärungsprozeß, […] zu einem ständigen Vollenden des ästhetischen Prinzips bei der Selbstvollendung in einen ganzen Menschen, zu seiner Selbstverwirklichung…
Kunze hat in der Nachbemerkung zu seinem Bändchen Zimmerlautstärke unter Berufung auf Margarete und Alexander Mitscherlichs Wort, zum Widerstand gegen die Anweisungen des Kollektivs benötige man eine starke und stabile Ich-Organisation, dem Gedicht eine solche Funktion zugemutet:
Das gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.
Hieraus folgt aber nicht, daß, wie enthusiastische Tatmenschen vereint mit Gleichgesinnten so gern arrogant vermuten, damit der „selbstvergessenen Nabelschau“ das Wort geredet wird. Der Leser war für Kunze niemals eine zu vernachlässigende Größe. Gerade dem Leser oder Hörer von Gedichten hat Kunze – wiederum im Anschluß an Becher – ein derart intensives Eindringen in die poetische Aussage zugemutet und zugetraut, wie sie der Konsument von Erzählungen, Romanen oder Dramen nicht zu leisten imstande sei. Der Grund liege darin, daß in diesen Formen Figuren dazwischengeschaltet seien, die die Identifizierungsenergien absorbieren. Der Leser von Lyrik versetze sich dagegen unmittelbar in die Gedanken- und Formenwelt des Autors, jedenfalls dann, wenn er einen Zugang findet und die Zustimmung nicht versagt. Die von Kunze herangezogene Stelle in Bechers Verteidigung der Poesie lautet:
Das Wesen des lyrischen Dichters besteht darin, durch seine Dichtung sich selbst Gestalt werden zu lassen, und diese Gestalt ist eine ebenso erfundene Gestalt wie die Hauptfiguren im Roman oder im Drama. Das ,Ich‘ des lyrischen Dichters ist danach nicht eine unmittelbare private Aussage, sondern es gestaltet sich eine poetische Figur, indem ein Ich von sich aussagt. […] Der Romancier und der Dramatiker leben in ihren Gestalten weiter, der Lyriker aber ist selbst Gestalt […].
Kunze leitet daraus ab, daß in dieser subjektivsten Form dem Leser keine sichtbare Gestalt entgegentritt, die die geäußerten Worte als eigene beanspruchen könnte. Er schrieb 1959:
Die Gedanken und Gefühle, die lyrisch ausgedrückt werden, empfindet der Leser – auch wenn er vorher nie so gedacht oder gefühlt hat – meist unmittelbar als seine eigenen Gedanken und seine eigenen Gefühle, sobald. sie seinem Denk und Gefühlsvermögen entsprechen. In der Lyrik werden die Erkenntnisse über den Menschen und das Leben nicht durch eine fremde poetische Gestalt vermittelt. Der Leser geht selbst in die poetische Gestalt der Lyrik ein.
Der Vortrag schließt mit dem Satz: „Diese Macht des Lyrikers muß erkannt werden, zuerst von ihm selbst.“ („Macht der Poesie“ hatten Bechers 1955 erschienene Aufzeichnungen geheißen.) Diese Erhöhung seines Mediums brauchte Kunze als Durchgangsstufe zu einem Selbstbewußtsein, das Sicherheit genug besaß, um zurücknehmen und relativieren zu können. Die Möglichkeiten des Gedichts werden heute von ihm noch für genauso wichtig, aber nicht mehr für so weitreichend gehalten. Das Kommunikationsangebot bleibt bestehen. Was der Dichter von sich preisgibt und schutzlos dem identifizierenden oder vernichtenden Zugriff ausliefert, womöglich auch nur der gleichgültigen Verweigerung, ist eine Vorgabe, die, wenn sie angenommen und vom Empfänger durch seinen Anteil am sozialen Verständigungsprozeß ergänzt und vervollständigt wird, viel und wenig zur Humanisierung der Welt beitragen kann. Kunze hat in einer zweiten, an Max Frisch anknüpfenden Nachbemerkung zu Zimmerlautstärke mit zwei knappen Sätzen zusammengefaßt, was ich eben zu erläutern versucht habe:
Das gedicht als äußerster punkt möglichen entgegengehens des dichters, als der punkt, in dem auf seiner seite die innere entfernung auf ein nichts zusammenschrumpft. Das gedicht als bemühung, die erde um die winzigkeit dieser annäherung bewohnbarer zu machen.
Ehe Kunze wußte, was er selbst wirklich wollte – und dies erwies sich als ein langwieriger schmerzlicher Prozeß –, war er den irritierenden Bestätigungen und Verwerfungen eines desorientierten Publikums und einer desorientierenden Kritik ausgesetzt. Es scheint, als ob das Wichtignehmen der Dichtung vieler Länder und Zeiten, vor allem des deutschen klassischen Erbes und der tschechischen Volkspoesie, es ihm ermöglichten, den vorgestanzten Klischees der Besserwisser zu entkommen, die wußten, wie ein schönes sozialistisch-realistisches Gedicht auszusehen hatte. Er war nicht sicher genug, den Zumutungen polemisch zu begegnen, und er war zu sensibel, als daß er auf Meinungen nichts gab, selbst wenn er ahnte, daß sie ihn nicht weiterbringen konnten. So fragt er in einer Strophe des 1959 geschriebenen Prologs zu dem Bändchen Widmungen von 1963, das er Opus eins nennt, wodurch früher Erschienenes wenn nicht annulliert, so doch gründlich „ausgesiebt“ wird:
Gedicht, es sammelt sich dein publikum.
Kundgebung wimmelnder gestalten!
Ein urteil bringt das andre um.
An welches urteil wollen wir uns halten?
Sechs Jahre später, 1965, hat Reiner Kunze in fünf Anmerkungen selbstinterpretatorischen Klartexts eine Antwort gegeben, die über die im Prolog versuchten Ansätze hinaus geht. Vor allem legt er den Maßstab oder Verständlichkeit beiseite, der als besonders klobige Waffe bei der Disziplinierung der Künstler benutzt wurde, unter Mißbrauch der alte Bildungsprivilegien angreifenden Losung, die Kunst gehöre dem Volke. Kunze fragt nach der Beschaffenheit des Verstandes und des Willens, der dem Verstand zur Seite steht. Das unterschiedliche Vermögen der einzelnen relativiert die Kategorie der Verständlichkeit. Gesucht werden muß ein Maßstab, der für die Poesie selbst nicht sekundär, sondern konstitutiv ist. Statt der Verständlichkeit empfiehlt Kunze die Genauigkeit. Seine These zwei heißt lapidar: „Poesie soll einfach sein. Sie kann aber nicht einfacher sein, als es die Genauigkeit erlaubt.“ Meinungen über Poesie sind situationsbedingt, interessengebunden, bildungsabhängig usw. Eine Ansicht als die gültige Ansicht aller oder der Mehrheit auszugeben, widerspricht diesem unbestreitbaren Sachverhalt. Hält der Dichter sich nicht an diese Norm, wird ihm arrogante Verachtung des überwiegenden Teils der Gesamtbevölkerung, einige der Basis entfremdete Außenseiter abgerechnet, unterschoben. Kunze hierzu:
Man kann […] auf den Dichter eine Art öffentlicher Nötigung ausüben, indem man eine bestimmte Meinung als ,Massenmeinung‘ oder Meinung des Volkes deklariert (was natürlich eine Fiktion ist, denn das Verhältnis zur Poesie ist ein zutiefst individuelles Verhältnis). Der Dichter möchte nicht bezichtigt werden, die Meinung unserer Menschen oder des werktätigen Menschen zu mißachten.
Widerwillig und wider die eigene Einsicht die gängigen „gesellschaftsfähigen“ Urteile zu übernehmen, um als Person belohnt und belobigt zu werden, beschädigt oder zerstört die Poesie. In einem dem tschechischen Dichter Jan Skácel, von dem in deutscher Sprache eine Gedichtsammlung in Kunzes Übersetzung vorliegt, gewidmeten Satz wird ein Endpunkt dieser Reflexionen bezeichnet:
Das bedürfnis des dichters, nach außen hin etwas zu gelten, bricht in dem augenblick zusammen, in dem er begreift, was poesie ist.
Der Verzicht auf die Vorteile der Anpassung erhöht die Verteidigungskraft im Streit mit den Verächtern und Bekämpfern der Poesie. Um bei militärischer Metaphorik, die Kunze sehr fernliegt, zu bleiben: der Poet muß einen Mehrfrontenkrieg mit unregelmäßig verlaufenden Gefechtslinien bestehen.
Da muß man reagieren auf die besserwisserische und unhistorische Abkanzelung „dummer“ Gedichte aus der Vergangenheit, die angeblich den neuen Menschen nichts mehr oder doch nur Falsches zu sagen hätten, weil diese inzwischen so unendlich viel weiter gekommen seien. Diese überhebliche Zurückweisung, zu der die kritische Aneignung des Kulturerbes gelegentlich pervertierte, hatte natürlich auch Folgen für die Beurteilung zeitgenössischer Werke, die nach Irrtümern und Fehlhaltungen abgesucht wurden. Wie Kunze in seiner schwierigen „Übergangsphase“, als er schon „Treuhänder des Poetischen“ und noch „Erzieher“ im Sinne der gewünschten Normen war, in dieser Frage freies Feld zu gewinnen suchte, läßt sich dokumentieren. In der schon mehrfach erwähnten, an Becher anknüpfenden Aufsatz aus dem Jahre 1959 hatte Kunze das „Abendlied“ des Matthias Claudius erwähnt. Genauer gesagt, handelt es sich um ein Referat, das Kunze im April 1959 auf einem „Lehrgang für junge Lyriker“ gehalten hat (es lohnt nicht, im einzelnen darauf einzugehen, da es vorwiegend aus Banalitäten besteht, die dem Anlaß kongruent sind). Ein Lehrgangsteilnehmer machte Einwände geltend gegen Kunze, der die erste Strophe („Der Mond ist aufgegangen […]“) zitiert und ihres Natur- und Heimatgefühls wegen gerühmt hatte:
Claudius, meine ich, war bestimmt ein begabter Mann, aber er war ungenial. Und ich möchte sagen, seine Lyrik hat etwas ,Allgemein-Menschliches‘ […].
Dem jungen Lyriker kam das Ganze „dumm-religiös“ vor, und es sei „irgendwie typisch“ für Claudius, „daß er sich in seinen Gedichten oft so hinterwäldlerisch ins allzu eigene Ich zurückzieht“. Kunze reagierte heftig,
da mir die folgenschwere Anmaßung, mit der heute manchmal noch über die Geistesgüter unserer Nation gesprochen wird, für die Haltung einiger, die in der Literatur noch nichts vollbracht haben, symptomatisch erscheint; das zeigte sich auf dem Lehrgang auch darin, daß sich eine Reihe von Autoren wohl in der Lage fühlten, ein Gedicht wie das „Abendlied“ von Claudius mit kühner Geste zu verurteilen, nicht aber, es sich in einer historisch-konkreten Betrachtung kritisch anzueignen.
Bedroht wurde die Poesie zweitens von denen, die mit der herablassenden Gebärde des pragmatischen Aufbau-Organisators die beliebte Frage nach dem Nutzen stellten. Kunze hat darauf mit dem Gedicht „Vom Unwert der Lerche“ reagiert, das freilich nur einen schwachen Aufguß von Brechts Kinderlied „Die Vögel warten im Winter vor dem Fenster“ darstellt, in dem der Anspruch der Amsel, die „nur“ gesungen hat, auf Lohn und Korn bekräftigt wird. Das (bescheidene) Ziel dieser seiner Einreden faßte Kunze 1965 in den Satz:
Manchem, der glaubt, über Poesie den Stab brechen zu dürfen, sollte zumindest die Hand ein wenig zittern.
Kunze ordnet die menschheitsgefährdende Bedrohung durch Barbarei und Krieg; ebenfalls dem großen Thema der Verteidigung des Poetischen zu. In seinem, wie man hört, in der Sowjetunion stark beachteten Gedicht „Puschkins Michailowskoje“, das von einer Bemerkung des Museumsführers ausgeht, die Frontlinie des 2. Weltkrieges sei hier mitten durch den Garten hindurch verlaufen, schreibt Kunze:
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich
wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
Die Gärten der Dichter sind offen – Metaphorik der Schutzlosen. Standhaftigkeit gegenüber dem Eingriff, der Einschüchterung, dem Verbot kann die Waffen der „verfügenden“ Gegner auf Dauer doch stumpf werden lassen. Das Seneca-Motto der Zimmerlautstärke bekräftigt das:
… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
Wer nicht resignieren will, muß dieser Überzeugung sein. Als Kunze 1960 begann, in einem Zyklus von Fabeln, „Die Kunst der Tiere“, gegen engstirnige Funktionäre Sturm zu laufen, war ihm der Blick noch durch einen allzu heiteren Optimismus der Art, daß die fröhlich schmetternde Kunst schon nicht totzukriegen sei, getrübt: Die Nachtigall triumphiert, auch wenn die Uhus den Gesang mißbilligen. Sein Gedichtband von 1962 trug diese Überschrift: Aber die Nachtigall jubelt. Aus dem Zyklus läßt Kunze wohl nur mehr die beiden radikalsten Texte, „Das Ende der Fabeln“ und „Das Ende der Kunst“ gelten; diese beiden übernahm er jedenfalls in den Band Sensible Wege von 1969. In neueren Arbeiten zum gleichen Thema verzichtet Kunze auf die Absicherung durch die der Tierfabel angemessene satirische Übertreibung. Knappe Pointen haben die weitschweifigen, penetrant schelmischen Geschichten von einst ersetzt. Als Beispiel sei genannt: „Auf einen Vertreter der Macht oder Gespräch über das Gedichteschreiben“:
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Oder das Titelgedicht der Sammlung Zimmerlautstärke:
Dann die
zwölf jahre
durfte ich nicht publizieren sagt
der mann im radio
Ich denke an X
und beginne zu zählen
„Zimmerlautstärke“, ein Wort, das ein Bündel vielgestaltiger Assoziationen weckt. In der guten alten Zeit, als man noch wußte, was Lärm war, erinnerte die freundliche Stimme des Radioansagers die lieben Hörer noch öfters daran, daß man aus Rücksicht auf mithörunwillige Nachbarn sein Gerät auf einen angemessenen Pegel einstellen möge. Als es im Krieg Feindsender gab, deren Abhören bei Todesstrafe verboten war, mußte der informationshungrige Hörer die Zimmerlautstärke auf „Ohrenlautstärke“ bei enger Berührung mit der Membran drosseln. Die Zimmerlautstärke kam in der DDR zu neuen Ehren, als dort das Abhören der Westsender mindestens politisch und moralisch angeprangert wurde, von terroristischen Übergriffen und den exemplarischen Bestrafungen im Falle des „Gemeinschaftsempfangs“ nicht zu reden. All diese Beschränkungen der „Kommunikation“ mitsamt dem Mißtrauen gegenüber der Kritikfähigkeit des Bürgers gehen in Kunzes Metapher ein. Aber es schwingt wohl noch etwas anderes mit: Die Auffassung nämlich, daß Dichtung nicht laut sein muß, wenn sie sich Gehör schaffen will. Daß sie inmitten des Lärms paradoxerweise intensiver wirkt, klarer vernommen wird, wenn sie auf Auftrumpfen, auf Geschrei verzichtet. Die Apologie der Stille hat hier ihren Platz. Als Beispiele seien nur die Gedichte „Die Bringer Beethovens“ und „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“ genannt.
Weniges leise zu sagen, gehört zur dichterischen Eigenart Kunzes, der sich dadurch nach Temperament und Wirkungsmethodik erheblich von seinen Generationsgenossen Braun oder Biermann unterscheidet. Für eine kurze Begrüßungsrede auf einem internationalen Schriftstellertreffen, das im April 1973 in Budapest stattfand, hat Kunze „die Poesie“ personifiziert, um ihr – und nicht nur ihrem Schöpfer – eine Haltung zum Gerede über sie zuordnen zu können. Es heißt da:
Die Poesie ist schüchtern. Ich glaube, daß die Gefühle der Poesie gegenüber einer Konferenz, die sich mit ihr beschäftigt, ambivalent sind. Sie freut sich und sie ängstigt sich zugleich. Sie freut sich, weil manchmal das passende Wort gefunden wird. Und sie ängstigt sich vor dem überflüssigen Wort. Um niemanden zu kränken, verläßt sie den Saal, bevor einer von uns zu sprechen beginnt. Hinter der Tür lauscht sie. Dann entscheidet es sich: Entweder sie geht in eines der angenehmen Budapester Espressos und lächelt vor sich hin. Vielleicht auch setzt sie sich auf eine Donauboje, schaukelt und wartet. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, daß sie unbemerkt in den Saal zurückgeht – etwas verlegen, weil sie den Dichtern zu wenig vertraut hat – und in einer Ecke bis zu Ende zuhört […].
Diese Unterscheidung zwischen„ Worten“ und dem „Gedicht“ hatte schon den „Prolog“ von 1959 zu den Widmungen bestimmt.
Bei alledem wird von der Person des Dichters nicht abgesehen, der sich nicht unsichtbar machen, der sich kein „dickes Fell“ zulegen, der sich nicht verstecken kann. „An R. K., Dichter“ heißt ein Gedicht, das sich der Autor wie eine Tarnkappe aufstülpt:
Ich bin K.
und wohne
hier
Der dichter
ist verzogen
Anschrift
unbekannt
Treten in Kunzes Märchen Dichter auf, sind sie den Mächtigen lästig, die seine Spuren und Hinterlassenschaften gern löschten:
Nichts sollte mehr an den Dichter erinnern. Er hatte von den Menschen erzählt, und ihre Träume und Gedanken waren für die Mächtigen nicht schmeichelhaft gewesen.
An den Dichter kann man sich halten; er ist „verantwortlich im Sinne des Urheberrechts“. Wie ein Schutzschild legt er sich vor die Poesie. Der „Prolog“ (1959) schließt mit den Strophen:
Flieg, mein gedicht! Und fliehe dessen zeichen,
der dich verkennt! Und legt er an auf dich,
er wird dich nicht erreichen,
er trifft nur mich.
Ich doch ertrag, vom fieber schlagerhitzt
das herz, aus dem du dringst,
wenn du nur in den zweigen sitzt
und singst.
Man muß wiederum daran erinnern, daß dies 1959 geschrieben worden ist. Die Mischung aus Pathos und Sentimentalität mit einem gewissen Hang zur Larmoyanz ist längst einer genaueren Sprache gewichen. Kunze hat Sicherheiten gewonnen, nach innen wie nach außen. Die „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“, wie ein Peter Huchel gewidmetes Gedicht heißt, ist gewiß. In solchem Kontext zitiert Kunze Jean Amérys Bemerkung, man müsse Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Die unverrückbare Basis, von der aus auch abenteuerliche und riskante Entdeckungsfahrten ohne Zittern und Zagen unternommen werden können, hat Kunze in dem Gedicht „Blickpunkt“ thematisiert:
Frau nicht
die möbel verrücken
Wer
im kopf umräumt dessen
schreibtisch muß
feststehn
Trotz solcher„ Verankerung“ der Widerstandsfähigkeit des einzelnen finden sich Stellen, die einen Rückzug auf die Position „Die Gedanken sind frei“ signalisieren.
Zwei Beispiele dafür:
Retuschierbar ist
alles
Nur
das negativ nicht
in uns
(in: „Von der Notwendigkeit der Zensur“)
Nur die erinnerung in ihm
ist belichtet
(in: „Macht und Geist“)
Das Gedicht „Kottenheide“ ist von einer„ Wirf-deine-Sorgen-in-die Natur“-Stimmung erfüllt, die – durch die wortspielerische Abwehr allgegenwärtiger lästiger politischer Losungen verstärkt – unvermittelte Privatheit suggerieren könnte, wäre da nicht ein genauer geographischer, situationsbedingter Bezugspunkt, der dem Gedicht die Schwere (und auch die Fatalität) eines weltanschaulichen Bekenntnisses nimmt (das gleiche gilt für das Gedicht „Rückkehr aus der Versammlungsstadt“). Kottenheide ist eine abgelegene Gegend im Vogtländischen; das Gedicht lautet:
Die zeit
fällt aus den fichten als
reine zeit
Die losung des wildes ist
die einzige
Das zweiteilige Gedicht „Die Antenne“, dessen zweiter Teil aus einem einzigen Wort besteht, liefert die Kritik an der Illusion mit, es gebe Unantastbares,und stärkt durch solch nüchternes Eingeständnis auf dialektische Weise die Widerstandskraft. „Die Antenne“ geht von einer Kampagne gegen den Empfang des Westfernsehens aus („sie abzusägen, drohte / die straße“). Der erste Teil endet mit der Apotheose des unzerstörbaren Gedankens: „Die antenne flüchtete / in den kopf, er / bot sicherheit“. Die Scheinhaftigkeit dieser angenommenen Garantie wird durch das isoliert stehende „vorerst“ des zweiten Teils einbekannt.
Das Insistieren auf der Subjektivität und Integrität des einzelnen hat bei Kunze nichts von der Verachtung des Hochmütigen, der sich pharisäisch der Einsamkeit ergibt. In der Solidarität mit den Gefährten und im unstillbaren Bedürfnis nach Kommunikation widersteht Kunzes Dichtung jeder Esoterik. Das „Lied vom Biermann“ ist ein Echo auf Wolf Biermanns Gedicht „Frühzeit“, das Titelgedicht der Sammlung „Sensible Wege“ nimmt die Metaphorik vom Roden der Wurzeln aus Peter Huchels „Garten des Theophrast“ auf. Das Gedicht „Deutschland, Deutschland“ ist Alexander Solschenizyn gewidmet, dessen Buch vom Lagerleben des Iwan Denissowitsch während der Chruschtschow-Ära in der Sowjetunion Aufsehen erregte, auf Weisung der SED aber nicht in der DDR erscheinen durfte:
Der standhaftigkeit, als einzige
verschwiegen zu haben
das buch eines standhaften
hörte ich sie sich
rühmen
Hier wie auch in manchen anderen Gedichten zeigt sich der Einfluß des späten Brecht. Die ironische Andeutung, der Gestus des Beobachtens, die epigrammatische Zuspitzung sind Beispiele einer Differenzierung von Kunzes Ausdrucksmitteln, die sich allmählich von der Vorherrschaft des Emotionalen befreiten. Kunzes Herkunft von der Tradition der Volkspoesie mit ihrer Vogel- und Blumenmetaphorik hat ihn nicht immer vor weitschweifigen Lyrismen bewahrt. Manchmal entstehen Leerstellen. Der Vergleich der Anfänge zweier Wintergedichte auf Greiz kann das verdeutlichen. In „Dezember“ heißt es: „Stadt, fisch, reglos / stehst du in der tiefe.“ Die kunstlos-kunstvolle Reihung macht den Vergleich selbstverständlich. Das Gedicht „Fischritt am Neujahrsmorgen« beginnt dagegen:
Stadt, schlüpfrige, halt
still
Ah, jetzt erkenn ich’s, du
bist ein fisch.
Das eingeschobene „schauende Subjekt“ verdirbt mit dem „ah, jetzt erkenn ich’s“ das Gedicht, dessen neckischer Märchenton auch im folgenden gezwungen wirkt.
Die Rezeption der Volkspoesie und vor allem der tschechischen Lyrik, in der volkstümliche Traditionen selbstverständlicher fortleben als in der deutschen, war für die „Subjektwerdung“ des Dichters Kunze von entscheidender Bedeutung. Nur die sture, zeitweise recht einseitige Behauptung der Bildhaftigkeit der Dichtung, die das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Formen der Wirklichkeitsaneignung sei, ermöglichte es Kunze, die Zumutungen abzuweisen, sogenannte „wichtige“ Inhalte (über deren Wichtigkeit andere entschieden hatten) direkt zu transportieren. Im Hintergrund stand anfangs eine schematische Entgegensetzung von Rationalem und Emotionalem; nur dieses hielt Kunze für poesiefähig. Die Schlußstrophe des Gedichts „Das Quartett“ aus dem Zyklus der Fabeln macht dies augenfällig:
Die Nachtigall sagt schlicht:
„Die Kunst – sie flieht Befehle.
Verstand allein regiert sie nicht.
Sie will des Künstlers Seele.
Zwar werden hier schon die von außen herangetragenen Anweisungen verworfen, aber der Zusammenhang von „Befehl“ und „Verstand“ erscheint nicht plausibel. Auch die Auftraggeber wünschen sich doch die volle Identifizierung des Künstlers, sie wollen Herz, Kopf und Hand, also auch seine „Seele“. Sonst müßte bei ihnen der Verdacht des „inneren Vorbehalts“ aufkommen. Den Zeilen fehlt Genauigkeit.
Kunzes Leistung besteht nicht zuletzt darin, aus der Sackgasse der falschen Alternativen herausgefunden zu haben, etwa auch der von Rose und Ordnung („In der Thaya“). Seine epigrammatische Dichtung erliegt der Gefahr einer dürren Didaktik deswegen nicht, weil sie auf einem Fundament aus Anschaulichkeiten aufgebaut wird. Der Autor vertraut auf den konkreten Wortwitz der Sprache und bettet ihn in eine einfache Bildlichkeit ein, die nun nicht mehr in „Gefühligkeiten“ ausufert. Erst in der Synthese hat Kunze seinen eigenen Ton gefunden, gleich weit entfernt von gefühlsgeladener Symbolik wie von unpersönlicher Direktheit. Politisches existiert nur als Poetisches. Die Naturmetaphorik wird „vergesellschaftet“ (Beispiel: „Der Hochwald erzieht seine Bäume“). Die Qualität der Gedichte läßt sich nicht an hand des benutzten Vokabulars bestimmen, als sei dieses bei „privaten“ oder allgemeinmenschlichen Sujets ursprünglich, bei politischen aber abgeleitet und folglich ausgebleicht. Wenn ein politisches Thema dem Dichter Kunze nicht poetisierbar im Sinne einer imaginativen Inspiration erschiene, verzichtete er – trotz der Notwendigkeit der Kritik – auf dessen Behandlung eher, als daß er an einer passenden Imitation herumbastelte, die zu verbergen hätte, daß eine gefügte Struktur sich nicht wie von selbst herstellt.
Die Sehnsucht nach Kommunikation durchdringt die unter der Überschrift „Hunger nach der Welt“ zusammengestellten Gedichte des Bands Sensible Wege und die 21 Variationen über das Thema „Die Post“. Aber je mehr er sich unzumutbaren Ansprüchen verweigerte, desto schwererer wurde es für ihn, in der DDR noch eine Tribüne zu finden. Für einige Jahre wurde es ihm nach 1968 ganz und gar verwehrt, in der DDR noch etwas zu publizieren. Dennoch gilt auch für Reiner Kunze, daß er zum Nutzen der sozialistischen Gesellschaft schreibt, daß von seiner Seite die Solidarität mit den in der DDR lebenden Menschen nie aufgekündigt worden ist, auch wenn er Kompromisse, die an die Substanz gingen, nicht zu schließen gewillt war. In dem Gedicht „Dreiblick“ heißt es:
Ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
Man darf dieses prinzipielle Bekenntnis zur DDR nicht übersehen, wie es in jenen Kreisen im Westen allzu gern geschieht, die Kunze als „Partisan der Wahrheit“ ans Herz drücken möchten. „Gedichte sind mißbrauchbar wie die macht“, heißt die dritte kommentierende Anmerkung zu dem Bändchen Zimmerlautstärke. Auch ein Gedicht wie „Düsseldorfer Impromptu“ mit den drei Schlußzeilen:
Der mensch
ist dem menschen
ein ellenbogen
sollte man im der Bundesrepublik nicht überlesen. Reiner Kunze, der sich die Gegenstände seiner Kritik und den Grad ihrer Schärfe von niemanden diktieren läßt, hat in einem Interview, das er im Herbst 1972 einem westlichen Journalisten gab, seine Primärleserschaft weiterhin in der DDR gesehen:
Ich schreibe nicht für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Wenn ich durch mein Schreiben Menschen helfe, bestimmten Dingen gegenüber eine Haltung zu gewinnen, so ist es für mich ein glücklicher Umstand. Reaktionen, die ich aus der BRD und aus dem Ausland erhalte, deuten darauf hin, daß es auch dort Menschen gibt, für die meine Bücher nicht völlig ohne Belang sind. Die Dinge, hinter die ich schreibend kommen möchte, sind den Menschen in der DDR aber näher. Deshalb bedaure ich sehr, daß ich meine Büchner vorerst nur noch in der BRD und im Ausland publizieren kann.
Im Frühjahr 1973 erschien in der Hauszeitschrift des Reclam-Verlags in Leipzig ein Interview mit Reiner Kunze, in dem der Befragte sich ganz ähnlich ausdrückt:
Ich gehöre hierher, in dieses Land, in diese Gesellschaft. Im Gedicht ist der Dichter den anderen Menschen am nächsten. Ich möchte vor allem hier den anderen Menschen am nächsten sein.
Das ist keine Abgrenzung, keine Abqualifizierung von Lesern außerhalb der DDR. Sie werden nicht zu Zaungästen gestempelt, die nur „mitlesen“ dürfen. Sein Wille zur Kommunikation und zur Solidarität, Kunze spricht in dem letztgenannten Interview von seinem „Internationalismus“, stünde in einem unaufhebbaren Widerspruch zu einer Selbstbeschränkung auf die engere Umgebung des eigenen Lebenskreises. Auch zu dieser Position gehört der Gedanke, die Heimat sei nötig, um sie überschreiten zu können. Es ist daher nur folgerichtig, daß Kunze Literaturpreise aus der Bundesrepublik, z.B. den Jugendbuchpreis des Jahres 1971 oder auch den Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste angenommen hat, daß er jedoch ein Stipendium, durch das ihn die Jury für die Verleihung des Kunstpreises Berlin im Frühjahr 1973 auszuzeichnen gedachte, aus eigenem Entschluß und ohne äußeren Druck „mit aufrichtigem Dank und Respekt“ ablehnte, nicht etwa, weil die Ehrung aus Westberlin kam, sondern weil er künftigen Fehlinterpretationen, auch böswilligen Unterstellungen vorbeugen wollte:
Ein Preis ist eine Auszeichnung eines bereits existierenden Werkes, ein Stipendium eine Vorleistung. Einen finanziellen Betrag angenommen zu haben, der mit dem ausdrücklichen Vermerk vergeben wird, er diene der Förderung neuer Arbeiten, könnte zu Mißverständnissen in bezug auf das Bewußtsein führen, in dem diese Arbeiten entstehen.
Reiner Kunze hat in dem Interview mit einem Lektor des Leipziger Reclam-Verlags auch einige aufschlußreiche Bemerkungen über das weltpolitische Engagement des Dichters gemacht. Darin bekräftigt er die Auffassung, daß Gedichte – auch wenn sie sich nicht direkter appellativer Formen bedienen – gegen Aggression und Barbarei antreten, schon weil sie der „Abstumpfung durch Gewöhnung entgegenwirken“. Dem Prinzip, dem Gedicht die Last aufzuladen, den jeweils aktuell notwendigen Protest ästhetisch stimmig und wirksam zu strukturieren, kann Kunze jedoch nicht zustimmen.
Hier muß der Dichter aus der Dichtung heraustreten, wie die fortschrittlichen Künstler immer auch außerhalb ihrer Kunst gegen die Barbarei aufgetreten sind, ich denke zum Beispiel an die Proteste, die der Überfall auf die Sowjetunion 1941 unter Dichtern, Malern und Komponisten von Weltrang hervorgerufen hatte.
Auch größte Erschütterungen müßten nicht oder nicht in dem Augenblick, in dem es aus außer künstlerischen Gründen wünschenswert poetischen Bild inspirieren. Kunze hat über das Problem in dem Gedicht „Fanfare für Vietnam“ bereits in ähnlichem Sinne reflektiert:
Meine worte will ich schicken gegen
bomber
bomber
bomber
Mit meinen orten will ich auffangen
bomben
bomben
bomben
Meine worte aber haben
handschellen
Übrigens gilt sicher auch für die Verteidigung der Poesie, daß sie nicht nur durch sich selber betrieben werden kann. Der Dichtung Freiräume zu schaffen, kann nicht durch Dichtung allein bewirkt werden. Um Kunst durchzusetzen, bedarf es kräftiger „außerkünstlerischer Mittel“. Auch hier läßt sich der Bogen zurück zu Bechers Buch von 1952 schlagen, in dem es heißt:
Eine Verteidigung der Poesie kann nicht aus einer ,verinnerlichten‘ Position heraus erfolgen. In solch einer ,Igelstellung‘ wird das Poetische wehrlos überrannt. Eine Verteidigung der Poesie kann nur außerhalb des Poetischen selbst erfolgreich durchgeführt werden: man muß aus seiner Haut fahren, um sich seiner Haut zu erwehren.
Daß sie nur außerhalb des Poetischen erfolgreich verteidigt werden kann, mag übertrieben sein, aber das Einbekennen der „Machtlosigkeit“ des schutzbedürftigen Guts kann vor idealistischen Höhenflügen und Omnipotenzräuschen bewahren.
„Das aktuelle Interview“ mit Kunze entstand anläßlich der Herausgabe einer Gedichtauswahl, die 1973 als Band 553 von Reclams Universalbibliothek in Leipzig unter dem Titel Brief mit blauem Siegel erscheint. In „Fast ein frühlingsgedicht“ wurde der Text dieses Briefes dechiffriert. Er lautet:
Nichts
währt
ewig
Auch der Boykott währt nicht ewig. Kunze hofft, daß in der Auswahl etwas von dem sichtbar wird, was „zwischen den großen Farben Schwarz und Weiß liegt“. Er spielt damit auf sein Gedicht„ Horizonte“ aus der Sammlung Widmungen an, das mit der Zeile „Ich bin des regenbogens angeklagt“ beginnt. Die Poesie zu verteidigen, heißt für Kunze, auf ihrem vollen Spektrum zu bestehen.
Manfred Jäger
Nachbemerkung
Die vorliegende Materialsammlung soll, anhand von Dokumenten aus acht Jahren, den Weg des Schriftstellers Reiner Kunze überschaubar machen und zugleich exemplarische Kontinuität bzw. Diskontinuität der DDR-Kulturpolitik seit dem VI. Schriftstellerkongreß im Mai 1969 vorführen. Der Band, zusammengestellt zu einem Zeitpunkt, da erneut ein Boykott über Reiner Kunze verhängt wurde, möchte zum einen dazu beitragen, die Vorwürfe zu entkräften, mit denen man Reiner Kunze in der DDR zu diskreditieren versucht; zum andern möchte er helfen, die Annexionsansprüche derer zurückzuweisen, die meinen, Reiner Kunze im Westen für ihre politischen Ziele mißbrauchen zu dürfen.
Die Sammlung beschränkt sich ausschließlich auf bereits publizierte Texte; um den Charakter der Dokumentation zu wahren, wurde auf jegliche Kommentierung verzichtet. Aus der Fülle des Materials, etwa der Rezensionen, konnten nur jeweils beispielhaft einige Texte aufgenommen werden. Die nicht abgedruckten Arbeiten sind in den bibliographischen Hinweisen am Ende der Kapitel bzw. in der Bibliographie im Anhang verzeichnet. Daß ein Text lediglich bibliographisch vermerkt und nicht abgedruckt wurde, bedeutet keineswegs in jedem Fall, daß der Herausgeber ihn für weniger wichtig hielt als einen anderen aufgenommenen Text. Häufig war der Umstand ausschlaggebend, daß in einer Rezension biographische oder andere Tatsachen vorgetragen werden, die bei der Publikation des Beitrags in einer Zeitschrift oder Zeitung ihre Berechtigung hatten, hier im Buch aber zu überflüssigen Wiederholungen geführt hätten. Von der Möglichkeit, entsprechende Passagen zu streichen, wurde kein Gebrauch gemacht – alle Texte sollten, im Sinne strenger Dokumentation, ungekürzt abgedruckt werden. In einigen wenigen Fällen allerdings mußte aus zwingenden Gründen von diesem Prinzip abgegangen werden; die entsprechenden Stellen sind deutlich markiert. Von der guten Regel, daß ein Herausgeber keine von ihm selbst verfaßten Beiträge aufnehmen sollte, mußte gelegentlich abgewichen werden, da einige Informationen, deren Kenntnis für den Leser wichtig ist, nur ihm zugänglich waren.
Die Dokumentation, die, von dem Gedicht „Zimmerlautstärke“ abgesehen, keine im engeren Sinne literarischen Beiträge enthält, wurde mit Wissen und Zustimmung, jedoch ohne Mitwirkung Reiner Kunzes zusammengestellt. Das Manuskript wurde Anfang Januar 1977 abgeschlossen.
Jürgen P. Wallmann, Nachwort
Reiner Kunze
gehört mit seinen Gedichtsammlungen Sensible Wege und Zimmerlautstärke, dem Kinderbuch Der Löwe Leopold und mit dem Prosaband Die wunderbaren Jahre zu den wichtigsten Schriftstellern der zeitgenössischen deutschen Literatur. In der DDR hat man Kunzes kritische Solidarität mit seinem Land und sein Engagement für die Rechte des Einzelnen seit Jahren zum Anlaß für Pressionen und Boykottmaßnahmen genommen, die Ende Oktober 1975 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden: Reiner Kunze wurde aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen und hat damit faktisch Berufsverbot.
Die vorliegende Materialsammlung soll, anhand von Dokumenten aus acht Jahren, den Weg des Schriftstellers überschaubar machen und zugleich die Kontinuität bzw. Diskontinuität der DDR-Kulturpolitik seit 1969 vorführen. Der Band möchte dazu beitragen, sowohl die in der DDR gegen Kunze erhobenen Vorwürfe zu entkräften als auch westliche Annexionsansprüche zurückzuweisen.
Aufgenommen wurden Beiträge aus Ost und West, aus Deutschland wie aus dem Ausland: Berichte, Meldungen, Reden, Polemiken, Rezensionen, Stellungnahmen, Interviews, Offene Briefe, Analysen. Diese Materialien, nicht zuletzt auch die Beiträge von Reiner Kunze selbst, dokumentieren eindrucksvoll den Weg eines Dichters, der seinem Gedichtband Zimmerlautstärke programmatisch ein Wort von Seneca vorangestellt hatte: „… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.“
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1977
„Und es war schön finster“
– Zum Werk des Schriftstellers Reiner Kunze: Reiner Kunze, seit einiger Zeit von der DDR nach Westdeutschland gezogen, ist bei uns vor allem bekannt geworden durch seine Prosaskizzen Die wunderbaren Jahre. Kürzlich erschien im S.-Fischer-Verlag, Frankfurt, ein Sammelband Reiner Kunze, Materialien und Dokumente. Herausgegeben wurde er von J.P. Wallmann. –
DREIBLICK
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
hoffe ich
mit deinem grün
Reiner Kunze hat diese tapfere Liebeserklärung an das Land, dessen Funktionäre es ihm so schwer machten, 1965 geschrieben. Nun hat er das thüringische Greiz, seine „Zuflucht“, verlassen. Er lebt jetzt in Westdeutschland. Noch im Dezember 1976 hatte er erklärt, er wolle den neuen Attacken standhalten „bis an die Grenzen der psychischen und auch physischen Belastbarkeit“. Kunze hielt nicht stand. Stoiker sind noch keine Märtyrer. Man hatte den Verfemten am 29. Oktober 1976 aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Das bedeutete faktisch Berufsverbot. Von nun an durfte von Kunze in der DDR keine einzige Zeile mehr gedruckt oder gesendet werden. Der totale Publikationsboykott erstreckte sich zugleich auf alle anderen Ostblockländer. Damit entfiel auch die Möglichkeit der Veröffentlichung von Uebersetzungen. Die mit Genehmigung der zuständigen Behörden kurz zuvor (nur) in der BRD erschienenen Prosaskizzen Die wunderbaren Jahre (bisher weit über 100.000 Exemplare verkauft) waren der unmittelbare Anlass für das Schweigegebot. Für Kunze bedeutet Schreiben: atmen, leben. Seine Ausreise war lebensnotwendig.
Der Sammelband Reiner Kunze, Materialien und Dokumente enthält Beiträge aus Ost und West, aus Deutschland wie aus dem Ausland: Rezensionen, Interviews, Offene Briefe, Reden, Berichte, Aussagen, nicht zuletzt von Kunze selber. Seine persönlichen und politischen Krisen werden sichtbar, sein Weg als Dichter vom angestrengten Parolenschreiber zum kompromisslosen (ein Lieblingswort Kunzes) Wahrheitssucher, ebensosehr auch die unberechenbaren Rösselsprünge der DDR-Kulturpolitik seit dem VI. Schriftstellerkongress im Mai 1969, die mal ächtet, mal duldet, mal ermuntert, mal zügelt, je nachdem, wie der (Ost-?)Wind bläst. Wie bedrückend die Lage vieler Menschen in der DDR ist, die an den täglichen Lügen und Gewissensverrenkungen leiden, die den gefährlichen Balanceakt zwischen Anpassung und Widerstand täglich exerzieren, wird aus diesem Buch erschütternd deutlich, ebensosehr aber auch der Glaube an die Macht des Wortes und die Kraft der Solidarität.
Wallmanns Sammelband kann in seiner Vielfalt hier nicht besprochen werden. Er sollte nicht als Alibi für unsere Deformationen gelesen werden, sondern als ein Zeitdokument ersten Ranges, das auch uns angeht.
Abgesehen von Die wunderbaren Jahre sind folgende Werke Reiner Kunzes zugänglich: Sensible Wege, das neue buch, rowohlt 80, 1976; Der Löwe Leopold, fibü 1534, 1974; zimmerlautstärke, fibü 1934, 1977.
Sensible Wege
Am 21. August 1968 drangen Truppen der Warschauerpakt-Staaten in die ČSSR ein und setzten dem Prager Frühling ein Ende. Kunze reagierte darauf mit dem Austritt aus der Partei. Auch die SED reagierte: für fünf Jahre sollten Kunze alle Publikationskanäle verschlossen bleiben. Die Sensiblen Wege finden bei DDR-Verlagen keine Gnade. Dann genehmigen die DDR-Behörden die Veröffentlichung bei Rowohlt. Die Gedichte erscheinen im März 1969. Auf dem VI. Deutschen Schriftstellerkongress im Mai 1969 in Ostberlin geht Max W. Schulz, der Vizepräsident des DDR-Schriftstellerverbandes, mit den Sensiblen Wegen scharf ins Gericht:
Es ist alles in allem,… der nackte, vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus, der aus dieser Innenwelt herausschaut und schon mit dem Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert…
Und dann ein neuer Pfeil gegen den Unbequemen: man entzieht ihm einen Uebersetzungsauftrag, der den ungarischen Lyriker Gyula Illyes hätte erschliessen sollen. 1973 wieder Klimawechsel: Der Verlag Reclam in Leipzig gibt als Band 553 der Universalbibliothek eine vom Autor veranstaltete Auswahl von Gedichten (auch aus den Sensiblen Wegen) unter dem Titel Brief mit blauem Siegel heraus, von denen die Hälfte bisher in der DDR noch nicht gedruckt worden war. Innerhalb weniger Tage sind die 15.000 Exemplare der ersten Auflage verkauft, eine zweite Auflage in gleicher Höhe erlebt den gleichen reissenden Absatz. Dies die Umstände, unter denen die Sensiblen Wege erschienen, wie gesagt, bis zur Auswahl von 1973 nur im Westen. Was mochte Leute wie Max W. Schulz so erbittert haben?
DAS ENDE DER FABELN
Es war einmal ein fuchs…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der fuchs die fabel
wird er ihn holen
Es war einmal ein bauer…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der bauer die fabel
wird er ihn schlachten
Es war einmal…
Schau hin schau her
Nun gibt’s keine fabeln mehr
Dreimal setzt der Hahn an, eine Fabel zu dichten. Zielscheibe seines ersten Angriffs ist der Fuchs, sein Erzfeind. Doch wie er die Folgen seiner Herausforderung begreift, verstummt der Hahn. Doch gegen den Bauer, seinen künftigen Schlächter, wird er’s wohl wagen dürfen? Doch nein, seinen frühzeitigen Tod will er nicht provozieren. Noch einmal rafft er sich auf doch niemand fällt ihm ein, dem er ungestraft den Spiegel vorhalten dürfte. Er verfällt dem Schweigen.
Aufgabe der Fabel ist Kritik, ihr Zweck Besserung. Wo Kritik mit dem Tod bedroht wird, und es gibt nicht nur den physischen Tod, da verstummt sie… oder flieht, wie hier, in eine Maskeradenform der Fabel. Der Tod der Fabel wird, paradoxerweise, in einer Fabel verkündet, was gegen ihre eigene Aussage ihr Fortexistieren bezeugt. Es gibt aber Zeiten, da selbst das Schlupfloch der Fabel gegen den Zugriff der Mächtigen nicht genügend Schutz bietet.
DAS ENDE DER KUNST
Du darfst nicht, sagte die eule zum auerhahn,
du darfst nicht die sonne besingen
Die sonne ist nicht wichtig
Der auerhahn nahm
die sonne aus einem gedicht
Du bist ein künstler,
sagte die eule zum auerhahn
Und es war schön finster
Die Bedingung der Möglichkeit, die Dinge im Licht zu sehen, das heisst, so wie sie sind, will die Eule aus den Gedichten des Auerhahns verbannt sehen. Die Sonne steht aber auch als Inbegriff alles Wahren, Lauteren, Erleuchteten. Zuerst verbietet die Eule, dann versieht sie den Folgsamen mit einem lobenden Etikett. Verbot wie Lob beschränken den Künstler und treffen somit die Welt, in der fortan muffiger Obskurantismus triumphiert.
Lyrische Aphoristik
Kunze, der Lorca, die moderne tschechische Poesie, Heine und Brecht als Vorbilder seiner Lyrik nennt, bestimmt den Zweck seines Schreibens so:
Ich schreibe, um mein Leben zu intensivieren, um Situationen zu bewältigen, die ich anders nicht bewältigen kann, um Haltungen zu gewinnen und um innere Entfernungen zu Menschen, die ich nicht kenne, zu verringern. (Wallmann, S. 132)
Und in zimmerlautstärke S. 65:
Das gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und aussen.
Ein eminent didaktisch-aufklärerischer Zug durchzieht Kunzes Werke, seine Verse singen und rühmen nicht, sie zeigen, wie nach Heraklit der Gott zu Delphi:
Er spricht nicht aus und verbirgt nicht, sondern gibt Zeichen (be-deutet).
Man hat von „lyrischer Aphoristik“ gesprochen. Kunze scheut jedes überflüssige Wort, er spart aus, spricht leise nur weniges, präzis:
Oft besteht zwischen der Kürze eines Gedichts und der Zeit, die ich darüber nachgedacht habe, ein umgekehrtes Verhältnis. (Wallmann, S. 168)
Wo Worte inflatorischem Verschleiss ausgesetzt sind, kann nur Schweigen oder dem Schweigen nahes andeutendes genaues Benennen die Wahrheit vor Verrat schützen. Dabei sind seine Verse nicht dürr, unanschaulich, sondern sie atmen in Bildern, sind voll der alltäglichen Dinge, deren Zeigecharakter Kunze oft ingeniös aufspürt.
Immer wieder verteidigt Kunze die Stellung der Poesie:
PUSCHKINS MICHAILOWSKOJE
aaa„Die front ging hier
aaadurch den garten“
Beklommen, doch
ohne schuldgefühl
Verzeiht
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum geg-
ner hätten sie mich
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
Ein Museumsführer erklärt, die Frontlinie des Zweiten Weltkrieges sei mitten durch den Garten von Puschkins Landgut Michailowskoje, wo der Dichter 1824–1826 interniert war, verlaufen. Kunze ist betroffen, doch er fühlt sich nicht verantwortlich. „Verzeiht“: das heisst, verzeiht den Irrwitz unserer Väter, oder doch eher: verzeiht, dass ich an anderes denke, an das „hier und jetzt“. Die Gärten der Dichter sind offen, blindwütigem Anrennen schutzlos preisgegeben. Und dennoch, standhaft würde jeder Zoll eigenen Geländes verteidigt.
(…)
zimmerlautstärke
Seneca lieferte das Motto zu den 1972 erschienenen Gedichten zimmerlautstärke:
… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
Zwischen Zuruf und Schweigen, das ist der Ort dieser Gedichte.
„Zimmerlautstärke“, das bedeutet Vorsicht, Misstrauen, Rückzug ins Private, Insistieren auf der Unantastbarkeit des Einzelnen gegenüber vermessenen Ansprüchen des Kollektivs; der Titel kündet aber auch vom Glauben, dass Dichtung nicht laut sein muss, um eindringlich zu wirken (anders als bei Kunzes Freund, aber nicht „Genosse“, Biermann). Gegenüber den Sensiblen Wegen sind die Gedichte noch kürzer, schärfer im Ton, bitterer (aber nicht verbittert) geworden:
AUF EINEN VERTRETER DER MACHT
ODER
GESPRÄCH ÜBER DAS GEDICHTESCHREIBEN
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Eine Gruppe Gedichte unter dem Titel „wie die dinge aus ton“ ist der Tschechoslowakei gewidmet. Kunzes Frau ist Tschechin, in diesem Land hat er in schwieriger Zeit gelebt („die Tschechoslowakei war für mich für fast ein Jahrzehnt geistiges Asyl und literarische Heimat“), die moderne Lyrik dieses Landes hat er in deutsche Verse übertragen. Das Ende des Prager Frühlings bedeutete für ihn Erschütterung, Enttäuschung; sachte gewachsenes Vertrauen war zerbrochen: „nun ist es schwer den weg zu euch zu finden“, und:
Der winter wird hart sein und lang.
Und doch, es gibt Zeichen der Hoffnung, dass die unheilvolle Gegenwart in eine lichtvollere Zukunft mündet, so die Zuerkennung des Nobelpreises an Solschenizyn, dessen Werke in der DDR niemals publiziert wurden, am 8. Oktober 1970:
……
Ein tag der die finsternis
lichtet
Der ans mögliche erinnert:
Immer wieder einen morgen
auf sein gewissen nehmen
Kurt Steinmann, Neue Zürcher Nachrichten, 10.9.1977
Der blaue Vogel soll fliegen
Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.
Friedrich Schiller formulierte diesen Gedanken vor ca. 220 Jahren, und die Mütter und Väter des Grundgesetzes knüpften mit Artikel 5 Abs. 3 daran offenbar bewusst an, als sie formulierten:
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Wird gegen Künstler – wie heute in China z.B. gegen Ai Wei-Wei, wie in Russland z.B. gegen Pussy Riots, wie im Iran z.B. gegen Jafar Panahi oder wie damals in der DDR z.B. gegen Reiner Kunze – vorgegangen, so wird umso deutlicher, dass die Freiheit der Kunst (die nicht mit Vogelfreiheit verwechselt werden darf) einer der wesentlichen Indikatoren und Gestaltungsfaktoren anti-totalitärer moderner Gesellschaften ist. Die Vorherrschaft ideologischer Machtansprüche sowie der Mangel an Demokratie manifestiert sich besonders daran, dass Künstler, die auf der Freiheit und Verantwortung von Kunst bestehen, marginalisiert, ausgegrenzt oder als Staatsfeinde verfolgt werden. In dem Maße, wie sich eine moderne demokratische Gesellschaft der Inspiration durch den freiheitlich-widerständig-kreativen Geist der Künste verschließt, verfällt sie in Demokratie-Defizite, Geistlosigkeiten, alte Gewohnheiten. Insofern besteht auch in Deutschland einiger Handlungsbedarf (zumal durch enorme Einflusssphären ehemaliger DDR-Kulturfunktionsträger seit der Wiedervereinigung, durch die ehemalige DDR-Dissidenten-Künstler massiv ausgegrenzt werden). Der oben genannte – im Grundgesetz verankerte – Gedanke ist also enorm wichtig.
Es bleibt indes die Frage, wovon und wofür Kunst und Wissenschaft in einer modernen demokratischen Gesellschaft frei sein sollten. Zugespitzt wird diese Frage durch die Problematik der Moderne, die sich durch das tiefe Eingreifen moderner Technologien in kleinste Teilchen (z.B. in Gene, Atome, Ozon) und damit in große langfristige Lebenszusammenhänge kennzeichnet. Dies bildet eine geradezu wahnwitzige Herausforderung an die Entwicklung der menschlichen Intelligenz. Nach dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz lautet diese Herausforderung zusammengefasst: Wird die Menschheit „zu dumm zum Überleben“ sein? Zumal Kunst und Wissenschaft als Intelligenzenergien gedacht werden können, geht es mit der Freiheit und Verantwortung von Kunst und Wissenschaft daher um die Kraft und Zukunftstragfähigkeit der menschlichen Intelligenz und der menschlichen Gesellschaft als Ganzes. Mit seiner gleichermaßen hochpoetischen wie hochpolitischen Nachdichtung von Jan Skácels „Der blaue Vogel“ (blau, die Farbe der großen Zusammenhänge, der Weite, der Tiefe, der Freiheit!) rückt Reiner Kunze die entsprechenden Fragen einmal mehr in den Fokus.
DER BLAUE VOGEL
Über den wassern, ach, über den wassern
erhob sich ein vogel ins blau.
Keiner weiß, wie, keiner weiß, wann
der vogel sich über die wasser erhob,
über den drahtverhau.
Seit dem Ende der DDR wurde so getan, als sei der Realsozialismus eine moderate Angelegenheit gewesen. Doch: ca. 70 Millionen Tote durch Mao zu Friedenszeiten, 29–46 Millionen Tote in den sowjetischen Gulags, 1–2 Millionen bestialisch Erschlagene in Kambodscha, ungezählte Tote im Horror nordkoreanischer KZs (s.a. Film Camp 14), ungezählte mittels Zersetzung gebrochene Biografien durch das MfS der DDR. „Auschwitz der Seelen“ nannte es Jürgen Fuchs. Entsprechend gab es in der DDR keine Freiheit für Kunst und Wissenschaft. Nur in dem Maße, wie sie sich von der SED-Diktatur willfährig in Dienst nehmen ließen, wurden ihnen gewisse Handlungsspielräume zugestanden. Was bedeutete das für die mentale Entwicklung einer Gesellschaft? Heute lässt sich meines Erachtens konstatieren, dass es nicht zuletzt dissidente Künstler waren, die das totalitäre Spiel nicht mitspielten und damit zur Beseitigung der SED-Diktatur beitrugen. So sehr sich die wendehalsigen ehemaligen SED-Kollaborateure dagegen wehren, wird die DDR-Kultur früher oder später unter diesem Gesichtspunkt reflektiert werden müssen und dabei den großen Wert der Kunst von Künstlern wie Reiner Kunze ans Licht bringen. Jan Skácel dichtete:
Alle aber sahen
seinen schnabel,
sahn des vogels festen schnabel.
Alle aber sahen seine krallen,
sahn des vogels scharfe krallen.
Reiner Kunze machte in verschiedenster Form immer wieder darauf aufmerksam, wie wesentlich Freiheit und Individuum sind, um den Stand der Gezeiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. So lernte ich ihn 1971 erstmals kennen. Beim Jahrestreffen von Vertrauensstudenten der Evangelischen DDR-Studentengemeinden in Bad Saarow, wohin er zu einer Lesung eingeladen war, las mit ihm vor uns jungen Leuten ein Dichter, der sich nicht nur der Probleme dieses traurigen Landes in ihrer ganzen Tragweite und Tiefe bewusst war, sondern sie in eine knappe Sprache und mit einer unglaublich schön und zutreffend ausgeschliffenen assoziativen Metaphorik zu fassen vermochte. Ich war begeistert. Zurück in Weimar begann ich per Hand mit mehreren Blaupause-Durchschlägen Reiner Kunzes Gedichte abzuschreiben und sie an Freunde zu verteilen. Das war nicht ungefährlich, doch fanden mit solchem Samisdat-Verfahren seine Gedichte unter Studenten einige Verbreitung. Zugleich begann ich meine „Drei Lieder nach Texten von Reiner Kunze“ zu planen und mit ihm in einen kleinen Briefwechsel zu treten. Einer der drei damals von mir vertonten Texte lautet:
EINLADUNG ZU EINER TASSE
JASMINTEE
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Angesichts der lauten SED-Parolen schweigen zu dürfen, nicht mitschreien zu müssen, war damals ein entwaffnender freiheitlicher Ansatz. Es war etwas völlig anderes, als schweigen zu müssen. Mit der Vertonung dieses Kunze-Gedichtes wendete ich sozusagen für mich das Blatt, denn an der Weimarer Musikhochschule, wo ich in den Hauptfächern Fagott und Komposition studierte, hatte man mich als „spätbürgerlichdekadent“ eingestuft, weshalb meine Musik an dieser Hochschule mehr oder minder zum Schweigenmüssen verurteilt war. Nachdem sich mein Hauptfachlehrer – der „Zwölftöner“ Günter Lampe, der mich über Arnold Schönberg an die großen Fragen der Musik der Moderne heranführte – vergeblich bemüht hatte, mir das Kompositionsstudium als I. Hauptfach zu ermöglichen, hieß es angesichts meiner offensichtlichen fachlichen Qualifikation dann jedoch von Johann Cilenšek (bis 1972 Rektor der Weimarer Hochschule) an das zuständige Direktorat: „Wallmann einladen und auffordern, Unterlagen beizubringen für den offiziellen Antrag zur Aufnahme in die Meisterklasse“ (so zeigt es meine Studentenakte von 1972). Ich reichte u.a. meine „Drei Lieder nach Texten von Reiner Kunze“ ein, mit denen beim DDR-Kulturministerium der offizielle Antrag für mein Kompositionsmeisterstudium gestellt und abgelehnt wurde. Meine Reiner-Kunze-Lieder dürften (neben meinem Engagement in der Evangelischen Studentengemeinde) einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen sein. Erstmals hatte nun auch ich selbst einen höheren Preis dafür zu bezahlen, Kunst als Tochter der Freiheit praktizieren zu wollen. So ging es für mich (gerade mal 21-jährig) zunächst ins Orchester; zuerst nach Meiningen, dann in die Staatskapelle Weimar.
Alle aber sahen
seine augen,
sahn des vogels klare augen.
Alle aber sahen
seine federn,
sahn des vogels blaue federn.
Mit einemmal erblickten sie
die blauen augen der mutter.
1975 gründete ich in Weimar unmittelbar die gruppe neue musik weimar, das erste Spezialensemble für zeitgenössische Musik Thüringens, mit dem ich u.a. Werke von „spätbürgerlich-dekadenten“ Komponisten wie Stockhausen, Schönberg, Webern, Messiaen (die allerdings außerhalb der SED-Schusslinien standen) zur Aufführung brachte. Noch bevor mein Engagement in der Weimarer Staatskapelle begann, hatte mich die Weimarer Musikhochschule jedoch auch noch um mein Diplom betrogen, das ich 1974 mit „1“ verteidigt hatte. Mir dämmerte langsam, dass der Preis, der für Kunst als Tochter der Freiheit zu zahlen ist, sehr hoch sein kann (wobei mir damals noch nicht der schillersche Freiheitsbegriff bewusst war). Umso mehr bewunderte ich jene Künstler, die ihn zu zahlen bereit waren – und Reiner Kunze stand von diesen für mich in der ersten Reihe.
Überraschenderweise fand ich mein nie ausgehändigtes – doch bereits ausgestelltes – Diplom 2008 in meiner Weimarer Studentenakte. Diplombetrug war eine übliche Methode der SED-Diktatur, um widerständige Studenten zum Schweigen zu bringen, zumindest aber in ihrem beruflichen Fortkommen zu behindern. Sie fand auch z.B. bei Wolf Biermann oder Jürgen Fuchs Anwendung. Heute könnte der Fund einer solchen Diplomurkunde eigentlich eine Trophäe sein – ein Beweis gelebter Freiheit der Kunst. Doch die Weimarer Hochschule sieht es offenbar als Schandfleck und drückt sich darum, sich zu ihrem einst begangenen Betrug zu bekennen und damit ihre eigene Verstricktheit in die SED-Diktatur aufzuarbeiten. Kunst als Tochter der Freiheit ist ihr offenbar ganz und gar unwichtig, womit sie ein wesentliches Essential moderner Kultur in Abrede stellt und damit letztlich sich auch selbst keinen Gefallen tut.
Doch zurück in das Jahr 1976. Im September erschienen in Westdeutschland Kunzes Die wunderbaren Jahre – ein Buch, das Alltagssituationen von Jugendlichen in der DDR ungeschönt festhält. Das war starker Tabak für die SED, deren „Lösung“ oft genug in der Verfälschung bzw. dem Verschweigen von Fakten sowie der konspirativen Zersetzung von jenen Personen bestand, die es sich erlaubten, Fakten zu benennen und damit den Absolutheitsanspruch der SED aushebelten. Ich las Die wunderbaren Jahre in einem Zug. Unter „FLUGBLATT NR. 5“ zitiert Kunze einen Gedanken von Le Corbusier, den ich bis dahin so nicht kannte und mir einprägte:
Man macht keine Revolution, indem man aufbegehrt; man macht eine Revolution, indem man die Lösung bringt.
Zukunftstragfähige Lösungen setzen zukunftstragfähige gedankliche Reflexionen voraus – das war es, was mich wirklich interessierte!
Mit einem mal gewahrten sie
schiffe, schiffe, schnelle schiffe,
die zur freiheit, fern der riffe,
still das blaue wasser teilen.
Überhaupt war 1976 für meine künstlerische Entwicklung ein wichtiges Jahr, in dem viele Würfel fielen. Ich hatte nicht nur den Berliner Komponisten Friedrich Goldmann kennengelernt, sondern auch den Gothaer Maler/Entwerfer/Kunstphilosophen Kurt W. Streubel – ein Genie. Er, der sich keinerlei Vereinnahmung und Abhängigkeit preisgab, gehört für mich ebenso wie Reiner Kunze in die erste Reihe jener, die in der DDR für Freiheit der Kunst einstanden. Streubel umriss sein Werk mit den drei Worten „abstrakt-konstruktiv-konkret“, bot der realsozialistischen Kunstdoktrin Paroli und mir den Anschluss an die Ideenwelten des Weimarer Bauhauses – an Wassily Kandinski und Paul Klee. Damit initiierte er in mir jenen enormen Denkstoff, der mich zur Entwicklung von Integrale Moderne führte, was im Sommer 1977 begann und erst 28 Jahre später seinen vorläufigen Abschluss fand: Integrale Moderne – Vision und Philosophie der Zukunft, Pfau-Verlag 2006. Neben der unter Dissidenten und Protestanten allgemein verbreiteten „Hierbleib-Ideologie“ war es dies, was mich jahrelang fesselte, in der DDR zu bleiben.
Mit einem mal gewahrten sie
segel, segel, weiße segel,
die wie brot im mund, wie vögel
sich verlieren, die wie vögel
still im blauen uns enteilen.
Am ersten Oktoberwochenende 1976 – ca. sechs Wochen vor der Ausbürgerung Wolf Biermanns – waren meine Frau Susanne und ich von Sibylle Havemann, Jürgen und Lilo Fuchs sowie Robert und Katja Havemann nach Grünheide eingeladen. Wolf Biermann kam auch und abends wurde ich aufgefordert, per Tonband etwas von meiner Musik vorzustellen. Robert Havemann äußerte sich euphorisch über das, was er von mir gehört hatte – u.a. meine Reiner-Kunze-Lieder, Wolf Biermann behandelte mich wie immer mit freundlichem Respekt. Im Verlauf des Gespräches kam die Rede auch auf Reiner Kunze. Da er die DDR verlassen wollte, wurde er in dieser Runde sehr kritisch gesehen; ich teilte diese Einschätzung nicht und stellte mich voll hinter ihn, wodurch ein gewisser Dissens aufkam. Ich wusste aus eigener Erfahrung nur zu genau, welch schwere Folgen der DDR-Unrechtsstaat für eine Familie haben kann und dass es Belastungsgrenzen gibt. Denn meine Mutter war Anfang 1954 gestorben, nachdem mein Vater – damals Leipziger Stadtjugendpfarrer -1953 in großen Zeitungsartikeln diffamiert worden war, ein „amerikanischer Agent“ zu sein, womit ihm quasi die Todesstrafe drohte.
Mit einem male sahen sie
tücher, tücher, blau gestickt,
mit blumen blau, zu haus gepflückt
im feld, mit blumen, die so schmerzen,
die so schmerzen, so sehr schmerzen,
aber alle wunden heilen.
Was die politische Spannung 1976 in der DDR anging, so hatte sie im Herbst derart stark zugenommen, dass sie für uns alle mit Händen zu greifen war. Reiner Kunze hatte nun erneut einen hohen Preis zu zahlen, dass er Freiheit der Kunst praktizierte. Am 3. November wurde er mit scharfen ideologischen Hasstiraden aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen und bewies dabei einmal mehr das ihm eigene Stehvermögen. In seinem Buch Deckname ,Lyrik‘ zitiert er die Stasi, die zu seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband festhielt:
Kunze unterstrich […], dass sich nach seiner Auffassung im Vereisungsprozess der DDR faschistoide Machtstrukturen dergestalt ausgeprägt hätten, dass der Sicherheitsdienst alle Vorgänge im Leben beherrscht und die meisten Bürger über diesen Vereisungsprozess gar nicht mehr nachdenken. Dieses Nachdenken wolle er mit seinem Buch anregen.
Diese Sicht der Dinge traf die Situation. Auch ich selbst empfand die DDR je länger je mehr als faschistoid.
Riefen alle nach dem vogel,
in die höhe nach dem vogel,
mit gewaschnen hemden
winkten sie dem vogel.
Mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns wurde für uns der Herbst 1976 dann ein wirklich heißer Herbst. Lilo Fuchs beschrieb in einem Gespräch mit Udo Scheer die Situation dieser Tage so:
Niemand wusste ja, was noch losgehen würde. Jeder war wie elektrisiert. Erst haben wir befürchtet, sie würden Havemann inhaftieren. Das haben sie sich nicht getraut. Für ihn holten sie die nicht so bekannten jungen Männer.
Wie die Stasi-KD Gera am 28. Dezember 1976 festhielt, schrieb Reiner Kunze an Karl Corino:
Meine größte Sorge sind jetzt diejenigen, die keine Öffentlichkeit haben.
Wohl angesichts der allgemeinen Vereisungssituation schickte Reiner Kunze mir zum Jahreswechsel 1976/77 eine Neujahrskarte, auf der stand:
Mit einem Bündel Grußreisig, zum Abdecken der Seele, falls es zu sehr frieren sollte.
Unser Geist, unsere Seelen – das Freieste, was ein Mensch sich wünschen kann – zitterten. Es war eiskalt, sodass Kunzes „Bündel Grußreisig“ tatsächlich hilfreich war.
Wohin gehst du, blauer vogel,
klares wasser trinken?
Sag, wo pickst du goldnes korn,
sag, wo schläfst du unterm dorn,
sag doch, sag doch, wo?
Im Sommer 1976 hatte ich eine Suite für Solovioline mit dem Titel „Briefe zur Nacht“ komponiert und als Satzüberschriften Fragmente aus Reiner-Kunze-Gedichten gewählt: „meine suchende feder“ / „wie ein vogel davonfliegen“ / „plädoyer der fieberträume“ / „aber die hoffnung nicht verschweigen“; („Briefe“ sind bei Reiner Kunze ein großes Thema). In dieser Violinsuite taucht zum ersten Mal in meinem Werk das Wort Vogel auf. Da Vögel für mich Sinnbild und Boten der Freiheit sind, spielen sie fortan in meinem Werk eine wichtige Rolle. Titel wie „gleich den Vögeln“ (Musik im Raum für 4 Klarinetten oder Sopransaxophone, 1986) oder „Der blaue Vogel“ seien dafür als Beispiele genannt. „Mit Briefe zur Nacht“ hatte ich im Sommer 1976 bereits jene Problematik künstlerisch zu bearbeiten begonnen, die uns in den vereisten 1976er November-/Dezembertagen real eingeholt hatte.
Sang der blaue vogel:
Wo die mutter euch gebar,
dorthin geh ich wasser trinken.
Dort, wo eure kindheit war,
pick ich goldnes korn,
schlaf ich unterm dorn,
dort zu haus, bei uns.
Was die Situation Ende 1976 in der DDR betraf, so war klar, dass Biermanns Ausbürgerung als eine politische Richtungsentscheidung gesehen werden musste und dass mit ihr für die nächste Zeit alle Chancen auf einen „Berliner Frühling“ dahin waren. Mich kompositorisch zu entwickeln und mit Streubel im Rücken philosophische Grundlagen für die Kultur der Zukunft zu entwickeln, schien mir jedoch nach wie vor möglich. Zumal ich hinsichtlich Agitprop-Kunst keinerlei Ambitionen verspürte, erblickte ich darin meine erste Aufgabe, der ich mich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten unter Aufbietung all meiner Kräfte widmete.
Riefen alle da von neuem,
riefen hoch hinauf von neuem,
winkten alle mit den hemden
lange da von neuem.
Während die Stasi gegen uns in Kirchheim (wo wir 1974 mit Freunden auf einem stillgelegten Bauernhof eine der wenigen „DDR-Kommunen“ gegründet hatten) die Ermittlungsakte OV „Kreis“ eröffnet hatte, konnte am 13. April 1977 Reiner Kunze die DDR endlich in Richtung Westen verlassen. Es gab nach den vielen Extrembelastungen, denen er über all die Jahre ausgesetzt war, dazu keine wirkliche Alternative. Was Jürgen Fuchs und Robert Havemann sowie die Jenaer Verhafteten betraf (von denen uns wie Sybille Havemann und Wolf Biermann einige mehrfach in Kirchheim besucht hatten), so hofften wir zutiefst, dass Biermann gemeinsam mit Kunze nun etwas Wesentliches für deren Freilassung bewirken könnte. Unter Datum vom 19. April 1977 notierte Susanne über Ostern zu einem Radiointerview:
Abends: Interview mit Reiner Kunze. Er hat sehr gut gesprochen: haben Sie Geduld. Gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand. Lernen Sie, äußern Sie sich mit solch hoher Qualität, dass Ihre Aussagen von der Öffentlichkeit getragen werden, dass Sie von der Öffentlichkeit geschützt werden. Ich wünsche dem Land, dass alles gut geht, dass alles gut wird, den vielen guten Menschen zuliebe, die darin leben.
Was Reiner Kunze uns – nun vom Westen aus – zu verstehen gab, traf die Situation. Auch für mich war das der Weg, auf dem es sich vermutlich eine Zeit lang gehen lassen würde und den ich bereits bewusst zu beschreiten begonnen hatte.
Fliege, blauer vogel, fort,
fliehe, fliehe diesen ort.
Unterm blau des himmels ziehe
hin am blau, die kugel fliehe,
flieh das blei.
Durch die Aufführungen meiner Musik, die ich mit meinem Weimarer Ensemble durchzusetzen vermochte, wurde meine kompositorische Begabung offenbar unüberhörbar. Daher versuchte man seitens der DDR-Komponistenverbandes (der ein Instrument der SED-Diktatur war) immer stärker, mich zu vereinnahmen. Im Februar 1978 kamen zu den DDR-Musiktagen in Berlin meine „Yukihara-Gesänge“ (nach einem altjapanischen Gedicht) sowie meine „Briefe zur Nacht“ (mit den Satzüberschriften von Reiner Kunze) zur Aufführung, letztere durch den Konzertmeister der Staatskapelle Berlin. Für die Briefe erhielt ich einen Kompositionspreis der DDR-Musiktage 1978. Niemand hatte allerdings bemerkt, dass die Überschriften der Sätze dieser Violinsuite aus Texten von Reiner Kunze stammten, und ich selbst schwieg dazu wie ein Grab. Ich freute mich diebisch, dass dieses Stück nun an prominenter Stelle aufgeführt werden würde und Reiner Kunzes Gedankenwelt damit quasi wieder anwesend war. Ich verließ mich auf die Kraft der Musik selbst. Oder waren gerade diese ersten prominenten Aufführungen meiner Musik der Versuch, mich zu vereinnahmen und in die Abhängigkeiten des Drahtverhaus der SED-Diktatur zu bringen?
Sang der blaue vogel:
Ich fürchte nicht die schnelle kugel,
nicht das blei.
Eure mütter sandten mich.
Ob euch nichts im schlafe schreckt,
ob euch brot und segen weckt,
hießen sie mich fragen.
Obwohl ich mich nicht darum beworben hatte, erhielt ich 1980 auch den Hanns-Eisler-Preis von Radio DDR. Nach dem Preisverleihungskonzert mit der Uraufführung meiner „Stadien“ durch das Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig unter Wolf-Dieter Hauschild fand ganz oben im damaligen Hotel Stadt Berlin am Alexanderplatz ein Empfang statt. Als wir – Susanne und ich – etwas verspätet dort eintrafen, fanden wir eine eigenartig skurrile Atmosphäre vor. Alle Teller des Buffets waren abgegessen, überall standen Herren in schwarzen Anzügen und mit dunklen Brillen eigenartig tuschelnd beisammen. Mir lief es kalt den Rücken herunter. An diesem Abend begriff ich, dass Erfolg einen Künstler verschlingen kann, wenn er es nicht versteht, dagegenzuhalten. Und so ging ich nicht auf Prof. Schönfelder ein, der die Laudatio gehalten hatte und mich nun vor einigen Personen des Kulturministeriums bedrängte, die Idee einer ideologiefreien Kunst, die ich im Juli 1980 beim Geraer Ferienkurs für Neue Musik vertreten hatte, zurückzunehmen. Einige Tage nach der Preisverleihung erhielt ich von meinem ehemaligen Weimarer Lehrer Günter Lampe einen Glückwunschbrief, in dem er mir schrieb:
Hüte Dich, bitte, vor eventuellen Beifall von der falschen Seite, so schmeichelhaft er auch für den vergänglichen Augenblick sein möge.
Er hatte verstanden, worum es ging; das tat mir wirklich gut.
Riefen alle da von neuem,
riefen hoch hinauf von neuem;
winkten mit den hemden
lange da von neuem.
Grüße, vogel, grüß zu haus,
richte viele grüße aus.
Wir schlafen ein mit näglein besteckt,
wachen auf, vom brot geweckt,
vom brot, von brot und segen.
Der Gedanke „ideologiefreie Kunst“ war für mich unaufgebbar. Er stand für Freiheit der Kunst. Ich reagierte mit ihm nicht nur auf die realsozialistische Instrumentalisierung der Künste, sondern entwarf auf seiner Basis ein neues Konzept avancierter Kunst und Musik (Integral-Art, auf dessen Grundlage ich ab 1991 große avancierte Klangprojekte realisierte, die von Zigtausenden besucht wurden). Bereits zu Beginn des Jahres 1981 legte ich dazu in einem Vortrag als Goldmanns Meisterschüler bei einer Sitzung der Ostberliner Akademie der Künste einen umfassenden philosophischen Ansatz vor. Dieser bezog sich (ich knüpfte an James Joyce an) im Kern auf das ästhetische Wechselspiel zwischen der synthesischen Wahrnehmung des Ganzen und der analytischen Wahrnehmung der Teile, zwischen den Relationen des Intelligiblen (Wahrheit) und den Relationen des Sensiblen (Schönheit). Es ging mir darum, essentielle philosophische Fragen von Kunst (sowie der europäischen Kultur überhaupt) neu zu stellen und in ihrer Tiefe neu zu durchdenken; ein Schritt in Richtung Integrale Moderne. In Das weiße Gedicht (S. Fischer 1989) sagt Reiner Kunze es so:
Ideologen jeder Couleur pflegen dem Wort ,ästhetisch‘ ein pejoratives ,nur‘ voranzusetzen, sobald ein Kunsturteil ästhetische Kriterien über ideologische stellt. Der Begriff ,nur-ästhetisch‘ ist eine Denunziation des Ästhetischen, denn es sind die ästhetischen Qualitäten, die ein Kunstwerk zum Kunstwerk machen, und die ästhetischen Kriterien sind die ihm einzig gemäßen; nur mit ihnen lässt es sich in seinem Wesen erfassen.
Dem ist nichts hinzuzufügen, denn mit dem Ästhetischen geht es um nichts weniger als um die Wahrnehmung des Zusammenwirkens zwischen den Teilen und ihrem Ganzen (resp. Kaputten) und damit auch um die Wahrnehmung unserer Freiheit und Verantwortung selbst – wo auch immer wir tätig sind. Ich habe diesen Gedanken daher in Satz 10 von Der blaue Vogel vertont.
Sang der blaue vogel:
Warum kommt ihr nicht nach haus,
bleibt so lange aus?
Frühling ist’s, der schnee zerrinnt,
auf dem weg zum meere sind
alle flüsse… Aber ihr?
Ließen sie die köpfe sinken,
ließen sie die arme sinken,
hielten ein, mit ihren hemden
hoch hinauf zu winken.
Nachdem ich 1986 Integrale Moderne in Grundsätzen entwickelt hatte (wobei mir damals noch der Begriff der Postmoderne querstand), stellte ich gemeinsam mit meiner Frau und für unsere beiden Kinder am 31. März 1986 einen kulturpolitisch begründeten DDR-Ausreiseantrag. Es war für uns zu diesem Zeitpunkt klar, dass Reformen in der DDR nicht zu erwarten waren und höchstens durch Ausreiseanträge bewirkt werden konnten. So begann unser ganz persönlicher Sturm auf die Mauer und – wie für viele andere (vor allen den Zigtausenden, die wegen ihrer Ausreiseanträge im Gefängnis saßen) – eine sehr schwere Zeit. Es sei daran erinnert, dass (nach der Ausreisewelle von Künstlern 1976/77) es die Ausreisebürgerrechtler und die Fluchtwellen waren, die die DDR-Lethargie überwanden, den Willen zur Freiheit massenhaft artikulierten, so die Mauer unterspülten und der deutschen Wiedervereinigung den Weg bereiteten. Doch wurde von den Wendehälsen solcher Mut nach dem Mauerfall zum Nichts marginalisiert. Viele sind daran nach der Wiedervereinigung noch einmal – und nun gründlich – zerbrochen. Wie es uns selbst seit dem Mauerfall erging, umreißt mein Buch Die Wende ging schief (Kulturverlag Kadmos 2009), das die – sowohl nach dem Nationalsozialismus als auch nach dem Realsozialismus – in Deutschland ausgebliebene Selbstverständnisdebatte anmahnt.
Eine solche Selbstverständnisdebatte könnte Last in Licht verwandeln. Reiner Kunze weist dazu auf Ilse Aichinger, die schrieb:
Wir sind gar nicht gemeint. Gemeint ist, was an uns Licht gibt.
Mit diesen Worten beginnt und endet mein Reiner-Kunze-Zyklus. Doch anstatt Licht zu geben, wurde nach der Wiedervereinigung in vielen Bereichen das Dunkel verlängert. Wohl auch um ihre eigenen Vergangenheiten zu übertünchen, waren ehemalige DDR-Kulturfunktionsträger einflussreichen „Wessis“ außerordentlich zu Diensten. Sie sorgten zugleich dafür, dass eine Aufarbeitung der SED-Diktatur im Bereich der Kultur weitgehend ausblieb oder aber von Schönfärberei sowie von – nach alten Mustern – neu installierten Abhängigkeiten dominiert wurde. Die Freiheit und Verantwortung von Kunst und Künstlern verwechselten diese Leute mit ihrer eigenen Machtfülle sowie der – in ihren Augen – Austauschbarkeit individuellen künstlerischen Ausdrucks. Zugleich verleugneten sie jene Künstler, die – anders als sie selbst – in der DDR bewusst die Kunst als Tochter der Freiheit gesehen hatten. Dass sie diese Werte der Entwicklung unserer Kultur vorenthielten, ist eine Kulturkatastrophe. Eine Musikwissenschaftlerin schrieb mir kürzlich entsprechend:
Und was soll denn dieser schillersche Freiheitsbegriff? Gerade in dieser ,neuen‘ Zeit erleben wir alle – Du auch, Johannes –, dass es den für Kunst nicht gibt, sondern nur verschiedenste Formen von Abhängigkeiten.
Darf eine moderne demokratische Gesellschaft (zumal die deutsche, die zwei totalitäre Staaten hinter sich hat) es zulassen, dass die im Grundgesetz Artikel 5, Abs. 3 garantierte Freiheit der Kunst nur eine Farce ist? Was passiert dann mit dieser Demokratie, verwandelt sie sich erneut in einen Drahtverhau?
Kleiner vogel, flieg nicht fort,
komm herunter aus dem blau,
flieg herab, uns zu bedauern,
doch zu haus verschweig das trauern,
das du siehst im drahtverhau.
Hörte es der blaue vogel.
Wie ein stein fiel er zur erde,
wie ein schöner blauer stein,
wie ein blauer edelstein.
Wie ein stein fällt er zur erde,
wie ein blasser blauer stern,
lange, lange fällt er nieder,
federn schweben vom gefieder,
mit dem kopf, dem kleinen kopf,
schlägt er auf.
Mit dem schnabel auch,
dem festen schnabel,
schlägt er auf.
Mit den krallen auch,
den scharfen krallen,
schlägt er auf.
Im ersten Quartal 2013 veranstaltete DRadio Berlin eine 7×90-minütige Sendereihe mit Hans Pischner, einem der hochrangigen Kulturfunktionäre und trickreichsten Vollstrecker der SED-Diktatur. Pischners Aufgabe bestand in seinen unterschiedlichen Funktionen vor allem darin, die SED-Diktatur kulturell zu bemänteln. Der von ihm forcierte allgemeine „Interpreten- und Virtuosenhimmel“ in der DDR verfehlte seine Wirkung nicht und stellte widerständige Kreativkünstler (Schriftsteller, bildende Künstler, Komponisten) umso mehr ins Aus. Dass Leute wie Pischner wieder salonfähig und DRadio Berlin sogar 630 Sendeminuten wert sind, liegt in der Logik der völlig ungenügenden Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sind sich die Verantwortlichen im Klaren, was es für die Zukunft unserer Kultur für Folgen hat, wenn quasi die Gefängniswärter geehrt werden, anstatt sich auf jene zu besinnen, die für die Kunst als Tochter der Freiheit einstanden? (James Joyce sprach von Kunst als den „Gefängnistoren der Seele“ – raus oder rein ist hier die Frage, erst recht angesichts der ungeheuren Macht der Unterhaltungsindustrie.)
Mit den augen auch,
den klaren augen,
schlägt er auf.
Nur die federn,
nur des vogels blaue federn
schwebten lange.
Schwebten nieder aus dem blau,
blaue federn, blauer tau,
schweben in das gras und strahlen,
blauen auf dem stein, dem kahlen,
blauen aus dem sand, dem fahlen,
fädchen aus der wälder naht,
schweben hin am stacheldraht,
hin an türmen, am MG,
blaue federn, blauer schnee.
Es ist bemerkenswert, wie Reiner Kunze seit dem Mauerfall seine Unabhängigkeit immer wieder unter Beweis stellte und vehement dafür eintrat, den Realsozialismus klar zu sichten und aufzuarbeiten, anstatt die DDR-Kultur mit Leuten wie Hermann Kant oder Hans Pischner verklären zu lassen. Kunzes mutige dokumentarische Bücher wie Die wunderbaren Jahre, Deckname Lyrik, Am Sonnenhang sprechen dazu eine klare Sprache. Dass er auch den Austritt aus der Berliner Akademie der Künste nicht scheute, zeigt sein Format:
Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte Sie, meinen Austritt aus der Akademie zur Kenntnis nehmen zu wollen. Ich möchte jedoch betonen, dass mir dieser Schritt schon heute für den Tag leid tut, an dem die Akademie der Künste vornehmlich wieder vom Geist der Künste inspiriert sein wird.
In Satz 8 meines Reiner-Kunze-Zyklus „Der blaue Vogel“ ist dieser Text vertont.
Vom Geist der Künste inspiriert sein, der sich als Tochter der Freiheit versteht. Vom Geist der Künste inspiriert sein, der Schönheit und Wahrheit miteinander vereint. Vom Geist der Künste inspiriert sein, „weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert“ (Friedrich Schiller).
Lasen alle auf die federn,
nahmen sich die blauen federn,
banden in die hemden
sauber sich die federn.
Augen, ach, der mutter augen,
schiffe, schiffe, schnelle schiffe,
segel, segel, weiße segel,
wasser, wasser, still geteilte,
blumen, blau gestickte blumen,
und die herzen, die zerrissnen,
blutenden, die blutenden.
Kunst als Tochter der Freiheit bildet eine Herausforderung an unseren Staat, unsere Kultur, unsere Gesellschaft. In dem Maße, wie sie angenommen wird, werden wesentliche Impulse zur modernen Weiterentwicklung von Kultur und Demokratie entstehen – auch zur Unterstützung all jener mutigen Künstler, die in anderen Ländern totalitären Machtansprüchen trotzen. Nur weil solche Unterstützung damals im Fall von Reiner Kunze von Westdeutschland aus gewährt wurde, konnte er dem Zugriff der SED-Schergen entrinnen und sein künstlerisches Werk fortsetzen. Das sollten wir angesichts der Not von Künstlern – z.B. in China, Russland, Iran – nie vergessen. Denn in der Kunst solcher Künstler liegt kulturelles Know-how für das Überleben der Menschheit.
Lasen alles in die bündel,
alle federn in die bündel,
und vergruben sie mit worten
traurig wie die bündel.
Dir war’s nicht gegeben, vogel,
herzufliegen aus dem blau,
her in diesen drahtverhau, kamst,
barmherziger, ums leben,
wirst du jemals uns vergeben?
Schwieg der blaue vogel.
Indem „Der blaue Vogel“ in den Drahtverhau abstürzt, richten Jan Skácel und Reiner Kunze eine eindrückliche Warnung an all jene, die die Problemlage allzu leicht nehmen. Denn genau darin, ihn nicht abstürzen zu lassen, ihn nicht zum Schweigen zu bringen, ihn nicht zu begraben, sondern seinen freien Flug zu gewährleisten, läge der große Gewinn für die kulturelle und demokratische Entwicklung Deutschlands, Europas sowie der Menschheit als Ganzes. Warum sollten wir – zumal Künstler wie Reiner Kunze dem im Sinne Friedrich Schillers sowie des Grundgesetzes kraftvoll voran gingen – nicht ganz darauf setzen?
[Dieser Text ist teils meinem Buch DIE WENDE GING SCHIEF (Kulturverlag Kadmos 2009) entlehnt. Das Gedicht DER BLAUE VOGEL von Jan Skácel in der Nachdichtung von Reiner Kunze ist Titel und Teil meines Reiner-Kunze-Zyklus DER BLAUE VOGEL – Musik im Raum für Bariton und Kammerensemble (2007) und wurde mit freundlicher Genehmigung von Reiner Kunze vertont. Der 15-sätzige Zyklus gelangte in Kooperation mit Deutschlandfunk 2009 im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie zur Uraufführung.]
H. Johannes Wallmann, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
Gespräch mit Reiner Kunze
– Das Gespräch mit Reiner Kunze führte Steffen Grabisna im Rahmen einer Spurensuche, bei der das jetzige Wirkungsfeld ehemaliger DDR-Schriftsteller beleuchtet werden soll. –
Aufbruchsstimmung.
Die gepackten Koffer verkünden „abreisereif!“.
Und trotzdem findet er Zeit zwischen Frühstück und mittäglichem Bestaunen des sonnenbadenden Bergeidechsen-Pärchens. Zeit, ehe er stolz seinen mammutmäßig sprießenden Mammutbaum hinten „Am Sonnenhang“ bewundert. Plötzlich betrittst du das Haus dieses ehemals verbotenen Dichters – waghalsig der Lehrer, der seinen Namen in der Deutschstunde nannte.
Zwischen den peinlich geordneten Bücherregalen, die nichts, kein winziges Wässerchen des Blicks auf die dort tatsächlich noch tiefblaue Donau versperren. Die zweite Heimat des Reiner Kunze.
Steffen Grabisna: „Am Sonnenhang“ enthält Erlebtes, Erinnertes, Gelesenes, Übersetztes, Gesagtes und Geschwiegenes. Gelesenes – mit Vorliebe wohl Albert Camus, den Sie anfangs zitieren:
Mit vierzig Jahren klagt man nicht mehr über das Böse, man kennt es und kämpft gemäß seiner Schuldigkeit. Dann kann man sich dem Schaffen zuwenden, ohne etwas zu vergessen.
Ihr persönlicher Zusatz:
Mit sechzig gilt das doppelt.
Worin erkennen denn Sie heute das Böse?
Reiner Kunze: Camus’ existentielle Absurdität ist das eine. Daß sich der Mensch dagegen auflehnt, das andere. Doch das Böse stellt sich mir – wohl auch Camus – nicht als philosophisch, sondern ganz real dar. Dabei müßte man zum Beispiel über den Krieg in Bosnien sprechen: Was heute am Ende des zweiten Jahrtausends nach Christus Menschen Menschen antun, das ist für mich die Inkarnation des Bösen.
Grabisna: Gemäß welcher Schuldigkeit oder Verantwortung versuchen Sie dagegen zu kämpfen?
Kunze: Das wenige, das der einzelne tun kann, zu tun. Und nicht daran zu verzweifeln, das man so vieles nicht beeinflussen kann.
Grabisna: Literarische Einflüsse wirkten schon seit Ihren kindheitsprägenden Einzelgängen auf Sie. Im „Sonnenhang“ befindet sich eine Auswahl von Werken, denen Sie grundlegende Erkenntnisse verdanken. Darunter auch Saint-Exuperys „kleiner Prinz“. Was verdanken Sie ihm?
Kunze: Die Philosophie in Märchen.
Grabisna: Der Lyriker Volker Braun charakterisierte Sie noch zu DDR-Zeiten als: „Er ist kein Krieger, kein Lohnsklave, kein Konzernschreiber und doch kennt er den Kampf und Not und Qual…“ Was entgegnen Sie Heißspornen, die meinen, Sie leben heute Ihre wunderbaren Jahre in niederbayerischer Schrebergarten-Idylle ,am Sonnenhang‘?
Kunze: Wer das sagt, hat entweder meine Bücher nicht gelesen oder er kann nicht lesen. Oder eine Ideologie hat ihm solche Barrieren gesetzt, daß er auch nicht willens ist zu lesen. Ideologien können nicht nur das Hirn, sondern auch die Augen verplomben.
Grabisna: Schatten ideologiebeladener Vergangenheit zeigen sich dem Leser in schonungslos erschütternder Weise…
Kunze: Im „Sonnenhang“ wurde ein ganzer Lebensabschnitt reflektiert, der längste in meinem Leben. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme ist nun auch dieser für mich zu Ende gegangen. In diesem Buch habe ich versucht, gedanklich Ordnung zu schaffen. Einiges abzuschließen, innerlich – soweit möglich.
Grabisna: Doch neben dem allmählichen Sterben Ihres Vaters, dem Bergmann aus Ihrer ersten Heimat, dem erzgebirgigen Oelsnitz, zeigen sich im Buch vor allem Bestürzung beim Lesen der Briefe Ihres Leipziger Freundes Horst Drescher. Briefe als einziges Ventil gegen Veröffentlichungsverbot. Zensur, deren Druck auch durch Leute wie dem Ex-Präsidenten des DDR-Schriftstellerverbandes, Hermann Kant, ausgeübt wurde. Wie wichtig war Ihnen nach dem Zwangsausschluß Mitte der 70er Jahre die Wiederaufnahme?
Kunze: Es war keine Wiederaufnahme in den Schriftstellerverband des Hermann Kant – die habe ich abgelehnt. Vielmehr sammelten Greizer Demonstranten im Oktober ’89 Unterschriften dafür, daß mein Ausschluß von Gera und Weimar rückgängig gemacht wird. Ja darüber habe ich mich riesig gefreut, hätte es nie für möglich gehalten.
Grabisna: Seitdem sollte ein eigentlich neues geeintes Deutschland entstehen. Unsere alte literarische Elite hüllt sich jedoch größtenteils in „Verlustschmerz als letzter Einheit“. Wann wird der „deutsche Überzinnsoldat“ schmelzen? Welche Hoffnungsstreifen sehen Sie am nun ideologiefreien deutschen Dichterhimmel?
Kunze: Der Überzinnsoldat wird nie schmelzen. Und neue Dichter? Ich habe mich jetzt sehr mit einer ganzen Reihe von jungen Leuten beschäftigt, deren Namen ich nur kannte. Beinahe täglich erreichen mich Briefe mit Texten zum Rezensieren. Aber ich möchte sie nicht festlegen. Weder mich noch sie.
Grabisna: Was hat Sie an denen begeistert?
Kunze: Wenig. Sie schreiben aus ihrem Protest heraus. Protest gegen ganz verschiedene Erscheinungen. Aber das, was sie schreiben, ist keine Poesie. Es ist keine Literatur nach meinem Empfinden. Doch habe ich gerade ein Porträt über einen jungen Dichter geschrieben, der in Kroatien lebt. Dessen erster Band mit Gedichten, die er in deutscher Sprache geschrieben hat, ist in diesem Jahr unter dem Titel Flügel-Applaus im S. Fischer Verlag erschienen. Und für diese Gedichte kann ich mich begeistern: Marian Nakitsch, Jahrgang ’52. Ich war gerade bei ihm, habe mit ihm gesprochen, ihn porträtiert. Seine Eltern und Schwestern sind deutsche Staatsbürger, schon vor 20 Jahren als damalige Gastarbeiter hierhergekommen. Er selbst ist zur Hälfte erblindet und unfreiwillig gelernter Maurer. Sein Deutsch ist Eigenlese von den Weinbergen Rilkes, Huchels… Er wohnt in Zagreb, lebt geistig aber in Deutschland, dessen Gesetze es ihm untersagen, seiner Sehnsucht nachzuziehen.
Wenn meine alte Mutter
mich anruft aus Deutschland
bin ich wieder an der Schnur:
ihr einziger Sohn,
der mißratene Embryo.
Und wir sprechen nicht.
ich liege hier, wartend
im Dunkeln, lautlos,
um nie geboren zu werden.
Wann schon hört man ein ,Nocturne‘ so anstimmen:
Dem Hahn habe ich den Schnabel
mit einem Regenfaden zugenäht,
damit der Morgen allein erwacht.
Und wann ein ,Nocturne‘ so enden:
… der Pilgerstab aus Wachs wächst nieder.
Das ist eine so großartige Bildsprache und philosophisch-tiefgründige Poesie. Und da er aus eigener Kraft – ohne jeden Unterricht – Deutsch erlernt, gehört diese Dichtung eigentlich schon zur deutschen Poesie.
Grabisna: Welche Ideengehalte verraten in ihm den Dichter?
Kunze: Das Leben! Warum sucht Ihr immer nach Ideen, nach Themen? Das Leben enthält alle Themen. Heißsporne haben nur Ideologien im Kopf, nur bestimmte Themen, nur bestimmte Sichtweisen. Der Künstler soll Kunst schaffen. Kunstwerke – das ist seine Bereicherung der Wirklichkeit. Er muß neue Wirklichkeit schaffen. Die künstlerische Wirklichkeit, die er der realen hinzufügt, um diese durchschaubar zu machen. Um uns, die Menschen, reich zu machen.
Kreuzgefragtes – kurz & knapp
Grabisna: Für wen schreiben Sie?
Kunze: Für meine potentiellen Leser, die ich nicht kenne.
Grabisna: Welche Enkelfrage bereitet Ihnen noch immer Kopfzerbrechen?
Kunze: Die Frage nach Gott?
Grabisna: Wie definieren Sie ,dichterische Phantasie‘?
Kunze: Die Fähigkeit mittels Sprache in unserer Vorstellung neue Wirklichkeit entstehen zu lassen, durch die bestehende Wirklichkeit erfahrbarer wird.
Grabisna: Stichwort Phantasie: An welchen Ort wünschen Sie sich und mit welchem Buch?
Kunze: Immer dorthin, wo ich die größte Möglichkeit habe, zu schreiben. Und wenn auch ein Werk erlaubt ist, dann bitte mit dem Grimmschen Wörterbuch.
Grabisna: Ihr Lieblingsheld in der Dichtung?
Kunze: Der kleine Prinz.
Grabisna: Was bewegt Sie, wenn Sie nun wieder in Ihre sächsische Heimat reisen?
Kunze: Vorher war mir nie so deutlich gewesen, was 40 oder gar 60 Jahre Prägung durch totalitäre Ideologie ausmachen, ausmachen können.
Grabisna: Angenommen, Sie sollten jetzt ein Flugblatt verfassen. Was möchten Sie herausschreien?
Kunze: Das Hinausschreien habe ich mir längst abgewöhnt. Was nicht heißt, daß mich nicht ständig Erlebnisse erschüttern.
Grabisna: Wann fühlten Sie sich zuletzt als Dichter „mächtig“, einflußreich?
Kunze: Als ich noch nicht wußte, was es heißt, sein Leben auf Literatur zu bauen.
Grabisna: Wann die letzte Ohnmacht?
Kunze: Sie ist ein Dauerzustand, der nur immer mehr Lebensbereiche betrifft. Proportional an menschlichen Werten und Hemmungen in der Gesellschaft. Auch zum überdimensionalen, aber weiterhin wachsenden Einfluß der Medien.
Grabisna: Ihre Lebens-Maxime?
Kunze: „Es herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor“.
Deutsche Bücher, Heft 4, 1994
MUSICA ANTIQUA BOHEMICA
Franz Benda Un poco andante
Für Elisabeth und Reiner Kunze
Ein Flötenlied
dem Wind vom Mund gestohlen,
ich schreite langsam voran,
ein Mann,
der seine Wege kennt,
bedarf nicht mehr der Eile.
Im Hopfenfeld
kommt mir die Dämmerung entgegen,
ich sehe in den Gräsern
ihren Schritt,
schon liegt ein Schatten
in der Fährte.
Das Licht nimmt ab,
das Sternbild Heimat
leuchtet
wortlos.
Hanns Cibulka
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag von Reiner Kunze:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag von Reiner Kunze:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag von Reiner Kunze:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag von Reiner Kunze:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag von Reiner Kunze:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zu Reiner Kunze + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


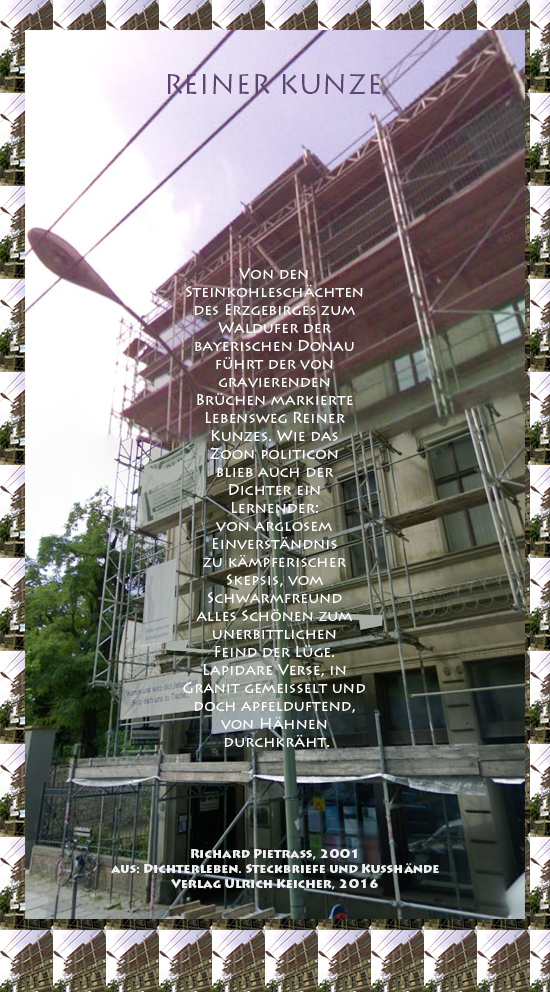












Schreibe einen Kommentar