Jürgen Rennert: Hoher Mond
DER VOGEL REILING
Der Vogel Reiling
Und der Vogel Hölder,
Das heilignüchterne Wasser
Und das wirkliche Blau.
Tübingen oder das eine
Und andre Exil. Wie schnell
Gehen die Zeiten,
Wie bleiern die Zeit.
Weiß auf dunkel verhangenem
Himmel die Urschrift der Zeilen
Lineaturen bestechend
Unbestochenen Seins.
„Die schuldbeladenen Wörter / In die Wüste schicken“
will Jürgen Rennert in diesem Gedichtband. Der Leser lauscht mit ihm dem seltsamen Singen im Geheimnis des Psalters und dem Stakkato des Marders auf dem Dach. Er sieht den Sprüchen, den Fassadenkletterern unter den Worten, zu und zwei leiterbewehrten Akteuren der Berliner Stadtreinigung, die versuchen, himmelblauen Deko-Stoffe exakt über einem Viertel der Stadt aufzuspannen. In Ungarns Hauptstadt zecht er mit Gábor im Gerbeaud und erlebt die Verwandlung von Schwarz und Rot, Angst und Liebe. Später rennt seine Uhr mit den flackernden Psychen in den Fluren des Griesinger Krankenhauses ums Leben. Aber im Gewebe der Zeit finden sich außer den Bildern einer durchlittenen und überwundenen eigenen „Hölle“ auch Brandlöcher und Blutflecken der Geschichte. „Doch / Alles in allem ist’s schon ein Stoff / Gerad wie gemacht vor die Augen der Bürger“. Während die Sinne erneut in ihre Ordnung kommen, inspiziert der „Unentschiedene“ die leeren, reglosen Hände der Vernunft, die im Schlamm hockt und gegen das Dunkel ansingt. Jener hat keine andere Wahl als den Stabreim. Aber Jürgen Rennert stellt neben gereimten metrischen Gedichten auch solche mit freiem Rhythmus und Prosagedichte vor. In seinen Texten ist er „festnagelbar“. Das Erfahren einer Grenzsituation auf Tod und Leben geht mit dem Kampf um die Würde des Menschen, für und um das Herstellen einer aktiven Wirklichkeitsbeziehung einher. Die Gedichte greifen Widersprüche auf, deren Lösbarkeit von dem Wahrnehmen der Verantwortung und der Notwendigkeit des tätigen Eingreifens des Menschen abhängen. Als Christ und Antifaschist läßt der Autor nicht nur den „Faden der Erinnerungen“ brennen, sondern stellt sich in den „Brennpunkt“ unserer Zeit.
Union Verlag Berlin, Klappentext, 1983
„Die Rose ist mehr als die Rose…“
Hohe Sprachbewußtheit zeichnet den – nach den Märkischen Depeschen und dem Dreistrophenkalender für Kinder Emma, die Kuh – und andres dazu – dritten Gedichtband Jürgen Rennerts aus. Der Begriff meint nicht allein den überlegten Einsatz sprachlicher Mittel, auch nicht im engeren Sinn das exzellente Sprachspiel – das Gedicht „Labyrinthisches“, bietet in dieser Hinsicht das Muster des Bandes –, sondern bedeutet zugleich, daß der Dichter im Gedicht und mit ihm über die Sprache, ihr Wesen und ihre Wirkungen nachdenkt. Jürgen Rennerts gänzlich undogmatische Verpflichtung christlichem und jüdischem Ideengut gegenüber entdeckt sich vor allem in seiner Hochachtung vor der Sprache, vor dem Wort, mit dem ihm alles beginnt; das Zurückgreifen auf überlieferte Motive, Bilder, Gleichnisse ist demgegenüber sekundär.
Aufschlußreich ist das Gedicht „Im Schloß“, das dem Sagbaren und dem Unsagbaren nachsinnt.
Ich spreche mehrere Sprachen in meiner,
Das macht, daß ich bin, der ich war, der ich werde,
Sein könnte, nicht war und nicht werde, nicht bin.
Sprache ist mehr als Instrument, sie ist Leben für das Ich, damit Wandel und Wandlung; Sprache erschließt Raum und Räume, bewahrt vor Leere und Tod. Sprache ist menschliche Ordnung der Dinge; es verwundert nicht, wenn in Rennerts Gedichten metaphorisch die Korrespondenz von Natur und Sprache beschworen, die Erscheinungen der Welt, das Ich eingeschlossen, als Gewebe von Stimme und Stummheit empfunden werden. „Von Erde zu Erde. Die Metapher bin ich“, setzt das Gedicht „Metaphorisch“ ein, gleichsam Goethes Sentenz „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ paraphrasierend. Am Anfang ist in diesen Gedichten das Wort, in ihm offenbart sich das Ich:
Erst
Was ich sage, sagt mich.
Dichtung verschreibt sich dauernden menschlichen Grundspannungen – „In Mythen versiegelt, schreitet die Zeit / Greifbar durchs ungreifbare Leere“ („Versiegelte Zeit“). Erstarrung und Leben werden in dem Erich Arendt gewidmeten Gedicht „Allmählich, immerfort“ durch die Metaphernvariation der „steinernen Lichte“ und „leuchtenden Steine“ zum schwisterlichen Gegensatz. Mit allen Sinnen öffnet sich der Lyriker der Welt, aber es bleibt ein Moment der Fremdheit, die vom Gedicht verraten wird und sich doch nicht verraten läßt.
Im Gedicht „Nässendes Wort im verhangenen April“ haben die Engel der Sprache eine bewahrende Funktion:
Wären nicht Engel, es bliebe
Alles Verlorene verloren und alles Trachten
Unbeflügelt und ohne Gestalt.
Doch ist der Ambivalenz der Sprache wie des Lebens nicht zu entgehen, sowohl das Vergessen als auch das Erinnern können heilsam und tödlich sein („Damokles“, „Tuch“). Aber der Dichter muß sich stellen:
Ich kann für alles, was ich weiß („Das Ende der Gitarren“).
Und er beharrt auf „Seltsamem Singen“:
Nie besser als
Mit dem Messer an der Kehle,
Nie freier als
Mit gefesselten Händen und Füßen,
Nie klarer als
An den Wassern der Trübsal,
Nie jünger als
Im Steinalt der Klage,
Nie menschlicher als
Unter Gottes drohendem Kehrbild.
Das dichterische Wort bleibt ihm Widerstand gegen alle Bedrohungen des Menschen, mahnende Erinnerung an Barbarei – untilgbares Gedächtnis als antifaschistisches und humanistisches Fundament dieser Lyrik.
Das Leiden des einzelnen wird aufgerufen, wenn der Dichter „Über den Zeilen früherer Dichter“ sinnt oder den „Lichtflügler“ E.T.A. Hoffmann herbeizitiert, und der Wille des einzelnen, verhängnisvollen Wirklichkeiten zu wehren. Solche Akzentuierung deutet zugleich die Differenz zu einer Lyrik an, die ihre Kraft aus historischer Kollektivität zu ziehen suchte und sucht, Rennerts Verse sprechen oft von Einsamkeit; doch gehört diese, schieben wir nur manche Selbsttäuschung beiseite, zu jedem menschlichen Leben; und indem sie davon sprechen, tragen sie zur Bewältigung von Einsamkeit bei oder zu ihrer Anerkennung und schöpferischen Metamorphose. In dem Leid ins Lied verwandelnden Zyklus „Closed. Station 4B, Griesinger“ verkörpert sich dieser kreative Sinn der Dichtkunst ausdrucksstark.
Hervorgehoben seien die „Budapester Porträts“, Gelegenheitsgedichte, in welchen Bildung, Witz und Phantasie zusammenschießen, und die den Band abschließenden Prosagedichte, in denen Spruchhaftigkeit und surreale Laune sich frei gesellen. Die Neigung zum Allegorischen, zum komplizierten Gedankenbild, ist auch im neuen Band spürbar (vgl. beispielsweise „Solitude“, „Berlin-Buch“), wenn vielleicht auch nicht mehr so stark ausgeprägt wie in den Märkischen Depeschen. (Weitgehend unreflektiert blieb bisher von der Kritik, wie Jürgen Rennert dieses spezifische und traditionsreiche Ausdrucksmittel für seine Zwecke zu nutzen wußte und damit dessen Gebrauchswert wieder zur Diskussion stellte.
Bei manchen Gedichten des Bandes fühlte ich mich an Clemens Brentano erinnert, an seine Sprachmusik, die den Sinn, will man ihn fassen, entgleiten läßt. Damit ist nicht gesagt, daß Rennert bewußt diesem Poeten oder vergleichbaren Dichtern „folgt“. Die Assoziation kann aber vielleicht den Weg weisen, für Rennerts Bildsprache, die einfach und schwierig zugleich ist, Tradition und Neuerung geheimnisvoll und Unruhe weckend verknüpft, einen Sinn zu entwickeln. Deutung und Verdeutlichung werden wohl erschwert, aber nicht ausgeschlossen, denn gegen Gertrude Stein sucht Rennert die selbstzweckhafte Magie der Wörter zu überschreiten:
Die Rose ist mehr als die Rose…
(„Frühlicht“).
Gedichte sind ihm Gleichnisse menschlichen Daseins und Hierseins. Sie enthalten so ein „konservatives“ Moment, wie es sich gerade im Beharren auf dem Naturbild als Analogon seelischer Prozesse kundtut. Man lese das Gedicht „Rekapitulation“, das in der Naturmetapher kunstvoll über den Sonnenstaat Campanellas handelt. (Man muß es wohl genauer sagen, damit zugleich eine Eigenart Rennens bezeichnend: Geschichtliche; wird nicht im Naturbild gefaßt, sondern Natur, die Geschichte so von vornherein umgreift, im Geschichtsbild beziehungsweise im Historischen assoziierenden Bild; vgl. auch „Letzte Dahlien“ in Märkische Depeschen.) Gedichte wie „Schweigsamer Winter“, „Hoher Mond“, „Augenschiffe“ fixieren gefühlsgesättigte lyrische Augenblicke, in denen Welt, Natur und Ich sich seltsam entsprechen (oder verschweigen); reale Landschaften fließen in geträumte. Das lyrische Vokabular des Volksliedes ist in diesen Gedichten ebenso bewahrt, wie auf die zwischen Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit changierende, Abstrakta und Konkreta mischende Metaphernbildung der Moderne zurückgegriffen wird. Im Vergleich zu den Depeschen ist jedoch die Liedstrophe seltener geworden, die Zahl der gereimten Gedichte hat abgenommen. Diese Form macht besondere Schwierigkeiten, gerade auch weil sie durch die Schule der Moderne geschleift wurde.
Hochzeitsjubel, Tanz, Klagegeschrei,
Dazwischen ernüchterndes Staunen,
Statisterie in dem großen Vorbei
Wiederkehrender Launen
(„Versiegelte Zeit“).
Das Karussell der Zeiten, Begriffe und Bilder, dreht sich nach der Musik des Schaustellers Benn, die Töne und Reime klingen allzu leichtfertig. Die vorletzte Strophe von „Augenschiffe“ lautet:
Augenschiffe mit zarten Skeletten, Flaumfedern, jungen Katzen an Bord,
Sanftem Geklirre zahlreicher Ketten
Und dem leisen Wissen um Mord.
„Zahlreicher Ketten“ – das Adjektiv mutet beliebig an: ein Füllwort, schwieriges Erbteil der liedhaften Strophe.
In dem Text „Widerspruch“ gibt sich Rennert Rechenschaft über seinen Drang zur Spruchhaftigkeit:
Jegliche Poesie geht nach Spruch wie nach Brot. Doch käme sie an, wäre sie verloren. Beredt und gesättigt, zitierbar. Gelobt sei, was verhindert. Wenn es verhindert, verhindert es auch die Verhinderung. / Das Grüne grünt – ergo sum.
Es ist der aufreizende Widerspruch von Emotion und Abstraktion, von einmaligem Erlebnis und destillierter Spruchweisheit, von Sinnfeststellung und Sinnentgrenzung, der die Gedichte Rennerts durchdringt und durchtränkt. Eine sinnlich leuchtende Sprache zeichnet sie aus und eine geistig erleuchtende, die doch immer das Element der Dunkelheit kennt: Sinn ist oft mehr ahnbar als greifbar, liegt nicht offen zutage, sondern nächtet und nistet in den Höhlungen der Bilder: Die Rose ist die Rose ist die Rose und mehr als die Rose.
Jürgen Engler, Neue Deutsche Literatur, Heft 3, März 1984
Gespräch mit Jürgen Rennert
– Das Gespräch mit Jürgen Rennert führte Hans Ester in Amsterdam am 30. Juni 1986. –
Hans Ester: Welchen Sinn hat das Schreiben von Lyrik?
Jürgen Rennert: Den Sinn: die Sinne zu schärfen und scharfzuhalten. Wer heute noch Gedichte schreibt, verrät Eigensinn, beharrt auf seinen Empfindungen und Erfahrungen, leistet Widerstand gegen jede Art von Verflachung und Entpersönlichung, widersetzt sich jener modernen Form der Analphabetisierung, wie sie etwa durch den massenhaften Einsatz und Mißbrauch der elektronischen Medien erzeugt und hervorgerufen wird. Heute Gedichte schreiben heißt: gegen den Strom schwimmen, der Konsumismus heißt. Mich drängt es mehr und mehr, all jene zu erreichen, die von den Parolen jedweder Reklame und Selbstreklame taub, blind und sprachlos gemacht werden sollen. Es muß mir, denke ich hartnäckig, doch möglich sein, mit Sprache gegen Unsprache anzukommen. Der Mensch ist mehr als seine Manipulatoren von ihm wissen oder ahnen. Das ist mein Credo.
Ester: Haben Ihre Erfahrungen in Amsterdam dieses Credo erschüttert?
Rennert: Nein, eher herausgefordert. Ich habe mir gleich zu Anfang als Reprint Pierre Fouquets Stiche vom Amsterdam des 18. Jahrhunderts gekauft. Und mit Hilfe dieses Büchleins auf meinen Fußmärschen versucht, Amsterdam und sein eigentliches architektonisches Antlitz zu entdecken. Das hieß für mich: mir all jene marktschreierischen, farblich überlauten und disharmonischen Reklame-Elemente von den Innenstadtfassaden wegzudenken und dahinter das zu sehen, was Amsterdam wirklich auszeichnet und von anderen Städten deutlich abhebt. Ich würde es am ehesten als „schlichte Noblesse“ bezeichnen. Etwas, was ich so nur noch von Leningrad her kenne. Ich spüre hier allenthalben, daß Zar Peter I. bei Ihnen in die Lehre gegangen ist. Zum großen Vorteil seines bis dahin als hinterwäldlerisch verrufenen Reiches, in dem er bis auf den heutigen Tag geliebt und verehrt wird. Und wo sein Geist – wie ich denke und hoffe – vieles von dem inspiriert, was beispielsweise Mijnheer Gorbatschow sagt und will. Natürlich schleppe ich hier auf Schritt und Tritt meine östliche Heimat und Herkunft mit. Und denke ausdauernd darüber nach, wie vorteilhaft und segensreich ein permanenter Austausch an Menschen und Gedanken, an Waren und stichhaltigen Informationen für beide Seiten wäre.
Ich zögere, das demokratisch stolze und republikanisch freie Königreich der Niederlande dem „Westen“ zuzuschlagen. Dennoch erlebe ich es so. Ich bin, alle feinen Differenzierungen einmal beiseitegelassen, ein Mensch des Ostens. Das heißt für meine – durch größere Reisefreiheit privilegierte – Person: aus freien Stücken. Und da ist der Vorteil der, daß der „Ostmensch“ aufgrund seiner schwächeren pekuniären Verfassung die „westliche Welt“ gleichsam „von unten“ erlebt. Ich fühle mich hier den Ärmeren Ihrer reichen Gesellschaft nahe, sehe mich solidarisiert mit Bürgern aus der dritten Welt. Mit letzteren habe ich mich – das unterscheidet den Bürger der Deutschen Demokratischen Republik vom Bürger der Bundesrepublik Deutschland – trotz eines von Ihrer Botschaft erteilten Einreisevisums bei der Fremdenpolizei anzumelden. Das ist eine gute Erfahrung. Ich lege Wert auf Gleichbehandlung mit den Menschen der sogenannt dritten Welt, gewiß auch deshalb, weil es meinem schlechten Gewissen als einem Angehörigen der unabweisbar zweiten Welt einige Erleichterung verschafft.
Ester: Sie bemühen sich, wie ich bemerken konnte, um das Niederländische, benutzen das eine oder andere Wort, die eine oder andere Wendung. Welche Bedeutung hat die Begegnung mit unserer Sprache für Sie?
Rennert: Ein Volk ist immer auch und nicht zuletzt seine Sprache. Mein Bemühen ist nichts als der respektvolle Versuch einer Annäherung an Ihr Volk, an dem sich mein Volk mörderisch vergangen hat. Ich komme auch hier auf meinen Streifzügen gottseidank nicht von der Geschichte und ihren Konsequenzen los. Die zahlreichen Mahnmale auf Ihren Straßen und Plätzen, die das Gedenken zum Beispiel an die Frauen von Ravensbrück, an den antifaschistischen Widerstand wachhalten, empfinde ich als äußerst notwendig und hilfreich. Sie stellen sich dem verhängnisvollen Trend zur historischen Vergeßlichkeit entgegen und lassen einen Deutschen wie mich etwas überlegter und leiser sprechen. Ich war in Rotterdam und empfand vor allem Scham, Schmerz und Trauer. Der Stadt ist, wenngleich keine Ruine mehr davon kündet, bis auf den heutigen Tag schlimm anzusehen, was ihr am 14. Mai 1940 von Deutschen geschah.
Was nun die niederländische Sprache anbelangt und den Eindruck, den sie mir macht, so bin ich viel zu kurz im Lande, um irgendetwas halbwegs Vernünftiges zu sagen. Ich kann allenfalls mit Empfindungen und Assoziationen dienen. Nur ein Beispiel: Was im Niederländischen herrlich selbstbewußt „fietsen“ heißt und auf Fietsen daherkommt, duckt sich im Deutschen, selbst wenn es vier Räder unter sich hat, als „radfahren“.
Ester: Sie waren, wie Sie mir erzählten, auf den Spuren des jüdischen Amsterdam. Das ist wenig erstaunlich, wenn man weiß, daß Sie sich in Ihrem Lande seit längerem der tätigen Vermittlung zwischen Deutschem und Jüdischem, zwischen Christen und Juden verschrieben haben. Sie übersetzen unter anderem aus dem Jiddischen. Zwei Bücher des in Riga beheimateten jiddischen Autors Mark Rasumny wurden von Ihnen übertragen und sind in einer Gesamtauflage von mehr als vierzigtausend Exemplaren in der DDR verbreitet worden. Vor genau zehn Jahren fragte ich Sie schon einmal nach der Bedeutung der christlich-jüdischen Tradition für Ihr Selbstverständnis. Sie antworteten damals, daß Ihnen diese Tradition das Gefühl innerer Geborgenheit und Übereinstimmung gäbe. Hat sich daran etwas geändert?
Rennert: Nichts. Ich bin nach wie vor kein Marxist. Auf eine, wie ich glaube, unüberhörbar deutliche Weise. Mein Weltbild ist religiös bestimmt. Und das Werk der Vermittlung tut not wie eh und je. Die Christen bedürfen nach wie vor des dringlichen Hinweises auf das in weiten Teilen ihrer Theologie noch immer mitgeschleppte, auch von Luther herkommende anti-jüdische Element. Es spukt im Unbewußten, im Verborgenen, wird kaum als antisemitisch erkannt. Und die staatstragenden Marxisten meines Landes sind immer wieder und immer nachdrücklicher darauf hinzuweisen, daß die bloß an der marxistischen Gesellschaftstheorie orientierte Behandlung der jüdischen Problematik längst nicht hinlangt. Es schmerzt nicht nur mich immer wieder tief, wie bedenkenlos und undifferenziert unsere unbestreitbar antifaschistische und antirassistische Presse mit dem Begriff des Zionismus operiert. Die pauschale Verketzerung des Staates Israel, die weitgehende Gleichsetzung seiner Regierenden mit den Regierten, ist unentschuldbar, ist ein Unrecht und wird aufhören müssen. Daß es bald aufhört, dafür kämpfe ich. Auch mit meiner Arbeit.
Ester: Ist das ein Kampf gegen den Marxismus oder die Marxisten?
Rennert: Kein Kampf gegen, sondern ein Kampf für. Schauen Sie, wer vom Dialog redet und aus christlicher Voraussetzung für den Dialog eintritt, sieht im Gegner nicht den Feind, meint, wenn er Kampf sagt, nicht den Krieg, sondern die entschiedene Auseinandersetzung. Rosa Luxemburgs Definition der Freiheit als einer Freiheit auch für die Andersdenkenden gewinnt in den Auseinandersetzungen, die in meinem Lande geführt werden, langsam aber sicher an Boden. Das Haßvolle, das gegenseitige Mißtrauen verlieren sich in dem Maße, wie es gelingt, auf allen Seiten Selbstvertrauen, Selbstbewußtsein und den Mut zur Übernahme persönlicher Verantwortung zu stärken. Ich weiß, das klingt sehr viel schöner, als es in der Wirklichkeit ist.
Ester: Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Denn ich wollte Sie gerade nach den Konflikten fragen, Konflikten, von denen wir auch hier gehört und gelesen haben. Wie ist das mit der kirchlichen oder auch nicht-kirchlichen Friedensbewegung, die sich mit der offiziellen Friedensbewegung der DDR ja kaum in Kongruenz bringen läßt? Ich denke etwa an die Reaktionen auf die Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“, an die Gewissenskonflikte junger Menschen bei der Wehrerziehung oder der Jugendweihe?
Rennert: Ich muß jetzt aufpassen, daß ich den Mund nicht zu voll nehme, denn ich kann natürlich nicht für alle und alles sprechen. Bitte, berücksichtigen Sie auch hier wie bei meinen vorangegangenen Antworten, daß alles, was ich sage, weder abgewogen noch reiflich genug überlegt ist. Es gibt so viele, allzuviele Klischees in der Welt, da muß unsereiner gut aufpassen, nicht selbst noch welche in die Welt zu bringen.
Die Konflikte, die es gab, gibt und geben wird, sind für die Betroffenen schlimm und keineswegs immer lehrreich. Dies sage ich im solidarischen Blick auf die Betroffenen. Nehmen wir den von Ihnen angesprochenen Konfliktfall des vor drei oder vier Jahren von der kirchlichen Friedensdekade kreierten Emblems „Schwerter zu Pflugscharen“, dessen Tragen von staatlichen Behörden als politische Provokation empfunden und verboten wurde. Die meisten der jungen Leute gaben zähneknirschend dem Verbot nach. Einige wenige wehrten sich gegen das Uneinsehbare solchen Verbots, trugen das Emblem weiter, riskierten Ordnungsstrafen oder das gewaltsame Abtrennen des Aufnähers von ihrer Kleidung. Diesen wenigen und den vielen, die sich durch ihr Beispiel überzeugen und beeindrucken ließen und die verbale und gedankliche Auseinandersetzung mit den staatlichen Stellen nicht scheuten, ist zu verdanken, daß dieses Zeichen wieder Legalität und Verbreitung erlangte. Es ist heute signifikanter Bestandteil vieler Materialien der kirchlichen Friedensarbeit.
Lassen Sie es bitte mit diesem Beispiel genug sein. Es macht mir und hoffentlich auch Ihnen deutlich, welche Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen ich begründet hege. Der Ausbau von Demokratie verlangt in meinem Lande genau das gleiche wie in jedem anderen Land der Welt: Demokraten, Menschen mit Zivilcourage, Bürger, die sich selbst einbringen. An diesen Menschen fehlt es bei uns nicht. Ebensowenig wie an Konflikten, die noch ausgetragen werden müssen.
Ester: Können Sie den Arbeitsprozeß beim Schreiben von Lyrik beschreiben? Ist das Machen von Gedichten ein bewußter, kontrollierbarer Prozeß oder „kommen“ Ihnen die Gedichte?
Rennert: Bewußtes, einsehbares Tun steht ja nur vermeintlich in Widerspruch zu einem Handeln, das sich auch vom Unbewußten, Uneinsehbaren her inspirieren und motivieren läßt. Das „oder“ in Ihrer Frage schreibt eine Scheinalternative fest. Ein tödliches Welt- und Selbstbild, das sich bloß in den Koordinaten des Kontrollierbaren und Bewußten zu definieren weiß. Und nicht weniger tödlich und tötend erscheint mir jenes, das dem Unkontrollierbaren und Unbewußten Primat einzuräumen versucht. Menschen stehen lebenslang auf der Kippe. Ebenda stehe auch ich. Und ebendort mache ich meine Gedichte, versuche ich, Gedichte zu machen. Wenn sie mir nicht „kommen“ wollen, gehe ich ihnen balancierend entgegen.
Ester: Können Sie Ihre Antwort an Hand des abgedruckten Gedichtes „Das Nisten der Trauer“ erläutern?
Rennert: Äußerer Anlaß für das Gedicht war ein sehr bewußtes Erschrecken über das Phänomen der Gleichgültigkeit, genauer: über das Phänomen lächelnder Gleichgültigkeit. Ich war, bei Gelegenheit einer Massendemonstration, gegen deren Strömen ich anlief, hundertfach auf jenes mir sphinxhaft erscheinende Lächeln von Menschen gestoßen, die sich in ihrer Haut nicht ganz wohl fühlen, andererseits aber auch nicht unwohl genug, um nicht eben diese Haut massenhaft zu Markte zu tragen. Ebenjenes Lächeln verstörte mich, fand mich sprachlos. Und häufig ist Sprachlosigkeit bei mir der Punkt, von dem aus ich die Linien des Gedichts zu ziehen beginne. Im Blick auf das vorliegende Ergebnis will mir scheinen, ich hätte es gemacht wie die Spinne, die ihr Netz baut: mich an einem Punkte verankert, sodann am haardünnen Faden womöglich tragfähiger eigener Formulierung ins unabsehbar Freie des Gedanken- und Sprachraums hinabgelassen, zwischen Möglichkeiten und Richtungen pendelnd, einen Seitenschwung gewagt, Halt gefunden an anderer Stelle, anderer Wand, den Faden, ohne ihn zu zerreißen, festgemacht und, dem vom Heftpunkt ausgehenden Winkel spiegelverkehrt entsprechend, in erneuter Abstoßbewegung versucht, an drittem Punkte sechsfach begrenzten Raumes zu landen…
Was so entsteht, wird – den sich seltsam offenbarenden Regeln eingeborener Geometrie gemäß – etwas Netzartiges haben, sichtbar um ein Nichts gewebt sein. Zerreißbar wie ein Spinnweb.
Kann solch Gebilde etwas leisten? Und läuft die ihm zugrundeliegende Anstrengung, auf den eingangs erwähnten Gedichtanlaß bezogen, nicht Gefahr, gänzlich im Leeren zu verpuffen? Wird je ein gleichgültig Lächelnder erfahren, daß sein Lächeln aufgehoben und als Ausdruck nistender Trauer umrandet wurde? Daß es Anstoß gab, Hölderlins „Hälfte des Lebens“ erhellend zu zitieren, daß es mich verneinend ja sagen ließ? Höchstwahrscheinlich nicht. Doch das Höchstwahrscheinliche ist noch nicht das Gewisse. In kleine Differenzen wie diese spanne ich – manchmal – das Gedicht.
Ester: Ist für Sie die Zeit von den Märkischen Depeschen bis zum Hohen Mond auch ein Lernprozeß gewesen? Wenn ja, wer oder was bestimmte diesen Lernprozeß?
Rennert: Ob man wirklich etwas dazugelernt hat oder nicht, wird sich vermutlich erst erweisen, wenn diese Frage für einen selbst keine Bedeutung mehr hat. Ich hege hin und wieder größte Zweifel am Ausmaß meiner Lernfähigkeit. Ich entdecke wie viele Menschen, die sich ihres Alterns auch als eines Abbauprozesses ohne Wenn und Aber bewußt werden, daß an die Stelle des offensiven Lernens, der Belehrbarkeit, etwas nahezu Blockierendes tritt: das vermehrte Innewerden der eigenen Beschränktheit. Und ein Teil der Energie, die in früheren Jahren auf den Erwerb von Wissen verwandt wurde, verliert sich nun an das Bemühen, das Gewußte, Erlernte zu retten, aus der liberalen Unverbindlichkeit des Kopfes radikal ins alltägliche Handeln an und mit anderen zu überführen.
Zwischen dem Erscheinen der Märkischen Depeschen und dem Erscheinen des Hohen Mondes liegen schlimme, krisenhafte Jahre. Jahre, in denen ich mir selbst zur größten Gefahr, zum größten Problem und zur größten Enttäuschung wurde. Daß das seinen Niederschlag in Gedichten gefunden hat, läßt sich im Hohen Mond nachlesen. Mehr weiß ich nicht.
Ester: Wie stehen Sie zu der Auffassung, daß das Schreiben von Literatur auch gelernt werden kann? Hat das Johannes-R.-Becher-Institut in Ihrem Leben eine Rolle gespielt?
Rennert: Gelernt werden kann? Gelernt werden muß! Wer nicht Schreiben lernt, bleibt Analphabet. Schreiben muß also auch gelehrt werden. Ich weiß, Ihre Frage zielt auf anderes. Nehmen Sie dennoch meine vorab gegebene Antwort auch für dieses andere als verbindlich. Schreiben von Literatur – da wäre auch zu fragen nach welcher – vollzieht sich in den Koordinaten des „Literarischen“, liefert sich also Maßstäben aus, innerhalb derer es bestehen will. Auch wenn es beabsichtigt, sich über alle Maßstäbe hinwegzusetzen, wird es zu seinem Vorteil nicht umhin können, sich der Maßstäbe zu vergewissern.
Ich habe nie am Leipziger Johannes-R.-Becher-Institut studiert. Aber schon oft bedauert, daß mir dies nicht möglich war. Denn die wesentliche Leistung dieser generös mit staatlichen Mitteln ausgehaltenen Hochschule sehe ich in der unorthodoxen Vermittlung solider Grundkenntnisse in den Sparten der Literatur wie in den Sparten der Wissenschaften. Hochgeschätzte Kollegen von mir wie Peter Gosse oder Max Walter Schulz sind oder waren lehrend an diesem Institut tätig. Ich weiß von keinem Talent, das an oder in dieser Schule zugrunde gegangen wäre. Viele Namen auf den Absolventenlisten früherer Jahre haben heute Klang und Rang. Ich rechne Helga M. Novak, Sarah und Rainer Kirsch ebenso dazu wie die jüngeren Ralph Grüneberger, Bernd Weinkauf und Matthias Biskupek. Daß diese Hochschule sehr viel leistet und sehr viel leisten konnte, verdankt sich ihrer weitgehenden Unabhängigkeit von kommerziellen Gesetzen und Regeln, wie sie etwa der westliche Buchmarkt mit sich bringt und erfordert.
Ester: Was erfahren Sie als positiv und was als negativ an Ihrer Arbeit im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR?
Rennert: Als positiv an meiner Arbeit im Vorstand empfinde ich die Herausforderung, die sie bedeutet. Denn sie stellt mich mit Namen und Hausnummer unentrinnbar in die Mitverantwortung für jeden Kollegen und alles, was mit ihm geschieht. Negativ macht sich vor allem all das bemerkbar, was ich zu tun versäume oder aus anderen Gründen zu tun unterlasse. Wenig beglückt mich, daß einige meiner namhafteren Kollegen, ich denke da auch an Christa Wolf, sich nach dem Biermann-Eklat, der verbunden war mit unfairen und z.T. verleumderischen Anwürfen gegen ihre Personen, sich nicht mehr dazu verstehen wollen, in diesem Vorstand mitzuarbeiten. Das ist ein großer Verlust. Nicht so sehr für die Antipoden von Christa Wolf, als vielmehr für Leute wie mich, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, daß ohne ihr Bemühen sehr vieles schlimmer und manch anderes nicht zum Besseren liefe.
Deutsche Bücher, Heft 2, 1987
Krumbeck: Berliner Schriftsteller fühlt sich in der Prignitz richtig wohl
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Roland Lampe: Ein streitbarer Anwalt der Literatur
Märkische Oderzeitung, 13.3.2013
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK


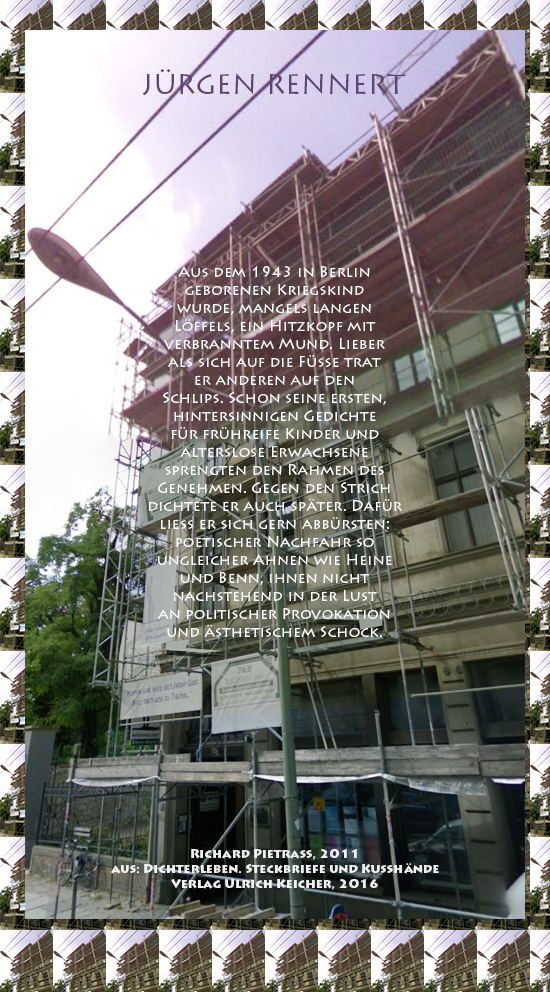












Schreibe einen Kommentar