Jürgen Rennert: Märkische Depeschen
MARC
Seine Hände singen Welt,
Seine Augen haben Flügel.
Er ist Brunnen, alles fällt
In ihn, klärt den Spiegel.
Samt der Boden, tiefste Tiefe,
Er weiß nicht wie tief.
Schweigt er, ist’s
Als ob er schliefe,
Sein Gesicht ist schief.
Regen löst in ihm den Wind.
Wind ist überall.
Da, wo Wind und Regen sind,
Wird sein Strich zum Schall.
Nachwort
1
Jürgen Rennert will mehr sein als ein Dichter. Er ist verliebt in die Sprache, ihre „rätselhafte Klarheit“ und gibt die Hoffnung nicht auf, daß ihr „als Vorbedingung menschlichen Miteinandersprechens und -lebens kein böses Kraut gewachsen ist“. Und geprägt von diesem Bekenntnis, schickt er seine Depeschen auf die Reise, aus der Mark stammend, doch über ihre Gemarkung hinauseilend und Empfänger suchend. „Wem rede ich denn das Wort?“ fragt sich Rennen (in der Studie „Wie ich zur Literatur kam“ – Sinn und Form, Heft 4/1972 –, aus der hier und im folgenden mehrfach zitiert wird), um darauf zu antworten: „nicht der Literatur, sondern den durch sie und von ihr Betroffenen“. Ein Wollen dieser Art schließt den Leser ein, so daß es ihm vielleicht auch wie dem Dichter ergeht:
Des Schweigens gute Schwester, die Stille,
Macht hörbar, was niemand vermißt.
Krisis der Sinne, euphorischer Wille,
Sich zu erinnern, bevor man vergißt.
Rennert ist „um Einhaltung sprachlicher Ordnung bemüht“ und weiß um die Mühen anderer Menschen, ihn zu ermutigen, „eine Brücke mehr zwischen Stilisiertem und Nicht-Stilisiertem, zwischen Literarischem und Nicht-Literarischem zu schlagen“. Aber nicht weniger zeigt er sich der Tatsache bewußt, daß es „wohl eher Brücken eines produktiven Mißverstehens“ waren und für ihn von geringer Tragfähigkeit, da sie „zusammenbrachen“, kaum daß er „ein Ufer erreicht hatte“. Und so bleibt er im Ergebnis von Erfahrungen und Erkenntnissen seinem literarischen Standort treu, wobei er jedoch auf die Brücken weder verzichten kann noch will, für die sich immer wieder Erbauer finden in diesem Land, mag er es zuweilen auch noch mißverstehen. „Die Verwandlungen des Orpheé“ dürften sich daher nicht allzuweit von den seinigen vollziehen:
Doch das Schweigen
Liefert ihn aus an die Sprache.
Mit ihr irrt er umher, und sie
Ergreift ihn ganz, überantwortet
Sich ihm, trägt ihn
Bis an ihr Ende, das unabsehbare,
Und zwingt ihn zur Unsterblichkeit,
Wo er sich an den Tod verliert.
2
Vom unmittelbaren Geschehen des zweiten Weltkriegs hat Jürgen Rennert wenig erlebt. Er wurde im Vorfrühling geboren, am 12. März 1943. Als Berlin, seine Heimatstadt, von der Roten Armee befreit wurde, war er zwei Jahre alt. Dennoch schwelen in der Erinnerung des Dichters die Kriegsbrände fort; er schreibt aus der Sicht der Gegenwart:
Heute nun ist mir nicht einmal ein Zehntel dieser kindheitsprägenden Angst vor dem Himmel geblieben. Lediglich das Triebwerkgeräusch von Flugzeugen schüchtert mich ein. Aber das ist schon eine Erfahrung der Nachkriegszeit.
Diese Nachkriegszeit jedoch schleppt er nicht nur im Hinblick auf die zwiespältigen Möglichkeiten der Technik mit sich herum, sondern vor allem hinsichtlich seiner Lebensumstände zwischen 1943 und 1953 in Westberlin:
Ausgesperrt von allem, was gewesen war, abgeschlossen von allem, was sich an Leben und Wiederaufleben vollzog, in immer schweigsamerer Gesellschaft einer krebskranken Großmutter, deren qualvolles Sterben Jahre dauerte, entwickelte sich in mir ein Lebensgefühl aus Angst und Vergeblichkeit. Es hatte sich bereits alles ereignet und zerschlagen, was der Familie an Hoffnungen und Lebensmöglichkeiten zu Gebote stand. Ruinen und Trauerflor bezeichneten eine Realität ohne Pathos, in die ich mich hoffnungslos gestellt sah: So kam ich zwar nicht zur Literatur, wohl aber zu Gründen und zum eigentlichen Thema meines späteren, meines gegenwärtigen Schreibens.
„Ein Lebensgefühl aus Angst und Vergeblichkeit“ spricht aus vielen Gedichten Jürgen Rennerts:
So viel Vergänglichkeit im frühen Sommer.
Die Wolkenschiffe segeln über Land
Und lassen ihre schweren Ketten schleifen,
Bleibt keine Spur im heißen Sand.
Ein Sommer, noch gar nicht zur Entfaltung gekommen, wird schon in seiner Vergänglichkeit empfunden. Vergeblich versucht der Mensch, die Wolkenschiffe zu „bewegen, umzukehren“. Doch:
Die Ketten reißen, wenn die Anker fassen,
Das Herz zerwühlen und beschweren.
Nur der Sand bleibt ohne eine Spur von ihnen. Vergänglichkeit erblickt der Dichter aber nicht nur „im frühen Sommer“, sondern auch „in der Lethargie des Ortes“. Der Ausweg aus dieser Vergeblichkeit wird in einem „Sandkorn“ wahrgenommen, das „… auf der Zunge reift / Zur Perle in der Muschel eines Wortes“.
Auch im Gedicht „Die toten Dichter“ schlägt Jürgen Rennert sein Thema an. Die Beziehungen der toten Dichter, die irgendwo allein liegen, zu allen Himmeln und Stürmen sind existent:
Farnkraut, Schachtelhalm, Moos
Schmuggeln ihre Kassiber.
Jede Klage erstirbt. Was der Mensch noch vermag, ist das:
Abseits liegt eine träumende Hand
Und greift nach Spiegelscherben.
Angst vor einem ähnlichen Schicksal, dies dürfte herauszuhören sein. Mehr als nach Spiegelscherben zu greifen ist nicht übriggeblieben. Und wenn der Dichter vom „Ende eines leisen Tags“ erzählt, dann verlassen seine Stunden sein Haus, sein Schweigen, „… die Rotunden / Der Einsamkeit. Die Uhr erfriert“. Und letztlich, nachdem sich Enttäuschung „in den Verliesen des Herzens“ verbreitet hat:
Kein Satz, der blieb. Durch deine Hände
Rinnt weiße Zeit wie Sand.
Die Uhr erfriert. Du siehst das Ende
Und hängst ihr Bild an eine Wand.
Gedichte dieser Denkweise lassen noch „das Ghetto frühester Kindheit“ mitschwingen: Berlin-Neukölln in den letzten Kriegsjahren mit dem Sirenengeheul und den Bombardierungen, mit seinen vielen mehrstöckigen Mietshäusern und Hinterhöfen, wo der Blick aus der Küche und sommers vom Balkon das einzige waren, um ein Stückchen Welt einzufangen. Und da wuchs die Angst ins Riesengroße, wurde für Rennert eine Abkapselung von den Menschen systematisch betrieben, damit er mit den ideologischen Trümmern der Vergangenheit nichts zu tun bekäme und vor der Nachkriegszeit verschont bliebe. Alles geschah mit den besten Absichten, „liebevolle Härte“ angewandt in einer „hermetischen Abgeschlossenheit“, hatte sich doch die Welt „nicht nur als gefährlich und feindlich, sondern auch als heimtückisch erwiesen“.
3
Jürgen Rennert wuchs in einem kleinen Kreis von Menschen auf. Das brachte es mit sich, daß er sich danach sehnte, Kontakte zur Welt außerhalb dieses Kreises herzustellen. Aber die Sehnsucht wurde zugleich durch die Furcht vor diesem „Draußen“ gedämpft: „Furcht und Sehnsucht bestimmten gleichermaßen mein Verhältnis zur menschlichen Gemeinschaft“. Und es beleuchtet seine persönliche Situation, wenn er mitteilt:
Nie verlor ich das Gefühl des Vereinzelten und nie den Glauben an die gemeinschaftsbildende Wirkung dieses Bewußtseins, das ich seinerseits bei allen anderen voraussetzte.
Hier erkennt er für sich die „schwache Stelle“, durch die Literatur eindringt, eine schwache Stelle als „das Ergebnis eines frühen Eingesperrtseins, einer fragwürdigen Erziehung, einer kommunikationsarmen Kindheit“, Sonntagsschule und protestantischer Kindergottesdienst gehörten zu seiner frühen religiösen Umwelt. „Bereits im Vorschulalter“, schreibt er, „gewann man Einblick in die Praxis von Exegese und Hermeneutik.“
Ein bezeichnendes Licht auf die Rennertsche Haltung zur menschlichen Gemeinschaft wirft das Gedicht „Partisan“. Dieser Partisan ist seinem Wesen, seiner Haltung und seinem Handeln nach keinesfalls gleichzusetzen mit jenem Helden, den wir als verehrungswürdigen Kämpfer gegen Unrecht und Unterdrückung hochschätzen. Dieser Partisan, als den Rennert auf einer gewissen Stufe seiner eigenen Entwicklung sich zeichnet, ist vielmehr eine Art Steppenwolfnatur und Einzelgänger, der zwar kämpft, dabei jedoch rät: „Nehmt euch kein Beispiel / An den Erfolgen / Meines verzweifelten Krieges.“ Furcht und Sehnsucht zugleich bestimmen die Tendenz dieses Gedichtes. Während in anderen Versen die Vergeblichkeit als Gefühl triumphiert, wird im Gedicht „Partisan“ Aktion sichtbar, wenn auch vorerst noch eine fruchtlose; denn es sind Erfolge eines „verzweifelten Krieges“, nicht zur Nachahmung empfohlen.
Das Verhältnis zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft skizziert auch das Gedicht „Der Taubenbaum“. Der Dichter läßt Perspektive ahnen. Die Stimmen, die vom Luftzug herangetragen werden, nehmen Platz „und plaudern von allem wie Gäste“. Gäste aber markieren den Abstand. Und während sein Herz Luft „schöpft“ und die Nacht „besingt“:
Der Gäste Rede wendet der Schlacht
Vom Vortag sich zu. Aber im schlafe
Unter Tauben.
Zu einer ähnlichen Aussage gelangt Rennert im Gedicht „Der Salon“. Draußen die Äcker, garstig, die aufbrechen „unter der Mittagssonne im Juli“. Zeit des Ungeziefers, die Blätter verbrennen, und der Abend wird vergeblich erwartet: „Aber ich sitze da.“ Nur die Gedanken vermögen die Wände zu sprengen, und die Frage dauert fort:
Der Boden verdurstet, was soll ich tun, ist mein Salon
Nicht die stärkste Aktion, nördlich der Stadt
Und mittags im Juli?
Furcht und Sehnsucht im Verhältnis zur menschlichen Gemeinschaft spiegeln sich wohl am einprägsamsten in dem Gedicht „Bild mit dem Hahn und dem Grenadier“:
Ich bitte um Asyl. Ein Grenadier,
Der seinen Schatten sucht, den er verlor
Im Feuer der Pogrome, und
Der Schlachten schlug mit Worten, die
Sich Gott erfand, bevor
Ihn Einsamkeit und Schweigen überfiel.
Welche Vergangenheit er mit sich herumträgt, sagt der Dichter in der zweiten Strophe:
Ich bitte um Asyl. Ich bin
Von gestern hergekommen, eine Meile
Vergeßlichkeit trennt mich bereits von meinem Land,
Das mir noch anhängt, das mich nicht
Verlassen will, das seine Stille
Aussendet, um mich einzuholen.
Er hält sich nicht nur für einen Menschen unseresgleichen, sondern ist es auch:
Ich bitte um Asyl. Mein Hahn
Sitzt schon auf eurem Dach. Wenn ihr
Mich fortschickt, denunziert
Er den Verrat, den ihr an einem euresgleichen
Verübtet. Bitte, laßt
Mich wohnen unter euch.
Er weiß unser Land zu schätzen, es bezieht Position gegen das Verbrechen:
Ich bitte um Asyl. Habt keine Furcht.
Die Monde schweigen, und die Sonnen
Erblindeten, als sie den Tag
Im Rauch der Krematorien erblickten,
Wo Luft gehügelt stand und Wind
In schwarzen Stiefeln patrouillierte.
Und er wiederholt zum fünften Mal sein:
Ich bitte um Asyl. Kein Wort
Birgt mehr, was ich besaß. Die Hand
Ist taub, mit blasser Tinte
Spürt meine Feder Zeichen auf,
Die leer sind, dunkle Ornamente
Am fahlen Himmel der Gedächtnislosigkeit.
4
Mit zehn Jahren kam Jürgen Rennert von Westberlin in die DDR. Die Erziehung ging nach dem Tode der Großmutter in die Hände der Eltern über. Das war zugleich das Ende seines hermetischen Abgeschlossenseins, bedeutete aber auch für ihn, sich in einer neuen gesellschaftlichen Umwelt zurechtfinden zu müssen. „Mein äußeres Leben“, berichtet er, verlief nun zwar „in freiheitlicheren Bahnen, aber das kam für mein ramponiertes Selbst- und Umweltverständnis zu spät.“ Was er gewann in den weiteren Jahren seiner Schulzeit, seiner Ausbildung zum Schriftsetzer, seiner Hilfspflegertätigkeit in einem Krankenhaus und als Werbetexter, das war der „befreiende Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten des einzelnen“. Und dieser Glaube erhielt mehr und mehr Bindung zur Gegenwart und ihrer Geschichte. Daher rückt Alexander Twardowski, der sowjetische Dichter, in seinen Gesichtskreis. Angst und das Gefühl der Vergeblichkeit werden gebannt, und Künftiges wird in die Dichtung eingebracht. Wieviel Anerkennung für Twardowski und sein Volk sprechen aus diesem Gedicht. Doch es wird noch mehr spürbar. Die Grenzen werden überschritten, und der Menschheitsgedanke rückt ins Blickfeld. Und wenn es von Twardowski heißt: „Sein Wort nahm sich gelassen, / Klar und erheiternd aus, / Schlug ungezählte Trassen, / Bot Obdach wie ein Haus“, so vermag sich dann gleichermaßen folgerichtig wie unaufdringlich die Strophe anzuschließen:
Er sah sich unter vielen
Ankommen und vergehen
Und dennoch in den Zielen
Der Menschen fortbestehen.
Den Widersprüchen auf den Spuren, den großen gesellschaftlichen unserer Zeit, zeigt sich Jürgen Rennert in seinem Gedicht „Doktor Allende“. In der ersten Strophe wird konstatiert: „Doktor Allende ist tot“. Doch in seinem Land, in Chile, wissen die Kinder der Armen Bescheid – es hat sich schon eingebürgert unter seiner Regierung –, daß sie von ihm Milch und Kuchen bekommen. Hier wird kundgetan: Allendes Tod ist nur physischer Natur. Darum kann er auch noch in die faschistischen Kerker gehen und den Gepeinigten Mut zusprechen. In der dritten Strophe wird wiederholt, daß Allende tot ist, aber jetzt sind es die Mörder, die ins Bild kommen. Rennert nimmt den geschichtlichen Verlauf vorweg; denn:
Sie hoffen,
Falls er aufersteht,
Wärn sie bereits dahin.
Und in der letzten Strophe wird gesagt:
Sie ahnen nicht, wie sehr er lebt.
jedoch, daß sie schon tot sind,
Das ahnen sie.
Ihr Amoklauf
Schafft Rot, weil Wunden rot sind.
Ein Lebensgefühl, das frei ist von Angst und Vergeblichkeit, bricht sich „mit den erinnernden Morgen“ Bahn:
Mit den erinnernden Morgen
Über Land ziehen,
Mittags die Pferde wechseln
Am Gasthaus zur Jugend, einkehren
Und besinnungslos trinken;
Mit der Tochter des Hauses
Unkäuflich die Zeche begleichen,
Eine Sprache sprechen mit den Vögeln,
Ein Herz haben mit der WeIt.
Doch der Wagen rollt. Und darum heißt es dann:
Mit den sengenden Mittagen
Weiter über Land ziehen,
Abends die lahmenden Pferde entlassen
Am Gasthaus zur Nacht, einkehren,
Sich dem Wirt
Für die Zeche am Mittag verpfänden;
Ein Schweigen sprechen mit den Vögeln,
Mit der Welt ein dunkles Herz haben,
Ihren Mut fassen und aufrichten.
Mit seinem Übersiedeln in unseren Staat, mag es auch gegen den kindlich ungestümen Protest des Zehnjährigen vor nunmehr bald einem Vierteljahrhundert erfolgt sein, hat für Rennert nicht nur objektiv, sondern – und das im zunehmenden Maß – auch subjektiv die Möglichkeit real ihren Anfang genommen, seinen Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten des Menschen zu verwirklichen.
Darum dürfte für ihn zutreffend sein, was Erich Arendt in seiner neunten „Flug-Ode“ schrieb:
Möge, die die Mitternacht
mit Blindheit schlug, gereift
euch sein die Trauer; der sterblichen
Bäume und der Felsen
Mutter, die eiserne Spitze
im Herzen, bebte,
vom Zirkelschlag
der Geschichte: Und zerbrechend
das steinerne Antlitz
jahrtausendalt – o Schmerz
o Flamme! – Aurora
kündete den gesetzlichen Tag,
eine Möglichkeit
dem Menschen.
Jürgen Rennert nimmt diesen Gedanken auf in seinem Gedicht „Letzte Ölung 45“, sollte es auch auf den ersten Blick nicht so erscheinen:
Die großen Kräne stehen stumm,
Ohne sich zu bewegen,
Auf den Abraumhalden herum
Und frieren im Regen.
Ein zugrunde gegangener Staat
Verschorft unter Schmieröl und Kresse.
Pfützen liegen im schwarzen Ornat
Und lesen die Totenmesse.
Wer das erkannt hat, sich mit der Geschichte kritisch auseinandersetzt und sich mit jenen zu identifizieren beginnt, die den Lauf der Geschichte wirklich bestimmen, an den richtet sich Rennerts „unermüdliche Aufforderung“:
Tritt ein, nimm Salz wie Hoffnung
Aus der Schale, hier ist die Liebe Brot,
Nimm Platz und schreite. Aber zahle
Mit dir, und wirf das Lot der Maurer,
Die in Babel bauten,
Hier läuft man nicht davon,
Hier übersetzt man, fremden Lauten
Entrann man nur in Babylon.
Und in der letzten Strophe wird wiederholt, worauf es dem Dichter ankommt:
Hier ist die Liebe Brot, nimm Platz
Und schreite, aber zahle mit dir,
Und wirf das Lot.
5
Als Kriegskind geboren, von Angst und dem Empfinden der Vergeblichkeit gepeinigt, von Furcht und Sehnsucht ergriffen und den Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten des Menschen verteidigend, so schlägt sich Jürgen Rennert wacker in unserer Zeit mit ihren Widersprüchen und Problemen im Großen wie im Kleinen. Und daher ist seine Dichtung von all diesen Momenten geprägt, ohne daß auseinandergehalten werden könnte, welches Gefühl im einzelnen dominiert. Vielmehr mischen sich Freundlichkeiten und Traurigkeiten in seiner Poesie, die sich wie jegliche Dichtung der Elle des Zuschneiders entzieht.
Jürgen Rennert hat in unserer Gesellschaft nicht nur Platz genommen, sondern auch das Lot geworfen. Er bezieht die Haltung eines aufrechten Humanisten, Demokraten und Antifaschisten und bejaht aus Motiven christlicher Ethik den Sozialismus in der DDR. So vermag er auf seine Weise einen Beitrag, und keinen unwesentlichen, zur Menschenbildung in unserem Land zu leisten. Dabei geht zugleich sein Blick über die Grenzen hinaus, wie seine Dichtung erkennen läßt. Die Märkischen Depeschen finden ihre Adressaten nicht nur in der Mark und ihrer näheren und ferneren Umgebung, sondern auch im Sowjetland und in Chile und verweilen in Prag, in seiner Altstadt mit ihrem jüdischen Friedhof und dem Bethaus des Israel Pinkas, bei Rabbi Löw und Mordechai Meisl. Die „Mauern Trojas“ und die „Kuppel St. Peters“ werden nicht weniger zu Orten der Erkundung. Und bei den Persönlichkeiten dürfen ein Rousseau, ein Kleist, ein Marc und ein Brecht nicht fehlen. Sie sind gegenwärtig, seien sie nun ausdrücklich benannt oder auch nicht.
6
Jürgen Rennert, der die Dreißig mehr und mehr überschreitet, ist von einer kritischen Liebenswürdigkeit. Brille, Bärtchen und Zigarre sind Merkmale der äußeren Erscheinung. Die Brille gibt ihm Schärfe, der Lippenbart nimmt sie zurück und mildert, und die Zigarre räuchert nur die anderen ein, nicht ihn. Er liebt Stern und Taube und kann seinen Namen von rechts nach links schreiben. Als Zuhörer ist er sehr aufmerksam, als Frager manchmal sehr unbequem. So hat er seine Aufgaben übernommen als textender Werberedakteur und als Dichter. Der Grundzug seines Wesens dürfte Bescheidenheit sein, aber keine von nur hinnehmender Natur. Sein Hang zum Radfahren mag ihm geholfen haben, Ortsangaben über die Mark zu machen, doch die Mulde könnte es ihm nicht weniger angetan haben und ein Besuch an Ostwalds Ruhestätte, obwohl weder der Fluß noch der Chemiker in seiner Dichtung bisher namentlich zu finden sind.
Armin Zeißler, Nachwort, März 1975
Jürgen Rennert: Märkische Depeschen
Die Gedichte aus diesem zweiten Band Jürgen Rennerts sind geschrieben im Gedanken an den Empfänger. Es ist deswegen nicht verwunderlich, daß oftmals der erste Adressat in der Widmung der Gedichte an die Oberfläche tritt. Der Dichter ist sich der Verletzbarkeit der Sprache und auch seiner eigenen, durch die Gedichtform anders, depeschenartig funktionierenden Worte bewußt. Die Sprache des Dichters verlangt vom Leser Sensibilität und Ergänzung, wie sie vom dichterischen Ich selber im Umgang mit dem Werk anderer Dichter demonstriert werden. Rennerts Gedichte sind der Ausdruck einer fortwährenden Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen des Gedichts, über die Rechtfertigung der eigenen Dichterexistenz und die Zweifel an dieser Existenz.
Das Wort wird im Appell des Dichters wiederholt als Gegenprinzip zum Stein aufgefaßt. Der Stein bildet die Materie, die vom dichterischen Wort gespalten, verwandelt wird. Der Stein in seiner Schwere bedeutet Bindung an Verhältnisse, von denen sich der Dichter lösen möchte. Das Verlangen nach Freiheit, Ungebundenheit wird erkennbar im Bild der Taube. Das von Hannelore Teutsch gezeichnete Bild auf dem Schutzumschlag des Bandes zeigt eine Brieftaube, deren Kopf die Züge Jürgen Rennerts trägt. Damit wird betont, was sich mittels des Bildes der Flügel und des Fluges als Verlangen des Dichters ausspricht: ihm geht es um die höchste Form der menschlichen Kommunikation, sein Weg führt immer wieder zum Menschen zurück, er will kein Einsiedler, sondern ,Partisan‘ des Wortes sein:
UNERMÜDLICHE AUFFORDERUNG
Tritt ein, nimm Salz wie Hoffnung
Aus der Schale, hier ist die Liebe Brot,
Nimm Platz und schreite. Aber zahle
Mit dir, und wirf das Lot der Maurer,
Die in Babel bauten,
Hier läuft man nicht davon,
Hier übersetzt man, fremden Lauten
Entrann man nur in Babylon.
Komm bücke dich, an diesen Bohlen
Ist schlechter Halt zu fassen, das Haus
Steht abbruchreif, wir holen uns Licht
Von den Landstraßen. Den Maßstab
Unserer Karten
Bestimmen alte Träume,
Hier schlaf ein wenig, und wir warten
Und hängen Fenster in die Räume.
Brich von dem Dach dir, nimm vom Keller,
Wir wohnen schon im Schatten des Turmes,
Den wir schneller, noch steht er nicht,
Berechnet hatten. Tritt ein, nimm Salz
Wie Hoffnung aus der Schale,
Hier ist die Liebe Brot, nimm Platz
Und schreite, aber zahle mit dir,
Und wirf das Lot.
Hans Ester, Deutsche Bücher, Heft 2, 1977
Gespräch mit Jürgen Rennert
– Am 6. April 1977 führte Hans Ester (Universität Nijmegen) in Hohenneuendorf das folgende Gespräch mit dem Autor. –
Hans Ester: Bekannt und neu – das war meine Erfahrung, als ich Ihre Märkischen Depeschen zum ersten Male las. Welche dichterischen Tendenzen sind für Ihr Werk bedeutsam geworden? Welche Impulse bestimmen von der Tradition her Ihre Sprechweise?
Jürgen Rennert: Ihre Erfahrung mit meinen Gedichten – von Ihnen selbst zur Formel „bekannt und neu“ verdichtet – beruhigt und beunruhigt mich zugleich. Es gibt also etwas in diesen Texten, das – grenzüberschreitend – ohne Verlust transportiert und in Empfang genommen, als bekannt erkannt werden kann. Das beruhigt mich, da ich ja – wie der Titel meines Bandes verrät – wirklich und wahrhaftig „Depeschen“ auf die Reise bringen wollte. Und Depeschen rechnen auf Empfänger. Aber das Wort „bekannt“ beunruhigt mich auch, weil vielleicht ein einschränkendes „allzu“ mitschwingt. Doch da sei das „neu“ vor, das es allerdings nun auch wieder in sich hat: „Neu“ muß nicht wirklich neu in dem Sinne von „noch nicht dagewesen“ sein, es verrät vielleicht nichts weiter als den Kenntnisstand des Betrachters. Wie dem auch sei, mir gefällt Ihre Formel, da sie mein Verhältnis zur menschlichen Welt umschreibt, unter deren Sonne es bekanntlich ja nichts wirklich Neues gibt, wenn man vom unausgesetzten Neuarrangieren, Verbrämen und Wiederentdecken des Bekannten absieht. Daß dies selbstverständlich auch im Bereich der Künste gilt, ist mir früh bei der Begegnung mit den Werken des deutschen Expressionismus bewußt geworden. Der Hinterlassenschaft seiner Dichter, seiner Novatoren verdanke ich erste mobilisierende Anregung und dauernden Zuspruch. Georg Heym und Else Lasker-Schüler, Klabund und Gottfried Benn waren und sind mir die liebsten. Ihre durch die Texte hindurchscheinende und textgewordene Emotionalität, ihre Unbedingtheit und Lauterkeit auch im Pathos sind mir ein Gottesbeweis für den menschlichen Willen zur brüderlichen Befriedung und Befreiung der Welt, einen Willen und eine Hoffnung, an deren Vorhanden sein und Unauslöschlichkeit ich auch heute noch hartnäckig glaube.
Bei den Expressionisten ließ sich auch unschwer entdecken, wem sie sich brüderlich verbunden fühlten, verbunden wußten: Büchner, Hölderlin, Kleist. Und es deckt sich gewiß auch mit Ihren Erfahrungen, wenn ich meine Empfindung gegenüber dem Werk dieser für mich exemplarischen Dichter auf die Formel bringe „bekannt und neu“.
Was Form und Formung meiner Sprechweise anbelangt, sind – denke ich – viele Meister unterschiedlichster Couleur zu nennen: Brecht und Tucholsky, Jean Cocteau, Nelly Sachs, Günter Eich, Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Vielleicht verwirrt Sie die bunt und scheinbar widersprüchlich zusammengewürfelte Galerie der zur Erklärung meiner Sprech- und Denkweise bemühten Ahnfrauen und -herren, aber ich denke, daß Sie im Blick auf diese heterogene Gesellschaft besser verstehen werden, was Sie fremd und „neu“ an meinen Texten berührte. Möglicherweise resultiert mein „Neues“ aus meinem Konservativismus, der revolutionär genug ist, „dichterischen Schulen“ das zu versagen, was ich einzelnen Dichtern, die mich durch ihr unverwechselbares Sein bereicherten, lebenslang zu halten gedenke: die Treue. Und Treue will heißen: in ihrem Geiste arbeitend, das zu werden, was sie mir wurden: freie Menschen, deren wichtigste Botschaft sie selber waren, indem sie Freiheit als das Verantwortlichsein für alle und alles nicht allein artikulierten, sondern lebten, praktizierten. Jede Entäußerung von Menschen dieser Art erscheint mir wesentlich, wesentlich für den Fortbestand der Welt, deren Wesen hinwieder durch das verbrieft wird, was ich Kunst nenne.
Ester: Inwiefern ist die Sprache thematisiert in Ihren Gedichten?
Rennert: Eines meiner Gedichte, „In jedem verliert sich Sprache“ überschrieben, nimmt die Sprache direkt zum Thema. Und es erweist sich, zumindest metaphorisch, daß Sprache allen verfügbar, allen verlierbar ist, daß sie wie eine Münze kostbar und weniger kostbar sein kann. Eines, so souffliert das Gedicht, dessen Prämisse auf Hamanns „Es gibt kein Denken außerhalb der Sprache“ beruht, eines ist Sprache nicht: erläßlich, entbehrlich.
Sie wissen, was im faschistischen Deutschland mit der deutschen Sprache geschah: Unter dem Zugriff der Herrschenden kam sie fast gänzlich um den Verstand, ihre Schönheit erwies sich als prostituierbar, ihre geglaubte Klarheit als tauglich zur Verdunkelung von barbarischen Zwecken und Sachverhalten. Bis heute ist – wie ich meine – die deutsche Sprache in ihrem allgemeinen Gebrauch noch nicht zur Besinnung gekommen, zur Rückbesinnung auf ihre Möglichkeiten und Un-Möglichkeiten. Dieser Sachverhalt erschwert für Leute meines Naturells den Vorgang des Schreibens beträchtlich. Es gibt wohl nur sehr wenige Gedichten in den Märkischen Depeschen, die nicht durch diese fast traumatische Erfahrung des Sprach- und Denkverlustes stigmatisiert sind. Günter Kunert hat unlängst in einer Interpretation meines Gedichts „Erschaffung des Golems“ auf den Untertext des Gedichts als einer „Evokation des Schweigens“ hingewiesen. Ich bin ihm dankbar für diese Entdeckung, denn ich halte mich frei davon, bewußt auf die Thematisierung der Sprache hinzuarbeiten. Aber ich entdecke, daß da, wo ich den Menschen anrufe, Menschliches artikuliere, als Synonym auch „Wort“ oder „Logos“ stehen könnte. Und für „Unmenschlichkeit“, „Tod“ steht mir das „Schweigen“, nicht aber die „Stille“, die ich einmal metaphorisch als „des Schweigens gute Schwester“ apostrophierte.
Adornos „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch“ gehört zu den Pfeilen im Fleisch auch meiner, scheinbar nachgeborenen Generation.
Ester: Von diesem Thema her scheint mir eine Brücke zu dem möglich, was man vielleicht als jüdisch-christliche Tradition in Ihrem Werk bezeichnen kann. Welche Bedeutung besitzt dieses Gedankengut für Sie als Dichter?
Rennert: „Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlung der Welt“, heißt es, für mich unübertrefflich formuliert, bei Nelly Sachs. Ein gnädiges Wort, das sowohl die Kinder der Erschlagenen wie auch die Kinder der Mörder annehmen dürfen in ihrer elementaren und ungestillten Sehnsucht nach Heimat.
Sie wissen, daß das deutsche Wort Heimat dem verantwortlich Sprechenden heute fast nicht mehr über die Zunge will. Es gehört zu den zahllosen, durch den Sprachgebrauch des Nationalsozialismus geschändeten, beschmutzten und vernutzten Wörtern. Die Gefahr ist nun, daß mit der Tabuisierung des Wortes auch tabuisiert wird, was es eigentlich meint: das sich Geborgen- und Einswissen-Dürfen in und mit einem Raum, dessen Grenzen überschau- und absehbar sind und weniger Grenzen darstellen als vielmehr Membranen zur angrenzenden Welt.
Mir wurde anstelle von geographisch bestimmbarer Heimat die orthodox protestantische Tradition, in der ich aufwuchs, und die jüdische Tradition, der ich mich mehr und mehr annäherte, zum realen Raum, der mir das Gefühl der Geborgenheit und der größeren Übereinstimmung gibt. Allein aus dem Gefühl dieser persönlichen Geborgenheit heraus, ist es mir möglich, an der Verwandlung der Welt entschlossen und unverzagt teilzunehmen. Diese Haltung wird, vermute ich, auch aus meinen Gedichten abzulesen sein.
Ester: Hat das Jüdische auch Bedeutung für Sie von der deutschen Vergangenheit her?
Rennert: Ich denke, kein nachdenklicher, um Wahrhaftigkeit bemühter Deutscher, der 1945 überlebt hat, ist unberührt und ungebrannt davongekommen. Zu seinem Nachkrieg gehörte die Entdeckung des eigenen Herzens als Mördergrube. Die Ermordung von sechs Millionen jüdischer Menschen vor den offenen, halbgeöffneten oder ängstlich verschlossenen Augen, Ohren und Mündern eines Volkes, das sich zur Führungsnation berufen fühlte, die Ermordung von sechs Millionen jüdischer Menschen durch die Angehörigen eben dieses Volkes, an dessen „Wesen die Welt genesen“ sollte, wurde zur zentralen existentiellen Frage jedes „Davongekommenen“. Meine Kindheit war wesentlich geprägt durch die physischen und psychischen Anstrengungen, denen sich die überlebenden Erwachsenen meiner Familie unterzogen, unterziehen mußten angesichts der – im Osten Deutschlands drakonischer als im Westen gestellten – Frage: „Kain, wo ist dein Bruder Abel?“ Zur bewegendsten Lektüre meiner Kindheit wurde das Tagebuch der Anne Frank, die in Ihrem Lande wenigstens für Zeit Schutz und Unterschlupf fand. Ein Tatbestand, der mich bis heute mit Respekt, Dankbarkeit und Rührung gegenüber Ihrem Land und Ihren Landsleuten erfüllt. (Verzeihen Sie mir bitte meine pauschale, leider durch keine unmittelbare Kenntnis und Anschauung getrübte Voreingenommenheit.)
Das also zum allgemeinen Hintergrund, auf dem sich nicht nur für mich das Problem des Jüdischen mit dem Problem der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verband und verbindet.
Eine andere, familiäre Beziehung zum Jüdischen besteht über meinen Großvater väterlicherseits, einen jüdischen Bürger aus Leipzig. Von meinem verstorbenen Vater her rührt mein erstes frühes Wissen um den Talmud und die jüdische Geistesgeschichte. Inzwischen habe ich gelernt, Jiddisch zu lesen und zu schreiben. Und gegenwärtig übersetze ich für den Union Verlag die 1975 jiddisch in Moskau erschienene Novellensammlung meines in Riga beheimateten jüdischen Adoptiv- Vaters Mark Meir-Razumny.
Ester: Der Dichterberuf bekommt in manchen Ihrer Gedichte ein beinahe altmodisches Gewicht. Wie sehen Sie die Stellung des Dichters in der Gesellschaft?
Rennert: Das Altmodische wird ja immer wieder einmal Mode. Und so geniere ich mich nicht, das Bild und vor allem den Begriff des Dichters hochzuhalten. Jean Cocteaus Vor- und Orphée-Bild hat mich in dieser Ansicht wesentlich bestärkt und beeinflußt. Cocteaus Maxime: „Man soll ein lebender Mensch und ein postumer Künstler sein“, verhalf mir zur notwendigen Gelassenheit, die es braucht, um gegen Torheiten und Gefahren gefeit zu sein, die eine dichterisch begriffene Existenz mit sich bringt. Der Dichter ist nach meinem Verständnis weder die Inkorporation irgendeines nationalen Gewissens noch Mitglied einer globalen Sekte, die im kunstfertigen Sprachgeraune ihr Heil sucht und findet. Er ist weder Produzent von erhellenden Sprüchen noch von dunklen Orakeln. Er ist, wenn es hoch kommt, weit mehr: ein verdammt Einzelner, der sich mit allen Kräften und um jeden Preis am Schleppseil der Sprache durch die reißende Strömung des Flusses, der Leben und Geschichte heißt, an ein Ufer hangelt, zu hangeln versucht, das von seinen Zeitgenossen immer wieder als unerreichbar aufgegeben wird. Das Wichtige für die Gesellschaft an diesem Vorgang ist nicht der Dichter, sein Stürzen, Versagen, Versinken, sondern die Beobachtbarkeit des Vorgangs. Denn wer dabei zuschaut – und es gibt ja immer noch Leser von Gedichten –, schaut im Grunde sich selbst zu, seinem eigenen Versuch, es wieder und wieder zu versuchen mit der Überquerung jenes Stroms, der zwischen dem Ufer unserer Resignation und dem Ufer unserer frühen Träume und Hoffnungen dahinschießt.
So „artistisch“ sehe ich das von außen, quasi als „lebender Mensch“. Von innen betrachtet, von der Position des vorfabrizierenden „postumen Künstlers“ aus, formuliere ich bescheidener: Da hat der Dichter vor allem seinen Ort tätig zu bestellen, einen Ort unter der Sprache und unter den Menschen seiner unmittelbaren Umwelt. Seinen Respekt, seine Verantwortlichkeit für die Gesellschaft kann er nicht besser zum Ausdruck bringen als durch das hohe Bemühen, eines ihrer wichtigsten Güter, die Sprache, so verantwortlich und bedenklich, so sparsam und effektiv wie möglich zu gebrauchen. Die Art seines Umgehens mit der Sprache verrät ihn als Dichter, nicht die Wahl dieses oder jenes Gegenstandes. Verdichtend, komprimierend, nicht verdünnend, verwässernd, sei der Vorgang seines Sprechens und Schreibens. Eine Gesellschaft, der die Sprache zerstört wird, die ihre Sprache vernachlässigt, verliert die Fähigkeit, sich selbst zu begreifen, sich selbst zu kontrollieren und zu regulieren. Was Dichter da und dagegen zu leisten vermögen, ist scheinbar gering. Franz Fühmann hat einmal auf die Frage nach der Bedeutung des Dichters und des Gedichtes für die Gesellschaft geantwortet, daß es sich da wie mit den Vitaminen im menschlichen Organismus verhalte: bei ausreichendem Vorhandensein läßt sich ihre Bedeutung kaum nachweisen, erst ihr Fehlen erweist ihre Unentbehrlichkeit.
Ester: Welche Tendenzen sehen Sie in der DDR-Literatur der Gegenwart?
Rennert: Ich zögere mit der Antwort auf diese Homogenität voraussetzende Frage, da sie möglicherweise nicht hilfreich ist. Um von Tendenzen in der gegenwärtigen DDR-Literatur zu sprechen, wäre erst einmal zu klären, was über die DDR-Literatur tatsächlich gewußt wird. Mir scheint, daß sich die Betrachtung der DDR-Literatur von außen allzuoft noch im bloßen Etikettieren erschöpft. Da ist dann von einer „Tendenz zur Innerlichkeit“ oder zur „gesellschaftlichen Relevanz“ die Rede. Und übersehen wird, daß die Literatur der DDR – wie jede andere europäische Nachkriegsliteratur – ein heterogenes und äußerst widersprüchliches Phänomen ist. Brecht und Becher, Arendt und Maurer, Hermlin und Fühmann, Anna Seghers und Arnold Zweig – um nur einige Begründer der DDR-Literatur zu nennen – haben seit Bestehen der DDR relativ kontinuierlich veröffentlicht, und Sie werden mir zustimmen, daß jeder dieser Namen schon eine Welt und eine Tendenz für sich ist. Es gab also und gibt die unterschiedlichsten und widersprüchlichsten Tendenzen.
Es gab aber auch eine Tendenz – und dies war keine Tendenz der Literatur, sondern der Kulturpolitik –, die sich in den sechziger Jahren vergrößernde Vielfalt des literarischen Sprechens zu beargwöhnen, in der Formen- und Themenvielfalt eine Abkehr der Literatur von dem die DDR konstituierenden Standpunkt der sozialistischen Weltanschauung zu vermuten. (Dabei muß ich zu Ihrer Information hinzufügen, daß es immer eine Minorität von DDR-Autoren gab, die von bürgerlich-humanistischen oder christlichen Positionen her ihre Werke schreiben und veröffentlichen konnten.) Die erwähnten Schwierigkeiten zwischen Kulturpolitikern und Autoren der DDR wurden weitgehend beseitigt, als sich auf dem achten und neunten Parteitag der SED jene Anschauungen artikulierten und durchsetzten, die der Kunst und den Künstler auf der Basis der Loyalität ihrem Staat gegenüber nahezu uneingeschränkten Spielraum ermöglichten. Das hat das Arbeitsklima für fast alle Autoren wesentlich erleichtert und dazu geführt, daß bei Betrachtung der heutigen DDR-Literatur sich für mich nur eine Tendenz erkennen läßt: die Tendenz zur untendenziösen, am Wort, an der Sache, am Menschen engagierten, experimentierfreudigen literarischen Arbeit.
Deutsche Bücher, Heft 2, 1977
DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit
– Ein weiteres Gespräch mit Jürgen Rennert führte Hans Ester in Amsterdam am 30. Juni 1986. –
Ester: Welchen Sinn hat das Schreiben von Lyrik?
Rennert: Den Sinn: die Sinne zu schärfen und scharfzuhalten. Wer heute noch Gedichte schreibt, verrät Eigensinn, beharrt auf seinen Empfindungen und Erfahrungen, leistet Widerstand gegen jede Art von Verflachung und Entpersönlichung, widersetzt sich jener modernen Form der Analphabetisierung, wie sie etwa durch den massenhaften Einsatz und Mißbrauch der elektronischen Medien erzeugt und hervorgerufen wird. Heute Gedichte schreiben heißt: gegen den Strom schwimmen, der Konsumismus heißt. Mich drängt es mehr und mehr, all jene zu erreichen, die von den Parolen jedweder Reklame und Selbstreklame taub, blind und sprachlos gemacht werden sollen. Es muß mir, denke ich hartnäckig, doch möglich sein, mit Sprache gegen Unsprache anzukommen. Der Mensch ist mehr als seine Manipulatoren von ihm wissen oder ahnen. Das ist mein Credo.
Ester: Haben Ihre Erfahrungen in Amsterdam dieses Credo erschüttert?
Rennert: Nein, eher herausgefordert. Ich habe mir gleich zu Anfang als Reprint Pierre Fouquets Stiche vom Amsterdam des 18. Jahrhunderts gekauft. Und mit Hilfe dieses Büchleins auf meinen Fußmärschen versucht, Amsterdam und sein eigentliches architektonisches Antlitz zu entdecken. Das hieß für mich: mir alle jene marktschreierischen, farblich überlauten und disharmonischen Reklame-Elemente von den Innenstadtfassaden wegzudenken und dahinter das zu sehen, was Amsterdam wirklich auszeichnet und von anderen Städten deutlich abhebt. Ich würde es am ehesten als „schlichte Noblesse“ bezeichnen. Etwas, was ich so nur noch von Leningrad her kenne. Ich spüre hier allenthalben, daß Zar Peter I. bei Ihnen in die Lehre gegangen ist. Zum großen Vorteil seines bis dahin als hinterwäldlerisch verrufenen Reiches, in dem er bis auf den heutigen Tag geliebt und verehrt wird. Und wo sein Geist – wie ich denke und hoffe – vieles von dem inspiriert, was beispielsweise Mijnheer Gorbatschow sagt und will. Natürlich schleppe ich hier auf Schritt und Tritt meine östliche Heimat und Herkunft mit. Und denke ausdauernd darüber nach, wie vorteilhaft und segensreich ein permanenter Austausch an Mensch und Gedanken, an Waren und stichhaltigen Informationen für beide Seiten wäre.
Ich zögere, das demokratisch stolze und republikanisch freie Königreich der Niederlande dem „Westen“ zuzuschlagen. Dennoch erlebe ich es so. Ich bin, alle feinen Differenzierungen einmal beiseitegelassen, ein Mensch des Ostens. Das heißt für meine – durch größere Reisefreiheit privilegierte – Person: aus freien Stücken. Und da ist der Vorteil der, daß der „Ostmensch“ aufgrund seiner schwächeren pekuniären Verfassung die „westliche Welt“ gleichsam „von unten“ erlebt. Ich fühle mich hier den Ärmeren Ihrer reichen Gesellschaft nahe, sehe mich solidarisiert mit Bürgern aus der dritten Welt. Mit letzteren habe ich mich – das unterscheidet den Bürger der Deutschen Demokratischen Republik vom Bürger der Bundesrepublik Deutschland – trotz eines von Ihrer Botschaft erteilten Einreisevisums bei der Fremdenpolizei anzumelden. Das ist eine gute Erfahrung. Ich lege Wert auf Gleichbehandlung mit den Menschen der sogenannten dritten Welt, gewiß auch deshalb, weil es meinem schlechten Gewissen als einem Angehörigen der unabweisbar zweiten Welt einige Erleichterung verschafft.
Ester: Sie bemühen sich, wie ich bemerken konnte, um das Niederländische, benutzen das eine oder andere Wort, die eine oder andere Wendung. Welche Bedeutung hat die Begegnung mit unserer Sprache für Sie?
Rennert: Ein Volk ist immer auch und nicht zuletzt seine Sprache. Mein Bemühen ist nichts als der respektvolle Versuch einer Annäherung an Ihr Volk, an dem sich mein Volk mörderisch vergangen hat. Ich komme auch hier auf meinen Streifzügen gottseidank nicht von der Geschichte und ihren Konsequenzen los. Die zahlreichen Mahnmale auf Ihren Straßen und Plätzen, die das Gedenken zum Beispiel an die Frauen von Ravensbrück, an den antifaschistischen Widerstand wachhalten, empfinde ich als äußerst notwendig und hilfreich. Sie stellen sich dem verhängnisvollen Trend zur historischen Vergeßlichkeit entgegen und lassen einen Deutschen wie mich etwas überlegter und leiser sprechen. Ich war in Rotterdam und empfand vor allem Scham, Schmerz und Trauer. Der Stadt ist, wenngleich keine Ruine mehr davon kündet, bis auf den heutigen Tag schlimm anzusehen, was ihr am 14. Mai 1940 von Deutschen geschah.
Was nun die niederländische Sprache anbelangt und den Eindruck, den sie mir macht, so bin ich viel zu kurz im Lande, um irgendetwas halbwegs Vernünftiges zu sagen. Ich kann allenfalls mit Empfindungen und Assoziationen dienen. Nur ein Beispiel: Was im Niederländischen herrlich selbstbewußt „fietsen“ heißt und auf Fietsen daherkommt, duckt sich im Deutschen, selbst wenn es vier Räder unter sich hat, als „radfahren“.
Ester: Sie waren, wie Sie mir erzählten, auf den Spuren des jüdischen Amsterdam. Das ist wenig erstaunlich, wenn man weiß, daß Sie sich in Ihrem Lande seit längerem der tätigen Vermittlung zwischen Deutschem und Jüdischem, zwischen Christen und Juden verschrieben haben. Sie übersetzen unter anderem aus dem Jiddischen. Zwei Bücher des in Riga beheimateten jiddischen Autors Mark Rasumny wurden von Ihnen übertragen und sind in einer Gesamtauflage von mehr als vierzigtausend Exemplaren in der DDR verbreitet worden. Vor genau zehn Jahren fragte ich Sie schon einmal nach der Bedeutung der christlich-jüdischen Tradition für Ihr Selbstverständnis. Sie antworteten damals, daß Ihnen diese Tradition das Gefühl innerer Geborgenheit und Übereinstimmung gäbe. Hat sich daran etwas geändert?
Rennert: Nichts. Ich bin nach wie vor kein Marxist. Auf eine, wie ich glaube, unüberhörbar deutliche Weise. Mein Weltbild ist religiös bestimmt. Und das Werk der Vermittlung tut not wie eh und je. Die Christen bedürfen nach wie vor des dringlichen Hinweises auf das in weiten Teilen ihrer Theologie noch immer mitgeschleppte, auch von Luther herkommende anti-jüdische Element. Es spukt im Unbewußten, im Verborgenen, wird kaum als antisemitisch erkannt. Und die staatstragenden Marxisten meines Landes sind immer wieder und immer nachdrücklicher darauf hinzuweisen, daß die bloß an der marxistischen Gesellschaftstheorie orientierte Behandlung der jüdischen Problematik längst nicht hinlangt. Es schmerzt nicht nur mich immer wieder tief, wie bedenkenlos und undifferenziert unsere unbestreitbar anti-faschistische und antirassistische Presse mit dem Begriff des Zionismus operiert. Die pauschale Verketzerung des Staates Israel, die weitgehende Gleichsetzung seiner Regierenden mit den Regierten, ist unentschuldbar, ist ein Unrecht und wird aufhören müssen. Daß es bald aufhört, dafür kämpfe ich. Auch mit meiner Arbeit.
Ester: Ist das ein Kampf gegen den Marxismus oder die Marxisten?
Rennert: Kein Kampf gegen, sondern ein Kampf für. Schauen Sie, wer vom Dialog redet und aus christlicher Voraussetzung für den Dialog eintritt, sieht im Gegner nicht den Feind, meint, wenn er Kampf sagt, nicht den Krieg, sondern die entschiedene Auseinandersetzung. Rosa Luxemburgs Definition der Freiheit als einer Freiheit auch für die Andersdenkenden gewinnt in den Auseinandersetzungen, die in meinem Lande geführt werden, langsam aber sicher an Boden. Das Haßvolle, das gegenseitige Mißtrauen verlieren sich in dem Maße, wie es gelingt, auf allen Seiten Selbstvertrauen, Selbstbewußtsein und den Mut zur Übernahme persönlicher Verantwortung zu stärken. Ich weiß, das klingt sehr viel schöner, als es in der Wirklichkeit ist.
Ester: Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Denn ich wollte Sie gerade nach den Konflikten fragen, Konflikten, von denen wir auch hier gehört und gelesen haben. Wie ist das mit der kirchlichen oder auch nicht-kirchlichen Friedensbewegung, die sich mit der offiziellen Friedensbewegung der DDR ja kaum in Kongruenz bringen läßt? Ich denke etwa an die Reaktionen auf die Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“, an die Gewissenskonflikte junger Menschen bei der Wehrerziehung oder der Jugendweihe?
Rennert: Ich muß jetzt aufpassen, daß ich den Mund nicht zu voll nehme, denn ich kann natürlich nicht für alle und alles sprechen. Bitte, berücksichtigen Sie auch hier wie bei meinen vorangegangenen Antworten, daß alles, was ich sage, weder abgewogen noch reiflich genug überlegt ist. Es gibt so viele, allzuviele Klischees in der Welt, da muß unsereiner gut aufpassen, nicht selbst noch welche in die Welt bringen.
Die Konflikte, die es gab, gibt und geben wird, sind für die Betroffenen schlimm und keineswegs immer lehrreich. Dies sage ich im solidarischen Blick auf die Betroffenen. Nehmen wir den von Ihnen angesprochenen Konfliktfall des vor drei oder vier Jahren von der kirchlichen Friedensdekade kreierten Emblems „Schwerter zu Pflugscharen“, dessen Tragen von staatlichen Behörden als politische Provokation empfunden und verboten wurde. Die meisten der jungen Leute gaben zähneknirschend dem Verbot nach. Einige wenige wehrten sich gegen das Uneinsehbare solchen Verbots, trugen das Emblem weiter, riskierten Ordnungsstrafen oder das gewaltsame Abtrennen des Aufnähers von ihrer Kleidung. Diesen wenigen und den vielen, die sich durch ihr Beispiel überzeugen und beeindrucken ließen und die verbale und gedankliche Auseinandersetzung mit den staatlichen Stellen nicht scheuten, ist zu verdanken, daß dieses Zeichen wieder Legalität und Verbreitung erlangte. Es ist heute signifikanter Bestandteil vieler Materialien der kirchlichen Friedensarbeit.
Lassen Sie es bitte mit diesem Beispiel genug sein. Es macht mir und hoffentlich auch Ihnen deutlich, welche Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen ich begründet hege. Der Ausbau von Demokratie verlangt in meinem Lande genau das gleiche wie in jedem anderen Land der Welt: Demokraten, Menschen mit Zivilcourage, Bürger, die sich selbst einbringen. An diesen Menschen fehlt es bei uns nicht. Ebensowenig wie an Konflikten, die noch ausgetragen werden müssen.
Ester: Können Sie den Arbeitsprozeß beim Schreiben von Lyrik beschreiben? Ist das Machen von Gedichten ein bewußter, kontrollierbarer Prozeß oder „kommen“ Ihnen die Gedichte?
Rennert: Bewußtes, einsehbares Tun steht ja nur vermeintlich in Widerspruch zu einem Handeln, das sich auch vom Unbewußten, Uneinsehbaren her inspirieren und motivieren läßt. Das „oder“ in Ihrer Frage schreibt eine Scheinalternative fest. Ein tödliches Welt- und Selbstbild, das sich bloß in den Koordinaten des Kontrollierbaren und Bewußten zu definieren weiß. Und nicht weniger tödlich und tötend erscheint mir jenes, das dem Unkontrollierbaren und Unbewußten Primat einzuräumen versucht. Menschen stehen lebenslang auf der Kippe. Ebenda stehe auch ich. Und ebendort mache ich meine Gedichte, versuche ich, Gedichte zu machen. Wenn sie mir nicht „kommen“ wollen, gehe ich ihnen balancierend entgegen.
Ester: Können Sie Ihre Antwort an Hand des Gedichtes „Das Nisten der Trauer“ erläutern?
DAS NISTEN DER TRAUER
Das Nisten der Trauer im unbewußten
Refugium der Seele dicht unter der Haut:
ein traumloses Brüten unter den Krusten
des Lächelns, das sich nicht und niemandem traut.
Das Sehen und Gehen der Augen im klaren
Taglicht des kläglich gestundeten Seins
erblindet, ermüdet, erlischt vor dem Wahren,
zugunsten des wirklich erhellenden Scheins.
Das Flattern der Ängste im subkutanen
lidüberwölbten Schlafsaal des Lichts
beschwört und zitiert die klirrenden Fahnen,
mobilisiert die Verneinung des Nichts.
11.–13. Mai 1986, Berlin (DDR)
Äußerer Anlaß für das Gedicht war ein sehr bewußtes Erschrecken über das Phänomen der Gleichgültigkeit, genauer: über das Phänomen lächelnder Gleichgültigkeit. Ich war, bei Gelegenheit einer Massendemonstration, gegen deren Strömen ich anlief, hundertfach auf jenes mir sphinxhaft erscheinende Lächeln von Menschen gestoßen, die sich in ihrer Haut nicht ganz wohl fühlen, andererseits aber auch nicht unwohl genug, um nicht eben diese Haut massenhaft zu Markte zu tragen. Ebenjenes Lächeln verstörte mich, fand mich sprachlos. Und häufig ist Sprachlosigkeit bei mir der Punkt, von dem aus ich die Linien des Gedichts zu ziehen beginne. Im Blick auf das vorliegende Ergebnis will mir scheinen, ich hätte es gemacht wie die Spinne, die ihr Netz baut: mich an einem Punkte verankert, sodann am haardünnen Faden womöglich tragfähiger eigener Formulierung ins unabsehbar Freie des Gedanken- und Sprachraums hinabgelassen, zwischen Möglichkeiten und Richtungen pendelnd, einen Seitenschwung gewagt, Halt gefunden an anderer Stelle, anderer Wand, den Faden, ohne ihn zu zerreißen, festgemacht und, dem vom Heftpunkt ausgehenden Winkel spiegelverkehrt entsprechend, in erneuter Abstoßbewegung versucht, an drittem Punkte sechsfach begrenzten Raumes zu landen…
Was so entsteht, wird – den sich seltsam offenbarenden Regeln eingeborener Geometrie gemäß – etwas Netzartiges haben, sichtbar um ein Nichts gewebt sein. Zerreißbar wie ein Spinnweb.
Kann solch Gebilde etwas leisten? Und läuft die ihm zugrundeliegende Anstrengung, auf den eingangs erwähnten Gedichtanlaß bezogen, nicht Gefahr, gänzlich im Leeren zu verpuffen? Wird je ein gleichgültig Lächelnder erfahren, daß sein Lächeln aufgehoben und als Ausdruck nistender Trauer umrandet wurde? Daß es Anstoß gab, Hölderlins „Hälfte des Lebens“ erhellend zu zitieren, daß es mich verneinend ja sagen ließ? Höchstwahrscheinlich nicht. Doch das Höchstwahrscheinliche ist noch nicht das Gewisse. In kleine Differenzen wie diese spanne ich – manchmal – das Gedicht.
Ester: Ist für Sie die Zeit von den Märkischen Depeschen bis zum Hohen Mond auch ein Lernprozeß gewesen? Wenn ja, wer oder was bestimmte diesen Lernprozeß?
Rennert: Ob man wirklich etwas dazugelernt hat oder nicht, wird sich vermutlich erst erweisen, wenn diese Frage für einen selbst keine Bedeutung mehr hat. Ich hege hin und wieder größte Zweifel am Ausmaß meiner Lernfähigkeit. Ich entdecke wie viele Menschen, die sich ihres Alterns auch als eines Abbauprozesses ohne Wenn und Aber bewußt werden, daß an die Stelle des offensiven Lernens, der Belehrbarkeit, etwas nahezu Blockierendes tritt: das vermehrte Innewerden der eigenen Beschränktheit. Und ein Teil der Energie, die in früheren Jahren auf den Erwerb von Wissen verwandt wurde, verliert sich nun an das Bemühen, das Gewußte, Erlernte zu retten, aus der liberalen Unverbindlichkeit des Kopfes radikal ins alltägliche Handeln an und mit anderen zu überführen.
Zwischen dem Erscheinen der Märkischen Depeschen und dem Erscheinen des Hohen Mondes liegen schlimme, krisenhafte Jahre. Jahre, in denen ich mir selbst zur größten Gefahr, zum größten Problem und zur größten Enttäuschung wurde. Daß das seinen Niederschlag in Gedichten gefunden hat, läßt sich im Hohen Mond nachlesen. Mehr weiß ich nicht.
Ester: Wie stehen Sie zu der Auffassung, daß das Schreiben von Literatur auch gelernt werden kann? Hat das Johannes-R.-Becher-Institut in Ihrem Leben eine Rolle gespielt?
Rennert: Gelernt werden kann? Gelernt werden muß! Wer nicht Schreiben lernt, bleibt Analphabet. Schreiben muß also auch gelehrt werden. Ich weiß, Ihre Frage zielt auf anderes. Nehmen Sie dennoch meine vorab gegebene Antwort auch für dieses andere als verbindlich. Schreiben von Literatur – da wäre auch zu fragen nach welcher – vollzieht sich in den Koordinaten des „Literarischen“, liefert sich also Maßstäben aus, innerhalb derer es bestehen will. Auch wenn es beabsichtigt, sich über alle Maßstäbe hinwegzusetzen, wird es zu seinem Vorteil nicht umhin können, sich der Maßstäbe zu vergewissern.
Ich habe nie am Leipziger Johannnes-R.-Becher-Institut studiert. Aber schon oft bedauert, daß mir dies nicht möglich war. Denn die wesentliche Leistung dieser generös mit staatlichen Mitteln ausgehaltenen Hochschule sehe ich in der unorthodoxen Vermittlung solider Grundkenntnisse in den Sparten der Literatur wie in den Sparten der Wissenschaften. Hochgeschätzte Kollegen von mir wie Peter Gosse oder Max Walter Schulz sind oder waren lehrend an diesem Institut tätig. Ich weiß von keinem Talent, das an oder in dieser Schule zugrunde gegangen wäre. Viele Namen auf den Absolventenlisten früherer Jahre haben heute Klang und Rang. Ich rechne Helga M. Novak, Sarah und Rainer Kirsch ebenso dazu wie die jüngeren Ralph Grüneberger, Bernd Weinkauf und Matthias Biskupek. Daß diese Hochschule sehr viel leistet und sehr viel leisten konnte, verdankt sich ihrer weitgehenden Unabhängigkeit von kommerziellen Gesetzen und Regeln, wie sie etwa der westliche Buchmarkt mit sich bringt und erfordert.
Ester: Was erfahren Sie als positiv und was als negativ an Ihrer Arbeit im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR?
Rennert: Als positiv an meiner Arbeit im Vorstand empfinde ich die Herausforderung, die sie bedeutet. Denn sie stellt mich mit Namen und Hausnummer unentrinnbar in die Mitverantworung für jeden Kollegen und alles, was mit ihm geschieht. Negativ macht sich vor allem all das bemerkbar, was ich zu tun versäume oder aus anderen Gründen zu tun unterlasse. Wenig beglückt mich, daß einige meiner namhafteren Kollegen, ich denke da auch an Christa Wolf, sich nach dem Biermann-Eklat, der verbunden war mit unfairen und z.T. verleumderischen Anwürfen gegen ihre Personen, sich nicht mehr dazu verstehen wollen, in diesem Vorstand mitzuarbeiten. Das ist ein großer Verlust. Nicht so sehr für die Antipoden von Christa Wolf, als vielmehr für Leute wie mich, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, daß ohne ihr Bemühen sehr vieles schlimmer und manch anderes nicht zum Besseren liefe.
Aus: Gerd Labroisse und Ian Wallace (Hrsg.): DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit. Eine Dokumentation, Rodopi, 1991
Laudatio
– Zum Heinrich-Heine-Preis des Ministeriums für Kultur der DDR 1979 –
Gestatten Sie, verehrte Anwesende, daß ich mich vorerst ausschließlich an den Auszuzeichnenden wende.
1
Unser beider Staatswesen, lieber Jürgen Rennert, hat mir das Wort gegeben, um Sie so hochzuloben, daß unser Genosse Minister – vor dem kleinen musikalischen Intermezzo, das unsere kleine Zeremonie in unsere kleine Zecherei überleitet –, daß der Minister gar nicht mehr anders kann, als Ihnen Heinrich Heine ehrenhalber ans Herz zu legen.
Allerdings ist das schon beschlossene Sache. Darum will ich Sie nicht zelebrieren, sondern Ihnen meine Meinung sagen, die, hoffe ich, kurze Beine hat.
Über Ihre nun zwanzigjährigen geselligen Arbeiten und Spiele mit der Sprache, in der Sprache brauche ich mich heute nicht auszulassen. Im Nachwort zu den Märkischen Depeschen hat es bereits 1975 Armin Zeißler freundschaftlich getan. Und Günter Wirth ist Ihrer Ungereimten Prosa nicht nur stabreimisch profund gerecht geworden, als er seine Besprechung in der NDL, 1978 im Mai, überschrieb:
Märkisches und Mosaisches. Märkisches und mosaisches Seelenland – das grenzt an sarmatische Weiten…
Wir kennen uns, lieber Jürgen Rennert, jetzt auch bald zwanzig Jahre. Ich könnte Ihr Vater sein, ziehe es indessen vor, in Ihnen einen Bruder zu finden, besser, gefunden zu haben.
Wir sind viel mehr als Zeit-Genossen. Wir sind Brüder in der Zeit. Freunde und Genossen kann man sich aussuchen, Sie kennen den Witz, unter Brüdern übt man gegenseitige Wertung und Selbsteinschätzung. Also will ich Sie unter Brüdern unliterarisch bloßstellen.
2
Verehrte Anwesende! Zwischendurch zur Erbauung für Sie drei Zitate. Heinrich Heine behauptet:
Ein Talent können wir nach einer einzigen Manifestation anerkennen, für die Anerkennung eines Charakters bedürfen wir aber eines langen Zeitraums und beständiger Öffentlichkeit.
Friedrich Schlegel behauptet:
Die Dichter sind die Wurzeln der Zukunft…
Und – an anderer Stelle:
Darum darf es auch dem Dichter nicht genügen, den Ausdruck seiner eigentümlichen Poesie, wie sie ihm angeboren und zugebildet wurde, in bleibenden Werken zu hinterlassen. Er muß streben, seine Poesie und seine Ansicht der Poesie ewig zu erweitern und sie der höchsten zu nähern, die überhaupt auf der Erde möglich ist; dadurch – daß er seinen Teil an das große Ganze auf die bestimmteste Weise anzuschließen strebt: denn die tötende Verallgemeinerung wirkt gerade das Gegenteil. Er kann es, wenn er den Mittelpunkt gefunden hat, durch Mitteilung mit denen, die ihn gleichfalls – von einer anderen Seite auf eine andere Weise – gefunden haben. Die Liebe bedarf der Gegenliebe. Ja, für den wahren Dichter kann selbst der Verkehr mit denen, die nur auf der bunten Oberfläche spielen, heilsam und lehrreich sein. Er ist ein geselliges Wesen…
Drittes und letztes Zitat: Gotthold Ephraim Lessing (an einen Herrn R.): ,
Es freuet mich, mein Herr,
daß Ihr ein Dichter seid.
Doch seid Ihr sonst nichts mehr,
mein Herr? Das ist mir leid.
3
Nun wieder zu Ihnen, lieber Herr Bruder R.! – Sie solidarisieren sich mit Lessing, Sie schicken seinen eindeutigen Spruch Ihren vielsinnigen Depeschen voraus.
Von Ihrer Seite, auf Ihre bestimmte Weise – ich erinnere Schlegel – sind Sie zum Mittelpunkt vorgestoßen. Ihr… Talent – ich erinnere Heine – ist manifest. Was Ihren Charakter anbelangt, so behaupte ich unter Brüdern: Die von Heine geforderte „ständige Öffentlichkeit“ haben Sie lange teils gescheut, teils sich hartnäckig erst erkämpfen müssen. Auch die Gegenliebe, deren Ihre Liebe nach Schlegel bedarf, haben Sie, ich spreche von der gesellschaftlichen Gegenliebe, erst spät erfahren. Dennoch stehen Sie, nein, sitzen Sie heute als ein Mitbürger sondergleichen unter uns. Sie sind ein Schelm, Sie sind fromm und garstig. Das lob ich uns.
4
Allein, verehrte Anwesende, meine Charakteristik Jürgen Rennerts bleibt noch zu beweisen. Ich bitte um Ihre Geduld für weitere sieben Minuten.
Bereits vor sieben Jahren lag der ehemalige Schriftsetzer, Krankenpfleger und Werbetexter, der sehr heutige Dichter, Nachdichter und Publizist, in einem Wort: der freie Schriftsteller Jürgen Rennert, lag der baldige Heine-Preisträger auf einer Wolke und reimte – für Kinder (!) – unter anderem folgendes:
Manchmal kommst du auf Gedanken,
Die irr keinem Lehrbuch stehn.
Dann beginnt die Welt zu wanken
Und sich nach dir umzudrehn.
Denn sie fürchtet, daß da einer
Ihre alte Ordnung stört.
Irgendso ein winzig Kleiner,
Der nicht weiß, was sich gehört.
Der nicht weiß, was alle wissen.
Denn sonst ließe er den Quarks.
Wer die Welt stubst, wird gebissen
So wie weiland Dr. Marx.
Wenn das nicht die poetische Untat eines Erzschelms und Unruhestifters ist, was dann?
Und das lob ich uns.
5
Daß er fromm und garstig ist – fromm im reinsten und ursprünglichsten Sinn des Worts, dem nachzusinnen und auf den Grund zu kommen auch manchen wissenschaftlichen Sozialisten, meine ich, noch irdischer, noch diesseitiger machen kann…
Daß er fromm und garstig ist – garstig, weil politisch, weil wach und gescheit und entschieden in unserer Mitte, an unserer Seite, für unsere Sache arbeitend (für den realen Kommunismus)…
Daß Jürgen Rennert fromm und garstig ist, möchte ich Ihnen vor Ohren führen, indem ich eine Rede verlese, die er nicht gehalten hat. Es handelt sich um seinen Beitrag zur Diskussion auf dem VIII. Schriftstellerkongreß, Ende Mai 78, auf dem Rennert wie zwölf andere nicht mehr zu Wort kam. – Wenn Sie nachlesen wollen, Sie finden die Rede im Protokoll zwischen den nachgereichten Beiträgen von Siegfried Pitschmann und Trude Richter.
Ich mute Ihnen, verehrte Anwesende, Jürgen Rennerts damalige Standortbestimmung gerade hier und heute (am 12. Dezember 1979) zu, weil seine Auszeichnung mit dem Heine-Preis, so empfinde ich das, besondere Bedeutung gewinnt an einem Tag, an dem es ernst wird, an dem anderorts – und nicht von uns – Entscheidungen getroffen werden, die uns alle gefährlich angehen.
6
Ich zitiere Jürgen Rennert:
Der VIII. Kongreß unseres Verbandes ist für mich ein Vorgang von großer Wichtigkeit. Gestatten Sie mir deshalb, daß ich von dem spreche, was mir gegenwärtig am wichtigsten ist: von meinem Selbstverständnis und der Lebensnotwendigkeit des Gedichts. Beides steht für mich in unauflösbarem Zusammenhang. Und so bitte ich Sie um Nachsicht, wenn ich das, was ich für meine Person zu erklären habe, durch Texte einer Dichterin pointiere, der ich mich in manchem verbunden weiß. Der erste Text, den ich bei ihr entlehne, hat den Charakter eines Satzes und lautet:
Schreib
deine eigene Welt
zu Ende
ehe das Ende
dich abschreibt.
Unter der Rubrik dieses Satzes erkläre ich, daß es zuallererst elementares Gottvertrauen ist, das mich hier – im mehrfach eindeutigen Sinne des Wortes – zuversichtlich und frei sprechen und leben läßt. Vertrauen auf jenen einen und einzigen Gott, der mit dem verbindlichen Gesetz die wesentliche Bedingung der Freiheit schuf. Ohne Bindung im Wirklichen – keine wirkliche Freiheit; ohne Rücksicht – keine Voraussicht; ohne beides – keine Einsicht. Und ohne dies alles – keine gegründete Zuversicht. Dies ist also der Grund, auf dem ich in aller Bewegung und Beweglichkeit stehe, Und zugleich ist dieser Grund auch ein Grund meines Schreibens. Ein Grund, der gedankliche und praktische Kooperation nicht nur gestattet, sondern herausfordert. Kooperation mit allen, die das Bild einer möglichen, sozial befreiten und befriedeten Welt nicht leugnen, nicht zerstören, nicht zynisch oder resigniert verraten. Kooperation mit allen, die diesem Bild mit all ihrer Macht und Ohnmacht zustreben, um es aus dem zerbröselnden Rahmen der Utopie zu lösen, um seine Wirklichkeit erlösend in der unseren aufgehen zu lassen.
An diesem von mir nicht genauer und nicht gerechter zu benennenden Denk- und Sachverhalt scheiden sich die Geister, die Haltungen und die Welten. Und der Kampf, der da schwelt und tobt, schwelt und tobt auch in mir. Es gibt keine Grenzen, die nicht auch immer mitten durch das eigene Herz gehen. Und jeder Krieg, der entbrannt ist und neu entbrennt, macht auch in uns Tote, Verwundete und Gefangene, schreit in uns nach seinem Ende. Einem Ende, das Frieden heißt und immer alles von uns verlangt, und oft genug Paradoxes: unsere unauffällige Tapferkeit, unsere disziplinierte Phantasie, unsere bedachte Offenheit. Um dies nicht allein verstehen, sondern vor allem Verstehen auch empfinden zu können, braucht es vielleicht den Dichter, der sich unentrinnbar in die Mitverantwortung für alle und alles gestellt weiß.
Die gebrannte Dichterin schreibt:
Im übersättigten
Hungerjahrhundert
kaue ich die Legende
Frieden
und werde nicht satt
Kann nicht verdauen
die Kriege sie liegen
mir wie Steine im Magen
Grabsteine
Der Frieden liegt mir am Herzen
ich kaue
kaue
das wiederholte Wort
und werde nicht satt.
Dieser ungestillte Hunger, von dem das Gedicht spricht, verbindet hierzulande viele, Atheisten und Theisten. Er ist der Hauptnenner vieler im einzelnen divergenter Anschauungen. Ich bin nach wie vor geneigt, das Vorhandensein dieses Hungers bei uns für staatspolitisch relevant zu halten. Nicht zuletzt prägte und prägt er auch das Gesicht unserer Literatur, auf dem sich höchst selten ein Anflug von Sattheit zeigt.
Die Literatur eines Landes, das sich gegen Auschwitz konstituierte, kann und darf nicht satt und ruhig werden. Ihr gehört an, ihr strömt zu, was sich mit ihren hungrigen Intentionen deckt. Und das ist viel.
Eine mir und uns verbündete Stimme habe ich hier – nach guter DDR-Tradition – einfließen lassen. Sie gehört der Dichterin Rose Ausländer, einer vom Faschismus Verfemten und Verfolgten, die heute einundsiebzigjährig in einem Düsseldorfer Altersheim lebt. Sie soll in meinem Beitrag zu unserem Kongreß das letzte Wort haben. Das Wort ist ein Gedicht und trägt die Überschrift „Bitte II“:
Wahrheit
sag mir die Wahrheit
Trag mich
auf deiner Schulter
sternweit
Ich will
dir tragen helfen
Rose und Schwert.
7
Soweit Jürgen Rennert. Uns bleibt nur noch, auf ihn zu übertragen – und die Übertragung ist stimmig –, was er im „Dritten Brief an Françoise“ über unser Leben mit Heine nachfragte und vorschlug:
Aber mit Rennert leben, das heißt doch auch, mit seiner fast krankhaften Sensibilität, seiner gesteigerten, überreizten Wachheit, seiner über das Unmittelbare hinausgreifenden politischen Neugier zu leben. Mir will scheinen, als hätten wir diesen Punkt erreicht und eine Tür geöffnet, um im angrenzenden Zimmer die Probe auf ein lohnenswertes und höchst einträgliches Exempel zu machen…
Lieber Jürgen Rennert, bleiben Sie sich und uns treu! Bleiben Sie ein Schelm, fromm und garstig! Von Bruder zu Bruder: Glück für den Lebensweg! Den Wecken ein gutes Gelingen!
Paul Wiens, neue deutsche literatur, Heft 3, März 1980
Krumbeck: Berliner Schriftsteller fühlt sich in der Prignitz richtig wohl
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Roland Lampe: Ein streitbarer Anwalt der Literatur
Märkische Oderzeitung, 13.3.2013
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + deutsche FOTOTHEK + IMAGO


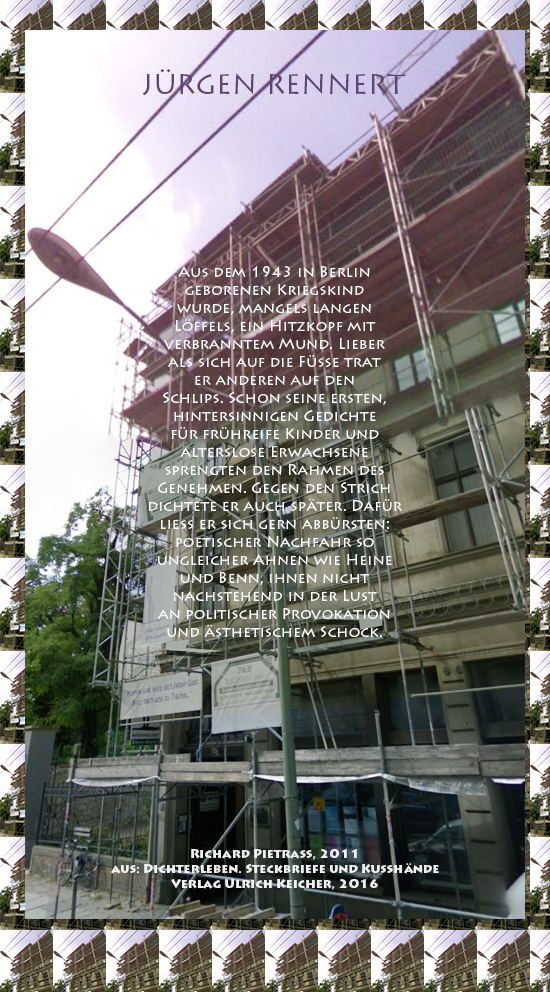












Schreibe einen Kommentar