Kerstin Hensel: Freistoss
DER NEUE TON
Und nun – groß durchatmen
Im abgfuckten Jahrhundert, die Hände
Tief in den Hosentaschen, vom Nichts
Dichten, wie vordem im Großenundganzen
Vom Nichts. Versschmieden klippern
Fern her
Jauchzt das Strickliesel in Millionen
Auflagen.
Ich könnte auch eine Betonmischmaschine bedienen
Wenn’s der Staat von mir fordert. Aber was
Seh ich: die geilen Neunziger, Hände tief
In den Hosentaschen. Der Kaderschmieden Köpfe:
Beton Beton und keinen Ton.
Die Aufklärer abgeklärt, die dunnemals wilden
Gelage, was traute ich denen und trauer
Denen nicht nach.
So müde ist’s hier, daß man vergißt, das Gas
Aufzudrehen. Unter den spitzen Häubchen der Sechziger:
Vergnügen in Gott irrdich und haschmich, ich bin
Der Frühling Haschisch. Hier dröhnt alles
Vierzig Jahre später so richtig die Klöppel zu, endlich
Vor jedem Trampelpfad das Stoppschild
HOFFNUNG
Das mit dem Ausweg ein linkes Ding –
Weggeatmet – und nun: das Nichts
Klippern, ja! und fern her, Ja!
Seid umschlungen!
Beiträge zu diesem Buch:
Jan Koneffke: Stunt-Ort-Dichtung
Freitag, 5. 4. 1996
Kurt Drawert: Aus den Winkeln der Hinterhöfe
Neue Zürcher Zeitung, 17. 10. 1996
Der langsame Blick, der gute Text
– Gespräch mit Kerstin Hensel. –
Birgit Dahlke: Was hat sich für dich als Autorin seit 1989/90 verändert?
Kerstin Hensel: Seit zehn Jahren habe ich endlich eine menschenwürdige Wohnung, durch deren Fenster Licht fällt! Das meine ich im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Das Land ist größer geworden, die Welt nähergerückt, und ich bin mit derselben Lust dabei, den Dingen nachzuspüren und über ihre Verrücktheiten zu schreiben, wie vor einem Jahrzehnt.
Dahlke: Würdest du sagen, daß es für dich als Schreibende ein Glück ist, daß du den gesellschaftlichen Einschnitt 1989 erleben konntest?
Hensel: Absolut. Wer darf schon mehrere Gesellschaftssysteme kennenlernen, und das auch noch in den Glücksfall gebettet, daß es kein Krieg oder eine blutige Revolution waren, die einem dazu verholfen haben.
Dahlke: Wie bezeichnest du diesen Einschnitt eigentlich, den ich mit „1989“ immer umschreibe, um ihn nicht benennen zu müssen?
Hensel: „89“ ist doch gut. Man weiß genau, was damit gemeint ist, zumindest noch für die nächsten zehn Jahre.
Dahlke: Dein Status als Autorin hat sich seit 1990 enorm verändert: Damals hattest du sehr jung drei Bücher veröffentlicht, warst Kandidatin des DDR-Schriftstellerverbandes und hattest gleichzeitig einige Texte an inoffiziell publizierte Zeitschriften wie Bizarre Städte gegeben, heute kannst du eine ansehnliche Reihe an Veröffentlichungen vorweisen, vom Roman über mehrere Lyrikbände, kleinere und größere Erzählungen, Hörspiele und Theaterstücke. Du hast jede Menge Literaturpreise bekommen, bist Mitglied von Jurys, warst im Literarischen Quartett. Erzeugt das alles nicht auch Druck?
Hensel: Ich mache in der Regel nur, was mich interessiert oder worauf ich neugierig bin. Allerdings wird die Neugier, was den Literaturbetrieb angeht, immer weniger. Ich kann mir derzeit leisten, drucklos zu leben – soweit du unter „Druck“ den der Öffentlichkeit meinst.
Dahlke: Du bist überhaupt nicht belastet durch all diese Jurys und öffentlichen Auftritte? Werden nicht die Maßstäbe, die du als Rezensentin vertrittst, und da bist du ja nicht zimperlich, auch gegen deine eigenen Texte gekehrt? War dein Schreiben um 1990 nicht viel unbelasteter?
Hensel: Die Maßstäbe, die ich als Rezensentin, d.h. als Leserin vertrete, richte ich auch an meine eigenen Arbeiten. Da kann es natürlich sein, daß der Jäger zum Gejagten wird. Seit längerer Zeit vermeide ich es, über mir bekannte deutschsprachige Kollegen zu schreiben, wenn ich ihre Arbeiten nicht allzusehr schätze.
Dahlke: Bisher hast du ja immer sehr diszipliniert mit deiner Zeit umgehen müssen, wird sich das jetzt ändern, wo dein Lehrauftrag an der Schauspielschule endet und du freiberuflich arbeiten wirst?
Hensel: Ich war immer freiberuflich, nur gibt es jetzt keine Schauspieleleven mehr, die ich mit Verslehre und Diktion quälen kann. Aber ich habe schon andere Opfer gefunden. Deutschlehrer in Weiterbildungsseminaren zum Beispiel. Im übrigen habe ich jetzt endlich mehr Zeit, in die Pilze zu gehen.
Dahlke: Du trittst ja heute, im Unterschied zum Anfang der neunziger Jahre, auch viel häufiger öffentlich in der Rolle der Autorin auf, als Gesprächspartnerin, als Gastgeberin, als Mittlerin.
Hensel: Das bringt der Beruf mit sich. Du bist als eine, die so sperrig, also nicht bestsellerverdächtig, schreibt wie ich, immer auch Mittlerin für das Publikum. Natürlich kannst du dich in eine Ich-zeig-mich-nicht-Aura hüllen und den Nimbus des Geheimdichters pflegen, aber da warte ich lieber, bis ich die Weisheit dazu habe.
Dahlke: Hat sich darüber hinaus mit dem Mauerfall etwas in deiner Lebenssituation verändert?
Hensel: Ich hätte auch mit Mauer dafür gesorgt, daß ich nicht in einem einzigen Dasein vor mich hin schmore.
Dahlke: Inwiefern haben die vielen Reisen, in die USA, nach Mittelasien, Skandinavien, Israel, das halbe Jahr in der Villa Massimo deine Weltsicht verändert?
Hensel: Sie haben meine Weltsicht verdeutlicht, verstört, aber nicht geändert. Im Grunde bin ich ein seßhafter Mensch, der sich nur manchmal die Beine woanders vertreten will. Wenn ich im Ausland bin, kann ich nur gucken und staunen, nicht schreiben. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Vielleicht daran, daß ich meine Freunde, Bücher und Kochlöffel um mich herum brauche. Im Ausland, wo ich mich ja immer nur relativ kurz aufhalte, kann ich mich allenfalls über Fremdes informieren, leben kann ich es nicht.
Dahlke: Du hast auch immer auf dem Fiktionalen als dem für dich Wesentlichem bestanden und Formen des Dokumentarischen als dir eher fernstehend bezeichnet. Reisereportagen sind von dir also nicht zu erwarten.
Hensel: Kaum.
Dahlke: Wie ist das mit Reisen ins „andere Deutschland“, nach Westdeutschland? Du liest ja viel im ehemaligen Westen. Und: Siehst du dich Anfang 2000 eher als DDR-Autorin oder eher als deutsche Autorin?
Hensel: Ich bin mental total Ostsee-Alpen-fixiert. Ich treibe mich gern in allen Ecken, an allen Grenzen Deutschlands herum, sammle dort die wunderlichsten Menschen mit ihren Geschichten, spüre ihren Dialekten hinterher und bin froh, wenn ich nicht Englisch sprechen muß.
Dahlke: Nun gibt es neben sprachlichen Kontakten ja auch noch andere Eindrücke, Gesten, Rituale, Tänze, Landschaften… Für dich sind die Gespräche mit Leuten wichtiger als Landschaften, ja?
Hensel: Natürlich lese ich Literatur aus dem Ausland. Den größten Teil meiner literarischen Eindrücke habe ich über nichtdeutsche Literatur bekommen. Ich verstehe zum Beispiel Lateinamerika besser durch die Romane von García Marquez, als wenn man mich zwei Wochen in den Dschungel schicken würde.
Dahlke: Du bist weniger DDR-Autorin als deutsche Autorin?
Hensel: Wenn du fast dreißig Jahre in der DDR gelebt hast, bist du genauso geprägt, wie wenn du dreißig Jahre im Sauerland oder in Oberschwaben verbracht hast. Niemand kann leugnen, woher er kommt. Du schreibst immer aus deiner Herkunft heraus, auch wenn du dich noch so weltläufig gibst. Worüber du am besten Bescheid weißt, darüber hast du am meisten zu sagen, und nur das wird dir wirklich überzeugend gelingen. Ich meine damit nicht, daß man nur über sich schreiben soll.
Dahlke: Aber du hast doch inzwischen zehn Jahre gesamtdeutsche Erfahrung.
Hensel: Das ist eine andere Tatsache. Kindheit und Jugend sind für das Leben prägender als die Herbstjahre. Ein Roman, in dem Kindheit gar keine Rolle spielt, funktioniert nicht.
Dahlke: Es gibt noch immer die Aufforderung an AutorInnen aus der DDR, doch endlich thematisch von der DDR loszukommen, sich neuen Themen zuzuwenden, in der Einheit „anzukommen“. Deine Perspektive von unten, die soziale Genauigkeit deiner Figuren halte ich für spezifisch für DDR-Literatur.
Hensel: Weltliterarisch betrachtet, finden sich sozial genaue Darstellungen überall. Derzeit vielleicht in Osteuropa mehr als anderswo. Aber auch die DDR-Literatur entsprach dem nur zu einem kleinen Teil.
Dahlke: Mit den Erzählungen „Tanz am Kanal“ oder „Im Schlauch“ ist dir gelungen, seismographisch das Klima, die soziale Dynamik der Jahre nach 1989 zu erfassen. Ist das „dein Thema“ dieses Jahrzehnts geworden?
Hensel: Themen interessieren mich weniger, Tagesthemen für die Literatur überhaupt nicht. Wichtig ist es, Zusammenhänge zu erkennen, sie zu gestalten und ihnen Dauer zu verleihen. Jeder, der schreibt, kreist immer wieder um ein und denselben Zentralpunkt, d.h. um einen Stoff, nicht um ein Thema.
Dahlke: Trotzdem fungiert gute Literatur doch immer auch als Seismograph gesellschaftlicher Verhältnisse, sie fängt ein, was an Ängsten, Bewegungen und Stimmungen zum Zeitpunkt ihres Entstehens in der Schwebe ist, schwelt, heraufdämmert. Was atmosphärisch zu ahnen, aber noch nicht auf den Punkt zu bringen ist…
Hensel: Gute Literaten sind immer Seher. Die Frage ist nur, wie du dir den Abstand zur Zeit schaffst, um sie zu durchschauen oder Zukunft zu erahnen.
Dahlke: Ist das für dich eine legitime Erwartung an Literatur, an AutorInnen, etwas von dem zu begreifen, was in ihrer Zeit vor sich geht? Oder ist das zu didaktisch? Ich sehe eine große Orientierungslosigkeit vieler Menschen, überhaupt nicht nur ganz junger oder ganz alter… Kann gegenwärtige Literatur da etwas zur Selbstverständigung beitragen? Oder ist das für dich ein vollkommen überholtes Literaturverständnis?
Hensel: Es ist nicht nur Aufgabe der Künstler, Dinge und Ereignisse durchschaubar zu machen, es ist die Pflicht aller denkwilligen Leute, dies zu tun. Dabei meine ich nicht Aufklärung im Sinne rabiater Didaktik. Die heutige Kult- und Kulturgesellschaft giert ständig nach Neuem; Kitsch- und Schockprogramme geben immer vollendetere Surrogate ab, und da ist es schnell so, daß du als Mensch allein bist und merkst es gar nicht. Auf dem bequemen Weg der medialen Verblödung gaukelt man den Leuten ein Selbstverständnis vor, das sie nicht haben. Ein Teil dessen, was heute als Gegenwartsliteratur verkauft wird, bemüht sich, durch Eitelkeit und Pop-Aktualität dies ebenso zu tun – du mußt dich da abgrenzen und eben weniger beliebt bleiben.
Dahlke: Meinst du, wir können die Welt heute in irgendeiner Art „durchschauen“?
Hensel: Nur in Teilen. Wir wissen ja nicht, was wirklich stattfindet, wir ahnen nur etwas. Was da im Hintergrund wirklich passiert, an den Börsen, in den Gen-Labors, in der Kernphysik – es bleibt uns letztlich verschlossen. Das darf einen nicht dazu verführen, zu resignieren und nichts mehr verstehen zu wollen.
Dahlke: Ist die Unübersichtlichkeit der Welt, der Gesellschaft der Grund für die Schwierigkeiten zeitgenössischer Dramatik? Du schreibst ja auch Theaterstücke und Hörspiele. Braucht Dramatik nicht immer den Draufblick auf Strukturen?
Hensel: Diese Schwierigkeiten haben viel mit der Theatersituation zu tun. Theater ist ein altes und langsames Medium, dem die heutige Welt in ihrer Aufgeregtheit davonzulaufen scheint. Ein weltweites Problem, denke ich. – Zur Zeit der DDR habe ich geglaubt, daß nur das schrille, absurde Theater dazu in der Lage sei, die eingefahrenen gesellschaftlichen Strukturen aufzureißen – heute, wo Absurdität auf der Bühne überwiegt, aber in bloße Hackstückerei des Textes übergegangen ist, versuche ich wieder dramatische Strukturen zu finden, altmodische Dinge wie Charakter, Konflikte und Fabeln nicht sterben zu lassen.
Dahlke: Mir sind wenig neuere Theatertexte bekannt, wo solche dramatischen Strukturen erkennbar sind…
Hensel: Du hast recht, heute wird ja auf der Bühne alles verspielt: Prosa, Lyrik, Gebrauchsanweisungen, Schaltpläne… Es mag sein, daß so etwas die verfahrene Situation des Theaters dokumentiert, aber es interessiert mich weniger. Die kleineren Stadttheater, die durch ökonomischen Druck, mitunter auch durch Feigheit der Direktoren, nur noch erfolgssichere Schmankerln aufführen, finde ich noch bedauernswerter! Von vielen gegenwärtigen Autoren, vor allem Frauen, weiß ich, daß sie von Theater und Dramaturgie recht wenig wissen, eher auf Performances aus sind, und ihre Texte vielleicht deswegen für die Bühne tauglich scheinen.
Dahlke: Welche Erfahrungen hast du mit deinem Theaterstück Hyänen 1999 in Ingolstadt gemacht?
Hensel: Hyänen ist ein Charakterstück. Inszeniert wurde es als Farce, flott, schrill, mit einer Portion moderner Masche, aber es kam in der kleinen bayrisch-katholischen Stadt gut an.
Dahlke: Worum geht es?
Hensel: Eine junge Sekretärin namens Elly liebt den Juniorchef eines Schlachthofs, versucht der ewig erziehenden Mutter und dem harmoniegeilen Vater zu entkommen, indem sie auf die Sonnenseite der Gesellschaft gelangen und den Ruhm einer Künstlerin genießen will. Aus den Figuren von Einkaufskatalogen leimt sich Elly triviale Geschichten von Liebe und Glück zusammen und nähert sich mit dieser Liebe ihrem Chef. Von einem skrupellosen Verleger wird sie zum Verkaufsschlager hochgeschossen und wieder fallengelassen. Jeder in dieser Gesellschaft gehört den Hyänen an, jenen Tieren, die sich gegenseitig zerfleischen oder im Rudel auf Beutekampf gehen, um zu überleben – ein Stück mit Parabelcharakter also.
Dahlke: Das würde ja dann für die „deutsche Autorin“ sprechen, da gibt es keine Verständnishürden, kein Ost-West-Rezeptionsproblem.
Hensel: Das ist ein Stück, das überall spielen kann. Weit weg von der sogenannten DDR-Thematik, aber aus dem Verständnis für die Schwächeren geschrieben.
Dahlke: Das ist eigenartig, wenn ich da an die Angriffe im Berliner Literarischen Colloquium denke, wo dein Text „Gipshut“ noch im Manuskript als sozialistischer Realismus angegriffen wurde, ja wo es bis zu persönlichen Angriffen ging… Da mag Konkurrenz, der Haß auf den lange wirksamen Ostbonus eine Rolle gespielt haben, Neid auf deine vielen Preise…
Hensel: Ich bin bis jetzt auf meinen Lesungen in Westdeutschland noch nie als DDR-Autorin angegriffen worden. Vielleicht darf man nicht mit so vielen Schriftstellerkollegen zusammentreffen, weil die immer glauben, sich in einer Gladiatorenarena zu befinden und den anderen niederbeißen zu müssen.
Dahlke: Dieser Ost-West-Unterschied in ein und derselben AutorInnen-Generation interessiert mich sehr, ich stelle oft einerseits eine Art „Erfahrungsdruck“ in ostdeutschen Texten fest (wie in den neuen Gedichten von Lutz Seiler zum Beispiel, der gerade den Kranichsteiner Literaturpreis bekommen hat), und andererseits eine Art biographische Leerstelle in westdeutschen Texten, was dann manchmal zu dieser „Germanistenlyrik“ führt, hochartifiziell und gekonnt, aber irgendwie leer … Darf ich das jetzt so sagen? In der Gesprächsreihe mit AutorInnen aus Ost und West, die du 1998/99 im Berliner Literaturforum im Brechthaus gemacht hast, seid ihr auch darauf gestoßen.
Hensel: Das darf ich als Autorin nicht sagen, du als Germanistin darfst es. Was ich aber in vielen Gesprächen mit Kollegen meiner Generation aus dem Westen festgestellt habe, ist, daß wohl die meisten arg unter Selbstzensur gelitten haben, vielmehr als wir unter den sozialistischen Kulturvorgaben. Viele Kollegen kamen über das Germanistikstudium zum Schreiben und kannten sich in den Moderne-Diskursen aus. Da war es zum Beispiel in den siebziger und achtziger Jahren verpönt, über Natur oder die Arbeitswelt zu schreiben, oder ganze Sätze zu verfassen oder dies oder jenes anzusprechen – unter der Fuchtel, auf der Höhe der Modernediskussion sein zu müssen, hat man dann immer mit dem Radiergummi in der Hand geschrieben. Die Autoren, die das betrifft, reden heute sehr selbstironisch davon.
Dahlke: Vielleicht in dem Wissen, daß eine Übermacht an Texten schon geschrieben ist, daß es eine Pluralität von Stilen gibt, auf die man jederzeit als Lesender zurückgreifen kann. Dieses Gefühl hatte man in der DDR ja nicht, da gab es jede Menge Lücken, Verdrängtes, Marginalisiertes, auch Tabus, gegen die man anschreiben konnte.
Hensel: Eine sogenannte Postmoderne gab es in der DDR nicht, aber das Anschreiben gegen Tabus um der Tabus willen, diese krampfige Wahrheitsfindung, machte die Literatur auch nicht besser.
Dahlke: Dann betrifft dich diese andere Situation als Autorin doch jetzt auch. Bemerkst du solcherart Selbstzensur inzwischen auch an dir selbst?
Hensel: Ich habe meine Vorstellungen davon, was ich will. Die „absolute Geschichte“ steht noch aus. Absolut im Sinne von meisterhaft erzählt. Wie ich das schaffe, ist meine Sache. Da spielen literarische Maßstäbe eine Rolle, keine Forderungen von außen. Das klingt nicht sehr erfolgsträchtig.
Dahlke: Solchen Erfolg kann man doch aber nicht voraussagen, „Tanz am Kanal“ z.B. löste 1994 eine größere Reaktion aus.
Hensel: Was ist Erfolg? Woran mißt man ihn? Alle meine Bücher (außer denen, die in kleinen Verlagen oder in der Umbruchszeit 1989/90 erschienen sind) haben Aufmerksamkeit in der Presse und vor allem bei Germanisten gefunden. Aber die Verkaufszahl hat bei keinem die 1.500er-Grenze überschritten. Mit anderen Worten: Diese Bücher haben kaum ein Publikum, und ein Haufen positiver Kritiken hat nichts zu bedeuten. Ich will mich darüber aber nicht wirklich beklagen. Wichtig ist für mich der gelungene Text, nicht ein Ruhm, der sich auf den Begriff „Bestseller“ gründet.
Dahlke: Daß Reich-Ranicki dich ins Literarische Quartet„ einlud, hatte nichts damit zu tun, daß er deinen Namen kannte?
Hensel: Mit Sicherheit nicht, er kannte bis dahin keine Zeile von mir. Ins Literarische Quartett wird man aber auch nicht als Autorin geladen.
Dahlke: Zum Stichwort Verlage: Du hast ja seit 1990 eine wechselnde Verlagsgeschichte – Reclam Leipzig, Mitteldeutscher Verlag Halle, Luchterhand, Suhrkamp, Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Kontext, Edition Balance, jetzt Kiepenheuer Leipzig. Wie kommt das?
Hensel: Nachdem der Mitteldeutsche Verlag nach 1989 vor allem Telefonbücher druckte, der Luchterhand Verlag (in dem die Lizenzausgaben erschienen waren) alle DDR-Autoren abgestoßen hat, nachdem Suhrkamp mich aufgenommen hatte und nach zwei Büchern meiner überdrüssig geworden war, nachdem meine Lyrik nur in einem Kleinverlag erscheinen konnte, bin ich jetzt mit immerhin schon drei Büchern beim Gustav Kiepenheuer Verlag, und da schau mer mal, wie’s weitergeht.
Dahlke: Aber Katja Lange-Müller z.B. ist doch schon lange bei einem Verlag, bei Kiepenheuer & Witsch, oder?
Hensel: Du kannst auch Glück haben. Vielen Autoren, die bei den großen Verlagen sind, geht es jedoch genauso wie mir. Spätestens nach dem zweiten Buch macht ihnen der Verlag Druck. Der besteht meist darin, daß man die Autoren auffordert, den Erwartungen, die ihr erstes Buch gesetzt hat, immer wieder mit der gleichen Masche zu entsprechen. Tun sie das nicht, zeigt man ihnen schnell die Tür – und tun sie es, kann es sein, daß sie wie Fußballstars von anderen Verlagen abgekauft werden. Auch der häufige Wechsel von Lektoren ist zu erwähnen, d.h. wenn man überhaupt noch von Lektoren sprechen kann.
Dahlke: Engagieren sich die Verlage denn nicht für ihre AutorInnen, versuchen sie sie nicht zu halten? Was Suhrkamp für den neuen Band von Barbara Köhler macht, ist doch lächerlich.
Hensel: Gedichtbände sind bei allen Verlagen unbeliebt, weil sie sich nicht verkaufen. Das heißt aber nicht, daß es in diesem Land nicht engagierte und wissende Verleger gibt, die sich für ihre Autoren und für das Stiefkind Lyrik einsetzen. Die konkrete Arbeit an den jeweiligen Büchern, die ich erlebt habe, war in den meisten Fällen korrekt. Auch habe ich Lektorinnen und Lektoren kennengelernt, mit denen ich heute befreundet bin.
Dahlke: Bei welchem Theaterverlag bist du jetzt?
Hensel: Beim Projekt-Theater- und Medienverlag in Köln. Theaterverleger sind eher Agenten als Lektoren, und das ist auch gut so. Da sie nicht vom Buchverkauf existieren, sondern über die Vermittlung von Stücken, sind sie dem Autor auch immer freundlich auf der Spur. Theaterverlage wechselt man selten.
Dahlke: Wie ist das mit der Gutenberg-Presse Leipzig oder der Edition Balance?
Hensel: Die Pressen sind wieder ein ganz anderes Kapitel. Bibliophile Ausgaben in kleiner Auflage sind mit einer großen Veröffentlichung nicht vergleichbar. Man vergißt bei diesen Kostbarkeiten nicht, daß es noch so etwas wie Buchkunst gibt. Allerdings wird dieser Bereich von Sammlern, nicht von Lesern dominiert.
Dahlke: Machst du noch bibliophile Ausgaben mit KünstlerInnen wie Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre?
Hensel: Das ist weniger geworden, hat aber nicht aufgehört. Die Zusammenarbeit mit Komponisten interessiert mich inzwischen mehr.
Dahlke: Die Buchpremiere zu Gipshut wurde vom Schlagzeuger Gottfried Rößler begleitet, du hast Libretti zu Musik von Friedrich Schenker und Andre Werner geschrieben.
Hensel: Ja, und in diesem Jahr findet in Rheinsberg die Uraufführung einer kleinen Oper zum Lilith-Stoff statt, deren Libretto ich geschrieben habe. Die Musik stammt von Helmut Zapf.
Dahlke: Wunschprojekte der nächsten Zeit?
Hensel: Ich würde gern meinen Traumfilm schreiben, ohne die brutal-blöden Geld- und Erfolgsmaßgaben, die im Filmgeschäft gesetzt werden. Die Erfahrungen mit der verknöcherten Produzentenszene, die ich im letzten Jahr gemacht habe, versichern mir aber, daß das wohl ein Traum bleiben wird.
Dahlke: In einem früheren Gespräch kamen wir auch auf die Abwesenheit von Humor in der deutschen Gegenwartsliteratur zu sprechen, siehst du das noch genauso? Was hältst du von dem Film Sonnenallee?
Hensel: Bei dem Film Sonnenallee gab es keinen Zentimeter künstlerischen Anspruch. Ich habe mich gelangweilt, weil er voller Klischees war und auf mich wirkte, als würde mir jemand 120 Minuten lang Witze erzählen. Mag auch sein, daß mir alles Rockig-Poppige fremd war und bleibt.
Dahlke: Mir fiel auf, daß mit Brussigs Helden wie wir viele GermanistInnen meinten zeigen zu müssen, daß sie sehr wohl auch diese unterhaltsame Literatur zur Kenntnis nehmen. Kaum ein Aufsatz zur deutschen Gegenwartsliteratur kam ohne die Spiegel-Entdeckungen Brussig oder Ingo Schulze aus. Dem wurde das eher melancholische „Fräuleinwunder“ an die Seite gestellt – auch so ein Medienphänomen. Andere wichtige Texte, etwa von Christoph Brumme, Annett Gröschner, Peter Wawerzinek, Andreas Koziol, finden selten Beachtung. Werden Lockerheit, Unterhaltsamkeit, Ironie amerikanischer Entertainer zur neuen gesellschaftlichen Norm gerade für Intellektuelle?
Hensel: Ich bin im Grunde nicht gegen Ironie. Aber diese Ironie, von der du sprichst, ist absolut gesellschaftsfähig. Sie tut – im Gegensatz zur Komik und Groteske – niemandem weh, wird hofiert und lenkt auf die Dauer davon ab, in tiefere Bewußtseinsschichten zu dringen. Aber was ist heute schon von Dauer? Jedes halbe Jahr reißen die Medien einen neuen Knallbonbon auf und warten, was an literarischen Wundern herausfällt. Man sollte es nicht allzu ernst nehmen.
Dahlke: In unserem Gespräch von 1993, das in dem Band Papierboot. Autorinnen aus der DDR – inoffiziell publiziert (Würzburg 1997) veröffentlicht wurde, hast du die beherrschte Ästhetik in Hermlins Abendlicht zum Maßstab erhoben und Affekttexte, Tagebuch für dich abgelehnt, aus Angst vor „inneren Abgründen“, sagtest du damals. Siehst du das noch genauso?
Hensel: Ja. Tagebuch schreibe ich noch immer nicht. Es gilt der veröffentlichte Text!
Dahlke: Die frühen surrealistischen Gedichte, die Groteske in „Kotterba“, das ist so überbordend: Der Lehrer wächst durch die Decke, die Ofenkachel fliegt durchs Zimmer… Ist das eine Ausnahme?
Hensel: Das Überbordende und das Unbewußte hängen mit dem Geordneten, dem Kontrollierten und der Konstruktion zusammen. Die Gefahr dabei ist, sich in seiner Phantasie zu gefallen. Dann fängst du selbst an, durch die Decke zu wachsen, und verlierst den Überblick. Konstruktion bremst. Abgründe delegiere ich immer auf meine Figuren. Wieweit sie mein eigenes Leben betreffen, erahnen nur Leute, die mich sehr genau kennen.
Dahlke: Da du die Perspektive „von unten“ nun schon mehrmals durchgespielt hast: Ließe sich nicht auch mal mit einer Perspektive „von oben“ experimentieren?
Hensel: Willst du wirklich eine Welt beschreiben, die untere oder die obere Gesellschaft, dann mußt du sie schon genau kennen. Recherchen bringen nur bedingt weiter. Obwohl ich der Meinung bin, ein Schriftsteller muß sich glaubhaft in andere Personen und Umstände hineinversetzen können, weiß ich auch, daß er niemals seine Herkunft verleugnen kann und letztlich immer wieder über das schreibt, was er kennt. Im Kleinen (Gedicht, Erzählung) kann das Hineinsteigen in eine fremde Welt gelingen, im Großen (Roman, Stück, Film) wirst du schnell von Fakten und Klischees eingefangen.
Dahlke: Wogegen schreibst du heute an? Muß es überhaupt so ein Dagegen als Schreibantrieb geben?
Hensel: Ich schreibe nicht gegen einen Feind, sondern erzähle, was ich sehe. Natürlich ist schon die Tatsache, daß man überhaupt etwas niederschreibt, ein Widerstand gegen das Bilderrauschen und Gestammel des Alltags. Der Schriftsteller, wenn er gut ist, hat einen langsamen Blick, und er schreibt an gegen schnelles Überblicken und gegen Oberflächlichkeit.
Dahlke: Das macht ja auch jede Ironie so schwierig.
Hensel: Was willst du heute ironisieren? Die gewesene DDR? Abgehakt. Den Kapitalismus? Der ist so wenig komisch, daß er nicht mal fürs Kabarett taugt. Die Politiker? Die sind Realsatire und allenfalls für den Kölner Karneval brauchbar.
Dahlke: Die Fähigkeit zu sprechen, über eine eigene Sprache zu verfügen, ist eines deiner Kernthemen. Die Pschespoldnitza in Gipshut fordert dazu auf, sein Leben zu erzählen, um sein Leben zu erzählen. In „Tanz am Kanal“ sind die sozialen Auseinandersetzungen immer auch solche um Benennungen… Wenn man weiß, wo du herstammst, erhält diese Fähigkeit zu sprechen, sich abzuheben, gegen provinzielle Dumpfheit zu denken, eine existentielle Dimension.
Hensel: Die Pschespoldnitza fordert zum Erzählen auf und verkündet gleichzeitig meine Poetik des Erzählens: Wer in der Lage ist, eine Stunde lang spannend über ein Streichholz zu erzählen, dem sei sein Leben geschenkt, wer nicht, der muß untergehen.
Dahlke: Du hast nun alle möglichen literarischen Formen ausprobiert, Roman, Erzählung, Sonett, Opern-Libretto, hast du inzwischen „deine“ Form gefunden?
Hensel: Jede Form ist in sich spannend, und nicht jeder Stoff kann in jeder Form bearbeitet werden. Es reizt mich immer wieder, mich von einer Form fesseln zu lassen und mich innerhalb dieser Fesseln frei zu bewegen.
Dahlke: Gibt es für dich Rangabstufungen zwischen Lyrik, Dramatik, Prosa?
Hensel: Nein. Ich schreibe zwar weniger Gedichte, aber das liegt daran, daß ich an der Schauspielschule seit langer Zeit über Verse predige. Nach fünf Jahren habe ich wieder einen schmalen Gedichtband fertig. Er trägt den Titel Bahnhof verstehen und wird meinem Verlag im Herbst vorgelegt. Derzeit hat das Theater bei mir den Vorrang.
Dahlke: Aufregende Lektüreerlebnisse der letzten Jahre?
Hensel: Aufregend ist vor allem das, was ich jedes Jahr lesen kann und was mich jedes Jahr aufs neue fasziniert: Büchner etwa, Kleist, Hölderlin, Goethe, Rilke, die Gebrüder Mann und andere mehr. Im vergangenen Jahr hat mich ein Buch tief angegriffen und berührt: die Gedichte von Heiner Müller, und sozusagen als höhnisches Gegenwerk: die billigen Reimereien von Peter Hacks.
Dahlke: Erlaube mir zum Schluß eine Nachfrage zum Reizthema Feminismus, hat sich da irgend etwas in deiner Sicht verändert? Du sprichst nach wie vor vom „Schriftsteller“, auch wenn du dich selbst meinst.
Hensel: Ismen lehne ich immer noch ab. Was mir aber zunehmend klarer wird, ist die Tatsache, daß wir in der DDR dem Selbstverständnis von Frauen und Männern sehr viel näher waren, als das heute der Fall ist. Ich beobachte gegenwärtig eine wahre Lust der Leute zur (Selbst-)Erhöhung und (Selbst-)Diskriminierung. In eine weibliche Traditionsreihe stelle ich mich aber nicht. Mich interessieren Persönlichkeiten, Männer und Frauen.
neue deutsche literatur, Heft 532, Juli/August 2000
Brigitte Schwens-Harrant im Gespräch mit Kerstin Hensel – „Die Realität ist es, die übertreibt“.
KERSTIN HENSEL
ich bin eine Tüte
die sich allein durch den Wald trägt
dann auf einer Lichtung liegt
und ihren Knisterrausch ausschläft
ich bin eine Tüte
die sich langsam
über meinen Schädel zieht
bleibt nur zu hoffen, dass sich
irgendwer schon darüber freut
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram +
Facebook + KLG + IMDb + PIA + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Kerstin Hensel liest das Gedicht „Erste Hoffnung“ auf der Großen Nacht der Poesie des 2. ÖKT in München.


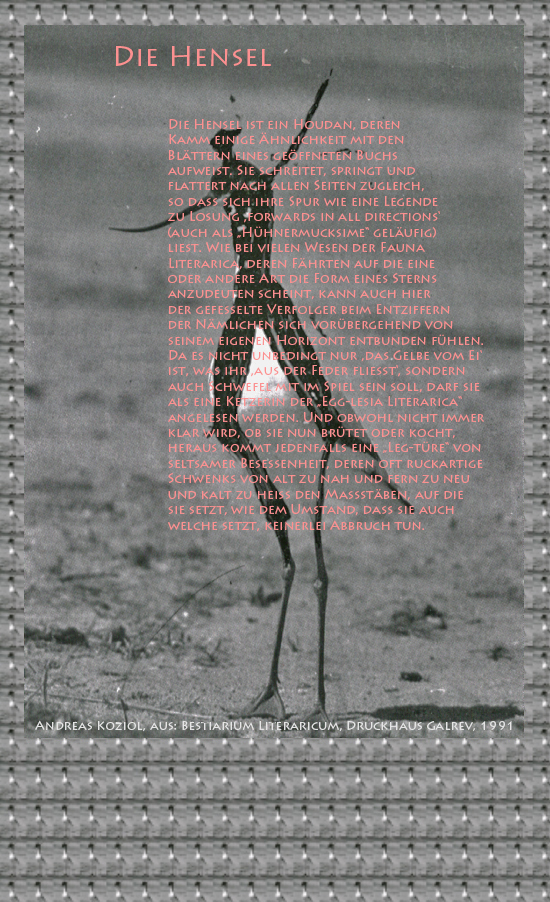
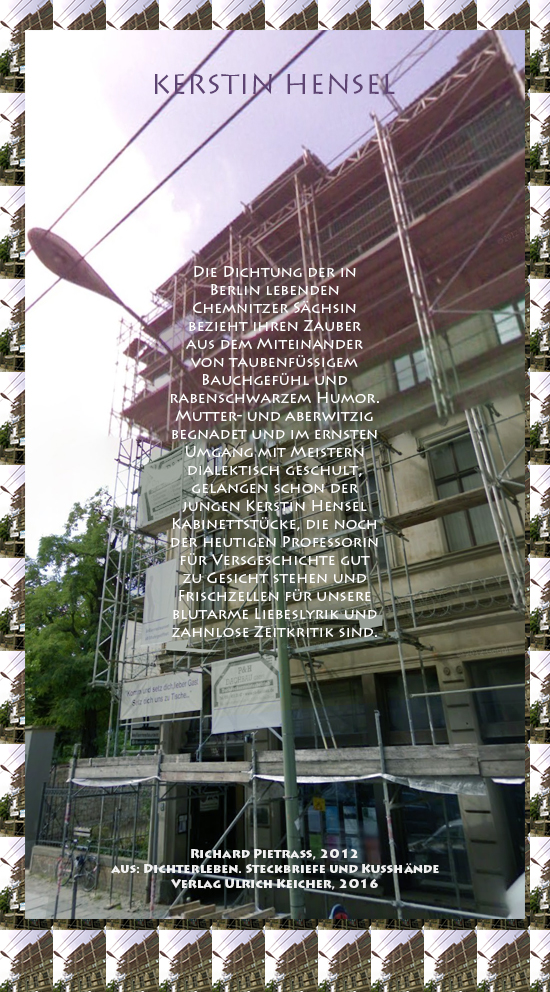












Schreibe einen Kommentar