Kurt Drawert (Hrsg.): „Die Signatur deiner Augen“
MIT HEINE
Dies Land, von dem die Rede geht,
es war einst nur in Mauern groß,
dies Land, von Lüge zugeweht,
ich glaubte schon, ich wär es los.
Ich glaubte schon, es wär entschieden
daß wer nur geht, auch gut vergißt.
Doch war nun auch ein Ort gemieden,
der tief ins Fleisch gedrungen ist.
Als fremder Brief mit sieben Siegeln
ist mir im Herzen fern das Land.
Doch hinter allen starken Riegeln
ist mir sein Name eingebrannt.
Kurt Drawert
Die Ferne des Lebens. Die Nähe der Poesie.
– Eine Vorbemerkung. –
I
„Wer das Dichten will verstehen, / Muss ins Land der Dichter gehen“, heißt es bei Goethe. Diese simple Behauptung hat einen tiefen Grund: dass sich die poetische Sprache in ihrer komplexen inneren Ordnung nur dem vollständig öffnet, der die Orte ihrer Entstehung sehen und erleben kann. Natürlich können wir nicht erwarten, dass der Leser von Gedichten diesen Weg zu den Orten tatsächlich geht – und was wäre dann mit der antiken oder barocken oder klassischen Dichtung, von der es keine geopolitischen, sozialen und kulturellen Referenzen mehr gibt? Denn das ist ja die transzendierende Dimension jeder Dichtung, dass sie uns Räume erlebbar und erinnerbar macht weit über deren Geschichte hinaus. Nur gibt es immer auch sprachliche Verluste, unaufgelöste Bilder und symbolische Verweise, die ideolektisch, also geheimsprachlich bleiben. Diese Verluste aber relativieren sich im Augenblick eigenen Erlebens. Plötzlich ist eine Metapher real und löst sich auf, wie zum Beispiel in einigen Hölderlin-Oden, in denen die Wanderschaft des Autors zu Bildern geführt hat, die ganz naturgegeben waren und sichtbar dem Auge dessen, der diese Wege ihm hinterherging (wie es zum Beispiel der Herausgeber der großen kritischen Hölderlin-Herausgabe Dietrich E. Sattler getan hat). Ebenso gibt es Literaturtheoretiker wie Paul de Man, die von der radikalen Unverständlichkeit des lyrischen Textes sprechen, weil er mit seinen rhetorischen Mitteln der Tropen jede semantische Verbindlichkeit sprengt. Und wenn diese apriori gegebene Unverständlichkeit dennoch verstanden werden kann, dann eben nur, weil der Leser über die Begabung einer imaginären Komplettierung verfügt, das heißt, er kann in sich aufrufen, was der Text mit seinen sprachlichen Zeichen aufgerufen (hervorgebracht, und eben nicht abgebildet) hat; er kann (auf-)füllen, was leer zwischen den Wörtern und Sätzen und Zeilen geblieben ist und doch einen Hinweis auf das Ganze liefert. Genau das nun führt zu dem Problem der kongenialen Übersetzung von Literatur und Poesie im besonderen: dass sie nicht dann gelungen ist, wenn sie sich am Original festhält und an die Inhalte hängt, die immer nur Oberflächen sind, sondern ihren Sinn in der Art und Weise der Rede entdeckt, die einen sprachlichen Mehrwert, einen Überschuss einführt. Denn das Unsichtbare sichtbar werden zu lassen – und nichts anderes intendiert ein Gedicht – heißt auch, mit sprachlichen Zeichen eine Welt so abzugrenzen, dass sie ins Innere ihres Wesens führt und dadurch auch antizipiert werden kann. Das Wesen selbst aber ist durch singuläre oder nur lose miteinander verknüpfte Zeichen noch nicht präsentiert; erst in der sehr besonderen Architektur aller Zeichen, in der Syntaktik entsteht, was die Semantik gern möchte. Form und Inhalt sind demnach korrelativ und nicht voneinander zu trennen. Um nun auf die Form der Rede zu kommen, auf das Wie des Was, und damit schließe ich an Goethes Satz noch einmal an, ist es immer gut – und geradezu eine Voraussetzung dort, wo die kulturellen und sprachlichen Differenzen durch keine Ähnlichkeitsbeziehungen mehr überbrückt werden können –, wenn die Übersetzer (richtiger wohl: die Nachdichter) das System einer Sprache aus dem Erlebnis- und Erfahrungsfeld heraus kennenlernen, das denen zur Verfügung steht, die es poetisch verwenden.
II
Diese Möglichkeit des Sehens und Erfahrens war nun sieben jungen Lyrikern aus Deutschland, die alle Teilnehmer der Darmstädter Textwerkstatt sind, gegeben, als sie im Oktober 2014 auf Einladung des Istanbuler Goethe-Institutes auf sieben türkische Lyriker trafen, um sich gegenseitig ihre Gedichte zu übersetzen. Da noch niemand, bis auf den bekannten Dichter und Übersetzer Nafer Ermiş, über ausgereifte Erfahrungen im Umgang mit Gedichten aus einem anderen Sprach- und Kulturraum verfügte, war das Risiko zu scheitern erfreulich hoch; erfreulich, weil jedes Scheitern eine Vorbedingung des Gelingens markiert und wir durch nichts so viel lernen wie dadurch, uns überfordert zu haben. Ein großer Dank gilt hier vor allem dem Goethe-Institut, das dieses Risiko mit uns eingegangen ist und das Projekt bis zur Realisierung als Buch getragen und organisatorisch vorbildlich begleitet hat. Vier Tage saßen wir beieinander, die zu Paaren aufgeteilten Lyriker, die mit den Gedichten ihrer Kollegen beschäftigt waren, und die Übersetzer der Interlinearfassungen, und das oft über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus (bis ein türkischer Autor sogar einmal verwundert sich fragte, ob die deutschen Autoren denn gar nichts von der Stadt sehen möchten). Interessant auch hier, dass bei der Aufteilung der Lyriker untereinander sofort Übereinstimmung darin bestand, wer wen übersetzt, so als wäre vorher schon abgesprochen worden, welche poetologischen Referenzen und Vorlieben gegeben sind. Das einzige Problem, das ich so ähnlich auch erwartet hatte, war die Freiheit des Übersetzers, sich von der Wortwörtlichkeit zu lösen und als lyrisches Subjekt selbst aufzutreten. Nichts nun ist schwieriger für jeden literarischen Übersetzer als eben diese Frage für sich zu klären: wie weit darf man das Original verlassen, wie sehr seine Bildlogik ändern oder offensichtliche Fehler des Originals korrigieren? Bei metrisch gebundenen Gedichten kommt noch ein weiteres Problem hinzu: wie können Reim, Rhythmus und Aussage so aufeinander reagieren, dass kein Element verlorengeht? Die Antwort darauf ist nun ganz ähnlich einer anderen, ebenso primären Frage, wie sie ein Autor für sich allein zu beantworten hat: wie weit können die Regeln der Sprache gebrochen werden, um eine neue, poetische Sprache zu generieren? Und das eben nicht aus polizeirechtlichen Gründen einer für alle geltenden Grammatik, sondern um nicht inkommensurabel und isoliert zu sein. Es ist immer ein fast nur intuitiv zu gewinnendes Spiel der Verhältnismäßigkeiten, wie Bekanntes mit Unbekanntem, Neues mit Altem so in Beziehung zueinander gebracht werden, dass Konventionen gekündigt, Erneuerungen aber auch noch immer als diese erkannt werden können. Denn jede Regelverletzung braucht ein Regelsystem, das diese Bruchstellen anzeigt, sonst ist sie leer und poetisch unergiebig. So auch die Nachdichtung: Sie schafft auf dem Weg der Übertragung in den eigenen kulturellen Kosmos etwas Neues, Anderes, Eigenes, das aber so, dass ihre Substanz als die des Ursprünglichen erkannt wird. Wir können Substantive nennen, so viele wir wollen – sie sagen nichts aus, erstens: weil sie ihren Sinn nur in einem zum Satz gebrachten Zusammenhang finden, und zweitens: weil dieser Zusammenhang noch einmal historisch verschieden entsteht und nie gleichermaßen interpretiert werden kann. Allein das Wort „Wasser“ ruft unendlich viele Möglichkeiten hervor, verwendet zu werden, ebenso ist vollkommen offen, wie es, ob positiv oder negativ oder neutral, konnotiert ist. Der Ertrinkende hat naturgemäß ein völlig anderes Verhältnis zum Wasser als der Verdurstende und so weiter und so fort. Auch hier wieder gilt: Wortwörtlichkeit ist das Ende einer jeden guten Übersetzung (wie Eindeutigkeit das Ende einer jeden guten Literatur bedeutet). Und allen diesen Gefahren zum Trotz, sind so viele gute nicht nur eigene, sondern auch übertragene Gedichte entstanden, die hier vorzustellen Freude bereitet. Sehen wir über die formalen Kriterien einmal hinweg – nach denen auf beiden Seiten der lyrischen Tradition das offene, freie, metrisch ungebundene Gedicht zwar stark positioniert wird, ebenso aber auch das klassische Versmaß erscheint –, so sind die Stimmungslagen, die Sujets, die Haltungen zur Welt bei den türkischen wie bei den deutschen Dichtern doch sehr verwandt, was für eine in primären Lebensbereichen gleichgeschaltete Wirklichkeit spricht, die virtuell erst beginnt, wo sie physisch sich auflöst. Oder anders noch: Wir leben alle in einer digitalen Moderne, die politisch asynchron und technologisch synchron verläuft, also eine vertikale mit einer horizontalen Verlaufsform verknüpft, und es wäre einen gesonderten Essay wert, die Konsequenzen, die daraus erwachsen, einmal weiterzudenken. Hier sei nur auf die Modernität hingewiesen, mit der die doch sehr verschieden sozialisierten lyrischen Subjekte auf eine Wirklichkeit reagieren, die von leerer Substanz umgeben ist und oft als entleert uns erscheint. Vielleicht sind die jungen türkischen Dichter etwas politischer, konkreter, auch narrativer als die deutschen (und damit verbindet sich kein Werturteil, weil Gedichte, wie schon Mallarmé es sagte, nicht aus Gedanken, sondern aus Worten gemacht sind), aber wer die gewalttätigen Auseinandersetzung der Demonstranten mit der Polizei auf dem Taksim-Platz und in der Innenstadt Istanbuls miterlebt hat, weiß wohl, wie unabdingbar das ist und wie die Macht, wenn sie ins Innere des Körpers dringt, zwangsläufig auch Sprache – und zur Sprache gebracht – werden muss.
III
So also kamen wir uns nahe.
IV
Ein Wort noch zu dieser Ausgabe. Wir haben sie so zusammengestellt, dass immer die zwei Lyriker nebeneinander erscheinen, die sich nachgedichtet haben. Das sprengt die alphabetische Reihe zugunsten der Dialoge. Ein Sound, ein Stil, eine Tonlage kann so noch ein wenig weiterschwingen und bei sich bleiben, ohne von einer anderen sofort überlagert zu werden. Eher ungewöhnlich auch, dass sich der Herausgeber hier selbst mit Gedichten vorstellt, was meiner Meinung, seine Aufgabe betreffend, ganz und gar nicht entspricht. Nun aber hatten wir uns entschieden, die Doppelrolle von Nafer Ermiş, der die Interlinearübersetzungen besorgte und selbst ein guter Lyriker ist, mit einem Abdruck auch seiner Gedichte zu würdigen. Altersmäßig komplett aus dem Rahmen gefallen bin also ich, der Nafer übersetzte und so zu einem „Paar“ geworden auch das editorische Schlusslicht abgibt; das aber gern. – Nun danke ich allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben, den Autorinnen und Autoren, den Kollegen im Goethe-Institut und in der Kulturakademie Tarabya, deren Stipendiat ich zu eben dieser Zeit sein konnte, sowie dem Verlag, der diese schöne Edition besorgte.
Kurt Drawert, Vorwort, Januar 2015
Dem Goethe-Wort folgend:
„Wer das Dichten will verstehen, / Muss in das Land der Dichtung gehen“, kamen sieben deutsche Lyriker der Darmstädter Textwerkstatt auf Einladung des Goethe-Institutes nach Istanbul, um auf sieben türkische Dichter zu treffen und mit ihnen gemeinsam die Übersetzungen ihrer Gedichte zu erarbeiten. Das Ergebnis liegt nun in dieser Ausgabe vor und kann – pünktlich zur Leipziger Buchmesse im März 2015 – den Lesern in Deutschland und der Türkei vorgestellt werden. Sinnfällig daran ist nicht nur die hohe Qualität der Poesie, sondern auch die Überschneidung von Sujets und Motiven, die bei aller kulturellen Differenz und ästhetischen Eigenwilligkeit in eine Weltanschauung zusammenfließen: der einer globalisierten Welt.
Die Autorinnen und Autoren sind: Ann-Kathrin Ast (Innsbruck), Özlem Özgül Dündar (Wuppertal), Kurt Drawert (Darmstadt), Marit Heuß (Dresden), Alicia Metz (Darmstadt), Andreas Pargger (Lienz/A), Martina Weber (Frankfurt am Main), sowie aus Istanbul: Furkan Caliskan, Cenk Gündogdu, Nafer Ermis, Deniz Durukan, Gonca Özmen, Gökcenur C. und Nilay Özer. Gefördert vom Goethe-Institut Istanbul.
Luxbooks, Klappentext, 2015
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram + DAS&D +
KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.



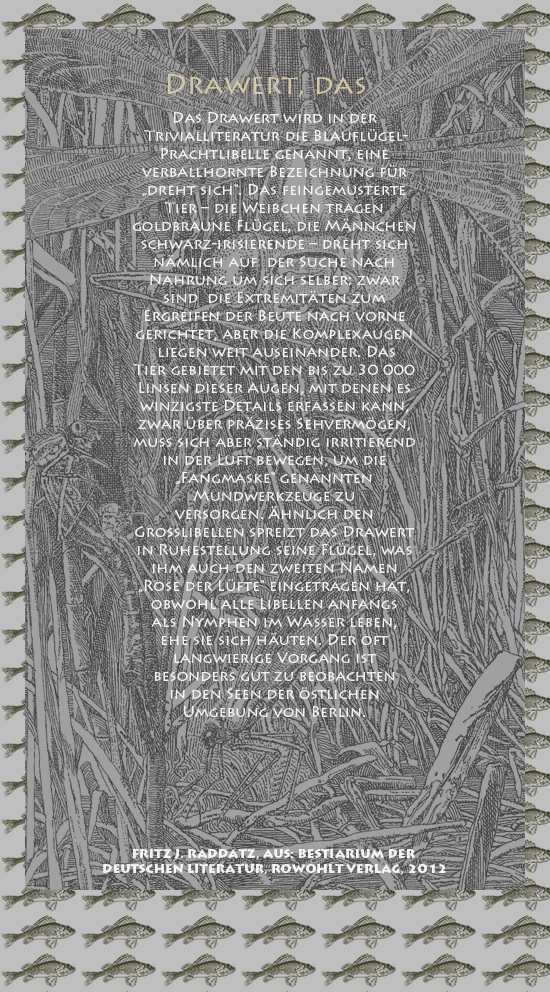












Schreibe einen Kommentar