Kurt Drawert: Idylle, rückwärts
IDYLLE, RÜCKWÄRTS
Eben noch war es der Leichtsinn
des Frühlings, und schon pfeifen die Vögel
im Innenrohr weiter, ununterscheidbar
vom Rauschen des Blutes,
oder was sonst noch passiert
jenseits der Herrlichkeiten.
Man beschäftigt die Fachwelt
mit seinem Körper, nervt,
weil die Geheimnisse wechseln,
und wird auf die Zukunft verwiesen.
Dabei ist das alles, von einem Moment
auf den anderen, sehr einfach:
die Idylle spult rückwärts,
wie ein Film am Anschlag der Rolle.
Die Geschichte der Geschichte beginnt,
das andere Leben, als Homunkulus
im Sprechstundenzimmer
mit gebürstetem Schädel
und Stich in die Vene.
Sehr privat auch erkennbar als Schwäche
des Phallus, dieser Knick einer Blume,
bevor sie zum Kraut fällt.
Es ist der Anfang vom Abgang.
Es ist die Stunde der Hunde.
Und so geht es zu nach den Höhepunkten:
Beckett, mein Teckel, vierjährig −
wegen Aufruhr geschlachtet;
die Arktis mit ihren Eiskremreserven −
leergepickelt. Schöne Maschinen
fallen vom Himmel wie Schuppen
der kranken Kopfhaut. Überall Brände,
alle U-Boote sinken. Das Arbeitsamt online
(keine Chancen mehr für Fahrradfahrer).
Nietzsche auch tot, mehrfach. Von oben
betrachtet – das reine Wissenschaftschaos.
Doch hosianna, ihr Börsianer!
In den Chat-Rooms der Hölle
pokern wir weiter.
Die Adressen der Unsterblichkeit leuchten.
Die fröhlichen Toten winken uns zu
Editorische Notiz
Die Gedichte der Kapitel I, II und IV sind folgenden Bänden entnommen: Zweite Inventur, Aufbau Verlag, Berlin und Weimar 1987; Privateigentum, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998; Fraktur, Reclam Verlag, Leipzig 1994; Wo es war, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996, und Frühjahrskollektion, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. Der Essay in Kapitel III ist entnommen dem Band Rückseiten der Herrlichkeit. Texte und Kontexte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001, und „Laufen. Traumtext.“ dem Band Steinzeit, Theaterstück und Prosa, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999. Bei einigen Gedichten habe ich Änderungen vorgenommen. Das betrifft lediglich den Zeilen- oder Strophenbruch und einzelne Wörter, die gestrichen oder ausgetauscht worden sind – wir können ändern, solange wir leben, sagte Jean-Paul Sartre einmal, und für diesen Hinweis bin ich ihm dankbar. (…)
Kurt Drawert, Oktober 2010
Nach seinem großen,
von der Kritik hoch gelobten Roman Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte (2008) legt Kurt Drawert, der sich vor allem als Lyriker und Essayist auch international einen Namen gemacht hat und bereits jetzt zum Kanon der deutschen Literatur gehört, eine Auswahl seiner Gedichte aus drei Jahrzehnten vor. Ein wesentliches Thema der Gedichte ist, die Verlorenheit in der Welt als Verlust von Sprache zu beschreiben. Dabei bezieht seine ebenso lakonische wie erzählende, melancholisch grundierte oder ironisch überzeichnete Lyrik immer auch einen Standort der Kritik und flüchtet sich nicht in das reine Spiel der Zeichen. Zugleich schreibt Drawert die vielleicht schönsten Liebesgedichte der Gegenwartslyrik:
Ich wollte noch sagen, ich liebe dich,
glaube ich,
sehr,
aber da war mir der Hörer
schon aus den Händen und auf die Kacheln
des Bodens gefallen.
Doch ich mochte es,
dir in der Ferne näher zu sein
als in der Nähe die Ferne zu spüren,
hob das Telefon auf und versuchte
das alles,
alles noch einmal.
Der Band Idylle, rückwärts versammelt das Beste aus Drawerts bisherigen Gedichtbänden sowie neue Gedichte.
Verlag C.H. Beck, Klappentext, 2011
Hand auf den Herzschmerz
− Widerborstig und mit unerbittlicher Ruhe die Einsamkeit ertragen: Idylle, rückwärts versammelt Gedichte Kurt Drawerts aus drei Jahrzehnten, Stärken und Schwächen inklusive. −
Es ist nicht ganz unheikel, einem Gedichtband die eigenen poetologischen Reflexionen beizugeben, wuchtet man damit den Maßstab der Kritik doch selbst gleich auf eine gewisse Höhe – und die ist bei Kurt Drawert seit jeher nicht in Bodennähe zu suchen, auch wenn seine Gedichte auf den ersten Blick den wenig spektakulären Erscheinungen des Alltags viel Raum gewähren. Ungeachtet dieser Gefahr findet man im Band Idylle, rückwärts, der eine Auswahl von Drawerts Gedichten aus drei Jahrzehnten enthält, gleich zwei Essays des 1956 in Brandenburg Geborenen, der vor drei Jahren mit dem Roman Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte mit einer brachial bösen, ganz und gar eigenwilligen Abrechnung mit der DDR berauschte.
Auch Drawerts poetologische Verlautbarungen sind von einer gewissen Widerborstigkeit. Das „Erzeugen“ wird darin zum zentralen Kriterium für das Gelingen eines Gedichts, das „Mitteilen“ demgegenüber – Erkennungsmerkmal des Schreibanfängers, wie Drawert anmerkt – Garant des Scheiterns. Gilt gemeinhin die stimmlich-klangliche Umsetzung durch den Dichter als unabdingbarer Bestandteil des Gedichts, der in der schriftlichen Fixierung nur nicht mittransportiert werden kann, findet Drawert es „furchtbar“, wenn Dichter ihre Texte öffentlich vortragen und sich körperlich zu ihnen verhalten müssen. Nicht zufällig heißt einer der Essays „Die Lust zu verschwinden im Körper der Texte“. Für Drawert ist das Gedicht selbst die „adäquate symbolische Konstituierung des Körpers“, weil es genau wie dieser einen Überschuss an Energie zu produzieren vermag. Diese Überschussproduktion ist für ihn gleichermaßen Wesensmerkmal wie Existenzberechtigung eines Gedichts, dieses komprimierten, kondensierten und komponierten Sprachkörpers, in dem der Dichter verschwinden will und der ihn doch zugleich preisgibt: Im Text, schreibt Drawert, werde die Person, also der Dichter, berührbar, ansprechbar.
Ein Fremder im System DDR
Mehr als alles andere zeugen Drawerts Gedichte von einer heillosen und doch mit unerbittlicher Lakonie konstatierten Einsamkeit. Nicht einmal der Blick zurück hat etwas Versöhnliches:
Aber wenn ich heute,
aus dem Haus gekommen,
in den Dingen
meine Bedeutungen suche:
Wege, die Erinnerungswege,
Handlungen,
die Erinnerungshandlungen sind,
habe ich,
ich weiß nicht,
was ich besitze,
was ich verlor.
Einsam ist Drawert in den Gedichten aus den achtziger Jahren als Fremder im System DDR, uneinig mit einer Ideologie, die sich tief auch in der eigenen Familie verankert hatte:
Schließe die Augen
sagte Vater & du siehst
was dir gehört: & ich schloß
die Augen & sah was er
nicht meinte & sagte nicht
was ich sah jenseits der Grenzen
seiner einer deutschen Fantasie.
Allein die Kürze der Verse zeigt die Hilflosigkeit angesichts der unüberwindlichen Distanz selbst zum eigenen Vater, die den Sohn fast verstummen machen will, wenngleich er seine Unkorrumpierbarkeit bewahrt.
Inventur der Innerlichkeit
Auch deshalb wohl sind es mehr die Dinge als die Menschen, durch die Drawert sich seiner selbst versichert. „Zweite Inventur“ heißt ein Günter Eich gewidmetes Gedicht.
Ein Tisch.
Ein Stuhl.
Ein Karton für altes Papier, Abfälle,
leere Zigarettenschachteln, Briefe,
die keiner Antwort bedürfen.
Aber selbst, wo Gegenstände Halt, Struktur, womöglich Identität geben, ist ihnen das Wissen um den möglichen Verlust eingeschrieben:
Mein Vorteil ist die Anwesenheit
von Gegenständen, die mir vertraut sind,
die mir vertraut sind wie die Erfahrung,
sie wieder verlieren zu können,
endgültiger.
Wie eine Inventur, wie ein Sammeln ist auch der Gestus von Drawerts Gedichten, denen Ruhe eigen ist, ein unbeirrtes Feststellen gerade auch des Schmerzhaften. „Nirgendwo bin ich angekommen. / Nirgendwo war ich zu Haus. / Das stelle ich fest / ohne Trauer.“ Und selbst da, wo der Schmerz in Wut umschlägt, halten Drawerts Sprachkörper diese Wut im Zaum, bändigen auch dort, wo es unter der Oberfläche tobt, wie in „Tauben in ortloser Landschaft“, dem grandiosen, balladesk-surrealen Abgesang auf die DDR.
„Schon hing eine Webe mir stinkend am Kinn“
Die vielleicht bitterste Erfahrung folgt nach der Wiedervereinigung: „Gewonnen hab ich / die Einsicht vom Ende / der Herkunft.“ Mehr aber nicht. Auch der Westen bleibt Drawert fremd. „Jeden Tag eine Nachricht / von Kriegen, ist auch eine Art / geregeltes Leben.“ So beginnt das „Heimatgedicht, C-Dur“ und endet: „Ehrlich gesagt: / wir können doch stolz sein auf dieses / mein Vaterland mit so schönen Enten. / Und auf all Deine Siege, Boris.“ Drawert holt in den Gedichten der neunziger Jahre zu einem Rundumschlag gegen alle Erscheinungen der Wohlstands- und Vergnügungsgesellschaft aus, oftmals durch das parodierende Zitat: „Wir können uns ja nicht ständig / die Polonaise vermiesen, / nur weil einer stolpert / und quer liegt.“ Quiz- und Talkshow-Kritik darf ebenso wenig fehlen wie Börsianer-Verächtlichkeit. Dieser zuweilen bittere Zynismus lässt die Spannkraft der Texte erschlaffen. Ein Gedicht dürfe nie hinter dem Organisationsniveau seiner Gegenstände zurückbleiben, schreibt Drawert in seinen poetologischen Überlegungen. In seinen allzu eindimensionalen Medien- und Konsumschelten unterläuft ihm genau das.
Herrlich lustig dagegen sind sein teilweise kalauernd, immerzu mit offensiv zur Schau gestellter Schlechtgelauntheit vorgetragener Widerwille gegen die Natur und der mindestens ebenso große Widerwille gegen ihre Romantisierung: „Hand auf den Herzschmerz, / die Natur ist doch nur / Katzenpisse und Hundefurz.“ Schon in den ersten Versen vom „Naturgedicht“ ist Hopfen und Malz zweifelsohne verloren. Das mürrische Fazit, nach einem dennoch durchgestandenen Spaziergang: „Ich sage nur soviel für heute: / ich ging im Walde (und nur für mich hin), / schon hing eine Webe mir stinkend am Kinn. / Als Mahnung fürs erste, sollte das reichen.“
So schön spöttisch seine Naturgedichte sind, so erschreckend banal ist wiederum zuweilen das, was Drawert im anderen großen Genre vollführt, dem Liebesgedicht. Als wäre er hier ein ums andere Mal auf das gänzlich ungefüllte Stereotyp, das nichts ist als der hinterlistige Kumpel Kitsch selbst, hereingefallen. „Wer liebt, ist immer auch verloren / An jenes Glück, das man gewinnt / Als Sand, der durch die Hände rinnt.“ Das könnte ohne weiteres auch auf einer Ansichtskarte oder im Büchlein mit Poesiealbumsprüchen stehen. An anderer Stelle dann kippt das Ganze in biedermeierliche Gemütlichkeit. „Der Geruch, den du hinterlässt, / wenn du fortgehst, ist wie der Geruch / frischen Kaffees, den du mir aufgebrüht / auf den Tisch gestellt hast.“ Womöglich passt dieser behagliche Ton einfach nicht zu Drawert und verleiht ihm unfreiwillig, aber unvermeidlich etwas Täppisches. Oder aber die Parodie ist hier auf einer Stufe des Zynismus angekommen, die nicht mehr zu durchschauen ist. Und dann ist da plötzlich wieder, im abschließenden Zyklus mit New-York-Gedichten, einer dieser Sätze, die alles vorher Gesagte über den Haufen werfen lassen: „Aber die Liebe ist nur eine Einbildung / der Einsamen, möchte ich sagen, wie das Meer / eine Erfindung der Seefahrer ist.“
Wiebke Porombka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.10.2011
Was war das für ein Land, dem wir entkamen?
− Kurt Drawerts Gedichte aus drei Jahrzehnten schlagen einen Bogen von der DDR der frühen achtziger Jahre in das New York der Gegenwart. −
„Gedichte aus drei Jahrzehnten“ verspricht der schöne Band und nennt beim ersten Gedicht in der Überschrift demonstrativ das genaue Datum von dessen Entstehung: „Gedicht, als Brief angekommen, 15.7.1981“. Es lautet:
Der Antrag auf eine Reise
in das nichtsozialistische Ausland
ging bei uns ein & wurde
gründlich beraten. Leider
ist es nicht möglich, Deinen Antrag
zu realisieren, da alle Reisen
vergeben sind. – Freundschaft.
Es gehört zu denen, die man nicht vergisst, wenn man ihnen einmal begegnet ist. Die Technik ist simpel: eine amtliche Mitteilung in Versform abteilen. In diesem Falle ist der Effekt entwaffnend. In einem Gespräch mit Andreas Herzog 1994 sagte der Autor: „Was nützt einem ein Talent, wenn man keinen Stoff hat!“ Kurt Drawert ist der Schriftsteller, Dichter, Essayist, der fast obsessiv den „Stoff“ herausfordert.
Wählen konnte er ihn kaum, denn die politische Realität der DDR und „die Katastrophen des Ostens“ gehörten auch im Westen sozusagen zur Großwetterlage jener drei Jahrzehnte, die in seinem neuen Gedichtband poetisch dokumentiert werden. Dem „Stoff“ rückte er freilich auch als Essayist zu Leibe mit Texten, die umso wertvoller werden, je mehr wir uns vom Zeitalter ihrer Anlässe entfernen. Das Bedürfnis, sich über sein Schaffen theoretisch Rechenschaft abzulegen, dokumentiert sich auch in diesem Band, dessen drittes Kapitel den Essay „Die Lust zu verschwinden im Körper der Texte“ von 2001 enthält. Was der Theoretiker Drawert für das Gedicht fordert, einen „Mehrwert“ und ein „Textsubjekt“, das haben auch seine Prosatexte – wie „Laufen. Traumtext“ – in ihrer stark stilisierten poetischen Sprache selbst da noch, wo sie anekdotisch, realistisch oder autobiographisch erzählen.
Die Gedichte bilden drei Kapitel, nach Jahrzehnten geordnet: „In den Fabriken (die 80er Jahre)“, „Der letzte Hund der Geschichte (die 90er Jahre)“, „Das Jahr 2000 findet statt / offline.“ Öfter gibt die Natur den abstoßenden Hintergrund, öfter wischt das unlyrische Ich wieder ab, was es vor uns auf die Tafel gemalt hat. Aber immer bringt der Dichter sich selber mit, in die Natur, in die Geschichte, an fremde Orte. Als letztes Kapitel folgen zwei Dutzend neue Gedichte und ein kleiner Zyklus von zehn Gedichten, unter der Überschrift „Jeder Tag kostet Geld / (Matrix Amerika)“.
In einem Zeitungsartikel hat Drawert das überwältigende Erlebnis seiner New York-Reise in Prosa geschildert, darunter die Fahrt mit der Subway bis zur Südspitze Brooklyns, in die Welt der russischen Emigranten, aus der das letzte Gedicht des kleinen Zyklus herausgewachsen ist:
Immerhin verstehe ich
ein wenig vom russischen Wesen,
und auch kyrillische Schrift
kann ich lesen.
Aber was ich nicht verstehe,
warum ich die Vergangenheit
in der Gegenwart
als Zukunft sehe
Das Gedicht entwickelt eine Meditation, welche den Bogen zurückschlägt zum allerersten Gedicht des Bandes:
Was war das für ein Land,
dem wir entkamen
und das uns dennoch überlebt?
Es ist, als käme dieser Reisende nicht an in New York, in seiner „brandneuen Ökomaschine, die mit Ziegenmilch flog“. Das erste, was er dichtend notiert und was wir lesen, ist der Widerstand: „Nein, ich schreibe nicht über New York / in New York“, und:
so ein Leben
als Schaufensterpuppe in der 5th Avenue
… ist auch nicht
sehr anders, als in Halle an der Saale
Grütze zu kochen.
Immer wieder stößt das Bekannte sauer auf: „Empfänger von Hartz oder Holz“. Diese Bewegung kulminiert in Verspaaren, die sich als Zitate geradezu aufdrängen:
Mein Land war eine Rittmeisterpeitsche
…
Ich werde es nicht mehr erwähnen,
ostdeutsch verwundet und westdeutsch
verwaltet.
Das Land überlebt in den Eingeweiden des Dichters, es ist auch verfilzt ins Textsubjekt.
Eine dramatische Begegnung mit einem Auto, die im Brooklyn der russischen Emigranten den poetischen Einfall begleitete, ist Anlass zu einem weiteren Gedicht:
Wer nicht läuft, fällt ins Getriebe
und wer ins Getriebe fällt, ist tot.
Und während ich das schnell notiere,
fährt ein Fahrzeug in der Not,
mich zu verschonen, an die Wand.
Soviel zur Veränderung der Welt
durch Poesie.
Dieses berichtete und bedichtete Ereignis in seiner Zufälligkeit muss wirklich in New York stattgefunden haben. Nichtsdestoweniger ist es zugleich die Wiederholung eines früheren Ereignisses oder gar nur die Wiederholung einer Erinnerung an ein früheres Ereignis. In einer kleinen Skizze „Nachträgliche Beschreibung eines Gefühls beim Verfassen eines Gedichts“ aus dem Jahr 1985 beschreibt Drawert den Erlebnishintergrund eines Verses in seinem „Gedicht ohne Anfang“: „Im Nachdenken über eine Situation… kam ich auf eine andere, irgendwann in meiner Kindheit geschehene und bis zu eben diesem Moment vergessene Situation (ich laufe einem Abrisshaus entgegen, an dessen glatter Seitenwand mit großen Buchstaben HIER KÖNNEN FAMILIEN KAFFEE KOCHEN steht, und überlege, dabei die Fahrbahn betretend, wie das wohl praktiziert worden sei, als plötzlich ein Fahrzeug scharf bremst und in der Absicht auszuweichen gegen eine Mauer fährt).“
Damals notierte Drawert dazu, „dass der neuen Erfahrung die Muster bereits gemachter Erfahrung untergeschoben waren“. So nützlich diese Erkenntnis dem jungen Autor vor einem Vierteljahrhundert auch erschienen sein mag, so problematisch erweist sie sich nun vor der Matrix Amerika. Die Gedichte werden widerspenstig. Das Textsubjekt scheint darin des öfteren verzweifelt wie ein Insekt in einem Spinnennetz. Einmal hat es sich auch befreien können, in dem kleinen narrativen Stück von dem Mann aus Sri Lanka, der empfiehlt, „die Organe die wir zweifach haben, einmal hierher ins Hospital / zu bringen für eine gute Summe Geld.“ Da beschränkt sich die Rolle des Sprechenden auf die Wiedergabe der Szene, welche durchaus, wie der Theoretiker Drawert verlangt, „Gefühlswahrheit aufnehmen“ kann und „mehr als sich selbst“ repräsentiert. Es ist ohne Zweifel ein gutes Gedicht – für diesen kleinen Zyklus freilich untypisch, denn es riskiert weniger als die anderen neun, die obsessiv ihren „Stoff“ suchen.
Dass Drawert sich aus den klischeehaft angeschlagenen Motiven eines verbreiteten Amerika-Bilds (Lehman Brothers, Hedgefonds, Wall Street, Ground Zero) nicht entbindet, dass das Textsubjekt immer wieder zwanghaft zurückfällt auf seinen eigenen Boden – das nehmen wir als irritierenden Überschuss dieser Gedichte wahr.
Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 7.1.2012
Die Dinge verschwinden
− Gestimmt auf den Grundton der Vergeblichkeit: Die Gedichte Kurt Drawerts erscheinen in einer ersten Gesamtausgabe. −
Nur wer im Gedicht seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Ton gefunden hat, ist als Lyriker des Erinnerns wert. Das galt schon weiland für Heinrich Heine, später für Benn oder Rilke ohnehin, in der Gegenwartsliteratur gilt es für Sarah Kirsch wie Celan, für Enzensberger wie Wondratschek oder Jürgen Becker. Es sind durchaus nicht immer die Motive, das „Lebenszittern“ (wie Thomas Mann es einmal nannte) des Thomas Brasch. Es ist der Klang der Worte, die Musik ihres Rhythmus; ein kleines Wunder allemal, da das „Material“ ja knapp ist, 26 Buchstaben zählt das deutsche Alphabet – und die zu immer neuen Fugen, Fügungen zu komponieren: eigentlich kaum möglich.
Und immer wieder eben doch. Der diese (Un-)Möglichkeit so bestechend meistert, das ist Kurt Drawert. Sein lyrisches Werk liegt nun in einer schönen Zusammenfassung vor. Der innerste Kern einer reichen Frucht-Ernte entbirgt sich bereits im Motto von César Vallejo „Ich, der geboren ist, und sonst nichts“. Der tief tönende Grundakkord dieser wundersamen Vers-Welt nämlich ist Vergeblichkeit. Über 260 Seiten nimmt ein bedeutender Künstler Abschied – von sich selber: „… dann werde ich abscheiden, Im Schnee stehen und mir nachwinken, bis der Arm erfriert, blau das Gesicht von des Scheiterns schneidendem Wind“. Schon in diesen wenigen Zeilen erweist sich Kurt Drawerts Perfektion – wir lesen nämlich nicht lediglich einen Notruf; wir HÖREN ihn, indem der Dichter eine Vokalreihung vorträgt, die sich hauptsächlich aus dem Schneide-Laut i, ei, ie zusammensetzt; kein aufblühendes O also, kein staunendes A – i aus dem Schnitter, der ist der Tod. Ein etwas längeres Gedicht führt diese schlechterdings großartige Sprachmeisterschaft vor, es wiegt sich gleichsam in einem hoffenden Anfang, um im Lebenselend zu verrinnen.
Wer liebt, ist immer auch verloren
An jenes Glück, das man gewinnt
Als Sand, der durch die Hände rinnt −
Das andere ist auch geboren:
Das Nichts im Sein, der Tod im Leben,
In Leidenschaften mischt sich Qual.
Und doch ist es des Lebens Wahl,
Dem Scheitern einen Grund zu geben
Und jedes Ende zu beginnen
Mit einem Anfang und dem Schein,
Die Dinge würden ewig sein
Und nicht mit unsrer Zeit verrinnen.
Allein mit der Erkenntnis misst,
Wer außerhalb der Dinge ist.
Dabei schrillt keine Jeremiade aus der Asservatenkammer von Drawerts Sprachschatz. Das wären ja in Trauer gekleidete Appelle. Kurt Drawert aber appelliert nicht, er konstatiert. Nie greint er: „Ach wäre es doch anders“. Immer – fast als Selbstgespräch – zieht er Bilanz mit schwarzem Stift: „Meine Jahre bis heute / sind eine Schleifspur / gebrochener Schritte“. Gewiss, das kennen wir aus seiner so präzisen wie gnadenlosen Prosa, es ist ja die seelische Existenz dieses Schriftstellers grundiert von seinen politischen (DDR-)Erfahrungen. In schier gigantisch sich aufbäumendem Anti-Surrealismus hat er das zum Beispiel eingefangen, aufgefangen in dem großen Roman Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte. In einer früheren Prosaarbeit Spiegelland hat er die versehrte Innenhaut seines gesamten Werks wie eine nicht heilbare Wunde gezeigt: „Die Worte gehen weiter, und der Tod der Worte geht weiter […] Der einem wie Stallgeruch anhaftende Status DDR geht weiter.“
In seinem Buch Steinzeit führt uns Drawert, für den „von Anfang an keine Ernte vorgesehen“, tief in jenen Abgrund, der sein ganzes Ich zu verschlingen droht, seine Hoffnungen zermalmt, seine Horizonte herunterzerrt:
Dass auch im letzten Winkel des Abgrundes weitere Abgründe aufgerissen wären, wenn ich heruntergestürzt und hart aufgeschlagen wäre auf den Grund dieser Tiefe, den ich von meiner Position aus ohnehin nicht mehr sah und den ich mir nur vorstellen konnte als eine tiefschwarze, indessen gallertartige, bewegliche und gewissermaßen lebendige, atmende, sich fortpflanzende, ausbreitende, über die Errungenschaften der menschlichen Welt sich allmählich ausbreitende und sie lächerlich machende Masse, überzogen von einer verkrusteten, grindigen Haut. Und im Zentrum des Wesens, im gelben Auge, in der dunkelgelben Mitte des hellgelben Auges hätte es einen abwärtsziehenden, von kräftig pulsierenden Muskelformationen bewegten Wirbel gegeben, in dessen Sog schließlich alles, was auf diesen rohen, fleischigen Boden gestürzt war, verschwände, wie ein Wurm verschwindet im Schlund einer kräftigen, tierhaften Pflanze in der Mitte des verwucherten Auges.
Doch hier, in den Gedichten, benutzt er eine verkehrt herum gehaltene Wünschelrute; sie schlägt aus – dort, wo Leben eigentlich blühen sollte, aber zu Schotter geworden ist: in der Liebe. Nicht nur „wo immer ich bin, bin ich fremd“ (will sagen: einsam), sondern auch der tiefe Fall ins Schweigen gehört zur Katastrophe dieses Zerbrechenden; was schützen soll, behüten, die Liebe, ist auch nur mehr Wahn und Ohnmacht:
… Später, an einer empfindlichen Stelle
der Biographie, brach, wie dem einen
die Stimme, dem anderen
das Rückgrat, erinnere dich,
mir war das Glück des Verstummens
gegeben, wo es war.
Wo es war, hat das Gras schon zu wuchern
begonnen. Die kleine Senke im Boden,
in der ich von Liebe geträumt haben muss,
ist mit Schotter gefüllt, Lachen von Flusstang
und Öl, zerdrückte Aluminiumdosen…
Glück – das ist im Kosmos des Kurt Drawert ein Fremdwort, Unheils-Menetekel eher als etwa Verheißung:
Und was das Glück
dieser Welt ist,
hing als Blüte gebrochen
im Knopfloch
künftiger Soldaten.
Nie und nirgendwo in seinen Gedichten schmückt dieser Lyriker sich mit einer Gebärde. Er ist das Unheil – im doppelten Sinn des Un-Heilbaren –, das er kündet. Seine Schwärze ist nicht angepasst von einem schicken Couturier; sie ist seine Verfasstheit. Das ist ja das immer neue Wunder, das Gedichte uns bescheren: der Verfasser kann von Unheil und Selbstzweifel schier verstört sein – aber seine Kunst ist nicht zerfressen, ist „ungestört“. Nur die verletzte Auster produziert eine Perle – also Kunst. Das wusste Heinrich Heine, das formulierte Gottfried Benn. Wie weit entfernt ist das von der Kunstperlenproduktion eines Durs Grünbein, dem selbst die FAZ (die ihn einst „erfand“) das Waten in der Milchschaumbucht bescheinigt: erlesene Verse der Bildung, nicht der Prägung. Grünbein findet immer, aber er sucht nicht. Kurt Drawert ist Versuchung, seine Lyrik der Schrei eines Verlorenen: wüst, die Leere ausbuchstabierend, doch nie füllend. Seine schreckliche Einsamkeit reißt uns Leser mit in die Schluchten des Fürchterlichen. Ratlos macht sie uns jedoch nicht; denn siehe: das Grässliche wird zur Schönheit – durch das Wunder seiner Sprache. Sie ist so klar wie Glas und auch so hart. Aber man kann durch sie – wie durch Glas – hindurchsehen und sieht dann das Antlitz des Glasschleifers. Er hat in der einen Hand einen diamantenen Griffel, mit dem er seine Zeichen ritzt. In der anderen Hand hält er, einer Monstranz gleich, die erstorbene Sonne; sie ist schwarz.
Fritz J. Raddatz, Die Welt, 12.3.2011
Idylle, rückwärts von Kurt Drawert
− Kurt Drawert ist ein reflektierender Autor, aber zum Glück merkt man das seinen Gedichten nicht an. −
Der Deutsche Literaturfonds kann hochzufrieden sein. Wenn man einen Schriftsteller mit dem New-York-Stipendium auszeichnet, lässt sich der literarische Ertrag dieser zehn Wochen ja schwer abschätzen. Kreativität kann man zwar fördern, aber nicht zwingen, und es wäre nur zu verständlich, wenn ein literarisches Vorhaben immer wieder vom einen auf den anderen Tag verschoben würde, weil die Eindrücke der Weltstadt eine gar zu große Ablenkung sind.
Bei Kurt Drawert, der dieses Stipendium im Herbst 2010 absolviert hat, war das anders. Abseits von den vielfältigen Verpflichtungen, die den Leiter der Textwerkstatt im Literaturhaus an seinen Wohnort Darmstadt binden, scheint er wie befreit losgeschrieben zu haben. Endlich sind wieder neue Gedichte von ihm zu lesen, und der in New York entstandene Zyklus „Matrix America“ zeigt beispielhaft Drawerts außerordentlichen Rang als Lyriker. Wenn er Romane oder Theaterstücke schreibt, ja, auch in den Essays ist die Präzision seiner Sprache am Gedicht geschult, und seine sehr konzentrierten Prosatexte widersetzen sich der flüchtigen Aufnahme, indem sie die Aufmerksamkeit vom Leser gleichsam einfordern. Im Gedicht aber ist Drawert ganz bei sich, es ist der Kern und die Keimzelle seines Schreibens, und ohne dass es angestrengt einem sprachlichen Originalitätsdruck folgen müsste, entwickelt es einen unverwechselbar eigenen Ton. Wie früh er schon ausgeprägt war, zeigt diese schöne Auswahl, die drei Jahrzehnte zurückreicht. Ein paar Gedichte sind auch darunter, die Drawert 1989 in Darmstadt vorgetragen hatte, damals noch als Gast aus Leipzig, der zum Literarischen März eingeladen worden war und prompt den Leonce-und-Lena-Preis gewann. Man möchte der Jury im Nachhinein noch recht geben, wenn man die melancholische Bestandsaufnahme liest, die beginnt mit den Zeilen „Zu sagen die wenigen Dinge / auf die morgens mein Blick fällt, / mit einer Handvoll Vokabeln // und dem Gefühl für das Ende / der Illusion, mit der ich / hier ankam, allein, eines Nachmittags“. Ein paar weitere Zeilen nur benötigt Drawert, um den Kreis abzuschreiten von der Ankunft bis zum Abschied, von der Liebe zur Enttäuschung, vom Sommer bis zur Kälte des Schweigens.
Heute sitzt Drawert selbst in der Jury des Literarischen März, und auch in den Gesprächen seiner Textwerkstatt wird er geschätzt für Analysen, die feine Unstimmigkeiten eines Textes aufspüren können, im glücklichen Fall aber auch beschreiben, wie Literatur wirken kann. Die nun vorliegende Sammlung zeigt Drawert nebenbei als Theoretiker des Gedichts mit dem Essay „Die Lust zu verschwinden im Körper der Texte“, in dem der „Überschuss an Energie“ beschrieben wird, dessen Erzeugung der Sinn des Gedichts ist, über den wahrnehmbaren Inhalt, die Sprachgestalt und den Klang hinaus. Drawert ist ein reflektierender Autor, aber gottlob klingen seine Gedichte niemals wie die gedrechselte Beweisführung einer lyrischen Theorie. Sie sind vielmehr auffallend unangestrengt und selbstverständlich, von einer großen Musikalität der Sprache und einem Rhythmus, der Formbewusstsein verrät, aber nicht den Willen zur Regelerfüllung. Dieser sehr autonome Umgang mit Sprache erlaubt es Drawert, auch große Themen anzusprechen, Liebe oder Vergänglichkeit, Hoffnung oder Schmerz und individueller Freiheitsdrang, der sich im Korsett des politisch Möglichen bewegen muss. Auf das Erleben der ostdeutschen Diktatur nimmt der New-York-Zyklus Bezug, wie überhaupt der Blick auf die Sammlung ein Netz von Verweisen erkennen lässt. Auch in diesem Sinne war der New-York-Aufenthalt nicht Ab-, sondern Hinlenkung auf das eigene Schreiben.
Man sieht gleichsam dabei zu, wie sich aus den Einzelteilen der Gedichte ein Lebenswerk formt, das mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Seit 1996 lebt Drawert nun in Darmstadt. Und bei aller Wertschätzung seiner Arbeit an Textwerkstatt und Lesebühne sollte man ihm gelegentlich ein paar Wochen abseits dieser Stadt gönnen, damit dieses Werk weiter wachsen kann.
Johannes Breckner, echo-online.de, 8.6.2011
Ich muss das noch einmal sagen
Was hat sich bewährt, was ist von den Zeitläuften beschädigt? Kurt Drawert, seit über zwei Jahrzehnten eine eigensinnige Stimme der deutschsprachigen Dichtung, zieht in Idylle, rückwärts Bilanz. Symptomatisch sind von Anfang an Reflektionen eigener Erfahrungen („Mein kleines, aufgeschlitztes Land / mit seiner textlosen Hymne“) – die Jahre in einem unwirtlichen und unwirklichen Staatssozialismus bis 1989. Jahre der Entfremdung, aber auch Jahre der Findung zu einem sich öffentlich artikulierenden Selbst:
Schließe die Augen
sagte Vater & du siehst
was dir gehört: & ich schloss
die Augen & sah was er
nicht meinte & sagte nicht
was ich sah jenseits der Grenzen
Obwohl Drawert, Jahrgang 1956, nicht zum Underground der DDR gehörte, findet sich in seinen frühen Gedichten viel Kritisches, freilich zumeist als Ausdruck einer inneren Emigration:
Mich beispielsweise, lieber Czechowski,
interessiert tatsächlich nur noch
das Privateigentum der Empfindung,
der Zustand des Herzens, wenn die schwarze Stunde
am Horizont steht, die Würde der Scham
und das Ende der Hochmut.
Dass Drawert einen moralischen Raum des Sprechens reklamiert, mag manch einem überholt erscheinen. Doch Drawerts aufklärerische Haltung fragt nach der Zerstörbarkeit des Individuums und nach der möglichen Rettung des Schönen. Gesten und Gebärden in den Gedichten sprechen immer wieder davon:
Nirgendwo bin ich angekommen.
Nirgendwo war ich zu Haus.
Das stelle ich fest
ohne Trauer
Und über die Nachwendezeit heißt es im selben Gedicht:
Jetzt also spreche ich Klartext:
Ihr habt mich getäuscht. Ich
bin ein anderer gewesen
im Zentrum der beschädigten Jahre.
In einige politische Gedichte aus den späten 1990er Jahren schleicht sich zuweilen ein allzu bittersüßer Ton ein. Drawerts satirische Suada gegen die selbst gewählte Wohlstandsgesellschaft klingt gelegentlich wie Modekritik, und mitunter mischt sich darunter sogar eine Spur Larmoyanz:
Ich steh im Brockhaus
und leb von Stütze.
Dagegen zeigen Reisegedichte wie „Die Beskiden“ oder „Letzte Tage in Bordeaux“ einen Feinironiker und renitenten Geist. Als Zugabe: „Matrix America“, ein Zyklus neuer Gedichte, in denen man bis zu Ground Zero gelangt.
Tom Schulz, Der Tagesspiegel, 5.2.2012
Das Bekannte ist etwas Anderes
− Dreißig Jahre Kurt Drawert. −
Ein Waldspaziergang zum Beispiel
interessiert mich nur wenig.
Hilflos schlendre ich rum
zwischen nichtsynthetischen Stoffen
und mache mich schmutzig.
Das ist kein Waldspaziergang, sondern ein Gedichtanfang.
Der Antrag auf eine Reise
in das nichtsozialistische Ausland
ging bei uns ein & wurde
gründlich beraten. Leider
ist es nicht möglich, Deinen Antrag
zu realisieren, da alle Reisen
vergeben sind.
− Freundschaft.
Auch dies keine Antragsablehnung, sondern ein versifizierter Brief vom 15.7.1981, also ein Gedicht. Dreißig Jahre später:
Ich werde es nicht mehr erwähnen
ostdeutsch verwundet und westdeutsch
verwaltet, ich habe zu sprechen begonnen
und war sofort allein.
Wieder keine Anklage, sondern ein Gedicht.
Kurt Drawert hat einen Band mit alten und neuen Gedichten zusammengestellt. Darin findet sich auch der kluge poetologische Text „Die Lust zu verschwinden im Körper der Texte“. Hier entwickelt er in der Tradition des Strukturalismus sein Dichtungsverständnis, dass die Wörter Material sind und der Mehrwert der Dichtung aus deren Übersetzung und Überschreitung entsteht. Das mag für Literaturwissenschaftler ein alter Hut sein. Für einen Autor ist dies ein beachtliches Sich-Zurücknehmen. Den Leser erinnert es daran, dass ein Gedicht vor allem ein Gedicht ist, und erst im deutenden Lesen auch Geschichts- oder Reisebuch, Trostspender, Gegenöffentlichkeit, Handlungsanweisung oder was auch immer werden kann.
Der Anfang seines aktuellen Zyklus – „Nein, ich schreibe nicht über New York“
in New York, aber so ein Leben
als Schaufensterpuppe in der 5th Avenue
[…] ist auch nicht
sehr anders, als in Halle an der Saale
Grütze zu kochen für brutto drei-
fünfundzwanzig, zum Beispiel
− ist keine billige Koketterie, es sind Fenster, Assoziationsräume oder, in Drawerts Worten:
Sprache, verstanden als die kalte Haut eines Textes, ist im Gesamtkomplex der Kommunikation nicht mehr als eine empfindliche Membrane, die regelt, daß Informationen zirkulieren und daß Bewußtseine überhaupt in Kontakt treten können.
Semantische Klarheit und sprachliche Offenheit standen bei Drawerts Gedichten schon Anfang der 80er in keinem Widerspruch:
Die Geschichte war fertig. Die Gegenwart
war fertig, die Zukunft, die Revolution,
die Antworten waren fertig
und sie tun es heute nicht: „Armut ist sexy, solange man Geld hat“. In Brighton Beach, dem wegen der zahlreichen dort lebenden Russen „Little Odessa“ genannten Stadtteil von NY, sieht das lyrische Ich am Ende Vergangenes aufscheinen und fragt sich
Was war das für ein Land,
dem wir entkamen
und das uns dennoch überlebt,
weil alles weiterstrebt
und nur die Form sich ändert?
Ich gebe auf
und werde es nicht wissen.
Allein die Toten
werden uns vermissen.
Kurt Drawert ist und bleibt ein großer dichterischer Einzelgänger. In Idylle, rückwärts kann man dies auf 260 Seiten (wieder) entdecken.
Franz Huberth, die horen, Heft 246, 2. Quartal 2012
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jan Kuhlbrodt: Ein Hohelied der Autonomie des Individuums – singt auch das Lied Bedrohung
fixpoetry.com, 27.10.2011
Als.: Der Defekt der Lyrik
Neue Zürcher Zeitung, 1. 9. 2011
Michael Braun: Das Daseinsgefühl der Abwesenheit
Deutschlandfunk, Buch der Woche, 3.7.2011
Das Lyrische Quartett im Lyrik Kabinett München sprach am 28.6.2011 über dieses Buch und ist zu hören ab 0:18:17.
Laudatio auf Kurt Drawert und Adolf Endler
aus Anlaß ihrer gemeinsamen Ehrung durch den Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
Ich, leider Mensch, bin ratlos: Mein Gefühl
Wird dutzendmal am Tag und mehr gebrochen (…)
Willst du es ändern, schlag mich tot!
Adolf Endler 1963
Ich ahne nicht, ob das Feinsinn ist
oder Schlamperei oder beides
Eckart Krumbholz 1991
Der Organismus der Ideen ist auf das Maß seiner
Metastasen geschrumpft
Kurt Drawert 1993
Sie können mich nicht betrügen. Ich spüre es doch. Ich spüre die lautlos hallende Frage im Raum, die ich selbst, unter anderen Umständen, niemals zu stellen gewagt hätte. Ich spüre, daß Sie von mir wissen wollen, was Kurt Drawert und Adolf Endler, nachdem sie schon gemeinsam einen Preis bekommen, darüber hinaus noch gemeinsam haben könnten. Sie hoffen, auch das spüre ich, daß sich diese Gemeinsamkeit nicht in dem Preis erschöpft und nicht in dem trivialen Umstand, daß es sich bei beiden um ostdeutsche Lyriker handelt, die dem DDR-Regime ablehnend gegenüberstanden.
Aber worin sollten die höheren Gemeinsamkeiten bestehen? Es ist nicht die gleiche Generation, Drawert stammt aus der Mitte der fünfziger Jahre, Endler ist fünfundzwanzig Jahre, ein ganzes Leben und einen Krieg älter. Drawert ist in die DDR hineingeboren, Endler hat sie aus eigenem Entschluß gewählt, indem er ungefähr zu der Zeit, als Drawert geboren wurde, von Düsseldorf in die DDR umzog. Vor allem aber – es ist nicht das gleiche Temperament. Endler und Drawert sind sich in ihrem dichterischen Temperament etwa so ähnlich wie ein Papagei und ein Zaunkönig. Drawerts Lyrik ist still und beherrscht, Endlers schrill und spektakelnd. Drawert wendet sich ab mit Grausen von dem Sprachmüll unserer Gegenwart, Endler türmt ihn mit sardonischem Vergnügen zu wahren Restmüllpyramiden. Drawert ist Melancholiker, Endler Ironiker. Wenn ich vor meinem geistigen Auge die Dichter imaginiere, dann sehe ich Drawert vor einer einsamen Landschaft in eine schweigende Weite träumend, Endler dagegen mit grimmigem Humor vor einer Kneipe gestikulierend.
Was also hat sich die Bayerische Akademie der Künste gedacht, als sie diese beiden grundverschiedenen Poeten unter denselben Preis gezwungen hat? Sie hat offenbar, wie andere ehrwürdige Akademien in ehrwürdigen Jahrhunderten zuvor, eine Preis- und Rätselfrage stellen wollen, die der Laudator nun beantworten soll. Und in der Tat, ich glaube, ich habe das Rätsel der Gemeinsamkeit lösen können.
Es handelt sich um die Wohnung.
I
Es ist die Wohnung, die Adolf Endler und Kurt Drawert gemeinsam haben. Natürlich nicht irgendeine beliebige Wohnung, in der sie zufällig, zugleich oder nacheinander gewohnt haben – sondern ein ganz bestimmte, eine sprechende und bezeichnende Wohnung, wie sie von beiden erlitten und schließlich zur Chiffre des verfallenden Landes und ihrer prekären Existenz erhoben wurde.
Es ist „diese Wohnung“, mit den Worten Drawerts, „die, von der sogenannten Küche aus betrachtet, in der alle Leitungen lange schon aus bautechnischen Gründen vom Strom-, Gas- und Wassernetz abgetrennt sind und in der aus offenliegenden Abflußrohren, die wie freie eiternde Wunden im Wandkörper liegen, alle Gärungs- und Fäulnisgerüche dieser Welt in die sogenannte Stube dringen…, die also nichts als ein besseres Einstiegsloch in die Kanalisation darstellt…“
Diese Wohnung in Leipzig also, deren allegorischen Zerfall Kurt Drawert in seinem berühmt gewordenen Prosastück Haus ohne Menschen beschreibt, entspricht ziemlich genau der Wohnung, die Adolf Endler in Berlin als „jenes bröckelnde und triefende Uralt-Quartier 100 Meter neben der sogenannten Mauer“ beschrieben hat, in der „Straße Hinter den Müllkübeln, Nähe Koth-Allee, Ecke Kottzplatz“. Diese Wohnung ist auch der Schauplatz von Endlers jüngster Prosa mit dem barockcn Titel Nächtlicher Besucher, in seine Schranken gewiesen. Der Besucher wird vor allem von der Wohnung in Schranken gewiesen beziehungsweise der Bewohner benutzt sie, um den unerwünschten Besucher einzuschüchtern:
Ich will gerne gestehen, das ich mich (ersatzweise für die KOMMUNALE WOHNUNGSVERWALTUNG)… dieser Bude insgesamt nun doch hin und wieder recht ordentlich schäme; dieses besseren Schweinekobens, durch dessen „Decke“ soeben nicht zum ersten und gewiß nicht zum letzten mal im Rahmen unseres stattlichen Prosagebildes etwas tröpfelt, rinnselt, sickert, pispelt und plurrt, oh nein, mein Bester, das sind die zerfaserten Rohrleitungen unseres Miethauses nicht!: Das Grünliche dort auf ihrer hängenden Schulter, wie es sich im Zeitlupentempo schweigend ausdehnt und um ihren schönen Nacken sich legt wie ein klebriger Auswurf und gleichsam als Shawl…
Genug. Diese Wohnung, wie es sie in allen Städten der DDR gab, hat nicht nur Löcher in der Decke, sondern auch im Fußboden, die Fenster schließen nicht, sie ist der Witterung und dem Straßenlärm unerträglich ausgesetzt: sie ist, wie es Drawert sagt, mit offizieller Absicht und Genehmigung zum Verfall und zum Grab für ihre Bewohner bestimmt. Diese Wohnung ist eine Allegorie, die es schrecklicher- und wunderbarerweise in der Realität gab – schrecklicherweise für die Normalbürger, wunderbarerweise für die Dichter.
Über den Absturz der sozialistischen Ideale in den real existierenden Verfall hat Kurt Drawert im Rückblick einmal gesagt: „Der Organismus der Ideen ist auf das Maß seiner Metastasen geschrumpft“ – das heißt, es handelt sich recht eigentlich gar nicht um einen Absturz und noch weniger um ein Scheitern der sozialistischen Ideen, wie oft gesagt wird, sondern um ihre notwendige krankhafte Entartung beim Übergang in die Realität. Der deplorable Zustand der DDR war eine Konsequenz ihrer Ideenwelt – eben genau so, wie Metastasen eine Konsequenz des Urprungskrebses sind.
Diese Wohnung, die geschilderte, prototypische Wohnung war eine logische Emanation des sozialistischen Staates. Man kann sie auch als Metapher nehmen – nämlich für all das, was zwar hinter dem Rücken der Parteipropaganda, der offiziellen Sprache geschieht, aber möglicherweise als ihre Konsequenz. Es ist jedenfalls auffällig, wie unsere beiden Dichter in der Beschreibung des Verfalls und des Moderns dieser Wohnung schwelgen, sie können sich gar nicht satt schreiben an der Schilderung dessen, was offiziell unsichtbar und auch nicht zu schildern war. Man könnte sagen: die Sprache des Dichters triumphiert gerade dort, wo die offizielle Sprache schweigt. Kurt Drawert würde sogar sagen: Die Dichtersprache kann immer nur dort, in der verfallenden, zerstörten Wirklichkeit sein, jenseits der offiziellen Sprache und ihrer schönen Lügen. Die Dichtersprache ist die schlimme Wahrheit und das schlechte Gewissen der offiziellen Sprache.
Dies ist die bedeutendste Gemeinsamkeit von Kurt Drawert und Adolf Endler: daß sie besessen sind von der offiziellen Propagandasprache, dem, was der Russe Boris Chasanow einmal das Heilige Abrakadrabra der Partei genannt hat, und daß sie die Wirkung dieser Propagandsprache, die andernorts nur belacht wurde, für so fatal und toxisch halten. Drawert und Endler rechnen mit einer Totalvergiftung des Sprachbewußtseins durch das Kauderwelsch der Klassiker – und mit der Möglichkeit, wenn nicht Pflicht der Dichtung, ein Gegengift zu verabreichen. Wie dieses Gegengift herzustellen und zu verabreichen ist, daran trennen sich dann freilich die dichtungstheoretischen und -praktischen Wege wieder. Endler ist Homöopath und Drawert Allopath, um das Prinzipielle des Wesensunterschiedes schon einmal anzudeuten.
Drawert sucht nach dem Anderen, nach einer Sprache, die soweit wie irgend möglich von der offiziell verabreichten entfernt ist, sauber, klar und still. Endler dagegen arbeitet mit dem giftigen Material selbst, er stellt durch Übersteigerung und Kondensierung eine poetisch wahnsinnige Potenzierung, eine Art Impfstoff her, der im Körper des Lesers zu einer heftigen Immunreaktion führen soll. Drawert versucht den Patienten in einen Luftkurort der Sprache zu entführen, von dem aus die Abscheulichkeit des lügenhaften Sumpfes umso sichtbarer wird; Endler dagegen ist der Bademeister, der den Sumpf als Kurpackung verabreicht.
II
Es wäre im übrigen nicht weiter nötig, sich mit der Wirkungsweise beider Therapien zu beschäftigen, wenn die Sprachkrankheit sich mit dem Untergang der DDR erschöpft hätte. Sie war aber dort nur besonders leicht zu diagnostizieren. Sowohl Drawert wie Endler haben bald entdeckt, Endler vielleicht sogar schon zuvor gewußt, daß die Sprachverderbtheit, die Bewußtseinsvermüllung keine totalitäre Partei als Erreger haben muß. Die Werbung, die Medienwelt des Westens können mühelos ein verwandtes Krankheitsbild hervorrufen. Es scheint nur, darüber streiten die Fachleute noch, nicht so zielstrebig letal zu verlaufen, sondern nur die Verstandes- und Gefühlskräfte nachhaltig zu schwächen.
Wenn man dieses Krankheitsbild ganz allgemein als gefährliche Behinderung und Schwächung der Wirklichkeitswahrnehmung definieren will, dann kann man nach dem Krankheitsverlauf einen Ost- und einen Westerreger unterscheiden: der Osterreger, der in allen, übrigens nicht nur linken Diktaturen zu Hause ist, führt zur vollständigen Wirklichkeitsblindheit, so daß der Patient in seinen eigenen vier Wänden tödlich verwahrlost, letztlich an den Ausscheidungen erstickt, die er nicht mehr erkennt – während der Westerreger den Kranken nur lähmt, so daß er einen dauerhaft tauglichen Wirtskörper für den Erreger abgibt, der ihn nach seinen Interessen zu manipulieren beginnt. Kurzum: Der Ostpatient krepiert, der Westpatient geht shoppen.
Die Furcht, ich meine die durchaus berechtigte Furcht, vor einem pathogenen Versagen der Sprache, vor einer Irreführung durch Sprache hat nicht nur die DDR überlebt, sie war auch zuvor schon da. Sie ist so alt wie die Moderne und ihre Möglichkeiten der Massenkommunikation. Die Furcht war schon da, bevor zwei Diktaturen die Macht der Manipulation durch gezielte Sprachverarmung bewiesen haben und bevor die Konsumwerbung an der semantischen Entmündigung des Bürgers zu arbeiten begann. Es waren auch schon die beiden Therapien, gewissermaßen vorbeugend, im Umlauf, es hat die beiden exemplarischen Behandlungsmöglichkeiten, nach Drawert und nach Endler, in der deutschen Literatur immer gegeben, die Asketen und die Schocktherapeuten der gezielten Überfütterung, die Weltflüchter und die Bahnhofsmissionare vor Ort, die Schweige- und die Bettelorden, Hofmannsthal und Döblin.
Hofmannsthal empfahl den Rückzug, die vornehme Askese, die Verweigerung der verdummten Welt verdummter Massen – Döblin sagte; da müssen wir durch. Er schickte seinen Biberkopf auf dem Weg der Läuterung durch die ganze versaute Reklame- und sprach-restringierte Unterschichtenwelt. Aber auch Biberkopfs Weg sollte, das dürfen wir nicht vergessen, ein Heilsweg, ein christologischer Kreuzweg sein, der allerdings durch den Schweinkoben des Diesseits zu führen hatte. Es geht also nicht, um einem naheliegenden Mißverständnis vorzubeugen, um unterschiedliche Grade der Empfindlichkeit und des Ekels, der Verzweiflung und des Pessimismus. Es geht um unterschiedliche Wege. Das ist wichtig.
Das ist sehr wichtig, um auch die unterschiedliche ästhetische Physiognomik unserer beiden Dichter, ich meine jetzt wieder Drawert und Endler, gerecht zu beurteilen. Es wäre nämlich sonst durchaus möglich, in Drawert den Moralisten und in Endler den zynischen Spaßmacher zu sehen, betrachtet man nur das Sprachmaterial, mit dem sie umgehen. Drawert geht in der skrupulösen Auswahl der Worte, die er allenfalls noch für tauglich und unbelastet hält, bis zum Verstummen. Endler dagegen wühlt begeistert in dem verdorbenen Material, illuminiert von der schwarzen Sonne seines Ekels, und collagiert und recyclet, bis – nun, manchmal bringt er das Material nur zur Selbstentlarvung, manchmal bis zur Wiedereroberung einer neuen, ergreifenden Unschuld und Unmittelbarkeit.
Es sind nämlich in Wahrheit beide große Moralisten. Drawert ist ein Moralist der Gesellschaft, Endler der Existenz. Der Moralist Drawert hält die Gesellschaft für verkommen, der Moralist Endler schon die menschliche Existenz. „Vielleicht“, hat Endler einmal gesagt, „ist meine ganze Existenz nicht so sehr auf DDR und Sozialismus zu beziehen, sondern auf die Frage, ob das Leben absurd ist oder nicht.“ Der Wurm steckt bei Endler also schon im Menschen drin, bevor er sich vergesellschaftet. Bei Drawert wird der Mensch erst im Augenblick der Vergesellschaftung zum Wurm.
Anders, als man denken möchte, ist nicht der Fonds der Verzweiflung der tiefste, aus dem der Melancholiker Drawert schöpft; denn es gibt für ihn das Kind, das im Wortsinne des Infanten unschuldige, das erst mit dem Spracherwerb in die Bosheitswelt der Erwachsenengesellschaft tritt, wie er in einem überwältigend ergreifenden Essay am autobiografischen Muster ausbuchstabiert hat. Aber der tiefer verzweifelte ist Endler, der Humorist, der Satiriker und Kabbarettist, der an eine voranfängliche Unschuld gar nicht glaubt, weder vor der Gesellschaft noch an eine wieder zu erobernde nach der Gesellschaft.
Es ist in diesem Zusammenhang überaus aufschlußreich, daß Endler mit Nachdruck einmal seine Verachtung für die „kalten und falschen Seelenvollen“ artikuliert hat, also jene, die glauben, eine Seele und eine Sensibilität den anderen vorauszuhaben, während sie in Wahrheit nur Solidarität verweigern, wenn sie nicht gar die vorgebliche Empfindsamkeit zur betrügerischen Camouflage ihrer Kaltherzigkeit benutzen.
Ebenso wie es aufschlußreich ist, daß Drawert in Kaspar Hauser seinen persönlichen Mythos gefunden hat. Der berühmte Findling des 19. Jahrhunderts, der aus dem sprachlosen Naturzustand in die Gesellschaft eingeführt und für die Gesellschaft sprachlich zugerichtet wurde, spukt überall durch Drawerts Werk und hat es diesen Herbst zu einem ganzen Roman gebracht.
Wenn aber Drawerts expliziter Prototyp Kaspar Hauser ist, der aus paradiesisch unschuldiger Vorgeschichte in die sündige Sprachgeschichte eintritt, dann ist Endlers impliziter Prototyp der Penner, der in alten Zeitungen und Propagandamüll, in aktuellen Prospekten und verworfenen Traditionen wühlt. Während Kasper Hauser seiner Natur nach unschuldig ist und unter Schuldige gerät, ist Endlers Penner ein Faun, der sich mit erheblicher Koketterie selbst einen „dirty old man“ nennt, mit Tabubrüchen und Ziegenbockgemecker Furcht und Schrecken unter den Spießern verbreitet.
Wo bei Drawert Mißtrauen in die Mehrheitsgesellschaft ist, da ist bei Endler Verachtung. Ich wage einmal, nur jetzt, nur für den Raum dieses Vortrags die riskante Formulierung: Drawert inszeniert sich als Schriftsteller in der Rolle des Opfers, Endler in der Rolle des Täters. Mit einer schönen Formulierung des Germanisten Walter Hinck: Drawert „nimmt die Schutzlosigkeit hin, mit der er seine Freiheit bezahlt“. Endler dagegen bewaffnet sich, bis unter die Zähne, mit den höhnisch verbogenen Waffen, die er seinen Gegnern abgenommen hat.
III
Mißtrauen ist da, wo man noch etwas unterscheiden kann, die Wahrheit vom Lug, und wo man vor allem den Trug fürchtet, der das eine gegen das andere tauschen will. Verachtung ist dort, wo man sich die Mühe der Unterscheidung nicht mehr macht, wo man nur noch mit Lug und Trug rechnet.
Deshalb ist es mit Endler und Drawert noch einmal anders, als es die gerade skizzierte Rollenverteilung des Märtyrers und des Provokateurs nahelegt. Der leidende Dichter Drawert ist hier nämlich, insofern er mißtrauisch Wahrheit und Lüge sortiert, der aktiv zensierende Dichter. Der beleidigende Dichter Endler dagegen, insofern er nicht sortiert, sondern nur collagiert, ist der passiv resignierende Dichter.
Endlers Sprachskepsis ist generell – schon indem er es für möglich hält, jedes Wort aus jeder Sphäre mit jedem anderen Wort aus jeder anderen Sphäre zu collagieren, gibt er zu verstehen, daß jedes Wort in jedem Zusammhang trügen kann, womöglich sogar nichts mehr besagt. Drawerts Sprachskepsis dagegen ist keineswegs generell, es ist vielmehr eine besondere, eine Herrschaftssprachskepsis. Sprache ist dann, vielleicht sogar nur dann, suspekt, wenn sie dazu dient, Herrschaft auszuüben, indem sie Satzmuster als Gedankenmuster vorgibt und kollektive Sprechakte an die Stelle individueller Sprechakte setzt.
Es gibt eine filigrane Theorie dazu bei Drawert, die ich, er möge mir verzeihen, nur höchst holzschnitthaft andeuten kann. Ein wesentliches Moment der Herrschaft durch die Sprache ist die Eroberung der bis dahin vorsprachlichen, sozusagen körperlichen Bewußtseinsinhalte des Individuums – sie werden mit Gewalt versprachlicht, bis sie sich auch sprachlich behandeln, also verformen, zerstören, manipulieren lassen. Nicht ohne bittere Ironie zeigt Drawert, wie schon innerfamiliär im Medium der „unendlichen Aussprache“, wie er es nennt, nämlich zwischen Eltern und Kindern die Herrschaftstechnik ausgeübt wird, die sich im autoritären Staat zwischen Abweichler und Parteikollektiv oder im liberalen Staat zwischen Konsummuffel und Werbebotschaft vollzieht.
Diese ausformulierte Sprachtheorie Drawerts findet bei Endler – nun, eigentlich, kein Pendant. Dem Theoriediskurs entspricht vielmehr ein Verzweiflungsdiskurs bei Endler – etwas, das nicht begrifflich vorgetragen, sondern gestisch vorgeführt wird. Warum? Weil die Verzweiflung bei Endler stets von einem Stolz begleitet wird, der wie aus fernen Zeiten seltsam aristokratisch hinüberragt. Der Stolz verbietet die Verzweiflung nicht, wohl aber, sie auszustellen. Man muß deshalb weit zurückgehen in seinem Werk, um auf etwas explizit zu stoßen, was man damals das Gebrochene nannte. Dieses Gebrochene war etwas, was in der sozialistischen Ästhetik der sechziger Jahre so ziemlich die schlimmste Verfehlung war, die ein Kritiker einem jungen Autor wie Endler vorwerfen konnte. Endler antwortet also, wie er höhnisch titelte, „Dem ungebrochenenen Rezensenten“ 1963 mit folgendem Gedicht:
„Gebrochene Gefühle!“ rügt er manchen kühl
Will jener Rezensent auf Steine pochen?
Ich, leider Mensch, bin ratlos: Mein Gefühl
Wird dutzendmal am Tag und mehr gebrochen.
Wie ist ein ungebrochenes Gefühl? Mit glatten Rändern?
Meins jubelt heute, morgen schon in Not!
Meins ist gebrochen. Kann ichs denn ändern?
Willst aber du es ändern, schlag mich tot!
Aber wie es nun einmal so ist, berühren sich die Gegensätze, die ich zwischen Endler und Drawert so scharf heraus zu arbeiten versucht habe, am Ende doch – und zwar auch im Lebensgefühl und über den Abstand vieler Jahrzehnte hinweg. Es gibt ein Gedicht Drawerts aus dem Jahre 1993 mit dem Titel „Zustandsbeschreibung. Zwischenbericht“:
Im sächsischen L., einer Stadt
Im Auswurf der Zeiten,
habe ich nichts mehr
verloren. Gewonnen hab ich
die Einsicht vom Ende
der Herkunft. Was bleibt,
ist der Name
für meine vermutete
Person,
wie er auf amtlichen
Kopfbögen steht.
Und daß mein linker Fuß
Auf Dauer krank
Und verpfuscht ist.
Da hilft auch die Freiheit
Als geordnetes Rauschen
Im Heizkörper nichts,
nichts hilft
der letzte schöne Weg
aller Dinge von gestern
in die Entsorgung
nichts hilft die Gnade,
die Orte der Hinfälligkeit
zu vergessen
Politisch betrachtet
Meine ich bildlich gesprochen
Schon lange nichts mehr,
und so sage ich klar:
meine Jahre bis heute
sind eine Schleifspur
gebrochener Schritte
aus oben beschriebenen Gründen
im anders grauen Sand.
Ja – so ist das. Gebrochene Gefühle – bei Endler; gebrochene Schritte – bei Drawert. Das Leben eine Schleifspur im anders grauen Sand. Darauf könnten sich die beiden einigen – aber wohl nicht darauf, wer daran schuld ist, das Leben selbst, wie Endler vielleicht sagen würde, oder jene, die den Sand vergraut haben, wie Drawert vielleicht meint.
IV
Ich breche ab. Ich beende jetzt diese willkürliche, doch traditionsstolze Gegenüberstellung nach dem Muster von Plutarchs Doppelbiographien, zu der mich die ehrwürdige Akademie gezwungen hat. Ich fasse meinen Bericht an die Akademie wie folgt zusammen:
Die Wohnung, in der die Dichter Drawert und Endler zu Hause sind, ist die gleiche; aber wie sie darin hausen, das unterscheidet sich drastisch. Der eine hat einen Putztick, der andere einen Sammelwahn; der eine räumt unablässig auf, der andere ist ein Messie. Ich will gerecht sein: Ganz gewiß gibt es einen Willen zur Ordnung auch bei Endler, und eine vernachlässigte krautige Ecke auch bei Drawert. Aber ganz gewiß gibt es bei Kurt Drawert nicht und nirgendwo jenes Endlersche In-eins-fallen von Sinn und Unsinn, das mir vor Zeiten einmal Eckart Krumbholz demonstriert hat.
Sie werden wahrscheinlich Eckart Krumbholz nicht kennen? Aber Sie kennen doch wohl Karl Mickel? Und werden davon gehört haben, daß er einen Schlüsselromam über die Dichter der DDR geschrieben hat mit dem Titel Lachmunds Freunde? Nun Eckart Krumbholz, das war Lachmund. Mehr will ich jetzt nicht über Krumbholz sagen, nur soviel, daß ich ihm 1991 einmal ein Buch von Adolf Endler zur Rezension geschickt habe. Es hieß CITATTERIA & Zackendulst, und Krumbholz hat es sehr gerne rezensiert, nur mit der Typografie war er unzufrieden. Er schrieb mir: „Bitte überprüfen Sie: Citatteria steht auf dem Titel mit Großbuchstaben, auf dem Innentitel und im Text normal, ich ahne nicht, ob das Feinsinn ist oder Schlamperei oder beides.“
Feinsinn oder Schlamperei oder beides – diese drei Lesarten auf einmal zu provozieren oder zuzulassen, je nach dem, dazu muß man als Dichter erst einmal kommen, sehr verehrter lieber Adolf Endler, ich gratuliere Ihnen. Sie haben den Rainer- Malkowski-Preis verdient.
Und Sie lieber Kurt Drawert, Sie werden darob nicht neidisch werden, Sie werden sich vielmehr glücklich schätzen, daß Ihnen der Feinsinn nicht aus Schlamperei und die Schlamperei nicht aus Feinsinn unterläuft, ich gratuliere Ihnen jedenfalls dazu. Sie haben den Rainer-Malkowski-Preis verdient.
Jens Jessen
„Nicht immer sieht es so schön aus, /
wenn die Biegsamkeit überlebt.“
Rede zur Verleihung des Rainer-Malkowski-Preises 2008
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem sehr verehrte Frau Malkowski, ohne deren Großzügigkeit es diesen Preis nicht geben würde, liebe Jury, der ich herzlich zu danken habe, und, nicht zuletzt, lieber Jens Jessen, ein Dank auch Ihnen für Ihre großartige Rede, die etwas leistet, das ich mir gar nicht vorstellen konnte: zwei so verschiedene Autoren wie Adolf Endler und mich in einen nicht nur biografischen, sondern auch poetologischen Zusammenhang zu bringen.
Einen Preis zu erhalten, zumal einen so bedeutsamen wie den Rainer-Malkowski-Preis, ist gewiß eine Ehre und Bestätigung für etwas, das schon geleistet wurde und wohl nicht völlig vergeblich in der Welt ist. Ihn aber auch anzunehmen, ist etwas anderes und gar nicht so einfach, wie es scheinen mag. Denn man hat sich einiges zu fragen, das zu beantworten schwer werden kann. Die erste Frage, die ich mir stelle, leitet sich aus einem Begründungssatz ab, mit dem die Jury ihre Entscheidung erklärt, Zitat: „Durch den Gang der Geschichte haben sich viele seiner Gedanken bestätigt. Man könnte sagen, das Leben hat ihm recht gegeben, was nicht so häufig geschieht.“ Aber wollte ich denn, seit ich denken und schreiben kann, jemals recht haben? Oder gehört es nicht schon zu den Niederlagen, wenn tatsächlich eintrat, was befürchtet worden war? Denn die Imaginationen des Scheiterns, die traurigen Vorhersagen eine Gesellschaft betreffend, die auf dem Weg ist, sich selbst abzuschaffen, wurden nur allzu oft Realität und bittere Wahrheit. Das hat mit Irrationalismus nicht das geringste zu tun, sondern allein damit, daß der Mensch in jener Tiefe seiner selbst, in der auch Gedichte entstehen und Literatur, nicht mehr zu hintergehen ist. In dieser spür- und ahnbar werdenden Option, ein Wissen über die Sprache hinaus zu besitzen, entstehen Gedichte, und sie verfügen gleich ihrem Verfasser über jenes Unterbewußtsein, über das wir mit dem Eigentlichen dieser Welt in Kontakt sind. Und damit rede ich jetzt nicht gegen die Aufklärung und gegen „den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“, was immer das in einem Zeitalter der fremdverwalteten Innerlichkeit noch bedeuten kann. Ich rede über die Aufklärung hinaus, über die Antworten hinaus, die nichts wirklich eingebracht haben. Vielleicht war ich auch deshalb ein wenig unbeholfen, als ich den Satz vom Leben, das mir recht gab, zur Kenntnis nahm. Denn wenn etwas recht hatte, dann waren es am ehesten noch meine Gedichte, die ich ja allzu oft selbst erst später verstand, um rückblickend erstaunt zu sein, was vorausbedeutend nicht alles schon geschrieben worden war. Beispielhaft hierfür ein Gedicht, das im Sommer 1989 entstand, zu einer Zeit also, in der niemand sich vorstellen konnte, daß bald schon die DDR zusammenbrechen und die Mauer fallen würden.
ANDERE ARBEITER, EIN ANDERER HERBST
Unverständlich und klar
liegen in ihrer Geschichte
die Dinge begraben.
Alles hat seinen Anfang
und seinen Krebs –
eine Empfindung von gestern
zur Stunde. Die Frau
und ihre gealterte Katze,
in deren Körper die Zeit
sich bewegt, zählen die Schnitte
auf der Platte des Tisches
den Tagebuchseiten
hinzu. Im Hintergrund
das bekannte Geräusch
der Fabrik. Andere Arbeiter,
sagt man, ein anderer Herbst,
wie es im Buch steht
und vorauszusehen war.
So habe ich von meinen Gedichten immer nur gelernt, wie man auch von seinem Körper lernt, wenn man ihn zu lesen versteht. Ein Gedicht, das nicht klüger ist als sein Autor, ist bloße Behauptung und frei von jenem poetischen Mehrwert, der das Gedicht erst beglaubigt. Das meinte auch ein Satz Mallarmés zu Degas, der sich darüber beklagte, daß ihm seine Gedichte immer zu lang werden würden, und zur Antwort bekam: Gedichte werden ja auch aus Worten, nicht aus Gedanken gemacht. Vielleicht kann man es die Klugheit des Körpers nennen, was sich im Umweg über die Sprache symbolisch konstituieren und weitergeben läßt, um am Ende, über alle Rhetoriken hinweg, auf unbestechliche Art und Weise recht zu bekommen. Die Bilder, die sich mir in den Gedichten und Prosatexten ergeben haben und von der Geschichte bestätigt wurden, sind daher auch gewiß nicht mit einem Gefühl der Genugtuung verbunden, sondern eher mit dem eines Versagens, mehr gewußt als getan zu haben. Aber ich habe ja nicht mehr gewußt als mein Text, und das nimmt mich nun wieder in Schutz. Diese Ungleichzeitigkeit von Wissen, Verstehen und Handeln ist wohl Gesetz, denn andernfalls müßten die Wissensvorräte, wie sie in den Bibliotheken lagern, den Lauf der Dinge aufhalten können. Nun glaube ich zwar, daß Literatur die Welt verändert, aber die Zeitachse, auf der das geschieht, geht mit den Anlässen und unserer Lebenszeit nur selten überein. Einmal hatte ich das Glück, es zu erleben: als die DDR und mit ihr der gesamte Ostblock an sich selbst zugrundeging und wie Phönix aus der Asche die Gedichte ihre historische Wahrheit berührten. Ein kurzer Triumph, denn bald schon bin ich von den Kränkungen, die das Land mir vererbt hat, wieder eingeholt worden. Dann nämlich, wenn ich daran dachte, wie der Sechzehnjährige, der ich war in einer Fabrik, dafür gemaßregelt wurde, daß er Ansichten vertrat, mit denen er recht haben sollte. Und keiner war mehr zur Stelle, den man hätte fragen oder gar zur Rechenschaft ziehen können. Sie waren alle, mit dem verendeten Land und ihrer Verantwortung dafür, in einem Untergrund verschwunden, aus dem gelegentlich noch Leichengift nach oben steigt. Das war ein Grund dafür, daß ich wegging, um am Ende doch immer wieder meiner Herkunft verhaftet zu sein.
MIT HEINE
Dies Land, von dem die Rede geht,
es war einst nur in Mauern groß,
dies Land, von Lüge zugeweht,
ich glaubte schon, ich wär es los.
Ich glaubte schon, es wär entschieden,
daß wer nur geht, auch gut vergißt.
Doch war nun auch ein Ort gemieden,
der tief ins Fleisch gedrungen ist.
Als fremder Brief mit sieben Siegeln
ist mir im Herzen fern das Land.
Doch hinter allen starken Riegeln
ist mir sein Name eingebrannt.
In dieser Zeit nun meiner gefährdeten Jugend ist auch die Literatur als eine Überlebensmöglichkeit nicht nur wichtig, sondern zwingend für mich geworden und haben sich die Sinnzusammenhänge von Literatur und Gesellschaft poetologisch konsolidiert. Dabei gehörten für mich Form und Aussage immer zusammen. Die beste Absicht ist nichts wert, wenn sie ihre literarische Form nicht findet, wie andererseits die Form für gar nichts steht und auch nichts bedeuten kann. Einen Satz Jean-Paul Sartres würde ich auch heute noch sofort unterschreiben: „Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie der Mühe nicht wert. Das will ich mit Engagement sagen“. Literatur ist nicht schön, wenn sie nicht wahr ist, und sie kann nicht wahr sein, wenn sie nicht kritisiert. Das nun ist die zweite Frage, die ich mir heute stellen will: wer ist eigentlich noch für diesen Wert eines humanen gesellschaftlichen Fortbestandes, der sich durch Kritik am Bestehenden äußert, empfänglich? Ich gebe gern zu, daß ich ein Romantiker bin, und da das Begehren nach Harmonie eine besonders harte Projektionsfläche für Wirklichkeit abgibt, muß ich wohl literarisch hauptsächlich Alpträume haben. Auf die Kritik bezogen heißt das, das Kritisierte nicht zerstören, sondern verändern zu wollen, und was keinen Bestand hat, bleibt der Sprache entzogen. Allein das, Kritik als produktiv zu betrachten, ist jedem totalitären System unmöglich, und deshalb muß es auch, aus seiner eigenen Überheblichkeit heraus, scheitern. Aber auch andere Systeme, die zur Reflexion untauglich sind, sterben aus, auch wenn dieser Sterbevorgang recht lange anhalten kann und über den Umweg medialer Täuschungen noch den Anschein von Glückseligkeit abgibt. Und wenn ich jetzt sage, daß mein jüngster lyrischer Zyklus „Vom Ende der Poesie“ heißt, dann verstehen Sie schon, daß ich den Zweifel meine, ob Literatur fern jeder Interessenausbeutung und Vermarktungswilligkeit noch eine realistische Chance hat, und mit ihr jene, die sie zu schaffen imstande sind.
VOM ENDE DER POESIE ( I )
Jedes Gedicht, sagte Herr Müller
von der HypoVereinsbank,
ist ein Schuldschein,
und Sie schreiben zuviel.
Ich also hängte diesen Teil
meines Lebens
wie an einen Haken für Schweine.
Nein, ich will jetzt nicht das leidige Thema „Geld und Gedichte“ ansprechen, das auch mir nur unerfreulich ist, auch wenn natürlich stimmt, daß 1.) die kapitalistische Grundformel „Zeit ist Geld“ heißt, womit sich die Zeitgesetze eines Gedichtes wirtschaftlich betrachtet nur noch verheerend für dessen Produzenten auswirken, und 2.) ein Mann wie Ludwig Wittgenstein jun. kaum noch in Sicht ist, der in einem Brief vom 14.7.1914 an Ludwig von Ficker schrieb: „Sehr geehrter Herr! Verzeihen Sie, daß ich Sie mit einer großen Bitte belästige. Ich möchte Ihnen eine Summe von 100.000,- Kronen überweisen und Sie bitten, dieselbe an unbemittelte (…) Künstler (…) zu verteilen.“ Noch mehr Sorge macht mir, was aus unserem Begriff von Literatur geworden ist, und wie sehr wir unsere Werte verlieren, wenn wir diesen Begriff aufgeben, der sich in seiner substantiellen Tiefgründigkeit doch immerhin recht lange gehalten hat. Denn was da nicht alles als Literatur avanciert und die Zu- und Abflüsse des Marktes verstopft, läßt mich darüber nachdenken, ob die Berufsbezeichnung „Schriftsteller“ nicht doch besser geschützt werden sollte. Nun greift diese Polemik natürlich ins Leere, weil ich zwar sagen kann, was ich für wichtig halte, aber über keine Möglichkeit verfüge, um diese Überzeugung auch praktisch umzusetzen. Denn Literatur und Kunst unterliegen immer auch einem Meinungskonsens und sind eine gesellschaftliche Verabredung darüber, was mit welchen Werten bedacht wird. Wenn also der Literaturbegriff heute in den „Feuchtgebieten“ diverser Bestsellerlisten ertrinkt, dann sagt es erschreckend viel aus über das kulturelle Niveau der Gesellschaft, in der wir leben. Nicht dieses Buch gleichen Titels und dessen Autorin mit ihren doch recht privaten proktologischen Nöten sind der Skandal. Der Skandal ist sein kommerzieller Erfolg. Aber er ist auch nur für den ein Skandal, der nicht lesen möchte, wie es im Darmausgangsbereich einer sexuell hochaufgeregten jungen Frau aussieht. Und da sind wir schon in einer Minderheitsfalle, denn viele schauen dort ja offensichtlich gerne hinein, als wäre er der siebente Himmel, und die Kasse stimmt auch noch. Die Übereinkunft von Zeigelust und Voyerismus ist schon lange zu einem Wirtschaftsfaktor geworden und treibt immer bizarrere Blüten, die wir aber bitte nicht Literatur oder Kunst nennen wollen. Hier nun kommt auch das Argument von der Quote ins Spiel, die wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Aber was sagt uns die Quote? Stellen Sie sich einmal vor, auf dem Marktplatz würde wieder ein Galgen errichtet, und es fände eine Hinrichtung statt. Ich wette alles dagegen, die halbe Stadt wäre auf den Beinen. Was sich, über den Weg einer medialen Großvernetzung, die noch die entlegenste halbzivile Ritze in ihr sinnentleertes Raster zieht, an Verflachung und Vernichtung von Wahrnehmung bereits vollzogen hat, ist wohl kaum noch zu kompensieren. Daß sich, biologisch erwiesen, die Gehirnstrukturen adaptiv ihrer funktionalen Beanspruchungsmuster langfristig verändern, sei hier nur am Rande vermerkt. Wir sind zu Abwesenden in einer Welt geworden, die wir hauptsächlich nur noch aus den Chats und Foren des Internets kennen, um Wirklichkeit und symbolische Referenz permanent zu verwechseln. Ein Umgang mit komplexen literarischen Texten, die sich erst in der Rezeptionsbegabung eines Lesers entfalten, findet mehrheitlich kaum noch statt. Bei einer Lesung vor wenigen Tagen wurde ich vom Veranstalter mit den sicher gutgemeinten, aber verunglückten Worten begrüßt, daß ich, nun ja, ein wohl doch etwas schwieriger Autor sei und bitte nicht so lange lesen möchte. Aber kann eigentlich etwas schwieriger, komplexer und rätselhafter sein, als das Leben selbst, das zu verstehen wir uns bemühen mit den Mitteln der Sprache und der Literatur? Wo sind wir hingekommen, wenn wir keine Instanz mehr suchen, die das Leben dort reflektiert, wo es in der Sackgasse steckt. Und auch umgekehrt wird ein Schuh daraus, denn meine gelegentlich etwas nachlassenden Motivationen zum Schreiben beziehen sich auf die Gefährdungen dieser Welt, auf ihre Defekte und Hinfälligkeiten, auf die dauernde Abwesenheit des Glücks. Nicht, weil ich das Unglück beschwören möchte und insgeheim verliebt darin bin, sondern weil das Schöne nichts und niemanden mehr braucht. Mit dem Schönen können wir sehr gut allein sein, mit dem Unglück nicht. Auch davon spricht eines meiner Gedichte:
ZWISCHEN DEN ZEILEN
1
Es gibt viele schöne Dinge
für ein Gedicht, die ein Gedicht
nicht mehr brauchen,
weil sie schon schön sind.
2
Dennoch, ich wollte sie nennen, alle,
bis zur weißen Blüte der Kirsche.
3
Aber immer, zwischen den Zeilen,
bleibt etwas übrig.
Freilich, nicht jeder will wissen, was übrig- und auf der Strecke bleibt, zwischen den Dingen, die sich schnell verbrauchen und am besten gleich aufessen lassen. Aber offen gesagt, es ist mir auch egal, und ich strecke die Waffen. Dort, wo sich die Ideale von Freizeit mit einer Fernsehshow vom Dschungelcamp treffen, haben wir sowieso schon verloren. Da brauchen wir auch keine Bücher mehr, von diversen und meistens nur peinlichen Lebensbeichten vielleicht einmal abgesehen. Und machen wir uns nichts vor: wir, für die Literatur, und ich meine jetzt wirklich einmal nur die Literatur, die ihren Namen auch verdient, eine Möglichkeit des Lebens und des Überlebens ist, werden überschaubarer von Tag zu Tag. Wir sind eine Minderheit, die sich nur deshalb nicht als eine solche empfindet, da sie noch immer die Buchhallen füllt, wenn ein Termin es erfordert. Was ich verlange, ist eine Art Minderheitenschutz, ein Reservat an kulturellem Sinn, ohne den wir bei den Barbaren enden. Natürlich weiß ich, daß ein guter Verleger auch ein guter Kaufmann sein muß. Aber wer nur Geld verdienen will, egal auf welcher Seite der Literatur, der sollte doch besser gleich eine Wurstfabrik gründen. Wobei es natürlich auch ein kleines, verstecktes Glück ist, daß die Finanzkrise, von der wir jeden Tag hören, ohne deren Ausmaß auch nur annähernd zu begreifen, Geld in seiner völligen Leere und Wertlosigkeit vorführt und, ich zitiere eine Zeitung: „Bänker so stark wie die Bären zu Tränen rührt“. Wenn man bedenkt, daß da eben eine ganze Insel von zockenden Kapitalmarktbrokern verspielt worden ist und deren Bevölkerung vielleicht schon als Insolvenzmasse kursiert, weiß man einmal mehr, daß die Absurditäten des Realen auch noch die kühnste literarische Phantasie übersteigen. Aber wenigstens liegt im Bedeutungssturz des Geldes eine Befreiung von Sinn, so meine gewiß nur kleingehaltene Hoffnung. Also tun wir, was unsere Aufgabe ist und sagen es mit dem liebenswürdigen Bartleby: „Nein, ich will lieber nicht“. Und wenn es etwas gibt, auf das ich, ohne hochmütig zu werden, ein wenig stolz sein möchte, dann ist es die existentielle und ästhetische und geistige Konsequenz, mit der ich immer gedacht und geschrieben habe und auch weiterhin denken und schreiben werde, so wahr mir Gott und die Sparkasse helfen. Mein Verleger, der heute anwesend ist und diesen Weg mit mir geht, hilft sowieso, und auch dafür möchte ich danken. Vielleicht hatte Rainer Malkowski, in dessen Namen wir hier und heute versammelt sind, Ähnliches gemeint, als er sein wunderbares Gedicht „Schöne seltene Weide“ schrieb, das ja, mit seinen letzten zwei Versen, den ganzen Widerstand beschreibt, den wir zu leisten haben.
SCHÖNE SELTENE WEIDE
Manchmal, nach einem Herbststurm,
wenn die Luft still und gefegt ist,
gehe ich im Garten umher und zähle
die abgeschlagenen Äste.
Nur die Weide zeigt keine Veränderung.
Ich bewundere sie lange:
nicht immer sieht es so schön aus,
wenn die Biegsamkeit überlebt.
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Anwesenheit.
Kurt Drawert, München, am 24.11.2008
„Dem vom Körper umschlossenen Geheimnis“
– Zu Kurt Drawerts Poetik zwischen Körper und Sprechen. –
In „Was gewesen sein wird. Eine Interpretation“ bemerkt Kurt Drawert:
Ebenso (…) bleiben die Körper, die immer zu einer Historie gehören und politisch kontextuiert sind, von jener Erregung durchströmt, die sie einmal affektiv ausgefüllt hat (…).[footnoteKurt Drawert: „Was gewesen sein wird. Eine Interpretation“, in: Ders.: Was gewesen sein wird. Essays 2004 bis 2014, München 2015, S. 290[/footnote]
Der Satz erscheint fast beiläufig. Er ist es nicht. Sein Stellenwert erweist sich anhand der Dimensionen von Körperlichkeit in Drawerts lyrischen und essayistischen Texten. Dies liegt an dem autopoetischen Status des zitierten Passus und des Essays. Der Leser Kurt Drawert interpretiert hier einen Text des Dichters Kurt Drawert. Dies wird reflektiert und festgestellt: In „X (Brighton Beach)“, Abschluss des Zyklus „Matrix Amerika“ (2010), lese er, was er im Moment des Schreibens nicht gewusst habe.1 Poetische Texte, so weiter, veränderten Menschen, „weil sie erfassen und gestalten in gleicher Weise, reflexiv und antizipatorisch in einem sind“.2 Bemerkenswert ist diese Auffassung nicht so sehr inhaltlich, bemerkenswert ist sie durch ihren Kontext. Die Interpretation mündet in die Ausstellung eines werkinternen Zusammenhangs. „X (Brighton Beach)“ stehe mit dem Text „Mit Heine“ (1996) in Verbindung. Zudem wird die Entstehung des New-York-Gedichts in „New York against the world“ gezeigt.
Bereits Anfang der 1990er Jahre hatte Drawert in den Zeitmitschriften darüber reflektiert, dass der Körper Ort und Instanz einer solchen Verbindung mit Sprache und auch Text ist. So heißt es in dem Essay „Der Text und der Körper“:
Der Raum der Gefährdung war die Sprache, deren Bestandteile die Grenzlinie des Körpers überschritten, um sich in ihn einzugraben und von innen her zu verändern.3
Die unmittelbare Einflussnahme von Sprache und sprachlichen Gebilden auf den Körper macht demnach das Potenzial aus, in dem jene Variation begründet liegt. Darüber hinaus ist das Maß an Fiktionalität auffällig, das der Leser wie der Tagebuchschreiber Drawert mit „X (Brighton Beach)“ verbindet. Ähnliches gilt für die reziproke Projektion der „Unhintergehbarkeit von wiederholter Geschichte im Augenblick der absoluten Dauer“4 in die Gedichte. Die Bestimmung jener Art der Konvergenz beider Texte lässt das Erfahrungsmoment erkennbar werden, das die Rolle des Körpers als Medium dieser Erfahrung immer wieder, gerade auch in seiner Variation, ausmacht.
Spiegelland. Ein deutscher Monolog 1992 beginnt mit einem Gedicht:
… doch
es muß eine Hinterlassenschaft geben,
die die Geschichte,
auf die ich selbst einmal, denn das Vergessen
wird über die Erinnerung herrschen,
zurückgreifen kann wie auf eine Sammlung
fotografierten Empfindens, und die die Geschichte,
denn das innere Land
wird eine verfallene Burg sein
und keinen Namen mehr haben und betreten sein
von dir als einem Fremden
mit anderer Sprache, erklärt.5
Drawert zitiert das Gedicht komplett in seiner Dankrede zur Verleihung des Uwe-Johnson-Preises 1994.6 Für die poetische Bedeutsamkeit des Körpers ist eine Änderung an diesem Gedicht signifikant. In allen Veröffentlichungen nach 1992 lautet der dritte Vers:
die die Geschichte des Körpers,7
Diese Änderung8 lässt sich zunächst als Hervorhebung des körperlichen Erfahrens und Erleidens von Geschichte, Erinnerung und Vergessen lesen. Nicht allein dieser Bezug kennzeichnet das Gedicht, sondern das Thema bleibt (seither) nachhaltig virulent, bis hinein in den Zyklus „Matrix Amerika“. Der zentrale Begriff ,Geschichte‘ wird spezifiziert, bei seiner zweiten Verwendung (V 7) gibt es keine Ergänzung. Damit wird einerseits zwischen „Geschichte des Körpers“ und „Geschichte“ differenziert und andererseits beiden eine Explizierbarkeit zugeschrieben, die sich an spurhafte Relikte zu binden hat. Die Geschichte des Körpers erscheint so als Summe der von ihm erfahrenen Affekte, Erregungen, deren Hinterlassenschaft durch poetische Texte im wörtlichen Sinn ansprechbar ist. Jenes „fotografierte Empfinden“ scheint auf, da der Leser Drawert sein Begreifen der engen Verbindung von „X (Brighton Beach)“ und „Mit Heine“ benennt und (öffentlich) begreiflich macht. Diese Zuspitzung von ,Geschichte‘ zeigt den Status des Körpers als Rezeptor, Vermittler und auch Speicher von Geschichte als Erinnerung an. Dieser Status bleibt auch unstrittig, wenn die absolute Gefährdung von individuellen Erinnerungsinhalten im Moment des Sprechens und noch deren völliges Verschwinden vorausgesetzt werden muss.
Die Reflexionen in der Johnson-Preisrede beziehen sich auch auf das Verhältnis von Sprache und Körper, hier mit Blick auf die Mächtigen (in dem „kleinen“), hinfällige(n) Land“9):
(…) sie haben reden, nicht aber zuhören gelernt. Diese ihre Stärke aber ist ihre Krankheit, und die Krankheit ist die Verweigerung von Krankheit. Denn der Körper ist ihnen der Feind, wie das Reale der Feind ist, und in der Überwindung des Körpers liegt für sie das Geheimnis der Ewigkeit verborgen und die Chiffre der Macht.10
Die Figuren von Körperlichkeit und deren Durchdringung mit historischen wie gesellschaftlichen Markierungen in Drawerts (lyrischen) Texten verweisen auf die Defizite und Defekte der Moderne. Sie formen schroffe Darstellungen und klarsichtige Diagnosen von Phänomenen, Alltagserscheinungen, abgeschabten Sprachformeln und ihrem nur noch reflexhaft identifizierten Bedeutungsgehalt. Dies gelingt nicht nur durch die hohe Dichte der Versatzstücke aus einer als flimmernd und wenig Orientierung bietend verstandenen Wirklichkeit. Die poetischen Verfahren zeigen Brüche in der Instanz des (sprechenden) Ichs wie im Körper und in der Textwirklichkeit an.
Der Text „Unterwegs“ etwa markiert die Diskrepanz zwischen Körpergeschichte und mitgeteilter Geschichte, ganz so, als verschwände der Körper im Vorgang der Mitteilung:
Unterwegs dann wird die Geschichte,
die meinem Körper gehört,
zunehmend fremder vor der Geschichte,
die ich erzähle.11
Die Wirklichkeit des Körpers, der noch als Instanz eigener Geschichte (und Erzählung) zu gelten hat, entfremdet sich von der sprachlich produzierten. Diese Divergenz im Ich wird in den übrigen Strophen bestätigt und entspricht einer grundlegenden, politisch-historisch beeinflussten Körpererfahrung, die der Essay „Revolten des Körpers“ so fasst:
Mein(e) Grunderfahrung im Osten war die, den Körper verleugnen (oder verdrängen) zu müssen, wollte man im ideologischen System funktionieren, denn die Wirklichkeit (… und damit der Körper) hatte abgeschafft sein müssen, um den Anspruch an Wirklichkeit (… und an den Körper) zu behaupten.12
Diese perzeptive Präzision prägt die Drawert’schen Texte nachhaltig, und zwar als Diagnose einer zeitlichen Verschränkung, die in „X (Brighton Beach)“ – „Aber was ich nicht verstehe, / warum ich die Vergangenheit / in der Gegenwart / als Zukunft sehe.“13 – benannt wird, und als Befund sozialer wie historischer Relationen. Die Texte weisen oft Formeln des ,Alltagssprechs‘ auf, deren gepresst-aufgesetzte Lässigkeit seine Texte offenlegen und zugleich unterlaufen. Dies trifft etwa auf die zerbröckelnden, stenogrammartigen Sprachhülsen des Fernsehens zu, auf die „Quiz“ (2002) anspielt, und auf das Läppische kapitalistisch oktroyierten somatischen Stylings als Marker sozialer Segregation, das „Fit for fun“ (2002) erkennbar werden lässt.14
„Matrix Amerika“ schließt mit seinen Körperimagines hier an. Die Verdichtung von New York ist nicht so sehr elogenhaftes Thema – „Nein, ich schreibe nicht über New York / in New York“15 –, denn stadträumliche Folie. Erscheint in „Fit for fun“ das opportunistische entraînement als selbstauferlegte Körperpolitik zugleich harter und kläglicher Perfektionierung fürs ,selfmarketing‘, so spielt „Matrix Amerika“ die Bilder des (auch körperlichen) Elends und der asozialen Verkommenheit des Kapitalismus vor der Folie New York an und gegen dessen Hochglanz aus.16 Der Körper erscheint etwa als Metapher für den Finanzmarktplatz. In der Text-Matrix oszilliert diese Imago zwischen krankhafter Anfälligkeit – die Kettenreaktionen an der Börse vorgestellt als infektiöse ,Gonorrhoe‘ – und dem „Börsenfick an der Wall Street“.17 Die Körperlichkeit hebt sich von deren thematischem Einsatz ab und erinnert noch an jenen „homo oeconomicus“, von dem Drawert geschrieben hatte, er sitze bei „seinem Psychiater“ und lasse sich „die Zeichen seines abhandengekommenen Körpers erklären“.18 Solches Verschwinden im kapitalistischen Einerlei – eigentlich die Destruktion von Körpergeschichte in Richtung bloß materialistischer Körper-Schichtungen – wird in „Matrix Amerika“ zugespitzt. In „II (Die Mode. Der Schlachthof.)“ zur Fläche für Werbeanzeigen degradiert, kommt der menschliche Körper abhanden, indem er durch Reklame verdeckt wird.19 In „VI (Fabriken)“ gibt es die krasse Reduktion des Körpers auf sein ureigenes fleischliches Material: Ein Mann auf der Straße sagt, der Verkauf einer seiner Nieren habe gutes Geld für seine Familie zu Hause in Sri Lanka gebracht. Er erzählt dies nicht als Abschreckung, sondern im Ton der Empfehlung. Wäre im Fall des Reklameverteilers die Reduktion des Körpers aufs Material noch umkehrbar, wird in „VI (Fabriken)“ eine Schwundstufe somatischer Verdinglichung erkennbar, die sich noch als Kehrseite des „Eingriff(s) in tabuisierte Restzonen“20 (besonders im Fernsehen) erkennen lässt, bei dem Drawert deutlich macht, es gehe „(im Grunde) nicht um Enttabuisierung (…), sondern um die Zurschaustellung des Körpers als ein Geschlecht“.21
Zwischen diesen beiden Polen, dem zur schlichten Ware reduzierten Körpermaterial und der billig-leeren Exposition zeigen vor allem Drawerts jüngere Texte die Rolle von Körperlichkeit. Somatische Instanz der Geschichte, sozialer und politischer zumal, bleibt der Körper weiterhin. Das Sprechen von ihm bedient sich einer Sprache, die nicht mehr nur die Gefährdung des Körpers anzeigt, sondern seine auch gewaltsame Verdinglichung protokolliert. Drawerts (Körper-)Texte insistieren poetisch auf dieser Botschaft, nicht als Zwang, sehr wohl aber mit ihrer beeindruckenden sprachlichen Präzision.
Stephan Krause, aus TEXT+KRITIK: Kurt Drawert – Heft 213, edition text + kritik, Januar 2017
IM DEUTSCHEN PARADIES
für Kurt Drawert (in Rom 1995)
Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart…,
so sollte ich in dieser Schule des leichten und
lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen…
Goethe: Italienische Reise
Ob wir das warn: Fernreisestipendiaten
im Garten Eden Studio 3 und 4
in allen Himmelsrichtungen hohe Mauern
neunfacher Stacheldraht bewacht vom Schutzwall
vor Lebenslust Naturvolkleichtigkeit –
und Leichtsinn mit der Herkunft in den Knochen
ein deutsches Paradies: Zitronen kullern
und Sonnen schweben im Orangenhain
Kieswege strahlendweiß kurz vorm Erblinden
im Schatten ausruhen neben Brunnen die pullern
(es muß dein blondes Pflichtbewußtsein sein
dir strafend neue Verse aufzubinden)
nur nachts kann es in Leitungsrohren pochen
Parkginster knistert eine Eule schreit
und aus den Katakomben zieht ein Schwall
von Schimmelluft wo tote Seelen kauern
ausschwitzen halb ins Bett halb auf Papier
was wir mitschleppten aus zwei deutschen Staaten
die sich umschlungen haben: Millionen
dein Land das morsch in sich zusammenfiel
von Heuchelei und Irrwisch zugeweht
das meine dieser breitbeinige Sieger
das nicht mehr war was es gewesen ist:
Teufel und Tod im Kreuz aus besenreiner
Enge Emsig- und Ergiebigkeit
ein Doppelschwindel dieses Doppelland
(doppelter Schwindel wird vereint nicht kleiner)
sich loszumachen reichte nicht es blieb
unseren Lebensnerven eingebrannt
ich wollte von der Heimat nichts mehr wissen –
du hast dich umso mehr in sie verbissen
ob wir das waren: zwischen Grimm und Spiel
Klatsch Albernheiten und Sprachlosigkeit
bis dich dein blondes Pflichtbewußtsein trieb
vors weiße Blatt (ein Nichts das nie vergeht
und alle Tage unsern Mut zerfrißt)
was dich das kostete: der Schmerz kam wieder
Koliken ohne Ende: Nierensteine
vor meinem Studio wimmernd siech und schief
ob wir das waren: Fernreiseteutonen
auf Pinienalleen bei Fackelschein
noch (halbwegs) jung im deutschen Paradies
das kann nur in der Fremde heimisch sein
aus dem man uns als unsere Frist ablief
mit allen Sinnen Sack und Pack verstieß
Jan Koneffke
Joke Frerichs: Deutsche Zustände
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + DAS&D + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.



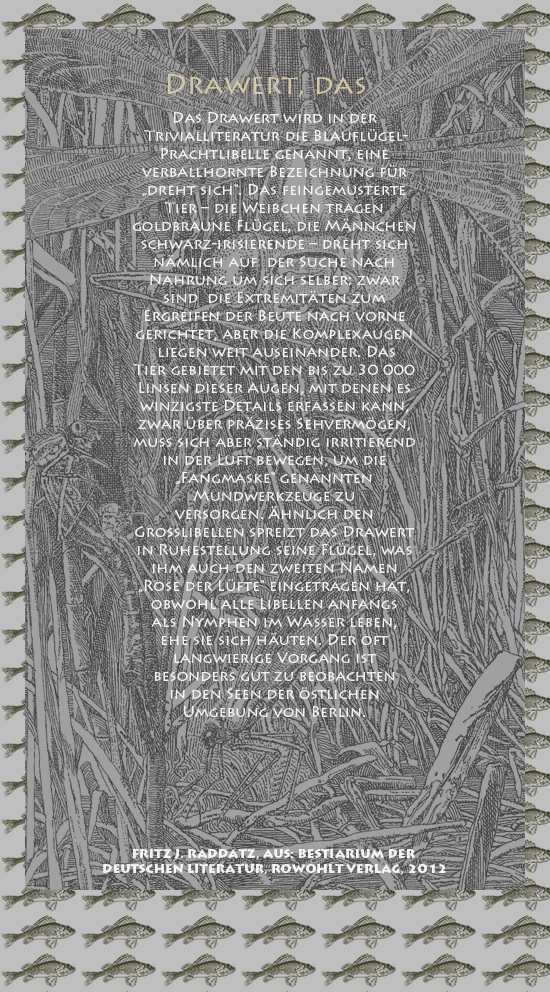












Schreibe einen Kommentar