Leonhard Lorek: Daneben liegen
wir werden juenger
mit gewalt
verschiedene
gestalten
zwischen gut & gern
werden wir
uns entsinnen oder
kreuzweise vorab
beginnen
mit etlichen
marienliedern
auf der zunge
sterben wir knapp
bin ich das &
der trick
mit dem genick
nach vorn
ist zeitlos begehbar
la deutsche vita: sonntagsattentat
fett: zu gehen
Im Dezember letzten Jahres
bekam ich von einer langjährigen Freundin
den liebevoll verarbeiteten Lyrikband Daneben liegen von Leonhard Lorek mit Illustrationen von Gösta Wellmer in einer Berliner Taverne geschenkt. Gestern Abend wurde der Band in der Lettrétage in der Methfesselstrasse 23-25 vorgestellt. Jörg Sundermeier – mir eher als der Autor des „letzten linken Studenten“ in der jungle-world bekannt – ist es als Verleger der Verbrecherei gelungen, Leo Lorek zur Veröffentlichung seiner Gedichte zu bewegen. So kommt das lyrische Debut des bekannten Künstlers mit 52 Lebensjahren möglicherweise nicht gerade früh, ein Beweggrund für die jetzige Veröffentlichung war wohl die Diagnose der aktuellen Krisenhaftigkeit der Gesellschaft.
In einer prekären Phase ist die beste Zeit für Gedichte, es kann wieder neu über Zeit und Wert nachgedacht werden. Für Leo Lorek „haben Gedichte in etwa so zu wirken wie Calgon: Kalk lösend und Verkrustungen aufhebend“. Damit meint er aber nicht, den Leser oder Lesungszuhörer mit allerlei kunstfertiger lyrischer Vortragsakrobatik betören zu müssen. Er überlässt die therapeutische Wirkung seiner Lyrik viel lieber dem geneigten Leser, der den Klang der Buchstaben und Worte im eigenen inneren Selbst zum schwingen bringen möge – quasi als Möglichkeit zum entkalken vermeintlicher Sicherheiten und störender Anhaftungen. Es geht also um ganz praktische Ontologie.
Der Einleitungsessay „Wirtschaft, Tod und zehn Gedichte“ gibt dem Leser einen Kompass in die Hände. Es wird über die Gestalten der Krise, Rimbaud und Brecht die biographische Route zum Erlebnis von Dichtung beschrieben. Den Weg dahin sollte der Leser aber immer selbst beschreiten. Dichtung kann auch nur schön sein, den Bücherschrank vollstellen, den Klang von Smörebröd Rompömpöm annehmen, taubgrüner Ginst im Musenhain. So würde sie aber nichts weiter zur eigenen Beförderung beitragen. In Krisenzeiten brechen Sicherheiten schneller weg, die Seele ist verletzlicher aber auch eher offen für neue Ansichten.
Ein Mensch kann mit seinen Ansichten, Haltungen und Sicherheiten auf zweierlei Weise daneben liegen. Entweder, man hat sich über eine ganze Zeit über etwas hinweg getäuscht und möchte das abändern oder man liegt daneben und ist nur passiver Zuschauer und beweint vielleicht noch seine Opferrolle. Beiden Grundhaltungen kommen die verdienten Gedichte zu. Die Entscheidung trifft natürlich immer der Leser.
Einen geradezu sympathischen Bonus hat Leo Lorek noch in der anschliessenden Diskussion erworben. Es wurde kritisch nachgehakt, warum er seine Gedichte denn nicht vorlesen möchte? Die Lesung bestand aus der Rezitierung des Eingangsessays und eines Gedichts.
Ganz einfach: Die längere Vorleserei von Lyrik ist 1. ermüdend und 2. nicht zielführend. Wenn ein Gedicht beim Leser nicht anklingt, hat entweder der Leser oder der Autor etwas falsch gemacht – oder Beide. Die Vorgabe über eine Autorenvorlesung kann beide Punkte nicht heilen, eher vernebelt sie die eigentliche Vergnügung oder Erschütterung des Lesers. Also: Lorek Lesen, lesen, lesen … sonst rieselt ganz schnell oder schlimmer, ohne dass man es merkt, der Kalk.
http://augenzuppler.wordpress.com, 17.1.2010
DANEBEN LIEGEN oder GLEICH IM GEDICHT WOHNEN
− Nö mal Nö ist gleich Nö. −
Er ist über fünfzig Jahre. Er sieht aus wie ein Musiker. Bassgitarre denkt man sofort, Schlagwerk. Er könnte gut und gerne in der Band Einstürzende Neubauten spielen. Aber nein, Dichter ist er geworden. Dichtet seit nunmehr dreißig Jahren. Hat jung begonnen. Ist mit der Dichtung jung geblieben. Dichtet wie andere Leute von ihren Hunden auf Trab gehalten werden, Gassi laufen müssen. Er trägt Parka mit großer Kapuze, in die hinein sein Jungenkopf verschwindet. Hermetischer Abschluss zur Außenwelt kann das bedeuten, konsequent nach außen hin zum Ausdruck gebracht: Wer da etwas von mir will, komme mir frontal.
Zur Dichterlesung in der Methfesselstrasse sitzt er an einem Tisch im Vortragsraum eines Kleinverlages, das oder die Lettrétage ausgesprochen, je nach dem, ob man sich sprachlich deutsch oder französisch positioniert. Die Crew ist ein blutjunges Unternehmen im Auftrag der Schrift. Die Räume sind flüchtig geweißt, an die Wände bunte Autorenbilder gepinnt, über dem Kopierer reihen sich ein paar Zeitungsartikel, sieben, acht an der Zahl. Nicht sonderlich inhaltsreiche und viel zu auffällig kurze Texte. Erwähnung im Stadtmagazin. Programmhinweise. Randnotizen. Was halt so über einen erst im Jahre 2009 aus der Programmarbeit des Literaturhauses hervorgegangenen Verlag zu schreiben geht, der aus Unvermögen oder in Absicht keine Pressearbeit verrichtet. Der erste verlegerische Streich betitelt sich COVERING ONETTI.I. Zwischen den Deckeln des Sammelbandes versucht sich das Dutzend Jungautoren an dem uruguayischen Großmeister Juan Carlos Onetti, zwingt sich getreu nach dessen Arbeitsanleitung Klaut, wenn nötig. Lügt immer Text ab. Das stolze Buch liegt nun als Ergebnis zum Verkauf auf dem improvisierten Kassentisch aus. In einem Aufsteller daneben sind kleine gelbe Heftchen versammelt, nicht viel größer als Zigarettenschachteln mit schwarzen Bildchen darauf. So an die fünfzig Stück von Wagner über Kapielski zu Winkler. Aber es geht an diesem Abend nicht um die gelbe Serie, sondern um Leonhard Lorek, den über fünfzigjährigen Dichter, der sein wahrhaft spätes Debüt begeht. Titel seines ganz frischen Bandes DANEBEN LIEGEN, für den der Verbrecher Verlag, Berlin die Verantwortung trägt. Er hat die Räume des Jungverlages für die Lesung genutzt. Der Chef höchst persönlich hält eine kurze Rede. Deren Inhalt im Grunde eine Ode an die ihm ins Gesicht geschriebene Freude, es geschafft zu haben. Nach Jahrzehnten. Gegen das bizarr anmutende, permanente Nö des Autoren, der alle ihm entgegengebrachten Angebote von Seiten verschiedener anderer, durchaus renommierter Verlage, strikt ausgeschlagen hat.
Dreißig Jahre Nö und nix als immer wieder Nö zu einem eigenen Buch. Nö zu den daraus erwachsenden Konsequenzen. Ein deutliches Nö an die Vermarktungen. Ein Nö der Eile, weil Dichtung braucht Zeit. Ein Nö dem Sein in der Gegenwart. Gute Gedichte wirken, wenn überhaupt, erst nach dem Ableben der Dichter. Und dabei ist noch nicht einmal raus, ob es je eine günstige Zeit für Gedichte gegeben hat, nach Lorek für Lorek geben wird. Ein dreifaches Nö an den gängigen Literaturbetrieb. Ein weiteres Nö wider den Zwängen. Nö, nö, nö also. Jahrein. Jahraus. Und gleich zu Beginn der Lesung dann auch an das Publikum, das seiner ersten öffentlichen Lesung aus dem Debütexemplar beiwohnt.
Wer etwa von den Anwesenden zu einer Dichterlesung vom Dichter vorgetragen Verse erwartet, sieht sich enttäuscht. Der Dichter beschränkt sich. Der Dichter wird im Verlauf der Lesung höchstens ein Poem vortragen. Darauf hat er sich begrenzt. Das Gedicht, das in sich den Titel für den Gedichtsband birgt, wird am Ende der Übung als Nachspeise serviert, verspricht der Dichter. Das Hauptaugenmerk bei seiner Buchpräsentation widmet der Nöhilist dem Anfangstext des Buches Wirtschaft, Tod und zehn Gedichte. Zwanzig fehlerlos vorgetragen Seiten. Vier-, fünfmal Mittun und Lachen des Publikums, danach Ruhe und Einkehr zu den vielen essayistischen Aussagen. Es geht um Engel, Ordnung, Struktur, dem Vertracktem, dem Aufwand und Nutzen, Depression, Wirtschaft, Krise, Seele, Elend, Seelenelend. Und natürlich um Rimbaud, Liebe, Kummer, Anspruch, Verlaine, Bronnen, Brecht, wie Bonbons, verschwitzte Körper, Seemänner. Die Revolution ist ein Gedöns. Höhen und Niederungen münden in Musikalität. Am Schluss weiß der Zuhörer sicher, dass Matrosen heutzutage keine Attraktion mehr darstellen, das Meer jedoch der Katalysator Nr. 1 für unsere Sehnsucht bleibt (Zitat) seiner Weite wegen, die, anders als die des Universums, für uns als Entfernung fassbar ist, und wegen seiner Tiefe, der Abgründe wegen.Mehrfach bekennt sich der Dichter zu dem, was ein gutes Gedichte seiner Ansicht nach ist: Calgon, Kalk lösend, Verkrustungen aufhebend.
Der Dichter hat schließlich fertig, aus, basta. Es rumpelt im Hirn wie Waschmaschine. Der Dichter sitzt an seinem Lesetisch mit dicken Stummelbeinen, die ans Brandenburger Tor erinnern. Sitzt steif und erwartungsvoll wie eine Quadrigafigur. Das Publikum steift mit. Was das zuvor abgegebene Versprechen anbelangt, ist Leonhard Lorek ihm noch was schuldig. Der Dichter bleibt im Wort, durchsucht nach dem Gedicht im Buch, von dem er meint, es könne von ihm öffentlich vorgelesen werden. Findet eins. Sagt von ihm, dass es anginge. Liest es. Bedankt sich. Flicht ein, dass vierzig Minuten Lesung eine Zumutung sind. Die anderen Gedichte soll sich der Leser bitte sehr allein antun. Er biete sie an und werde sich der an seinen Gedichten interessierten Person nie aufdrängen. Sich dergestalt einmischen: Nö. Jemanden mit dem ihm eigenem Tonfall und Stimmpotential vorbestimmen: Nö. Das müsse einer/eine sich schon selbst abringen. Dafür stünde er als Autor nicht zur Verfügung.
Nö als Haltung immerhin, Nö als etwas Seltenes unter Dichtern obendrein, wird ihm in der anschließenden Diskussion vom Publikum bestätigt und dann sofort ordentlich dagegen moniert. Die große Leserschaft erscheine zu Lesungen, um eben die Interpretation, Modulation des Dichters zu vernehmen. Man möchte doch hören, fühlen, aufnehmen, sich erschrecken oder einlullen lassen. Man habe ein Recht darauf, beim Vortrag in Sprache zu versinken, beharrt eine Frau aus der Zuhörerschaft. Man will eine Stimmung insgesamt mit nach Hause bringen. Man möchte Daheim angelangt doch das Erlebte ins Verhältnis zur eigenen Interpretation setzen können. Die Dichter dürfen sich verdammt nicht so eitel zieren, kokettieren, sondern sollen artikulieren, intonieren, flüstern, tönen, die Zunge führen.
Nö, sagt Lorek abermals. Darum gehe es ihm eben nicht.
Und betet wie gehabt, dass ein Gedicht zu wirken habe wie beispielsweise Calgon. Man müsse nur genügend Calgon in Gedichtsform zu sich nehmen, um genügend Gedichtscalgon parat zu haben, wenn die Verkrustungen nach Calgon und Dichtung schreien. So geht die Lesung schließlich aus. Herzlicher Beifall für all das schöne Drumherum um die lorekschen Nös. Der Frau steht nach Lesung und Diskussion noch eine Weile die Frage ins Antlitz geschrieben, wie ein dichtender Mensch nur so hartnäckig und stur daneben liegen kann. Dann gibt sich das bei der Frau sehr rasch. Ein Buch mehr ist in dieser Welt. Eines mit Gedichten, als ob die es nicht so schon schwer genug haben. Empfohlen von Ihrem Apotheker oder dem Lit-Arzt Peter Wawerzinek
Leonhard Lorek
daneben liegen
144 Seiten
Hardcover
für 19,00 €
Verbrecher Verlag Berlin
So viel wie ich weiß, hat Fontane erst mit viel mehr Jahren auf dem Buckel angefangen. Aber wer ist Fontane, bitteschön.
sc.HAPPY, 2010
Lorek, Jahrgang 1958, ist zwar nicht mehr ganz so jung,
dafür legendär. In den Achtzigern gehörte er zu den wichtigsten Exponenten der Dichterszene vom Prenzlauer Berg, außerdem war er Autor für und Musiker von Bands, die so schöne Namen wie teurer denn je, fett oder la deutsche vita trugen.
Andreas Schäfer, Tagesspiegel
Daneben liegen – poetische Prosatexte
− Leonhard Lorek veröffentlicht erstmals seine literarischen Texte. −
Ostberlin in den 1980er Jahren: Im Bezirk Prenzlauer Berg trifft sich die alternative Künstlerszene der Hauptstadt der DDR. Literaten, Musiker, Theaterleute und Bildende Künstler finden sich in subkulturellen Nischen zusammen und suchen nach neuen, experimentellen Ausdrucksformen. Zu den dichtenden Protagonisten der jüngeren Generation zählt neben Johannes Jansen, Bert Papenfuß und Sascha Anderson auch Leonhard Lorek.
1958 im polnischen Zabrze geboren, machte sich Lorek in jenen Tagen (zudem als Mitherausgeber der Untergrund-Zeitschrift schaden sowie als Texter und Musiker von Bands wie teurer denn je, fett, la deutsche vita oder Deut) einen Namen. Ihre Songs nahmen die Bands auf Kassetten auf. Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist Lorek 52. Aktuelle Stücke seiner Avantgarde-Popband Mendelsson laufen auf MySpace. Literarische Texte von ihm sind erstmals in einem eigenen Band erschienen: „Daneben liegen“ heißt die Sammlung aus Gedichten und Prosatexten, die der Berliner Verbrecher Verlag im Herbst 2009 veröffentlichte.
Ein spätes Debüt, dessen Texte zum Großteil im Ostberlin der 1980er Jahre entstanden sind. Die Gedichte nehmen den meisten Platz ein. Weder alltagsspezifisch noch auf den Zeitgeist ihrer Jahre fixiert, wirken sie nicht in ihrer Entstehungszeit verhaftet. Die Lebensumstände in der DDR werden nicht beispielhaft-situativ thematisiert. Stattdessen gleicht Loreks bildhafte, lesenswerte Lyrik einer reflexiven, poetischen Standortbestimmung, die den fragilen Formen des Daseins nachspürt.
Besonders deutlich wird dies im Gedicht „statement zum flugversuch mit sonett tausendundeins“ aus dem Okober 1983: „die standorte unseres vergrenzens bedingen die grenzorte un/seres verstandes. und unser ich ist ein kommissarisches. und/das kommissarische ich bewegt sich in etueden echt./statisch ist der rahmen der öffentlichkeit. innerhalb dieses rahmens/sich die möglichkeit einer eigenen dynamik zu verschaffen,/ist das ich ein kommissarisches (…)“. Angesichts der übermächtigen Präsenz festgelegter gesellschaftlicher Regeln scheint es unmöglich, eine Identität jenseits dieser Vorgaben dauerhaft zu behaupten und zu entwickeln. Mit nüchterner, fast wissenschaftlich anmutender Gewissheit wird Kritik an den Verhältnissen geübt.
Andere Gedichte ähneln vielmehr einem assoziativen Sog, dem der Reiz des Rätselhaften anhaftet. So heißt es in „statement zur abfertigung von herz und knochen“ (1984): „(…) weise genug mir/ein skalpell zum geburtstag von thomas geschenkt/zu wuenschen das raetsel der platzangst vertikal/aus dem unterarm zu loesen um von amsterdam/aus nicht nur die wolkenkratzer auszumachen wel/che den stoff zum leben hergeben koennten fuer 1/statement zur abfertigung von herz und kochen“.
Im Text „Wirtschaft, Tod und zehn Gedichte“, der den Band eröffnet, bekennt Lorek, dass Gedichte für ihn in etwa so zu wirken hätten wie Calgon: Kalk lösend und Verkrustungen aufhebend. Ein Anspruch, der nicht leicht einzulösen ist. Wer sich auf seine Lyrik einlässt, den erwarten vielschichtige Impulse, sich mit Grundfragen der Existenz auseinander zu setzen.
Lutz Steinbrück, Die Berliner Literaturkritik, 28.6.2010
Spätes Debüt, mit Papierflugzeug in der Tasche
In einem Prosagedicht von Leonhard Lorek, das, in der gedruckten Version, gleich von zwei weiteren Personen unterzeichnet wurde und noch heute wie eine Absichtserklärung klingt, finde ich überraschenderweise eine Floskel wieder, die im Ostberlin der Achtziger (oder auch nur am Prenzlauer Berg) in der Luft gelegen haben muss und von Lorek und seinen Mitstreitern (zwei imaginären Protagonisten?) aufgegriffen wurde: den Begriff eines „kommissarischen Ich“.
Was ein „kommissarisches Ich“ um diese Zeit auch bedeutet haben mag: Sieht einer den Humor an der Sache, denkt er zuerst vielleicht an einen schrägen Popsong von Falco und die Refrainzeile „Der Kommissar geht um“, Ironisierungen amerikanischer Fernsehserien wie „Columbo“ oder „Einsatz in Manhattan“ – oder den Detektiven Leonhard Lorek, der besagte Floskel spannend und aufregend gefunden haben muss und umgehend in ein Gruppen-Gedicht oder gedichtähnliches Statement einbaute. Eine gewisse Vorsicht ist dabei jedoch geboten. Betrachtet man es nicht so wertfrei wie es zu dieser Zeit noch möglich war und im literatur- bzw. zeitgeschichtlichen Kontext der Neunziger, fällt einem sofort Wolfgang Hilbig ein, der diesen Gemeinplatz als Zitat seinem Roman „Ich“ voranstellt.
Einen Exkurs, bevor ich mich weiter in Loreks Buch hineinbewege, möchte ich der besseren Verstehbarkeit halber hier unternehmen. Denn die Querelen, in welche das Ich (ohne die Anführungszeichen, als Stilfigur) nach dem Erscheinen von Hilbigs Roman geriet, waren gravierend und führen bis heute zu Irrtümern und Diffusionen, die fast schon wieder zum Fundus der Literaturgeschichte gezählt werden können. Hilbig – und seinem Erfahrungshintergrund nach ist das verständlich – mochte das postmoderne Ich nicht, wenn damit ausschließlich Mummenschanz betrieben wurde und jemand nicht zu dem stehen musste, was er schrieb. Er torpedierte diesen Ansatz gelegentlich auch vor Erscheinen des Romans Ich – doch wenn die Öffentlichkeit bis dahin so gut wie keine Notiz davon nahm, so geschah das um so heftiger, als zwei Autoren der Prenzlauer-Berg-Szene als informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit enttarnt wurden. Mit einem merkwürdigen Nebeneffekt: Das Kunstprodukt „Ich“ wurde auf einmal generell mit einem Dokument verwechselt. Autoren, die sich im Umfeld von Hilbig befanden oder befunden hatten, schließlich auch Schriftsteller, die aus dem Osten kamen und mit einem poetischen Ich ausdrückten, gerieten plötzlich, wenn auch nur unter dem halbseidenen Siegel der Verschwiegenheit, gleich mit unter Verdacht, wenn nicht für das System als Spitzel gearbeitet zu haben, so doch wenigstens unter einem blasierten Ego zu leiden.
Und dazu noch etwas. Nach dem Fall der (innerdeutschen) Mauer, schon kurz nach dem Erscheinen des Romans Ich, als Hilbig in der Kleinstadt, aus der wir seinerzeit stammten, wieder regelmäßig zu Besuch war, kam es bei einem gemeinsamen Freund einmal zu einer Gesprächssituation, in der ich ihn darauf hinzuweisen versuchte, dass er mit dem (für die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit) zu wenig austarierten Blick auf die Stilfigur auch für alle nachfolgenden Autoren, die dasselbe Recht darauf haben, mit ihrem poetischen Ich so spielerisch umzugehen wie er das als junger Mann für sich selbst eingefordert hatte, die Tür mit verschloss. Zwischen uns war nie ein lautes Wort gefallen, es fiel auch in dem Moment keines, und von meiner Seite her kann ich den ihm neuerdings nachgesagten Jähzorn auch nicht bestätigen. Auf das, was ich zum Ausdruck brachte, reagierte er eher mit Verwunderung, da er wusste, dass ich schon während meiner Armeezeit ähnliche Beschädigungen hinnehmen musste wie er sie selbst zur Genüge erfahren hatte, und mir das, was er mit diesem „Ich“ beschrieb, auch nicht annehmen musste, da es mit mir nichts zu tun hat. Ob das Gesagte in ihm etwas in Bewegung brachte, lässt sich für mich nur schwer bzw. überhaupt nicht sagen. Was ich meinte, galt in einem gewissen Sinn jedoch ebenso für ihn und sein eigenes Handwerkszeug. Er musste in Betracht ziehen, dass der theoretische Hintergrund, den er beim Schreiben mit im Blick hatte, von der Öffentlichkeit so nicht geteilt wird, es ihm auch selbst geschehen kann, dass die Öffentlichkeit (oder Teile des Feuilletons) sich einen seiner Texte nimmt, diesen ganz und gar nicht in den von ihm angedachten Kontext überträgt, die Inhalte den Bedürfnissen der Zeit entsprechend anpasst, wie es seinem Roman Das Provisorium zwei Jahre nach seinem Tod widerfahren ist.
Auffällig ist, dass die Schlingerbewegungen, in die das lyrische Subjekt / poetische Ich in der Literatur der Nachwendezeit geriet, bei vielen Lyrikern nicht zu übersehen sind, und bei den meisten interessanterweise erst durch das interkulturelle Großereignis Jahrhundertwende langsam wieder auflösen. Die Möglichkeiten, die sich die Autoren zur Selbstbefragung oder Reflexion noch zugestanden, blieben (mit Ausnahme derer, die verstummten) beschränkt auf eine gewisse Engführung der Stilfigur, so zum Beispiel das permanente Monologisieren, den Kunstgriff, sich mit dem Zweiten Personalpronomen im Singular als Du anzusprechen, das Ich bzw. lyrische Subjekt vollkommen zum Verschwinden zu bringen und dabei mehr oder weniger zum Medium zu erklären. Für den ein oder anderen (in der Vermischung der genannten Möglichkeiten) führte das zur rigorosen Abwendung vom Ästhetizismus; andere (und auch das gehörte, wenigstens in Ex-Ost-Deutschland, während der Hoch-Zeit postmoderner Ausdrucksformen zum Machbaren) verfolgten weiterhin die relativ risikofreie Variante, den Mummenschanz zu bedienen, frei nach der Devise: Ich ist irgendwer, den ich nicht kenne. Die einfachste Möglichkeit indessen war auch der schwierige Weg: die entsprechenden inneren Spannungen auszuhalten, bis das poetische Ich durch und durch reflektiert war.
Leonhard Lorek war von den Zerwürfnissen der Neunziger als Autor möglicherweise schon nicht mehr betroffen. Soweit sich sein Lebensweg anhand der spärlich zur Verfügung stehenden Lebensdaten nachvollziehen lässt, hatte er Dederanien schon zwei Jahre vor dem Mauerfall verlassen und lebte in Westberlin. Es ist anzunehmen, dass er sich von der Literatur verabschiedet hatte, denn die Verbindung zu den meisten Weggefährten aus dem Prenzlauer Berg scheint bis weit in die Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer vollständig abgerissen gewesen zu sein. Zumindest sucht man seine Arbeiten vergeblich in den beiden wichtigen, in den Neunzigern bei Galrev erschienenen Anthologien Vogel oder Käfig sein und Abriss der Ariadnefabrik, die bis heute als eine empfehlenswerte Zusammenfassung der Samisdat-Literatur gelten können, allerdings nur einen Einblick in den Großraum Ostberlin zulassen – und so soll an dieser Stelle, gerechterweise, wenigstens auf die Tatsache hingewiesen sein, dass die Wirkung der Prenzlauer-Berg-Literatur (mit Ausnahme von Papenfuß und Schedlinski) durch das Nord-Süd-Gefälle, das im Osten vorherrschte, ziemlich begrenzt war, nicht jeder jüngere Autor im Inland, der mit Sprache experimentierte und laborierte, den Samisdat-Zirkeln angehörte oder dem Fußvolk des Prenzlauer Bergs zugeschlagen werden kann.
Die ersten Arbeiten von ihm bekam ich zufällig zu lesen, bei Jayne-Ann Igel, die ich damals hin und wieder in ihrer Leipziger Wohnung besuchte, und bei einem Glas Palinka (einem Obstler, den wir seinerzeit gern tranken) in den raren Westbüchern blättern durfte. Zwei davon, die Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung (Kiepenheuer & Witsch 1985) und Sprache & Antwort (Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1988) gehören heute ebenso zu den Standardwerken der ehemals hochgelobten (und schon damals nur teilweise unabhängigen) neuen Literatur im Osten der Achtziger. Es waren beides Veröffentlichungen, denen bereits durch die Tatsache, dass es zeitgenössische Literatur war, der Hauch des Gefährlichen stärker anhing als den weitgehend vom Hörensagen her bekannten modernen Autoren Burroughs und Lautreamont – die der gewöhnliche Leser im Osten genauso wenig zu lesen bekam wie die Zeitschriften der Samisdat-Szene.
So wenig Gelegenheit damals war, die Bücher genauer anzuschauen, reichte die Zeit, eine Reihe der Texte wenigstens anzulesen. Loreks Arbeiten fielen zunächst durch ihre Machart auf oder, genauer gesagt, durch das experimentierfreudige Verfahren, mit dem das Schriftbild eines Textes organisiert wird. Trotz der Flüchtigkeit, mit der ich die Texte von ihren Inhalten her wahrnehmen konnte, überzeugte mich das, wenn ich heute auch einräumen muss, dass die formalen Aspekte durch ihre leichte Kopierbarkeit von späteren Lyrikern oft unreflektiert übernommen worden sind und dahingehend vielleicht eine gewisse Stereotypie mitbringen. So passiert es mir heute zuweilen, dass ich Texte, die von der experimentellen Seite her an die von Lorek erinnern, mit einem leichten Schulterzucken wahrnehme, weil die Form sehr oft aufgesetzt wirkt und als avantgardistisches Element durch das, was dort sprachlich geschieht, nicht unterstützt wird.
Worin der Unterschied zu Loreks Gedichten besteht, kann ich aus seinen Arbeiten erst heute langsam herauslesen, die – wenn auch als sehr spätes Debüt – unter dem verzweigten Titel daneben liegen vor gut einem Jahr im „Verbrecher Verlag Berlin“ erschienen sind. Freilich ist es nach wie vor der aus der Seitenbreite herausgenommene und auf Spaltenbreite gebrachte Blocksatz, der dem Leser ganz zuerst auffällt und (in etwa / der Einfachheit halber) so beschrieben werden kann, dass dabei nicht zwangsläufig das letzte Wort am Ende einer Gedichtzeile in die entsprechende Formatierung des Blocksatzes gezogen wird. Hin und wieder bleiben einzelne Buchstaben oder halbe Worte aus dem weitgehend interpunktionsfreien, in sich fortlaufenden Text ohne Trennzeichen stehen, und der Rest des (in sich zerschnittenen) Wortes ergibt durch den abenteuerlichen Umbruch auf der nächsten Zeile manchmal einen überraschend neuen Sinnzusammenhang.
In der Publikation lässt Lorek an der ein oder anderen Stelle jedoch etwas genauere Einblicke in bestimmte Formen der von ihm bevorzugten Montagetechniken zu. So erweisen sich manche seiner Gedichte und Prosagedichte als Konglomerate von eigenen Aussagen und fremden Statements, die er auf eine Art überblendet und miteinander verschleift, dass sie noch heute wirken, als spricht dort jemand, der nicht eine Sekunde Zeit zu verlieren hat, sein Gegenüber zu überrumpeln gedenkt oder ihm gar nicht erst die Möglichkeit zu einer Antwort lassen möchte.
Angenehm ist, dass Lorek auf Lyrismen und allzu viel technisches Bumm-Bumm verzichtet und dem Anspruch Rimbauds, man müsse absolut modern sein, nicht in marktschreierischer Variante, sondern mit selbstironischer und humorvoller Attitüde nachgeht. Man kommt bis heute ins Schmunzeln, wenn zum Beispiel Volker Braun als Dichter unter seiner Telefonverbindung, quasi nur noch als Nummer und Ziffernfolge bzw. als Soundsovielter vorkommt, die Entdeckerfreude sich aber ohnehin dermaßen zu überschlagen scheint, dass (unkenntlich gemachte) Zitate von Oskar Schlemmer bis hin zu unbekannteren (oder erfundenen Protagonisten) des Prenzlauer Bergs eingearbeitet werden. Einsprengsel, von denen man an keiner Stelle sagen kann, sie würden sich dem Textfluss nicht inhaltlich unterordnen. Das Verfahren funktioniert nur im Zusammenspiel der größtmöglichen Ansammlung von Unwägbarkeiten und erinnert bei denen, die es darin zur Meisterschaft gebracht haben, kaum an die Arbeitsweise der Surrealisten, Textschnipsel durch die Luft zu werfen und sie neu zusammenzusetzen. Bei Lorek wird die anarchische Grundhaltung höchstens noch dadurch gesteigert, indem er auch davor nicht Halt macht, einen Querstrich unter die jeweils vorletzte Zeile vieler Texte zu ziehen und diesen Querstrich zu unterbrechen. Die Schlusszeile erinnert dann an die Ausformulierung eines mit arithmetischen Mitteln gewonnene Ergebnis, das der Lösung einer Rechenaufgabe in Sprache gleicht. In einer weiteren Variante wird der halb geöffnete Querstrich aber schon wieder unter die erste Zeile des Gedichts gezogen, dass man sich fragt, ob das Gedicht in dem Fall nicht vielleicht sogar aus einer zuvor errechneten oder anderweitig entstandenen Summe heraus entwickelt wird.
Insofern erreicht auch der Buchtitel daneben liegen, der einem der zuletzt entstandenen Gedichte entlehnt ist, eine gewisse Fächerung. In seiner Vieldeutigkeit verleiht er der Publikation nach außen hin Statik, während das gleichnamige Gedicht (das monologisch als auch dialogisch gelesen werden kann) die Statik eher verneint. Das „daneben liegen“ bildet den Schluss des Gedichts, das jedoch schon vor dem halb durchgezogenen Querstrich der letzten Zeile in der Aufforderung mündet: „dreh dich mal / vom meer zum sand / und zurück / vom sand zum meer / und bleib daneben liegen“. Für mich als Rezensenten fast schon ein Alibi, mich innerhalb der Besprechung des Buches mit keinem der Texte Loreks näher zu beschäftigen, zumal im daneben liegen nicht nur die Facetten stecken, die durch die monologischen und dialogischen Bezüge abgedeckt sind, sondern auch die Nebenbedeutung, dass einer mit dem, was er sagt, daneben liegen, seine Interpretation völlig daneben sein kann und die vom Autor anvisierte Bandbreite der möglichen Konnotationen und Assoziationen vielleicht zu wenig hervorhebt. Grund genug auch, den Leser (und das durchaus im Sinne Loreks) zu ermutigen, zur Bedeutungsfülle der Texte zu meditieren und sich dabei von keinem sagen zu lassen, so und nur so könne ein solcher Text gelesen werden.
Ein geringfügiges Manko sehe ich darin, dass die Zusammenstellung im letzten Drittel des Buches Lücken in der Kontinuität aufweist und der Abstand von Gedicht zu Gedicht extrem sichtbar wird. Zwar beschreibt Lorek im einleitenden Essay die Gründe und Beweggründe für seinen zeitweiligen Abschied vom Schreiben so präzise wie nachvollziehbar und verweist darauf, dass das Schreiben von Gedichten an den Faktor Zeit gebunden ist – in dem Sinn, dass einer viel Zeit mitbringen und investieren muss, wenn er ein gutes Gedicht bzw. einen poetischen Text zustande bringen möchte. Nur lässt mich dabei der Eindruck nicht los, der Autor hat unter der Prämisse weniger ist mehr bei der Auswahl der vorhandenen Texte zu häufig selbst die Schere angesetzt.
Mehr als interessant (und auf ihre Art offen und aufschlussreich) sind hingegen die deutlich ausformulierten Haltungen, die Lorek im begleitenden Essay zum Leben und Schreiben, zum Leben mit und ohne das Schreiben äußert und ihn als einen Zeitgenossen charakterisieren, der zu den Lektionen, denen er nachgeht und nachging, auch reflektiert. Haltungen, über die man gewiss geteilter Meinung sein kann, und die dennoch nicht leicht von der Hand zu weisen sind.
Mit einer Ausnahme. So würde ich der Ansicht, Brecht und Rimbaud als Egomanen zu bezeichnen, doch widersprechen wollen. Bei Rimbaud ganz einfach durch die Tatsache, dass er die Literatur fast noch als Jugendlicher hinter sich zurückgelassen hat und es während der Adoleszenz ganz sicher zur Normalität im Verhalten von jungen Menschen gehört, davon auszugehen, dass sich die Welt um sie zu drehen hat. Es sei denn, man betrachtet Rimbauds Fortgehen aus der Literatur tatsächlich nur als Produkt einer früh abgeschlossenen Selbstfindung, und nicht gleichermaßen als Konsequenz auf die Liaison mit Verlaine oder auch eine ganze Reihe von Befindungen, die in der Summe vielleicht zu einer seelischen Schieflage geführt haben, dass ihm nur dieser eine Ausweg geblieben war / möglich schien. Nur ist es dann auch leicht möglich, das Fortgehen (den Fakt an sich!) als Ausdruck von Egomanie zu werten, und noch leichter, per Kurzschluss eine Analogie zwischen Egomanie und der Berufung zum späteren Waffenhändler herzustellen.
Bei Brecht verhält sich die Angelegenheit noch schwieriger. Es ist kaum in Abrede zu stellen, dass er über weite Strecken Integrationsfigur war und seinen Mitbewerbern und Zeitgenossen gegenüber fair verhielt. Doch vielleicht ist es tatsächlich nur eine Frage, wie unterschiedlich man einen Begriff definiert, oder aus welchem Blickwinkel die Brechungen einer anderen Künstlerbiografie gesehen werden. Lege ich das Gewicht auf die hässliche Bemerkung, mit der Brecht sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt über den in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit gerade aufstrebenden Benn hermachte (der doch so viel menschliche Größe bewies, manche der Prostituierten, die zu ihm in die Arztpraxis kamen, kostenlos zu behandeln, ihnen im ein oder anderen Fall noch die Kohlen für den Winter bezahlte), entsteht sofort ein anderes Bild. Ein Bild, das eine Facette von vielen darstellt oder auch eine der Nachtseiten Brechts ausstellt – wie jeder einzelne Schriftsteller sie zur Genüge mitbringt (als etwas, das man nicht ausschließlich unter dem Storybord Menschliches, Allzumenschliches abhaken kann).
Eine Egomanie – darin sehe ich eher Verfestigungen (Verknöcherungen) der Art, wie Fritz Riemann sie in den „Grundformen der Angst oder die Antinomien des Lebens“ beschrieben hat. Seiner Beobachtung oder Definition nach (die ich hier nur sehr vereinfacht wiedergeben kann) ist ein Mensch seelisch dann weitgehend intakt, wenn es innerhalb seiner charakterlichen Grundmerkmale im Alltagsverhalten mental zu leichten Verschiebungen kommt und jemand auf eine Situation angemessen, manchmal aber auch emotional und sehr unterschiedlich reagieren kann. Gelingt ihm das nicht mehr, reagiert er oft immer gleich unangemessen und nähert sich innerhalb der Parameter eines der vier Grundcharaktere (des Melancholikers, Sanguinikers, Phlegmatikers, Cholerikers) nicht selten auch einem psychotischen Verhalten.
Ablagerungen wie Engramme (Erinnerungsinhalte, Gedächtnisspuren im weitesten Sinn) sind damit wohl eher nicht gemeint. Man könnte andernfalls das etwas burschikose Loreksche Statement „Für mich haben Gedichte in etwa so zu wirken wie Calgon: Kalk lösend, Verkrustungen aufhebend.“ auch so verstehen, dass neben den Menschen, die ein Traumata erlitten haben und dieses Trauma mit einem gut gemachten Gedicht aufgelöst haben wollen, bald auch Leute vor der Waschmaschine Schlange stehen, die sich durch den gepflegten Hang zur Verdrängung auszeichnen.
Möglicherweise habe ich an dieser Stelle jedoch eine Unschärfe aus dem Weg zu räumen, die ich vor einigen Jahren selbst erzeugt habe. Ich benannte die in der deutschen Literatur von Zeit zu Zeit aufflammende Subjektfeindlichkeit als Gegensatz zur Subjektbesessenheit in Form der Egomanie – wobei ich bei letzterem zwar die Verknöcherungen im Blick hatte, doch das nicht näher und genauer ausführen wollte. Ich muss mich dabei insofern korrigieren, dass mentale Verfestigungen nicht unbedingt etwas mit der Stilfigur Ich oder dem lyrischen Subjekt zu tun haben müssen, sondern nur dann, wenn sie darin zum Vorschein kommen / darin zum Ausdruck gebracht werden; und logischerweise können von den mentalen Borniertheiten ebenso sehr Menschen betroffen sein, denen eine Subjektfeindlichkeit eigen ist.
Von seinem Gesamteindruck her ist Leonhard Loreks Gedichtband eine gelungene Publikation, und das nicht einfach deshalb, weil damit das Bild von der Prenzlauer-Berg-Literatur um eine wichtige Facette erweitert und vervollständigt erscheint. Lorek ist durch und durch Poet, seine Gedichte sind durchgearbeitete Gebilde und haben sich ihren angenehm frischen, in keiner Weise aufdringlichen Ton bis heute bewahren können.
Was mir darüber hinaus wichtig scheint: Es ist kaum anzunehmen, dass daneben liegen das letzte Buch aus den Achtzigern und Neunzigern war, das bisher keinen Verleger gefunden hat bzw. hatte. Die Gründe dafür mögen so vielfältig sein wie die Widrigkeiten, mit denen es Dichter zu tun bekommen, wenn sie den ästhetischen Vorstellungen des Marktes (als einer vorgeschobenen Illusion, denn es gibt diesen Markt für das Genre Gedicht schon seit zwanzig Jahren nicht mehr) weder entsprechen können noch entsprechen wollen.
Ein Dichter / Poet / Lyriker kann dabei so wenig auf die Entdeckung durch einen Talent-Scout setzen wie es sich für ihn lohnen wird, auf das Feuilleton zu warten. Manchmal besteht ein Funken an persönlichem Glück darin, dass einer nach der Zeit fragt mit der Ellipse: Warten, worauf? – Sich bemerkbar zu machen ist zur Realisierung eines Buches also unter Umständen die halbe Miete. Siehe Leonhard Lorek. Ein verspätetes Debüt? Sicher. Doch dafür eins mit Papierflugzeug in der Tasche, wie man es nachlesen kann, in einem seiner Gedichte.
Tom Pohlmann, poetenladen.de, 3.12.2010
Der knirschende Kiefer erzählt
Der Prenzlauer Berg war in den achtziger Jahren ein Widerstandsnest, in dem viele Dichter gegen das Regime anschrieben. Leonhard Lorek war einer von ihnen. Mit seiner Sprache versucht er sich kritisch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse einzulassen, zugleich stöbert er in den Wortspeichern des Argots und des Slangs:
geh ueber kaltleim
& kohlen
die knochen
brechen
& recht
behalten denn
nur wer lack hat
kann
die puppen tanzen
lassen
Das Gedicht solle Verkrustungen lösen, Festes wieder flüssig machen, schreibt Lorek in einem kleinen poetologischen Essay. Allerdings wirkt ein Gedicht noch nicht lösend, nur weil in ihm Fäkalsprache ausgestellt wird. Und Loreks politischer Impuls erschöpft sich immer wieder in Texten, die das Politische mit Pointiertheit verwechseln:
Just in madeira
leben
im dax
zunge im arsch
und das ganze
noch mal
Besser sind jene Gedichte, in denen Lorek für seinen Stoff eine in sich bewegliche Form findet und davon träumt, seinem großen Dichtervorbild, „der ratte rimbaud zu begegnen“.
Nico Bleutge, Stuttgarter Zeitung, 12.3.2010
übrig bleibt aufzutauchen
− Leonhard Loreks Gedichte – Essay. −
I. Prologiker
ist kein
koerper zerdroschen genu
g zart zu fuehlen was unaa
antastbar bleibtaaaaaaaa
zum glu
eck des einenaaaaaaaaaaa
ist keine
haut duenn genug dahinte
r zu steigen fort bleibeaaa
n zu koennenaaaaaaaaaa
ist keine z
aeh genug auszuhalten wa
s keinen rueckhalt brauca
ht frei zu seinaaaaaaaaaa
zum glue
ck des anderenaaaaaaaaa
Die folgenden Fragestellungen sollen ausgehend von der Qualität der Vorgaben entfaltet werden. Leonhard Loreks seit 1983/84 geschriebenen Gedichte sollen paradigmatisch einen veränderten Zustand lyrischer Aneignung zu beschreiben ermöglichen. Im Vordergrund steht dabei mein Erkenntnisinteresse als Leser.
II. Ideologetiker
Sprachkritik ist Ideologiekritik, demnach immanent denunziatorisch. Ein Freischaufeln authentischer Ausdrucksmöglichkeiten, Pionierarbeit. Denn das Ausdruck-Finden ist kein Privileg, keine Problematik ausschließlich des Dichters, sondern eine allgemeine des europäisch zivilisierten Menschen. Ausdruck ist kein Luxus; oder genauer: der Luxus der Menschen eines bestimmten historischen Stadiums der Kultur und der Aufklärung; des mathematisierten und verzifferten Lebenszusammenhangs unter der Diktatur der allgemeinen Sinndefinitionen der Existenz. Genau auf diesem Feld haben die Medien ihre infantilisierende Wirkung, und diesen psychosozialen Acker zu entsteinen, die Sprache wieder aufzurauhen für menschlichen Gebrauch, macht(e) sich sprachkritische Dichtung zur Funktion.
III. Aporetiker
Zugleich ist damit ihre Grenze umrissen, nämlich Präparation zu sein, der die Analyse des Materials / der Wirklichkeit erst folgt. Aber wie geht das im Gedicht? Was steckt im Text, der von sprachlicher Intensität herkommt, aber darüber hinausgehen will, in Richtung auf eine Sprache, die eine eigene Wirklichkeit gewinnt? Kategorien stehen zur Verfügung wie: Erfahrungsdruck, Ausdruckshunger, Neugier. Hilflosigkeit ist an ihnen unverkennbar, will man zu schlüssigen Differenzierungen kommen. Deshalb kann im folgenden nicht mehr als die Dokumentation einer Annäherung gegeben werden, der Versuch, textuelle poetische Strukturen begrifflich aufzunehmen und zu bewegen. Wie auch umgekehrt: begriffliche Bewegung an Gedicht-Wirklichkeit zu überprüfen. Denn letztendlich bleibt als rezeptive Kategorie der Bewertung nur die Erlebnishaftigkeit des Textes, und wie man bei Kafka nachlesen kann, ist das Erlebnis das eigentlich nicht zu Beschreibende, „& darueber hinaus / stolpern die aussagen“.
IV. Empiriker
Texte, die als Erlebnisse, als Prozesse zu lesen sind, deren Ende am Anfang noch nicht feststeht, deren innere Spiralstruktur die Dialektik von Erfahrung nach- bzw. vorspielt, die auf Abenteuer aus sind, auch als solche zu lesen sind; Texte, die, indem sie mein Sprachbewußtsein provozieren, zugleich darüber hinaus meine Erlebnisfähigkeit / Wahrnehmungsehrlichkeit in Frage stellen und damit, in dem sie simultan wirken, zum Erlebnis werden. Loreks Texte drängen auf Abenteuer – Rimbauds Ankommen im Unbekannten.
V. Vitaliker
Die traditionelle Frage, mit der Gedichte konfrontiert wurden/werden, ist die nach dem Ich. Tatsache scheint zu sein, daß eine überkommene Art quasi-authentischen Aussagens, unmittelbarer (bzw. im Gewande von Unmittelbarkeit daherkommender) Selbst-Aussprache eines „betroffenen“ Ich erledigt ist. Das 19. Jahrhundert läßt sich auch in der Lyrik nicht ohne Peinlichkeit reanimieren. Aber ebenso augenfällig ist eine veränderte Position des Ich im Text. Dabei mußes nicht explizit auftreten, entscheidend ist die Weise, in der sinnlich-erfahrende und sprechende Aussage-Indices sich in die Wirklichkeit und in die Sprache des Gedichts begeben, einen Text formend, im empirisch-existenziellen wie im sprachlichen Sinne. Loreks lyrisches Ich (das verbindet ihn mit anderen) existiert jenseits des chimärischen Kollektivismus früherer Generationen, deren Subjektivität durch ein Aufgefangensein im sozialen oder historischen Kontext gleichsam relativiert wurde; sowohl in Entwurf wie Verantwortlichkeit. Kein „naives“ Ich sieht sich mit einer Welt als Erlebensraum konfrontiert, träumt sich Befreiung oder sieht sich zur Selbstzurücknahme gezwungen, sondern: Das Ich ist nicht selbstverständlich, oft auch ein reduziertes („willst du / gottlos gluecklich sein / suche mich // ich liebe dich / ich bin der zweite / mann im tross“), ein versehrtes, aber es zelebriert sein Versehrt-Sein nicht. Klage und Anklage sind ihm fern. „Zerfallen ist eine Identität der Erfahrung, das in sich kontinuierliche und artikulierte Leben“, das einzig es erlaubt, sich zum Zentrum einer Wirklichkeit zu erklären. Demgegenüber bestimmt sich Loreks Ich gewissermaßen negativ, indem es, Wirklichkeit (auch sprachliche) synthetisierend, zu sich selbst eine Versuchshaltung einnimmt: „und das kommissarische ich bewegt sich in etüden echt“. Über die Sinndefizite (vor allem ideologischer Abkunft) kann so ein Zipfel Utopie festgehalten werden.
VI. Emphatiker
Leonhard Loreks Gedichte wollen keine Gefühle zeigen (im landläufigen Sinn), eher zeigen sie, wie Gefühle innen aussehen. Spricht aus den Texten anderer oft eine metaphysische Traurigkeit, eine Angst (die sich oft als Ohnmacht ausdrückt), stellen Loreks Gedichte den Mechanismus der Angst vor: Angst als psychologisches Pendant der, pardon, Entfremdung: „hin / & wieder sind wir / alle eheliche kinder / im eksil / landläufig / kontaktarm & / stark / genug / … / dann / & wann ist mein / hueben / mein drueben / …“. Solche Texte sind bedingungslos zeitgenössisch (ohne einer Modernität hinterherzuhecheln), indem sie sich auf einen Zustand des Ich einlassen, in dem es als geschichtsphilosophische Kompetenz unerheblich geworden ist, dies aber erlebt als ein An-Dauern. Darum wird das Ich auf neue Art wichtig; in Gedichten wie „ist zeitlos begehbar“ muß es sich, nicht ohne Brutalität, selbst definieren, indem es ein Vieles an Möglichkeiten ist, die den Tod einschließen. Nicht die Möglichkeit des Ich-Sagens schlechthin ist sein Problem, sondern die Behauptung einer Vitalität jenseits der (falschen) Geschichte: „& ich hab ein gesicht / & brauch es nicht“.
VII. Chaotiker
Lorek ist kein Forschungsreisender ins Unbewußte, in die Nebel des Traums. Rauschhaftes Sich-Steigern findet nicht statt, die Intensität kommt anderswo her, aus einer trockenen Hitze, sensitiven Erregtheit. Seine Texte sind leicht entzündbar, keine Entzündungen selbst, diese auslösend, möglicherweise; beharrlich, ohne auf eine Pointe zu zielen (entsetzliche Vorstellung), ein Quellungsprozeß, auftreibend im Bewußtsein des Lesers. Nicht funkelnd und sprühend, sondern insistierend auf jenes Chaos, das unter der ordnenden Hand des Regulativs „sozial-historische Erfahrungswelt“ nicht nur schwelt, sondern dessen Bedingung bleibt, das unter der durch die Bedingungen der vermittelten Wahrnehmung (Kindheitsmuster, Bildung, Ideologeme) planierten Wirklichkeit aufscheint. Chaos nicht als Unordnung, sondern als selbst strukturierte Gegebenheit, die erkennbar/denkbar/ahnbar ist, als der wilde Zusammenhang der Dinge, dessen Spitzen wie Nadelstiche in die scheinbar festgefügte Erfahrungswelt spießen.
VIII. Erotiker
Liebesgedichte, wie ein Durchlöchern der Wünsche, der Utopien, mit denen wir umgehen, wie giftige Pfeile in die Ideale einer verlorenen Zeit, die sich ins Heute gerettet haben: „luege auf den ersten / blick zurueck / folgt nichts / als angst // folgt kein zweiter / …“. Grenzerweiterungen des Bösen, destruktiv in Mephistos Manier, kaum je erotisch, oder wenn, dann die Erotik auflösend in eine Sentenz wandspruchartiger Knappheit: „weinst du mich / in dich hinein / lass es sein / so wie es ist / haben wir uns / im griff“. Das zitierte Gedicht „stell mich still“ produziert eine sprachliche Ästhetisierung, die das Erotische aufgesogen hat, es übersetzt in das System von Leichen des Textes. Die Sinnlichkeit hat sich vom Vorgang abgelöst und siedelt jetzt im Kopf/Text; so kann Schönheit behauptet werden.
IX. Dialektiker
Maximal entfernt vom Schwulst, von expressionistischer Nachfahrenschaft, finden die Texte ihre Wahrhaftigkeit im Kampf, der bekanntlich der Vater aller Dinge sei, in der ungelösten, unlösbaren Spannung (zwischen Dingen, Sachverhalten, Verhältnissen, Worten, Sprachebenen, Gesten sprachlicher und nichtsprachlicher Art). Und dieses in der Struktur Enthaltene muß nicht beschrieben werden, würde zur Lüge sonst. Das Umkippen des Textes, nicht ins platte Gegenteil, sondern von Fall zu Fall, von Aussicht zu Aussicht, und alles im Prozeß eines Sachverhalts, scheint mir dialektisch. In solcher Verfahrensweise scheint die seltsame Möglichkeit auf, Wittgensteins Satz: „Wovon man nicht reden kann, darüber sollte man schweigen“, eine Wendung ins Positive geben zu können: das Erschweigen von Wahrheit. Erkenntnis nicht zwischen den Zeilen in Sklavensprache, sondern zwischen den Worten, als das Verhältnis, das Worte zueinander einzugehen in der Lage sind, so wie sie zwischen den Menschen erst im Verhältnis zueinander, nicht im „vereinzelten Einzelnen“ entsteht. Eine neue Art der mimesis ließe sich so entwickeln: strukturelle Wahrheit. Texte erschließen sich vorrangig über Wortbeziehungen, weniger über einzelne Wortbedeutungen; der zweite, fünfte oder achte Blick entziffert eine Semantisierung der Strukturen, einen inneren Ablauf, eine Wendung der Worte, durch die Inhalte entstehen über die einzelnen Bedeutungen hinaus. Dieses semantische Möglichkeitsfeld erzwingt auch beim Leser einen Pluralismus des Ich.
X. Ästhetiker
Viele Gedichte haben von sich aus eine Affinität zum Ikonischen; das meint nicht sprachliche Graphik, sondern sprachinterne Übertragung graphischer, bild-bildender Fun ktionsweisen.
XI. Linguistiker
Metaphern im traditionellen Sinne von Uneigentlichkeit/Stellvertretung kommen nicht vor. In einem Gedicht wie „im wertwandel der wolkenkratzer“ gehen sie nicht von Vergleich oder Analogie aus, sondern entwickeln sich aus dem Wort. Das heißt, die mataphorische Beziehung wird nicht vom Ding / der Sache getragen, sondern primär aus den Bedeutungen/Nebenbedeutungen des Wortes hervorgebracht; „die standhaftdes widerstan/ds“, oder: „in den mietskasernen derst/einreichen stadt“. Dadurch gewinnt Sprache eine Wirklichkeit, die sich der Erfahrung gegenüberstellen läßt. Eine Selbstbewegung des Sprachlichen findet statt (die es in Loreks Texten auch gibt, wenn der Text vorrangig vom Assoziativen oder Semantischen des Worts weitergetragen wird, z.B. im ersten Teil von „wolkenkratzer“), Sprach-Geburten, ein Sich-Einlassen des Ich auf ein Bewußtseins-Abenteuer, für das Sprache ein eigenes Erfahrungsfeld definiert, das aber nicht sich selbst genügt, sondern, in dem Klischees abgefragt werden, Wendungen gewendet und Erwartungen irregeführt werden, auf einen Zustand des Ich zurückweist, der als permanentes Suchen erscheint. Das Nichteinhalten des syntaktisch Notwendigen, die mehrfache Bezüglichkeit des Wortes auf Vorheriges und Nachfolgendes, das Abbrechen des Sprechens und Wiederaufnehmen in einem anderen Sinnkontinuum (ohne daß der Text zum dichterischen Dokument von Sprachstörungen, Stottern, Aphasie, mißrät), Mechanismen der Wortantithetik, oft in scheinbar falschen, ungewöhnlichen Zusammenhängen, all dies bringt Räume in die Texte, die der Leser ergreifen kann, wobei er die Dominanzen selbst zu setzen hat (:Demokratismus).
XII. Strukturiker
Das weitgehende Fehlen einer ausladenden Metaphorik, das Zurücktreten des assoziativen Moments bewirkt eine Gerichtetheit der Texte (vor allem der kleineren), denen somit jede Unmittelbarkeit einer diffusen Primär-Wahrnehmung, jede flächen- oder raumgreifende Weite fehlt. Im Gegenteil waltet zumeist ein Zug innerer Logik und Notwendigkeit, die die Sprachkompetenz des Dichters unterstreicht, die sich nicht auf das Buchstabieren einer (fremden) Welt, auch nicht auf das parataktische Nebeneinander schwarzer oder schmutzigbunter Visionen zurückwerfen läßt. Denn im sprachlichen Impressionismus der (Wort-)Bild-Collage wird ein autonomes Ich zumindest als Beobachter unterschoben. Im Prozeß der Gedichte Leonhard Loreks erweist sich gerade dies als Illusion; ein sprachmächtiges Ich hat sich in den Bewegungen von Sprache und der in den Sprechablauf hineingerissenen Wirklichkeiten erst zu entfalten: „sterben wir knapp // bin ich das & / der trick / mit dem genick / nach vorn // ist zeitlos begehbar“. Loreks Texte lassen sich geradezu beschreiben als der permanente Versuch einer Überwindung des verbindungslosen Nebeneinander (sicherlich eine moderne Grunderfahrung) der Dinge und Menschen, als das Nicht-akzeptieren-können einer nichtstrukturierten Erfahrungswelt.
XIII. Poetiker
Ein Text wie „koepfen“ enthüllt eine Poetik des bewegten Wortes. Er variiert nicht einen (mehrere) Gedanken (Ideen) in ornamentaler Gewandung, metaphorischer Ausschmückung, ist nicht an eine vorgegebene Wahrheit und Bedeutung gebunden, seine Sprache ist nicht nur Vehikel des Gedankens / der Konstellation, sondern zugleich auch deren Erzeugung. Das destruktive Moment der Zerstörung von Sinnganzheiten ist Voraussetzung einer Konstruktion, die auf die Herstellung einer neuen Identität der Erfahrung zielt.
XIV. Dynamiker
Auffällig ist bei Loreks Texten eine eigentümliche Form der Hypotaxe, die sich nicht in Satzgefügen ausdrückt (keine Kommas im Text), sondern in einer Art anarchischem Miteinander, das Spielraum läßt für die Entfaltung der Bedeutungspotentiale auch der untergeordneten Einheiten. So entsteht bei aller Emanzipation der Teile (Verse, Satzeinheiten, Wahrnehmungs- und Erfahrungsebenen) zu jeweils eigenbedeutenden, ihr zwingendes Gewicht entfaltenden und einbringenden Ganzheiten kein disparates Kauderwelsch, sondern eine spannungsgeladene Struktur. Der Text zerfranst nicht in ein unentschiedenes Spiel-Feld von Umkehrungen, vielmehr baut sich eine Textur auf, deren Verflechtung zwar Spiel-Raum läßt, aber doch zwingend einer selbstgesetzten Logik folgt. Anstelle ausufernder Verdünnung ins Beliebige entsteht so Verdichtung im Textuellen wie Nicht-Textuellen der Interpretationshöfe. Damit im Zusammenhang steht oft eine augenfällige sprachliche Kargheit der Gedichte, kein Reduktionismus zwar, aber eine Technik des Abbruchs, des Zusammenziehens unterschiedlicher Aussagen und Sprechrichtungen, woraus eine z.T. brisante Dynamik entspringt, eine Atemlosigkeit, die zugleich die Suggestivität der Sprechabläufe bewirkt.
XV. Katalogiker
Seltsam wenige Dinge bevölkern das Universum der Gedichte: es ist, als wolle Lorek die den Texten immanente Denk- und Erlebensbewegung nicht von zu vielen Dingen umstellen lassen, die eine statische Komponente einbrächten, die Bewegungsräume vollstellten und so die Abläufe behinderten. Wenige Konstellationen mit Dingen werden etabliert, in denen ein Ich sich selbst erfahren könnte, in denen die traditionelle Subjektbesetzung der Dinge, die Metapher, eine Subjekt-Objekt-Relation suggerierte, über welche die überkommene Rezeptionsweise von Lyrik, die Einfühlung, sich herstellen könnte. Wie wenig Loreks Gedichte mit solchen Funktionsweisen zu tun haben, zeigt einerseits, wie weit hier von einem konventionellen Begriff von Lyrik abgegangen wird, und verweist andererseits auf eine Konzeption, die auf ganz anderes aus ist als auf kathartische Effekte.
XVI. Semantiker
Indem Worte und Strukturen, Textelemente und vor allen deren Dynamik semontisiert werden, soll eine kulturelle Hierarchie an Werten, Sinnbesetzungen und -zuordnungen destruiert werden. Die subversive Energie der Texte richtet sich auf die elementaren Bedingungen der Wahrnehmung selbst: Raum, Zeit, Bewegung. Durch die weitgehende Dingarmut und die beschriebene, nicht im Bildhaften, sondern im Sprachlichen wurzelnde Metaphorik kann nicht entschieden werden, ob der Raum innen oder außen, groß oder klein ist. Er ist lediglich Raum für die Bewegungen und Wechselfälle des fortschreitenden Sprechens. Raum wird segmentiert (in Sprechakten) und zusammengezogen für die Konstruktion eines Lebens-Raumes, der den humanen Gesetzen des sprechenden Ich folgt: „… gar abwegig gen / ug bleibt die unverschae / mtheit zu sich zu finden // letztendlich den koepfen“. Ebensowenig folgt die Zeit der Gedichte dem Ablauf einer Uhr, einer historischen Abfolge; Zeitraffer und -dehnungen schaffen Platz für die mögliche, wie auch immer haarig ausfallende, Überwindung der sozialen Negation des Ich: „ich bin eine blutende haemorrhoide / im baerenfell am arsch der welt / wo pfennigweise kindergreise / sterben eh der groschen faellt“.
Insbesondere die Lied-Texte, die hier kaum in Rede standen, überwinden eine noch im „Sonett“ und anderen früheren Texten herrschende Formdominanz, zeigen eine Souveränität im Umgang mit dem Material an, ein völlig uneitles „Konspirieren mit der Sprache“, deren Tricks und Effekten.
XVII. Soziologiker
Eine dezidiert und unaufgesetzt plebejische Sicht (auf Tradition und Gegenwart) verzichtet auf jeglichen Moralismus; ein sprachliches Jakobinertum richtet sein Interesse vorzüglich auf Objekte, die eine bestimmte Schwelle an Niedrigkeit nicht überschreiten dürfen; nicht kraftmeierische Vulgarismen einer zitierfähigen Brutalo-Sprache, sondern eine (groß-)städtische Kultursprache verwertet Worte vorgeblich banaler Zusammenhänge, stürzt sich neugierig (und das ist eine Botschaft) in die Erfahrungswelt der Straße. Eine Vitalität schlägt zu Buche, eine Phantasie von unten, die ihre Herkunft aus einer plebejischen Subkultur (der vielberufenen zweiten Kultur) nicht zu verleugnen braucht, angesiedelt in den Grauzonen der ,modern times‘, eine Vitalität, die bei allen Reduktionen sich der Larmoyanz ebenso verweigert wie der Metaphysik: „sag ich hab schiffe falten an / gefangen in der fahrtrinne ein / es eisbrechers“.
XVIII. Historiker
Der Anspruch, aus Literatur etwas Neues über die Welt und den Menschen zu erfahren, die Wirklichkeitswahrnehmung zu erweitern, muß nicht aufgegeben werden. Allerdings ist es eine entzauberte Welt, der Schleier vor den Augen der Göttin ist herunter, und wir starren in unser falsches Spiegelbild, anwesend wie nie, an Nullpunkten, die Absprungpunkte werden können, nicht Landepunkte (Endpunkte): „wir werden juenger / mit gewalt / verschiedene / gestalten / zwischen gut & gern“.
Peter Böthig, schaden, Heft 8, Dezember 1985
gefahrenklasse a 1
− eine im nachhinein konkretisierte passage eines gespräches egmont hesse – leonhard lorek. −
spurensicherung
gespräche stellen, wo sie existentiell werden, den „prozeß und die verwirklichung eines werdens“ (gilles deleuze, claire parnet) dar. nicht systeme und deren machtstrukturen werden geformt, sondern die ständige veränderung am objekt (oder des subjekts) wird aufgezeigt, um sinnzusammenhängen ausdruck zu verleihen. ohne den anspruch, grundsätzlich den beweis einer angenommenen vorstellung zu führen, werden, statt definitionen, formeln hypothetisch aktiviert. fühlen, wissen, anspruch; und die unbestimmtheit hat eine möglichkeit als fragment. dabei ist es problematisch, sich mit den mitteln des erkennens zu erklären, und dennoch notwendig, in einem gespräch, das den anspruch erhebt, sich ohne „standortmanifestation“ zu bewegen.
vom allgemeinen zum jetzt speziellen:
als ich mit leonhard lorek über dichtung und schreiben diskutierte, fiel in einem peripheren zusammenhang der begriff „gefahrenklasse a 1“ („vielleicht sollten wir frequenzen verursachen, die unsere sinne vorgeben, nicht erfassen zu können, ungewöhnliche frequenzen, die im zusammenspiel anders wirken; du weißt, was ich meine…“). mit dieser textindikation war der hinweis auf den brandsatz einer sache gefunden, die sich noch immer am deutlichsten durch ihre brisanz auszeichnet.
auf loreks texte und seine textauffassung, sowie die daraus resultierende abstrahierung allgemeingültiger ansätze zu einem eigenen sprachmodell, sind wir eingegangen, seiner sprache im gedicht adäquat, eine weitere zu schaffen, die eine verständigung hierüber ermöglicht. mit meinen fragen – in die richtung gestellt, in der ich ihre freisetzung erwartete – zielte ich letztendlich auf loreks ich(-verständnis) und dessen stellung im text, die ich für wesentlich halte, will man mit den gedichten eine begegnung, um zu verstehen. die sehr direkte „gangart“ des gesprächs trifft sich in dieser form mit loreks schritten, „übers eis zu gehen“.
Egmont Hesse: ist es schon wieder oder immer noch und jetzt besonders wichtig, über sprache zu sprechen?
Leonhard Lorek: das pathos dieser fragestellung geht mir nicht besonders nahe, aber eine diskussion um die substanz halte ich immer für angebracht; wir gehen doch in der und mit der sprache ganz unerläßlich um.
Hesse: seit mehreren jahren läßt sich ein erweitertes sprachbewußtsein feststellen. worauf ist das zurückzuführen?
Lorek: … wenn in den auslaufenden siebziger jahren gerade hier ein anderes (für uns damals neues) sprachbewußtsein lokalisiert werden kann, so hat das sicher mehrere ursachen (retrospektiv sind die vielleicht besser zu orten und zu verstehen). ohne simplifizieren zu wollen, scheint mir dabei ein aspekt besonders bemerkenswert…
womit wir uns so schwertun und was hier geläufig als gesellschaft verstanden wird, ist totalitär ambitioniert und bemüht, ebenso zu funktionieren. die hierzulande seit kriegsende bis dahin, im selbstverständnis konstruktive literatur war im spektrum ihrer mittel im allgemeinen konservativ (auch dann, wenn sie aggressiv war). daß so etwas situationsbedingt angebracht ist, kann durchaus sein; nur: wir haben eine andere beziehung zur situation. ich spreche vom wir eines teils der jüngeren autorengeneration, welches zu dem zeitpunkt im eigenen selbstverständnis noch zutrifft, inwiefern ein solches wir aber bis jetzt seine gültigkeit bewahrt hat, kann ich nicht schlüssig beantworten… der individualisierungsprozeß des wortes innerhalb der texte war ein, an und für sich, anarchischer akt der befreiung (komisches pathos), das resultierende sprachbewußtsein eine folge der wechselbeziehung zwischen verbalem anarchismus und den textstrukturen. das bedingte ebenso die ermittlung einer anderen stilistik… die problematik ist beständig, die beziehung aber, so hoffe ich, allgemein, weiterhin in der entwicklung begriffen. sprachbewußtsein – die naheliegende intensivierung von text und denkstrukturen – weniger momentabhängige texte – die selbstbewußte beanspruchung einer mondäneren gangart. vielleicht hatten wir etwas nachzuholen… es reicht aber perspektivisch nicht mehr, sich allein auf das wort zu konzentrieren; und wie suspekt mir der begriff vom logischen denken auch sein mag, ein lediglich philologisches hätte mich, und nicht nur als autor, in ein knock out arrogiert. eigentlich ist es auch falsch, von vornherein vom sprachbewußtsein zu reden; wir sollten davon ausgehen, daß das sprachbewußtsein aus einer wortbewußtheit resultiert, welche neben den traditionellen textstrukturen einherging. mir ist der text komplex wichtig (und seine entstehung). und da ist ein spektrum der bestandteile, und ich bin (mittlerweile) an einem demokratischen miteinander der komponenten interessiert.
Hesse: demokratisches miteinander“ – ein politischer terminus, der bisher in wohl jedem system, wo er verwendung fand, letztendlich versagte; wie ist das zu verstehen?
Lorek: … ein allgemein gültiges scheitern müßtest du mir schon beweisen. wenn die ursachen einer anders akzentuierten literatur auch politische sind, warum soll dann der prozeß nicht an einem politischen modell erörtert werden? für mich ist es uninteressant, allein um einen zustand, oder nur eine erscheinung, bemüht zu sein. der prozeß ist (retrospektiv, perspektivisch, in der analyse und in der praxis) ein wesentliches problem.
Hesse: gehen wir auf deine texte zu. beim lesen hatte ich oft den eindruck, daß sich mit jedem wort jeweils der gesamte text in seiner aussage dreht, ähnlich einer spirale.
Lorek: … drehen. sagen wir einfach: er bewegt sich. er / bewegt / sich. die spirale ist als bild nicht annehmbar, dann wäre das eine kanalisation; kanalisiert in eine bewegungsrichtung. und diese eineindeutigkeit ist nicht gegeben… die kettenreaktion wäre ein treffenderes modell. eine reaktion, die ich steuere, die aber nicht allein aus meinen, letztendlich subjektiven, manövern resultiert. ich setze den prozeß in gang (da ich erfahre, staune, verunsichert bin, vergesse, wahrnehme,…), ich bewege mich mit dem material selbstverständlich, oder genauer: um ein selbstverständnis bemüht. das ist eine identitätsfrage, ohne daß der text immer eines frontalen ich bedarf (welches mir oft jeden zugang versperren würde).
Hesse: hängt das mit der art deines schreibens zusammen, die ja doch zum größten teil und im wesentlichen ein erschreiben ist?
Lorek: mit dieser komponente bestimmt. das ich ist dem verfahren oft so immanent, daß ich es gar nicht als solches einfügen brauche.
Hesse: innerhalb deiner texte existieren zwei bewegungen; die bis zu einem gewissen punkt vertauschbaren aussageinhalte und die genau durch den sprachstil festgelegte art ihrer anordnung. würdest du es als verfehlt ansehen, schreiben, ganz abstrakt, als ein ordnen von worten zu betrachten?
Lorek: wenn man schreiben letztendlich nur als das ordnen von wörtern verstehen würde, könnte bestenfalls ein synthetisches produkt entstehen, aber kein organisches gebilde. wilhelm fränger führt einen seltsamen vergleich, um die struktur der radierungen von hercules seghers begreifbar zu machen, und spricht vom rätsel der instinkt-geometrie, die (grundrißlos und ohne gliederung und mitte) architekturen wachsen läßt statt baut, die sich nach allen seiten endlos spannen, wenn nicht der zufall eines festen rahmens sie beschränkte. als ein organisches gebilde aber brauche ich meine texte, in ihrer störanfälligkeit, in ihrer aktions- und reaktionsfähigkeit.
Hesse: stört dich das wort „ordnen“, weil es in seiner bedeutung immer ein schubfachdenken assoziiert?
Lorek: ja, ein anderer terminus müßte für einen solchen bewegungskomplex gestellt werden; auch halte ich es nicht mehr für ausreichend, von inhalt und form in einem flächenmodell zu sprechen.
Hesse: … mallarmé sagt: „verse macht man nicht mit ideen, sondern mit worten“; kann ein wort gedanken ersetzen?
Lorek: verse…, da trifft es im detail zu. was aber deine frage angeht; in der totalität – nein. wörter können weder profan, noch in der konstellation, und selbst dann nicht, wenn sie eine veränderung ihrer gebräuchlichen substanz erfahren (ein metamorphes verfahren) gedanken ersetzen. aber sprache sollte so intensiv sein (zumindest die, die ich brauche), daß sie das, was denkbar sein könnte, ermöglicht. die sprache gibt gelegenheit, spannungsfelder (mit einer ihnen eigenen frequenz) zu schaffen, die nicht mehr mit sprache aufzufüllen sind (schon, weil wir die wörter nicht haben, und ich weiß gar nicht, ob sie notwendig sind…). und wenn schedlinski meint: „die diktatur der sprache über das denken ist nicht mehr zu brechen…“, bin ich zunächst einmal gar nicht von einer solchen absolutheit betroffen. die, wenn auch mittels sprache, geschaffenen spannungsverhältnisse, die entstehenden räume, sind nicht durch sprache ersetzbar. unser ganzes denken ist nicht von sprache okkupiert, denn die situationen, die zwischen den wörtern existieren, sind durchaus denkbar, nicht nur empfindbar, also auch außerhalb der sprache existent.
Hesse: aber noch einmal zurück zu deinen texten. daß worte mit ihrem selbstwert durch andere worte in ein aussagesystem gebunden sind, ist normal; nur, in deinen texten erfahren beide positionen auf engstem raum eine dimension, die voraussetzung für eine weitere dimension ist, die ich hier phantasie nennen möchte. nehmen wir zum beispiel „aufeinander verlassen“. hier treffen sich nicht nur zwei worte, sondern geraten in vielerlei hinsicht aneinander, wollen nicht zusammenpassen, aber trotzdem…
Lorek: eine suggestive kraft…, die mir wichtig ist. durch reagieren und agieren entsteht ein beziehungskomplex, dessen resultate assoziativ wirken. um all das, was zwischen und wegen „aufeinander verlassen“ möglich ist, in einem (zum beispiel) prosatext detailliert zu beschreiben, wäre ein aufwand nötig, der mich behindern und langweilen würde. es ist unmöglich, solche kombinationen in alle zulässigen einzelvarianten aufzuschlüsseln; das würde so vieles nehmen. als leser bliebe mir doch nur der nachvollzug meiner phantasie, der text wäre nicht mehr anregend. ich bin an beiden möglichkeiten der bewegung von phantasie interessiert (der passiven des nachvollzugs und der aktiven der kreativität auf grund, z.b., einer assoziation.). nur gibt es bei mir kaum texte, die rückwärtsgewandt sind, d.h. in denen ich mich ausschließlich erinnere. was ich hinter mir habe, kenne ich mehr oder weniger gut, und ich kann mich darin, bei bedarf, recht frei und auch sicher bewegen; ich habe kein interesse daran, solches zu vermitteln.
Hesse: du bist mehr er- als vermittler?
Lorek: das angebot hinkt, aber wenn ich vermittle, dann den ermittlungsprozeß. ja.
Hesse: du weißt also kaum, was dich beim schreiben erwartet?
Lorek: nein. ja. doch. ich habe angst vor der konsequenz des erstellten materials, vor dem eigenen text.
Hesse: zwingend wäre in diesem zusammenhang die frage: denkst du an leser?
Lorek: ich bin der leser. ich bin plural, obwohl in unserem denkmodell das absolute ein punkt ist.
Hesse: ein loch.?
Lorek: nein, ein brennpunkt, ein resultat einer selektiven verdichtung von punkten. (je mehr wir verdichten, um so weniger einzelpunkte sind zu lokalisieren) und bevor wir in diesem punkt ankommen (kommen wir nie! an), können wir die punktzahl komprimieren.
Hesse: ist bewegung für dich das thema?
Lorek: … wenn es das gibt, für mich, dann ist es eine sehr lebendige bewegung, eine konstruktive (ohne destruktive bestandteile überhaupt nicht denkbare). und ziele, gibt es, ein absolutes, nicht in der form erreichbares (das glück, und nicht auf kosten anderer).
Hesse: wir reden immer noch von deinen texten…
Lorek: ja, ich habe gesagt: es gibt keinen identitätsantagonismus „text – lorek“.
Hesse: aber du bist trotzdem nicht der text.
Lorek: quatsch… ich bin ich.
Hesse: und „ich ist ein anderer“.
Lorek: … das ist immer der fall, nur versuchen wir, einander näher zu kommen. und der reiz des näherkommens (nahe seins) ist viel größer, als die angst vor den strapazen unterwegs (gangart). dabei bin ich das „&“.
Hesse: seine quantitative dominanz in deinen texten gäbe dir mit baudelaire („um die seele eines dichters zu durchschauen, muß man in seinem werk diejenigen wörter aufsuchen, die am häufigsten vorkommen. das wort verrät, wovon er besessen ist.“) recht. das „&“ ist demnach ein schlüsselwort für dich?
Lorek: ja, und es gibt schlüssel (schlüsselwörter) zum „&“.
Hesse: dieses wort charakterisiert somit auch deine position innerhalb der verhältnisse, welche im text geschaffen werden, und kennzeichnet sowohl den standort des dazwischenstehens (-tretens, usw.), als auch den schritt des weitergehens… &… &…?
Lorek: reden wir statt von einer position von der situation… dazwischen, und mehr dazwischen als inmitten, da es um bewegung geht und nicht um eine standortmanifestation…
Dieses Gespräch wurde im August 1985 geführt.
Erschienen in: Egmont Hesse (Hrsg.): Sprache & Antwort. Stimmen und Texte einer anderen Literatur aus der DDR, S. Fischer Verlag, 1988.
„Nur 95 Prozent?“
– Leonhard Lorek befragt Thomas Blume. –
Nach dem ersten Gespräch mit Leonhard Lorek, beim Bier in einer Westberliner Kneipe, entstand die Idee, daß Loreks Sicht auf die DDR, seine Erfahrungen und Denkweise deutlicher würden, wenn er mich befragte.
Das Gespräch, zu dem wir uns dann ein paar Tage später trafen, ist nicht ,informativer‘ geworden als die ,alten Geschichten‘, die Lorek bei der ersten Verabredung erzählt hatte.
Für mich ist es eine Suche nach Denk- und Verhaltensklischees, eine Verunsicherung, auf die ich mich einlassen wollte. Und mir bleibt das Gefühl, daß wir ständig aneinander vorbeigeredet haben, nie ,auf den Punkt‘ gekommen sind.
Keine Botschaft?
Thomas Blume
Leonhard Lorek: Über die Gegenwart lohnt es ja eigentlich nicht so viel zu reden. Denn wenn das Ganze publiziert wird – wie lang ist Euer Vorlauf?
Thomas Blume: Ein halbes Jahr…
Lorek: Sehr amüsant, wo die Zeiten doch so hastig sind. Okay. Du hast gesagt, viele Leute wissen nicht, was diese Autoren gemacht haben, wie sie gelebt haben, warum sie so gelebt haben, was sie für Probleme hatten, vor allem wie sie sich selbst verstanden haben, warum, wieso die gegangen sind usw. Daß wir den Spieß jetzt umgedreht haben, daß ich Dich befrage, hat auch damit zu tun, daß ich in der DDR in den letzten Jahren mit solchen Leuten, die nicht wußten ,wie, was, wo‘ eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte. Insofern ist es für mich schon interessant. Als ich noch ordentlich gearbeitet habe, so ein richtiger Schlosser war, hatte ich mit Arbeitern zu tun. Die wußten nicht unbedingt über Literatur bescheid und wie Literaten so leben, aber die wußten.
Blume: Die wußten was? Da müßtest Du schon genauer sein. Ich habe nicht gesagt, daß der größte Teil der DDR-Bevölkerung völlig naiv ist, und alles was passiert ist, jetzt auf diese Art bekannt gemacht und aufgearbeitet werden müßte. Mich interessiert eine bestimmte Art Öffentlichkeit, die in der DDR außerhalb der Institutionen existierte.
Lorek: Das Nicht-Wissen und das Wissen spielen ja in der DDR zur Zeit eine große Rolle. Vor allem hat nach meinem Eindruck eben niemand nichts gewußt, und dennoch wurden alle ganz schrecklich betrogen. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hab ich gesagt, die DDR wäre für mich interessant wenn 95% der Bevölkerung zurücktreten würden. Ihr fragt ja jetzt ganz verschiedene Leute. Sarah Kirsch zu kennen, war kein Problem. In DDR-Bibliotheken waren ihre Bücher zugänglich. Woher kennst Du Leute wie mich zum Beispiel?
Blume: Ich wußte natürlich von der Existenz dieser ,Szene‘.
Lorek: Wodurch?
Blume: Durch Freunde, die gesagt haben: in der Kirche liest an dem Tag der und der. Und ich habe auch mal bei ‘nem Verkauf in einer Kirche einen schaden gesehen. Aber ich habe eigentlich nicht ,dazu gehört‘. Auch über Rockmusik und bildende Kunst, Performances, wußte ich, daß Leute wie Du existieren, daß die Sachen ganz interessant sind und politisch von den offiziellen Leuten als dubios angesehen werden. Zwar geduldet werden, aber nicht allzugern gesehen sind. Und was sich so rumspricht, an der Uni habe ich von der Sache mit dem Peter Böthig gehört, dem wohl gesagt wurde entweder beim schaden mitmachen oder Forschungsstudium.
Lorek: Nun bist Du ja auch ein offizieller ,Leut‘. Zumindest gewesen, in der Zeit, um die es jetzt geht. Du hast Dein Studium gemacht, Du warst in der Ordnung, Du warst ordentlich. Du warst normal, hast einer gültigeren Norm entsprochen, als der, in der ich mich bewegt hab.
Blume: Ja.
Lorek: Was hast Du Dir eigentlich vorgestellt, was es da außerhalb dessen, worin Du unterwegs warst, gab?
Blume: Es ist nicht so, daß der Bereich, in dem Du gelebt hast, eine mir vollkommen fremde Zone war. Ich wußte schon ungefähr, was da abläuft. Also ich bin ab und zu zu solchen Sachen gegangen, hab mir zum Beispiel Papenfuß und Faktor angehört oder bin relativ häufig zu Rockkonzerten gegangen. Sicher habe ich die Entscheidung weniger zu Lesungen und häufiger zu Rockkonzerten zu gehen, ganz bewußt getroffen. Einfach weil der Druck der existierte, diese „gestockten Widersprüche“, da mehr auf den Punkt gebracht, auf die Spitze getrieben wurden, in Punk-Konzerten.
Lorek: Wurde da mehr auf die Spitze getrieben, oder war das einfach problemloser, weils nicht verbal artikuliert war?
Blume: Da wurde auch verbal artikuliert. Die Texte hast Du ja zum großen Teil verstanden.
Lorek: Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob Du Dir einen Döring-Text anhörst, oder ihn liest. Und bei der Musik, die da abgelaufen ist, hast Du das Zeug ja nicht lesen müssen.
Blume: Nein, mußte ich nicht. Das war vielleicht eine bequemere, auf jeden Fall eine andere Art der Rezeption.
Lorek: War Pop-Musik in der DDR, auch die nichtoffizielle, nicht eher ein Kundendienst für einen Frustrierten, als es Literatur auf der Ebene, in der wir die gemacht haben, sein konnte?
Blume: Das ist eine Frage, die die Pop-Musik denunziert. Ich denke nicht, daß eine Wirksamkeit auf Leute immer gleich mit einem inhaltlich niederen Anspruch verbunden sein muß.
Lorek: Ich will nicht mit ,hoch‘ und ,niedrig‘ operieren, sondern mit Sachlichkeit. Für mich ist zum Beispiel Liedermacherei in der DDR in den letzte , 7–8–9–10 Jahren der totale Kundendienst gewesen. Sag den Leuten, wie beschissen es ist, und alle sagen: Oh wow, so isset! Jede Portion Eigenverantwortung wird dir abgenommen. Und das ist bei Pop-Musik, nicht in dieser schmierigen Form, aber auch in einer nicht so anstrengenden Art, wies mit der Literatur gewesen wäre, auch abgelaufen. Du hast da ein Gemeinschaftserlebnis, bist mit anderen Leuten zusammen, so daß deine Eigenverantwortung relativiert wird. Mit Literatur bist du mehr oder weniger alleingelassen. Es sei denn, auf einer Lesung, wo du aber eh nur einen Bruchteil dessen mitkriegst, was da abläuft. Wo der Transportverlust weitaus größer ist, als bei Musik.
Blume: Der Unterton Deiner Frage ist, ob nicht die Leute in der Rezeption von Pop-Musik weniger aktiviert wurden. Was aber ein schiefes Bild voraussetzt, weil das vollkommen verschiedene Arten der Rezeption sind.
Lorek: Du hast aber beides im Gespräch in den Zusammenhang gebracht.
Blume: Und meine Entscheidung war dann eben, mich weniger für diese Literatur zu interessieren. Vielleicht weils anstrengender, aber auch weils für mich langweiliger war. Vielleicht weil dieses Erlebnis einer Gruppenidentität nicht da war. Kann sein, daß es eine DDR-Krankheit ist, daß man nicht alleingelassen werden will. Daß man, wenn man schon was Verbotenes macht, das mit anderen zusammen machen will.
Lorek: Ging es da nur um das Verbotene oder um das Zusammen oder besser, das Beieinander?
Blume: Ich denke schon, es ging um, meinetwegen ein ,Beieinander‘. Eins der Phänomene in der DDR war doch, daß Du vertikale Strukturen hattest, in denen Du Dich bewegt hast, wo Du versucht hast, was anzuschieben. Aber daß durch die Art der Organisation der Öffentlichkeit immer verhindert wurde, daß Du eine Rückkopplung hast, ob viele Leute so denken wie Du, oder ob Du ein schillernder Vogel bist, der bloß ’n flitz hat und einen am Großteil der Leute vorbeigehenden Anspruch.
Lorek: War das eine Hinterfragung einer Sache, die man vielleicht eigene Sozialität nennen könnte?
Blume: Ja, einer gesellschaftlichen Situation, der Bedingungen in denen Du existiert hast, eigener Sozialität auch. Du hast immer wenn Du was machen wolltest gemerkt, daß Du etwas umschmeißen mußt, von dem Dir gesagt wurde, daß es richtig ist, so wie es existiert.
Lorek: Das wäre eine Frage von Autoritäten. Dem, daß Dir jemand Imaginäres was gesagt hat, könnte man entgegensetzen: da haben auch andere was gesagt, zum Beispiel in dieser ,Szene‘, die sich außerhalb bewegte.
Blume: Es ging natürlich um das eigene Verständnis dessen, was Du tust. Viele Leute hatten Vorstellungen, wie etwas anders gemacht werden könne. Was immer verhindert wurde war, daß sie sich als Gruppe verständigen konnten.
Lorek: Meinst Du, daß das stimmt? Warum war dann außerhalb dessen doch was anderes, was Du Dir reinziehen konntest?
Blume: Das existierte nicht nur außerhalb, das wurde auch geduldet. Wenn die Stasi da hätte aufräumen wollen, hätte es nicht existiert.
Lorek: Es gab also die Möglichkeit sich in dieses Feld hinein zu bewegen und es sich nicht bloß anzugucken?
Blume: Ja, und diese Möglichkeit erschien mir nicht allzu interessant, weil da die Leute in einer Nische vor sich hinarbeiteten, in ihrer eigenen Suppe kochten.
Lorek: Und in wessen Suppe hast Du gekocht?
Blume: Ich habe oder wurde in der offiziellen Suppe gekocht.
Lorek: Und diese erschien Dir interessanter?
Blume: Ja, durchaus. In den letzten Jahren war das die Zeit meines Studiums. Und da wurden mir wichtige Sachen vermittelt. Gesellschaftsmodelle, Geschichte; auch der DDR und des Sozialismus, was mir eine Chance und Begriffe bot, über unsere Situation nachzudenken. Vielleicht sind es Modelle, die mich behindern. Dieses Studium war auch eine Insel.
Lorek: Es ist für mich schwer vorstellbar, daß ein Studium und das, was es vermittelt, in der Spannungssituation, in der sich Leute in der DDR befunden haben, soviel gebracht hat.
Du hast gesagt, daß die ,Szene‘ irgendwie geduldet wurde. Das bezieht sich ja auf Literatur, auf Musik usw. Nun befragt Ihr ja für dieses Buch Leute, die vom Alter herein ganzes Stück auseinander liegen; für die es in der DDR wahrscheinlich die Kategorie gibt: die sind weggegangen, in den Westen.
Blume: Der Ausgangspunkt war für uns die Erfahrung beider Teile Deutschlands. Wir wollten fragen, was diese Leute unter ,deutsch‘ verstehen, es wurde dann wichtig für uns, daß wir sie jetzt danach fragen können, welche Erfahrungen sie mit diesem Länderwechsel gemacht haben.
Lorek: Warum willst Du das wissen?
Blume: Weil mich interessiert, was an diesen beiden Staaten gleich oder ganz anders ist. Welchen Stand der Aufarbeitung dieses Weggehens oder Weggegangen-werdens die Leute haben, wie sie das reflektieren und in Zusammenhänge stellen. Das zu wissen halte ich für wichtig. Für mich und viele andere Leute.
Lorek: Ist das jetzt wieder eine Autoritätsgeschichte, oder freundlicher: eine Kompetenzsache?
Blume: Du fragst, ob ich diese Leute zu Autoritäten mache, von denen ich wissen will, wie ich mich jetzt verhalten soll?
Lorek: Das ist zu banal.
Blume: Diese Erfahrungen existieren doch. Und ich möchte möglichst viele wichtige Erfahrungen von anderen Leuten kennen, auch um das für mich zu verarbeiten. Das ist doch was ganz normales.
Lorek: Ich will nur rauskriegen, wie weit sich jemand wie Du riskiert.
Blume: Na ganz und gar. Die Feigheit ist sicher da. Aber ich versuchs.
Lorek: Weil Du es jetzt darfst?
Blume: Nein, ich habe das früher auch gemacht. Für mich ist in den letzten Monaten was passiert, so daß ich mir Feigheit vorwerfen kann, mich fragen, wieso ich jetzt in vielen Punkten anders denke.
Lorek: Wirklich anders denkst, oder nur anders artikulierst?
Blume: Nein, ich denke wirklich Vieles anders. Ich hatte die Vorstellung, die Verselbständigung dessen, was mit mir passiert, vermeiden zu wollen. Zum Beispiel die Wahl. Daß ich nicht losgegangen bin und überall ’ne Riesen-Randale gemacht hab, um zu sagen: das ist Wahlfälschung. – Was dann mit mir passiert wäre, war klar. Ich wäre, nach ich weiß nicht wie langer Zeit, im Westen gelandet. Und die Entscheidung war – das ist ein Punkt über den ich jetzt anders denke – die Entscheidung war: Was kannst du noch riskieren, ohne diese Mühle, die dann was mit dir macht, in Bewegung zu setzen. Das ist eine ungeheure Einschränkung, ja. Ich habe versucht, trotzdem was zu ver ändern…
Lorek: … ohne Dich zu riskieren …
Blume: … zu riskieren, daß ich nicht mehr beeinflussen kann, was mit mir passiert. Ich wollte nicht in den Westen.
Lorek: Jetzt sind wir zum dritten Mal bei Autoritäten.
Blume: Das ist auch eine Autorität in mir selbst gewesen.
Lorek: Es geht darum, daß von jemandem gesagt wurde, von der Situation, die der jemand bestimmte, festgelegt wurde: das darfst du. Hier ist dein Jojo-Spielraum.
Blume: Ja, im Namen eines Ideals, daß ich akzeptiert habe. Also meinetwegen: Sozialismus. Die konkrete Frage wäre doch, ob ich irgendjemanden im Stich gelassen oder auf dem Gewissen habe, mit dem ich zu tun hatte. Und das ist nicht so.
Lorek: Nun sind ja viele Leute weggegangen. Zu einer anderen Zeit als jetzt. Was hat Dir ermöglicht, das in Kauf zu nehmen?
Blume: Ich habe gedacht, daß das die Entscheidungen dieser Leute sind, die Spielregeln, die im Sozialismus gelten, nicht einzuhalten. Eine Verweigerung.
Lorek: Interessant, daß Du jetzt von Sozialismus und nicht von Stalinismus redest.
Blume: Ich rede so, wie ich es damals gedacht habe. Da habe ich nicht ,Stalinismus‘ gedacht. Dann hätte ich die Entscheidung hinter mir gehabt. Wenn ich gedacht hätte, das, was hier passiert, hat gar nichts mit Sozialismus zu tun, das ist nicht nur halb falsch, sondern ganz falsch, hätte ich die Konsequenzen gezogen. Sehr schnell wahrscheinlich.
Lorek: Nochmal dazu, daß Leute weggegangen sind und wer weggegangen ist.
Blume: Ich hab’ denen, bis auf Ausnahmen, letztlich unterstellt, die Verantwortung für das, was in der DDR passierte, nicht länger tragen zu wollen oder zu können. Eine lange Zeit. In den letzten Jahren habe ich auch gesehen, daß es viele Leute sind, die sich nicht nur diesen Zwängen nicht stellen wollen, sondern daß vielen Arbeit, die für sie wichtig war, unmöglich gemacht wurde. Das habe ich als Grund für ihr Weggehen auch akzeptiert.
Lorek: Das hört sich ein bißchen an, wie die These der chinesischen KP: Kampf dem bürgerlichen Liberalismus. Danach wären die Künstler, die seit ’76 in den Westen abgedriftet sind, in der Endkonsequenz bürgerliche Liberale gewesen.
Blume: So habe ich das nicht gedacht, aber etwas von dieser Sichtweise hat vielleicht eine Rolle gespielt.
Lorek: Es spielte also eher ’ne Rolle, daß die weggehen und Dich allein lassen, als daß die sich mit dem, was sie gemacht haben, solange den Arsch aufgerissen haben.
Blume: Ja, aus meiner Ansicht heraus, die Karre sei noch nicht am Baum, und es sei wichtig, daß möglichst viele Leute versuchen, sie noch dran vorbei zu kriegen.
Es gab doch neben den Leuten, die ihre Öffentlichkeit außerhalb der Institutionen gesucht haben, auch Leute, die versucht haben, mit ner Menge Frust, auch belächelt, was möglich war, ein Stückchen ’rauszuschieben sich noch auf Institutionen einzulassen.
Lorek: Meinst Du, daß es nur nötig war, sich auf Institutionen einzulassen?
Blume: Nein, so nicht. Ich rede ja nicht davon, daß sich jemand verkaufen soll, sondern von der Entscheidung, dann eben in ein Theater zu gehen und da ein Projekt zu machen, oder auf Rockmusik oder -texte umzusteigen, um dadurch an mehr Leute ranzukommen. Der Spielraum existierte doch.
Lorek: Da ist ein von Dir artikulierter Bedarf an sozialem Verhalten, an Kommunikation usw. Und das ist gleichzeitig vordergründig ich-bezogen.
Blume: Ja, logisch. Ginge das anders?
Lorek: Wie weit geht dieser Bedarf an Sozialität?
Blume: Meine Freunde sind mir wichtig…
Lorek: Der Rest der Menschheit wird abstrakter?
Blume: Ja. Den kann ich bloß als Modell denken und wünschen, daß denen die Befriedigung ihres ,Bedürfnisses an Solidarität‘ auch möglich ist. Daß sie nicht darauf angewiesen sind, sich zu verstellen, um irgendetwas zu erreichen, daß sie keine anderen Leute ausbooten müssen, um sich irgendwo durchzusetzen.
Lorek: Über das Thema Ellenbogen brauchen wir hier nicht zu reden. Okay. Jetzt befragst Du Leute, die im Westen sind. Das läuft darauf hinaus, daß Du Dich selbst stabilisierst. Innerhalb.
Blume: Vielleicht auch. Wirf mir doch was vor.
Lorek: Warum denn? Ich habe nicht die Absicht, Dich an die Wand zu drücken. Ich will was wissen.
Blume: Ich wäre mehr für Zuspitzungen. Ich empfände Vorwürfe nicht als An-die-Wand-drücken, sondern als Möglichkeit, in Extremen zu reden.
Lorek: Du bist für mich keine Kategorie, an der ich mit der DDR was abzumachen hätte, mit meinem DDR-Erlebnis jetzt abrechnen müßte. Da bist Du inkompetent, da gibt es keine Kompetenz. Die wären diese 95% der DDR-Bevölkerung.
Blume: Ich gehöre aber bei Deinem Bild zu den 95% dazu. Und wenn Du schon alle in einen Topf schmeißt, kannst Du mir auch was vorwerfen.
Lorek: Es ist so, daß ich einen Abstand zu den Dingen habe, mit denen Du zu tun hast. Da ist man nicht so verbiestert. Das heißt nicht, daß ich jetzt sanfter wäre. Ich habe am Anfang gesagt, daß ich mit Leuten wie Dir in den letzten Jahren meines Lebens in der DDR nicht zu tun hatte.
Blume: Was sind denn Leute wie ich?
Lorek: Die Möglichkeit, DDR wie sie war, funktionieren zu lassen.
Blume: Und sie trotzdem ändern zu wollen.
Lorek: Ja. Nach Abwägen des Risikos.
Blume: Vorausgesetzt, daß es kein Opportunismus oder Karrierismus war. Ich habe keine Vorteile gehabt. Gut, ich hatte auch keine wesentlichen Nachteile davon.
Lorek: Das ist es. Um die Vorteile gehts nicht, dann würde man eher ein schlechtes Gewissen kriegen.
Blume: Das ist mir zu simpel. Ich denke nicht, daß man alle Leute, die in der DDR leben, für alles verantwortlich machen kann, was passiert ist.
Lorek: Nein, nur 95%.
Blume: Das ist zu hoch gegriffen. Dieses Urteil würde voraussetzen daß jeder alle Konsequenzen dessen, was er macht, kontrollieren kann.
Lorek: Daß jeder das, was er macht, begreift.
(…)
Lorek: Ich hätte mir eigentlich weitaus rabiatere und radikalere Momente gewünscht, aber die können wahrscheinlich in einem solchen Gespräch schon deshalb nicht entstehen, weil wir dem, was los ist mit ’ner ziemlichen Portion Hilflosigkeit gegenüberstehen.
Blume: Es ist weiterhin so, daß alles funktioniert, ohne daß wir gefragt werden.
Lorek: Also jetzt könnte es radikal werden. Es juckt mich nicht, ob ich gefragt werde, das heißt, es juckt mich schon, aber das ist nicht der Ausgangspunkt dafür, daß ich etwas tue. Das wäre eine Festlegung aufs Reagieren. Mich interessiert weitaus mehr, und das ist mein Job, daß ich agiere.
Blume: Ich meinte einen anderen Kontext. Ich halte es nicht für messbar, wie wirksam Du bist. Das meine ich mit dem Problem, daß nach wie vor alles ohne uns funktioniert.
Lorek: Das verstehe ich nicht.
Blume: Der Anspruch, den ich im Hinterkopf habe, ist sicher ein utopischer, daß ich mich mit meiner Meinung in gesellschaftliche Mechanismen einbringen kann und diese Meinung auch eine Rolle spielt.
Lorek: Aber doch nicht, daß Du Deinen Platz verabreicht kriegst.
Blume: Nein, natürlich nicht. Aber ich halte das für eins der generellen Probleme, von denen aus ich meine Position selbst bestimmen will, diese Gesellschaftsstruktur. Die Suche nach einer Perspektive.
Lorek: Diese Popelrevolution, diese Revolte die jetzt abgelaufen ist, hat mit Revolution für meine Begriffe nichts zu tun. Weil da null Radikalität dahintersteht. Da braucht ihr nicht einmal zwei Schritte zurück anschließend. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, kann sein. An sich sollte alles beim alten bleiben. Nur reicher sollte es sein. Wie langweilig.
Blume: Ich habe noch eine Hoffnung. Daß das, was jetzt passiert, sowas wie eine Verkleidung ist. Daß wir jetzt bürgerliche Revolution spielen.
Lorek: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Man braucht nichts neu zu machen. Alles schon gehabt.
Blume: Und genau das Phänomen mein ich, daß sich die Leute verkleiden, um das alte nochmal durchzuspielen, dabei aber etwas Neues schaffen…
Lorek: Ich habe Fasching schon immer gehaßt.
Blume: Und ein Urteil, ob was wirklich Neues passiert ist, ist sicher erst in ein paar Jahren möglich.
Lorek: Was anderes. Ich habe den Eindruck, daß die Mauer im Kopf funktioniert. Und die ist viel schwerer wegzukriegen als die paar Steinchen, die Erich Honecker der DDR vererbt hat. Die Mauer im Kopf scheint es in der DDR noch zu geben.
Blume: Sicher. Wie soll die auch so schnell verschwinden.
Lorek: Es gab doch im Laufe der Jahre viele Leute, bei denen sie verschwunden ist. Ob die nun weggegangen sind oder nicht.
Blume: Ich weiß nicht, ob die sich nicht auch einfach auf die andere Seite der Mauer gesetzt haben. Auch in ihrem Kopf. Ich vermute, nach den Erfahrungen mit den Gesprächen bisher, daß die Leute mit dem, was mit ihnen passiert ist, nicht fertig sind, auch das Reflektieren darüber etwas wegdrücken.
Lorek: Weil sie einfach hinter Deiner Mauer stehen. Die Leute, die Ihr jetzt befragt, sind schlichtweg anders. Und deshalb wird es auch in der Kommunikation schwierig. Schon, daß ich nicht dem entspreche, womit Du in Deiner normalen DDR-Situation umgegangen bist. Die Leute, mit denen Du redest, haben einfach ein anderes Erfahrungsspektrum, insofern können die nicht so mit Dir sprechen, als wären sie noch richtige DDR-Menschen.
Blume: Sollen sie auch nicht. Das habe ich nicht erwartet.
Lorek: Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Denn wenn Du nicht die Erfahrung mit etwas anderem als der DDR-Wirklichkeit hast, weißt Du nicht, wie anders die Leute, die diese Erfahrung haben, sind.
Blume: Ja, als wir überlegten, wir würden Leute fragen, wie diese beiden Deutschland sind, dachten wir nicht daran, daß die vielleicht nicht mehr verstehen, was wir fragen.
Lorek: Verstehen schon, aber sich nicht darauf einlassen.
Blume: Vielleicht ist es dann ein Notbehelf, über ihr Leben in der DDR zu sprechen…
4. Februar 1990
LEONHARD LOREK
der Jäger muss
wissen wie
man Wölfe
killt
ein gutes Märchen
braucht schon den
Doppelmord
Willst du das
Rotkäppchen
rächen
Geh ausserhalb
Des Waldes
brechen
Peter Wawerzinek
Zum Sechzigsten von Leonhard Lorek
– Kurze Notizen für einen Text, der nicht geschrieben werden braucht. –
Storagemanagementadministrationssuitesalesman sagt Ihnen nichts. Kann man sich ansehen, läuft als Video auf MySpace. Leonhard Lorek – nie gehört sagen Sie. Okay. Dann wissen Sie auch nichts vom Beutespektrum Brechts, dass Brecht und Christo wenig unterscheidet. Und wissen nichts über die Erschöpfung aus Langeweile, sahen nie das Grau bröselnder Häuserfassaden. Und wissen also absolut nichts von der enormen Musikalität Rimbauds, wie Ihnen haarige, verschwitzte Körper, tätowierte Haut, Weite, Tiefe, Häfen, Fernweh und Abgründe fremd sind. Und dieses Lied hier, sagen Sie nicht viel dazu, ich weiß es doch, auch das kennen Sie nicht. Nie gehört sagen Sie wieder und wieder, wenn man es ihnen wieder und wieder vorspielt.
Sie wissen nichts von einem solchen Text, den Sie wieder und wieder lesen, als würden Sie keinen Liedtext vor sich haben: Ein Seemann muss aufs Arbeitsamt, ein Seemann, der gut schwankt. Der Seemann hat die ganze Nacht getankt, und sich durchgezappt durch die Kanäle, von See zu See, von Mast zu Mast, von Braut zu Braut. Und hat dem Herrgott bei der Rettung mancher längst verlorn geglaubten Seele zugeschaut und ihm gedankt. Keine Ahnung vom wem das ist, wer so etwas schreibt. Sie können nur ständig wiederholen, was sie längst schon zu Protokoll gegeben haben. Sie sahen noch nie ein Herz auf der Strasse schwimmen im taeglichen Staub der eff sechsundneunzig. Endler, Hilbig, Jansen, Schleime, Döring, Erb, Baader Holst kennen Sie nicht einmal vom Namen her. Sie wissen von so vielen guten anderen Leuten nicht, können mit weiteren hundert Namen von Namenlosen nicht anfangen, auch wenn die Ihnen zuraunen: Vergissmeinnicht. Sie wissen nicht, wie viele es von denen gibt, die alle zum Gesamten dazu gezählt werden müssen. Ihnen ist auch ganz unbekannt geblieben, wie leicht sich Gedichte schlucken lassen, verschreibt man sich gegen Kummer und Weltekel. Sind nicht so große Unterschiede auszumachen bei den Worten still, Stall, Stellung, Schall, Schelle, Scholle und Stullen im Stollen. Sie heulen nicht, sagt man plötzlich Weinbrand zu Ihnen. Ihre Wangen glühen nicht dabei, ihre Augenlider sind noch nie in Flammen aufgegangen. Also seien Sie besser doch froh und Ihrer Unkenntnis dankbar, dass Sie von Leonhard Lorek nicht wissen, und also auch nicht die tückischen Eigenschaften des märkischen Sandes kennen müssen. Macht nichts. Das lässt uns weitergehen, solange der Boden unter unseren Füssen hält. Das lässt uns weiter an uns glauben und jeden locker behaupten: Gibt eh keine größere Zusammengehörigkeit als jene mit sich selbst, braucht niemanden weiter als die Musik, das Lied, den Freundeskreis. Muss sich alles einmal um einen herum verändern, dass die Schaffenskraft bleibt. Wir stehen nicht für die Gesellschaft, der wir entstammen. In uns pocht das Kunstherz. Wir sprechen für uns. Wir sind einzigartig, stellen dies weiter unter Beweis. Also lassen Sie sich noch rasch sagen: Vielfalt erzeugt Konzentration. Wir werden nicht Fuß fassen auf Euren glatten Terrassen. Wir brennen durch Gestrüpp und der Dornenhecke. Wir haben die Zweitrangigkeit etabliert und besetzen jeden Platz, der uns nicht gebührt. Durchschnitt setzt sich durch. Wir aber bleiben ruhig und beleben eben die Graubereiche. Abhauen hieß schon immer für uns, bleiben, wo wir uns festgesetzt haben. La deutsche Vita oder Mendelsson, No-Name bewahrt den Ruf. Es ist leicht und braucht seine Zeit, zu dem zu werden, was man zu Beginn gleich war. So wird man lässig sechzig Jahre alt, und altert lustig für sich hin. Denis Scheck wird zu keiner deiner Aufführungen kommen, lieber Leonhard. Arbeiten wir als alle weiter stetig daran.
Peter Wawerzinek, junge Welt, 27.1.2018
Alles flüchtige Zaubertinte
– Ein Gedanken- und Erinnerungsspaziergang zum 60. Geburtstag von Leonhard Lorek. –
Mein treuer Mitspaziergänger und den Lesern dieser Zeitung ein jahrelanger Bekannter Klaus leidet nicht darunter, wie rasch Lebenszeit vergeht. Mit wird schwindlig beim Gedanken. Klaus erinnert sich besser als ich an früher, weiß Orte, Namen, Personen wie mit dem Dartpfeil geschossen. Kann einfach nicht daneben liegen. Daneben liegen, sage ich. So heißt ein Buch von Leonhard Lorek. Zitat:
Ich wäre gern alt geboren worden, jung gestorben.
Der wird an diesem Sonnabend sechzig Jahre alt. Schon dämmern mir Geschehnisse und Geschichte, und ich habe sie vor mir, die paar Übriggebliebenen, die mit uns geborene Generation.
Als es Verlage gab, an die man nicht herankam, nur lauter illegale Zeitschriften, für die man selbst die Texte in die Schreibmaschine hämmern musste. Wir tönten, rasselten, kritzelten und trugen unsere Texte an Orten vor, wo es nur ging. Zwischen Häusern auf Halde, unter Dachbalken, in kohligen schimmligen Kellernischen. Irgendwo weit draußen gleich hinter der Mauer gab es das Zweitberlin, die Ersatzillusion. Da wollten wir nie erscheinen, eher in China präsent sein.
Wir kamen aus allen Provinzen nach Ostberlin und schrieben unsere Geburtsurkunden um. Ich strich Rostock, setzte dafür Raumerstrasse ein. Hautfarbe: Gassengrau. Karriereabsicht: keine. Nicht wahrgenommen zu werden war der Urantrieb unserer Öffentlichkeitsarbeit in der Ostblockära. Da stand der Gasometer noch an der Dimitroffstraße, sagt Klaus. Flutsch war der dicke, runde Bau weggesprengt, als hätte man uns die Mütze vom Kopf geschlagen.
Leonhard Lorek, stammele ich unbeirrt, bin mir nicht sicher, ob der Neunzehnhundertvierundachtzig beim Sichtungsturnier mit dem Titel Zersammlung dabei war? Da sollten alle Äffchen eingefangen und so etwas wie ein Verbund gezähmter Autoren geschmiedet werden. Wir aber, der Lorek und ich, wollten mit unserer Kunst lediglich sicher ins Nachhinein geraten. Durchhalten bis Vielleichtspäter. Darauf waren wir aus. Text, Aktion, Stimme und das Ziel, sich erfolgreich im Umlauf zu befinden. Ohne doppelten Boden, Absicherung und Vernetzung im weiten Kosmos Gleichgesinnter irren, stotternd Signale senden. Worte und Sätze empfangen, die man sich ins Hirn tätowiert, um sie zu besitzen.
Mein Weltraum waren Wohnungslesungen bei Poppe in der Rykestraße, bei Maaß in der Schönfließer. Ich wollte hereingelassen werden, dabeisein dürfen, den Stempel mit der Aufschrift Opposition ins Fleisch gedrückt bekommen.
Alles flüchtige Zaubertinte. Man gehörte als Dichter da nicht wirklich dazu, blieb Zierrat, Fußvolk, Randerscheinung. Schwamm drüber. Klaus hat sich dafür nie erwärmt. Ich bin dann da auch nicht weiter hingepilgert. Wenn es derartige Treffen heute noch gäbe, Lorek und ich, sage ich, würden uns dort nie in die Quere kommen.
Wer ist denn dieser Lorek, reagiert Klaus wirsch auf mein Gefasel? Vom Typus her ähnlich mir und Matthias Baader Holst, antworte ich. Dem Kunstwald zugehörige streunende Reizwölfe, hier und da von Bewegungskameras eingefangen, nie aber festgesetzt, mitunter aufheulend, von Gerüchten umweht. Das zur Vita. Um Kunst von sich zu schleudern reicht die Identität als Ausnahmefall vollkommen aus. Du musst nur genügend Ichselbst sein, dann wirst du nie fertig mit dir, stattest dich dein Leben lang aus, bereitest ihn vor und vor, den großen Wurf. Du singst, spielst, dichtest, schreibst und wuchtest das Große wie Geringes, und füllst damit eine Lücke nach der anderen. Du verweigerst dich. Du versperrst dir absichtlich jeden Zugang zu den etablierten Orten, die für dich den Tod bedeuten, rede ich mich in Eifer. Und halte dann ein.
Da sind wir schon ganz schön viel zu Fuß unterwegs und müssen uns neu orientieren, wo wir überhaupt sind. Und ich beginne mir dann einzugestehen, nicht einmal mehr zu wissen, ob je ein Text von mir im schaden erschien, wie die Zeitschrift hieß, von der gesagt wurde, der Lorek würde sie herausgeben? Habe es vergessen.
Wichtig daran ist nur, dass Leute wie Lorek und ich schließlich Musik machen und unsere Texte lieber singen, als gedruckt auf Papier zu sehen. Musik ist ja immer wieder ein großer Neubeginn. Mit jedem Titel. Song für Song häufen sich in leiser und loser Folge die Ergebnisse der vielen musikalischen Zusammenkünfte. Es werden Alben daraus. Und irgendwann gelangt man zu der Erkenntnis, die für dich und deinen Lorek gleichsam gilt: Warum nur so viele verschlungene Wege gegangen, die Zeit und Energien gekostet haben, wenn es viel, viel einfacher zu machen geht: Ein Text, ein Mund, der erste Ton, und fertig ist die große Zauberei.
Peter Wawerzinek, Berliner Zeitung, 27.1.2018
Abseits vom Abseits
– Der verborgene Dichter Leonhard Lorek wird am Sonntag 60 Jahre alt. –
Auf einem berühmten Foto von Helga Paris, das sie am 20. September 1981 in der Wohnküche des Liedermachers Ekke Maaß im Prenzlauer Berg aufnahm, präsentierte sich die kritische Osterberliner Schriftsteller-Szene. Autoren wie Uwe Kolbe, Hans-Eckardt Wenzel oder Sascha Anderson machten später mit sehr unterschiedlichen Werken von sich reden. Unter den 15 jungen Talenten war auch Leonhard Lorek, der am Sonntag 60 Jahre alt wird. Er blieb ein „großer Unbekannter“.
Lorek hatte damals gerade in Brandenburg/Havel sein Abitur gemacht. Seine Eltern waren mit dem zehnjährigen Sohn aus Zabrze (Polen) in die DDR gekommen. In Ost-Berlin besetzte Lorek Anfang der 1980er Jahre in der Nähe der Weißenseer „Spitze“ eine Wohnung und wurde einer der Avantgardisten der Literatur-Szene vom Prenzlauer Berg.
Lorek gründete 1984 die nichtoffizielle Künstlerzeitschrift schaden, die bis 1987 in 17 Ausgaben erschien, und zusammen mit ähnlichen Projekten in Dresden, Leipzig und Halle ein landesweites Netzwerk von unabhängigen Alternativpublikationen schuf. Er war als Autor und Musiker beteiligt an mehreren Bands, wie Z.art, fett, oder teurer denn je. Mit seinem Lied „asyl b“ eröffneten sie ihre Konzerte:
ich bin eine blutende hämorrhoide
im baerenfell am arsch der welt
wo pfennigweise kindergreise
sterben eh der groschen faellt
& ich habe ein gesicht
und brauch es nicht
Das so etwas die Offiziellen nicht gerne hörten, war klar.
Lorek war bei allen großen Projekten des Prenzlauer Berg vertreten, in den im Westen erschienenen Anthologien Berührung ist nur eine Randerscheinung (1985) und Sprache & Antwort (1988) wie an der Ausstellung Wort und Werk (1986) in der Ostberliner Samariterkirche. Und doch hat er sich immer wieder aus allen Zusammenhängen herauskatapultiert: ein Außenseiter der Außenseiter.
Dabei ging es Lorek, wie auch den anderen, um das, was der im September 1984 in Wilhelmshorst gestorbene Dichter Erich Arendt mit dem Titel seines letzten Gedichtbandes von 1981 formuliert hatte: entgrenzen – der verordneten (sprachlichen) Verblödung der offiziellen Landessprache zu entrinnen. Nicht nur bei Lorek, auch bei anderen mussten die Texte dabei eine Spannung aushalten, die sie manchmal zu zerreißen drohte: die Spannung zwischen Wut und Kunst, Rebellion und Ästhetik.
1987 ging Lorek nach Kreuzberg, und arbeitete weiter als Texter und Musiker. Auch hier wieder weit abseits des Marktes. Ein einziges Buch ist 2009 im Verbrecher Verlag erschienen: daneben liegen. 1993 stellte Wolfgang Hilbig seinen grandiosen Roman Ich ein als „Szene-Statement“ bezeichnetes Zitat voran:
statisch ist der rahmen der öffentlichkeit. innerhalb dieses rahmens, sich die möglichkeit einer eigenen dynamik zu verschaffen, ist das „ich“ ein kommissarisches.
Dieses Zitat, was wohl nur wenige wissen dürften, ist von Lorek, aus einem Text von 1983. So hat er wenigstens heimlich den Weg in die Literaturgeschichte gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass dem verborgenen Dichter Lorek das gefällt.
Peter Böthig, Märkische Allgemeine Zeitung, 27.1.2018
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + Facebook +
YouTube + Musik 1, 2, 3 & 4
1 Antwort : Leonhard Lorek: Daneben liegen”
Trackbacks/Pingbacks
- Leonhard Lorek: Daneben liegen - […] Klick voraus […]


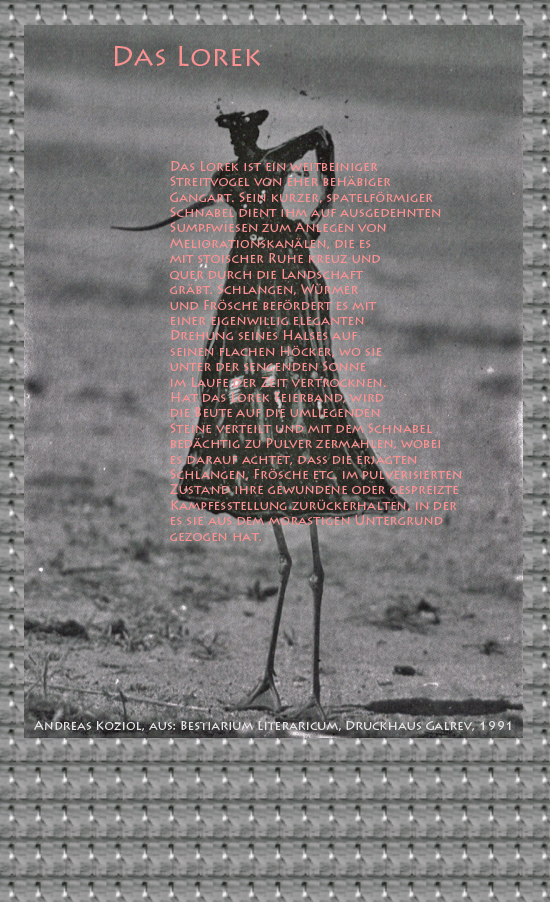












Es ist an der Zeit für Lorek!