Volker Sielaffs Gedicht „Fetisch“
VOLKER SIELAFF
Fetisch
Noch Tage danach sind seine Fußsohlen rot.
Er ist durch Eisen gegangen, aufrecht, im Nacken
noch immer das Tier, das ihm auf den Fersen ist,
das geflügelte oder das mit dem großen Schritt,
mit Elefantenohren oder der Trauer im Gesicht.
Vom Luchs, vom Adler, vom Bär – träumt er.
Allenthalben. Setzt die Maske auf, im Nacken
ein Leuchten wie von einem rastlosen Stern.
Ein Tier träumt sich. An seiner Stelle, es ruft
nach ihm, als sei er nie fortgewesen. Gleicher
unter Gleichen. Während der Elefant
seinen toten Bruder besucht: die Trauer
ein Wackeln mit den Ohren. Sprache?
Hamann glaubte, das komme von Gott.
2008/2009
aus: Laute Verse. Hrsg. von Thomas Geiger. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2009
Konnotation
„Alles, was man sagen kann, kann man auch beiläufig sagen.“ Die sprachphilosophische Maxime Ludwig Wittgensteins hat auch Geltung für die Gedichte des Lyrikers Volker Sielaff (geb. 1966). Denn die beiläufige Mitteilung, die poetische Verhaltenheit, der diskrete Ton – das ist die Schreibbewegung, der sich Sielaff anvertraut. Eine Behutsamkeit, die er von dem amerikanischen Lyriker Robert Creeley adoptiert hat: „Manches wacht auf / selbst durch beiläufige Mitteilung“. Manches wacht auf – es sind nicht nur die Wörter, die im Kontext des Gedichts erwachen und ihre semantischen Strahlungen, sondern auch die Dinge, die mit diesen Wörtern benannt werden. Manchmal verselbständigen sich die Dinge zu Fetischen, die als bedrückende Phantasmagorien die Protagonisten der Gedichte heimsuchen.
Es ist ein Phantasma der Unheimlichkeit, das den gehetzten Helden des Gedichts verfolgt. Ein Tier, das verschiedene Gestalten annehmen kann, dem Gequälten im Nacken sitzt und sich nicht mehr abschütteln lässt. Erst die letzte Gedichtzeile könnte in die Richtung weisen, wo der von Tieren Verfolgte zu finden ist. Johann Georg Hamann (1730–1788), der „Magnus im Norden“, wie ihn das literarische Deutschland zu nennen pflegte, erfand eine originär neue, kryptische Sprache, geboren aus der „Herzwärme der Willkür“.
Michael Braun, Deutschlandfunk-Lyrikkalender 2011, Verlag Das Wunderhorn, 2010


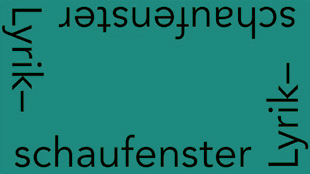
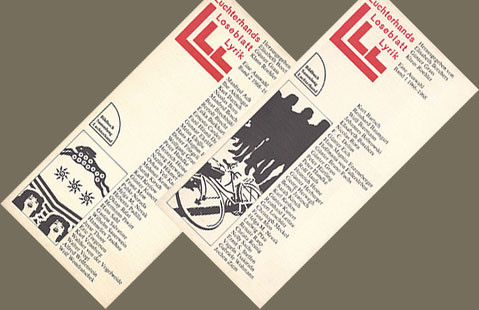



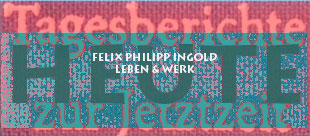
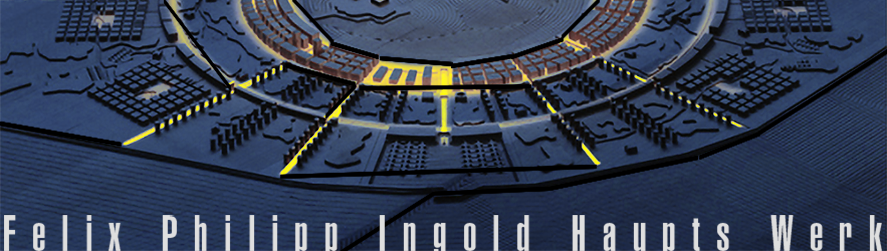
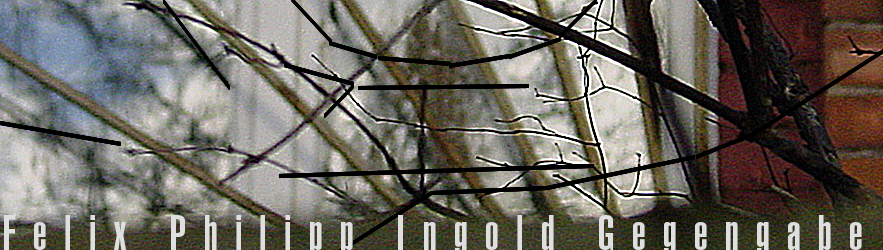
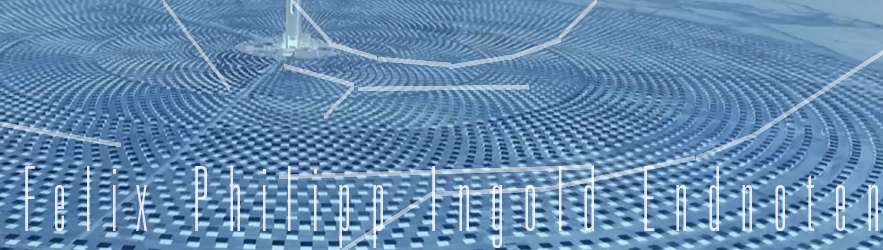

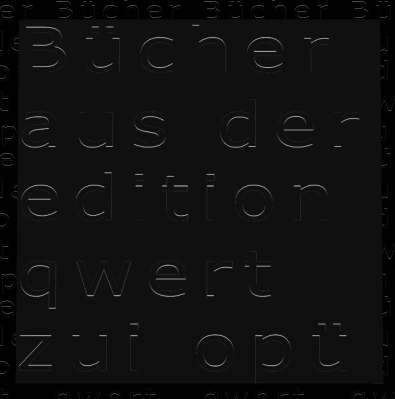
Schreibe einen Kommentar