Matthew Sweeney: Rosa Milch
MEERESTANZ
i.m. Ted Hughes
Heute abend wütet das Meer,
und das Dunkel, das sich herabsenkt,
besänftigt es nicht. Die Schiffe
verbergen sich in den Häfen.
Nur die Knochen der Ertrunkenen,
an denen Entenmuscheln haften,
toben durch die Wellen,
führen den Tanz auf, den niemand sieht,
ein Kreisen, ein Wirbeln unter Wasser,
und der Ehrenplatz des Abends
ist dem unlängst Ersoffenen vorbehalten –
der an einem milderen Abend als heute
von Dunwichs Klippen sprang,
die eingeschaltete Taschenlampe zurückließ
und einen heulenden Hund.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaUnd Aale
haben sich an seinen Augen gütlich getan,
Dorsche sein starres Fleisch angeknabbert,
Barsche die Fußknochen freigelegt,
doch all das hilft ihm nur –
noch nie hat er sich so frei bewegen können,
noch nie eine so stürmische Musik gehört
oder so viele Meilen in so wenigen
Stunden zurückgelegt, und wer weiß,
wohin ihn dieses Meer einst bringen,
an welcher Küste es ihn absetzen wird.
Vielleicht auch wird ein Netz ihn einfangen,
doch zunächst muß das Meer seinen Krieg
beenden, die aufgehende Sonne Strahlen
von seiner gläsernen Oberfläche prallen lassen,
während die Knochen auf dem Grund zur Ruhe kommen,
bis zum nächsten Sturm,
wenn der Tanz beginnt.
Nachwort
„Irland ist eine der Küste Europas vorgelagerte Insel, die sich dem über dreitausend Meilen von Ozean entfernten Amerika zuwendet. Was auch immer dort gedeiht, sei es nun tierischer, pflanzlicher oder geistiger Natur, kann nicht umhin, von der geographischen Lage und dem daraus resultierenden Klima beeinflußt zu werden. Ein Ire mag reisen, doch die Erinnerung an die mütterliche Landschaft läßt ihn nie los“, schrieb der Lyriker John Montague, selber Ire, in seinem Beitrag für die sogenannten Thomas Davis Lectures, die in den frühen siebziger Jahren von Radio Eireann ausgestrahlt wurden. Im speziellen Falle von Matthew Sweeney wäre diese Landschaft im äußersten Nordwesten Irlands zu suchen, dort, wo sommers, statistisch gesehen, der meiste Regen fällt und im Winter die heftigsten Atlantikstürme über den torfhaltigen Boden wüten, in der Grafschaft Donegal nämlich, jener spröden Schönheit mit Hügelland und Hochmooren im Innern und einer felsigen Atlantikküste, die an den Klippen des Slieve League weit über tausend Meter hinab ins Meer stürzt und an der man immer wieder auf breite Fjorde stößt, die tief ins Land hineinschneiden. Ganz im Norden Donegals, wo sich Irlands größte Halbinsel Inishowen (auf irisch: Inis Eoghain) ins Meer schiebt, wuchs Sweeney auf, genauer: in dem kleinen Dorf Ballyliffin, aus dem neben ihm auch der 1670 geborene Freidenker und Milton-Herausgeber John Toland stammt. Und in der Tat: In einer ganzen Reihe der Gedichte Sweeneys begegnet man dieser Landschaft, dem Ende der Welt, an dem der Atlantik beginnt, wie er an einer Stelle schreibt, man sieht die Kutter weit draußen, das Leuchten der Wellen, man hört das Möwengeschrei und spürt den rauhen Wind, der von der See her weht, trifft gar einmal auf einen gestrandeten Wal. In einem anderen Gedicht errichtet Sweeney den Hummerfischern jener Gegend ein eindrückliches sprachliches Denkmal – insbesondere jenem einen, dessen Unfähigkeit zu schwimmen zu seinem tragischen Ende im Meer führt. Und sowieso, das Meer: Wo es nicht an die nordirische Küste peitscht, wird es einem sicherlich in einer seiner vielen anderen Erscheinungsformen begegnen, liegt es ruhig glitzernd da oder steuert mit seiner Brandung die Geräuschkulisse zu einer Szene bei; und wo es nicht vom sicheren Land oder vom Schiff aus betrachtet wird, taucht die Erzählstimme des Gedichts ins Element hinein und in die Tiefe, hinab zu versunkenen U-Booten, zu verschollenen Fregatten und legendären Goldschätzen, über die nun ein Krebs, „der Diktator dieser wäßrigen Gegend“, wacht. Die Landschaftserfahrung, die Sweeney früh im Norden Donegals machte, spielt also ohne Zweifel hinein in seine Verse – und doch ist die Art und Weise, wie er sich mit ihr auseinandersetzt, weit entfernt von der Beharrlichkeit, mit der etwa James Joyce, um nur das berühmteste Beispiel zu nennen, noch in Triest oder Zürich an seinem heimatlichen Dublin festhielt und in jedem seiner Romane, in jeder seiner Erzählungen zum Hauptakteur machte. Irland ist alles andere als das zentrale Thema, um das Sweeneys Lyrik kreist, er entwickelt, obwohl auch er ins freiwillige Exil ging und damit in einer langen und ehrwürdigen Tradition der irischen Literatur steht (und obwohl er mehr als ein Gedicht geschrieben hat, in dem ein Exil eine Rolle spielt), keinerlei Besessenheit in bezug auf das Land seiner Geburt. Es ist kein Zufall, daß die Gedichte, in denen er sich Donegal zuwendet, allesamt Reminiszenzen an die dort verbrachte Kindheit sind; ebenso entrückt wie diese ist das Land, das in Sweeneys Lyrik bezeichnenderweise eher als ein mysteriöser – und sehr komischer – sommerlicher Schweißfleck auf einem Hemd auftaucht denn als Sujet lyrisch beschworen zu werden. Wo Sweeney sich spezifisch irischen Themen zuwendet, tut er dies diskret – in dem Gedicht über ein „Wartendes Paar“ in der Tat so diskret, daß ihm bei einer öffentlichen Lesung prompt und mit ehrlicher Empörung unterstellt wurde, er verherrliche die Sache der IRA. Und auch da, wo er aus der irischen Lyrikgeschichte bestens bekannte Motive aufgreift, tut er dies „tongue in cheek“ und mit ironischer Distanz. Sicher das markanteste Beispiel hierfür ist jenes Gedicht, das seinen eigenen Namen, Sweeney nämlich, im Titel führt: Jedes Kind kennt in Irland die uralte Geschichte von „Mad Sweeney“, von dem legendären König Suibhne aus Ulster, der sich versündigt, von einem Priester verflucht und mit Wahnsinn gestraft wird und sich fortan wie ein Vogel verhält, sich wie ein Vogel aus Angst vor den eigenen Gefolgsleuten in die Wildnis zurückzieht, um, wann immer ihm eine kurze Rast vergönnt ist, sein Schicksal in Versen zu rekapitulieren. Nicht nur irische Dichter haben sich des Themas angenommen, doch zwei der bekanntesten stammen von der Insel: Flann O’Brien, der die berühmte Geschichte in seinen Roman At Swim-Two-Birds einfügt, und natürlich Seamus Heaney in seiner Sammlung Sweeney Astray von 1983. Matthew Sweeney seinerseits läßt den berühmten Namensvetter nicht nur tatsächlich und bei, so scheint es, klarem Kopf zum Vogel sich verwandeln, er konfrontiert ihn darüber hinaus mit allen Facetten des modernen Alltags, mit geregelten Arbeitszeiten und indischem Lieferservice, deren Banalität die Vorgänge im Kontrast noch ungeheuerlicher macht und sie gleichzeitig erdet:
Selbst als ich ihm sagte, daß mein Kopf schrumpfe,
glaubte er mir nicht. Den Arzt wechseln, dachte ich,
doch wozu der Aufwand? Wir sind ja alle Hypochonder,
und diese Federn, die durch meine Poren wuchsen,
waren rein psychosomatisch.
Von dieser Metamorphose aus ist es nicht weit zu Gregor Samsa, der sich in Kafkas Verwandlung eines Morgens im Körper eines Käfers wiederfindet – und es überrascht nicht, daß Sweeney, der 1977, nach seinem Studium an der Polytechnischen Hochschule in London, nach Freiburg ging und sich eine Zeitlang intensiv der deutschen Literatur widmete. Noch heute nennt er neben Kleist eben auch Kafka als wichtigen Einfluß. Wie bei jedem Dichter, der den eigenen nationalen Tellerrand als Hemmnis empfindet, der wie in diesem Fall nicht nur in Deutschland, sondern jahrelang auch in Rumänien gelebt hat, nährt sich Sweeneys Dichtungsverständnis aus zahlreichen Quellen, finden sich so scheinbar disparate Einflüsse wie deutsche Romantik und Tom Waits nebeneinander wieder, läßt sich neben den irischen und anderen englischsprachigen Vorbildern – etwa Sylvia Plath, W.S. Graham, William Carlos Williams und James Wright – auch auf Dichter wie Vasko Popa verweisen, von dem wiederum eine Spur zu dem in Jugoslawien geborenen, doch schon seit seiner Kindheit in den USA lebenden Lyriker Charles Simic führt. Auch hier lassen sich Berührungspunkte ausmachen, und zweifellos würde Sweeney nicht nur die Aussage, sondern auch den grimmigen Charme dessen goutieren, was Simic in seinem Essay „Preis der Torheit“ über die Dichtkunst schreibt:
Die Poesie ist dann am besten, wenn sie sich im Herzen der menschlichen Komödie befindet. Es gibt keinen zuverlässigeren Berichterstatter über das, was es bedeutet, in dieser Dose voller Würmer zu sein. Ich bin der Ansicht, daß Poesie unvermeidlich ist, so unersetzlich und notwendig wie das tägliche Brot. Selbst wenn man in dem schäbigsten Land der Welt und in einem Zeitalter unvergleichlicher Widerlichkeit und Dummheit lebte, so würde doch Poesie geschrieben werden, und ihre Anziehungskraft und Beredtheit würde Hoffnung geben.
Matthew Sweeneys Gedichte zielen zu jeder Zeit auf dieses Herz der menschlichen Komödie ab, und diese ist, das versteht sich, niemals wirklich klar zu trennen von der menschlichen Tragödie – und umgekehrt. Und so, wie die Gedichte jeden einzelnen Komödianten oder Tragöden unmittelbar betreffen, so zugänglich sind sie auch für jedermann. Das ist keine Selbstverständlichkeit und entspricht zweifellos nicht dem Bild, das gemeinhin von der Lyrik verbreitet wird. Sweeneys Gedichte sind von ihrem Selbstverständnis her alles andere als elitär. Daraus erklärt sich auch seine Abneigung gegen einen bestimmten Strang der englischen Gegenwartsdichtung, der gelegentlich, etwas pauschal, unter dem Etikett Formalismus oder New Formalism zusammengefaßt wird. Zwar hat auch Sweeney Sestinen geschrieben, und auch der Reim ist ein Hilfsmittel, dessen er sich gelegentlich, wenn auch nicht oft, bedient; doch nie tritt die Klarheit des Gedichts (die keinesfalls mit Schlichtheit verwechselt werden sollte) hinter jene poetischen Aspekte zurück, die oft nur Spezialisten vertraut sind, nie wird das Material zugunsten einer zur Schau gestellten Kunstfertigkeit geopfert. Im Vordergrund steht immer das unmittelbare Bild, steht der mal kleinere, mal größere Ausschnitt der Geschichte, die jedes dieser Gedichte erzählt oder doch wenigstens andeutet. Man könnte, um noch einmal auf eine irische, wenn auch nicht ausschließlich irische Tradition zurückzukommen, den Begriff des yarning einführen, des Garnspinnens – und in der Tat erinnert sich Sweeney noch heute an seinen Großonkel Owenie und dessen Freunde, deren Geschichten und Anekdoten er als Kind oft lauschte. Oft genug ist es auch in seinen eigenen Gedichten das Fabulieren, die Lust an der Fragestellung „Was wäre wenn?“, die den poetischen Prozeß in Gang setzt und am Laufen hält. Das ist auch der Grund dafür, daß sie nicht nur gewieften Kennern einen Zugang bieten, sondern nahezu jedem, der ein offenes Ohr hat, der sein Grundbedürfnis an diesem täglichen Brot der Poesie und am Erzählen nicht verleugnet, der sich, kurz, die kindliche Lust am Zuhören bewahrt hat. Es ist kein Zufall, daß Sweeney sich weigert, zwischen einer Lyrik für Kinder und einer Lyrik für Erwachsene zu unterscheiden, und sich als Autor stets beiden verpflichtet fühlt – wie schon Walter de la Mare, dessen Gedichte Sweeney jüngst in einer neuen Auswahl herausgegeben hat. „Die Kindheit“, schreibt er dort in seiner Einführung, „war für de la Mare der Gipfelpunkt menschlicher Existenz, und eine seiner Lieblingsthesen, auf die er immer wieder einging, war, daß Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, bereits mit vielem ausgestattet sind, was sie nicht mehr zu erlernen brauchen, daß sie ein intuitives Wissen haben, eine natürliche Anmut in ihrer Art, sich zu bewegen, die sie mit der Zeit verlieren.“
Mit Walter de la Mare, aber auch mit dem irischen Nationaldichter William Butler Yeats – und im übrigen natürlich mit den meisten Kindern –, teilt Sweeney eine Vorliebe für das Übersinnliche, für die Geistererscheinung, das aufgestellte Nackenhaar. Es würde zu weit führen, all das aufzuzählen, was einem in seinen Gedichten in dieser Hinsicht begegnet: Von dem freundlichen Gespenst am Fußende des Bettes über den Schlachter, der aus seinem Grab steigt, um sich bis zum Morgengrauen wieder der Herstellung von Leberfrikadellen und Blutwurst zu widmen, bis hin zu den unheimlichen Porträts, die den Besucher, der „Die Türen“ durchschritten hat und ins rätselhafte Haus getreten ist, anstarren – und damit wären noch nicht die zahlreichen Gerippe über oder unter dem Wasser erwähnt, der im Sarg schlafende Gastgeber Rik, auch nicht die nächtliche Pokerrunde am offenen Sarg. Man trifft in jedem dieser Gedichte auf die unerhörte Begebenheit – mit einem deutlichen Faible für das Skurrile, das Abseitige, das Groteske und stets mit einem gehörigen Schuß schwarzen Humors versetzt. Da ist es nur naheliegend, daß Sweeney vor einigen Jahren, gemeinsam mit der Lyrikerin Jo Shapcott, als Herausgeber der Anthologie Emergency Kit fungierte, die sich im Untertitel dem Sammeln von „Poems for Strange Times“ und eben jenem Aspekt des Fremdartigen, des Abweichenden verpflichtete. Für seine eigenen Gedichte hat Sweeney, in Abgrenzung vom immer zu schnell herangezogenen Surrealismus, das Schlagwort „alternativer Realismus“ angeboten. Es ist nicht immer einfach, die feine Grenze zu erkennen, an denen die Texte vom Vertrauten in die Zone des Unbekannten gleiten – eine Grenze, deren Übertretung Sweeney aufs Charmanteste beherrscht. „Stell dir vor, die Haare / sämtlicher Friseurgeschäfte Chinas / regneten auf die Welt hinab…“: Möglich ist, was vorstellbar ist, und es wird zu einer bleibenden Erfahrung für den, der die angeborene Lust an der Geschichte, am sprachlichen Erfassen der Welt, am Gedicht kennt. „Mögen sie auch zugeben, daß Irland sie dauerhaft geprägt hat, so war es doch immer schon typisch für unsere Landsleute, ins Exil zu gehen, meistens aus purer Not, aber auch aus Neugier“, schreibt John Montague in seiner Thomas Davis Lecture. Es ist diese unbändige Neugier, die aus jedem einzelnen der Gedichte Matthew Sweeneys spricht, und es ist diese Neugier, die sie beim Leser, selbst bei dem, der sich bislang immun gegenüber der Lyrik wähnte, aufs neue und unwiderstehlich wecken.
Jan Wagner, Nachwort
Stell dir vor, die Haare
sämtlicher Friseurgeschäfte Chinas
regneten auf die Welt hinab…:
Möglich ist, was vorstellbar ist, und in den Gedichten des irischen Weltbürgers Matthew Sweeney wird es zu einer bleibenden Erfahrung für den, der sich die angeborene Freude an der außergewöhnlichen Geschichte, an der haarsträubenden Anekdote, an der verdichteten Sprache bewahrt hat. Ob ein wiederauferstandener toter Schlachter auf dem Weg zurück zu Beilen und Blutwürsten ist, ob die letzten Minuten eines ertrinkenden Fischers vor der Küste Donegals geschildert werden oder, wie im Titelgedicht, eine Schar von Mönchen das Wunder der „rosa Milch“ zu ergründen sucht – Sweeney folgt seinen Protagonisten mit ebenso viel Witz wie Mitgefühl in die Abgründe des Alltäglichen. Diese zweisprachige Auswahl aus allen bislang publizierten Gedichtbänden Matthew Sweeneys ist eine Einladung, sich seinen eigenwilligen Erkundungsgängen anzuschließen und dabei im Komischen das Tragische, im Tragischen das Komische zu entdecken.
Berlin Verlag, Klappentext, 2008
Donegal auf der Brust
– In Sweeneys Irlandgedichten, von Jan Wagner genau und gefühlvoll übersetzt, regieren weder Klischee noch Folklore, sondern konkrete, alltägliche Dinge und erstaunliche Details. –
Ein grüner Hut trudelt über einen Platz. Warum läuft niemand hinterher und versucht ihn zu fangen? Und der Wind ist doch gar nicht so stark, dass er Hüte vom Kopf risse? Vielleicht – und schon entsteht in zwanzig Zeilen eine Geschichte über einen „all-green man / thinking of his wife in another bed“, ein Phantasiestück in Grün, sozusagen. So unspektakulär der Auslöser sein mag, so reizvoll sind die daraus erwachsenden Bilder. Und mühelos nachzuvollziehen: keine dunklen Metaphern, keine gelehrten Anspielungen oder undurchsichtigen Verknüpfungen. Da erzählt jemand oder schildert und öffnet uns die Augen für Alltägliches wie Erstaunliches.
Trotz häufiger Ausflüge ins Irreale bleibt der Ton der Gedichte eher nüchtern. In kurzen Sätzen, kurzen Versen kommen sie daher, die unprätentiöse Sprache gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, obwohl das, was erzählt und geschildert wird, so komplex und unsicher, so voller Schreckensmöglichkeiten ist wie die Wirklichkeit. Trifft uns schon morgen die „Stunde Null“? Werde ich verschleppt und ausgesetzt? Und der dunkle Gang, der immer weiterführt durch Türen, die sich von selbst öffnen, bis man schließlich stehen bleibt, nur um die Türschlösser einzeln hinter sich zuklicken zu hören – wer hätte sich nicht schon einmal im Traum darin wiedergefunden? Und nicht auch im sogenannten richtigen Leben?
Neben den düsteren Szenarien gibt es listige, skurrile, absurde, ganz wie man das bei einem irischen Autor erwartet, und natürlich werden die unterschiedlichen Gestimmtheiten aufs schönste vermischt. Irland erscheint so, wie es geliebt wird: Die See strömt durch die Gedichte und lagert die Knochen der Ertrunkenen darin ab, hin und wieder lächelt ein Geist, das flüssige Grundnahrungsmittel ist Whiskey. Trotzdem regieren hier weder Klischee noch Folklore, sondern das konkrete und oftmals harte Detail. In „The House“ etwa schildert Sweeney das Haus, in dem er aufwuchs:
Downhill
half a mile was the Atlantic,
with its ration of the drowned –
one of whom visited the house,
carried there on a door.
Man sieht es sofort: Das einsam gelegene Haus und die, da keine Bahre vorhanden ist, hastig ausgeklinkte Tür, auf der der Tote herangeschleppt wird, und man sieht auch das Kind, das steht und starrt.
„Sweeney“ ist in Irland ein poetischer Name. Eine Sage berichtet vom König Sweeney, der, von einem Priester verflucht, sich plötzlich für einen Vogel hielt und im Wald fast verhungerte. T.S. Eliot schrieb zwei Gedichte über diese Figur. Matthew Sweeneys Version beginnt heiter und selbstironisch, dem Ich wachsen tatsächlich Federn, aber, wie man heute weiß, ist so etwas ja bloß „psychsomatisch“. Als unglückliche Krähe schafft das Ich es dann gerade noch auf einen Baum und muss mit ansehen, wie seine keineswegs betrübte Frau die Bücher wegtragen lässt und schließlich mit einem neuen Mann daherkommt. Sweeney fliegt gegen die Wand und erzählt, was unmöglich ist: den eigenen Tod. Das ist, obwohl todtraurig, so witzig und voller Charme, dazu so unangestrengt formuliert, dass man Jan Wagner zustimmt, der in seinem Nachwort darlegt, warum Sweeneys Gedichte auch denjenigen bezaubern, der sich „immun gegen Lyrik“ glaubt.
Wagners Übersetzung besticht durch Genauigkeit und Gefühl. Sweeney ist ja scheinbar ein leichter Kasus für Übersetzer: Keine Reime, keine hermetischen Sprachfiguren, keine den „Ton“ dominierenden Metren, sondern „einfach“ ein sanftes Parlando. Aber ein Blick auf eine Doppelseite zeigt sofort jene Eigenheiten der beiden Sprachen, die die Übertragung erschweren: Sweeneys Verse sind in der Regel kurz, die deutschen müssen länger sein. Wie etwa soll man die sechs Wörter „ride the toss-&-turning horse“ wiedergeben? Beschrieben wird damit das Sich-Hin- und Herwälzen bei Schlaflosigkeit, ein geniales Bild, dessen Knappheit keine Übersetzung retten kann, weil das Deutsche anders konstruiert ist. Wagner versucht nicht, diese Unterschiede zu leugnen, sondern leitet den Leser sacht auf die Spur des Gemeinten, und zwar so elegant, dass auch die Lektüre der Übersetzung Vergnügen bereitet.
Wie so viele irische Autoren hat Sweeney, 1952 in Donegal geboren, lange Jahre auf dem Kontinent zugebracht. Zurzeit lebt er „in Berlin, Graz und Timisoara“ (das ist Temeschwar, Rumänien), wie uns der Klappentext informiert. Die Gedichte sprechen auch von Exil und Heimweh, etwa wenn der Schweißfleck auf dem T-Shirt die Umrisse Irlands annimmt und das Ich verstört auf die heimische Grafschaft „über der rechten Brustwarze“ herabschaut. Beim ersten Lesen klingt das wie ein Scherz, beim zweiten spürt man den Schmerz und die Sehnsucht. Der Leser jedenfalls wird zum Irland-Liebhaber, willig folgt er dem Autor ans Meer, in den Wind, den Regen; in die Einsamkeit, unter die Trinkgenossen oder ins Kloster, von dem das hintersinnige Titelgedicht so gewitzt erzählt. Sweeneys warme, sensible Stimme gibt nicht vor, die Lebensrätsel lösen zu können, die sie in so lebhaften Farben vor uns ausbreitet, aber sie weiß genau, wovon sie spricht.
Gisela Trahms, culturmag, 2.2.2009
Das Wunder der rosa Milch
– Der irische Lyriker Matthew Sweeney über Pokerspiel und rote Nelken. –
Matthew Sweeney ist einer der bedeutendsten irischen Lyriker. 1952 wurde er in Donegal geboren, einer rauen Küstengegend im Nordwesten Irlands. Dorthin ist Sweeney nach vielen Reisen wieder zurückgekehrt – heute lebt er abwechselnd in Cork, im Süden, und Donegal. Er hat zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht. Rosa Milch heißt eine zweisprachige Auswahl seiner Gedichte, die jüngst im Berlin Verlag erschienen ist – es ist der erste Gedichtband auf Deutsch.
Matthew Sweeney:
PINK MILK
When the goats ate the red carnations
and the next morning’s milk was pink,
the abbot love it, demanded more
but the monks loved their flower-garden
and turned to cochineal, to crushed ants,
to paprika, all stirred in milk
to no avail – the perfume was gone
and the abbot grumpy, so carnations
were sacrificed to rampant goats
whose beards jigged as they chewed,
who looked up at the watching monks
while the abbot watched from a window
and in the kitchen, a leg of pork
thawed on a hook from the ceiling,
and blood dripped into a milk-jug.
Jan Wagner:
ROSA MILCH
Als die Ziegen die roten Nelken fraßen
und die Milch am nächsten Morgen rosa war,
ergötzte sich der Abt daran, wollte mehr,
doch die Mönche, die ihren Blumengarten liebten,
versuchten es mit roten Läusen, zerquetschten Ameisen
und Paprika, die sie in die Milch rührten,
freilich ohne Erfolg – das Arom war verflogen
und der Abt verdrießlich; weshalb man die Nelken
den zügellosen Ziegen opferte,
deren Bärte hüpften, als sie kauend
die Mönche beäugten, die sie betrachteten,
während der Abt von einem Fenster aus zusah
und in der Küche ein Eisbein
am Haken von der Decke hing und abtaute
und Blut in die Milchkanne tropfte.
Das Wunder der rosa Milch, dem ein Abt und seine Mönche auf der Spur sind; die kühle, eigensinnige Schönheit eines Eishotels; ein sonderbares Pokerspiel mit dem verstorbenen Onkel Charlie – all diese unerhörten Begebenheiten lassen sich in den Gedichten Matthew Sweeneys entdecken. Da gibt es Liebes- und Naturgedichte, vor allem Erinnerungen an die Kindheit in Donegal, neben im weitesten Sinne politischen Gedichten.
Der in den USA lebende Lyriker Charles Simic hat einmal gesagt:
Die Poesie ist dann am besten, wenn sie sich im Herzen der menschlichen Komödie befindet.
Genau darauf zielen die Gedichte Sweeneys ab, die von der menschlichen Komödie ebenso wenig wie von der menschlichen Tragödie zu trennen sind. Sie sind mit einem schwarzen Humor durchwoben, der in Matthew Sweeneys Augen nicht nur von einer irischen Literaturtradition inspiriert ist. Er hat in London und Freiburg studiert und sich intensiv mit der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt:
Ich war ausgesprochener Kafka-Fan. Nur liebte mein Deutschprofessor Thomas Mann. Eines Tages rief er mich in sein Büro und fragte: Warum magst du immer noch Kafka? Noch ein Essay über Kafka und ich lasse dich durchfallen. Wenn du etwas über Thomas Mann schreibst, gebe ich dir eine Eins. Kafka liebte ich also trotz dieses Drucks. Es gibt bei ihm einen Humor, den man kaum wagt, als Humor zu bezeichnen und trotzdem passiert etwas Lustiges. Das macht es umso ernster. Bemerkenswert ist auch die Bereitschaft, die Grenzen des Realismus zu überschreiten. Kafka lässt sich schließlich nicht als Realist bezeichnen. Du wachst morgens nicht als Kakerlake auf.
Der Hang zum Skurrilen, Abseitigen und Grotesken, der den Gedichten Matthew Sweeneys innewohnt, könnte leichthin mit dem Surrealismus in Verbindung gebracht werden. Doch davon hat sich Sweeney bewusst distanziert. Vielmehr ist für ihn das Zusammenspiel von realen Orten, Momenten und Situationen und der dichterischen Abstraktion ausschlaggebend. Genau das macht auch für Jan Wagner die Faszination für die Lyrik Matthew Sweeneys aus. Der 1971 geborene, in Berlin lebende Lyriker hat die Texte für den Band Rosa Milch ausgewählt und übersetzt:
Ich mag gerade die Tatsache, dass die Gedichte greifbar erscheinen, dass sie unmittelbar verwurzelt scheinen in dem, was jeder kennt in dem Alltäglichen. Aber dass sie fast unbemerkt, im Laufe eines Gedichts eine feine Grenze überschreiten, die dann zu dem führt, was Matthew ja selbst als den „alternativen Realismus“ bezeichnet hat. Die den Blickwinkel um wenige Grade verschieben und alles in einem neuen Licht erscheinen lassen. Aber auf eine ganz natürliche Art, die zugleich greifbar und ungreifbar erscheint.
Der englische Lyriker Ted Hughes war es, der denkwürdige, außerordentlich genaue, das Physische betonende Tierporträts entwarf. So trug die Krähe in seinem Gedichtband Crow die Züge eines listenreichen, bösartigen Tricksters, der die Autorität Gottes untergräbt.
Und auch Matthew Sweeneys Gedichte sind bevölkert von Tieren, die wie die Ziegen in „Rosa Milch“, immer auch Metaphern für menschliches Verhalten sind. Ted Hughes hat, so meint Matthew Sweeney, die Doppelbödigkeit sprachlicher Symbole auf unnachahmliche Weise durchleuchtet – bis darin menschliche Rätsel und Abgründe sichtbar wurden.
So sind wie bei Ted Hughes auch die Gedichte von Matthew Sweeney Einladungen, den eigenen Blick zu verschieben und die eigene Wahrnehmung zu erweitern – und das in einer klaren Sprache, in der eine scheinbare Banalität einen ungeahnten suggestiven Sog entwickeln kann.
Der große amerikanische Dichter Robert Frost hat das einmal so schön gesagt: Ich mag es besonders, wenn ein Gedicht als „verlockende Unbestimmtheit“ beginnt. Im Akt des Schreibens findet sich ein Gedanke und er wird zum Gedicht oder er führt ins Nichts. Und diese „verlockende Unbestimmtheit“, ein flüchtiger Blick, ein winziger Moment, von dem du nicht weißt, wohin er dich führt und woher er gekommen ist, der aber deine Neugier geweckt hat: Er ist es, woraus ein Gedicht entsteht.
Die große Aufgabe, den leichten, narrativen Ton und die poetische Dichte Matthew Sweeneys im Prozess der Übersetzung zu bewahren, hat Jan Wagner gemeistert. Auch im Deutschen haben die Gedichte ihre Kraft und düstere Heimlichkeit bewahrt.
Matthew Sweeney:
THE HOUSE
The house had a dozen bedrooms,
each of them cold, and the wind
battered the windows and blew down
power-lines to leave the house dark.
(…)
Crows were always sitting
on the wires, planning nests
in the chimneys, and a shotgun
sometimes blew a few away.
Neighbours never entered
as often as in other houses,
but it did have a piano upstairs.
And I did grow up there.
Jan Wagner:
DAS HAUS
Das Haus hatte ein Dutzend Schlafzimmer,
und alle waren kalt, und der Wind
trommelte an die Fenster, ließ Strommasten
umkippen, so dass das Haus im Dunkeln lag.
(…)
Immer saßen Krähen auf den
Drähten, planten ihre Nester
in den Schornsteinen zu bauen, und manchmal blies
eine Schrotflinte ein paar von ihnen weg.
Nachbarn besuchten das Haus nicht
so oft wie andere Häuser,
doch dafür gab es im oberen Stock ein Klavier.
Und ich wuchs dort auf.
Annette Brüggemann, Deutschlandfunk, 27.5.2008
Im Angesicht des kompromisslos
beiläufig gelingenden Gedichts
– Die Präsenz der irischen Landschaft ist in den Gedichten spürbar. –
Jan Wagner hat eine Gedichtauswahl des irischen Lyrikers Matthew Sweeney für den Berlin Verlag übersetzt und zusammengestellt. Rosa Milch ist nun pünktlich zur Leipziger Buchmesse 2008, der „Leser-Autoren-Messe“, erschienen; ein chic (wie immer bei der Lyrikreihe des BV) aufgemachtes Buchprodukt, knapp 130 Seiten, und dazu zweisprachig, nach dem altbewährten Links (Original)-Rechts (Übersetzung)-Muster. Soweit – so gelungen!
Die Gedichte Sweeneys sind gezeichnet von dem Erzähltrieb, der ihnen innewohnt. Wer also Jan Wagners Gedichte mag, jedoch dabei hier und da auf die zugegebenermaßen meisterhaften Manierismen des Gedichtschreibers verzichten kann, mit anderen Worten, wer glücklich-gesättigt nach dem üppigen Pasteten-Mahl, den Reiz frischer, knapp-raffinierter Roh-Kost schätzt, wird Sweeneys Texte mögen.
Es ist kein Zufall, dass Wagner sich dieser Texte angenommen hat, das spürt man sofort, nicht zuletzt am berechtigten Argwohn der Übersetzung gegenüber der vermeintlich launenhaften Beiläufigkeit des Originals. Denn gerade im Umgang mit lyrischem Stil und lyrischer Stimmung erweist sich der Sweeneysche Erzähltrieb als resistenter denn angenommen. Ihm wohnt etwas erstaunlich Leichtes, Naiv-Neugieriges, und dabei unmerklich ins unheimliche Gleitendes inne. Das in der Übertragung nachzuempfinden, scheint nicht zwangsläufig Wagners Intention gewesen zu sein, mindestens ebenso sehr bemüht er sich um die genaue Erfassung des Rhythmus der Originalfassungen.
Aus dem Gedicht: „The Doors“
Behind the door was another door
and behind that was another.
[…]
All the eyes in the portraits
were turned my way.
I looked back at the door
heard the lock click, then beyond
another lock, then another.
macht Wagner: „Die Türen“
Hinter der Tür war noch eine Tür
und hinter dieser noch eine.
[…]
Die Augen sämtlicher Porträts
ruhten auf mir.
Ich drehte mich zur Tür um,
hörte, wie ein Schloß zuschnappte, dahinter
noch ein Schloß, dann noch eines.
Jedes Gedicht (gerade auch das poetologische Gedicht „Die Türen“) gerät in den Verdacht, selbst Tür zu sein, dahinter Abgründe, die sich dem Leser einladend auftun, die ihn entführen in die unendlichen Weiten eines sagenhaften Alltags. Diese Abgründe stehen nicht gähnend und monströs in der Gegend herum, sie sind perfekt getarnt, direkt nebenan, unscheinbare Elemente im täglichen Blick- und Tastfeld der Realitäts-Wahrnehmung.
Jan Wagner weist in seinem Nachwort auf die Präsenz der irischen Landschaft in den Gedichten Sweeneys hin. Das muss zum Einen nicht überraschen, tut es aber zum Anderen doch, wenn Matthew Sweeney beispielsweise die landbekannte irische Mär von seinem Namensvetter Sweeney in neue Gewänder kleidet. Hier spricht kein Landschaft-ist-gleich-Seele-Diagnostiker, gerade weil beispielsweise das allegorisch anmutende Gedicht „Der Schweißfleck“ diese Rolle selbst thematisiert, in Sweeneys Texten ist Landschaft bodenloser Schöpfgrund der Geschichte des nächsten Gedichts. In „Der Schweißfleck“ taucht die irische Landschaft als Schweißfleck auf dem Hemd des Gedicht-Ichs auf, überraschend genau nachvollziehbar, und dabei lückenhaft und unerklärlich:
[…] What did it mean,
if anything? He got sweatmarks
all these day, but never a map before.
What did it mean, / if anything? – das wäre doch eine griffige Formel für Sweeneys Lyrik, wenn, ja wenn, irgendjemandem mit solchen oder anderen Formeln geholfen wäre, im Angesicht des einzelnen, kompromisslos beiläufig gelingenden Gedichts.
Und davon gibt es in Rosa Milch so einige. Wagners gewohnt nüchternes Nachwort konstatiert eine „unbändige Neugier, die aus jedem einzelnen der Gedichte Matthew Sweeneys spricht.“ Sweeney selbst gesteht diese Neugier ganz offen ein in den Texten, und es ist die charmante Unvermitteltheit, mit der das geschieht, die süchtig macht:
When they opened the manhole
on the street outside our house
I wanted to climb into it.
(Aus „The Tunnel“)
Tom Bresemann, Die Berliner Literaturkritik, 8.5.2008
Zwiebeln im Morgengrauen
– Alternativer Realismus: Die schauerlich-schönen Gedichte des Iren Matthew Sweeney. –
An Matthew Sweeneys Ende der Welt begann der Atlantik gleich vor der Haustür. Die Fischkutter waren Punkte weit draußen am Horizont, die Wellen leuchteten nachts grün, und Schiffswracks moderten am Meeresgrund. Der Strand war nichts als ein Haufen Kiesel, und es gab ein Haus mit einem Dutzend eiskalter Schlafzimmer darin, wo ab und an ein freundliches Gespenst am Fußende eines Bettes auftauchte.
Hier ist Matthew Sweeney aufgewachsen: in der Grafschaft Donegal im äußersten Nordwesten Irlands, einem rauen, menschenleeren Gestade, das von Hochmooren, steilen Klippen und heftigen Stürmen, vom Fischfang und vom Meer geprägt ist, das regelmäßig seinen Tribut fordert.
Gesunkene Schiffe und U-Boote, Gerippe am Meeresgrund, Schädel, in denen Tintenfische und Krebse schlafen, Fischer, die ertrunken sind, weil sie nicht schwimmen können, aber auch Geister, Spukgestalten, Schlachter, die nächtens aus dem Grabe wiederauferstehen, um Blutwurst oder Leberfrikadellen zuzubereiten: Sie bevölkern Matthew Sweeneys schaurig-schöne Gedichte voller schwarzem Humor. Was nicht nur der Allgegenwart des Todes im Leben der Menschen von Donegal geschuldet ist, sondern ebenso Matthew Sweeneys Studium in London und Freiburg sowie seiner intensiven Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und seinem besonderen Faible für Büchner, Kleist, Trakl, Kafka, Grass, Böll: „Die Tradition, in der ich verwurzelt bin, die irische Tradition“, sagte Matthew Sweeney einmal, „ist offen für das, was ich als ,Alternativen Realismus‘ bezeichne, dafür, die Grenzen des Realismus zu überschreiten. Und sie lädt dazu ein, Komisches und Ernstes zu vermischen. Dann entdecke ich auf einmal an einer anderen Ecke genau das Gleiche, nur mit einem Anstrich von Düsterkeit – europäischer Düsterkeit.“
Beide Traditionslinien haben Eingang in Matthew Sweeneys vortrefflich von Jan Wagner übersetzte Gedichte Rosa Milch gefunden, in denen er mit wenigen Strichen von unerhörten Begebenheiten sowie den Abgründen des Alltags erzählt: vertrackte Geschichten wie im titelgebenden Gedicht, in dem ein Abt und seine Mönche dem Wunder der „Rosa Milch“ auf der Spur sind; wie in „Die Türen“, wo in einem verlassenen Haus die Figuren auf den alten Porträts einen plötzlich anblicken, die Schlösser in den Türen von allein zuschnappen und man sich als Leser in einem verschachtelten System wie von M.C. Escher wiederfindet, ohne je zu begreifen, wie man da hineingeraten ist; wie in „Sweeney“, in dem einem Mann Federn durch die Poren wachsen, er sich als Krähe auf der Eiche hinterm Haus wiederfindet, sich im Nestbau übt und jedesmal geknickt aufkrächzt, wenn er „jemanden mit einer Flasche Wein“ oder den „indischen Lieferservice“ vorfahren sieht.
Von der Verwandlung eines Mannes in eine Krähe ist es nicht weit zu den rumänisch kolorierten Gedichten Matthew Sweeneys, der wie so viele Iren der Heimat den Rücken gekehrt und in jüngster Zeit vor allem als Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in Berlin sowie in Timisoara gelebt hat: Auch hier finden sich surrealistisch anmutende Motive wie in „Das verwandelte Haus“, wo Matthew Sweeney knackiges, pralles Gemüse Besitz von einem Haus ergreifen lässt, als habe er eine Variation auf Giuseppe Arcimboldos Gemälde „Der Gemüsegärtner“ im Sinn gehabt. Hinzu kommen neue, üppige Farben, Aromen und Geräusche: das Stechmückengesirre in den heißen, schlaflosen Sommernächten, das Hundegebell und Orgeln von Autoalarmanlagen, der Duft gebratener Zwiebeln kurz vorm Morgengrauen, der einen rauslockt auf den Balkon.
Oft ist es ein hypothetisches „Was wäre wenn“, das in Matthew Sweeneys Gedichten den Einstieg in bestrickende Fantasielandschaften liefert: etwa die Aufforderung, sich vorzustellen, es regneten „die Haare sämtlicher Friseurgeschäfte Chinas auf die Welt hinab“, die zunächst als weiche Büschel auf dem eigenen Gesicht landen, bald aber alles unter sich begraben, bis man sich an den immer weiter herabrieselnden Haaren verschluckt, sie einem das Gedärm verknoten, in die Augen stechen, die Nase verstopfen.
Bei allem Vergnügen am genüsslichen Spinnen von Erzählfäden, bei aller Freude am Skurrilen und Makabren sind die tragischen, ja von Gewalt durchzogenen Momente des Lebens bei Matthew Sweeney immer präsent – auch in den Büchern, die er für Kinder schreibt wie beispielsweise in „Fuchs“, der warmherzigen und doch nichts beschönigenden Geschichte über die Freundschaft zwischen einem zehnjährigen Jungen und einem Obdachlosen. Sweeneys Gedichte und Geschichten sind von großer sprachlicher Klarheit – gepaart mit einer magischen Anziehungskraft, die den Leser in die verschachtelten Gebäude seiner Vorstellungskraft hineinzieht und ihn noch einmal jene wohlig-schaurige Faszination erleben lässt, mit der man als Kind mit offenem Mund den unerhörtesten Schaudergeschichten und dem wildesten Seemannsgarn zuhörte.
Katharina Narbutovic, Der Tagesspiegel, 2.4.2008
Schnurkünstler
– Auf Geisterspuren: Der irische Poet Matthew Sweeney. –
Wer mit Matthew Sweeney in die Arktis reisen will, der sollte unbedingt eine große Rolle Schnur einpacken. Denn die Inuit dort oben, berichtet der irische Dichter, hätten die Fähigkeit, Schnüre Geschichten erzählen zu lassen:
Jeder Dichter ist
zugleich ein Schnurkünstler
und spricht damit auch die Kinder an.
Was genau man im Eis anstellen muss, um den Schnüren ihre Erzählungen zu entlocken, bleibt Sweeneys Geheimnis. Doch immerhin gibt er einen Wink:
Noch heute erzählt ein Schnurkünstler
der Inuit ganzen Horden
von Besuchern diese Geschichten,
ohne ein Wort zu sagen.
Gut vorstellbar, dass Matthew Sweeney selbst ein solcher Schnurkünstler ist. Wahrscheinlich benutzt er eine besonders feine Schnur, mit dem sich die Verse locker knüpfen lassen. Und gewiss wird er dabei kein Wort sagen – oder jedenfalls nur Worte verwenden, die etwas ganz anderes erzählen. Matthew Sweeney verfügt über die Gabe, die scheinbar feste Grenze zwischen dem Wirklichen und Möglichen durchlässig zu machen. Wenn er über die Landschaft des irischen Nordens schreibt, wo er 1952 geboren wurde, hat das nichts von Heimatliteratur, ja nicht einmal die Natur scheint ihn recht eigentlich zu interessieren.
Eher schon wird ihm die Küste mit ihren Wellen und Möwen zum Sprungbrett. Wie jener amphibische Schwimmer, den er in einem Gedicht beschwört, „nackt wie ein Delphin in der Augustsonne“, bevorzugt er das, was sich im Wasser befindet, und sei es ein gesunkenes U-Boot:
Ich tauche zum Kommandoturm hinab, steige ein.
Bläschen eilen mir nach, sind hinter und über mir,
doch ich bin schnell.
Überhaupt hat Sweeney ein Faible für den Untergrund. All die Tunnel, Löcher und Keller, die Ausgrabungsstätten und U-Boote zeigen seine liebste Vorstellung: Das Wesentliche spielt sich unter der Oberfläche ab. Dabei sind es keine idyllischen Zauberwelten, die er entdeckt, eher Särge, Skelette und Geisterspuren, die seine Nähe zur schwarzen Romantik verraten. Bisweilen entfalten die Verse auch Szenen harter Gewalt, die in ihrer Offenheit etwas Verstörendes haben. An solchen Stellen führen die Verse tief in eine finstere Rätselhaftigkeit hinein. Die Wirkung verdankt sich nicht zuletzt Sweeneys Kunst, seinen erzählerischen Grundton fast ohne Metaphern zu entwickeln. Vielmehr werden ihm die Dinge zu Bildern, indem er Einzelheiten genau beschreibt und langsam Szenen aufspannt.
Dem Vergangenen, Morbiden – das mag die versteckte Hoffnung dieser Gedichte sein – wohnt eine eigene Kraft inne. So können die letzten Früchte eines alten Hauses die Zimmer in kulinarische Höhlen verwandeln:
Aus den Reben,
die von der abgestützten Tür bis hin zum
Schrottauto wuchsen, ließ sich ein Wein keltern,
der unerschwinglich war, und das Basilikum,
das die Scheiben in den Fensterrahmen ersetzte,
ergab ein Pesto, das jedes in Genua übertraf.
Manchmal scheint Sweeneys Kunst der Verwandlung zu durchschaubar. Dann wird er jener Prämisse untreu, die er in dem Gedicht „Das Eishotel“ so genau benennt:
Ich werde in der Eingangshalle stehen,
die diesjährige Architektur bewundern,
es dafür lieben, dass es sich selbst nie gleicht,
weil Eis schmilzt und hier alles aus Eis ist.
Ähnlich, aber niemals dasselbe – das wäre das Ideal von Sweeneys Poetik.
Doch vielleicht ist dieser Leseeindruck auch ein wenig der Auswahl des Bandes geschuldet. Jan Wagner hat eine schöne Linie durch Sweeneys Motivschichten gefunden und die einzelnen Gedichte anhand kleiner Korrespondenzen verknüpft. Das führt beim Lesen manchmal zu anregenden Entdeckungen, aber auch zu einer gewissen Ermüdung. Umso bereitwilliger folgt man Wagners Übersetzungen. Matthew Sweeney benutzt fast immer freie Rhythmen, die er locker fügt. Trotzdem erarbeitet er sich über Klänge und Enjambements eine eigene Ordnung und Versspannung. Wagner holt das geschickt im Deutschen ein, indem er Satzteile umstellt oder verändert. So knackt er auch Sweeneys Eigenart, Assonanzen und Reime zu verschleifen. Am Ende kann man sogar in den Lauten spüren, wie sich das Apartment einer jungen Dame verwandelt, mitsamt „den roten Blüten der Kakteen, den Fühlern ihrer Wohnung“.
Nico Bleutge, Süddeutsche Zeitung, 9.5.2008
Raus aus dem Grab
Selten verlief eine familiäre Partie Poker friedlicher. Wenn Onkel Charlie verliert, dann erlassen ihm seine Anverwandten einfach die Spielschulden. Dass auch seine Gewinne unter den Mitspielern aufgeteilt werden, stört ihn nicht. Denn Onkel Charlie liegt tot in seinem Sarg, bereit, am nächsten Tag beerdigt zu werden. Hat man diese Konstellation im Gedicht „Poker“ von Matthew Sweeney erst einmal akzeptiert, ist auch das übrige lyrische Universum des irischen Dichters nicht weiter verwunderlich. Tote Schlachter erstehen allnächtlich aus ihrem Grab, um ihrem ehemaligen Gewerbe nachzugehen, und in „Rosa Milch“, dem titelgebenden Gedicht des Sammelbandes, lernen wir, dass nicht etwa rote Nelken als Tierfutter die außergewöhnliche Färbung erzielen, sondern ein Tropfen Blut, frisch von der Schweinekeule, dem Abt die Ziegenmilch schmackhaft macht. In klaren Bildern und einer geraden Sprache lässt Sweeney uns an seiner Welt des Bizarren teilhaben. Das zeitgemäße Vokabular erhält in der gelungenen Übersetzung einen leicht altmodischen Klang. Die zweisprachige Gedichtsammlung erlaubt es, anhand von Matthew Sweeneys Lyrik, die nun erstmals in Deutschland erscheint, zu beurteilen, ob das schwimmende Pferd von seinem Reiter beim Erreichen der Isle of Wight angemessener mit einer Schüssel Cider oder mit Apfelwein belohnt wird
scht, Frankfurter Allgemeine, 18.4.2008
Surreale Wörtergemälde
Es gibt Gedichte, die man wie ein Gemälde betritt, auf dem eine rätselhafte Szene dargestellt ist, oder wie eine unerforschte Landschaft, wie ein Haus mit Räumen voller verhängter Möbelstücke. Diese Gedichte konfrontieren uns mit dem scheinbar Absurden oder zumindest Unerklärlichen, um uns direkt an den Anfang des Staunens zu versetzen. Matthew Sweeney versteht es auf besonders subtile und unterhaltsame Weise, derartige Szenen zu entwerfen. Sie kommen auf den Leser wie einem grösseren, verborgenen Zusammenhang entrissene Ausschnitte, meist in Gestalt kurzer Erzählungen oder anekdotenhafter Einwürfe.
Eingefleischte Realisten werden vielleicht wenig Vergnügen aus diesen Gedichten ziehen, denn Sweeneys unverkennbare Fabulierlust ersinnt unerhörte Begebenheiten und klopft die Welt nach neuen, alternativen Möglichkeiten surrealen oder makabren Charakters ab. Oft führt bereits der Anfangssatz in die für einen Moment aufgehobenen Gesetzmässigkeiten hinein: „1954 landete ein Ufo in Irland, in Donegal, im Garten hinter meinem Haus“, „Stell dir vor, die Haare sämtlicher Friseurgeschäfte Chinas regneten auf die Welt hinab“, „Sieben Pferde entstiegen dem Wannsee und galoppierten triefend zu Kleists Grab“.
Immer bleiben die allenthalben anzutreffenden skurrilen, absurden, grotesken Elemente plausibel und verlieren sich nicht in gewolltem Unsinn, immer wecken sie die Neugier und regen die fragende Phantasie an. Im Gedicht „Rosa Milch“ beispielsweise fressen die Ziegen eines Klosters rote Nelken und geben anderntags rosa Milch. Um die Blumen zu schonen, versuchen die Mönche, diese ungewöhnliche Färbung mit anderen Mitteln zu erreichen – vergebens. Unterdessen (erfährt man beiläufig) tropft in der Klosterküche Blut von aufgehängtem Fleisch in eine Milchkanne. Sweeney hat dieses Gedicht dergestalt arrangiert, dass fast alle Zusammenhänge offenbleiben; die Szene lässt sich daher in verschiedene Richtungen weiterdenken oder erklären. Doch gleich, zu welchem Ergebnis man kommt, diese rosa Milch ist mit schwarzem Humor angereichert, und der spottet köstlich über die Wundergläubigkeit des Menschen.
Andere Visionen Sweeneys sind dunkler und bedrohlicher, sie belassen im Unklaren, ob es sich nur um die ungewohnte Perspektive einer vermeintlich realen Szene handelt oder jene Traum- und Albtraumwelten, die aus der Realität gespeist werden und deren Charakter schonungslos enthüllen. „Der Ladendieb hat sich die Haare geschnitten und ein Haus am Meer gekauft“, wo er vollkommen unauffällig lebt — aber warum? Und wer ist das Paar im Haus am Strand, das auf ein Boot wartet? Und aus welchem Grund steht ein U-Bahn-Schacht in Rauch und Flammen? In welcher Stadt hängt ein Mann am Laternenpfahl? Warum ergibt ein Schweissfleck auf einem T-Shirt die Karte von Irland? Und wer ist der Mann, der in einem unterirdischen Loch lebt und über eine Schreckensherrschaft schreibt? Nie werden Personen und Orte konkretisiert, aber man darf sie getrost mit realen Geschehnissen in Verbindung bringen.
Jürgen Brôcan, Neue Zürcher Zeitung, 26.7.2008
GLASAUGE
für Matthew Sweeney
wie seltsam, sagte ich zu meiner frau,
daß gerade dieses ding, das derart tot
in seiner höhle hockte, viel zu blau,
das er in einem sommer fast beim pferdetoto
verwettet hätte und nach ein paar bieren
herausnahm, schwor, wer jetzt hineinrief,
könnte noch viele stunden lang sein echo hören,
das er zur freude all der nachbarskinder
blitzschnell verschwinden ließ in seiner faust,
worauf ein geldstück in der leere klemmte,
ein silberaar in seinem schädelhorst;
daß jetzt nach all den jahren, da die fremden,
alle im leuchtendweißen overall
herabgeschwebt aus ihrer galaxie,
gesandte von oben, der hauptstadt, von frau holle,
mit schaufeln und plastiksäcken jeden klacks
ans licht geholt haben, ordnen und vermerken,
in einer halle voller knochen,
die unser dorf ist, diese blinde scherbe
als einziges lebendig scheint, weit offen
auf seiner plane ruht, darauf besteht,
uns anzustarren, uns genau
fixiert, wie um zu sagen: bleibt und seht,
fast flehend und, ehrlich, immer noch viel zu blau.
Jan Wagner
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + PIA + Kalliope
Porträtgalerie: Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2 + 3
Nachrufe auf Matthew Sweeney: Tagesspiegel ✝︎ Badische Zeitung ✝︎
signaturen ✝︎ FAZ ✝︎
Matthew Sweeney stellt vor und liest aus seiner zehnten Gedichtsammlung Horse Music.
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.Matthew Sweeney, Rosa Milch


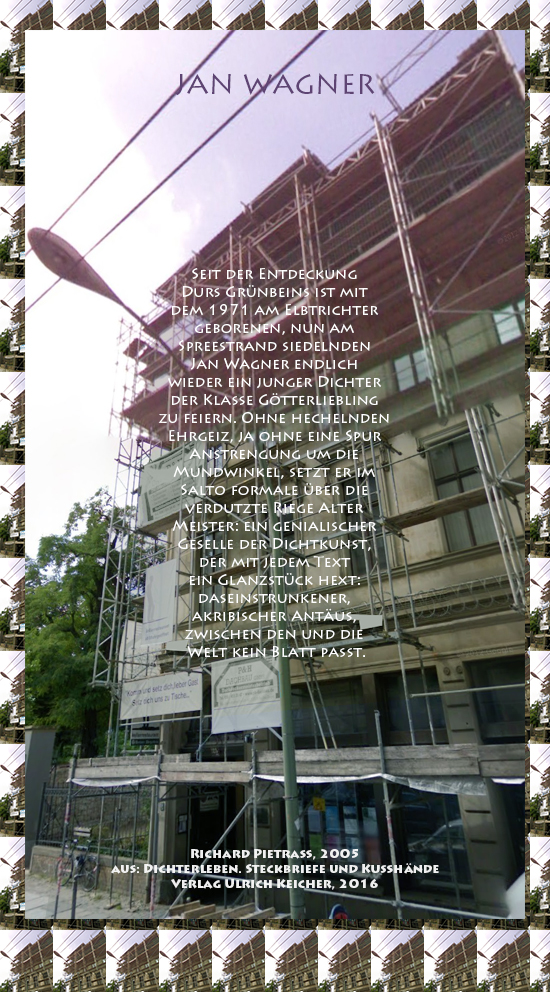












Schreibe einen Kommentar