Michael Buselmeier (Hrsg.): „die aprikosenbäume gibt es“
„ICH SCHREIBE WIE DER SCHNEE“
– Begegnungen mit Inger Christensen. –
Kennen gelernt habe ich Inger Christensen im Oktober 1988 im Künstlerhaus in Edenkoben. Bei einem dänisch-deutschen Lyrikertreffen habe ich sechs ruhige, klare Gedichte von ihr (aus dem Band det/das) und fünf mythisch dunkle von Jørgen Sonne übersetzt, doch seltsamerweise kein einziges von Pia Tafdrup, Ivan Malinowski und Klaus Rifbjerg, die auch dabei waren. Es war die erste Veranstaltung der Reihe Poesie der Nachbarn: Dichter übersetzen Dichter, und uns mangelte es noch an Erfahrung. Ich hatte Skrupel und fühlte mich wie ein Hochstapler, weil ich die dänische Sprache nicht beherrschte. Auch hatte ich vorher nie ernsthaft versucht, Gedichte zu übersetzen, schon gar nicht mithilfe von Interlinearversionen. Die Differenz zwischen wörtlicher Übersetzung, poetischer Übertragung und freier Nachdichtung war mir im vollen Umfang nicht bewusst.
Nach anfänglichem Zaudern ging ich ans Werk. Ich bemühte mich, dunkle Textstellen aufzuhellen und möglichst lesbare, also „deutsche“ Gedichte herzustellen. Jørgen Sonnes Deutsch war von liebenswerter Fehlerhaftigkeit, doch er maßte sich an, nahezu alles besser zu wissen und verteidigte seine Versionen lautstark, selbst wenn sie im Deutschen keinen Sinn ergaben. Inger Christensen sprach ein vorzügliches Deutsch, aber sie protestierte nie, sah mich nur etwas traurig an, wenn ihr eine von mir gewählte Formulierung missfiel. Sie hat mir Mut gemacht, auf meine Art an den Texten weiterzuarbeiten, und so sind wir uns ein wenig näher gekommen.
Sie schien überhaupt nicht gern zu sprechen. Meist saß sie schweigend und rauchend da, am langen Tisch zwischen den anderen, ein sich stetig leerendes Glas Weißwein vor sich, und beobachtete durch dicke, dunkel gefasste Brillengläser das Geschehen: „Ich habe versucht die Welt auf Abstand zu halten. Ich bin fremd. / Ich fühle mich am wohlsten wenn ich fremd bin“, heißt es in einem ihrer frühen Gedichte. Einmal vertraute sie mir mit leiser Stimme an, ihr Vater sei ein Schneider gewesen und ihr Lehrerinnen-Studium alles andere als selbstverständlich. Sie war 1988 in Deutschland noch kaum bekannt. Das Großgedicht alphabet, ihr wohl bedeutendstes Werk, das vor allem ihren Ruhm begründen sollte, war gerade, in Hanns Grössels Übertragung, bei Kleinheinrich erschienen, und sie schenkte es mir mit einer (dänischen) Widmung.
Inger Christensen liebte die Vorstellung, nicht sie schriebe ein Gedicht, sondern die Sprache selber, so als unterhielten Worte und Welt eigene geheime Verbindungen, hinter denen die Person des Autors zurücktritt und zumindest so tut, als beobachte sie nur, was – sich fortzeugend – geschieht.
ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das flüstern der hände
der füße der lippen
der haut und des geschlechts
Das sich selbst schreibende Gedicht entstehe, sagt sie in einem ihrer ebenso scharfsinnigen wie tiefgründigen poetologischen Essays, „mit derselben Leichtigkeit“, mit der eine Pflanze Blätter und Blüten treibe. Von Biologie, überhaupt von den Naturwissenschaften, verstand sie einiges, auch mit Musik und Sprachphilosophie hatte sie sich beschäftigt. Doch mehr noch als von den Theorien Noam Chomskys schien sie vom Geist der deutschen Romantik, besonders von Novalis’ Fragmenten inspiriert. „Wenn man den Menschen nur begreiflich machen könnte“, schreibt Novalis 1798 ganz in Inger Christensens Sinn, „dass es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei. Sie machen eine Welt für sich aus – sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus.“ Der Umschlag von rationaler Struktur oder mathematischem System in Poesie und Gesang, die Verwandlung von extremer Künstlichkeit in eine neue, der ursprünglichen vergleichbare Sprache des „Gefühls“ oder „Gemüts“ prägt Christensens grandiose, zyklisch angelegte Schöpfungen det/das (1969), alphabet (1981) und Das Schmetterlingstal (1991).
Auch das folgende Zusammentreffen mit Inger Christensen fand in Edenkoben statt, im Jahr 1992, wieder ein südpfälzischer Herbst, wieder ein später Oktober, ein Wochenende mit „Schlossensturm“ (Goethe) und Dauerregen. Bereits am Nachmittag war die Dämmerung aufgezogen, und ich watete durch die nebel-verhangenen Weinberge, die sich in Schlamm auflösten, auf das Künstlerhaus zu. Trat dabei, was mir noch nie passiert war, auf einen Vogel, Amsel oder Star, der am Rand einer Rebzeile kauerte und mein Kommen nicht bemerkt hatte – ein panisch zuckender, kreischender, mich zutiefst verwirrender Moment.
Drinnen im Saal stand Inger Christensen bereits aufrecht und wie immer schwarz gewandet am Pult, leise, doch überaus intensiv psalmodierend, mit dänischem Akzent, während der Regen wie mit Vogelschnäbeln an die Fensterscheiben pickte und der Sturm wie mit Flügeln gegen sie schlug. Ein Rauschen oder Summen, ein von jeder Sinnvermittlung befreites Singen kam aus ihrer Brust, ein gleichförmiges, fast anonymes Sprechen, so als kämen die Verse mittels mystischer Kontemplation tatsächlich von selbst zur Welt. Mein bald darauf entstandenes, Inger Christensen gewidmetes Gedicht „Oktoberlied“ versucht die eigenartige Stimmung dieses Nachmittags einzufangen:
Wen du nicht verlässest
Genius
ganz in Schwarz
schwebt er über dem Flutschlamm
auf klirrenden Schnapsflaschen
und trägt das Alphabet
der Menschengeschichte vor…
Ich habe Inger Christensen auch andernorts getroffen, etwa bei der Verleihung des Petrarca-Preises im Sommer 1994 in Weimar, wo wir im Liebhaber-Theater auf Schloß Kochberg direkt hintereinander lasen. Ich trug für sie „Oktoberlied“ vor. Ich habe auch unseren Auftritt in dem badischen Städtchen Hockenheim, das ganz dem Motorsport verbunden ist, nicht vergessen. Werner Aust, Buchhändler und Herausgeber der aufstrebenden Literaturzeitschrift Hirschstraße, hatte Inger Christensen im Mai 1994 in seine „Bücherecke“ eingeladen, und sie hatte darauf bestanden, dass ich sie begleite. In Hockenheim wusste so gut wie niemand, wer sie war, und so bildeten wir paar aus Heidelberg Angereisten ein spärliches Publikum. Sie ließ sich nichts anmerken und las so eindrücklich lispelnd wie immer. Doch Werner Aust hatte sich mit seinen hoch literarischen Ambitionen am falschen Ort finanziell übernommen, musste erst den Buchladen, dann auch die Zeitschrift aufgeben und verschwand Ende der neunziger Jahre spurlos – ein Opfer seiner Leidenschaft für die Poesie.
Im April 2003 erhielt ich von Inger Christensen aus Kopenhagen einen handgeschriebenen Brief, der so begann:
Es ist alles lange her, aber damit du weißt, dass ich inzwischen an dich gedacht habe, schicke ich dir als Beweis dieses Buch.
Es handelte sich um Hängebrücken. Berliner Renshi 1999, an dem sie zusammen mit Makoto Ôoka, Jürgen Becker und Adam Zagajewski beteiligt war. Ich blätterte das Buch flüchtig durch und legte es beiseite. Erst Monate später, als ich über Dritte erfuhr, dass Inger gekränkt sei, von mir keine Antwort auf ihre Zusendung erhalten zu haben, las ich das Renshi und entdeckte dabei auch das folgende, 7. Kettenglied:
Einmal habe ich Michael Buselmeier versprochen,
über die Hagebutten der Hundsrose zu schreiben.
Einmal habe ich der Dänischen Enzyklopädie versprochen,
über die gelbe Quitte, cydonia oblonga, zu schreiben.
Ich habe es nie geschafft – Pause – Pause.
Erst heute weiß ich, dass die japanische Quitte
rote Blüten und kleinere Früchte hat
und deshalb besser zu dem Gedicht passt,
das in der Frucht drinnen geschrieben steht.
Mit schlechtem Gewissen, wenn auch durchaus geschmeichelt, schrieb ich ihr zum Dank das Gedicht „Die Hagebutten“, das 2005 im Aprilheft der Akzente erschien:
Du mahnst mich zurecht an die Hagebutten, Inger,
dieses Spätjahr schwankten sie besonders dicht
vor dem dauerblauen Himmel über den Weinbergen
Edenkobens und ich dachte an dich, als ich sie
im Vorbeigehen berührte, wie Trauben schwer,
dunkelrot und noch immer unbedichtet.
Was konnte ich tun, als sie mit klebrigen Fingern
abzupfen und in der Hosentasche aufbewahren
bis zu unsrem nächsten Geflüster auf weißem Papier.
Großmutter, die sie früher zu Marmelade
eingekocht hat, ist gestorben. Die Fensterläden
ihres Häuschens am Bach klappern im Wind.
Soll ich sie festzurren, soll ich die Hundsrose
ausgraben? Schreiben wie der todgeweihte Herbst schreibt,
jäh wie die Bachweiden sich biegen, die Malven
sich krümmen mit einer letzten Blüte ganz oben,
das Schlusslicht, das träge verglüht wie die Kohlstrünke
des Nachbarn im Reif, die Vögel verwelken.
Immer, wenn ich Inger Christensen traf, haben wir uns über die Wegwarte („so endlos blau“) oder die Hagebutte verständigt, bescheiden am Rand von Wegen und Feldern wachsende und wenig beachtete Pflanzen, die eine sollte für den Sommer stehen, die andere legte ich ihr im Herbst auf den Tisch. Vielleicht waren wir auch nur froh, ein Pflanzenthema gefunden zu haben, das uns half, nicht über Persönliches oder über Literatur sprechen zu müssen.
In ihrem Brief verstand es Inger Christensen durchaus, eine persönliche Nähe anzudeuten, die sonst kaum zu bemerken war. Als wir uns im Herbst 2005 wieder begegneten – es war das letzte Mal –, ging sie auf unsere Briefe und Hagebutten-Gedichte mit keinem Wort ein. Sie wirkte gealtert, das Gesicht maskenhaft, der Blick durch die Brille starr in die Ferne gerichtet. Manchmal kam sie mir sogar wie eine biedere alte Dame von 70 Jahren vor, der man über die Straße helfen möchte. Doch dann las sie im Künstlerbahnhof Rolandseck aus ihren gewaltigen Schöpfungsgedichten alphabet und Das Schmetterlingstal vor, die von Naturkunde, Tonkunst und magisch belebten Landschaften zeugen – eine Feier der Poesie und des Todes, der sie umgab:
ich schreibe wie der winter
schreibe wie der schnee
und das eis und die kälte
und das dunkel und der tod
schreiben.
Anderntags trug ich ihr Köfferchen, das mir federleicht vorkam, zum Zug, und wir fuhren nach Edenkoben weiter, wo sie etwa das gleiche Programm absolvierte, aber eingangs so tat, als wisse sie noch gar nicht recht, was sie vorlesen sollte. Sie sah aus dem Zugfenster und schwieg, in sich eingesponnen, und ich hätte sie gern gefragt, ob sie ab und zu noch Gedichte schrieb oder das Schreiben nicht schon vor vielen Jahren eingestellt hatte…
Über Edenkoben und das Paradies hat sich Inger Christensen in ihrem erstmals 1994 erschienenen Essay „Die ordnende Wirkung des Zufalls“ Gedanken gemacht. Selbst im Herbst sei dort „die Paradiesillusion perfekt“: schon der allgegenwärtige Wein und die „Vorbereitung des Rausches“ trügen dazu bei. Sie schildert die „schwarze Wolke“ der Stare – sie nennt sie „Weindrosseln“ oder auch „Paradiesvögel“ –, die im Oktober die Luft über den südpfälzischen Weinbergen erfüllen. Im Bemühen, herauszufinden, was „Edenkoben“ bedeutet, greift sie, wie viele andere vor ihr, zur volksetymologischen, also streng genommen falschen Erklärung vom „Garten Eden“ und vom „Koben“ (dem Schweinestall, der kargen Hütte), wobei sie das Künstlerhaus freilich in ein überaus günstiges, hilfreiches und rettendes Licht rückt. Sie konstatiert nämlich „eine Welt, der das Paradies mangelt, wo es aber ab und zu einen Stall gibt, der uns dazu bringt, uns an das Mangelnde zu erinnern. Ein Ort, wo wir Fremde sind und dennoch zu Hause. Ein Ort, wo wir allein sind und dennoch zusammen.“
Ähnlich ein spätes, auf Januar 2007 datiertes, in deutscher Sprache geschriebenes Gedicht, das Inger Christensen dem Lyriker Gregor Laschen gewidmet hat, dessen Vor- und Nachname sich aus den Anfangsbuchstaben der dreizehn Verse ergibt, also ein Akrostichon. Es trägt den Titel „Erinnerung an Edenkoben“:
G rün in Grün und später Blau in Blau
R egen stürzt schon aus den Vogelwolken
E denkoben überschwemmt von Zwitschern
G elb in Gelb dann plötzlich Rot in Rot
O der später dann der reine Purpur
R egenbogen zweimal Regenbogen
L andschaft also draußen vor dem Fenster
A ber Landschaft auch schon eingedrungen
S chon durch meine Augen eingedrungen
C haotisch wo der Weg zu meiner fernen
H and gesucht wird, die als Teil der Landschaft
E denkoben schreiben kann, ganz Wort, ganz
N ame, dennoch Landschaft zweimal Landschaft
Michael Buselmeier
Über dieses Buch
Mit Beiträge von: Michael Buselmeier, Ulrike Draesner, Hanns Grössel, Norbert Hummelt, Ursula Krechel, Gregor Laschen, Lutz Seiler, Pia Tafdrup, Hans Thill und Soren Ulrik Thomsen. Als Inger Christensen im Januar 2009 starb, hatte sie zwar den verdienten Nobelpreis nicht erhalten, doch ihr Ruhm in der literarischen Welt, zumal der deutschen, war beträchtlich. Er basiert vor allem auf ihren zyklisch angelegten Großgedichten das (1969), alphabet (1981) und dem Sonettenkranz Das Schmetterlingstal (1991). Mit dem Künstlerhaus Edenkoben war Inger Christensen seit 1988 verbunden. Damals trat sie im Rahmen eines dänisch-deutschen Lyrikertreffens zum ersten Mal auf. Ihr traumhaft singendes Sprechen bezauberte alle, die ihren „Schöpfungsgedichten“ lauschten. Im selben Jahr erschien alphabet in der deutschen Übersetzung von Hanns Grössel, ein Werk, das den Umschlag von mathematischem Denken in Poesie und Gesang demonstriert. Über Edenkoben und das Paradies hat sich Inger Christensen in dem 1994 erschienenen Essay „Die ordnende Wirkung des Zufalls“ Gedanken gemacht.
Verlag Das Wunderhorn, Ankündigung
Zum 80. Geburtstag des Herausgebers:
Michael Buselmeier: Kurze Bilanz
Sinn und Form, Heft 2, März/April 2019
Volker Oesterreich im Gespräch mit Michael Buselmeier
Rhein-Neckar-Zeitung, 25.10.2018
Oleg Jurjew: Jugendlicher Buselmeier
Michael Braun und Ralph Schock (Hrsg.): Nichts soll sich ändern, Wunderhorn Verlag, 2018
Michael Zeller: „…eben noch ein Kind…“
Michael Braun und Ralph Schock (Hrsg.): Nichts soll sich ändern, Wunderhorn Verlag, 2018
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram +
IMDb + KLG + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + IMAGO
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Fakten und Vermutungen zu Inger Christensen + Instagram + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


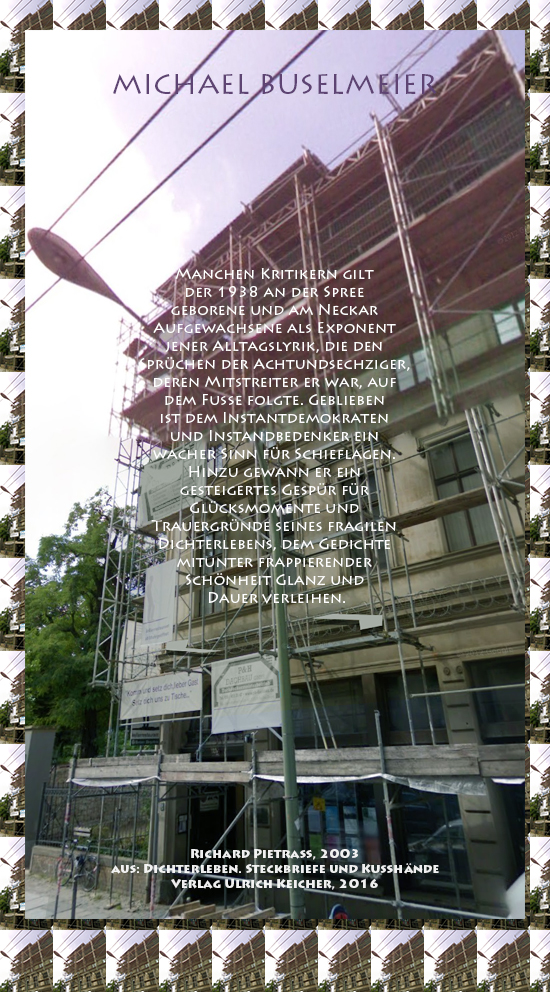
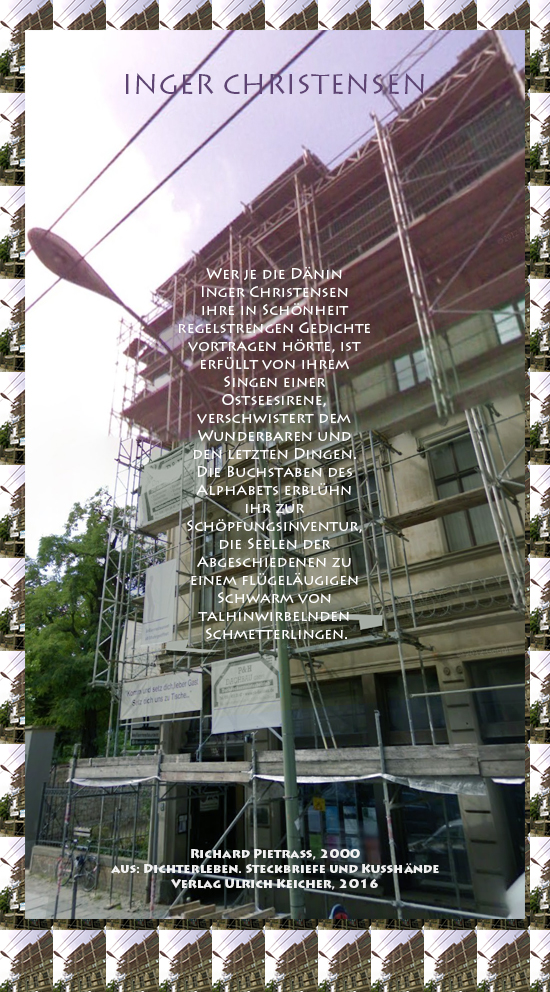












Schreibe einen Kommentar