Michael Hamburger: Das Überleben der Erde
VIII
Mond beinah voll, unverhüllt,
Zwei klare Sterne,
Andere flimmernd, verrätselt
Im Flies von Bewölkung
Das selbst so weiß leuchtet,
Es überstrahlt die ferneren Lichter.
Wogend, weit wie ein Meer.
Scheinbar ganz ruhig, ohne Strömung
Als könnte kein Wind,
Keine Planetenbahn es verschieben.
Und hing vielleicht zu derselben
Oder anderen Stunde eines anderen Jahres,
Jahrzehnts, Jahrhunderts, dort oben
Und zeigte sich anderen Augen.
Zur selben Stunde und später
Wird der nächsten Nacht vollerer Mond
Von dichter Bewölkung verdunkelt,
Die hellere Strahlung gebrochen
Von Cumulus, schwarz.
Für dieselben Augen ist es
Auf einmal ein herbstlicher Falter
Der aus dem Geißblatt,
Ein verspäteter Schmetterling
Der aus der späten Buddleia trinkt,
Wenn kühl dem Frühlicht
Noch Malvröten und Gelbe antworten.
Das Überleben der Erde
sucht die das Überleben gewährende Kontinuität, verstanden als das Gegenteil von Historie: Kontinuität ist da in der Vegetation, in der Tierwelt, in den Böden und im Wachsen. Vor allem die Vögel bewahren die Kontinuität der Erde, indem sie singen – ein überraschendes, fremdes Lob; aber auch die Schmetterlinge und die – scheinbar von innen her leuchtenden – Blumen. Diese Wesen und Dinge bedeuten in ihrer Unscheinbarkeit und Winzigkeit: Anfang. Das Gedicht ist darum Loyalität zu den Anfängen. Es sucht die Zeichen der Selbstlosigkeit, Ungesteuertheit, Machtlosigkeit des Planeten, die Zeichen der unbeabsichtigten Harmonien und der Liebe.
Folio Verlag, Ankündigung, 1999
Das Überleben der Erde
Die Werke des großen europäischen Lyrikers Michael Hamburger werden vom folio-Verlag sorgfältig betreut und kontinuierlich in zweisprachigen Ausgaben vorgestellt.
Der jüngste Lyrik-Band heißt Das Überleben der Erde und stellt ein einziges Gedicht mit neun Abschnitten dar.
Die Dynamik der Texte resultiert in erster Linie aus der Beschäftigung mit der Natur, denn der Mensch ist der Natur immer einen Schritt hintennach, wenn er diese durch den Jahreskreis begleitet.
Wenn jetzt ohne Vermittlung des Frühlings
Nach Dürre und eisigem Wind verspätet
Ein Kuckuck ruft (…) (S. 49)
Immer wieder setzt die Natur ein und bringt das Gedicht zum Ausbruch, ständige Neuansätze suggerieren, daß es jetzt wirklich losgeht, aber dann muß erst das Jahr ablaufen, mit ständigen Neuansätzen, so daß das Jahr letztlich gar nicht fertig wird.
Eine ähnliche lyrische „Anrufungs-Schneise“ wie durch die Natur zieht sich durch die Generationen. Unvermittelt sind die Enkel aufgefordert, auf etwas zu achten oder etwas zu besorgen, und sei es nur das Gleichgewicht zum Überleben.
Für euch, Kinder und Enkel
Geboren, auf Rolltreppen
Zu drängeln, die steckenbleiben,
Dann, in Panik blockiert, brennen,
Wie denn soll sich die Achse erhalten (…) ( S. 83)
Dem großen Gedicht vom Überleben der Erde hat Michael Hamburger viel Melancholie beigemischt, der Text ist getragen von der Distanz der Gelassenheit und der Schluß zeugt von geradezu fröstelnder Gleichmut.
Dann „sprich nicht mehr“, still mach dich für die Stille bereit und „Die Jahre laß in Bewegung“. (S. 105)
Einen Meister erkennt man schließlich daran, daß er sich nicht beschreiben läßt, und Michael Hamburger ist wahrlich ein Meister.
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. II, 1999–2003, Sisyphus, 2015
Interview mit Iain Galbraith
Iain Galbraith: Im Vorwort zu Ihrem 1973 erschienenen Band Ownerless Earth (Ausgewählte Gedichte 1941–1972) erzählten Sie etwas über die Schwierigkeiten, die Ihnen bei der Auswahl für den Band begegnet waren. Sie schreiben von einem damaligen Schriftsteller, einem viel jüngeren, der „durchaus verschieden“ war, dessen Gedichten Sie allerdings nicht „objektiv“ gegenüberstehen konnten, da auch er den Namen Michael Hamburger trug. Können Sie etwas über diesen „anderen“ Schriftsteller erzählen, über seine Anfänge, wie es dazu, kam, daß er Dichter und Übersetzer wurde, welche literarischen Vorbilder er hatte, gegen welche Einflüsse er sich wehren mußte?
Michael Hamburger: Die Verschiedenheit, die ich meinte, kam daher, daß meine frühen Gedichte weder Erfahrungen noch Beobachtungen aufnehmen konnten, mir darum später ähnliche Schwierigkeiten machten wie die abstrakte Gedankenlyrik anderer Autoren. Um das zu erklären, müßte ich eine ganze Autobiographie schreiben – was ich übrigens schon einmal getan habe, freilich ohne auto-psychoanalytisch zu verfahren. In dem autobiographischen Buch, A Mug’s Game, habe ich erzählt, wie verteufelt literarisch ich in frühen Jahren war. Um es kurz zu sagen: meine frühen Gedichte kamen mehr aus gelesener – wenn auch sehr intensiv erlebter – Literatur als aus dem gelebten Leben. Ich identifizierte mich dermaßen mit meinen Vorbildern – mit toten Dichtern und Helden, sogar mit Personen, die von Dichtern erfunden worden waren −, daß mir nun fast alle Gedichte aus dieser Zeit wie aus zweiter Hand vorkommen. Gefühle hatte ich zwar genug, wie auch Gedanken, projizierte und siebte diese aber durch übernommene Vorbilder. Darum wählte ich auch die strengsten, regelmäßigsten und kompliziertesten Gedichtformen. Dazu kam noch ein Streben nach Reinheit der Musik. Mindestens ein Jahrzehnt lang schrieb ich immer wieder liedhafte Gedichte, die ihre Form Konventionen des 17. Jahrhunderts oder spätestens des frühen 19. Jahrhunderts verdankten.
Galbraith: Mir fiel auf, daß in Ihren frühen Gedichten der Krieg als eigentliches Thema recht spät offen auftaucht. Erst Ende der 50er Jahre findet man Gedichte wie „Zwischen den Zeilen“ oder „Treblinka“.
Hamburger: Daß ich kaum Kriegsgedichte schreiben konnte, hängt mit dem eben Gesagten zusammen. Übrigens habe ich schon ganz früh lange apokalyptische Gedichte über den Krieg geschrieben; aber sie waren so schlecht – so rhetorisch und weltfremd −, daß ich sie später nur unterdrücken konnte, sogar in mein erstes Gedichtbuch nicht aufnahm. (Eins von diesen erschien leider in einer Sondernummer der Zeitschrift Poetry London von Tambimuttu; ein zweites wurde ohne mein Wissen mit groben Änderungen des Herausgebers und mit einem falschen Titel als Heft veröffentlicht, während ich als Soldat im Ausland diente. Ich mußte den Vertrieb verbieten und hoffe, daß nur ganz wenige Exemplare des Hefts, Later Hogarth, in Bibliotheken liegen.) Noch während meines Militärdienstes 1943–1947 verdrängte die Literatur die täglichen Erfahrungen und Beobachtungen. Der Anfang eines Durchbruchs stellte sich erst ein, als ich kurz nach Kriegsende in Italien und Österreich von dem dort Gesehenen und Gehörten tief erschüttert wurde. Ich arbeitete dann 1945 bis 1948 an dem Gedichtzyklus „From the Notebook of a European Tramp“, der schon etwas Wirklichkeit einfangen konnte, wenn er auch noch sprachlich und rhythmisch an den alten Vorbildern klebte. Darum habe ich in meine 1984 erschienenen Collected Poems den ganzen Zyklus aufgenommen, sogar früher noch nicht veröffentlichte Teile und auch noch einige frühere Gedichte, die mir etwas über diese Lebensphase sagen – und zwar nicht durch Selbstanalyse oder nur subjektive Stimmungen, sondern durch Bilder, die ich keinem Buch entnahm.
Galbraith: Meinem Gefühl nach stellt ein Gedicht wie „Schmerle“, das in Ihrem gerade auf deutsch erschienenen Band Heimgekommen auch aufgenommen wurde, für den deutschen Leser etwas Ungewohntes dar. Ich glaube, es ist das „Sachliche“, das hier befremdend wirkt: das Gedicht gibt lediglich eine sehr genaue Beobachtung eines nicht vergifteten Fisches in seiner natürlichen Umgebung wieder. Subjektive Elemente sind auf Anhieb nicht erkennbar. Soweit es in einem Gedicht möglich ist, haben Sie hier die Illusion der totalen Äußerlichkeit vermittelt. Was hat Sie zu diesem und ähnlichen „Dinggedichten“ inspiriert?
Hamburger: Das Gedicht „Schmerle“ steht am Gegenpol meiner Entwicklung zur Sachlichkeit und Dinglichkeit und Konkretheit. Seit den 60er Jahren interessiere ich mich immer weniger für die eigene Innerlichkeit und überhaupt für den übertriebenen Individualismus und Subjektivismus, der fast zwei Jahrhunderte lang unsere Kultur beherrscht hat. Ich fing an, Gedichte zu schreiben, die meine Innerlichkeit und Individualität ganz in einen äußeren Gegenstand versenken sollten – in Landschaften, wie in den Gedichten „Teesdale“ und „Oxwich“, in einen kleinen Fisch oder auch in andere Menschen oder in verschiedene Baumarten, wie in den Baumgedichten, die ich zur Zeit schreibe. Das könnte ich philosophisch und auch soziologisch und „ökologisch“ begründen, möchte es aber nicht, weil das hier zu weit führen würde.
Galbraith: Ich war sehr überrascht von Ihrem langen Gedicht „Travelling“ („Unterwegs“, Heimgekommen). Es schien mir, als sei Ihnen damit der Durchbruch zu einem ganz neuen Ton gelungen. Gleichzeitig dachte ich, daß Sie alles Vorhergehende haben schreiben müssen, um zu diesem Ton zu finden. War dieses Gedicht ein Meilenstein für Sie?
Hamburger: Das lange Gedicht „Travelling“ hat auch mich überrascht. Ein langes oder nur längeres Gedicht hatte ich seit meiner Jugend nie mehr geplant. Den ersten Teil von „Travelling“ schrieb ich auch als ein Kurzgedicht in vier kleinen Versgruppen und veröffentlichte ihn als abgeschlossenes Kurzgedicht in meinem Gedichtbuch Travelling, 1969. Daß es mir schon damals wichtiger, bedeutender vorkam als die anderen Kurzgedichte im Buch – weil es mich überrascht hatte −, erklärt wohl, warum es zum Titelgedicht des Buchs wurde. Den ersten Teil schrieb ich nach einem Aufenthalt bei meinen Freunden David und Pippa Wright im Lake District und in Northumberland, während einer schweren Krise in meinem Leben. Was mich überrascht haben muß, ist, daß schon dieser erste Teil nicht beim Gegenstand, an Ort und Stelle blieb, sondern sich frei in Zeit und Raum bewegte, indem er plötzlich von Nordengland nach Amerika, Österreich und Griechenland, von der Gegenwart ins Altertum sprang. Erst zwei Jahre später kam ein zweiter Teil. Da wußte ich, daß ich ein langes oder längeres Gedicht begonnen hatte, und zwar in einer Form, die ich als Variationenform erkannte. Die Variationenform in der Musik war schon längst eine meiner ganz besonderen Vorlieben. In der Prosa hatte ich auch schon einige kurze Stücke auf deutsch geschrieben, die ich „Variationen“ nannte. Daß etwas ähnliches in der Lyrik möglich wäre, hatte ich nie erwogen. An diesem Zyklus arbeitete ich dann neun Jahre lang. Für mich wurde es gewissermaßen zu einer Summe meines ganzen bisherigen Lebens – zugleich Reisegedicht, Liebesgedicht, Naturgedicht und wohl auch Bekenntnisgedicht. Jahrelang konnte ich dann keine anderen Gedichte mehr schreiben, da ich mich an den weiten Raum dieser Variationenform gewöhnt hatte. Kurz nach Abschluß von „Travelling“ begann ich daher ein zweites Variationengedicht, „In Suffolk“, welches aber thematisch dem ersten genau entgegengesetzt war, indem es vom Bleiben, nicht vom Reisen, handelte und an eine Ortschaft gebunden war. Anders als „Travelling“ läßt „In Suffolk“ ein Verschwinden der Person erkennen (im späteren Zyklus kommt überhaupt kein Ich vor); was aber in „Travelling“ – und in Kurzgedichten wie „Schmerle“ – lediglich stellenweise angedeutet war, ist erst hier konsequent durchgeführt worden. (Kein einziger Rezensent der zwei Variationen-Zyklen hat diesen wesentlichen Unterschied bemerkt. Statt dessen wurden beide Zyklen als Abarten von Eliots „Four Quartets“ oder Wordsworths „Prelude“ behandelt, obwohl mir weder das eine noch das andere als Modell gedient hatte.)
Galbraith: Ich verstehe „Unterwegs“ unter anderem auch als eine Antwort auf die Naturfeindlichkeit, auf eine Art des Benennes „mit den Waffen des Geistes“, die sowohl überlebensnotwendig wie auch versklavend und zerstörend wirken. Ich lese daraus die Identitätskrise von einem „Ich“, das begriffen hat, daß sein Tun und Handeln, vor allem seine Verwendung der Sprache, unmittelbar mit dieser Zerstörung verbunden ist. Gibt es Ihrer Erfahrung nach eine direkte Verbindung zwischen Sprache und der Zerstörung von Welt?
Hamburger: Den philosophischen, weltanschaulichen Fragen kann ich also doch nicht entgehen! Ja, Sie haben das richtig verstanden. Unsere Sprachen sind Waffen des Geistes, insofern sie dazu dienen, die Welt zu vergewaltigen. Darum vermeide ich nun die Gedankenlyrik – übrigens auch die Metaphorik und verwende nur die schlichtesten Benennungen der Dinge, solche, die sie nicht deuten oder verwandeln wollen, sondern sie in ihrer eigenen Quiddität beruhen lassen. Jede technische, propagandistische oder bürokratische Sprache ist eine solche Waffe des Geistes und dient zur Zerstörung der Welt, sobald sie sich als autonom versteht.
Galbraith: Beim Lesen des Gedichts „Unterwegs“ habe ich die Entwicklung und Durchführung des Themas „Aufgeben“ oder „Zurückgeben“ durch die Motive „Reise“, „Verlernen“, „Traum“ und „Vergessen“ sehr interessant gefunden. Die hier dargestellte enge Beziehung zwischen dem „Zurückgeben“ und einer Haltung, welche die Beherrschung von Andersartigem aufgibt, erinnerte mich an ein sehr altes Motiv: das des Opferns. Sehen auch Sie Ihr Gedicht als eine Aufarbeitung dieses heutzutage meist als dem Bereich des Aberglaubens zugewiesenen Rituals?
Hamburger: Auch dies ist eins der variierten Themen von „Travelling“ oder, besser gesagt, eine Variation des den Zyklus beherrschenden Themas. „Verlernen“, „Aufgeben“, „Vergessen“, „Zurückgeben“ in diesem Gedicht sollen auf den verschiedensten Ebenen zu einer Verringerung unserer (auch meiner) anthropozentrischen Arroganz führen. Gewiß ist das auch als eine Aufopferung zu verstehen, selbst wenn ich dabei kaum an religiöse Opferrituale gedacht habe. Was den „Traum“ betrifft, hatte ich schon vor „Travelling“ reine Traumgedichte geschrieben, und zwar keine Tagträume oder Träumereien, wie sie die Romantik pflegte, sondern ganz sachliche Wiedergabe einzelner Träume, die ich als aufschlußreich und sinnvermittelnd empfunden hatte, weil sie mir etwas sagten, das mein Bewußtsein nicht wußte. Das ist wieder nicht psychoanalytisch gemeint, weil es mir weniger um Selbsterkenntnis als um Erkenntnis des Nicht-Individuellen, Allgemein-Menschlichen ging. Daß die Träume, wie auch die Mythen, manches wissen, brauche ich nicht zu erörtern.
Galbraith: Dieses Gedicht hat auch einen besonders ausgeprägten politischen Aspekt für mich. Es ist aber kein „politisch engagiertes“ Gedicht im gängigen Sinne. Ich glaube, diese Wirkung kommt daher, daß ich aus dem Gedicht lese, daß Opferbereitschaft und Machtverzicht zur Überwindung der dargestellten Krise des „Ich“ notwendig sind. Diese Werte werden in dem Gedicht völlig und erfolgreich integriert. Dabei muß ich immer denken, daß es gerade diese Opferbereitschaft ist, die doch im Menschen etwas Natürliches und Positives sein kann, die aber immer wieder von politischen und religiösen Instanzen erzwungen und ausgebeutet wird. Aus diesem Gedanken ziehe ich den Schluß, daß die politische Wirkung dieses Gedichts in einem utopischen Moment liegt, das aus der Spannung zwischen erfolgreich integrierten und als positiv empfundenen Werten einerseits, andererseits aber aus der scheinbaren Unrealisierbarkeit dieser Werte in der Wirklichkeit rührt. Ist eine solche politische oder utopische Wirkung des Gedichts von Ihnen gewollt?
Hamburger: Daß das Gedicht auf Sie eine politische Wirkung hatte, freut mich sehr, zumal ich das nicht erwarten durfte. Wir haben ja die Gewohnheit, alles zu kategorisieren, alles in Fächer und Gebiete zu sondern. So geschieht es auch mit Gedichten, die entweder „politisch engagiert“ sein sollen oder das Gegenteil, ästhetisierend oder spielerisch oder hermetisch. Die Struktur von „Travelling“ erlaubte mir aber gerade, von einer Ebene zur anderen zu springen – so auch vom Persönlichen zum Gesellschaftlichen, von dem Besitzergreifen in der Liebe zum Besitzergreifen in der Politik und zum geistigen Besitzergreifen durch die Sprache, die das, was sie nennt, zu erfassen scheint. Utopien aufzustellen, halte ich für eine gültige Funktion der Literatur und mit der höchsten Skepsis vereinbar. Ich liebe und bewundere auch utopische Politiker wie Kropotkin und Gustav Landauer, die nur Möglichkeiten einer noch nie verwirklichten Gemeinschaft vorgedacht haben. Daß eine Bestrebung nicht – oder noch nicht – realisierbar ist, sagt nichts gegen die Bestrebung. Gerade weil ich mir von Gedichten keine praktische Wirkung verspreche, halte ich sie für geeignet, Utopien zu vermitteln und vielleicht dadurch indirekt zu wirken.
Galbraith: „Unterwegs“ ist so, wie ich es lese, auch ein Liebesgedicht. Nur dadurch, daß das Ich des Gedichts die Macht seiner Wörter aufgibt, wird ein Ort erreicht, wo eine wahre Begegnung mit dem Du des Gedichts möglich wird. Nur indem dieses Ich die Kunst des Festhaltens oder Besitzergreifens durch Sprache aufgibt, kann eine Liebe entstehen, die „Gleichheit im Anderssein“ bedeutet. Liebe, nicht nur zu diesem Du, wird erstickt, wo Sprache der Unterjochung von Andersgeartetem dient. Als mögliche Analogie hierzu fällt mir eine Zeile aus Ihrem Gedicht „Birdwatcher“ ein, in dem es heißt, daß der Vogelliebhaber sich nur danach sehne, „die Zunge zu essen, die zu ihm nicht sprechen will“. Außerdem ist mir aufgefallen, daß viele Dichter in ihrer Jugend Angler waren, z.B, Robert Lowell oder Ted Hughes, der in dem Rundfunkessay „Capturing Animals“ seinen direkten Weg vom Fangen von Tieren zum Schreiben von Gedichten aufzeigt. Ist es nicht so, daß auch Gedichteschreiben manchmal eine Unterjochung oder Plünderung des Andersgearteten darstellt – oder, wie es in einem sehr frühen Gedicht von Ihnen heißt: „Töte jede Kreatur, Tier und Vogel / Blume und auch uns, um das Wort zu füttern“?
Hamburger: Es freut mich auch, daß Sie Ansätze zur Thematik von „Travelling“ schon in ganz frühen Gedichten von mir gefunden haben, da sich ein Autor solcher Zusammenhänge kaum bewußt ist und immer nur mit seinen ihn eben angehenden Problemen beschäftigt ist. Das „sehr frühe“ Gedicht war „Palinode“, im Jahre 1952 geschrieben. Es eröffnete meine dritte Gedichtsammlung, The Dual Site, und ist eine Zurücknahme des romantisch-symbolistischen Epigonentums meines Frühwerks. Diese ganze dritte Sammlung sehe ich nun als eine Phase des tragischen Dualismus, den ich erst nach Jahrzehnten ganz überwinden konnte. „Palinode“ schrieb ich nach einer Spanienreise, auf der ich unter anderem Stierkämpfe gesehen hatte. Der Stierkampf wurde für mich zu einer Abart der romantisch-symbolistischen Kunst – die das Leben der Kunst zum Opfer bringt! Ich hatte auch bemerkt, daß ein mit mir befreundeter Lyriker bereit war, einen Menschen psychisch zu zerstören, nur um über diesen Vorgang ein Gedicht schreiben zu können. Daher jene Zeilen: „… Kill every creature, beast and bird, / Flower and ourselves, to feed the Word“. Gegen diese Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit der ideellen Kunst – der autonomen Kunst – reagierte ich schon zu jener Zeit, ohne aber den Dualismus lösen zu können. Um das zu tun, mußte ich ganz anders schreiben, auch meine schönen strengen Formen und Reime aufgeben. Was „Birdwatcher“ betrifft, ein Gedicht aus dem Jahr 1958 und in der nächsten Gedichtsammlung, Weather and Season, enthalten, ist es nicht der Vogelliebhaber, der „Birdwatcher“, der sich danach sehnt, „die Zunge zu essen, die zu ihm nicht sprechen will“, sondern sein Widerpart, der Jäger, der auch immer vorgibt, die Tiere zu lieben, die er tötet, und es wohl tatsächlich tut – nämlich auf jene besitzergreifende Weise, von der in „Travelling“ die Rede ist. Obwohl ich nie gejagt habe, war auch ich in der Jugend Angler und in der Kindheit – aus jener Liebe heraus – ein grausamer Fänger und Sammler von Tieren.
Galbraith: Ezra Pound gab den jüngeren Schriftstellern den Rat, so viel wie möglich zu übersetzen. Er sagte, diese Beschäftigung schärfe den Umgang mit der eigenen Sprache. Sind Sie auch dieser Meinung?
Hamburger: Daß ich seit meinem 16. Lebensjahr übersetze, halte ich, im ganzen gesehen, für ein seltenes Glück, da es mir neben dem oft ganz aussetzenden Schreiben eigener Gedichte eine zweite Tätigkeit schenkt, zu der ich fast immer fähig war. Ob das Übersetzen meiner eigenen Lyrik förderlich gewesen ist, kann ich nicht beurteilen; aber mindestens einem Dichter, den ich jahrzehntelang übersetzt habe, Hölderlin, habe ich, wie ich glaube, sehr viel zu verdanken.
Galbraith: Während der 80er Jahre haben Sie ihre Paul-Celan-Übersetzungen veröffentlicht, die seit 1980 in einem Band mit einer repräsentativen Auswahl vorliegen, Welche Resonanz haben Celans Gedichte in England gefunden?
Hamburg: Von der Resonanz meiner Veröffentlichungen weiß ich fast gar nichts. Die Besprechungen des Celan-Buchs in Großbritannien waren minimal und enttäuschend; von einer Rezeption in den Vereinigten Staaten, wo sich das Buch besser verkaufte, habe ich überhaupt nichts gehört, weil entweder keine Besprechungen erschienen oder weil mir keine zugeschickt wurden. Ich erinnere mich aber an eine Lesung aus meinen Übersetzungen in Cambridge – vor der Veröffentlichung des Buchs −, zu der so viele Menschen kamen, daß ich in drei Richtungen lesen mußte und alle Wände und Gänge vollgestopft waren. Das hängt vielleicht mit einer früheren, kleineren Auswahl in der Penguin-Taschenbuch-Reihe zusammen. Diese erschien 1972, vor dem Sieg des kommerziellen Philistertums, welches nun das Land beherrscht.
Galbraith: Wie sind Sie diese Übersetzungen angegangen? Hat Ihnen die Sekundärliteratur über Celan dabei geholfen? Wie lange haben Sie daran gearbeitet? War die Vorstellung, daß nur wenige Leute in Großbritannien diese Gedichte lesen würden, bei der Arbeit entmutigend?
Hamburger: Meine Celan-Übersetzungen sind langsam, schubweise entstanden, nach jeder wiederholten Lektüre der Originaltexte, bei der mir wieder ein kleines Licht aufging und einige bis dahin nicht übersetzbare Gedichte übersetzbar wurden. Dabei hat mir auch die Sekundärliteratur geholfen, obwohl die Deutungen – wie auch bei Hölderlin – sich so widersprechen, daß man am Ende wieder auf seine eigenen Einsichten angewiesen ist. Freilich fehlen mir bei Celan auch ganz bestimmte Kenntnisse, welche die Celan-Exegeten zum Teil besitzen von den religiösen, vor allem jüdischen Quellen bis zur Kernphysik. Darum warte ich ungeduldig auf jene kritische Celan-Ausgabe, die seit langem vorbereitet wird und von der ich Hinweise auf die gelesenen und gelebten Quellen der Gedichte erhoffe. In der letzten Zeit konnte ich auch ohne jene Hilfe wieder fast dreißig spätere Gedichte übersetzen. An die Resonanz denke ich bei der Arbeit gar nicht.
Galbraith: Hat die persönliche Bekanntschaft mit Paul Celan Ihnen geholfen, seine Gedichte zu übersetzen?
Hamburger: Meine Bekanntschaft mit Celan hat mir nur eine einzige Berichtigung vermittelt, und zwar in einem Gedicht, welches ich noch nicht übersetzt hatte, das aber ein englischer Rezensent im TLS zitiert und übersetzt hatte. Zu einer Zusammenarbeit mit ihm ist es leider nie gekommen, schon weil wir immer nur kurz in London oder Paris zusammenkamen.
Galbraith: Der griechische Dichter George Seferis hat einmal gesagt, daß Stil die besondere „Schwierigkeit“ sei, die ein besonderer Dichter habe, wenn er sich ausdrückt. Wie kann der Übersetzer einem fremden Stil gerecht werden, wenn seine eigenen Schwierigkeiten völlig andere sind? Wenn, wie Wilhelm von Humboldt schrieb, eine gute Übersetzung „eine gewisse Farbe der Fremdheit an sich“ trägt, ist dann diese „Farbe der Fremdheit“ nicht etwas, das aus der eigenen Sprache hervorgeht und eben nicht aus der fremden?
Hamburger: Das ist wieder ein zu weites Feld! Über das Übersetzen und über die Übersetzungen habe ich einiges geschrieben, auch über die Art des Übersetzens, die ich betreibe. Ich bin schon zufrieden, wenn meine Übersetzungen den Leser zu den Originaltexten führen, ihm als Hilfe – nicht als Ersatz dienen. Alles übrige ist eine ewige, immer wieder neu aufgeworfene und neu formulierte Problematik. Gerade die „gewisse Farbe der Fremdheit“ halte ich für das Wertvolle an den Übersetzungen, bemühe mich daher, sie nicht abzuwischen. Diese Dialektik des Fremden und Eigenen hat Hölderlin wunderbar erkannt und dargestellt und auch in seinen eigenen Gedichten und Übersetzungen ausgeführt.
Galbraith: Welche Lyrikübersetzungen schätzen Sie am meisten, und warum?
Hamburger: Ich schätze jede Übersetzung, die mich dem Originaltext, welchen ich nicht lesen kann, näherbringt. Andere, ganz wenige, Nachdichtungen lese ich als Originaltext, weil mich der Übersetzer als Autor interessiert. Eine Vorliebe habe ich für Übersetzungen aus dem Chinesischen und Japanischen, Sprachen, die ich ganz und gar nicht lesen kann und auch als Übersetzungen kaum beurteilen kann.
Galbraith: Welche bedeutenden deutschen Dichter sind in England unbekannt? Wie kam es z.B. dazu, daß Gottfried Benns Werke fast völlig unbekannt und unübersetzt geblieben sind?
Hamburger: Als ich, noch zu Lebzeiten Gottfried Benns, einen Aufsatz über ihn veröffentlichte, sagte mir der englische Lyriker John Heath-Stubbs, daß all diese Fragen der „absoluten Poesie“ doch längst veraltet und überholt seien und schon in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgekämpft worden seien. Auswahlbände aus Benns Werk sind mehrmals in englischer Übersetzung erschienen, aber durchgesetzt hat sich das Werk nicht. Das liegt, glaube ich, nicht an der politischen Stellungnahme Benns in den 30er Jahren. Vielmehr stößt der ganze Expressionismus in Großbritannien auf radikale Abwehr und Mißverständnisse. Auch meine frühen Trakl-Übersetzungen wurden als „krankhaft“ abgetan. Mit einem nihilistischen Verhältnis zur Gesellschaft und zu den Mitmenschen können die wenigsten englischen Leser etwas anfangen. Eine Liste der in England nicht bekannten bedeutenden deutschsprachigen Dichter würde sehr lang werden.
Galbraith: Die zeitgenössische deutsche Lyrik wird oft in der Spannung gesehen zwischen dem sogenannten Alltagsgedicht und dem sogenannten hermetischen Gedicht. Dabei geht man davon aus, daß die Sprache des hermetischen Gedichts einer verinnerlichten Welt gelte, während der Alltagslyriker sein Gedicht „an seinen Gegenstand heranzuschieben“ versuche (J. Theobaldy). Das hermetische Gedicht gilt als verschlossen, das Alltagsgedicht als offen. Ist aber nicht das Alltagsgedicht die verschlossenste aller Formen, gerade weil es ein Gedicht ist, „hinter dem nichts steht“ (R.D. Brinkmann), während die Dichtung von Paul Celan, der so oft als „Hermetiker“ beschrieben worden ist, gerade die offenste ist, weil sie die erlebte Wirklichkeit in all ihrer Komplexität wiedergibt?
Hamburger: Meines Erachtens sind solche Kategorien wie „Alltagsgedicht“ und „hermetisches Gedicht“ fast sinnlos, weil die Spannungen innerhalb der Gedichte und des Dichters stattfinden müssen, um fruchtbar zu sein. Die Programme und Theoriekämpfe sind belanglos. Celan behauptete ganz zu Recht, kein „hermetischer“ Dichter zu sein. In ein Exemplar eines seiner Bücher, das er mir schenkte, schrieb er: „Ganz und gar nicht hermetisch“. Damit will ich aber nicht sagen, daß es keine solche Spannung gibt. Ich selber kenne sie zu gut – wie ich schon angedeutet habe. Der Gegensatz ist aber kein absoluter, was übrigens auch aus J. Theobaldys späteren Gedichten zu ersehen ist. Absolut ist nur die Forderung, gute Gedichte zu schreiben. Ob sie mehr alltäglich oder mehr hermetisch ausfallen, entscheiden die verschiedensten Gegebenheiten – innere und äußere −, zu denen auch die historische Situation gehört. Ein sehr gutes „Alltagsgedicht“ zu schreiben kann – aus den von Ihnen erkannten Gründen sehr schwer sein, weil sich ja der Alltag so ungeheuer schnell verändert, ein gutes Gedicht aber dauerhaft sein muß.
Galbraith: Es ist mir immer wieder aufgefallen, daß viele Lyriker in der BRD inzwischen traditionelle Formen aufgegriffen haben. Es wird zögernd von einer „Wiederkehr der Formen“ (H. Hartung) gesprochen. Gibt es Ihrer Meinung nach eine wirkliche Aussicht auf eine solche Wiederbelebung traditioneller Formen, und welche Wirkungen könnte diese Entwicklung haben?
Hamburger: Die Schreibweisen wandeln sich immer, sobald die Schreibenden an eine Grenze stoßen. Darum ist es natürlich, daß nach den freien Versen wieder gebundene kommen – und umgekehrt. Wenn diese Entwicklung zur Zeit wieder ein positiveres Verhältnis zur Tradition andeutet, liegt auch das in der Luft, nachdem der Glaube an eine bessere Zukunft geschwunden ist. Ich selbst habe in den letzten Jahren wieder in strengen Formen geschrieben, während es in den 50er Jahren für mich notwendig war, mich von solchen Formen zu befreien. Die metrischen Gedichte, die ich nach dieser Befreiung schreibe, werden aber anders sein als jene, die ich davor schrieb. Übrigens hatte ich den Reim nie ganz aufgegeben ihn nur aus den Zeilenenden fortgenommen und organischer, unregelmäßiger klingen lassen. In der DDR sind die festen Formen nie so radikal abgelehnt worden wie in der BRD, und auch in den 60er Jahren sind sehr gute Gedichte in den alten Metren geschrieben worden.
Galbraith: Könnte diese Auseinandersetzung mit traditionellen Formen die Rezeptionsbedingungen der britischen Lyrik hier verändern?
Hamburger: Das hängt wieder von zu vielen Imponderabilien ab. Die Schwierigkeit mit der britischen Lyrik liegt wohl mehr in der Thematik als in den oft traditionsgebundenen Formen. Ein Lyriker wie John Betjeman, z.B., wird wohl immer im Ausland einfach unverständlich bleiben, weil er Verhältnisse darstellt und parodiert, die nur für England gelten. Es gibt aber auch ganz andere britische Lyriker. Einen solchen, Jim Burns, hat J. Theobaldy ins Deutsche übersetzt. Auch David Jones wird allmählich bekannt, wie auch der äußerst schwer übersetzbare und hervorragende Geoffrey Hill. Es gibt Ansätze zu einem Durchbruch britischer Lyrik. Daß er gelingen wird, kann ich nicht prophezeien.
Galbraith: Hat die amerikanische Lyrik zur Zeit einen starken Einfluß auf die britische? Gibt es auch eine Tendenz, sich gegen den amerikanischen Einfluß zu wehren? Welchen Entwicklungen der Lyrik in Großbritannien während der letzten zwanzig Jahre messen Sie Bedeutung zu?
Hamburger: Ich glaube, die Zeit des amerikanischen Einflusses auf britische Lyriker – nicht sehr viele – liegt nun zwei Jahrzehnte zurück. Diese von der amerikanischen Lyrik stark beeinflußten Lyriker haben es noch jetzt schwer. Es gibt eine mächtige Gruppe englischer Schriftsteller und Kritiker, die jede amerikanische Lyrik – sogar T.S. Eliot und E. Pound, die europäisch geschulten – grundsätzlich ablehnt. Die gegenwärtigen Tendenzen in der britischen Lyrik sind so verschiedenartig, daß ich nur einzelne Lyriker nennen könnte, die ich schätze. Das tue ich aber grundsätzlich nicht.
Galbraith: Gibt es Dichter in Großbritannien, deren Arbeit Sie schätzen, die wegen der Unangepaßtheit ihrer Arbeit an öffentlichen Erwartungen aus der literarischen Öffentlichkeit verdrängt worden sind oder aus anderen Gründen selbst entschieden haben, ihre Arbeit nicht zu veröffentlichen?
Hamburger: Es gibt viele solcher Dichter. Ich nenne nur einen, weil er nicht mehr am Leben ist: John Riley.
Galbraith: In einem Aufsatz, Politik und Lyrik, der in der Anthologie Grenzüberschreitungen veröffentlicht wurde, haben Sie auf die Gefahr hingewiesen, daß in England „das utopische Element aus der Poesie fast verschwunden ist und daß sie darum nichts Neues bietet, sondern nur das, was alle Leute schon wissen und sowieso glauben“. Woran ist diese „Anbiederung“ in der zeitgenössischen britischen Dichtung zu erkennen, und welche Gründe hat sie?
Hamburger: Das utopische Element habe ich schon erwähnt. Ich erwarte von jeder Lyrik – ob alltäglich oder hermetisch −, daß sie sich ins Unbekannte wagt. Dazu braucht sie nicht „experimentell“ zu sein. Experimentell nenne ich nur jene Lyrik, welche die Sprache selber schalten und walten läßt – also die sogenannte konkrete, die aber eigentlich zu einem hohen Grade abstrakt ist. Dieses Wagnis vermisse ich weithin in der englischen Lyrik, die zur Zeit gelesen und gelobt wird.
Galbraith: In einem Interview mit Forum – mainzer texte sagte Erich Fried vor einigen Jahren, daß englische Schriftsteller im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen „zum größten Teil nicht engagiert“ seien. Wie erklären Sie dieses Phänomen?
Hamburger: Über das Engagement denke ich wohl etwas anders als Erich Fried. Für mich braucht das Engagement nicht an der Oberfläche eines Textes sichtbar zu sein. Es darf untergründig hinter jeder Thematik liegen. Wo auch das nicht der Fall ist, entsteht eine Leere, die mit dem fehlenden Wagnis zusammenhängt.
Galbraith: Zum Schluß möchte ich Sie etwas zu dem Thema „das schwierige Gedicht“ fragen. Daß Gedichte oft als schwierig gelten und, vor allem, daß dies von Lesern bemängelt wird, führe ich auf die Erwartung zurück, alles Gelesene „verstehen“ zu müssen. Möchte nicht ein Gedicht sich dem Verstand oft entziehen? Zu diesem Thema schrieb Marianne Moore: „Man sollte so deutlich schreiben, wie es einem die natürliche Zurückhaltung erlaubt.“
Hamburger: Die Schwierigkeit, von der Sie sprechen, setze ich dem Wagnis gleich. Was nicht selbstverständlich ist, wird nicht ohne weiteres verstanden. Selbstverständliche Lyrik ist aber langweilig und überflüssig. Dabei liebe ich die Schlichtheit über alles, wenn sie sich aus einer notwendigen Reduktion ergibt und keine falsche Naivität ist. Die Lyrik, die ich am meisten schätze, ist zugleich schlicht und rätselhaft, also schwierig. Ich bin ganz Ihrer Meinung, daß man gute Gedichte zunächst gar nicht zu verstehen braucht. Erst erobern sie die Sinne, dann liefern sie sich dem Verstand aus. Denn Gedichte wollen und sollen in das sonst nicht Sagbare eindringen. Als Leser will ich dem Gedicht dorthin folgen.
Interview in: Iain Galbraith (Hrsg.): Britische Lyrik der Gegenwart, Edition Forum 1, 1984
W.G. Sebald besucht Michael Hamburger. Ein Text aus dem W.G. Sebald-Forum für den ausgewanderten Schriftsteller, Wanderer, Germanisten, Autor des Elementargedichts „Nach der Natur“ und weiterer Werke. Eingerichtet von Christian Wirth.
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLfG + IMDb +
Archiv + Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Voß-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Michael Hamburger: P.E.N. ✝ Die Zeit ✝ BZ ✝ SZ
Michael Hamburger – Ein englischer Dichter aus Deutschland. Ein Film von Frank Wierke (hier in voller Länge).


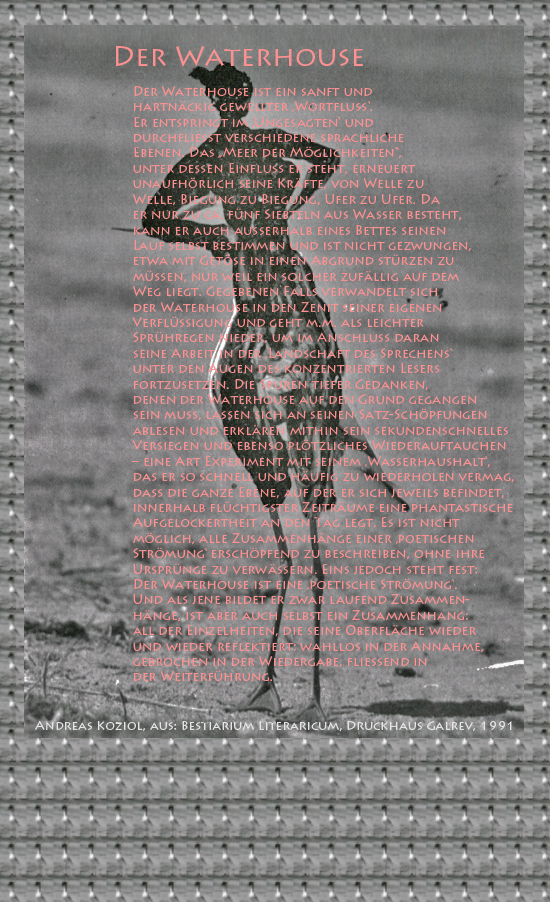














Schreibe einen Kommentar